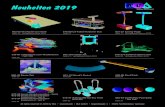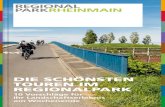Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download...
Transcript of Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download...
![Page 1: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/1.jpg)
Seite 1
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 1 von 41
[ibrp.pdf]
Wie kann die Beteiligung des Klienten am Hilfeplan aussehen?...... 2
Integrierte Hilfeplanung als Prozess:Der Übersichtsbogen A ......... 3
Der Einstieg in die Hilfeplangespräche ....................................... 5
Die Rollen „Kunde“, „Besucher“ und „Kläger“ .............................. 5
Einführung in die ersten Schritte der Hilfeplanung ....................... 7
Was ist die gewünschte Lebensform? .......................................10
Die Nutzung des Bogens B „Beschreibung der gegenwärtigen und / oder der angestrebten Wohnform ............................................11
Der Bogen C zur „gewünschten Tätigkeitsform“ .........................12
Der Übersichtsbogen A ...........................................................13
Anleitung zur Spalte „Aktuelle Problemlagen“ ............................13
Anleitung zur Spalte „Ziele“ .....................................................14
Die Kunst der konkreten und realistischen Formulierung von Zielen ............................................................................15
Goal Attainment Scaling .........................................................19
Anleitung zur Spalte „Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ ...............................................................24
Ausfüllen der Spalte „Hilfen“ ...................................................25
Umgang mit Netzwerken und allgemeinen sozialen Hilfen: aktivierbare nichtpsychiatrische Hilfen ......................................26
Anleitung zur Spalte: „Vorgehen“ .............................................29
Anleitung zur Spalte: „Erbringung durch ...“ ..............................30
Leistungsbereiche des Gemeindepsychiatrischen Verbundes – Hilfen für die Zuordnung .........................................................31
Der Klient will oder kann sich nicht beteiligen – was tun? ............35
Neue Klienten im gemeindepsychiatrischen Netz ........................36
Sicherstellen personeller Kontinuität bei der Koordination ...........37
Unterschiede dokumentieren ...................................................39
Förderung der Teilnahme anderer Professioneller an Gesprächen/Hilfeplangesprächen ...............................................................40
Schweigepfl icht und Datenschutz .............................................41
Evaluation ............................................................................41
Petra Gromann
Der integrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplan konkretEin Lernprogramm für die wesentlichen Schritte der Hilfeplanung
und die verwendeten Instrumente
![Page 2: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/2.jpg)
Seite 2
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41
[ibrp.pdf]
EinführungDie Grundlage der Integrierten Behandlungs- und Rehaplanung sind die Wünsche,
Vorstellungen und Bedarfe der Klientin oder des Klienten. Die Planung soll mit ihr /
mit ihm zusammen entwickelt werden. Es muss in jedem Fall nach geeigneten Wegen
gesucht werden, wie sich Klienten selbst an der Hilfeplanung beteiligen können und
wie vertraute Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld daran beteiligt werden können.
Dies gilt auch für die gesetzlichen Betreuer (hier Verweis auf kurzen Text zum Betreu-
ungsrecht), wenn deren Wirkungskreis entsprechend festgelegt wurde. Die gemein-
same Planung besteht im wesentlichen aus Gesprächen.
Auf der CD oder unter wwww.ibrp-online.de fi nden Sie einen solchen
Gesprächsbeginn als Video.
Wie kann die Beteiligung des Klienten
am Hilfeplan aussehen?
Gerade wenn in einem Dienst oder einer Einrichtung mit Hilfeplanung mit dem
IBRP begonnen wird, schrecken einige (durchaus auch erfahrene Mitarbeiter) davor
zurück, Klientinnen und Klienten selbst die Bögen mit ausfüllen zu lassen. Im Vorder-
grund der Bedenken steht dabei meistens die Belastung, die ein so detailliertes Benen-
nen der Schwierigkeiten und des jetzigen Standes bei psychiatrieerfahrenen Menschen
darstellt.
Ein weiteres Argument ist, welche unrealistischen Hoffnungen bei den Klienten
geweckt werden, wenn sie nach ihren Wünschen und Bedarfen gefragt werden. Diese
sind ja meist unmittelbar nicht einzulösen und – das ist die Befürchtung – das ganze
Verfahren könnte in bitteren Enttäuschungen enden.
Auch haben manche Mitarbeiter die Befürchtung, dass sie ihre gute Beziehung zu
den Klienten aufs Spiel setzen. Wenn Sie mit einer Klientin gemeinsam planen, müssen
sie ja auch ihre Sicht der Situation , ihre Einschätzung der Person deutlich machen. Mit-
arbeiter müssen sich also in diesem Verfahren erklären. Die eigene Sicht – gerade wenn
diese von der Sicht der Klienten abweicht – ist schwierig zu formulieren.
Am Ende des Verfahrens – nach ihrer ersten praktischen Hilfeplanung sollten Sie
diese Bedenken nochmals an ihren Erfahrungen überprüfen.
Falls Sie diese oder andere Einwände, Befürchtungen oder Bedenken in ihrem Team
vorhanden sind, schlagen wir Ihnen vor, in einer Gesprächsrunde die Gedanken der ein-
zelnen Teammitglieder auszusprechen. Sie sollten dann die Bedenken in einer Art Pro-
tokoll festzuhalten und eine Verabredung zu treffen, wie nach einer Erprobungsphase
diese Befürchtungen an den eigenen Erfahrungen diskutiert werden können. Unserer
Erfahrung nach sind diese Argumente nämlich nicht vorab auszudiskutieren.
Die grundlegende Verfahrensregel lautet: Das gemeinsame Bearbeiten der Bögen
besteht im Wesentlichen aus Gesprächen.
Die Gesprächsergebnisse werden in den Bögen dokumentiert und von der Klien-
tin bzw. dem Klienten nochmals überprüft.
![Page 3: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/3.jpg)
Seite 3
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 3 von 41
[ibrp.pdf]
Dies bedeutet, dass Mitarbeiter die Systematik der Bögen gut kennen müssen.
Deshalb werden wir Ihnen jetzt auch zunächst die einzelnen Bögen vorstellen.
Die Bögen sind auch als ein Gesprächsleitfaden zu verstehen. Wie bei so genannten
„offenen“ Interviews können die Beteiligten auch auf die Unterlagen sehen oder Über-
sichten (z.B. Manual „Wohnformen“) als Gesprächsanregung nutzen.
Wie das Verfahren insgesamt, so verlaufen auch die Hilfeplanungsgespräche indi-
viduell unterschiedlich. Für manche Klientinnen und Klienten ist es wichtig, selbst die
Bögen in der Hand zu haben, für andere ist dies geradezu gesprächsverhindernd. Man-
che Klienten sitzen überhaupt nicht gerne und so werden Hilfeplangespräche beim Spa-
zierengehen geführt. Grundsatz ist dabei, das „Setting“ weitgehend an den Klienten
zu orientieren. Dies trifft auf Zeit, Ort und Beteiligte an diesen Terminen zu. Häufi g
können sich Klientinnen und Klienten nur geringe Zeit konzentrieren. Es ist hilfreich,
dann gleich mehrere kurze Treffen zu vereinbaren. Alle diese Maßnahmen wirken den
Belastungen entgegen.
Um ein Hilfeplanungsgespräch mit Ihrer Klientin oder ihrem Klienten zu führen,
müssen Sie die Systematik der Bögen genauer kennenlernen.
Im Folgenden üben wir an einzelnen Beispielen, wie diese Bögen auszufüllen sind.
Integrierte Hilfeplanung als Prozess:
Der Übersichtsbogen A:
Bitte laden Sie sich den Bogen A im PDF-Format – sie fi nden Ihn
unter Downloads.
Der Übersichtsbogen A – auch Bogen
A genannt – besteht aus verschiedenen
Spalten. Diese versuchen, einen Prozess
vorzugeben
Auch hier gilt der personenbezogene
Ansatz, Sprache und Beginn sollen für
die Klienten angemessen sein.
GewünschteLebensform
AktuelleProblemlage
Ziele�derKlienten
Fähigkeiteneinschätzen
Beeinträchtigungeneinschätzen
Konkrete�undrealistische�Ziele�fürdie�vereinbarte�Zeit
verhandeln
Zuordnungnotwendiger�Hilfen:
a)�nicht�psychiatrischeb)psychiatrische
Wer�erbringtwelche�gebündelten�Hilfen?
Festlegung�derDurchführungsverant-
wortung
Festlegung�derProzessverantwortung:
Wer�koordiniert?
Bewertung�undggf.�Veränderung
des�Prozesses
Integrierte�Hilfeplanung�als�Prozess
![Page 4: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/4.jpg)
Seite 4
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 4 von 41
[ibrp.pdf]
Der den Bögen zugrundliegende Prozess (Selbstorganisationszirkel – siehe Schau-
bild) soll von Ihnen in verständlicher Sprache dargestellt werden: Situation einschätzen,
Ziele herausfi nden, Möglichkeiten und Hindernisse bedenken, Hilfen in der Umgebung
und von Mitarbeitern herausfi nden und gemeinsam verabreden. Dies kann mit oder
ohne Bögen bzw. andere Hilfsmittel geschehen.
Vielleicht können Sie das an einem Beispiel aus der Interessenswelt der Klientin /
des Klienten tun.
Bitte üben Sie das und ordnen Sie den einzelnen Beschreibungen der
folgenden Geschichte je einen der passenden Prozesse zu:
• Situation einschätzen
• Ziele herausfi nden
• Möglichkeiten, Fähigkeiten und Hindernisse bedenken,
• Hilfen in der Umgebung und von Mitarbeitern herausfi nden
• Gemeinsames Verabreden von Maßnahmen
Sie gehen allein an ihrem Urlaubsort wandern. Sie verirren sich in einem gro-
ßen Wald. Es wird langsam dunkel.
Sie glauben nicht, dass sie ihr Hotel vor Einbruch der Dunkelheit noch
erreichen können. Sie können aber vielleicht vorher noch eine Ortschaft
oder eine Waldgaststätte erreichen.
Sie haben eine Taschenlampe und eine Wanderkarte dabei, wissen aber nur ungefähr, in welchem Waldabschnitt sie sich gerade befi nden. Sie haben ziemliche Angst vor der Dunkelheit, aber noch schlimmer bedrückt sie, das sie nicht genau wissen, wo sie gerade sind.
Sie beschließen Bis zur nächsten Wegkreuzung zu gehen, um dort an den Wandermarkierungen herauszufi nden, wo genau sie sich befi nden.
Einschätzung�undBeschreibung�derAusgangssituation
Erkennungvon�Problemen�und
Ressourcen�derPerson
Festlegungvon�Zielen
Planung�derindividuellen�Hilfen
Durchführung
Auswertungund�Evaluation
Selbstorganisationszirkel
Die Lösungen zu den
Aufgaben fi nden Sie unter
Downlods, Lösungen.
![Page 5: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/5.jpg)
Seite 5
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 5 von 41
[ibrp.pdf]
Der Einstieg in die Hilfeplangespräche
Eine Hilfestellung, um zu erkennen, welcher Einstieg in Hilfeplangespräche
angemessen ist, bietet eine Systematik (nach de Shazer*), die von Mainzer Kollegen
angewendet wird: Sie unterscheiden nach drei großen Gruppen:
Diejenigen, die gleich Absichten, Wünsche und Bedarfe in Bezug auf die Betreu-
ung äußern (Kunden). Mit ihnen kann man gleich in die Beratung von gewünschter
Lebensform und Zielen einsteigen.
Diejenigen, die eher abwartend und zögernd kommen („Mal sehen, was die Mit-
arbeiter sich da wieder ausgedacht haben, das werde ich auch noch überstehen“)
(Besucher). Hier ist es hilfreich, die „Außenperspektive“ als Einstieg zu nutzen:
Kostenträger oder die Gesellschaft will eine Begründung und genaue Planung, für
was das Geld ausgegeben wird.
Diejenigen, die sich beschweren und beklagen (Kläger). Hier liegt der Einstieg
über die Verabredung von Veränderungen auf der Hand.
Bitte sehen Sie sich die Beispiel-Videosequenz an zum Thema:
Situation einschätzen
Die Rollen „Kunde“, „Besucher“ und „Kläger“
Bitte lesen Sie sich die folgenden Beispiele durch und ordnen sie
diese den Rollen „Kunde“ „Besucher“ und „Kläger“ zu. Auf der
CD-Rom können Sie diese aktiv zuordnen und eine Rückmeldung
erhalten:
Welche Ansprech-Rolle sehen Sie hier?:
„Sie haben auf Grund ihrer Erkrankung ein Recht auf Behandlung bzw. ein Recht
auf Hilfe zur Lebensgestaltung und Lebensbewältigung. Ich werde mit Ihnen jetzt
Bögen bearbeiten, die ›Individueller Behandlungs- und Reha-Plan‹ heißen. Diese
Bögen sollen helfen herauszufi nden, welche Art von Hilfe sie genau brauchen. Ich
möchte das mit Ihnen zusammen tun und gleichzeitig mit Ihnen überprüfen, ob das,
was Sie im Moment bekommen, Ihren Bedürfnissen entspricht. Daraus soll ein Hil-
feplan entstehen. In diesem Plan sind die verschiedenen Lebensbereiche Wohnen,
Tätigsein, Freizeit und Kontakte zusammen enthalten. Er kann aber nur funktionie-
ren, wenn Ihre persönlichen Voraussetzungen und ihre Ziele einbezogen werden.“
Welche Ansprech-Rolle sehen Sie hier?:
„Es gibt bestimmt einige Dinge in der Betreuung, die Ihnen nicht gefallen, die sie
eigentlich anderes haben wollen. Um genau herauszufi nden, wie es anders sein soll,
möchte ich mit Ihnen jetzt einige Bögen besprechen. Bei der Beantwortung der
Bögen sind Sie selbst nach ihrer Meinung gefragt. Sie sollen mitbestimmen, was Sie
anders haben möchten, was Sie erreichen möchten. Wir sprechen über die Bögen
und ich trage dann ein. Sie lesen anschließend noch mal nach, ob das so stehen
bleiben kann. Das Ausfüllen der Bögen benötigt einige Zeit. Wir werden uns viel-
leicht nochmals verabreden. Deshalb sagen Sie mir bitte, wenn sie sich nicht mehr
konzentrieren können. Wir erarbeiten so gemeinsam einen Hilfeplan, der dann ver-
bindlich abgemacht werden soll.“
* Steve de Shazer: Der Dreh.
Überraschende Wendungen
und Lösungen in der Kurz-
zeittherpie. Carl Auer Verlag,
8. Aufkage 2004
![Page 6: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/6.jpg)
Seite 6
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 6 von 41
[ibrp.pdf]
Welche Ansprech-Rolle sehen Sie hier?:
„Ich habe hier einige Fragebögen, die ich mit Ihnen ausfüllen möchte. Es geht um die
Planung der Hilfen, die genau für Ihre Situation passen sollen. Es wird uns einige Zeit
und Mühe kosten, diese Bögen gemeinsam auszufüllen, aber ich bin sicher, das sich
der Aufwand lohnen wird. Die anderen und ich werden dann klarer sehen, wie und wo
Sie leben wollen und welche Unterstützung Sie dafür brauchen. Wir werden uns einige
Male treffen. Wenn es für Sie anstrengend wird oder sie eine Pause brauchen, können
wir unterbrechen und einen neuen Termin vereinbaren. Wenn wir fertig sind, bekom-
men Sie zuerst den Bogen, um alles noch mal in Ruhe durchzulesen.
Sie sehen hier einige Bögen auf dem Tisch. Die sollen helfen herauszufi nden, wo sie im
täglichen Leben genau Hilfe und Unterstützung brauchen. Es geht um Fragen wie: Wo
und wie möchten Sie wohnen? Soll alles so bleiben oder möchten Sie ihre Lebensum-
stände verändern? Welche Unterstützung brauchen Sie, um sich selbst zu versorgen?
Ist Unterstützung nötig, damit sie aus dem Haus kommen oder mit Ihren Bekannten
zurechtzukommen? Wir besprechen das und halten Ihre Wünsche fest. Wir versuchen
Ziele für die nächsten Monate herauszufi nden und welche Unterstützung sie dafür
brauchen.“
Welche Ansprech-Rolle sehen Sie hier?:
„Sie sind der Mittelpunkt dieser Befragung und bekommen die Möglichkeit, sich mit
Ihrem Leben und den Folgen Ihrer Erkrankung auseinander zu setzen. Ich fi nde es
wichtig, über die Art, wie Sie leben wollen, und ihre Erfahrungen zu sprechen. Damit
wir nichts vergessen, möchte ich einiges asufschreiben, dafür sind diese Bögen da. Für
mich ist es wichtig, ihre Erfahrungen zu verstehen, um sie zu unterstützen, ihre Krank-
heit zu verarbeiten. Auch für Sie ist es wichtig, sich mit den Gedanken zur Zukunft,
ihren Stärken und Schwächen auseinander zu setzen. Nur so können wir herausfi nden,
was die passende Hilfe für Sie ist.
Was Sie selbst tun können, wo und für was Sie noch Unterstützung brauchen, das ist
Thema der Gespräche. Dieser Individuelle Behandlungs- und Reha-Plan, den wir hier
ausfüllen, ist eine Zusammenfassung aus unseren Gesprächen. Er soll zu besseren
Lebensumständen beitragen und alle Hilfen, die sie bekommen, miteinander abstim-
men.“
Welche Ansprech-Rolle sehen Sie hier?:
„Sie (und wir) haben gestern Post vom Kostenträger bekommen, der Ihren Aufenthalt
und Ihren Platz hier fi nanziert. Darin bittet der Kostenträger um einen Bericht über die
Entwicklung im letzten Jahr und fragt, welche Perspektiven sich ergeben sollen. Das
ist nicht so einfach zu beantworten, weil ja ein genauer Plan für die nächste Zeit gefor-
dert ist. Deshalb möchte ich mit Ihnen diese Bögen ausfüllen, damit wir einen solchen
Plan gemeinsam entwickeln können.“
Die Lösungen fi nden Sie unter downloads, Lösungen.
![Page 7: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/7.jpg)
Seite 7
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 7 von 41
[ibrp.pdf]
Einführung in die ersten Schritte der Hilfeplanung
Mit den ersten Schritten der Hilfeplanung ist gemeint:
• die Nutzung des Anamnesebogens bzw. Integration anderer Anamnesebögen,
• das Feststellen oder gemeinsame Herausfi nden der gewünschten Lebensform,
• die Zusammenfassung der Problemlage,
• die Formulierung von Zielen,
• die Einschätzung von Fähigkeiten und
• die Einschätzung von Beeinträchtigungen.
Wir schlagen vor, zunächst die Bögen an jeweils unterschiedlichen Beispielen zu
bearbeiten. Äußerst hilfreich ist es, wenn Sie sich auf folgende Rolle bei der Bearbei-
tung der Bögen einstimmen:
„Ich bin eine Fachkraft in einer Beratungsstelle. Zu mir können alle psychisch kran-
ken oder seelisch behinderten Menschen der Region kommen, um herauszufi nden, wel-
che Hilfen Sie benötigen um so leben zu können, wie sie möchten. Selbstverständlich
müssen die Klientinnen und Klienten mit beteiligt werden, aber es macht auch Sinn,
die Informationen, die ich als Fachkraft habe, für mich zu ordnen und Hilfeplangesprä-
che vorzubereiten.“
Sie werden im Folgenden immer wieder aufgefordert, etwas aufzuschreiben oder
Notizen zu ordnen. Grundsätzlich sollten ihre Notizen
• möglichst konkret und nachvollziehbar formuliert sein,
• möglichst eindeutig zugeordnet sein, d.h. tatsächlich eine 0 eintragen, wenn das
Item nicht zutrifft oder nicht notwendig ist.
Der IBRP und die Hilfsmittel sind keine Bögen zum „Abhaken“. Es ist nötig, sie
auch kreativ zu nutzen; begründetes Hinzufügen und Weglassen ist erwünscht und
möglich.
Die Bögen sind Hilfsmittel, um im Sinne einer subjektorientierten und personenbe-
zogenen Haltung die Frage nach dem persönlichen Hilfebedarf und darauf aufbauen-
der, mit allen Beteiligten abgestimmten Hilfeplanung beantworten zu können.
Der IBRP soll das personenbezogene Verhandeln fördern und dafür eine systemati-
sche Grundlage geben.
Bitte öffnen Sie sich zunächst den Anamnesebogen. Wenn es ihnen unvertraut ist,
einen so komplexen Bogen sich auf dem Bildschirm anzusehen, drucken Sie ihn jetzt
aus und sehen Sie sich diesen Bogen in der Papierform an.
Falls Sie bereits Mitarbeiterin / Mitarbeiter einer psychiatrischen Einrichtung sind,
vergleichen sie den dort verwendeten Bogen mit dem hier Vorgeschlagenen. In weiten
Teilen werden die hier nachgefragten Informationen identisch sein. Markieren Sie sich
in unserem Vorschlag, welche Fragen für Sie neu sind.
![Page 8: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/8.jpg)
Seite 8
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 8 von 41
[ibrp.pdf]
Bitte lesen Sie sich
den folgenden Beispielfall durch:
Beispielfall: Frau Mauer wird nachts von der Polizei in die psychiatrische Klinik gebracht, nachdem das Städtische Krankenhaus die Aufnahme verweigert hat. Sie gilt dort nach mehreren Aufnahmen als
„hoffnungsloser“ Fall, akute Lebensgefahr liegt nach Einschätzung des aufnehmenden Arztes im All-gemeinkrankenhaus nicht vor. Frau Mauer hat Prellungen am ganzen Körper und Schnittwunden an den Handgelenken und Unterarmen. Ihr körperlicher Zustand ist schlecht, sie ist abgemagert, hat alte Schnittnarben an Armen und Händen, sie wirkt ungepfl egt und riecht stark nach Alkohol.
Frau Mauer wirkt verschlossen und verstört, sie spricht kaum, ist aber zeitlich und örtlich orientiert. Sie macht folgende Angaben:
Name: Helga Mauer, 28 Jahre. Wohnort: keiner. Zuletzt hat sie auf einem wilden Campingplatz am Stadt-rand wechselnd bei verschiedenen Bekannten übernachtet. Sie hat keine Papiere, keine persönliche Habe und ist mittellos. Sie besitzt nur die Kleidung, die sie trägt; diese ist für die Witterung zu dünn, abgetra-gen und sehr verschmutzt.
Frau Mauer lässt sich freiwillig stationär aufnehmen. Sie ist ärztlich untersucht worden, weitergehende Planungen wurden zurückgestellt. Im Team wurde eine Bezugstherapeutin festgelegt. Diese hat mit Frau Mauer Kontakt aufgenommen und für den nächsten Tag ein längeres Gespräch verabredet.
Frau Mauer ist vom Krankenhaus mit Kleidung und Waschzeug versorgt worden. Sie hat die ersten bei-den Tage fast ausschließlich geschlafen, viel gegessen und weder mit Mitarbeitern noch mit Mitpatienten mehr als das Nötigste gesprochen.
Folgende Informationen haben sich bei Nachfragen von Mitarbeitern ergeben:
Sie ist in verschiedenen Heimen aufgewachsen und zweimal in Pfl egefamilien gewesen. Mit 18 lernte sie ihren ehemaligen Mann kennen und heiratete ihn, als sie schwanger war. Nach fünf Jahren Ehe folgte Scheidung auf Betreiben des Ehemannes, der dann das Sorgerecht für den Sohn gerichtlich zugespro-chen bekam und jeden Kontakt von Frau Mauer zu ihm und dem Sohn ablehnt.
Nach der Scheidung war sie wohnungslos und hatte verstärkte Alkoholprobleme. Eine Berufsausbildung hat Frau Mauer nicht, sie hat manchmal gejobbt, aber in der letzten Zeit nicht mehr.
Bitte versuchen Sie jetzt, die Informationen aus diesem Beispieltext in den Anamnese-
bogen einzutragen.
![Page 9: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/9.jpg)
Seite 9
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 9 von 41
[ibrp.pdf]
In einem zweiten Schritt formulieren Sie bitte, welche Informationen sie in einem
Gespräch mit Frau Mauer noch erfragen müssten (als Liste der Angaben formulieren,
am schnellsten geht das mit den Ziffern).
Weitere Informationen zu Frau Mauer: Frau Maurer lebte in den ersten drei Lebensjahren bei Mut-ter und Großmutter; über den Vater ist nichts bekannt. Die Mutter arbeitete bei einer Reinigungsfi rma, abends half sie oft in einer Gaststätte. Frau Mauer berichtet, das die Mutter stark getrunken habe. Die Großmutter habe sie versorgt, sehr gemocht und habe sie verwöhnt.
Nach dem Tod der Großmutter kam sie in ein Kinderheim, da die Mutter mit der Versorgung des Kindes überfordert war. Als 6-jährige nahm sie eine Pfl egefamilie auf, nach dem plötzlichen Tod des Pfl egevaters aber musste sie wieder zurück ins Heim.
Mit elf Jahren erfolgte wieder ein Wechsel in eine Pfl egefamilie, die eine etwas jüngere eigene Tochter hatte. Es gab sehr viele Schwierigkeiten. Frau Mauer fühlte sich zurückgesetzt, die Pfl egemutter klagte über störrisches Verhalten und fehlende Mithilfe. Nach sechs Monaten kam sie ins Heim zurück und blieb dort bis zum 18. Lebensjahr.
Frau Mauer besuchte eine staatliche Schule bis zum Hauptschulabschluss. Sie war keine gute Schülerin und hatte wenig Kontakte in der Klasse und zu den Lehrern. Nach dem Schulabschluss begann sie eine Lehre im Einzelhandel, die sie auf Grund der Schwangerschaft abbrach.
Während ihrer Ehe und auch nach der Scheidung übernahm sie stundenweise Aushilfstätigkeiten, zeit-weilig auch in einer Fabrik. Diese Beschäftigungsverhältnisse wechselten jedoch häufi g, im letzten Jahr hatte sie gar keine Arbeit.
Frau Mauer berichtet, das die Ehe sehr schwierig gewesen sei. Sie habe es ihrem Mann und der bei ihnen lebenden Schwiegermutter nicht recht machen können. Den kleinen Sohn habe man ihr immer mehr ent-fremdet. Sie habe dann häufi g Alkohol getrunken und sich auch öfter selbst verletzt. Nach fünf Jahren habe der Mann die Scheidung eingereicht und das Sorgerecht bekommen. Er sei inzwischen wieder ver-heiratet und habe zwei weitere Kinder.
Zur Mutter von Frau Mauer besteht seit Jahren keinerlei Kontakt.
Vorgeschichte der Erkrankung: Nach dem Tod der Großmutter fühlte sich Frau Mauer einsam und verlas-sen. Sie zog sich immer mehr zurück, war oft traurig und konnte sich im Kinderheim nicht einleben. In dieser Zeit dachte sie oft, dass sie auch lieber tot wäre, wie die Großmutter.
In den folgenden Jahren wuchs ihre innere Überzeugung, niemand könnte sie gern haben, sie sei wertlos und überfl üssig.
Schon im Heim kam es bei seelischen Belastungen zu selbstverletzendem Verhalten, das sie aber zu ver-heimlichen suchte. In der Ehe wurde dieses Verhalten sehr viel stärker, oft in Verbindung mit Alkohol. Frau Mauer war mehrmals zur Wundversorgung in der Ambulanz des Städtischen Krankenhauses, wurde aber in der letzten Zeit wegen ihrer „Alkoholfahne“ wieder weggeschickt.
In den letzten Monaten vor ihrer Einweisung war Frau Mauer fast ständig betrunken. Sie lebte bei ver-schiedenen Männern, wurde häufi g geschlagen und verlor ihre letzte Habe.
Inzwischen ist sie seit drei Wochen auf der psychiatrischen Station. Sie hat sich körperlich erholt, nach der Entgiftung hat sie sich strikt an das Alkoholverbot gehalten. Sie besucht eine Selbsthilfegruppe von außerhalb, die sich zweimal in der Woche in der Klinik trifft.
Mit dieser Übung machen sie sich schnell mit dem Anamnesebogen vertraut.
![Page 10: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/10.jpg)
Seite 10
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 10 von 41
[ibrp.pdf]
Wenn Sie einen anderen Bogen / ein anderes Dokumentations-
system in ihrer Einrichtung / ihrem Dienst nutzen:
Bitte überprüfen Sie, ob darin die persönlichen Daten zur allgemeinen Situation und
zur Ausbildung und Berufstätigkeit auch dokumentiert werden können.
Besonders wichtig für das weitere Hilfeplanverfahren ist, dass Sie mit ihrer Klien-
tin/ ihrem Klienten über die Erfahrungen mit bisherigen Hilfen ins Gespräch kommen
und dies auch dokumentieren können.
Wenn Sie eine Hilfeplanung mit einer Ihnen schon länger bekannten Klientin begin-
nen: es ist wichtig, sich die Basisinformationen aus dem Bogen D zur „vergegenwärti-
gen“.
Bei neuen Klientinnen/Klienten muss nicht „alles“ im Anamnesebogen schon aus-
gefüllt sein, bevor Sie mit der Hilfeplanung beginnen – sie haben in den folgenden Hil-
feplangesprächen Zeit, das Eine oder Andere zu ergänzen.
Was ist die gewünschte Lebensform?
Genau wie anderen Menschen fällt es manchen Klientinnen und Klienten schwer,
sich gedanklich von den jetzigen Lebensumständen zu lösen. Aber genau das ist nötig,
um zu beantworten: Will ich so leben? Was will ich verändern?
Die eigene Perspektive auf die Zukunft zu richten ist unerlässlich für Hilfeplanung
und außerdem Grundlage der Einschätzung von Situationen, Ressourcen und Hinder-
nissen in mir und in der Umwelt.
Um so einen „Leitstern“ zu entwickeln, muss ich mich lösen können, muss offen
sein für eine positive „Utopie“. Kann ich mir meine weitere Lebensentwicklung vor-
stellen, wie würde ich gerne wohnen, wie mit anderen zusammenleben, wie meine Zeit
verbringen, was gerne tun?
Für die eher Sachlichen sind die Bögen B und C mit den erläuternden Materialien
gedacht.
Diese Bögen sind Hilfsmittel, die sowohl die gemeinsame Einschätzung der jetzi-
gen Situation wie auch die sich daraus eventuell ergebenden Veränderungswünsche
klarer machen. Diese können, aber müssen nicht ausgefüllt werden. Vielleicht sind die
Wünsche klar und das Gespräch zu diesen Aspekten dient nur der besseren Einschät-
zung der Situation. Insbesondere bei Fortschreibungen ist die bloße Wiederholung nicht
sinnvoll.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die gewünschte Lebensform alle Lebensberei-
che betrifft, nicht nur zum Wohnen kann man Zukunftsvorstellungen entwickeln, son-
dern auch zu: Tätigsein und Nähe, Erreichbarkeit und/oder Distanz zu sozialen Kontak-
ten und sozialen Räumen sind genauso wichtig.
Als nützlich für Menschen, die noch gar keine genaue Vorstellungen äußern können,
hat sich folgendes Verfahren bewährt: die jetzige Wohnsituation in dieser Systematik
mit dem Klienten zu erarbeiten. Also die Frage: Was sind Vor- und was Nachteile für
mich?
Hilfreich kann auch sein, die Verantwortung an andere zu geben. Da haben sich
Experten eine Übersicht zu Wohnformen ausgedacht: Was meinen Sie, ist das so richtig,
wie es hier aufgeschrieben ist? Was sehen sie anders?
![Page 11: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/11.jpg)
Seite 11
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 11 von 41
[ibrp.pdf]
Oder: Der Dienst XY hat sie hierher geschickt, was haben die sich ihrer Meinung
nach dabei gedacht? Sehen Sie das auch so?
Auch die systemische Wunderfrage (Eine Fee hat sie über Nacht dorthin gezaubert,
wo sie schon immer leben wollten - wo wachen Sie auf?) kann in diesem Zusammen-
hang hilfreich sein.
Das Wichtigste überhaupt ist jedoch, mit den Klientinnen und Klienten in ein
Gespräch über die Zukunft zu kommen, das positiv getönt ist.
Manchmal liegt die Schwierigkeit auch nicht bei den Klienten: aus Vorsicht, ja nicht
zu unrealistische, unerfüllbare Wunschträume anzusprechen, bremsen Mitarbeiter
Zukunftsaspekte aus, bleiben ganz „auf dem Teppich“.
Auch bei der Vorstellung vom Schloss in Südfrankreich lassen sich „Wie-Qualitä-
ten“ herausarbeiten, die zu konkreten und realistischen Verbesserungen der Lebensum-
stände jetzt beitragen können.
Bitte rufen Sie sich jetzt den Bogen B auf und drucken ihn
gegebenenfalls aus.
Die Nutzung des Bogens B „Beschreibung der
gegenwärtigen und / oder der angestrebten Wohnform
Wenn Sie mit ihrer Klientin / ihrem Klienten über die gewünschte Lebensform
gesprochen haben, ist es sinnvoll, dies auch noch mit dem Bogen „B“ konkreter weiter
zu verfolgen.
Gehen sie ruhig in gemeinsamer Überlegung Vor – und Nachteile durch, lassen Sie
sich diese von ihrer Klientin/ ihrem Klienten vor allem aus ihrer /seiner Sicht schildern.
Gerade bei Fragen der Selbstversorgung und des Wohnens gibt es sehr unterschiedliche
Sichtweisen und die Gefahr des „Überstülpens“ eigener Vorstellungen ist groß.
Lesen Sie sich die folgenden neuen Informationen zu Frau Mauer
durch:
Weitere Informationen zu Frau Mauer: Frau Mauer hat Ihnen schon gesagt, dass ihr Traum eine eigene Wohnung sei. Im Moment ist Ihnen aber nur bekannt, dass im Betreuten Wohnen ein Platz in einer Vie-rer-Wohngruppe frei ist. Dort leben eine Frau und zwei Männer.
Welche konkreten Vor- und Nachteile der Wohnformen würden Sie mit ihr durchge-
hen? Welche Punkte wären Ihnen besonders wichtig? Als Hilfsmittel benutzen Sie bitte
das Manual Wohnformen.
Wenn Sie den Bogen B bearbeitet haben, können sie dessen Ergebnisse schon im
Übersichtsbogen A , S 2 oben bei der jetzigen/ angestrebten Wohnform vermerken.
![Page 12: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/12.jpg)
Seite 12
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 12 von 41
[ibrp.pdf]
Der Bogen C zur „gewünschten Tätigkeitsform“
Der Bogen C zur zur gewünschten Tätigkeitsform soll dazu beitragen, die
gewünschte Lebensform ihrer Klientin herauszufi nden oder einen schon bestehenden
Wunsch auf die konkreten Bedingungen hin abzuprüfen.
Bitte holen Sie sich diesen Bogen und drucken Sie ihn gegebenenfalls
aus.
Bitte füllen Sie diesen Bogen für sich selbst aus: Wie war Ihre Wochenstruktur,
bevor dieser Kurs begonnen hat? Was muss sich ändern wenn Sie diesen Kurs weiter-
machen?
Nachdem Sie das für sich ausgefüllt haben, schreiben sie auf, was aus ihrer Sicht
schwierig war beim Ausfüllen dieser Übersicht.
Bitte tauschen Sie sich im Kleingruppenforum aus und formulieren Sie zusammen
Thesen, auf was mann/frau bei dem Ausfüllen mit einer Klientin (z.B. Frau Mauer) aus
Ihrer Sicht achten sollte. Stellen Sie diese Thesen in das Kursforum und sehen sie sich
die Rückmeldungen an.
Der Bogen C sollte zweifach ausgefüllt werden siehe dazu die Überschriften: Ver-
sion 1 beschreibt die gegenwärtige Situation „Derzeitige Tages/Wochengestaltung“,
Version 2 die gewünschte und zu planende Veränderung der Tages/ und Wochengestal-
tung.
Diese zunächst schematisch wirkende Aufteilung hilft, Belastungsspitzen und Leer-
läufe in der Woche zu erkennen.
In die Kästchen der ersten Spalte sollten sie die konkreten Tätigkeiten eintragen
und jeweils ungefähr abschätzen, wie viel Zeit dafür nötig ist. Wenn Ihnen die Auftei-
lung nach Tagen zu detailliert ist und zu viel Zeit in Anspruch nimmt, versuchen Sie es
wenigstens auf Wocheniveau einzuschätzen.
Für die gewünschten Veränderungen kann es sehr hilfreich sein, diese in ihren täg-
lichen Belastungen (denken Sie auch an Fahrzeiten) zu überlegen.
Diese konkreten Überlegungen: “ was genau soll in z.B. 6 Monaten oder einem Jahr
in meiner Wochenstruktur anders sein“ helfen sehr bei der Erarbeitung von konkreten
Zielen. Bitte sehen Sie sich auch die ergänzenden Materialien an – vor allem wenn es
um Veränderungen der Arbeits- und Beschäftigungssituation geht.
Wenn Sie den Bogen C ausgefüllt, bzw. besprochen haben, können sie dessen Ergeb-
nisse (ähnlich wie bei der Wohnform) schon in den Bogen A eintragen.
![Page 13: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/13.jpg)
Seite 13
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 13 von 41
[ibrp.pdf]
Der Übersichtsbogen A
Bitte holen Sie sich den Bogen A und sehen Sie sich ihn an,
gegebenenfalls drucken Sie ihn aus.
Sie sollen jetzt versuchen, für unser Beispiel Frau Mauer, die erste Spalte auszufüllen.
Lesen Sie sich dafür zunächst die folgende Anleitung durch!
Anleitung zur Spalte „Aktuelle Problemlagen“
Die aktuelle Problemlage soll geschildert werden im Hinblick auf:
• Wohnsituation (Frage: Wird diese in irgendeiner Art und Weise als problema-
tisch empfunden und wenn ja, wie?).
• Vorrangige Störungen (Frage: Welche Möglichkeiten zur Krankheitsbewälti-
gung sind bis jetzt gefunden worden bzw. mit welchen Möglichkeiten wurden
welche Erfahrungen gemacht und welche weiteren Ideen gibt es diesbezüglich
schon?).
• Lebensfeldbezogene Fähigkeitsstörung (Frage: Welche Auswirkungen hat die
psychische Störung bei der Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen, im
Bereich Selbstversorgung und Wohnen, im Bereich Ausbildung, bei der Tagesge-
staltung im Freizeitbereich und bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?).
• Situative Faktoren und belastende Lebenssituation (Frage: Welche entlasten-
den und/oder belastenden, über- und/oder unterfordernden Lebensbedingungen
gibt es momentan, welche Faktoren der momentanen Lebenssituation werden als
problematisch angesehen?).
Generell ist wichtig: Falls Unterschiede in der Einschätzung der aktuellen Problem-
lage zwischen den Klienten einerseits und der Fachkraft andererseits auftreten, sind
diese in geeigneter Weise zu dokumentieren (durch verschiedene Farben etc.).
Wenn irgend möglich, sollten die Angaben der Klientinnen und Klienten in deren
Sprache notiert werden, es sollten keine Zusammenfassungen wie zum Beispiel
„Depressivität“ notiert werden. Es geht hier nicht um Ursachenklärung oder das Aufzei-
gen von Zusammenhängen: Bestehende Probleme sollen kurz festgehalten werden. Das
momentan vorhandene Problem sollte herausgearbeitet werden (es nicht dabei belas-
sen: „Ich bin alkoholabhängig“, sondern: „Ich bin alkoholabhängig, mir ist angedroht
worden, dass ich auf Grund des häufi gen Zu-spät-Kommens und der alkoholbedingten
Eigengefährdung an meinem Arbeitsplatz diesen verlieren könnte, und das will ich
nicht“ (= Gefährdung Arbeitsplatz durch Alkoholkonsum).
Es sollten auch vermeintlich „allgemeine“ Probleme („Ich habe keine Familie und
fühle mich deswegen minderwertig“) notiert werden.
Zunächst ist es günstiger, sämtliche Probleme auf einem Blatt zu notieren und nicht
nur die, die eventuell aktuell „bearbeitet“ werden sollen. Die aktuell „zu bearbeitenden“
Probleme können bzw. werden später in einem zweiten Schritt markiert und dann in die
Spalte eingetragen.
![Page 14: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/14.jpg)
Seite 14
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 14 von 41
[ibrp.pdf]
Übung zum Übersichtsbogen, Spalte „Aktuelle Problemlage
Auch wenn Sie Frau Mauer und ihre Lebensumstände nicht so genau kennen, schreiben
sie sich Stichworte im Hinblick auf:
• vorrangige Störungen,
• Krankheitsbewältigung,
• lebensfeldbezogene Fähigkeiten und Fähigkeitsstörungen,
• situative Faktoren,
• belastende Lebenssituation auf.
Prüffragen:
Ist das vorstellbar, das Frau Mauer das auch so formulieren würde?
Wie können Sie die Problemlage so beschreiben,
das auch Frau Mauer dieser Beschreibung ihrer Situation zustimmen könnte?
Sind dann noch die wesentlichen Probleme aus ihrer Sicht benannt?
Sie haben jetzt die ersten Schritte der Hilfeplanung geübt:
• die Nutzung des Anamnesebogens bzw. Integration anderer Anamnesebögen,
• das Feststellen oder gemeinsame Herausfi nden der gewünschten Lebensform,
Wohn- und Arbeitssituation
• die Zusammenfassung der Problemlage
Anleitung zur Spalte „Ziele“
Die nächste Spalte im Bogen A / IBRP ist überschrieben mit Ziele.
Hier sollen die vorrangigen, das heißt die allgemeinen und groben therapeutischen
Ziele benannt werden, und zwar bezogen auf:
• Allgemeine Wohn- und Lebenssituation (Zu diesem Gebiet haben Sie aus der
Bearbeitung der Bögen B und C einige Anregungen) Ziele können sich auf die
Erhaltung und Stabilisierung oder die Veränderung der Wohnsituation und/oder
der Tagesgestaltung beziehen.
• Die Symptomatik (Fragebeispiel: „Sie haben gesagt, Sie hören Stimmen, diese
stören Sie in Ihrer Konzentration beim Abwaschen, sodass Sie nicht vorankom-
men. Soll sich in Bezug auf dieses Stimmenhören irgendetwas ändern, zum
Beispiel bezogen auf bestimmte Situationen oder Zeiten?“): Ziele können sich
hier auf die Verminderung einer ggf. (fort)bestehenden Symptomatik wie auch
auf die Entwicklung von besseren Fähigkeiten, mit der Symptomatik umzuge-
hen, beziehen (Spalte „Fähigkeiten“ einbeziehen!).
• Eigene Befindlichkeit (Fragebeispiel: „Sie sagten, dass es Sie störe, so häufi g
traurig zu sein. Dadurch hätten Sie jegliche Lebensfreude und Freude an Akti-
vitäten verloren. Soll sich etwas von dieser Befi ndlichkeit ändern oder ist Ihnen
das nicht so wichtig?“).
![Page 15: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/15.jpg)
Seite 15
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 15 von 41
[ibrp.pdf]
• Kompetenzen (Beispielfrage: „Möchten Sie - und wenn ja, welche - für Sie
wichtigen alltagspraktische und soziale Kompetenzen und Fertigkeiten erwer-
ben?“).
• Soziale Integration (Beispielfrage: „Was könnten Sie sich vorstellen zu tun,
damit sich die Belastung für Ihre Nachbarn künftig verringert?): Es geht um
konkrete Ziele in Bezug auf die Vorbeugung von Benachteiligungen sowie Mil-
derung oder Kompensation von Ablehnung und Ausgrenzung.
Generell ist wichtig: Der Bereich der Ziele kann durchaus in einem ersten Durchlauf
aus einer Nennung einer großen Zahl von Zielen ganz unterschiedlicher und auch allge-
meiner Art bestehen. Bei der späteren Planung der Hilfen sind dann die für einen kon-
kreten Zeitraum auszuwählenden Ziele zu benennen und in diese Spalte einzutragen.
Es ist also wichtig, Ziele auf einen bestimmten Zeitrahmen (zum Beispiel den der
nächsten Kostenbewilligung) zu beziehen.
Nochmals: Das angestrebte Ziel kann sowohl in einer Veränderung bestehen als auch
darin, die gegenwärtige Lebenssituation zu erhalten.
Nützlich ist es, Ziele positiv und nicht negativ zu formulieren. Weiterhin ist es hilfreich,
sie so konkret und realistisch wie möglich zu formulieren. Zu berücksichtigen ist, dass
nicht jede Beeinträchtigung, Fähigkeitsstörung oder Umfeldbelastung aufgehoben wer-
den kann.
Wie in der Spalte vorher sollten die Angaben der Klientinnen und Klienten in deren
Sprache notiert werden. Es sollte nicht diskutiert, sondern ausschließlich im Sinne von
Präzisierung nachgefragt werden.
Unterschiede bei den Zielvorstellungen (z.B. andere Prioritäten) sind in geeigneter
Weise zu dokumentieren.
Achtung: Am Ende des Ausfüllens der zweiten Spalte sollten deren Angaben mit
denen der ersten Spalte abgeglichen werden, um festzustellen, ob Zielformulierungen
eventuell vergessen wurden. Wichtig ist dabei, dass nicht jedes formulierte Problem zu
einem Handlungsziel werden muss und umgekehrt.
An diesen fachlichen Qualitätsstandards für das Ausfüllen dieser Spalte haben Sie
schon gemerkt, das diese Spalte „schwierig“ ist und auf keinen Fall einfach so ausge-
füllt werden kann. Ich brauche dafür Vorarbeiten.
Die Kunst der konkreten und realistischen Formulierung
von Zielen
Der Begriff der „Kunst“ macht deutlich, dass dies eine zu übende Fähigkeit ist. Sie
ist nur schlecht allein zu üben, eine große Hilfe können die Klienten sein - denn auch
sie müssen merken können, wenn das Ziel erreicht ist. Die wichtigste Hilfe aber sind
Kollegen und die Kultur der Fallbesprechungen. Je mehr gute und klare Zielvereinba-
rungen ich geschrieben, gehört und deren Ergebnisse verfolgt habe, umso besser werde
ich.
Sehen Sie sich die Videosequenz an zum Thema:
Ziele konkretisieren
![Page 16: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/16.jpg)
Seite 16
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 16 von 41
[ibrp.pdf]
Wir üben dies jetzt in Schritten
an unserem Beispiel Frau Mauer:
Fallbeispiel: Der in der Klinik vereinbarte Wochenplan für Frau Mauer sieht folgendermaßen aus:
Dreimal eine Stunde Gruppentherapie; Angebot von Einzelgesprächen zweimal 30 Minuten pro Woche; dreimal morgens zum Schwimmen gehen; Arbeitstherapie, Belastungserprobung zunächst für eine Woche dreimal 1,5 Stunden, dann auf dreimal drei Stunden steigern.
Teilnahme an der lebenspraktischen Gruppe zweimal nachmittags 1,5 Stunden.
Frau Mauer nimmt an allen Angeboten teil und hält die Termine genau ein. In der Gruppentherapie wirkt sie weiterhin sehr zurückgezogen und still. In der Arbeitstherapie und der lebenspraktischen Gruppe ist sie wesentlich aufgeschlossener. Sie hat dort Freundschaft mit einer älteren Patientin geschlossen. Beide unterstützen sich gegenseitig. Die Stammtischrunde ist durch Entlassung von drei Patienten nicht mehr vorhanden. Frau Mauer hält sich an das Alkoholverbot, raucht aber sehr stark.
Sie lehnt jeden Kontakt zu ihrem letzten Lebensumfeld ab. Das Angebot, dort in Begleitung nach ihrer Habe zu schauen und der Besuch eines Mannes, der jetzt Patient einer anderen Station ist, wurde von ihr zurückgewiesen.
Frau Mauer bemüht sich, mit ihrem Taschengeld auszukommen, aber das starke Rauchen kostet sehr viel Geld.
Die Mitarbeiterin, die die lebenspraktische Gruppe leitet, berichtet, dass Frau Mauer sehr interessiert ist und viel Lob aus der Gruppe für ihre Fähigkeit bekam, aus wenigen einfachen Zutaten eine Mahlzeit her-zustellen. Sehr ungewohnt sei ihr längerfristige Finanzplanung.
Der Mitarbeiter aus der Arbeitstherapie berichtet, dass Frau Mauer verschiedene Arbeitserprobungen gemacht habe, sie bemühe sich sehr, benötige aber präzise Anweisungen und sehr viel Zeit.
In der letzten Woche hatte Frau Mauer einen Rückfall: Ein ehemaliger Patient aus der „Stammtischrunde“ hatte Alkohol mit auf das Klinikgelände gebracht und die ehemaligen Mitpatienten eingeladen. Auf der Station war dies unbemerkt geblieben. Frau Mauer hatte es selbst angesprochen, nachdem sie den Rück-fall in der Selbsthilfegruppe bearbeitet hatte. Erstmals sprach sie davon, dass die Gruppe sie unterstützen solle, ein Besuchsrecht für ihren Sohn zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund war sie besonders ärgerlich auf sich selbst wegen ihres Rückfalles.
Frau Mauer möchte entlassen werden. Sie hat von dem Schwiegersohn der befreundeten Mitpatientin ein Angebot: Sie könne eine kleine Dachgeschosswohnung neben der Jugendherberge beziehen. Herr Froh - der Schwiegersohn - und seine Frau sind die Herbergseltern. Die Wohnung ist seit vier Wochen frei und kostet 400 DM ohne Nebenkosten. Herr und Frau Froh können sich vorstellen, das Frau Mauer stunden-weise in der Herbergsküche gegen Entlohnung hilft.
Das Wohnangebot ist unabhängig vom Arbeitsangebot.
![Page 17: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/17.jpg)
Seite 17
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 17 von 41
[ibrp.pdf]
Die folgende Aufgabe ist in 3 Schritten aufgebaut:
Übung zum Übersichtsbogen, Spalte „Zielformulierung“
1. Aufgabe ist, sich auf das Hilfeplangespräch mit Frau Mauer vorzubereiten. Über-
legung: „Welche Vorstellungen hätten Sie als Fachkräfte für die Ziele von
Frau Mauer in den nächsten sechs Monaten?“
Sehr wichtig ist, das Sie dies als „Vorübung“ betrachten: in der Realität müssen
gerade die Ziele unbedingt mit der Klientin erarbeitet werden. Es ist aber gerade
am Beginn der eigenen Berufstätigkeit oder mit einer neuen Klientin / einem
neuen Klienten nützlich, sich vorher kurz selbst aufzuschreiben, was den eige-
nen Standpunkt, die eigene Sichtweise festhält.
Wir beginnen mit der ersten Vorübung: Was kommen aus ihrer Sicht überhaupt
für Ziele für Frau Mauer in Frage?
Bitte notieren Sie sich in Stichworten alles, was Ihnen einfällt.
Im Folgenden versuchen wir weitere Ansatzpunkte für eine inhaltliche Verdich-
tung zu fi nden: Leitstern soll die gewünschte Lebensform sein.
2. Aufgabe: Schreiben Sie alle Stichpunkte zusammen, die eine inhaltliche Verbin-
dung mit Frau Mauers Ziel „eigene Wohnung“ haben.
Schon aus der Beschreibung der gegenwärtigen Situation lassen sich Ziele for-
mulieren.
Zusammen mit neuen Informationen zur Wohnsituation und der Tagesgestaltung
kann sich wieder eine andere Sichtweise ergeben.
Es ist schwierig, eine solches Hin- und Herdenken, das komplexe Abwägen
von professionellen und persönlichen Zielen, das Einbeziehen der Zeit und der
Möglichkeiten hinzubekommen. Später können Sie es mit Einfärben oder Ein-
kringeln versuchen - wenn Sie es können auch auf dem Computer, sonst einfach
so auf Papier.
Weitere Ebenen entstehen, wenn sie die Fähigkeiten und in einem zweiten Schritt
die Beeinträchtigungen einbeziehen. Das sind die beiden nächsten Spalten im
Übersichtsbogen.
Diese lassen wir jetzt mal aus, zumal das ziemlich schwierig wäre, das für unse-
ren Beispielfall nachzuvollziehen.
Das nächste Hilfsmittel zum „Verdichten“ von Zielen ist das Bilden von Rangreihen.
Was steht für den Klienten im Vordergrund, was ist ihm am Wichtigsten, was ist
mir selbst wichtig?
Bitte bilden Sie zunächst für sich selbst eine Rangreihe der Ziele für Frau Mauer.
Welches der bisherigen Zielstichpunkte wäre Ihnen am Wichtigsten, welches das zweit-
wichtigste, welches das drittwichtigste ?
Wenn Ihnen das nicht unmittelbar gelingt , probieren sie das zunächst so, das sie die
aus ihrer Sicht wichtigen Ziele auf Karten schreiben und hin und her schieben. Wel-
ches Legen gefällt Ihnen am Besten? Das ist ein Hilfsmittel, das sich auch empfi ehlt,
wenn sie mit Klientinnen oder Klienten versuchen, Ziele zu ordnen. Sie können auch
![Page 18: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/18.jpg)
Seite 18
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 18 von 41
[ibrp.pdf]
versuchen, Punkte zu vergeben oder kleine Gruppen zu bilden – jeweils immer 2 oder
3 wichtige und weniger wichtige Ziele zusammenfassen.
Die folgenden Aspekte können dann nur an einem realen Fall geübt werden, weil
diese für sie bei einem Beispielfall nicht realistisch einzuschätzen sind.
Ein neuer Aspekt kommt hinzu: Was ist realistisch in den nächsten 3, 6 oder 12
Monaten zu erreichen? Das Ordnen nach Nah- und Fernzielen ist abhängig von der
Ausgangslage: welchen Auftrag haben Sie, wie lange brauchen Beantragung, Verän-
derungen von Absprachen aus ihrer Kenntnis von Verwaltungsabläufen? Wie schätzen
die Klienten ihre Kräfte zur Bewältigung ein?
Nach diesen Verdichtungsprozessen kommt die Kunst der konkreten Formulierung.
Es gibt Merkmale, die dabei helfen, Zielformulierungen zu überprüfen:
1. Stehen die Ziele in einem größeren Kontext? Deshalb ist die Frage nach dem
„Leitstern“, der gewünschten Lebensform so wichtig, auch wenn dieser Kon-
text mit der Zielformulierung für die nächsten sechs Monate nur indirekt zu tun
haben mag.
2. Sind die Ziele positiv formuliert? Der Anreiz, sie zu erreichen, ist wichtig. Eine
mögliche Frage hierzu lautet: Was wäre Ihnen am liebsten?
3. Sind die Ziele konkret genug gefasst? Ihr Erreichen muss zu sehen, zu fühlen, zu
hören sein. Je konkreter gewünschte Wahrnehmungen einbezogen werden, umso
besser kann das Erreichen von Zielen erkannt werden.
4. Sind die Ziele so beschrieben, dass die Klientin oder der Klient etwas dazu bei-
tragen kann, damit sie erreicht werden?
5. Passen die Ziele in die Lebenssituation und das soziale Umfeld der Klientin bzw.
des Klientin? Passen sie zu den Wertvorstellungen? In wessen Leben wird sich
durch das Erreichen von Zielen noch etwas ändern ? Welche Schwierigkeiten
können hingenommen werden?
6. Woran werde ich merken, das ich mein Ziel erreicht habe?
Als Hilfsmittel für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient das genaue Erinnern von
Umständen: Woran habe ich bemerkt, das Frau X mit dem Praktikum zurechtkam? An
den Blumen auf dem Küchentisch vielleicht. Auch die Frage, woran Freunde merken
könnten, dass es klappt, kann hilfreich sein.
Zielformulierungen, die sich auf Häufi gkeiten (z.B. dreimal die Woche die Woh-
nung verlassen) beziehen, sind hierbei günstig; auch möglichst konkrete Vereinbarun-
gen (etwa einmal in der Woche in der Tagesstätte Kaffee trinken gehen) machen Ziele
überprüfbar.
3. Teil der Aufgabe: Bitte sehen Sie sich jetzt ihre Stichpunktliste noch einmal an.
Bitte formulieren sie 3 Ziele für die nächsten 6 Monate aus. Sie sollen der Hin-
tergrund sein, mit dem Sie in ein Gespräch mit Frau Mauer einsteigen würden .
Zielformulierungen sind „an sich“ nicht gelungen, sondern sie werden nur in ihrem Kontext verständlich, deshalb habe ich hier auch nur wenige Beispiele genannt.
![Page 19: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/19.jpg)
Seite 19
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 19 von 41
[ibrp.pdf]
Ziele mit Klientinnen und Klienten gemeinsam zu formulieren ist ein Prozess, in der Regel werden die aufgeschriebenen Ideen mit jeder Überprüfung des Hil-feplans passender.
Die konkrete Zielformulierung ist erfahrungsgemäß eine der schwierigsten Anforderungen des IBRP. Deshalb schlagen wir bei Gruppen, die Mühe mit der Zielformulierung haben und zu allgemein bleiben, vor, dies mit Hilfe folgender Methode im nächsten Kapitel zu üben.
Goal Attainment ScalingDas Erreichen von Zielen kann skaliert werden. Eine sehr gut überprüfte Methode
aus den USA (Goal Attainment Scaling) besteht darin, gemeinsam mit den Patientin-
nen und Patienten eine solche Skalierung selbst zu entwerfen. Im Folgenden ist ein fi k-
tives Beispiel abgedruckt (entnommen aus: STIEGLITZ/HAUG, S. 194).
Zielerreichung
Studium Skala 1
Therapiecompliance Skala 2
Soziale Kontakte Skala 3
Arbeit bzw.
Studium
- 2 Wesentlich schlechter als erwartet
Kein Arztbesuch, keine Medika-menteneinnahme
Keine sozialen Kon-takte zu anderen Menschen
Erscheint jeden Tag ver-spätet zu den Vorlesungen (mehr als 30 Minuten)
- 1 Etwas schlechter als erwartet
Unregelmäßiger Arztbesuch – keine Medikamenteneinnahme
Soziale Kontakte zu einem Familienmit-glied
Erscheint jeden zweiten Tag mit halbstündiger Ver-spätung
0 Erwartetes Ergebnis Unregelmäßiger Arztbesuch – Medikamenteneinnahme nur auf Aufforderung durch andere
Soziale Kontakte zu zwei Familienmit-gliedern
Erscheint einmal pro Woche mit halbstündiger Verspätung
+ 1 Etwas besser als erwar-tet
Unregelmäßiger Arztbesuch – selbstständige Medikamenten-einnahme*
Soziale Kontakte zu einer Person außer-halb der Familie
Erscheint einmal pro Woche mit viertelstündiger Verspätung
+ 2 Wesentlich besser als erwartet
Regelmäßiger Arztbesuch – selbstständig Medikamentenein-nahme
Soziale Kontakte zu zwei oder mehr Per-sonen außerhalb der Familie
Erscheint einmal pro Monat mit viertelstündiger Ver-spätung
![Page 20: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/20.jpg)
Seite 20
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 20 von 41
[ibrp.pdf]
Bitte versuchen Sie dieses Beispiel einer gestuften Skala der
Zielerreichung auf eines Ihrer Beispielziele für Frau Mauer
anzuwenden. Benutzen Sie dazu das nachfolgende Beispiel.
Beispiel: Frau Schäfer ist 54 Jahre alt und lebt im vierten Stock eines Wohnhauses des Sozialen Woh-nungsbaus. Die Wohngegend ist als so genannter „sozialer Brennpunkt“ bekannt. Sie bewohnt allein eine 2-Zimmer-Wohnung.
Frau Schäfer ist in den vergangenen fünf Jahren ca. acht Mal stationär in der psychiatrischen Klinik behandelt worden; die Behandlungsdauer betrug zwischen vier und acht Wochen.
Die ärztliche Diagnose ist Schizophrenie. Frau Schäfer wurde jeweils in sehr verwirrtem und körper-lich sehr schlechtem Zustand (Austrocknung, Abmagerung) in die Klinik gebracht; bei den beiden ersten Klinikaufenthalten hatten entfernt lebende Verwandte telefonisch das Gesundheitsamt informiert. Die folgenden extremen Verschlechterungen wurden über Besuche der Ambulanz der Klinik bemerkt.
Frau Schäfer nimmt ihr verordnete Medikamente sehr unregelmäßig ein und vergisst auch fast immer bestehende Nachsorgetermine in der Klinik, beim Arzt und auch angekündigte Besuche der Ambu-lanz.
Frau Schäfer ist Spätaussiedlerin aus der Ukraine. Sie lebt seit 15 Jahren in Deutschland und hat ca. 9 Jahre ihre Schwiegermutter in der jetzt noch bestehenden Wohnung gepfl egt. Frau Schäfer spricht selbst sehr wenig. Wenn sie spricht, ist sie aber gut zu verstehen. Sie selbst versteht allerdings nach eigenen Aussagen nur wenig Deutsch.
Nach dem letzten Klinikaufenthalt beschließen die Pfl egekraft und die Ärztin der Ambulanz, eine kontinuierlichere Betreuung sicherzustellen. Bisher wurde während der Klinikaufenthalte bereits Ver-schiedenes ausprobiert: Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt, Vermittlung an eine Beratungsstelle für Spätaussiedler, Vermittlung von Kontaktbesuchen durch Mitarbeiter des Betreuten Wohnens, Ver-mittlung an ein Gruppentreffen vorwiegend älterer Besucher einer Kontakt- und Beratungsstelle. Alle weitergehenden Kontaktangebote wurden durch Frau Schäfer nicht wahrgenommen.
Die bestehenden monatlichen oder auch vierzehntägigen Treffen mit dem Krankenpfl eger der Ambulanz werden hingegen gerne von Frau Schäfer wahrgenommen – sofern sie zu Hause ist. Die Gespräche haben im Wesentlichen den Inhalt, die Medikamenteneinnahme zu stabilisieren, die Übersicht zu den Wochen-tagen und Terminen zu behalten, die Essensvorräte ggf. gemeinsam zu ergänzen und überhaupt einen Kontakt zu stabilisieren. Um hier etwas zusätzlich zu bewegen, wird eine Berufspraktikantin für Sozial-arbeit beauftragt, für vier Monate wöchentliche Besuche bei Frau Schäfer zu machen.
Die hier wiedergegebenen Spalten sind das Ergebnis der ersten 2 Treffen mit Frau Schäfer.
Aktuelle Problemlage:
• starke Vereinsamung und Rückzugstendenzen, da kaum Kontakte im Außen-
und im Wohnbereich;
• Ablehnung von Kontaktangeboten im psychiatrischen und nichtpsychiatrischen
(Freizeit-)Bereich;
• extrem geringe Eigenaktivität;
• herausgerissen sein aus den vertrauten Strukturen der Großfamilie durch die
Übersiedlung nach Deutschland;
• Distanz bzw. Nichtwahrnehmen eigenen Körpererlebens, der Erkrankung und
von Schlaf- bzw. Aktivitätsphasen (sie geht nicht ins Bett zum Schlafen);
• Frau Schäfer neigt dazu, eigene Fähigkeiten (Kompetenzen) herabzusetzen.
![Page 21: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/21.jpg)
Seite 21
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 21 von 41
[ibrp.pdf]
Ziele:
• Förderung und Stärkung der Eigenaktivität und Außenorientierung durch
wochenstrukturierende Aktivitäten und Hilfen.
• Befähigung, das durch die Erkrankung beeinfl usste Körpererleben auszuspre-
chen;
• Verbesserung des Tag-Nacht-Rhythmus.
Diese 3 Ziele sind sehr allgemein formuliert und deshalb wenig praktikabel. Wie
würden Sie mit dem Hintergrund ihrer Erfahrung der Praktikantin helfen, sie besser
zu formulieren?
Bitte versuchen Sie alle 3 Ziele
a) konkreter zu formulieren und
b) passende Überprüfungskriterien für Zielerreichung zu formulieren.
Die nächste Spalte im Bogen A ist die Einschätzung von Fähigkeiten
Sehen Sie sich die Videosequenz an zum Thema: Fähigkeiten
einschätzen und Hilfen in der Umgebung herausfi nden.
Dabei soll in Stichworten im Bogen notiert werden:
1. Unterstützende Fähigkeiten bei der Bewältigung psychischer Erkrankungen, eige-
nes Handeln zur Belastungsverminderung und/oder Spannungsreduktion. Hier soll in
freiem Text eingetragen werden, welche Fähigkeiten für die Klientin bzw. den Klienten
besonders zutreffen. Die Erläuterungen umfassen:
• Informationssuche und Austausch mit anderen Betroffenen,
• Wahrnehmung von Frühwarnzeichen,
• Aussprache/Ausdruck von Belastungen,
• sich etwas Gutes tun, sich ablenken können,
• Sinn geben können, religiöse Erfahrung und Praxis,
• Hilfepersonen aktiv anfragen und aufsuchen,
• sich selbst ermutigen können.
Diese Punkte sollen Anregungen sein, ganz spezifi sche hilfreiche Erfahrungen und
Eigenschaften im Gespräch zu erarbeiten und hier als Ressourcen der Person festzu-
halten.
2. Stützende Beziehungen. Auch hier wird kurz in freiem Text eintragen, wer in
Bezug auf die Ziele von der Klientin bzw. dem Klient als stützend/unterstützend erlebt
wird. Im Gespräch sollten dabei die verschiedenen Möglichkeiten:
• im familiären System
• bei Freundinnen und Freunden
• mit anderen Psychiatrieerfahrenen
• im weiteren sozialen Umfeld
![Page 22: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/22.jpg)
Seite 22
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 22 von 41
[ibrp.pdf]
durchgegangen werden und dann die wichtigen Personen, deren Unterstützung für die
angestrebten Ziele wichtig sind, benannt werden. Wenn irgend möglich sollten diese
Personen nicht mit vollständigem Namen, sondern nach ihrer Funktion für die Klienten
in den Übersichtsbogen eingetragen werden (Datenschutz!).
3. Besondere Fähigkeiten in den Lebensfeldern. Auch hier wird kurz in freiem Text
schildern. Als Anleitung für das Gespräch können die Items der nächsten Spalte
„Beeinträchtigungen“ dienen. Beim Ausfüllen dieser Spalte empfi ehlt es sich, zunächst
ein Beiblatt zu verwenden und dann erst in einem zweiten Schritt nur die wichtigen
Punkte und Unterstützungsleistungen für das Erreichen der Ziele im vereinbarten Zeit-
raum in den Bogen einzutragen:
• Selbstsorge,
• Arbeit und Beschäftigung,
• Tagesgestaltung und Teilnahme am öffentlichen Leben.
Hier soll benannt werden, über welche stützenden Fähigkeiten und Ressourcen die
Klienten verfügen. Treten hier unterschiedliche Einschätzungen von Klient und Mit-
arbeiter auf, müssen diese auch getrennt dokumentiert werden. Auch hier sind in den
Übersichtsbogen für die Planung der Hilfen hauptsächlich die Fähigkeiten und Res-
sourcen festzuhalten, die im Hinblick auf die Ziele und gewünschte Lebensform gegen-
wärtig bedeutsam sind.
Das wollen wir im Folgenden an einem neuen Fallbeispiel üben:
Beispiel: Herr Weber ist 54 Jahre alt und frühberentet. Er ist gerade aus einer betreuten Wohngruppe ausgezogen und lebt jetzt allein in einer winzigen 2-Zimmer-Wohnung in einer Kleinstadt. Herr Funk
– ein Sozialpädagoge – hat ihn bisher betreut. Er will in die Weiterführung der Betreuung seine neue Kollegin mit einbinden. Er berichtet ihr kurz in der Teambesprechung: Herr Weber führt sein aktuelle Befi nden stets auf seine psychiatrische Erkrankung zurück, seine Berentung ist dabei für ihn über-zeugender Beweis. Er fi ndet sich sehr unattraktiv und hat wenig Selbstwertgefühl. Er lebte auch in der Wohngemeinschaft sehr zurückgezogen und ging Konfl ikten aus dem Weg.
Herr Weber trinkt gerne Bier und raucht viel und gern, was in der Wohngruppe eine ständige Quelle von Ärger mit den nicht rauchenden Mitbewohnerinnen war. Er kann derzeit nicht selbst kochen, weil der Herd in der neuen Wohnung noch nicht angeschlossen ist. Tagsüber hält er sich oft in der Stadtbücherei auf, wo er aktuelle Zeitschriften und Tageszeitungen liest.
Frage:
„Wenn Sie die neue Kollegin wären: Was würden Sie bei diesen Informationen
nachfragen, um die Fähigkeiten von Herrn Weber herauszufi nden und in den
Bogen eintragen zu können?
![Page 23: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/23.jpg)
Seite 23
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 23 von 41
[ibrp.pdf]
Sehen Sie ein Beispiel-Video des ersten Treffens von Herrn Weber
mit der neuen Kollegin Frau Schmitt.
Bitte kreuzen Sie jeweils an, um wel-chen Typ Frage es sich handelt:
Die Frage ist geeignet, um Fähigkeiten herauszufi nden
Die Frage ist neutral: sie ist geeignet Informationen her-auszufi nden mit denen wie-derum Fähigkeiten herausge-funden werden können
Die Frage fi n-det nur Pro-bleme, keine Fähigkeiten heraus
Was haben die früheren Mitbewohne-rinnen an Herrn Weber geschätzt?
Wie sollte für Herrn Weber ein attrak-tiver Mann aussehen?
Trinkt Herr Weber in der neuen Woh-nung mehr?
Erkennt Herr Weber selbst, wenn es ihm schlechter geht?
Hat Herr Weber schon mal selbst gekocht?
Wie beschafft Herr Weber das Geld für sein starkes Rauchen?
Meldet sich Herr Weber, wenn er Hilfe braucht?
Wie verhält sich Herr Weber in Konf-likten?
Was hat Herr Weber früher berufl ich gemacht?
Wie hat Herr Weber den Mut aufge-bracht, umzuziehen?
Welche Probleme gab es bisher bei der Betreuung?
Trinkt Herr Weber in der neuen Woh-nung mehr?
Mit wem spricht Herr Weber in der Stadtbücherei?
Was ist für Herrn Funk angenehm in der Betreuung von Herrn Weber?
Wie oft am Tag / in der Woche ver-lässt Herr Weber seine Wohnung und für was?
Fähigkeiten neutral Probleme
Die Lösung fi nden Sie zur Kontrolle unter downloads, Lösungen.
An dieser Übung ist Ihnen deutlich geworden, das viele Fähigkeiten von Klientinnen
und Klienten erst herausgefunden werden müssen. Fragen ist gut, aber noch besser ist
es, sie auch so zu stellen, das Sie und ihre Klientin / ihr Klient eigene Fähigkeiten dabei
entdecken können.
![Page 24: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/24.jpg)
Seite 24
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 24 von 41
[ibrp.pdf]
Dabei hilft die grundsätzliche Vorstellung, die Lebensumstände als nicht nur erdul-
det, sondern auch als aktiv hergestellt zu betrachten. (Konstruktivismus). Zum Beispiel
können Sie die schlechte Angewohnheit, täglich mehr als 8 Stunden Fernzusehen auch
als Fähigkeit betrachten, 8 Stunden das furchtbare Programm zu ertragen.
Diese „Umdeutung“ macht nur Sinn, wenn sie Handlungsmöglichkeiten für Klien-
ten im Hinblick auf ihre Ziele erschließt. Anderenfalls ist diese Übung in „fl exiblem“
Denken schlicht nur zynisch.
Anleitung zur Spalte
„Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“
Bevor Sie jetzt die nächste Spalte im IBRP bearbeiten, sollten Sie
sich das Manual Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen
ausdrucken. Diese Spalte besteht aus ankreuzbaren Items, und deren
Bedeutung wird im Manual nochmals deutlich erklärt.
Die generellen Leitfragen für die Teilbereiche I und II lauten (Grundlage ist das
Manual):
• Für den Teilbereich I (Beeinträchtigungen/Gefährdungen durch die psychische
Erkrankung): Welche Beeinträchtigung der subjektiven Befi ndlichkeit durch die
psychische Erkrankung ergibt sich für die psychisch kranke Person in bezug auf
... (von a) „Angst“ bis m) „Störendes, fremdgefährdendes Verhalten“)?
• Für die Teilbereiche II und III (Fähigkeiten, Fähigkeitsstörungen und Beein-
trächtigungen ...): Verfügt die Klientin /der Klient über die erforderliche
Fähigkeit zu einer eigenständigen Bewältigung der in dem jeweiligen Teil-
bereich (11 und 111) genannten Anforderung im Hinblick auf die angestrebte
Lebens- und Wohnsituation oder ist er bzw. wäre er auf sich allein gestellt, also
hinsichtlich der Bewältigung dieser Anforderungen beeinträchtigt.
Zwischen I, II und III sind „Kreisfragen“ möglich und sinnvoll wie: Welche Auswir-
kungen hat zum Beispiel das stark ausgeprägte halluzinatorische Erleben (I d) auf die
Sicherstellung der Ernährung (III a) im engeren Wohn- und Lebensbereich (II a)?
Generell ist wichtig: Es sollen nicht auf der Basis schon geleisteter Hilfe die Fähig-
keiten, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen betrachtet werden, sondern die
Ausgangsfrage lautet vielmehr: „Sie haben sich entschieden in einer eigenen Wohnung
zu leben und erhalten keine Unterstützung. Sagen Sie mir bitte, welche Unterstützung
Sie brauchten, um so leben zu können.“
Es geht also nicht (nur) darum, zu erfragen, ob zum Beispiel „störendes Verhalten“
vorhanden ist, sondern wesentlich eher darum, ob und wie dieses Verhalten und Erle-
ben subjektiv beeinträchtigt/beeinträchtigend wirkt.
Insbesondere vor Bearbeitung des Themenkomplexes dieser Spalte ist es notwen-
dig, sich gut vorzubereiten, die Fragen sich „klientengerecht“ „auf die Zunge zu legen“.
Hierzu können eigene Ausarbeitungen hilfreich sein. Die entsprechenden Formulierun-
gen zu erarbeiten ist eine Frage der Übung.
![Page 25: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/25.jpg)
Seite 25
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 25 von 41
[ibrp.pdf]
Frage- und Betrachtungshintergrund ist die aktuelle oder die ange-
strebte Lebenssituation.
Dies bedeutet: Wenn – wie in unserem ersten Fallbeispiel Frau Mauer – ein Umzug
ansteht, ist es sinnvoll, etwa die Beeinträchtigungen der Selbstversorgung auf dem Hin-
tergrund der neuen eigenen Wohnung einzuschätzen. Es ist nicht sinnvoll, von der Situ-
ation auf der psychiatrischen Station auszugehen, bei der etwa die Fähigkeit, sich selbst
gut zu ernähren, durch die Zentralversorgung und Stationsroutine sichergestellt ist.
Die Stufung der Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen sollen ausschließlich
einen ersten Hinweis auf die Rangfolge und die Gewichtung der jeweiligen Aspekte
geben. Dabei ist festzuhalten, dass eine hohe Beeinträchtigung nicht zwangsläufi g
einen hohen Hilfebedarf nach sich zieht. Die Stufungen geben in ihren Ausprägungen
eine Orientierungshilfe und können als Grundlage dienen, um vorrangige Hilfeziele zu
formulieren.
Abstufung der Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen:
0 keine Beeinträchtigung vorhanden
1 leichte Beeinträchtigung vorhanden
2 ausgeprägte Beeinträchtigung vorhanden
3 stark ausgeprägte Beeinträchtigung vorhanden
Übung zum Übersichtsbogen, Spalte „Beeinträchtigungen“
Bitte wählen Sie sich insgesamt vier Items aus mindestens 2 ver-
schiedenen Bereichen (I. Beeinträchtigungen/Gefährdungen durch die
psychische Erkrankung II. Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen
bei Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen und III. Fähigkeitsstö-
rungen und Beeinträchtigungen in den Lebensfeldern) aus.
Formulieren sie dazu jeweils eine Einstiegsfrage oder eine Formulie-
rungen für ein Gespräch mit einer Klientin oder einem Klienten.
Ausfüllen der Spalte „Hilfen“
Vorab eine Warnung: Die Missachtung des ehernen Grundsatz „Nicht jede Beein-
trächtigung löst eine psychiatrische Hilfe aus“ ist meist schon unmittelbar auf dem
Übersichtsbogen zu erkennen: Fein säuberlich wurde hier jede Spalte ausgefüllt und
fast mit derselben Wertigkeit wie bei der Spalte der Beeinträchtigungen versehen. Als
Grundlage von Fallkonferenzen sowie zur Arbeitsteilung und Koordination sind solche
Vorlagen nicht zu verwenden. Deshalb ist in der neuen Version des IBRP die Stufung
nicht mehr gleich gewichtet : die Intensität der Hilfen soll jetzt mit a) wenig bis d) viel
Hilfe eingeschätzt werden, damit nicht automatisch die Wertigkeit von der Beeinträch-
tigung auf die Hilfe übertragen werden kann.
Es gibt eine „Faustregel“ bei der Einschätzung von Hilfen: „Vorsicht bei insge-
samt vielen kompensatorischen Hilfen (ankreuzen von c und d), denn die Gefahr
der Überversorgung und der „erlernten Hilfl osigkeit“ ist zu bedenken. Was
ist nötig, damit die Klientin bzw. der Klient selbst Erfahrungen machen kann?
Bei zu vielen fördernd-trainierenden Hilfen ist die Gefahr der Überforderung zu
bedenken. Was kann eine Klientin bzw. ein Klient „verkraften“?
![Page 26: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/26.jpg)
Seite 26
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 26 von 41
[ibrp.pdf]
Die Vielzahl der Möglichkeiten im Manual psychiatrischer Hilfen ist zunächst mit der
Brille der erarbeiteten Ziele zu betrachten.
Hierzu ein Beispiel, das der Übersichtlichkeit wegen lediglich auf den Bereich II
„Fähigkeiten, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen bei der Aufnahme sozialer
Beziehungen“ bezogen ist.
Beispiel: Herr Weber hat mit Frau Müller von der psychiatrischen Ambulanz folgende Ziele besprochen: Er will in den nächsten sechs Monaten neben anderen Zielen seine Ängste vor anderen Menschen ange-hen, indem er zweimal in der Woche die Tagesstätte besucht und einmal in den Patientenclub geht.
Herr Weber lebt allein und hat keinen Kontakt mit Nachbarn.
Bei Fähigkeitsstörungen in der Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen ist hier angekreuzt: II a im engeren Wohn- und Lebensbereich (3), Partnerschaft und sonstige familiäre Beziehungen entfällt, und II d im Außenbereich (1/2).
Durch die Brille des „Zieles“ betrachtet, erschließt sich jetzt: Aktivierbare nicht psychiatrische Hil-fen derzeit keine; Bedarf an psychiatrischen Hilfen II a (c), d.h. individuelle Planung, Beobachtung und Rückmeldung bei Besuchen in der Wohnung, und II d (d) begleitende, übende Unterstützung.
Übung:
Holen Sie sich das Manual Hilfearten und Hilfeausprägungen aus dem
Downloadbereich und suchen Se sich die entsprechenden Hilfearten und Aus-
prägungen für 2a) und 2d) heraus.
Welche Hilfeausprägung würden Sie Herrn Weber zuordnen?
Konkret vereinbart wird dann, das Frau Müller und ein Mitarbeiter des Betreuten
Wohnens sich zweimal wöchentlich in der Wohnung mit Herrn Weber verabreden und
von dort zunächst mit in Tagesstätte und Patientenclub gehen.
Ohne die Ausrichtung an den Zielen würde ein „lineares“ Übertragen vom „Grad“
der Beeinträchtigung auf die Intensität der Hilfe zu nicht passenden Vorgehensweisen
führen.
Wenn Sie sich den Übersichtsbogen aber genau ansehen, gibt es vor den psychiatri-
schen Hilfen noch eine kleine zugehörige Spalte: nichtpsychiatrische Hilfen.
Hierzu jetzt einige Erläuterungen:
Umgang mit Netzwerken und allgemeinen sozialen Hilfen:
aktivierbare nichtpsychiatrische Hilfen
Grundsatz der Arbeit ist es, dass qualifi zierte sozialpsychiatrische Hilfen nur dann
und nur dort eingesetzt werden sollen, wo sie unabdingbar notwendig sind.
Folgende Einschätzungen spielen eine große Rolle:
• Welche Hilfepotenziale sind im unmittelbaren sozialen Umfeld (Angehörige,
Freunde, Psychiatrieerfahrene, Nachbarn, Vereine, Bürgerhelfer) gegeben?
• Welche Hilfen gibt es im Rahmen von Diensten und Einrichtungen aus der sozi-
alen und medizinischen Regelversorgung?
![Page 27: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/27.jpg)
Seite 27
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 27 von 41
[ibrp.pdf]
• Welche Hilfen existieren im Umfeld des Lebensortes (Kirchengemeinde, Läden,
Park, Schwimmbad etc.)?
Ich muss bei dem Vorrang dieser Hilfen immer bedenken, welche Unterstützung not-
wendig ist, damit diese Ressourcen den Klienten verfügbar sind bzw. bleiben.
Gerade bei Angehörigen und Freunden als wichtigste Netzwerkstützen sollten Mit-
arbeiter vorrangig deren Belastung einschätzen können. Wie ist derzeit die Beziehung
zu Angehörigen und Freunden, wie belastet (überlastet?) sind diese selbst? Die Stabi-
lisierung der Stützen eines Klienten gehört mit zum Herstellen von „Netzwerken“ und
den „direkt klientenbezogenen“ Tätigkeiten.
Es ist in der Regel immer eigener Einsatz nötig, um im Umfeld Dinge zu klären, zu
arrangieren, selbst wenn die Klienten nicht direkt begleitet werden. Dieser Umfang
ist bei den psychiatrischen Hilfen mit zu berücksichtigen. Häufi g sind die Mitarbeiter
jedoch so stark im professionellen Netzwerk eingebunden, das ihnen meistens zuerst
eine „psychiatrische“ Hilfe einfällt.
Warum fi ndet die Skatgruppe in der Tagesstätte statt und nicht in der Kneipe? Der
Vorrang nichtpsychiatrischer Hilfen ist „dokumentationspfl ichtig“ zu machen, etwa die
Begründung, warum die Skatgruppe nicht in der Kneipe stattfi ndet. Mitarbeiter statio-
närer und teilstationärer Einrichtungen haben im Beruf immer nur Kontakt zu anderen
Professionellen - etwa niedergelassenen Ärzten oder Sozialarbeitern. Aus dieser „Ver-
trautheit“ mit Behörden und Diensten geht manchmal der Blick auf scheinbar „unpro-
fessionelle“ Hilfen verloren. Ob ich einer Klientin des Besuch der Tagesstätte vor-
schlage oder diese täglich mit dem Hund der erkrankten Nachbarin losschicke, macht
für die Einbindung in soziale Netze einen großen Unterschied.
Kollegen und Kolleginnen sozialpsychiatrischer Dienste können hier ein wichtiges
„Wächteramt“ wahrnehmen, indem sie bei ihrer Teilnahme an der Fallkonferenz - man-
cherorts auch Gutachterfunktion - auf dem Vorrang nichtpsychiatrischer Hilfen beste-
hen.
Hilfreich ist ebenfalls, wenn das Wissen und die Kontakte der unterschiedlichen
Berufsgruppen und Altersgruppen im Team systematisch zusammengeführt werden.
Auch die Ressourcen, die durch Mitarbeiter persönlich erschlossen werden können
(private Kontakte zu potenziellen Praktika, Mitgliedschaft in Sportgruppen u.Ä.) sind
hier von hoher Bedeutung für die „Normalisierung“ der Lebensverhältnisse.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an unser Fallbeispiel Herr Weber. Welche Möglich-
keiten nichtpsychiatrischer Hilfen fallen Ihnen für einen alleinlebenden Mann
ein, der gerne mehr Kontakte hätte, aber große Schwierigkeiten hat, Kontakte
aufzunehmen?
Bitte tragen sie alles an Möglichkeiten zusammen und schätzen Sie ein, was Sie
Menschen in der Umgebung zumuten können und wie viel Unterstützung von Ihnen
für solche Kontakte nötig sind.
Sehen Sie sich dazu noch einmal das Beipsielvideo an.
![Page 28: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/28.jpg)
Seite 28
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 28 von 41
[ibrp.pdf]
Bündelung der Hilfen
Wie die so erarbeiteten Hilfen zu bündeln sind, ist dann der zweite Schritt.
Wenn ich einen Patienten besuche, sehe ich und spreche ich darüber, wie es ihm
geht. Ich begleite ihn beim Einkaufen und spreche mit ihm bzw. helfe bei der Bewälti-
gung seiner Ängste, bei der Ernährung, beim Geldeinteilen und überprüfe gleichzeitig,
ob die verabredete Koordination der Hilfen gelingt.
Ich erledige also viele Dinge - etwa bei einem Hausbesuch - gleichzeitig.
Der Inhalt meines Hausbesuches ist aber vielschichtig und situativ bestimmt und
erschließt sich erst, wenn ich vorher (Planung: An was muss ich heute denken?) oder
hinterher genau darüber nachdenke.
„Gute“ Klientenkontakte und gelungene berufl iche Beziehungsaufnahmen leben
von der Fähigkeit, Kontakte spontan und authentisch zu gestalten, ohne professionelle
Aspekte auszublenden. Beziehungsarbeit scheint sich den Einschätzungen von Bedarf
(Mitarbeiterwahrnehmung) und Bedürfnis (Klientenwahrnehmung) zu entziehen, und
deshalb ist es wichtig, Hilfen in Hinblick auf Ziele zu defi nieren.
Ich bin also jetzt aufgefordert, die erforderlichen Hilfen zusammen mit den Klien-
ten zu benennen und zu bündeln. Eine Möglichkeit ist, die Ziele zu nummerieren und
danach diesen den angekreuzten Bedarf an Hilfen zuzuordnen. Eine andere Möglich-
keit ist es, vom Vorgehen her zu überlegen: Wer sollte was machen, was lässt sich gut
gemeinsam erledigen? Dafür muss ich wissen: Was kann ich, was kann mein Dienst,
meine Einrichtung leisten, was können andere?
Als einen Vorlauf zu individueller Hilfeplanung ist es sinnvoll, wenn ein Team sich
das eigene Angebotsspektrum erarbeitet. Um konkrete Arbeitsteilung mit Kolleginnen
und Kollegen anderer Teams zu verabreden, bin ich zukünftig auch als Makler meiner
Fähigkeiten, der Fähigkeiten meiner Kollegen und der Einschätzung der strukturellen
Bedingungen unseres Teams tätig.
Folgende Überlegungen helfen hierbei:
• Was ist die Struktur der Tagesstätte bzw. der Wohnheimarbeit und was kann ich
dabei alles individuell machen?
• Welche „Strukturen“ eignen sich für was (z.B. kann auch beim vereinbarten
gemeinsamen Wohngemeinschaftskochen durchaus etwa individuelle Beratung
zu einem ganz anderen Thema geleistet werden).
Ich muss abschätzen können, wie viel meiner Arbeitszeit insgesamt durch Wegezeiten,
Teambesprechungen, Dokumentation und Arbeitsstrukturen gebunden ist, um indivi-
duelle Vereinbarungen zu treffen oder individuelle Hilfen in die vorhandene Struktur
einzupassen.
Hier gibt es zwei Leitfragen (Grundlage ist das Manual):
1. Welche nichtpsychiatrische Hilfen können beim Erreichen der Ziele nützlich sein
(Vorrang)?
2. Welche psychiatrischen Hilfen sind zur Erreichung der Ziele notwendig?
Zur Klärung dieser Fragen ist der Zeitraum der Hilfeplanung unbedingt zu berück-
sichtigen.
![Page 29: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/29.jpg)
Seite 29
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 29 von 41
[ibrp.pdf]
Die Abstufungen im Bereich des Bedarfs an psychiatrischen Hilfen beinhalten
quantitative und qualitative Elemente und sind als Anregungen für die Planung der
konkreten Durchführung zu verstehen. Die Stufung des Bedarfes an nicht psychiatri-
schen Hilfen kann Hinweise geben, ob und wie viel an erhaltender und stützender Akti-
vität durch psychiatrische Fachkräfte nötig ist.
Dies gilt genauso für die Stufung der psychiatrischen Hilfen. Sie gibt dann auch
Hinweise bezüglich Schwerpunktsetzungen.
Im Gegensatz zum vorherigen spaltenweisen Vorgehen soll jetzt bereichsweise
(quer) im Zusammenhang mit den Spalten 3 und 4 vorgegangen werden.
Nach Bearbeitung der Spalte „Hilfen“ sollten noch einmal die Angaben der ersten
vier Spalten betrachtet werden. (Etwa: Es wurde ein sehr hoher und umfangreicher
Bedarf an psychiatrischen Hilfen bei „Ernährung“ genannt, Ernährung wurde aller-
dings nicht als Problem und nicht als Ziel defi niert.) Es geht also auch hier wiederum
um mögliche Vervollständigungen.
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit der Beschreibung der Stufung diese hier noch-
mals in großzügigerer Aufteilung:
Aktivierbarkeit, Verfügbarkeit nicht psychiatrischer Hilfen
0 keine Hilfen / Hilfspotentiale vorhanden
a geringe Hilfen / Hilfspotentiale vorhanden
b wesentliche entlastenden Hilfen / Hilfspotentiale vorhanden
Abstufung der Hilfearten und Hilfeausprägungen
bezogen auf den Bedarf an psychiatrischen Hilfen
0 keine Hilfen notwendig
a Information und Beratung notwendig
b Erschließung, Erhaltung von Hilfen im Umfeld nötig
c individuelle Planung, Beobachtung, Rückmeldung notwendig
d begleitenden, übende Unterstützung notwendig
e regelmäßiges, intensives individuelles Angebot notwendig
Anleitung zur Spalte: „Vorgehen“
Die Frage lautet: Welche fachliche Vorgehensweise ist notwendig bzw. sinnvoll, um die vorher genannten Ziele unter Berücksichtigung:
• der vorhandenen und verfügbaren Fähigkeiten,
• der bestehenden Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen,
• der (aktivierbaren) nichtpsychiatrischen Hilfen sowie
• des genannten Bedarfes an psychiatrischen Hilfen erreichen zu können?
Generell ist wichtig: Die Bedeutung und Aufgabe von fachlicher Planung wird häufi g
unterschätzt. Wie eine Fachkraft Planung „macht“, hängt auch von persönlichen Stilen
und Vorlieben ab. Auf alle Fälle ist in ausreichend kleinen Schritten vorzugehen, um
alle Aspekte zu berücksichtigen und um dann zu „Zusammenfassungen“ zu kommen.
![Page 30: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/30.jpg)
Seite 30
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 30 von 41
[ibrp.pdf]
Eine Möglichkeit ist, vom Allgemeinen zum Besonderen zu gehen, um so zu Zusam-
menfassungen zu kommen. Ein Beispiel:
1. Es hat sich herausgestellt, dass, um in einer eigenen Wohnung leben zu können,
fachpsychiatrische Hilfen notwendig sind.
2. Diese allgemeinste Ebene wird „zerlegt“ und fortgeführt unter anderem in: Es
hat sich weiterhin herausgestellt, dass dazu Hilfen zur Sicherstellung der Ernäh-
rung notwendig sind.
3. Dieses wiederum wird „zerlegt“ etwa in: Auf Grund einer starken Beeinträchti-
gung durch Ängste und Vergiftungsideen kommt momentan für das Mittagessen
ausschließlich selbst zubereitetes Essen in Frage. Beim Einkauf und Zubereiten
sind häufi ge Rückversicherungen bei einer psychiatrischen Fachkraft notwendig.
Fachliche Mittel dafür sind: Begleitung beim Einkauf, Dabeisein beim Zuberei-
ten und Essen, Nachbesprechung.
4. Folgende „Zusammenfassungen“ sind denkbar: Da Hausbesuche sinnvoll sind,
können dabei noch eventuell andere Dinge, die „hineinpassen“, mit besprochen
werden. Die auch in anderen Lebensbereichen durch Ängste und Vergiftungs-
ideen beeinträchtigte Person wünscht weiterhin diesbezüglich „aufarbeitende“
Unterstützung, zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie oder im Rahmen
einer psychoedukativen Gruppe.
5. Der Umfang (Anzahl der Treffen, Zeit pro Woche) der geplanten Hilfe ist festzu-
legen. Bei der Planung des Vorgehens ist zu unterscheiden zwischen:
• einer Einzelleistung, wie zum Beispiel einem therapeutischen Gespräch und
• einer Bündelung von Maßnahmen wie der unterstützenden Begleitung beim
Einkauf und dabei integrierter Beratung etwa bezüglich der Einteilung des Gel-
des, der Ernährung und Zuordnung zu einem Leistungsbereich (siehe hierzu AS
7 b). Für die Detailplanung ist es sicherlich notwendig, diese gesondert festzu-
halten.
In der Spalte 7 werden nur die zusammengefassten Ergebnisse der Planung dokumen-
tiert. Bei der fachlichen Haltung geht es hier immer um ein Verhandeln statt Verordnen.
Klare, überschaubare Zielsetzungen erleichtern das Ausfüllen dieser Spalte erheblich.
Anleitung zur Spalte: „Erbringung durch ...“
Hier lautet die generelle Frage, von wem welche Leistung in welchem Zeitraum
erbracht werden soll.
Zu benennen sind die Mitarbeiter, die konkret die vereinbarte individuelle Hilfe-
leistung erbringen werden, und zwar mit dem Namen ihrer Organisationseinheit, ihrer
Einrichtung, ihres Dienstes. Dies bezieht sich auf alle, auch die im Bereich nichtpsych-
iatrischer Hilfen eingeplanten Unterstützungsleistungen.
Um zu entscheiden, wer sinnvollerweise bestimmte Leistungen erbringt, ist neben
den Wünschen der Klienten die Verfügbarkeit und die funktionale Zuordnung („Für
was ist das wichtig?“) entscheidend.
![Page 31: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/31.jpg)
Seite 31
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 31 von 41
[ibrp.pdf]
Bitte lesen Sie jetzt den im Downloadbereich liegenden
Begleittext Gemeindepsychiatrischer Verbund und funktionale
Leistungsbereiche durch.
Leistungsbereiche des Gemeindepsychiatrischen Verbundes –
Hilfen für die Zuordnung
Die Zuordnung zu Leistungsbereichen ist notwendig, wenn mit dem IBRP Zeitbe-
messung und damit die Bildung von Gruppen vergleichbarer Hilfebedarfe (nach § 93
BSHG) vorgenommen werden soll.
Diese Zuordnung ist ein notwendiger Zwischenschritt zur Zuordnung von Minuten-
werten. Sie haben bereits den Begleittext gelesen. Dennoch kommt es zu Beginn des
Verfahrens manchmal zu Zuordnungsproblemen.
Wichtig für eine erfolgreiche und überprüfbare Zuordnung ist zunächst, gedanklich
nochmals zwischen den Hilfezielen und dem Vorgehen zu unterscheiden. Entscheidend
für die Zuordnung ist das Hilfeziel. Der entscheidende gedankliche Zwischenschritt
betrifft die Frage: Wofür ist das vereinbartes Vorgehen hilfreich?
Die Zuordnung nach Leistungsbereichen ist dementsprechend funktional zu
begründen.
Wenn man von den Hilfezielen ausgeht, fällt es wesentlich leichter, sich die „fi nale
Betrachtungsweise“ anzueignen und zu einer Zuordnung zu kommen. Zu Beginn fällt
die Unterscheidung oft schwer, wenn es um die Zuordnung zwischen Leistungsberei-
chen wie Tagesgestaltung oder Arbeit geht.
Hierzu ein Beispiel: Vereinbart ist die Unterstützung einer Klientin bei ihrem
Hobby, der Blumenpfl ege. Ohne die Betrachtung der vereinbarten Ziele ist die Zuord-
nung hier ganz eindeutig: Leistungsbereich Tagesgestaltung. Ist auch das Hilfeziel der
Tagesstruktur zuzuordnen, bleibt es dabei.
Ist jedoch als Ziel vereinbart, die Blumenpfl ege in der Tagesstätte zu überneh-
men oder die Fähigkeiten in Hinblick auf ein Tätigwerden im Bereich Floristik – sei
es auch nur ehrenamtlich – auszubauen, so wäre diese Leistung dem Bereich Arbeit/
Beschäftigung zuzuordnen.
Die methodische Regel lautet: Zuordnungen zu den Leistungsbereichen immer nach
fi nalen Gesichtspunkten (Für was soll das gut sein?) zu begründen; das erleichtert eine
Abstimmung in den Fallkonferenzen enorm. Hintergrund dieser Regel ist die Erkennt-
nis, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehender Dienste und Einrichtungen Leis-
tungen aus verschiedenen Bereichen erbringen. Das Verfahren des IBRP erkennt dies
an und versucht die bestehende Flexibilität von Mitarbeitern für die Kontinuität der
Begleitung von Klientinnen und Klienten nutzbar zu machen.
Noch einmal: Die ungewohnte Perspektive funktionalen Denkens fragt nach dem
Ziel bzw. der Absicht der Hilfeleistung.
Die bestehende Angebotsorientierung hat die Überlegungen „Für was ist das bei
Frau X gut?“ bisher überfl üssig gemacht. Im Wohnheim gab es nun mal eine Gesangs-
gruppe, die Arbeitsmotivation wurde in der Tagesstätte angebahnt und im Arbeitstrai-
ningsbereich der Werkstatt gefördert.
![Page 32: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/32.jpg)
Seite 32
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 32 von 41
[ibrp.pdf]
Die Frage nach der Funktion der Hilfen, nach der Zuordnung zu Leistungsbe-
reichen, macht die Angebotsprofi le von Einrichtungen und Diensten fl exibler und
bietet neue Möglichkeiten.
Zeiteinschätzung der Hilfen
Die Umsetzung bis zu einer Zeiteinschätzung ist erfahrungsgemäß am schwierigsten.
Hilfen für die Einordnung in Zeitstufen
Voraussichtlich wird es in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Rege-
lungen für die Einordnung in Zeitstufen geben.
Unabhängig von den länderrechtlichen Regelungen sind jedoch folgende metho-
dische Hilfen für die Zuordnung von vereinbarten Hilfen zu Zeitstufen wichtig: Alle
direkt klientenbezogenen Leistungen müssen hinsichtlich ihres durchschnittlichen
wöchentlichen Zeitaufwands berücksichtigt werden. Dieser Schritt wird in der Praxis
nicht immer einfach sein. Er bedeutet, die im vorigen Schritt besprochenen und mit den
Beteiligten ausgehandelten Leistungen auf eine der Zeitstufen zu beziehen. Die Betei-
ligten müssen sich auf einen durchschnittlichen wöchentlichen Zeitwert verständigen.
Dabei sind Schwankungen - soweit sie einzuschätzen sind - zu berücksichtigen und auf
einen Mittelwert zu beziehen. Mit den Zeitstufen werden die voraussichtlich erforderli-
chen direkt klientenbezogenen Leistungen in dem jeweiligen Leistungsbereich erfasst.
Zu den direkt klientenbezogenen Leistungen gehören: alle Kontakte mit dem Klien-
ten, alle Tätigkeiten, die nur für diesen Klienten stattfi nden (Kontakte zum rechtlichen
Betreuer, zu Nachbarn, zu Angehörigen, zu Behörden), Vor- und Nachbereitung von
Kontakten, Fallbesprechungen, Helferkonferenzen, Dokumentation, das Verfassen von
Berichten, Fertigung von Anträgen und Schreiben sowie die Wegezeiten, die regelmä-
ßig anfallen werden. Bei der derzeitigen durchschnittlichen Arbeitszeit von 38,5 Stun-
den pro Woche kann man jetzt die Jahresarbeitszeit abzüglich Urlaub, durchschnittli-
chen Krankheitstagen und Fortbildung abziehen. Wieder auf wöchentlich verfügbare
Arbeitszeit berechnet, kommen dabei ca. 31 Stunden durchschnittlich verfügbarer
Arbeitszeit heraus.
Nicht mitzurechnen bei einer Einschätzung direkt klientenbezogener Leistungen
sind die Zeiten, die nur indirekt für den Klienten anfallen. Als diese defi nieren die
Leistungstypbeschreibungen zum Beispiel: Teambesprechungen und Büroorganisa-
tion, allgemeine Dokumentation, Supervision, Teilnahme an der PSAG und anderen
Fachgruppensitzungen, Außendarstellung bzw. Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung,
Kontakte zu anderen Einrichtungen. Hierzu gehören auch Zeiten für Fortbildungen etc.
Diese Tätigkeiten sind aus Erfahrung mit etwa 7-9 Stunden wöchentlich anzusetzen.
Ein durchschnittlicher Mitarbeiter ist also 22-24 Stunden direkt klientenbezogen tätig.
Die Zeitstufen gehen von einem unmittelbaren Zeitaufwand eines Betreuers für
einen Klienten aus. Bei allen Maßnahmen, Leistungen oder Tätigkeiten, die ein
Betreuer mit mehreren Klienten zusammen erbringt oder verrichtet, muss der Zeit-
aufwand des einzelnen Klienten durch die Zahl der Klienten geteilt werden. Wird eine
Gruppenveranstaltung benötigt, an der durchschnittlich mehrere Klientinnen und Kli-
enten teilnehmen (z.B. ein Gruppengespräch in einer Wohngruppe oder eine Veranstal-
tung in einer Tagesstätte), ist der Zeitbedarf der Klienten durch diese Gruppengröße zu
teilen. Nehmen mehr als eine Fachkraft an der Gruppenaktivität teil, so ist der Zeitauf-
wand mit der Zahl der notwendig anwesenden Gruppenleiter zu multiplizieren.
![Page 33: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/33.jpg)
Seite 33
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 33 von 41
[ibrp.pdf]
Ist etwa in einer Wohngruppe (vier Bewohner) zweimal wöchentlich ein Gruppen-
gespräch vereinbart, das jeweils 60 Minuten dauert (zusammen dann 120 Mitarbei-
terminuten), so sind für den einzelnen Bewohner 30 Minuten einzurechnen. Nehmen
immer zwei Mitarbeiter teil, so sind 60 Minuten dafür einzusetzen.
Der Zeitaufwand für beaufsichtigende Leistungen während des Tages (Anwesen-
heitsbereitschaft), d.h. die ständige Anwesenheit einer Fachkraft in der Einrichtung,
wird nicht in personenbezogenen Zeitstufen berücksichtigt, sondern mittels eines
Zuschlags; dies gilt ähnlich für Nachtbereitschaften.
Der Bedarf an diesen Bereitschaften ist auf die Person bezogen in der Begutachtung
festzuhalten. Ähnlich ist die Erfordernis von Nachtwachen zu verhandeln und zu ver-
einbaren.
Neben diesen grundsätzlichen Hilfen ist zunächst zu berücksichtigen, dass der hier
geforderte Blickwinkel, nämlich die Einschätzung der Leistungen für einen Klienten
in Zeiteinheiten, ganz ungewohnt ist. Die gängigen „Personalschlüssel“ (etwa 1:8) sind
aber grundsätzlich auch nichts anderes. Ein Personalschlüssel – auf der Grundlage der
errechneten klientenbezogenen Arbeitszeit – sagt genauso aus, wie viel Zeit für einen
Klienten durchschnittlich pro Woche zu Verfügung steht.
Bei den häufi g vorkommenden Schlüsseln 1:4 bedeutet dies etwa sechs Stunden
wöchentlich, bei 1:8 drei Stunden und bei 1:12 zwei Stunden wöchentlich, die direkt
klientenbezogen eingesetzt werden können.
Auch heute schätzt zum Beispiel ein Klinikarzt ein, ob der Klient viel (d.h. in der
Regel eine 1:4-Betreuung im Wohnheim) oder wenig (z.B. eine 1:12-Betreuung im
Betreuten Wohnen) brauchen wird.
Wir sind nur gewöhnt, diese Zeiten mit festen Angebotsstrukturen zu verbinden,
und beziehen unsere Erfahrungswerte auf diese Angebotspakete.
Erfahrungsgemäß ist gerade bei Menschen mit Psychiatrieerfahrung nicht von
einem zeitlich immer gleichen Hilfebedarf zu sprechen. Es ist also eine durchschnitt-
liche Einschätzung gefragt. Auch derzeit ist es so, dass die zeitlich unterschiedlichen
Bedarfe sich bei mehreren Hilfeempfängern und einer bestimmten Teamgröße unterei-
nander ausgleichen. Geht der dokumentierte Aufwand jedoch deutlich über den einge-
schätzten Zeitbedarf hinaus, ist eine Neubewertung und damit verbunden eine Verän-
derung der Hilfeplanung vorzunehmen.
Die Umrechnung in wöchentliche „Zeiten“ statt in Schlüssel hat einen großen Vor-
teil: Die Klientinnen und Klienten wissen, welcher Zeitaufwand abgesprochen wurde,
sie können sich an der weiteren Einschätzung und Bewertung beteiligen.
Die zutreffende Einschätzung von Zeitbedarfen ist auch eine Frage der Erfahrung,
und diese Übung entsteht nicht nur durch Gewöhnung, sondern auch durch die Doku-
mentation der direkt für Klienten geplanten und durchgeführten Zeiten.
Als Hilfe bei der Einführung personenbezogener Zeitbemessung ist es sehr nützlich,
sich im Team einer Einrichtung oder eines Dienstes die bisherige Zeiteinteilung der
Arbeitswoche zu verdeutlichen.
• Welche sind die direkt klientenbezogenen Tätigkeiten?
• Wie sind diese auf einzelne Klienten pro Woche zu berechnen?
![Page 34: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/34.jpg)
Seite 34
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 34 von 41
[ibrp.pdf]
• Wie können diese auf einer Skala von 1 Stunde pro Woche (kleinste Zeiteinheit,
die sinnvoll ist) bis zu 16 Stunden pro Woche (mehr wird wohl im Rehabilitati-
onsbereich direkt klientenbezogen nicht geleistet) eingeordnet werden?
Mit dieser „Vorübung“ ist es meist sehr viel einfacher, durchschnittliche wöchentliche
Zeitbedarfe für direkt klientenbezogene Tätigkeiten einzuschätzen.
Sind mehrere Dienste und Einrichtungen beteiligt, errechnet sich die Gesamtein-
schätzung durch Addition bzw. durch klare Aufteilung der auf den jeweiligen Träger
entfallenden Zeitstufen.
Die Aufteilung ist unter fachlichen Gesichtspunkten zu treffen. Es werden also
immer die tatsächlich notwendigen Tätigkeiten für einen Klienten hinsichtlich ihres
Zeitbedarfes im Leistungsbereich eingeschätzt. Werden diese – etwa zur Stärkung der
Kontinuität für eine Klienten – von zwei unterschiedlichen Trägern erbracht, müssen
diese aufgeteilt werden.
Dieses Verfahren ermöglicht neben einer Zeitbemessung natürlich auch die Planung
und Einschätzung von Kapazitäten einzelner Träger und der Region insgesamt.
Das Verfahren macht aber auch lediglich auf den jeweiligen Klienten bezogene
Abstimmungen möglich. Es gibt die Chance, fl exibel nach zweit- oder drittbesten
Lösungen zu suchen, wenn Kapazitäten erschöpft sind.
Hierzu folgender Lernfall Herr Weber:
Bitte tragen Sie zunächst das erste Mal direkt in den Ausdruck des Bogens A die fol-
genden Daten ein. Alternativ können Sie den bereits ausgefüllten Bogen mit den unste-
henden Daten im Downloadbereich herunterladen oder im Anhang des Buches fi nden.
Inhaltliche Begründung für die Zeitbedarfe:
Herr Weber hat derzeit die besten Kontakte zu der Mitarbeiterin der Institutsambu-
lanz, die ja auch die Koordination zunächst weiter übernimmt. Diese Mitarbeiterin ist
auch Leiterin der Clubnachmittage.
Da die Ärztin der Institutsambulanz die medizinisch-präventiven Aufgaben über-
nimmt, muss hier die höchste Zeitstufe (III) für ambulante sozialpsychiatrische Grund-
versorgung eingesetzt werden (ca. 20 Minuten pro Woche).
Herr Weber kennt Herrn Wagner seit etwa einem halben Jahr. Er hat mit ihm den
Umzug vorbereitet, Wohnraumgestaltung, Hilfen bei der Selbstversorgung und Gestal-
tung der Zeit wie die Motivation und Begleitung sind bei ihm „richtig“. Er soll perspek-
tivisch auch noch die Koordination übernehmen, Lebensfeld Selbstsorge mit Zeitbedarf
(V) und Tagesgestaltung mit (V) (zusammen ca. 80 Minuten pro Woche).
Aus der Kenntnis des bisherigen Betreuungsverlaufs ist anzunehmen, dass für die
Koordination – zumal nur zwei Dienste beteiligt sind – die geringere Zeitstufe ausreicht
(I) (ca. 10 Minuten pro Woche). Behandlungsplanung und Abstimmung sind ebenfalls
mit 15 Minuten pro Woche zu rechnen. Insgesamt kommen wir zu einem Komplexleis-
tungsprogramm J (134 bis 189 Min. pro Woche).
![Page 35: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/35.jpg)
Seite 35
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 35 von 41
[ibrp.pdf]
Qualitätskriterien
Woran kann frau /man jetzt einen „gut“ ausgefüllten IBRP-Übersichtsbogen erken-
nen?
A Ist der Bogen nur aus dem eigenen fachlichen Zugang (z.B. „Sozialpädagogen-
brille“) heraus ausgefüllt? Ist der Bogen nur aus der Sicht der eigenen Institution
(z.B. „Stations“ oder „Wohnheimbrille“) ausgefüllt?
B Sind die Informationen, die im Übersichtsbogen festgehalten wurden, auch alle
dem Klienten bekannt und dessen ggf. abweichende Sicht gekennzeichnet?
C Sind die Ziele wirklich konkret für den vereinbarten Zeitraum beschrieben?
Sind die Ziele mit der Klientin bzw. dem Klienten abgesprochen?
D Sind die Hilfen im Umfeld (nichtpsychiatrische Hilfen) und die Leistungen, die
erbracht werden müssen, um diese „tragfähig“ zu machen, mitbedacht?
E Sind die psychiatrischen Hilfen durchdacht angekreuzt (kein einfacher Übertrag
der Werte der Beeinträchtigungen)?
F Sind in der Spalte „Vorgehen“ die Hilfen schon sinnvoll gebündelt?
G Sind bei der Spalte „Erbringung“ gebündelte Hilfen so zugeordnet, dass von
einer sinnvollen Arbeitsteilung gesprochen werden kann?
H Ist die Koordination und Durchführung der Hilfen so verbindlich vereinbart,
dass eine Abstimmung im Verlauf möglich wird?
Sie haben jetzt den gesamten Übersichtsbogen einmal an verschiedenen Beispielen aus-
gefüllt. Es gibt jedoch noch eine ganze Reihe von methodischen Überlegungen, die den
Prozess der Hilfeplanung begleiten.
Auch diese Problemstellungen sollen sie noch ergänzend bearbeiten,
bevor Sie sich an ihre erste „echte“ Hilfeplanung wagen.
Der Klient will oder kann sich nicht beteiligen – was tun? Die bisherigen Erfahrungen sind ermutigend, denn: dieser Fall kommt selten vor.
Klientinnen und Klienten, die erfahren, das man sich bei den Gesprächen auf sie
einstellt, dass aus der Hilfeplanung für sie etwas herauskommt, sind zunehmend stär-
ker bereit, sich an dem Verfahren zu beteiligen (siehe hierzu den Beitrag von Woitas im
Downloadbereich).
Neben der sorgfältigen Beachtung der methodischen Ratschläge ist bei der Einfüh-
rung des Verfahrens auch der „Mut zur Lücke“ erforderlich: Es ist sinnvoll, zunächst
nur wenige Aspekte einzubeziehen, aber diese zu dokumentieren und Hilfen verbind-
lich zu verabreden. Der IBRP ist bewusst als Prozess zu verstehen, der mit jedem
Zyklus mehr an „Passsung“ erreicht.
![Page 36: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/36.jpg)
Seite 36
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 36 von 41
[ibrp.pdf]
Dennoch gibt es eine kleine Gruppe von betroffenen Menschen, die entweder der-
zeit nicht in der Lage sind, sich an ihrer Hilfeplanung zu beteiligen, oder die dies deut-
lich ablehnen.
Hier empfi ehlt sich zunächst, von den Klienten eine Person ihres Vertrauens benen-
nen zu lassen, mit der die Gespräche geführt werden. Ist auch das nicht möglich, ist der
bestellte Betreuer direkt bei der Erstellung zu beteiligen. Die entstandene Hilfeplanung
ist den Klienten unbedingt vor der Fallkonferenz bekannt zu machen, die Meinung zum
Plan muss eingeholt und dokumentiert werden!
Verständlich ist, das Menschen mit langen Hospitalisierungserfahrungen sich ableh-
nend verhalten. Das Ansetzen an Wünschen, die von Mitarbeitern vermutet werden,
und das zunächst spärliche Dokumentieren können ein Ansatzpunkt sein, Vertrauen zu
schaffen. Wenn alles nicht greift, kann es Sinn machen, die Bögen zunächst zur Seite
zu legen und für einen Zeitraum nur das zu vereinbaren, was an Betreuung in der jetzi-
gen Situation ohnehin für alle (Grundpauschale) geleistet wird.
Dies bedeutet dann auch, sich an diese meist wenigen Vereinbarungen zu halten
und darauf zu bestehen, dass alle darüber hinausgehenden Betreuungsleistungen über
gemeinsame Hilfeplanung vereinbart werden. An manchen Orten unterstützen auch
Heimbeiräte die Anwendung des Hilfeplanungsverfahrens und können zu einer Betei-
ligung im eigenen Interesse motivieren.
Neue Klienten im gemeindepsychiatrischen Netz
Zur Zielgruppe gemeindepsychiatrischer Hilfen gehören Menschen mit schweren
und/oder lang andauernden psychischen und Suchterkrankungen, auch in höherem
Lebensalter. Sie kommen entweder mit der üblichen ambulanten ärztlichen Betreuung
und/oder anderen ambulanten Angeboten in ihrem Lebensfeld nicht aus, bzw. kommt
ihr Lebensfeld mit den Belastungen nicht zurecht. Nicht jeder erst- oder wiederer-
krankte Mensch erhält gemeindepsychiatrische Hilfen, eine ganze Reihe kommt in
ihren Lebensfeldern zurecht.
„Neu im System“ sind aber nicht nur die ersterkrankten Menschen, die so schwer
erkrankt sind, dass sie nach ihrer stationäre Behandlung umfangreiche Hilfen benö-
tigen. Auch unterversorgte, allein oder bei überforderten Angehörigen lebende Men-
schen benötigen nach Krisen umfangreichere Hilfen. In verschiedenartigen Einrichtun-
gen wie allgemeinen Wohn- oder Altenheimen, Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
oder auch in der Obdachlosigkeit leben Menschen mit psychiatrischem Hilfebedarf.
Das bedeutet, dass die Koordination der Hilfen vorübergehend oder dauerhaft durch
eine begleitende therapeutische Bezugsperson nötig ist und zeitweise umfassendere
Hilfen für diesen Mensch zu erschließen sind.Eine Hilfeplanung für „Neue“ muss
zunächst schnell für einen kurzen Zeitraum erfolgen, d.h. für die nächsten drei Monate.
Ein vollständiges gemeinsames Bearbeiten der Bögen ist meist nicht möglich, der „Mut
zur Lücke“ bedeutet in dieser Situation:
• sich auf das Wesentliche konzentrieren, nur das festhalten, was gewusst, also
vom Klienten berichtet wird (nichts dazu erklären);
• keinen Verfahrensschritt auslassen, aber zum Beispiel beim Fähigkeits- oder
Beeinträchtigungsprofi l nur einige der im Vordergrund der Situation stehende
Items klären;
![Page 37: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/37.jpg)
Seite 37
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 37 von 41
[ibrp.pdf]
• Wenn keine Vorstellung zur gewünschten Lebensform vom Klient geäußert
wird, die aktuelle oder verfügbare Lebenssituation stabilisieren.
Wichtig ist, bei „neuen“ Klientinnen und Klienten sehr kurzfristig zu entscheiden, wer
zunächst die koordinierende Funktion übernimmt, die Fallkonferenz einberuft und
den vorläufi gen Hilfeplan abstimmt. Die Unterscheidung zwischen der Verantwortung,
dass Hilfeplanung geschieht, und dem Aufbau der Koordination durch eine therapeuti-
sche Bezugsperson ist dabei wichtig.
Die meisten „neuen“ Klientinnen und Klienten mit dem Bedarf integrierter Hilfe-
planung werden von Mitarbeitern der Klinik benannt, aber auch die Sozialpsychiatri-
schen Dienste und/oder Beratungsstellen sind häufi g Vermittler. Mit der Trennung von
federführender und koordinierender Funktion in der regionalen Fallkonferenz können
dann Systemressourcen gesteuert werden.
Ein Beispiel aus den Verfahrensregeln des GPV-Reutlingen: Entsteht im Kontakt zu
einem Klienten der Eindruck, dass die Einsetzung einer koordinierenden Bezugsper-
son angebracht wäre, verständigen sich die GPV-Mitglieder und betreuenden Institutio-
nen in Absprache mit dem Klienten über die personelle Besetzung dieser Funktion.
Der Klient erklärt schriftlich sein Einverständnis zur Ausübung der Fallkoordina-
tion durch den ausgewählten Mitarbeiter und entbindet die betreuenden Institutionen
von ihrer Schweigepfl icht gegenüber der koordinierenden Bezugsperson und umge-
kehrt.
Die koordinierende Bezugsperson informiert alle beteiligten Einrichtungen und
Dienste schriftlich unter Hinzufügung der Schweigepfl ichtsentbindung über die Funk-
tionsübernahme.
Ausgangspunkt für das Tätigwerden einer Fachkraft ist ein Auftrag. Gerade im psy-
chiatrischen Bereich ist es jedoch häufi g so, dass die von einem Klienten, von Ange-
hörigen oder auch von anderen Diensten und Einrichtungen vorgetragenen Anliegen
einerseits unabweisbar deutlich mache, das „etwas“ getan werden muss, anderer-
seits aber sowohl das Problem wie auch das Ziel der Hilfe eher allgemein und unklar
beschrieben wird.
Eine wichtige Voraussetzung besteht darin, dieses Etwas zu präzisieren.
Eine konkrete Zielplanung mit Klienten und Angehörigen mit Hilfe des IBRP unter-
stützt diesen Vorgang. Es kann zunächst nützlich sein, getrennte Übersichtsbögen für
den/die Klienten/Klientin, für die eigene Einschätzung, für Angehörige und für Mit-
arbeiter anderer Einrichtungen kurz zu formulieren und erst dann in einem Gespräch
zusammenzufassen.
Sicherstellen personeller Kontinuität bei der
Koordination
Die kontinuierliche Begleitung durch eine „haltende“, Realität vermittelnde, koordi-
nierende Bezugsperson ist ein Qualitätsstandard personenbezogener Hilfen.
In praktisch allen Arbeitskonzepten und Teams im psychiatrischen Hilfesystem
werden Bezugspersonensysteme verwendet. Das Bezugspersonensystem ist Voraus-
setzung von Hilfeplanung nach dem IBRP. Standard ist die verantwortliche Festlegung
einer Bezugsperson und deren Vertretung.
![Page 38: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/38.jpg)
Seite 38
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 38 von 41
[ibrp.pdf]
Für die integrierte Hilfeplanung ist es wichtig, Stufen von zunehmender Qualität
bei der Betreuung zu unterscheiden. Ausgangslage (Stufe 1) ist häufi g, das jedes Team,
das Hilfen für eine Klientin bzw. einen Klienten erbringt, jeweils eine Bezugsperson
bestimmt hat. Abstimmungen für eine sinnvolle Gesamtplanung bestehen aus Abspra-
chen und Kontakten bei besonderen Anlässen, etwa bei Verlegungen und Wechseln.
Mit dem Erstellen eines Hilfeplans in der Fallkonferenz haben sich die beteiligten
Dienste und Einrichtungen auf eine Aufgabenverteilung geeinigt, ohne eine koordinie-
rende Bezugsperson verbindlich zu benennen. Die jeweiligen Bezugspersonen arbeiten
im Rahmen ihrer Teams an der Durchführung der Vereinbarungen. Nach Ablauf der
vereinbarten Zeit wird der Verlauf in der Fallkonferenz besprochen (Stufe 2).
Bei Stufe 3 ist eine federführende therapeutische Bezugsperson benannt, die im
Rahmen ihres Dienstes als Bezugsperson für die Klienten zur Verfügung steht und
übergreifend die Dokumentation weiterführt, Informationen über den Verlauf vermit-
telt und die Überprüfung des Hilfeplanes und erneute Fallkonferenzen koordiniert und
vorbereitet. Eine Abstimmung der Durchführung der verabredeten Hilfen untereinan-
der erfolgt jedoch nicht – sie wird entweder nicht akzeptiert oder aus der Furcht vor
Einmischung in dienstinterne Angelegenheiten anderer unterlassen.
Erst wenn eine koordinierende therapeutische Bezugsperson mit Vertretung für den
Hilfeplanungsprozess regelhaft benannt wird, kann man von einem erreichten Qua-
litätsstandard der Erbringung integrierter Hilfen ausgegangen werden. Diese koordi-
nierende Bezugsperson ist allen Beteiligten bekannt – kennt also auch die jeweiligen
Bezugspersonen in den anderen Einrichtungen und verknüpft deren Einzelleistun-
gen zu einer abgestimmten komplexen Hilfeleistung (Stufe 4). Sie passt auch durch
Absprachen oder erneutes Einberufen der Fallkonferenz zeitnah die Hilfen an verän-
derte Hilfebedarfe an.
Übung
Für Herrn Schmitt haben Sie ja den Übersichtbogen ausgefüllt. Es war
vereinbart, dass Herr Wagner vom Betreuten Wohnen die Koordina-
tionsfi unktion übernimmt. Er ist im Team des Betreuten Wohnens die
Bezugsperson.
Nach einem Jahr ist eine Verlängerung der Kostenzusage erforderlich. Herr
Wagner überprüft gemeinsam mit Hern Schmitt die Hilfeplanung und führt
begleitend ein Hilfeplanungsgespräch mit Frau Meier und Frau Dr. Seebald.
(Herr Schmitt wollte daran nicht teilnehmen)
Herr Wagner legt die abgestimmte Hilfeplanung in der Hilfeplankonferenz
der Region vor .
Welcher Stufe der Koodination würden Sie dieses Vorgehen
zuordnen?
� Stufe 1: Bezugsperson vorhanden
� Stufe 2:Aufgabenverteilung mit anderen in der Fallkonferenz erstellt
� Stufe 3: Koordination des Verlaufs und der Dokumentation
� Stufe 4: Koordination der Durchführung des Hilfeplans
![Page 39: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/39.jpg)
Seite 39
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 39 von 41
[ibrp.pdf]
Neben diesen qualitativen Aspekten der Prozesskordination ist jedoch für Klienten
die Funktion der Kontinuität in der Begleitung wichtig. Wichtigste Voraussetzung ist,
dass das regionale Hilfesystem mindestens die Stufe 3 erreicht. Nur so lässt sich bei
einem Wechsel der Lebensumstände bzw. von beteiligten Diensten und Einrichtungen
Kontinuität für Klienten aufrechterhalten. Die koordinierende Bezugsperson wird in
einem solchen System dann auch akzeptiert, wenn sie nicht mehr den Hauptanteil der
Betreuungsleistungen selbst erbringt. Von großer Bedeutung ist dabei die verbindliche
Festlegung einer Vertretung der Koordination, die auf keinen Fall demselben Arbeits-
team angehören sollte.
Mit diesem „Tandem-Prinzip“ gibt es gute Erfahrungen. Die Erkenntnisse gerade
im Funktionsbereich Selbstsorge weisen daraufhin, dass sich starre Teamgrenzen zwi-
schen Wohnheim und Betreutem Wohnen aufl ösen und eine Entwicklung zu einem
Wohnverbundsystem in Gang kommt.
Die Festlegung der koordinierenden Bezugsperson erfolgt wie die Hilfeplanung
in Absprache mit den jeweiligen Klienten. Da diese Bezugsperson die Hilfeplanung
durchführt, ist ein bestehendes Vertrauensverhältnis besonders wichtig.
Eine weitere Erfahrung ist zudem, dass bei einer guten Koordination der Klient
seinen Lebensmittelpunkt und auch den Betreuungsmittelpunkt in Richtung auf seine
Wünsche verändert, damit mit mehr Mitarbeitern in Kontakt kommt und so die Koor-
dinationsfunktion auch auf eigenen Wunsch wechselt.
Um aus den Erfahrungen mit der Hilfeplanung zu lernen, ist es jedoch günstig, mindes-
tens zwei Prozessphasen durchzuführen und nur eine der Positionen „Federführung/
Vertretung“ zu wechseln.
Unterschiede dokumentieren
Grundsätzlich gilt es, Wünsche und abweichende Meinungen der Klientin bzw. des
Klienten zu dokumentieren. Praktisch ist, dies mit Hilfe einer anderen Schreibfarbe im
Bogen oder eines Symbols kenntlich zu machen. Die Berliner Fassung der IBRP-Bögen
enthält gleich ein Extrablatt, auf dem die abweichenden Einschätzungen von Klienten
dokumentiert werden sollen.
Manche Mitarbeiter müssen ermutigt werden, Differenzen wahrzunehmen und auf-
zuschreiben: Sie vermuten, das „gute“ Mitarbeiter immer die Bedarfe ihrer Klienten
treffen und/oder die „eigentlichen“ Bedarfe klarer sehen. Im Rückschluss führt dies
dazu, dass differente Einschätzungen der Klienten ein Beweis für schlechte Arbeit
sind.
Die meisten Klientinnen und Klienten müssen sich an vorgegebene Strukturen
anpassen und haben gute verdeckte Strategien entwickelt, um unangenehme Dinge zu
vermeiden. Die Menge der Psychopharmaka in den Blumentöpfen spricht Bände über
die so genannte Compliance in Bezug auf Medikamenteneinnahme.
Je offener solche differente Einschätzungen ausgedrückt werden können, umso bes-
ser können diese verhandelt werden. Die Ermutigung und das Respektieren anderer
Einschätzungen und die Realitätsprüfung durch Ausprobieren gehört zum personenbe-
zogenen Ansatz. Wenn etwa eine Klientin des Betreuen Wohnens in vier Wochen ein
Vollzeitpraktikum beginnen möchte, der Mitarbeiter meint, dass sie dazu noch nicht in
![Page 40: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/40.jpg)
Seite 40
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 40 von 41
[ibrp.pdf]
der Lage sei, so kann dies erst einmal so stehen bleiben, denn Kompromissbildungen,
Erprobungen durch ein Teilzeitpraktikum bzw. durch Vereinbarungen können nur aus
der Differenz heraus entstehen.
Es muss auch nicht alle Differenz unmittelbar aufgelöst werden. Wichtiges ist zuerst
anzugehen. Auch das Abwechseln „Jetzt bin ich dran, dann bist du dran“ macht manch-
mal Sinn.
Andere Einschätzungen bestehen manchmal schon bei der Beschreibung der jetzi-
gen Situation und Problemlage, auch diese sind zu dokumentieren.
Förderung der Teilnahme anderer Professioneller an Gesprächen/Hilfeplangesprächen
Hier möchte ich nur auf die Teilnahme von anderen Einrichtungen, Diensten und
niedergelassenen Ärzten eingehen, die nicht regelhaft an Fallkonferenzen beteiligt sind
bzw. selbst keine Koordinationsfunktion übernehmen. Hilfreich ist es, kurz vor der
schriftlichen Einladung ein Telefongespräch zu führen, in dem der Prozess der Hilfe-
planung vorgestellt wird.
Günstig ist es, mit der eigenen Problemdarstellung anzusetzen und um ergänzende
Informationen zu bitten.
Übung:
Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen niedergelassenen Arzt zu einem Hilfe-
plangespräch für unser letztes Fallbeispiel Herrn Weber einladen. Wie würden
Sie dieses Gespräch beginnen?
Sehr hilfreich ist zudem, den Ort der Fallkonferenz so zu wählen, dass eine Teil-
nahme sehr gut möglich wird, also ggf. die Fallkonferenz in dieser Einrichtung, diesem
Dienst, dieser Arztpraxis anzusetzen.
Die vereinbarte Zeit sollte möglichst gut eingehalten werden. Falls eine Teilnahme
dennoch nicht möglich ist, sollte in der Fallkonferenz dem Koordinator ein entspre-
chender Auftrag zur Absprache erteilt werden.
Für die Beteiligung anderer Professioneller gelten
folgende Leitsätze:
• verhandeln statt bestimmen sowie
• Propagierung der eigenen Sicht, Stehenlassen und Dokumentieren unterschiedli-
cher Sichtweisen statt Verheimlichung und Harmonisierung.
Die Teilnahme an regionalen Fallkonferenzen ist als sich selbst fördernder Wachstum-
sprozess zu begreifen: Je mehr positive Erfahrungen mit personenbezogener Arbeit
gemacht werden können, umso mehr fördert dies Fallkonferenzen.
![Page 41: Petra Gromann Der integrierte Behandlungs- und ... · Seite 2 © FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [] · Stand: 12.10.04 Seite 2 von 41 [ibrp.pdf] Einführung Die Grundlage der](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022519/5b14edac7f8b9a66508cda2c/html5/thumbnails/41.jpg)
Seite 41
© FH Fulda 2004 / PDF-Text-Download von [www.ibrp-online.de] · Stand: 12.10.04 Seite 41 von 41
[ibrp.pdf]
Schweigepfl icht und Datenschutz
Grundsätzlich gelten natürlich auch innerhalb der psychiatrischen Arbeit die
Bestimmungen des Datenschutzes. Auch ohne die Verwendung des IBRP dokumentie-
ren Mitarbeiter aller Dienste und Einrichtungen derzeit ihre Arbeit, d.h., grundsätzlich
gelten die in der alltäglichen Praxis bereits abgestimmten Verfahren des Datenschutzes
und der Schweigepfl icht. Ziel des IBRP ist jedoch eine integrierte Koordination, die die
jeweilige Teamgrenze überschreitet, deshalb sollten folgende Verfahrensregeln ange-
wendet werden:
1. Sobald klar ist, dass eine integrierte Koordination stattfi nden soll, verständigen
sich der Klient und die Mitarbeiter der derzeit betreuenden Institutionen über die
Person, die die Hilfeplanung durchführen wird.
2. Die Klienten erklären schriftlich ihr Einverständnis mit dem Verfahren der
integrierten Behandlungs- und Reha-Planung und entbinden alle beteiligten Ein-
richtungen und Dienste von ihrer Schweigepfl icht gegenüber der koordinierenden
Bezugsperson und umgekehrt. Die koordinierende Bezugsperson informiert alle
beteiligten Einrichtungen und Dienste schriftlich mit der Kopie der Schweig-
pfl ichtentbindung über die Funktionsübernahme.
Wird der IBRP zur Hilfeplanung und Leistungsbegründung nach dem BSHG verwen-
det, sind jeweils landesweit geltende Verfahrensregeln zum Datenschutz zu treffen.
Aus Gründen des Datenschutzes sollten die Originale jeweils bei der koordinieren-
den Bezugsperson verbleiben, eine Kopie des Übersichtsbogens sollte stets den Kli-
enten zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin wird der zuständige Kostenträger die
Überlassung einer Kopie wünschen, ob diese bei ihm verbleibt oder nur die Eingruppie-
rung bestätigt bzw. nicht bestätigt wird und der Bogen dann in der Region verbleibt; ist
verfahrenstechnisch und datenschutzrechtlich zu prüfen. Auch wird die Funktion der
regionalen Verfahrensverantwortung sicher länderspezifi sch geregelt werden, wobei
in den Bundesländern, die derzeit bereits das Verfahren anwenden, dies dem regional
zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst zugeordnet wurde.
Evaluation
• Bewertung und ggf. Veränderung des Prozesses.
• Nach Ablauf des Planungszeitraums sollten auf jeden Fall im Bogen D2 die wich-
tigsten Veränderungen dokumentiert werden.
Übung:
Wenn Sie an unser letztes Fallbeispiel Herrn Schmitt denken, welche Items
wären besonders wichtig auszufüllen?
� E1 � E2 � E3 � E4 � E5
Grundsätzlich ist gemeinsam mit dem Klienten zu entscheiden, wie und ob über-
haupt eine neue Hilfeplanung erforderlich ist und wie eine Veränderung aussehen
könnte.
Der Prozess beginnt von vorne!