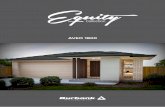LOT de Shazer
-
Upload
camelia-scarlat -
Category
Documents
-
view
112 -
download
2
Transcript of LOT de Shazer
Note: reference style and bibliography do not meet CU standards and have to be changed. Published: Preliminary Version, June 2002
Lsungsorientierte Kurztherapie nach Steve de Shazer. Wurzeln, Grundannahmen, Methodik
Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades MASTER OF ARTS (M.A.) am Psychology-Department der Cosmopolitan University Jefferson-City und Miami /USA
vorgelegt von
Dipl.Soz.Pd.(FH) Christa SteinhauserKuppel 1 D 87452 Altusried Germany
Wissenschaftliche Betreuung: Dr. phil. Rainer J. Wallerius, M.A. , Professor (USA) am PsychologyDepartment der Cosmopolitan University Jefferson-City und Miami/USA
Lsungsorientierte Kurztherapie nach Steve de Shazer Wurzeln, Grundannahmen, Methodik
Gliederung
Einleitung
1. Wurzeln
1.1. Einflsse auf seinen Ansatz 1.2. Entwicklung und Arbeitsbedingungen am BFTC
2. Worin unterscheidet sich de Shazer in seinen Grundgedanken von unserem europischen theorieorientierten Ansatz?
2.1. Herkmmliche theorieorientierte Anstze 2.2. Was ist bei de Shazer anders?
3. Grundannahmen von de Shazer
Annahme Eins: Annahme Zwei:
Zusammenhang zwischen Problem und Weltbild des Klienten Festhalten des Klienten an der anfnglichen berzeugung Elemente des beklagten Sachverhalts
Annahme Drei:
Schon kleine Vernderungen knnen zur Lsung fhren Vom Entweder/Oder zum Sowohl/Als auch
Annahme Vier: Annahme Fnf:
Zusammenhang zwischen Vernderung und Realittsauffassung des Klienten Umdeutungen vorschlagen
Annahme Sechs: Das systemische Konzept 4. Methodik
4.1. Kategorisierung des Klienten 4.2. Das Passen entwickeln 4.3. Hausaufgaben und Standardaufgaben 4.4. Ausnahmen 4.5. Die Wunderfrage
5. Gedanken zu de Shazers Ansatz
5.1. Theoriebegriff 5.2. Ergebnisorientierung 5.3. Auswirkungen auf den Therapeuten 5.4. Respekt vor dem Klienten und Mitarbeit 5.5. Widerstand 5.6. Helferrolle und Macht 5.7. Wandel der Psychologie 5.8. Ethik
Schlussbemerkung
Einleitung
Vor ca. vier Jahren stie ich eher zufllig auf die lsungsorientierte Kurztherapie von Steve de Shazer. Sicherlich hatte ich schon frher im Rahmen von Fortbildungen im therapeutischen Bereich den Begriff Kurztherapie gehrt. Nun hatte ich aber die Aufgabe eine Facharbeit zum Thema Lsungsorientierte Kurztherapie nach Steve de Shazer zu schreiben Nachdem sein Ansatz auch zu den systemischen Therapiemodellen zhlt, habe ich mir die Ausarbeitung nicht besonders schwierig vorgestellt. Seit Jahren bin ich mit einigen systemischen Anstzen in Theorie und Praxis vertraut. Doch es kam vllig anders als erwartet. De Shazers Therapiemodell machte mir groe Mhe. Er stellte z.B. nicht nur mein gewohntes kausalistisches Denken, sondern auch die in den meisten Therapieanstzen vorkommenden Defizitkonzepte infrage.
Neugierig nahm ich die Herausforderung an, mich nicht nur in der erwhnten Facharbeit, sondern auch mit dieser Ausarbeitung einem Therapieansatz zu stellen, der einige berlegungen beinhaltete, denen ich anfangs nicht oder nur schwer zustimmen konnte. Doch es reizte mich eigene, gewohnte Gesichtspunkte zu berdenken. Mglicherweise war der eine oder andere darunter, der zu schnell und zu bereitwillig bernommen und akzeptiert worden ist. Es knnte sich lohnen, verschiedene Gesichtspunkte einer Prfung zu unterziehen.
De Shazers Bcher sind es wert gelesen zu werden, auch wenn einem vielleicht davon abgeraten wird, so wie es mir verschiedentlich passiert ist. Der Tenor der gutgemeinten Warnungen war: Der Inhalt ist nahezu unverstndlich, der Ansatz erscheint nicht besonders glaubwrdig. Ich mchte nicht warnen, sondern ermutigen seine Bcher zu lesen. Besonders deshalb, weil er zu einer neunen und anderen Betrachtungsweise menschlicher Probleme und ihrer Bewltigung anregen kann. Er tut dies in einer erfrischenden und undogmatischen Haltung. Er liefert keine endgltigen Antworten sondern regt zur Neugierde und zum Hinterfragen von bereits bestehenden Therapiekonzepten an.
De Shazer unterscheidet bei seiner Beschreibung von Kurztherapie einmal
Kurztherapie im Sinne einer zeitlich begrenzten Therapie und zum anderen
Kurztherapie als einer Form der Bewltigung menschlicher Schwierigkeiten.
Zum ersten Punkt erwhnt de Shazer, dass die Bezeichnung Kurztherapie andeutet, dass sie sich von einer anderen Art der Therapie unterscheidet von einer langfristigen Therapie. Welche zeitliche Begrenzung fr die Kurztherapie relevant ist kann nicht eindeutig festgelegt werden. Z.B. Castelnuovo-Tedesco denkt bei dem Begriff an 10 25 Sitzungen. Nach Meinung anderer knnen es auch 40 50 Sitzungen sein. Andere wie Weakland, Watzlawick und Bodin bleiben innerhalb eines Limits von 10 Sitzungen. De Shazer und sein Team hatten sich bezglich der Zahl der Sitzungen kein Limit gesetzt. Ihre Devise war: So wenig wie mglich!
Zu Punkt zwei, Kurztherapie als einer Form der Bewltigung menschlicher Schwierigkeiten bemerkt de Shazer: Der Zugang zur Kurztherapie ist das, was der Klient mitbringt, nutzen, um seine Bedrfnisse in der Weise zu erfllen, dass er sein Leben zu seiner Zufriedenheit gestalten kann. (de Shazer, 1997, S. 23). Eingeschlossen werden muss, dass es nicht darum geht irgendwelche kausalen zugrundeliegenden Fehlanpassungen zu korrigieren, denn dazu besteht keine Notwendigkeit.
Lsungsorientierte Kurztherapie bedeutet: Die Lsung steht im Brennpunkt. Die Erklrung fr ein Problem ist primr nicht notwendig. Die Lsung beinhaltet die Erklrung. Sonst wre sie keine Lsung.
So wie de Shazer keine genaue, zusammenhngende Definition fr seinen Ansatz gibt so lsst er auch an anderen Stellen Freiraum fr Spekulationen und Vermutungen, wie er nun das eine oder andere gemeint haben knnte.
Natrlich kann diese Arbeit nur einen Einblick in de Shazers Ansatz geben. Vielmehr mchte ich Neugierde wecken, sich mit de Shazers Gedanken zu beschftigen. Es wird ein Gewinn sein, selbst fr den, der am Ende zu dem Schluss kommt, seinen Ansatz nicht bernehmen zu wollen.
1. Wurzeln
1.1. Einflsse auf de Shazers Ansatz
De Shazer nennt die Arbeiten von Milton H. Erickson als die Leitlinie seiner Arbeit. Von Beginn an grndet er seine Arbeit auf Ericksons Prinzipien. Dessen Arbeiten knnen als Ausgangspunkt fr de Shazers Arbeit und die seiner Kollegen am BFTC betrachtet werden.
Milton Erickson entwickelte u. a. die. Hypnotherapie. Dort geht man davon aus, dass unser jeweiliges Bewusstsein Ausdruck eines selbstinduzierten quasi-hypnotischen Prozesses ist. Es ist das Ergebnis der Art, wie wir Assoziationsmuster im Denken, Fhlen und Interagieren knpfen, welche unsere Wahrnehmung relativ fest auf Teilbereiche unserer Mglichkeiten einengen. Wir hypnotisieren uns selbst auf diesen Ausschnitt unserer Mglichkeiten. Meist fixieren alle Beteiligten, (nicht nur die Klienten, sondern auch die Therapeuten) gerade bei langdauernden Problemen ihre Aufmerksamkeit sosehr auf diese, dass ihr Repertoire wie bei einer Tunnelvision eingeengt erscheint, schreibt Gunther Schmidt. (de Shazer, 1997, S. 232)
Obwohl de Shazer in seiner Praxis jahrelang auf Hypnose und Trance basierende Methoden verwandt hatte, arbeitet er etwa seit 1982 nicht bewusst mit der Induktion von Trance. De Shazer: Dennoch sehe ich jetzt meine Arbeit als hypnotischer an und ich bin der Auffassung, dass ich dabei das von Erickon begonnene Werk weiter ausbaue. (de Shazer, 1989, S. 157)
Natrlich wird und wurde de Shazers Ansatz von weiteren Gedankenmodellen beeinflusst wie etwa von Batesons Modell der polykularen Betrachtungsweise oder der sich Ende der siebziger Jahre zu umfassenden Konzepten entwickelten familientherapeutischen Anstze wie etwa von Minuchin, Whiteacker, Bowen und anderen, die, wie auch de Shazer und seine Kollegen, die mit ihm das BFTC (s. u.) grndeten, aus der systemischen Richtung kamen.
Es zeichnet de Shazer aus, dass er mit groer Wissbegierde und Forschungseifer bemht ist seinen Ansatz zu optimieren und das auch gern mit Hilfe von Anregungen von Kollegen.
1.2. Entwicklung und Arbeitsbedingungen am Brief Family Therapy Center (BFTC)
Das von de Shazer initiierte Brief Family Therapy Center in Milwaukee, das sich als Forschungsprogramm versteht, wird seit seinem Beginn im Jahre 1978 im Team betrieben. Insoo Berg, Elam Nunnally, Eve Lipchik und Alex Molnar waren vom Grndungsjahr an Mitglieder am BFTC. Spter kamen Marilyn Bonjean, Wallace Gingerich, John Walter und Michele Weiner-Davis hinzu. Vorbergehend gehrten dem Team auch Jim Wilk, Jim Derks und Marilyn La Court an. Jedem Mitglied des Teams kommt eine wichtige und fr das Funktionieren des Ganzen notwendige Rolle zu Nach Steve de Shazer hat das ganze Team die Aufgabe, allen Anhaltspunkten nachzugehen, die etwa die Mglichkeit zu fruchtbarer Forschung erffnen oder zu neuen Formen der Problemlsung fhren knnten. (de Shazer, 1997, S. 15) Der Zweck des Teams besteht darin, einen Kontext bereitzustellen, in der Kreativitt sich ereignen kann. Damit Forschungsprojekte durchgefhrt werden knnen muss sich das Team als Ganzes fortwhrend um Geschlossenheit, Verstndlichkeit und Transparenz bezglich seiner Konzepte wie seines praktischen Vorgehens bemhen. Um den Zusammenhalt des Teams zu frdern setzte sich das neu entstandene Zentrum bewusst von anderen Gruppen der Familientherapeuten ab. Damit wollten sie sich den Spielraum fr ein kreatives Vorgehen in ihrer therapeutischen Arbeit schaffen. Ein weiterer Schritt bestand darin, eine gewisse Einheitlichkeit in der Interviewtechnik zu entwickeln, da jeder aus einer anderen Schule kam und damit auch schulspezifische Methoden anwandte (z.B. skulptieren, inszenieren usw.) De Shazer setzt den Begriff Interview mit therapeutischem Gesprch gleich.
Neben dem Forschungs- bzw. Theorie-Erarbeitungsprogramm finden auch Therapie und Ausbildung am BFTC in Milwaukee statt.
Lyman C. Wyne hebt eine Besonderheit der Milwaukeegruppe lobend hervor: Sie hebt sich ab von dem Trend fhrender Vertreter der Familientherapie, die ihre eigenen Ansichten immer und immer wieder bekrftigen und sich nach auen abschotten. Zusammen mit der Mailnder Gruppe (Selvini Palazzoli, Cecchin, Boscolo, Prata) hat sie neue, interessante Ideen und Behandlungsmethoden entwickelt. Interessant ist, dass zwischen den in Mailand und Milwaukee entwickelten Anstzen auffllige hnlichkeiten bestehen obwohl sie im wesentlichen parallel zu einander und nicht in Kenntnis der laufenden Arbeit der jeweils anderen Gruppe entstanden sind
Die aufflligen hnlichkeiten der in Mailand und Milwaukee entwickelten Anstze knnten in dem besonderen fr beide Gruppen zutreffenden Kontext liegen, in den ihre Arbeit eingebettet ist, resmiert L. Wyne. Beide Teams waren und sind bemht um einen offenen Dialog im kleinen Kreis von Kollegen auerhalb wie innerhalb des Instituts. So wechseln sie sich z.B. immer wieder ab in der Therapeutenrolle und der Beobachterrolle (hinter dem Einwegspiegel), um so der Gefahr einer Fixierung auf einen bestimmten Standpunkt entgegenzuwirken. Beiden Gruppen ist gemeinsam, sich viel Zeit fr detaillierte und gezielte Beobachtung klinischer Phnomene zu nehmen und darber ausgiebig und ungehindert zu diskutieren. Ihre Arbeit ist weder ausschlielich theoretischer Natur noch ausschlielich methodenorientiert, sondern eher beides zugleich. L. Wyne schreibt: Das ist eine Art der kreativen klinischen Forschung, wie sie meiner Meinung nach zunehmend und zu Unrecht vernachlssigt wird diszipliniertes und zugleich fr alle Beobachtungen offenes Erkunden, das nicht an eine festgelegte Ideologie oder an irgendwelche Forschungsvorgaben gebunden und damit organisiert ist. (de Shazer, 1997, S. 11)
Keines der beiden Zentren gehrt einer offiziellen akademischen Institution an und beide sind unabhngig vom Wohlwollen irgendwelcher auenstehenden Geldgeber.
Bei der Bearbeitung von Steve de Shazers Bchern gewann ich zunehmend den Eindruck, dass die BFTCler ihre Arbeit mit groer Wissbegierde und ansteckender Begeisterung verrichten .Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihre besonderen Rahmenbedingungen, in denen ihre Arbeit eingebettet ist, einen erheblichen Anteil daran haben. 2. Worin unterscheidet sich de Shazer in seinen Grundgedanken von unserem europischen theorieorientierten Ansatz?
2.1. Von herkmmlichen theorieorientierten Anstzen zur Lsungsorientierung
Zu Anfang des 20.Jahrhundert zeichnete sich Wissenschaft durch den Objektivismus der naturwissenschaftlichen Methode aus. Die zentrale Frage bzw. die Kernfrage, die blicherweise gestellt wurde lautete: Was ist die Ursache des Problems? Sie setzt voraus, dass fr ein bestimmtes Problem eine bestimmte Ursache fr genau dieses Problem existiert. Weiter steckt in dieser Frage auch die Annahme, dass man tatschlich die Ursache des Problems herausfinden und dadurch das Problem beheben kann. Schlielich setzt die Frage, Was ist die Ursache fr das Problem?, voraus, dass eine Beziehung zwischen Herausfinden der Ursache und dem Lsen des Problems besteht. Walter und Peller bemerken: Dieser Prozess stimmt mit der Idee der westlichen Wissenschaft - und auch mit traditionellen Beschreibungen im Rahmen der wissenschaftlichen Methode - berein, dass der Weg ein Problem zu lsen darin besteht, herauszufinden, welches die Ursache ist, so dass man dann nderungen herbeifhren kann, indem die Ursache beseitigt wird...... Wir scheinen demnach alle Probleme mit den Gesetzen der Mechanik zu verbinden wenn der Motormher nicht mehr luft, suchen wir nach der Ursache. (Walter u. Peller, 1994, S. 18)
In der psychoanalytischen Tradition wird z. B. die Ursache des Problems auf verschiedene Weise beschrieben.
Mgliche Varianten:
Ungelste Konflikte, sexuelle Unterdrckung, unzureichende Objektbeziehung, Entwicklungshemmung usw. . Dabei werden die Probleme meist als Symptome einer bestimmten zugrundeliegenden Pathologie beschrieben oder als Abwehr im Rahmen einer Persnlichkeitsstrung.
In der psychiatrischen Tradition kann die Ursache auch noch als chemisches Ungleichgewicht beschrieben werden, als krperliche Prdisposition oder als Krankheit, die verschiedene Verhaltensaufflligkeiten hat. Aus psychoanalytischer wie psychiatrischer Sichtweise verlangt jede urschliche Erklrung eine Interventionsform. Wird als Ursache eine Entwicklungshemmung diagnostiziert, knnen korrigierende emotionale Erfahrungen verschrieben werden. Werden z.B. ungelste Konflikte als Ursache, angesehen dann wird eine untersttzende Therapie empfohlen. Sollte ein chemisches Ungleichgewicht als Ursache erkannt werden, dann knnen spezifische Medikamente dafr verschrieben werden.
In der Tradition der Verhaltenstherapie kann das Problem als Folge oder als Ursache eines Lernprozesses beschrieben werden, der oft in der Familie begrndet ist.
Antworten auf die Frage Was ist die Ursache des Problems haben sich in Abhngigkeit von den Vorannahmen ber das Wesen des Menschen entwickelt und hingen ab von der jeweiligen theoretisch-philosophischen Ausrichtung des Theorieentwicklers. Dies bedeutet, wenn Menschen so gesehen werden, dass sie entscheidend von ihren sexuellen Bedrfnissen getrieben werden, wird nach Erklrungen innerhalb der Sexualentwicklung gesucht. Werden Menschen aber so gesehen, dass sie Probleme haben, weil sie individuelle Wnsche und Ansprche unterdrcken oder sublimieren mssen, aufgrund von Beschrnkungen, die ihnen die Gesellschaft auferlegt, dann liegt der Erklrungsansatz entsprechenderweise innerhalb dieser sozialen und politischen Gegebenheiten.
Alle diese Traditionen und Denkrichtungen beinhalten die gleiche Vorannahme: Probleme sind verursacht und die Ursache kann gefunden werden. Jede Richtung suchte nach der Ursache des Problems, aber jede fand eine andere Antwort. Allen gemeinsam jedoch ist das Prinzip der Kausalitt.
Mitte des letzten Jahrhunderts, im Rahmen der Entwicklung der Kybernetik tauchte eine neue Fragestellung auf: Was hlt das Problem aufrecht? Diese Frage betont das Aufrechterhalten, nicht die Ursache des Problems. Diese Therapierichtung geht davon aus, dass ein Problem existiert, stellt fest, dass das Problem aufrechterhalten wird und nimmt eine Beziehung zwischen Aufrechterhalten und Problem an, die gefunden und beschrieben werden kann.
Ein hnliches Modell schreibt Problemen und ihren Symptomen eine systemerhaltende Funktion, zu wobei sich die Handlungen der Familienmitglieder um das Problem organisieren (systemischer Ansatz).
Im Strukturellen Modell sieht man Probleme eingebettet in dysfunktionale Familienstrukturen und von diesen auch aufrechterhalten.
Das Mailnder Modell gibt an, dass Probleme von der grundlegenden Regel der Familie gesteuert werden usw.
Alle diese Modelle sind schlssig und folgerichtig im Hinblick auf ihre jeweilige Antwort auf die Frage: Was hlt das Problem aufrecht? Sie beschreiben sowohl das Verhaltensmuster wie das Denken um das Problem herum und geben entsprechende Interventionsanleitungen.
In den letzten Jahren wurde zunehmend eine andere und neue Frage gestellt: Wie konstruieren wir Lsungen?
Auch diese Frage geht von Vorausannahmen aus:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
es gibt Lsungen es gibt mehr als eine Lsung sie sind konstruierbar Therapeut und Klient knnen sie konstruieren Therapeut und Klient konstruieren und/oder erfinden Lsungen, anstatt sie zu entdecken dieser Prozess bzw. diese Prozesse lassen sich ausdrcken und modellieren. (vgl. Walter u. Peller, 1994, S. 21)
Es hat also eine Entwicklung von der Frage Was verursacht das Problem? zu den Fragen Was hlt das Problem aufrecht? und Wie konstruieren wir Lsungen?, stattgefunden, eine allmhliche Wegbewegung von Ursachen, ber Problem-Aufrechterhalten zu Lsungen hin. Das Augenmerk richtet sich mehr auf die Gegenwart, weg von der Vergangenheit, wo oft nur nach Ursachen fr die gegenwrtigen Probleme gesucht wurde.
Mit der letzten Frage: Wie konstruieren wir Lsungen? wird die Gegenwart und die Zukunft betrachtet. Wenn wir unsere Voraussetzungen von traditionellen, linearen Vorstellungen ber Kausalitt wegbewegen, bewegen wir uns auf eine relativistische und konstruktivistische Sichtweise zu sowie auf eine Zukunftsorientierung. (Walter u. Peller, 1994, S. 23)
Steve de Shazer hat die Frage Wie konstruieren wir Lsungen in konsequenter Weise wie kam ein anderer verfolgt. Gunther Schmid ber de Shazer: Er ist ein Pionier darin, wie man Wirklichkeiten zusammen mit dem Klienten konstruiert, die fr die Lsung wirksam werden. In mancher Hinsicht ist Steve darin sogar noch konsequenter als Milton Erickson selbst, gewissermaen nimmt er Erickson mehr beim Wort (und dies mit groem Erfolg) als dieser sich selbst. (de Shazer, 1997, S. 235)
2.2. Was ist bei de Shazer anders
Im Nachwort des Buches von de Shazer Wege der erfolgreichen Kurztherapie arbeitet Gunther Schmidt, der zur Neuen Heidelberger Gruppe um Helm Stierlin gehrt, einige zentrale Prmissen heraus, die er in der Arbeit de Shazers entdeckt hat. Er schreibt, dass die zentralen Grundideen des im oben genannten Buch vorgestellten Modells recht einfach sind, und fhrt aus: Steve und seine Gruppe gehen davon aus, dass es fr Lsungen von Problemen, insbesondere von solchen, denen wir in der Psychotherapie begegnen, nicht ntig ist, ihre Entstehung und alle relevanten Bezge des Problemzusammenhangs zu verstehen. Vielmehr sollten vom ersten Kontakt an alle Beitrge des Therapeuten darauf abzielen, den Blick der Beteiligten auf die Faktoren zu lenken, die mit der mglichen und gewnschten Lsung der Klienten einhergehen. Dies trifft auch auf Probleme zu, die blicherweise als Ausdruck sehr schwerer Strungen (z.B. Psychosen) gelten und die eine lange Geschichte haben. (de Shazer, 1997, S. 231)
Als wichtige Implikation dieser Prmisse bezeichnet Gunther Schmidt .... dass die Lsungsvorstellungen der Klienten selbst sehr ernstgenommen werden, dass die Autoritt ber die anzustrebenden Lsungen weitestgehend bei ihnen angesiedelt wird. Dies ist in der Psychotherapie keineswegs selbstverstndlich, jedenfalls nicht bei pathologieorientierten Konzepten. (de Shazer, 1997, S. 231)
Eine weitere Prmisse, die Gunther Schmidt bei de Shazer entdeckt, ist die Annahme, dass die Lsungsressourcen bei den Klienten meist schon vorhanden sind Die Aufgabe des Therapeuten ist , laut de Shazer, die Aufmerksamkeit des Klienten darauf zu lenken ...dass er (der Klient) alle Fhigkeiten besitzt, die ntig sind, um das Problem zu lsen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass die Klienten noch nicht wissen, dass sie bereits wissen, wie ihr Problem zu lsen ist. (de Shazer, 1989, S. 108)
Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer erwhnen zu de Shazers Modell: Das Modell der lsungsorientierten Kurztherapie grenzt sich von der blichen Weise systemischer Therapie und Familientherapie explizit ab (z.B.
DE SHAZER 1989c). Von der ersten Frage an wird direkt auf die Lsung und nicht auf das Problem zugegangen: Problem talk creates problems, solution talk creates solutions! So kann z.B. die Aussage eines Patienten: Herr Doktor, ich habe Depressionen! mit der Frage beantwortet werden: Woher wissen Sie das? und: Haben Sie diese Depression den ganzen Tag, 24 Stunden, auch wenn Sie schlafen? (von Schlippe u. Schweitzer, 1997, S. 35)
Die beiden Autoren sehen als Kernaussage bei de Shazer: .....die Vorstellung, es sei ein groer Irrtum der Psychotherapie, zu vermuten, dass zwischen einem Problem und einer Lsung ein Zusammenhang bestehe. Im Gegenteil, es zeige sich, dass der Prozess der Lsung sich von Fall zu Fall strker hnelt als die Probleme, denen die Intervention jeweils gilt. (DE SHAZER 1989b, S. 12). (von Schlippe u. Schweitzer, 1997, S. 35)
De Shazer kam nach 15 Jahren der praktischen und theoretischen Beschftigung mit der Kurztherapie zu folgendem Schluss, der auch Grundlage seines Buches Wege der erfolgreichen Kurztherapie ist: Um in wirklich passender Weise zu intervenieren, muss man ber die Details einer Klage, die der Klient vortrgt, gar nicht so genau Bescheid wissen. Es ist nicht einmal ntig, dass man sich genau vorstellen kann, wodurch die beklagte Situation am Leben gehalten wird, um dann eine Lsung finden zu knnen. Vor dem Hintergrund all dessen, was ich bis dahin getan hatte, schien diese Erkenntnis zunchst jeder Erwartung zuwiderzulaufen. Und doch ist es ganz offensichtlich so, dass ein beliebiges Verhalten, wenn es nur wirklich ein anderes als das gewohnte Verhalten ist, in einer problematischen Situation ausreichen kann, um eine Lsung herbeizufhren und dem Klienten die Befriedigung zu vermitteln, die er sich von der Therapie erwartet hat. Notwendig ist nur, dass die betroffene Person in ihrer unangenehmen oder lstigen Situation etwas anderes tut, selbst wenn dieses Verhalten scheinbar irrational, ganz und gar irrelevant, eindeutig bizarr oder komisch ist. (de Shazer, 1997, S. 24)
Hierzu passt die berhmt gewordene Metapher von de Shazer ber das Trschloss. Dabei vergleicht er die Klagen, mit denen Klienten zum Therapeuten kommen, mit Trschlssern, hinter denen ein befriedigendes Leben wartet. Die Klienten haben alles versucht ....aber die Tr ist immer noch verschlossen; sie halten ihre Situation fr jenseits ihrer Lsungsmglichkeiten. Hufig hat dieser Schluss immerweitergehende Bemhungen zur Folge. Sie versuchen herauszufinden, warum das Trschloss so und nicht anders beschaffen ist oder warum es sich nicht ffnen lsst. Dabei ist eigentlich klar, dass man zu Lsungen mit Hilfe eines Schlssels und nicht mit Hilfe eines Schlosses gelangt.... . Eine Intervention braucht nur in der Weise zu passen, dass die Lsung auftaucht. Es ist nicht ntig, dass die Lsung es an Komplexitt mit dem Schloss aufnehmen kann. (vgl. von Schlippe u. Schweitzer, 1997, S. 35)
2.2.1. Ziel und Zukunftsorientierung
Kurztherapie ist ausgehend von der Gegenwart auf die Zukunft orientiert. Soll Kurztherapie zufriedenstellend sein, so muss die Zukunft sich positiv von der Gegenwart abheben. Es braucht einen Anreiz fr den Klienten seine Situation zu verndern durch die Erwartung einer positiveren Zukunft. De Shazer: Wenn die Zukunft, zielmig ausgedrckt, in genaueren Einzelheiten vom Klienten beschrieben wird, d.h. in Begriffen des
Verhaltens, dann macht es Sinn, jetzt (in der Gegenwart) etwas zu tun, um diese Ziele zu erreichen. Ziele mssen als Minimalziele beschrieben werden. Sie sollen erreichbar sein, und sie sollten so konzipiert sein, dass es fr den Klienten einer bestimmten Anstrengung bedarf, sie zu erreichen. (de Shazer, 1989, S. 208)
De Shazer sieht in der Erwartung, dass sich etwas verbessern kann, die zentrale Voraussetzung jeder Therapie (selbsthypnotische Krfte).
2.2.2. Kundenorientierung
Sein Konzept ist kundenorientiert. Kundenorientierung stammt als Idee ursprnglich aus dem Wirtschaftsbereich und bedeutet, das Angebot soll genau auf die Nachfrage abgestimmt sein.
In diesem Begriff steckt auch das Wort Kundiger, einer der sich auskennt, der selbst Bescheid wei. Es bedeutet, dass Therapeuten mglichst genau das anbieten, was ihre Klienten subjektiv haben wollen, und nicht das, was sie nach Meinung der Fachleute brauchen. Professionelle Interventionen richten sich nicht nach objektiver Indikation oder Bedrftigkeit, sondern nach dem jeweils subjektiven Bedarf des Klienten. (vgl. von Schlippe u. Schweitzer, 1997, S.125)
2.2.3. Absage an den Begriff Widerstand
Etwa im Jahre 1979 zeichnete sich in der Arbeit am BFTC eine neue Perspektive ab: Schon lange hatte ich versucht, wie de Shazer schreibt, mir ber den Begriff des Widerstandes in der Therapie klarzuwerden. Jetzt, da ich Gelegenheit hatte, andere Praktiker der Kurztherapie bei ihrer Arbeit zu beobachten (Insoo Berg, Elam Nually u.a. ), festigte sich meine berzeugung, dass die Klienten sich wirklich ndern wollen. Zweifellos waren manche von ihnen ber die Art und Weise, wie sie sich ndern sollten, nicht besonders glcklich. Aber es fiel mir schwer, diese Haltung als Widerstand zu etikettieren; eher sah ich darin eine Botschaft, die dem Therapeuten bei seiner Aufgabe, dem Klienten zu helfen, Mut machen sollte. (de Shazer, 1997, S. 34) Er machte die Erfahrung, dass Patienten, die von anderen als unwillig etikettiert wurden, sehr an einer Vernderung interessiert waren und eine groe Kooperationsbereitschaft zeigten. Damit grenzt er sich klar von der Psychoanalyse ab, fr die Widerstand ein zentraler Begriff ist.
De Shazer ist berzeugt davon, dass Menschen, die zur Therapie kommen, eine Vernderung ihrer Situation anstreben. Die Versuche, die sie unternahmen, um eine Vernderung herbeizufhren, haben nicht funktioniert,
auch wenn sie in einer Therapie erfolgten. Vielleicht ohne es zu wollen, hat sich dadurch ihre Situation sogar verschlimmert. Wenn ein Therapeut diese Fehlschlge eines Klienten als Widerstand betrachtet, dann ist es gut denkbar im Sinne einer sich selbst erfllenden negativen Voraussage (self fulfilling prophecy), dass er damit erst Widerstand und Kooperationsunwilligkeit im Klienten weckt.
2.2.4. Indirektheit
Indirektheit ist ein wichtiger Bestandteil der Kurztherapie. Indirektheit besagt, dass die Symptome, die ein Klient aufweist, unbesehen vom Therapeuten akzeptiert werden. Er beseitig sie nicht, sondern transformiert sie zu einem Bestandteil der Lsung und nutzt sie damit (vgl. Ericksons Utilisation). Ein Beispiel, von dem de Shazer berichtet: Ein Geistlicher kam zur Therapie und klagte er habe Gott verloren. Das bereitet ihm bei seiner beruflichen Arbeit enorme Schwierigkeiten. Er hatte ein ausgeprgtes Interesse an sakraler Architektur und sprach gerne ber die rtlichen Sehenswrdigkeiten u.a. auch ber Kirchenbauten, die er noch nicht kannte. Er meinte einer seiner Freunde wrde gerne Fotos dieser Kirchen in sein Buch aufnehmen und so suchte er ermutigt durch den Therapeuten viele Kirchen auf in der Absicht, sie fr seinen Freund zu fotografieren. Wie er spter dem Therapeuten erzhlte fand er - bei einem seiner Fotostreifzge durch verschiedene Kirchen Gott wieder. (vgl. de Shazer, 1997, S. 30)
2.2.5. Lsungsorientierung die Lsung im Brennpunkt
Historisch hat sich Psychotherapie vor allem mit Problemen, die unterschiedlich definiert wurden und Lsungen, die selten definiert wurden, befasst. Dagegen setzt de Shazer bei der Lsung an und entwickelte ein Lsungskonzept. Seiner Meinung nach muss zuerst ein Lsungskonzept entwickelt werden, bevor es berhaupt ein Problemkonzept geben kann. Bestimmte Ereignisse, Symptome u.a. knnten auch ganz anders etikettiert und verstanden werden als durch den Begriff Problem. (vgl. de Shazer, 1989, S. 25)
Die Mitarbeiter des BFTC haben den Prozess weitergefhrt, indem sie ausschlielich die Lsungsseite betrachten. Fr sie sind Probleme Probleme und sie sind am besten zu verstehen in Bezug auf ihre Lsungen. Entwickelt sich z.B. aus der strukturellen Sicht des Problems eine Lsung, dann wird sie als ntzlich begrt. Dies beweist aber nicht die strukturelle Sicht und widerlegt sie auch nicht; es demonstriert nur in diesem besonderen Fall ihre Ntzlichkeit.
De Shazer glaubt, dass Probleme Probleme sind, weil sie aufrechterhalten werden: Sie werden einfach dadurch zusammengehalten, dass man sie als Probleme beschreibt. (de Shazer, 1989, S. 27) Fr ihn befasst sich ein Therapeut ausschlielich mit seiner Konstruktion dessen, wie sein Klient seine persnliche Realitt konstruiert; aus diesen beiden Deutungen konstruieren Klient und Therapeut gemeinsam eine therapeutische Realitt. Die zugrundeliegende Prmisse, die als radikaler Konstruktivismus (von Glasersfeld, 1975) bzw. verbaler Realismus (Wilder-Mott, 1981) bezeichnet werden kann, besagt mehr oder weniger, dass soziale Realitt durch Kommunikation konstruiert wird. (de Shazer, 1989, S. 81) Dazu zitiert de Shazer den Kommunikationstheoretiker Barnlund: Dieser legt nahe, dass alle Bedeutungen distinktiv sind, da sie die Schpfung einzigartiger Personen unter einzigartigen Umstnden sind. Ferner geht es bei der menschlichen Interaktion um eine transformierte und imaginierte Welt, da unser Wissen ber die Welt unweigerlich subjektiv ist. Es ist nicht die reale Welt, ber die wir streiten, lachen oder weinen, sondern es sind diese Transformationen. Unsere Bedeutungsgebungen sind Fiktionen, wertvoll und ntzlich zwar, aber dennoch Fiktionen (1981, S. 95). (de Shazer, 1989, S. 81f)
Kommunikation ist ein interpersonaler Prozess und beinhaltet, dass die Bedeutungen verhandlungsfhig sind. Wichtig ist auch der Kontext, indem sich eine bestimmte Situation ereignet. Das gleiche Verhalten in einem anderen Kontext kann vllig daneben und strend wirken. Z.B. wenn man wei, es handelt sich um einen Kindergeburtstag und nicht um einen Empfang bei einer hhergestellten Persnlichkeit, hilft dies ein angemessenes Verhalten an den Tag zu legen. Miller geht davon aus, dass Probleme, Lsungen und Vernderungen alle als Menschenwerk und deshalb als Artefakte therapeutischer Praxis zu betrachten sind. (vgl. De Shazer, 1989, S. 88) Die Probleme des Klienten sind am besten als Konstruktionen aufzufassen, die Aspekte ihres sozialen Lebens betreffen und die von ihnen in konkreten sozialen Beziehungen und Situationen verursacht werden. Aus dieser Perspektive ist alles, was in der Therapiesituation abluft etwas, das die Beteiligten konstruieren.
In dem ganzen steckt auch der Gedanke, dass der Beobachter das Beobachtete beeinflusst, geht aber noch darber hinaus. Fr die Therapiesituation bedeutet das, dass der Therapeut nicht nur das beobachtet, was der Klient sagt und tut und ihn dadurch beeinflusst, er hilft dem Klienten auch durch Fragen und Kommentare, sein Anliegen, sein Verhalten erst einmal Gestalt annehmen zu lassen. Therapeuten und Klienten kooperieren miteinander bei der Erzeugung der therapeutischen Realitt, in der sie dann zusammenarbeiten. De Shazer dazu: Dies heit nichts anderes, als dass Therapeut und Klient gemeinsam eine Neukonstruktion dieser Aspekte in der Weise vornehmen, dass die Klienten sie nicht lnger als problematisch empfinden. (de Shazer, 1989, S. 88)
Es geht um Lsungskonzepte, nicht darum, eine problematische Situation eines Klienten zu durchdringen, dem ueren Anschein auf den Grund zu gehen, zu suchen was dahintersteckt, sondern bereits vorhandene Mglichkeiten, Fhigkeiten in den Blickpunkt des Klienten zu rcken, die er bisher - warum auch immer beiseite gelassen hatte. Im Bild gesprochen: Wenn ein Klient bisher drei Rume seines Hauses gut kannte und blind den Weg dahin fand, dann fhrt ihn der Therapeut in weitere Rume des groen Hauses, die dem Klienten bis zu diesem Zeitpunkt nicht zugnglich waren. Ein anderes Bild, das de Shazer benutzt: Dem Klienten geht es wie einem unzufriedenen Schriftsteller, dem der Schluss seines Kapitels, an dem er gerade arbeitet, nicht gefllt. Er fragt seinen Lektor um Rat, der gibt ihm unterschiedliche Schlsse zur Wahl. Der Autor kann entscheiden, ob und welchen der Vorschlge er fr brauchbar hlt. Hufig reicht es, dass der Autor verschiedene Variationen zur Auswahl bekommt, um mit seiner
Arbeit weiterzukommen. Der Lektor ist nun zum Mitautor geworden, weil er zur Realitt des Autors alternative Anschauungen beigesteuert hat. (vgl. de Shazer, 1989, S. 94) Auf die Therapiesituation bezogen bedeutet es: Die Aufgabe des Therapeuten ist es seinen Klienten zu helfen, so mit dem Leben zurechtzukommen, dass sie damit zufrieden sind. Es gibt verschiedene mgliche Lsungen. Entscheidend ist, dass sie fr die Klienten passen und zufriedenstellend sind.
Ziel und Zweck ist es, eine nderung im Sinne der Klienten herbeizufhren.Deshalb nennt de Shazer seine Gesprche mit den Klienten auch gerne nderungsgesprche. Dazu gehrt u.a., mit den Klienten ber ihre Ziele zu sprechen oder auch darber, was sich bereits auerhalb des Therapierahmens gendert hat. Es geht vom ersten Kontakt an um Vernderung, um eine Lsung im Sinne der Klienten fr ihre dargestellten Probleme.
3. Grundannahmen von de Shazer
De Shazer schreibt: Um seine Arbeit tun zu knnen, muss der Therapeut sich gewisse Annahmen darber zurechtlegen, wie es zu dem beklagten Sachverhalt gekommen ist und welcher Art die Lsung sein knnte. (de Shazer, 1997, S. 42) Als beklagten Sachverhalt bezeichnet de Shazer - allgemein gesagt - die Probleme, mit denen ein Klient zur Therapie kommt. Die Grundannahmen eines Therapeuten sind entscheidend dafr, welche Vorgehensweise er in der Therapie mit seinem Klienten whlen wird. De Shazer dazu: Angenommen, der Therapeut geht davon aus, dass Symptome eine systemische Funktion besitzen, zum Beispiel die Familie zusammenhalten sollen. In diesem Fall wird er versuchen, einen Lageplan anzulegen, aus dem hervorgeht, wie diese Funktion in diesem System auch ohne das Symptom erfllt werden kann. (de Shazer, 1997, S. 43) Wenn der Therapeut dagegen mit einem anderen Annahmebndel arbeitet, entsteht eine andere Art von Lageplan. Zum Beispiel knnte der Therapeut annehmen, das Symptom sei nichts als Pech und diene keiner Funktion; er wird dann einen anderen Lageplan anlegen, der ihm anrt, das Symptom zu eliminieren und an seine Stelle das zu setzen, was vermutlich geschehen wre, wenn der betreffende Mensch nicht Pech, sondern Glck gehabt htte. (de Shazer, 1997, S. 43) Mit Lageplan, oder auch Landkarte genannt, bezeichnet de Shazer ein kartographisches Schema (entwickelt am BFTC) das beschreibt, was lsungsorientierte Therapeuten whrend eines Interviews mit den Klienten tun.
Die im folgenden beschriebenen Grundannahmen von de Shazer sind denjenigen von Watzlawick und Haley sehr hnlich. De Shazer rumt ein, dass es vermutlich noch andere Annahmen gibt, die auf einer tieferen Ebene fr die Praxis der Kurztherapie mit Familien gltig sind (de Shazer, 1997, S. 43), fhrt dies aber nicht aus.
De Shazer hat die sechs Grundannahmen sehr unterschiedlich stark ausgearbeitet. Er bringt z. B .zur Annahme Eins nur zweieinhalbe Seiten Stoff, dagegen zur Annahme zwei zehn Seiten.
Die sechs Grundannahmen sind textgetreu von de Shazer bernommen.
Annahme Eins:
Der beklagte Sachverhalt steht im Zusammenhang mit einem Verhalten, das durch das Weltbild des Klienten zustande gekommen ist. (de Shazer, 1997, S. 44)
Der erste Schritt auf dem Weg zu dem, was spter den beklagten Sachverhalt ergibt, scheint relativ klein, die Konsequenzen aber knnen unverhltnismiger Art sein. Es ist als sagte man: Entweder verhalte ich mich in der Weise A, oder ich glaube an die Weise Nicht-A. Aus welchem Grund (welchen Grnden) auch immer scheint A die richtige (die logische, die beste, die einzige ) Mglichkeit zu sein. Die Folge ist, dass alles andere (alles Nicht-A) in Bausch und Bogen abgetan wird. Das heit also, das Entweder-Verhalten(A) erscheint als eine Klasse fr sich, und die Formen des Oder-Verhaltens (Nicht-A) scheinen alle brigen Klassen (alle Klassen minus Klasse A ) von Verhalten zu sein, das htte gewhlt werden knnen. Eine hypothetische Klage lst sich aus so gut wie allem und jedem, sogar aus nichts konstruieren (Watzlawick, 1983), etwa so, wie dies im folgenden (zweifellos allzu sehr vereinfacht) beschrieben wird. Bettnssen ist ein verhltnismig weitverbreitetes und ziemlich bliches Verhalten von Kindern, das je nach den Gegebenheiten leicht zum Gegenstand einer Klage werden kann. Wenn ein Kind ins Bett macht, trifft die Mutter eine Entscheidung(1) darber, wie sie dieses Verhalten betrachten will: (a) als normales oder (b) als problematisches Verhalten. Wenn das Ergebnis lautet, dass dieses Verhalten normal ist, dann geht alles so weiter wie bisher (verdammt noch mal, schon wieder!). Wenn die Entscheidung aber zugunsten von (1b) getroffen wird, entwickelt sich der folgende Baum: Ergebnis (1b) erfordert Entscheidung (2): das Bettnssen ist (a) ein physisches Problem oder (b) ein psychisches Problem. Wird zugunsten des Physischen Problems entschieden (2a), dann liegt der nchste Schritt mehr oder weniger auf der Hand, wobei die physische Intervention mglicherweise keine Abhilfe schafft. Wenn im Sinne von (2b) entschieden wird, dann stellt sich die Frage, ob man das Kind mit diesem psychischen Problem als (3) entweder (a) bse oder (b) verrckt ansehen will.
Abb. 2.1: Der Baum zum beklagten Sachverhalt
Ist die Mutter der Meinung, dass das Problem des Kindes psychischer Art ist (2b), dann ist der nchste Schritt nicht so eindeutig. Wenn das Kind als bse (3a) betrachtet wird, dann werden alle mglichen Formen der Bestrafung angewandt, um dem schlechten oder bsen Verhalten ein Ende zu machen. Betrachtet die Mutter das Kind als verrckt (3b), dann versucht sie es vielleicht mit irgendeiner Form der professionellen oder nichtprofessionellen Behandlung. (de Shazer, 1997, S. 44-46) Natrlich ist die Situation hufig noch komplizierter, z.B. knnen Eltern die Situation des Kindes unterschiedlich einschtzen.
Wenn in dem Beispiel des Bettnssens von einer Entscheidung, die die Mutter trifft, wie sie das Verhalten ihres Kindes betrachtet, gesprochen wird, ist nicht die Rede von einer bewussten willentlichen Entscheidung, sondern einer Entscheidung, die sich aus ihrem Weltbild ergibt. Das Weltbild eines Menschen wird durch verschiedene Faktoren geprgt z.B. durch Beobachtungen, Erlebnissen, Erfahrungen, Bewertungen usw. Daraus resultiert ein Weltbild, ein Denkrahmen oder auch nur Rahmen genannt, nach dessen Gesetzmigkeiten und Regeln ein Mensch in den verschiedensten Situationen seines Lebens handelt. De Shazer zitiert Goffman. Fr Goffman sind Rahmen Definitionen einer Situation, die wir gem gewissen Organisationsprinzipien fr Ereignisse zumindest fr soziale und fr unsere persnliche Anteilnahme an ihnen...aufstellen (S. 19). (de Shazer, 1989, S. 117) De Shazer beschreibt Rahmen als Regeln nach denen wir unsere Realitt konstruieren, und folglich knnten auf andere Situationen auch andere Regeln zutreffen. (de Shazer, 1989, S. 117)
Die Aufgabe des Therapeuten ist es, dem Klienten zu helfen, seine Regeln, mit denen er eine bestimmte fr ihn problematische Situation mit entsprechender Bedeutung belegt, zu ndern. Das kann durch Umdeuten der
Situation geschehen. Dazu muss der gewohnte Denkrahmen des Klienten erschttert bzw. ein leiser Zweifel an ihm verursacht werden.
Es gibt Klienten, deren Rahmen recht global ist, d.h. sie geben ihren Schwierigkeiten und Problemen eine solch groe Bedeutung, dass diese zu Fakten des Lebens werden; z.B. wenn jemand alle seine Schwierigkeiten darauf schieben wrde, dass die Sonne im Osten aufginge. Obwohl es jedem Beobachter absurd vorkme, knnte es den Besitzer eines solchen Bezugsrahmens zu einem ungewhnlichen und seltsamen Verhalten verleiten. Sobald es aber gelnge, dass er seine Denkweise anzweifeln wrde, bestnde eine Hoffnung auf Vernderung. Solch globale Denkrahmen, Bezugsrahmen, knnen durch Dekonstruktion des Rahmens erschttert werden. Dekonstruktion bedeutet den Rahmen des Klienten in Einzelteile zu zerlegen. Dies geschieht im Gesprch mit dem Klienten, indem der Therapeut nach Ausnahmen sucht und den Klient sich eine beschwerdefreie Zukunft vorzustellen und ausmalen lsst, was nach de Shazer eine stark motivierende Auswirkung hat.
Um auf das Anfangsbeispiel zurckzukommen, bedeutet dies: Alles Nicht-A, das ausgeklammert, abgetan wurde, kommt ber die Ausnahmen wieder in den Blickpunkt des Klienten und kann eine andere neue Sichtweise seines beklagten Sachverhalts mit dem Therapeuten konstruieren (Probleme sind Konstrukte).
De Shazer beschreibt noch eine zweite Methode den globalen Denkrahmen eines Klienten zu erschttern: Die Konfusionstechnik. Dabei sucht der Therapeut nach irgendeinem Punkt im logischen System des Klienten der unlogisch ist; ein Punkt der die ganze problematische Konstruktion zusammenfallen lsst. Fr den Klienten ist dieser Prozess meist verwirrend, da seine bliche Logik nicht greift. Dieser Effekt ist das gewnschte Ergebnis der Konfusionstechnik. In dieser Verwirrung oder Konfusion kann eine neue Offenheit fr eine alternative Sichtweise seines beklagten Sachverhalts entstehen. (vgl. de Shazer, 1989, S. 119) Der Klient verlsst den bisherigen Deutungs- und Erklrungsrahmen seines Problems.
Annahme Zwei:
Der beklagte Sachverhalt wird durch die berzeugung des Klienten am Leben gehalten, dass das, was er bezglich der anfnglichen Schwierigkeit zu tun beschlossen hat, das einzig Richtige und Logische gewesen sei. Deshalb kann er jetzt gar nicht mehr anders als mehr desselben Verhaltens zu zeigen (Watzlawick u.a., 1974) weil die zweite Hlfte der Entweder/Oder-Prmisse ja abgelehnt bzw. vergessen wurde. (de Shazer, 1997, S. 47)
De Shazer fhrt aus: Beim Autofahren mssen wir uns immer wieder entscheiden: Soll ich jetzt nach rechts oder nach links abbiegen? Wenn wir nach rechts abbiegen, bleibt alles, was uns auf der linken Spur erwartet htte,
unbercksichtigt und un-erfahren. In einem interaktiven System wie der Familie kann eine im Grunde hnliche Entscheidung immer wieder gefordert sein (Das Bett ist schon wieder nass...). Vom Augenblick der richtigen Entscheidung an wird allerdings die Reaktion auf das nasse Bett den gleichen Gewohnheitscharakter tragen wie das nasse Bett selbst. Die Menschen halten nicht jedes Mal inne, um sich von neuem fr die gleiche Antwort zu entscheiden, denn sie betrachten das nasse Bett nicht jedes Mal als etwas Neues, sondern eher im Sinne des Ach, es ist mal wieder soweit. Wir Therapeuten sagen: Immer wieder die gleiche verdammte Geschichte. (de Shazer, 1997, S. 47)
Sobald sich die Mutter, im Beispiel des Bettnssers, auf eine Antwort festgelegt hat, die ihr als die richtige erscheint, z.B. - Bettnssen ist das Problem wird sie versuchen dieses Problem zu lsen. Wenn sie glaubt, dass ihr Kind das Bett willentlich nass macht, also bse ist, dann wird sie es bestrafen. Wenn eine leichte Bestrafung nicht hilft wird sie ihre gewhlte Form der Strafe intensivieren. Auch eine scheinbar andere Strafe ist im Grunde dasselbe, weil sie der gleichen Kategorie, nmlich Strafe- angehrt. Auf die Bestrafung folgen immer wieder nasse Betten, so wie auf nasse Betten immer wieder Bestrafung folgt, ein nicht endender Kreislauf von rger und Frustration. In dem Glauben, die einzig richtige Entscheidung getroffen zu haben (das Verhalten des Kindes ist bse), ist der Gedanke, Es muss eine wirksamere Strafe her, ganz folgerichtig. Man muss nur lange genug danach suchen, dann wird schon irgendwann eine Abhilfe gefunden werden. Inzwischen hlt der Zyklus Bestrafung/nasses Bett an und eskaliert mit jeder neuen Runde. Leider wird der Entschluss, dass das Verhalten des Kindes ein Verhalten ist, das bestraft werden muss, meist nicht in Frage gestellt. Es bedarf einer Umetikettierung des Kindes (siehe Abb. 2.1.) das als verrckt oder normal eingestuft wurde, um die vielen anderen Schritte, die die getroffene Entscheidung ausgeschlossen hat, fr die Eltern mglich zu machen und die sich von der Bestrafung unterscheiden. De Shazer: Ist diese Entweder/Oder-Konstruktion durchschaut, dann folgt, dass jedes denkbare Nicht-A-Verhalten schon anders genug sein knnte (weil es die Menschen nmlich aus ihrer Unbeweglichkeit herausholt), um eine Lsung herbeizufhren. (de Shazer, 1997, S. 49) Es geht also um ein Verhalten das anders genug unterschiedlich ist vom gewohnten Verhalten, um den Klienten aus seiner Sackgasse herauszufhren. Mgliche Anhaltspunkte, Ansatzpunkte fr ein anderes Verhalten, eine Vernderung, sind zu entdecken in de Shazers Aufschlsselung des beklagten Sachverhalts in zwlf Elemente, aus denen dieser nach seiner Erfahrung besteht. Fr den Klienten haben diese Elemente eine unterschiedliche Gewichtung. Folgende Elemente sind in der Regel an einem beklagten Sachverhalt beteiligt:
Elemente des beklagten Sachverhalts
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
eine einzelne Verhaltensweise oder eine Verhaltenssequenz; die Bedeutungen, die der Situation zugeschrieben werden; die Hufigkeit des beklagten Geschehens; der Schauplatz des beklagten Geschehens; das Ma der Unfreiwilligkeit des beklagten Geschehens; wichtige Bezugspersonen, die direkt oder indirekt mit dem beklagten Geschehen zu tun haben die Frage, wer oder was dafr verantwortlich zu machen ist; der uere Kontext (Berufsttigkeit, konomischer Status, Lebenskreis etc.); die zugehrige physiologische Befindlichkeit; die Vergangenheit; ein dsteres Zukunftsbild; utopische Erwartungen. (vgl. de Shazer, 1997, S. 49f)
Abb.2.3: Die Bausteine des beklagten Sachverhalts (de Shazer, 1997, S. 52)
Jedes dieser Elemente ist mit den brigen so verbunden, dass sie einander wechselseitig definieren. Eine Vernderung in einem dieser Elemente kann zu Vernderungen in den brigen Elementen fhren.
Aus den zwlf Elementen konstruiert der Klient seine beklagte Realitt, und der Therapeut konstruiert die therapeutische Realitt (beklagter Sachverhalt plus mgliche Lsungen) aus dem selben Material, aber der Schwerpunkt liegt auf der Lsung. Wegen dieser anderen Gewichtung, so de Shazer, mit der die Therapeuten ihre Konstruktionen versehen, sieht das therapeutische Problem anders aus als die Konstruktionen, die der Klient in Form des beklagten Sachverhalts liefert. Es ist dieser Unterschied in der Konstruktion, der zur Lsung fhrt.. (de Shazer, 1997, S. 55)
Wichtige Ansatzmglichkeiten fr einen Unterschied, der zu einer Lsung fhren kann, lassen sich an den Punkten, die der Klient hervorhebt, erkennen. Wenn z.B. der beklagte Sachverhalt an einen speziellen Schauplatz, nach den Worten des Klienten gebunden ist, dann muss man die Aufgaben insbesondere alles, was direkt mit dem beklagten Verhalten als solchem zu tun hat so whlen, dass sie an einem anderen Ort zu realisieren sind, mit dem Ziel einen kleinen Unterschied zu schaffen, der einen Unterschied macht. Wenn z.B. die Kche fr ein Paar der Ort ist an dem ihre Auseinandersetzungen immer stattfinden, dann kann der Therapeut dem Paar die Aufgabe stellen, ihre nchste Auseinandersetzung im Schlafzimmer zu fhren. De Shazers Erfahrungen zeigen, dass gute Aussichten bestehen, dass die andere Bhne auch ein anderes Verhalten auf den Plan rufen wird. Vielleicht fhrt eine befriedigende sexuelle Erfahrung sie wieder zusammen. (de Shazer, 1997, S. 52) Entscheidend ist die Erfahrung des Klienten, dass er aus seiner Unbeweglichkeit, aus seinem Schach-matt herauskommt durch eine andere Verhaltensmglichkeit als der Gewohnten. Eine solche Erfahrung wird den Klienten ermutigen und motivieren weitere Vernderungen, wenn ntig, zu suchen.
Auf der Basis einer oder mehrerer positiven Vernderungserfahrungen ist eine kooperative Haltung dem Therapeuten und der Therapie gegenber sehr wahrscheinlich. Aus diesem Grunde setzt ein lsungsorientierter Kurztherapeut immer an den Elementen an (siehe Abb. 2.4.), die der Klient bevorzugt.
Eine Metapher von de Shazer dazu:
Die zwlf Faktoren sind wie zwlf verschiedene Tren, die zu Lsungen fhren. Jeder Sachverhalt ist wieder anders, und die verschiedenen mglichen Lsungen sind die Tren mit den besser gelten Schlssern und Angeln. Verschiedene Tren knnen zu den gleichen oder zu verschiedenen Lsungen fhren, aber andererseits kann sich die gleiche Tr auch zu verschiedenen Lsungen ffnen. Jede Tr kann in eine Sackgasse fhren. Therapeut und Klient mssen gemeinsam erkunden, welche Tr sich aller Wahrscheinlichkeit nach am leichtesten ffnen lassen wird. (de Shazer, 1997, S. 53) Dazu muss er sorgfltig zuhren wie ein Klient den Sachverhalt schildert. Wenn ein depressiver Klient sein vergangenes Leben als bedrckend empfindet und er sich sehr hilflos fhlt, dann sind verhaltensbezogene Aufgaben nicht geeignet um eine Lsung zu finden. Wenn der Klient sich eher als Opfer frherer Ereignisse erlebt, dann knnten sich zwei Arten von Interventionen empfehlen. Die eine besteht in einer Symptomverschreibung; dabei rt der Therapeut dem Klienten sich zu noch grerer Depressivitt zu zwingen (die unfreiwillige Tr) um schlielich weniger depressiv zu sein. Die andere ist die nderung des Denk- und Bezugsrahmens. Dabei wird der Depression eine andere Bedeutung gegeben, so dass es dem Klienten allmhlich sinnvoller erscheint nicht mehr depressiv zu sein (die Tr der zugeschriebenen Bedeutung).
Abb. 2.4: Umwandlung des beklagten Sachverhalts in die Lsung. (de Shazer, 1997,S. 54)
Annahme Drei:
Schon eine sehr kleine Vernderung kann die Lsung auf den Weg bringen. Sobald die Vernderung in Gang gekommen ist (Aufgabe des Therapeuten), wird der Klient weitere Vernderungen selbst bewirken (Welleneffekt [Spiegel und Linn,1969]). (de Shazer, 1997, S. 57)
De Shazer: Vernderungen nehmen eine hnliche Entwicklung wie der kleine Irrtum, der weitreichende Folgen hat. Wenn ein Pilot in NewYork beim Start zum Flug nach San Francisco um einen Grad von der Richtung abweicht, wird er zu dem Zeitpunkt, zu dem er in San Franzisko sein sollte, ganz erheblich von seiner Route abgekommen sein. (de Shazer, 1997, S. 57)
Natrlich sind die Auswirkungen von Vernderungen im therapeutischen Prozess kein Irrtum, sondern sie sind gewnscht und werden herbeigefhrt und der Welleneffekt ist willkommen.
Vernderung lsst sich nach de Shazer im klinischen Kontext wie folgt definieren: Ein therapeutischer Prozess, bei dem beobachtete neue und andere Verhaltensweisen und/oder Wahrnehmungen (Rahmungen) im Kontext des vorgestellten Problems (und der zugehrigen Strukturen) und/oder die Lsung dieses Problems in Gang gesetzt (und vorangetrieben) werden (de Shazer und Molnar, 1984a) (wobei immer bedacht werden muss, dass die das Problem umgebenden Strukturen und das Problem selbst nicht etwa zwei separate Dinge, sondern in rekursiver Beziehung zueinander stehende Aspekte des gleichen Dinges sind). (de Shazer, 1997, S. 97) Es bedeutet, dass beide, Klient und Therapeut, teilhaben an dem interaktionellen Prozess der Vernderung. Der Klient setzt den Prozess der Vernderung in Gang, indem er zum Therapeuten geht und seine Probleme erzhlt. Damit gibt der Klient das Problem aus der Hand und es kann neu definiert werden. Die neue Definition muss anders beschaffen sein, da die alte nicht zu einer Lsung fhrte. Die neue oder andere Definition braucht eine neue oder andere Sichtweise, damit sie zu einer befriedigenden Lsung fhren kann.
Fr Milton Erickson verhlt es sich so, ......dass Patienten, die uns aufsuchen, uns deshalb aufsuchen, weil sie nicht genau wissen, WARUM sie eigentlich kommen. Sie haben Probleme, und wenn diese Probleme ihnen wirklich bekannt WREN, dann wren sie nicht erst gekommen. Da sie nicht wissen, was es mit ihren Problemen WIRKLICH auf sich hat, knnen sie uns das auch nicht sagen. Sie knnen uns nur eine ziemlich wirre Schilderung dessen geben, was sie denken. Und wir hren sie mit UNSEREN Hintergrund an und wissen nicht, was sie uns sagen, aber wir wissen immerhin besser, dass wir nicht wissen. Und dann mssen wir ETWAS tun, das eine Vernderung im Patienten in Gang bringt ... irgendeine kleine Vernderung, denn dieser Patient wnscht eine Vernderung, und sei sie noch so klein, und er wird das ALS Vernderung akzeptieren. Er wird nicht aufhren, sich mit dem AUSMASS dieser Vernderung zu beschftigen. Er wird das als eine Vernderung akzeptieren, wird sich an diese Vernderung halten, und die Vernderung wird sich im Einklang mit seinen
Bedrfnissen weiterentwickeln ....Das Ganze erinnert sehr stark an einen Schneeball, den man einen Bergabhang hinunterrollen lsst. Am Anfang ist es ein kleiner Ball, aber im Hinunterrollen wird er immer grer ... und schlielich wird er zu einer Lawine, die der Form des Abhangs entspricht (in Gordon und Meyers-Anderson, 1981, S. 16-17). (de Shazer, 1997, S. 99)
Es ist die Aufgabe des Therapeuten, etwas zu tun, das irgendeine kleine Vernderung im Klienten in Gang bringt.
In unserem Beispiel des Bettnssers mssen die Eltern eine Anleitung vom Therapeuten bekommen, wie sie den sich wiederholenden Zyklus des nassen Bettes und der folgenden Strafe durchbrechen. Wie schon beschrieben, haben die Eltern alle Mglichkeiten mit Ausnahme der Bestrafung ausgeschlossen. Gerade diese ausgeschlossenen, unmglich gemachten Reaktionen knnen die Lsung des Problems beinhalten und damit den bisherigen Misserfolgen Abhilfe schaffen. Mgliche andere Verhaltensweisen wren nach de Shazer: Eine Belohnung, wenn das Bett trocken geblieben ist, das Ignorieren des nassen Bettes, die Belehrung des Kindes darber, wie es sein Bettzeug selbst waschen kann, oder schlielich ein Schild im Kinderzimmer mit der Aufschrift Mach heute Nacht dein Bett nass! - all das hat schon zum Erfolg gefhrt. Der springende Punkt ist, dass jedes denkbare neue Verhalten mglicherweise anders genug ist, und alle anderen Verhaltensweisen sind ja durch die Regel Immer die gleiche verdammte Geschichte ausgeklammert worden, nachdem die richtige Entscheidung getroffen worden war. (de Shazer, 1997, S. 58) De Shazer empfiehlt bei der Suche nach einer neuen Reaktion den Ausnahmen von der Regel nachzuspren. Das Konzept Ausnahmen gegenber der Regel entwickelte de Shazer gemeinsam mit Wallace Gingerich und Michele Weiner-Davis. Im anschlieenden Teil Methodik werde ich auf dieses Konzept ausfhrlicher eingehen.
Fr unser Beispiel des Bettnssers lsst sich dieses Konzept wie folgt anwenden: Da nichts jemals ganz genau so ist wie etwas anderes (Grundlage des Konzeptes) lsst sich sicher auch ein Unterschied in den nassen Betten finden. Es knnte sein, dass das Kind einmal eine Nacht ein trockeneres Bett hat oder in einer Nacht das Bett nasser ist als in einer anderen. Auch wird das Kind das Bett zu unterschiedlichen Zeiten namachen und auch das Bettzeug kann verschieden sein. Es sind sicher Ausnahmen von der Regel zu entdecken, doch sind die Unterschiede manchmal so minimal, dass sie leicht bersehen werden. Doch diese Abweichungen vom blichen Muster nasses Bett sind die Informationen, die der Therapeut braucht. Wichtig fr de Shazer ist dabei, dass allen Beteiligten dem Therapeuten, dem Kind und den Eltern klar ist, dass das Kind auf irgend deine (vielleicht unbewusste?) Weise Kenntnis davon hat, wie man es anstellt, ein trockenes Bett zu haben! Und dass es mithin Zeiten gibt, in denen in dieser Familie das Muster trockenes Bett wirksam ist. (de Shazer, 1997, S. 59) Der Therapeut muss in Erfahrung bringen, welches die Unterschiede zwischen dem Muster nasses Bett und dem Muster trockenes Bett sind. Das Muster trockenes Bett wird fr den Therapeuten zur Grundlage seines weiteren Vorgehens um das Problem zu lsen. Er muss dabei im Auge behalten, welche Bedeutung der Umstand trockenes Bett fr die anderen Familienmitglieder hat und welche Verhaltensnderungen sich von den Eltern dem Kind gegenber ergeben knnten. Jede Intervention, die auf das Muster trockenes Bett aufbaut, also auf den Erfahrungen der Familie mit den Ausnahmen vom nassen Bett, hat den enormen Vorteil, dass sie passen, denn sie sind Bestandteil der bereits erlebten Realitt der Familie.
Damit wird die Kooperation gefrdert, und die Chancen fr eine Problemlsung vergrern sich. Zum zweiten Teil der dritten Annahme: Vom Entweder/Oder zum Sowohl/Als auch
Sobald die Vernderung in Gang gekommen ist (Aufgabe des Therapeuten), wird der Klient weitere Vernderungen selbst bewirken (Welleneffekt, vgl. auch M. Ericksons Schneeballbeispiel). Dazu ein Beispiel: Frau B. kam zur Therapie und klagte ber die Art und Weise, in der sie mit ihren Kindern umging. Sie wollte endlich ein fr alle Mal aufhren ihre Kinder anzuschreien. Es wrde sowieso keine Wirkung zeigen, nur sie selbst fhlte sich danach sehr entmutigt. Frau B. sieht die Dinge so, dass sie entweder die Kinder stndig anschreien oder das Anschreien ein fr alle Mal einstellen msse. (vgl. de Shazer, 1997, S. 59) Dazu eine einfache Regel von de Shazer: Klienten prsentieren einen Sachverhalt hufig nach dem Schema des Entweder/Oder, und in solchen Fllen kann es ntzlich sein, wenn der Therapeut das Problem nach dem Schema des Sowohl/Als auch konstruiert. (de Shazer, 1997, S. 57) Frau Bs Erwartungen waren unrealistisch. Es wird immer Zeiten geben in denen sie ihre Kinder anschreien wird, und vielleicht ist das auch in diesen Momenten das Beste, das sie tun kann. Der Therapeut fragte Frau B.: Was meinen Sie, was geschehen wird, sobald Sie damit anfangen, Joan, du gehst ruhiger und vernnftiger mit den Kindern um? Die Art der Formulierung formt das Ziel um. Sie macht daraus den Beginn von einem ruhigeren und vernnftigeren Umgang mit den Kindern. Damit wird Frau B`s unmgliches Ziel aufgegeben, das Schreien ein fr alle Male zu beenden. Der Therapeut wies Frau B. an, sich wie zufllig z.B. durch Hochwerfen einer Mnze zu entscheiden, ob sie schreien oder ruhig und gelassen mit ihren Kindern umgehen wolle und sich angesichts der Resultate darber schlssig zu werden, wann sie welche der beiden Mglichkeiten einsetzten wrde. Ihre Erfahrungen zeigten, dass es manchmal das Beste war zu schreien und zu anderen Gelegenheiten ein ruhigerer Umgangston wirksamer war. Die therapeutische Anregung, wie zufllig mit einem ruhigeren und gelasseneren Ton auf die Kinder zu reagieren, formte ihr problematisches Entweder/Oder-Schema in ein Sowohl/Als-auch-Schema um. Sie kann sowohl einen ruhigen und vernnftigeren Umgangston anschlagen als auch schreien. Frau B. entscheidet immer selbstndiger, anfangs noch mit der Mnze, welches Verhalten sie fr passend findet.
Durch ihr verndertes Verhalten setzte ein Welleneffekt ein. Fr ihre Kinder war Frau B. weit weniger berechenbar seit sie den Zufall ber ihren Ton bestimmen lie. Dadurch verringerten sich die Anlsse, die Frau B. zum schreien brachten. Wenn sie jetzt selten schrie, merkten ihre Kinder, dass es ernst war und reagierten positiv darauf.
Der Therapeut akzeptiert Frau B. ohne Einschrnkung, so wie sie kommt, eben als jemand, der seine Kinder anschreit. Sie wird nicht infrage gestellt und der Therapeut verlangt von ihr auch nicht, dass sie damit aufhrt ihre Kinder anzuschreien.
Niemand spricht Frau B. Erziehungskompetenz ab. In der Formulierung Joan du gehst ruhiger und vernnftiger mit den Kindern um sind folgende Botschaften enthalten:
1. 2. 3.
die Anregung, dass Joan ruhiger und vernnftiger mit ihren Kindern umgeht die Erwartung, dass Joan diesen Umgangsstil einfhren wird und die Erwartung, dass ein anderer Umgangston Auswirkungen haben wird, die Frau B. bemerken kann.
Diese Art der Satzkonstruktion entstammt den von Milton Erickson entwickelten Hypnosetechniken De Shazer ist der Ansicht, dass hypnotische Techniken in der Kurztherapie unabhngig davon zur Anwendung kommen, ob eine formale Trance induziert wird oder nicht. Deshalb halten wir uns bei der Formulierung und Anwendung therapeutischer Anregungen an Ericksons Beispiel. (de Shazer, 1997, S. 60)
Annahme Vier:
berlegungen darber, was man in einem bestimmten Fall ndern knnte, sollten ihrerseits auf der berlegung aufbauen, wie die Realittsauffassung des Klienten ohne den beklagten Sachverhalt ausshe. (de Shazer, 1997, S. 63)
Wenn Eltern eines Bettnssers in dem nassen Bett nur eines von vielen Anzeichen dafr sehen, dass sie ein bses Kind haben, dann wird sich ihre Einstellung ihrem Kind gegenber, wenn das Bett trocken bleibt, nicht wesentlich ndern Sie werden auch weiterhin ihr Kind fr ein bses Kind halten. In diesem Fall ist das trockene Bett keine wirkliche Lsung. Der Therapeut hat die Aufgabe fr gewisse Zweifel zu sorgen, was die Bedeutung des nassen Bettes angeht und/oder was den bergreifenden Gedanken vom bsen Kind angeht. Er kann Zweifel dadurch wecken, indem er den Eltern vermittelt, dass Bettnssen unter bestimmten Umstnden ein sehr hufiges, weitverbreitetes Problem sei. Gerade besonders kreative und sensible Kinder knnen flschlicherweise leicht in den Verdacht kommen bse zu sein. Dabei wird das Bettnssen solange anhalten, bis diese Kinder davon berzeugt sind, dass sie genauso viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen, wenn
sie ihr Bett nicht nass machen. Das Bettnssen wird den Eltern als ein Ausdruck fr die Kreativitt und Sensibilitt ihres Kindes vermittelt, es macht solange Unannehmlichkeiten, bis es an sein Ziel die Aufmerksamkeit der Eltern kommt Der Therapeut muss die Eltern darauf vorbereiten, dass das Kind solange Probleme machen wird, bis es wirklich davon berzeugt ist, dass es auch Aufmerksamkeit bekommt ohne das Hilfsmittel Bettnssen. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen und erfordert viel Geduld und Durchhaltewillen von den Eltern.
Welche Bedeutung ein Klient einem beklagten Sachverhalt beilegt, kann der Therapeut in Erfahrung bringen, indem er den Klienten danach fragt, wie seiner Meinung nach die Dinge dann aussehen werden, wenn das Problem erst einmal gelst ist. Was ein nasses bzw. ein trockenes Bett bedeutet, hilft bei der Bestimmung des Denk- oder Bezugsrahmens, den der Therapeut nutzen kann, um das Problem erfolgreich zu lsen. In dem vorliegenden Beispiel vom bsen Kind reicht ein trockenes Bett allein noch nicht aus. So wie diese Eltern ihr Kind sehen, wird es vermutlich in ihren Augen etwas anderes und ebenso bses tun. Erst wenn der Therapeut diese negativen Bedeutungen (Rahmungen) kennt, kann er mit einer Umdeutung des Verhaltens des Kindes beginnen. Dies bedeutet den Denkrahmen der Eltern zu ndern und damit den gleichen Verhaltensweisen positive Bedeutungen beizulegen. (vgl. de Shazer, 1997, S. 64f)
Annahme Fnf:
Umdeutungen brauchen nur vorgeschlagen zu werden; ein neues Verhalten auf der Grundlage (irgend)einer Umdeutung kann dann die Lsung des Problems durch den Klienten in die Wege leiten. (de Shazer, 1997, S. 65)
Wie in der Annahme Eins schon beschrieben, ist der Denkrahmen, die Rahmung, in der sich das Denken eines Klienten bewegt, entscheidend fr seine Handlungen und fr sein Verhalten. Hierzu fhrt de Shazer ein Experiment an, das Duncker entwickelte, das zeigt, dass und wie der Denk- und Bezugsrahmen (Definitionen und Bedeutungen) das Geschehen beeinflusst.
Gruppe Eins erhielt drei Pappschachteln, eine mit Streichhlzern, eine mit kleinen Kerzen und eine mit Reingeln gefllt Gruppe Zwei erhielt das gleiche Material, wobei sich die Streichhlzer, die Kerzen und die Reingel allerdings nicht in den Schachteln befanden. Die Aufgabe bestand darin, die Kerzen in vertikaler Stellung auf eine Unterlage zu montieren, damit das Ganze als Lampe dienen konnte. Den Probanden der Gruppe Zwei fiel die Lsung der Aufgabe sehr viel leichter. In einer Wiederholung des Experiments kam Adamson (1952) zu dem Ergebnis, dass nur 41 Prozent der Teilnehmer aus Gruppe Eins das Problem innerhalb von 20 Minuten lsten, whrend 86 Prozent der Teilnehmer aus Gruppe Zwei innerhalb der zur Verfgung stehenden Zeit damit fertig wurden. Es scheint, dass die Schachteln fr die Teilnehmer von Gruppe Eins als Behlter gerahmt (oder definiert) waren, whrend es den Teilnehmern von Gruppe Zwei eher gelang, in den Schachteln, die ja nichts enthielten, potentielle Plattformen (eine Umdeutung der leeren Schachteln) zu sehen, auf denen sie die Kerzen befestigen knnten. Das heit also, gewisse Rahmungen (z.B. Behlter) sind im Zusammenhang mit der Lsung dieses Problems weniger brauchbar als andere Rahmungen (z.B. leere Schachtel).Das fhrt uns direkt zu unserer Annahmen Eins(siehe S.44) und Fnf. Wie aus Dunckers Experiment hervorgeht, wird uns durch die Rahmungen (die Modi der Betrachtung oder Definition von Situationen) und die in ihrem Gefolge erscheinenden Benennungen (mehr oder weniger) diktiert, was wir sehen und tun knnen: Unser Blickwinkel bestimmt ber das, was als nchstes erfolgt. Das scheint nicht nur fr die Kunst und die Wissenschaft zuzutreffen, sondern auch fr unser alltgliches Leben: Rahmungen und die entsprechenden Benennungen richten unsere Erwartungen in einer bestimmten Weise aus und setzen uns in den Stand, die Welt sozusagen zu gliedern und zu er-messen. Jedem konkreten Faktum knnen unterschiedliche Benennungen beigegeben sein, die auf unterschiedliche Rahmungen verweisen (Watzlawick u.a., 1974). (de Shazer, 1997, S. 65f)
Auf das Beispiel des Bettnssers bezogen, wre es ohne weiteres mglich, dass der Denkrahmen dieses Kind wei, wie man es anstellt, ein trockenes Bett zu haben ausreichend ist, um eine gewisse Vernderung des problematischen Verhaltensmusters einzuleiten. Der Therapeut hat die Aufgabe die Familie anzuleiten, einen solchen neuen Dankrahmen zu benutzen. Er kann z.B. die Familie bitten auf das zu achten, was an den Abenden vor einer Nacht mit trockenem Bett passiert, oder was an den Morgen nach einer trockenen Nacht anders ist als an Tagen, in denen das Kind das Bett nass macht. Des weiteren kann er auch darum bitten, dass jedes Familienmitglied fr sich eine Vorhersage darber macht, ob diese Nacht das Bett trocken oder nass sein wird. Wird eine Vernderung von der Familie wahrgenommen, etwas, das die Bezeichnung anders als gewohnt verdient, kann der Therapeut weitere Interventionen darauf aufbauen. Als .... eine zwar kleine, dabei aber keineswegs leichte oder simple Aufgabe des Therapeuten zumindest in der ersten Sitzung, vielleicht aber auch in weiteren Sitzungen, so schreibt de Shazer, besteht darin, dem Klienten gewisse Zweifel einzuflen, was seinen Denkrahmen und das daraus folgende Verhalten angeht. (de Shazer, 1997, S. 67) Wenn die Familie anfngt, ihre Wahrnehmung bezglich des Kindes, das sein Bett immer nass macht, anzuzweifeln, dann werden andere Verhaltensweisen als die bisherigen zu einer realen Mglichkeit. Und andersherum, so de Shazer: Wenn die Familienmitglieder sich anders verhalten und einen Unterschied (ein trockenes Bett ) sehen knnen, dann knnen sie auch dahin kommen, dass sie an ihrer ursprnglichen Rahmung der Situation zweifeln. Denkrahmen und Verhaltensweisen interagieren und definieren einander wechselseitig: Dies ist keine Situation des Entweder/Oder. (de Shazer, 1997, S. 67)
Ein weiteres Beispiel de Shazers, an dem sich die Wirksamkeit von Benennungen oder Etikettierungen einer Situation zeigen:
Eine junge Frau kam zur Therapie weil sie an den Folgen einer krperlichen Behinderung leidet. Sie war in jungen Jahren an Kinderlhmung erkrankt und benutzte seither eine Gehhilfe. Zum erstenmal in ihrem Leben fhlt sie sich wegen ihrer Behinderung deprimiert. Sie hatte das Gefhl, wenn sie sich mit anderen jungen Frauen verglich, dass ihr etwas fehlte, und dass andere das wohl auch so sehen wrden. Seit dieser Zeit bemht sie sich - wenn irgend mglich - ihre Krcken so zu platzieren, dass sie nicht zu sehen sind. Als sie, angeleitet durch den Therapeuten anfing, Krcken mit ungewhnlicher, aufflliger Bauart, Farbe und Form zu benutzen und offen zur Schau zu stellen, wirkte dies als Zeichen einer auergewhnlichen Strke. Ihre Umgebung zeigte sich beeindruckt und behandelte sie anders als zuvor. Sie lie es nicht mehr lnger zu, dass sie von ihrer Behinderung zum Krppel gemacht wurde. De Shazer fhrt dazu aus: Das Etikett Krppel hatte ihren Umgang mit Menschen und Situationen geprgt, so wie das neue Etikett und der neue Denkrahmen Strke das neue und andere Verhalten frderte. Da der neue Rahmen befriedigendere Reaktionen frderte und damit bei ihr die Erwartung weiterer befriedigender Reaktionen weckte, konnte sie ihn beibehalten. An diesem Beispiel wird deutlich, was Denkrahmen und Etikettierung fr die Interaktion bewirken: Die Klientin sah andere Menschen im Gedanken daran, dass diese sie als Krppel betrachteten, bernahm dieses Etikett und verhielt sich nun auch wie ein Krppel. Je mehr sie sich wie ein Krppel verhielt (indem sie die Krcken nach Mglichkeit versteckte), desto eher sahen die Menschen sie als Krppel ein circulus vitiosus, der sich selbst am Leben erhielt. Als sie begann, etwas anderes zu tun (nmlich ihre dekorativen Gehstcke den Blicken offen auszusetzen), nahmen die Mitmenschen sie als stark wahr. Also begann sie sich als stark anzusehen, wie ihrer Meinung nach die Mitmenschen sie jetzt sahen (was Erwartungen bezglich weiterer Verhaltensweisen erzeugte und frderte, die von Strke zeugten), und damit fing etwas an, was man als circulus virtuosus, als einen wunderttigen Mechanismus, bezeichnen knnte. (de Shazer, 1997, S. 68f)
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass ein Wandel des Denkrahmens und der Etikettierung an jedem Punkt eines Interaktionssystems einsetzen kann. Wenn ihre Umwelt sie als starke Persnlichkeit betrachtet htte, bevor sie selbst sich in dieser Weise wahrnahm, dann htte diese vielleicht den Denkrahmen Strke fr die Klientin ins Spiel gebracht. Kommt ein Klient zur Therapie, dann ist es Aufgabe des Therapeuten einen neuen Denkrahmen ins Spiel zu bringen, der fr den Klienten und seine Umgebung passt. Der Rahmen sollte so gewhlt werden, dass das neue Verhalten des Klienten von der Umgebung positiv verstrkt wird. Gleichzeitig ist es wichtig, sehr darauf zu achten, dass das neue Verhalten daraus resultiert, dass der Klient sich anders wahrnimmt als zuvor. Eine neue, aufflligere Krcke, die von der Klientin auch versteckt worden wre, htte keine wirkliche Vernderung bedeutet. Erst wenn sie sich selbst als stark betrachtet, selbst dann wenn sie wieder einmal ihre alten unaufflligen Krcken verwenden wrde, ist eine hilfreiche Vernderung ihres Denkrahmens sichtbar.
Die Therapie bietet auf dem Wege der Umdeutung eine Art Spiegel, der den Menschen helfen kann, ihre Situation anders zu sehen und sich deshalb auch anders zu verhalten.
Annahme Sechs:
Die Praktiker der Kurztherapie legen in der Regel den Hauptakzent auf das systemische Konzept der Ganzheit: Eine Vernderung in einem Element eines Systems oder in einer der zwischen den Elementen bestehenden Beziehungen wird auch die brigen Elemente und Beziehungen beeinflussen, die miteinander das System bilden. (de Shazer, 1997, S. 70)
De Shazer schreibt: Bei der Suche nach Lsungen fr klinische Probleme bietet sich das Konzept der Ganzheit an, sozusagen als Linse, durch die sich die komplexen Gegebenheiten betrachten lassen. Um es einfach auszudrcken: Die Systemtheorie, auf menschliche Systeme und ihre Schwierigkeiten angewandt, besagt, dass eine Familie (bzw. jede beliebige Gruppe, die als Gruppe eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, nicht nur eine Ansammlung von Einzelwesen ist: Ein menschliches System ist mehr als die Summe seiner Teile. Es besteht nicht nur aus den Individuen, sondern auch aus den Beziehungen zwischen und unter diesen Individuen. Damit ist bereits gesagt, dass die systemische Betrachtung eine gewisse Komplexitt bedingt. Wie auch immer ein System ist ein Ganzes, und jeder Teil eines Systems ist mit den anderen Teilen so verbunden, dass eine nderung in einem Teil eine nderung in allen Teilen und damit dem ganzen System verursacht (Watzlawick u.a., 1967, S. 123; dt. S. 119). (de Shazer, 1997, S. 146)
Nach Weakland liegt der Betrachtung unter dem Aspekt der Interaktion folgende berlegung zugrunde: Wenn die Interaktion unter den Mitgliedern eines sozialen Systems als das angesehen wird, was das Verhalten in erster Linie formt und determiniert, dann folgt daraus, dass eine nderung im Verhalten irgendeines Angehrigen eines interaktiven Systems zumal einer Familie, die ja das weitestverbreitete, das innigste und dauerhafteste System berhaupt ist zu einer damit zusammenhngenden nderung im Verhalten anderer Mitglieder des Systems fhren muss (S.2). (de Shazer, 1997, S. 148) Dazu de Shazer: Da Interaktionsmuster sowohl individuelle als auch systemische Gewohnheiten einschlieen, erscheint es nur logisch, dass nichts weiter notwendig ist, als dass eine einzige Person sich anders verhlt, damit das kollektive Muster durchbrochen wird. (de Shazer, 1997, S. 70)
Wenn die Eltern des Bettnssers geteilter Meinung sind darber, ob das Bettnssen ein Problem oder normal ist, ob ihr Kind bse oder verrckt ist, ob es sich um ein physisches oder um ein psychisches Problem handelt, dann knnte eine Vernderung in der Beziehung der Eltern zueinander dem Bettnssen ein Ende bereiten. Es muss aber nicht gleich bedeuten, dass die Meinungsverschiedenheiten Ursache des Bettnssens wren und auch nicht, dass diese Meinungsverschiedenheiten durch das Bettnssen verursacht wrden. Auch muss das Bettnssen nicht als ein Phnomen betrachtet werden, das die Funktion hat, die Eltern zusammenzuhalten, die sich mglicherweise sonst trennen wrden. (vgl. de Shazer, 1997, S. 70f)
Aus de Shazers Sichtweise verhlt es sich vielmehr ganz einfach so, dass das Bettnssen und das Streiten in rekursiver Weise miteinander in Beziehung stehen. Die Sequenz lsst sich punktieren als (1) je mehr Bettnssen, desto mehr Elternstreit und/oder (2) je mehr Elternstreit, desto mehr Bettnssen. So oder so lautet die Sequenz schlielich nasses Bett/Streit/nasses Bett/Streit usw.. (de Shazer, 1997, S. 71) Nach dem ganzheitlichen Konzept, auch holistisches Konzept genannt, knnte das Ende der Streitereien auch dem Bettnssen ein Ende bereiten und/oder das Ende des Bettnssens auch die Streitereien beendigen.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Denkrahmen und Punktierung der Sequenzen und entsprechend kann der therapeutische Ansatz von Fall zu Fall differieren. Wenn z.B. die Familie die Sequenz punktiert als nasse Betten fhren zu Streitereien, dazu die Situation rahmt als nasse Betten sind das Ergebnis von Verrcktheit oder von Bswilligkeit, dann knnte es von Nutzen sein, dass der Therapeut die ganze Familie zum Gesprch einldt. Er knnte dafr sorgen, dass die alte Sequenz nasses Bett/Streiterei und umgekehrt, unterbrochen wird, indem er die Familie dazu anhlt neue Verhaltensweisen zu entwickeln, die dann als Folge den gewohnten Ablauf unterbrechen und verndern.
Ein denkbares anderes Setting wre nur das Kind einzuladen, besonders dann, wenn es selbst sehr daran interessiert ist, mit dem Bettnssen Schluss zu machen.
Wenn die Eltern, ohne es auszusprechen, die Punktierung htten, dass das nasse Bett die Folge ihrer Unstimmigkeiten ist, dann wre ein Setting ohne das Kind, nur die Eltern allein, gut denkbar.
Nach dem holistischen Konzept wre ein weiteres Setting z.B. allein mit der Mutter denkbar wenn diese die Sequenz nasses Bett/Streit als ihr eigenes Problem ansieht, das vor allem sie bedrckt. Vielleicht sagt sie, dass ihr Mann das Bettnssen nicht als Problem sieht und er der Meinung ist, dass sie einfach vllig berzogen reagiert und deshalb nur sie zur Therapie gehen sollte. In einem solchen Fall kann der Therapeut der Mutter helfen, ihr Verhalten bei den Streitereien mit ihrem Mann und/oder ihre Reaktion auf das nasse Bett zu ndern. An welchem Thema dann zuerst gearbeitet werden soll entscheidet sich an der Zielsetzung. Wenn die Klientin z.B. die Sequenz punktiert als nasse Betten fhren zu Streitereien, dann muss zuerst daran gearbeitet werden wie sie auf das nasse Bett reagiert. Sollte sie die Sequenz punktieren als Streitereien fhren zu Bettnssen, dann muss als erstes ihr Verhalten bei den Streitereien betrachtet werden. (vgl. de Shazer, 1997, S. 71f)
Mit diesem Ansatz, dem systemischen Konzept der Ganzheit, kann ein Therapeut auch nur mit einem Teil, selbst nur mit einer Person einer Familie oder Gruppe erfolgversprechend arbeiten und es ist nicht notwendigerweise erforderlich, jeden am Problem Beteiligten dabeizuhaben, wenn eine nderung in eine gewnschte Richtung angestrebt wird.
4. Methodik
In den einen oder anderen Punkt der sechs Grundannahmen sind bereits Aussagen ber die Methodik eingeflossen. Im folgenden mchte ich die mir als zentral erscheinenden Methoden, die de Shazer und sein Team anwenden, aufzeigen. Einige dieser Methoden wurden am BFTC entwickelt und einige wurden von andern Therapiekonzepten bernommen.
4.1. Kategorisierung des Klienten
Von Beginn an wird im Konzept der Kurztherapie an Vernderung gearbeitet. Eine Abklrung, zu welcher Kategorie der Klient zu zhlen ist, ob Besucher, Klagender oder Kunde gehrt zum essentiellen Repertoire der Kurztherapie: Um in einen Therapieprozess einsteigen zu knnen, ist es am BFTC Voraussetzung zunchst als Kunde kategorisiert zu werden. Die Abklrung erfolgt schon in der ersten Begegnung mit den Klienten.
Je nach der Art wie ein Klient seine Probleme schildert wird ihm vom Therapeuten ein unterschiedliches Kontraktangebot gemacht.
Besucher (Visitor)
Besucher kommen oft nicht freiwillig, es gibt keine explizite Beschwerde, keine Vernderungserwartung/keinen Vernderungsauftrag. In diesem Fall werden nur Komplimente gemacht, die bisherigen Lsungen positiv gewertet, ansonsten weder Therapie noch Aufgaben angeboten.
Klagender (Complainer)
Als Klagende werden Personen mit Beschwerden bezeichnet, doch wird die Vernderung in erster Linie von anderen erwartet (z.B. vom Therapeuten oder vom Ehepartner). In der Therapie werden hier vor allem Verhaltensbeobachtungs- oder Denkaufgaben gestellt.
Kunde (Customer)
Nur Personen, die eine Beschwerde haben, aber darber hinaus die Vorstellung mitbringen, aktiv etwas dagegen tun zu knnen, werden als Kunden angesehen, mit denen es einen Vernderungskontrakt gibt. Sie bekommen neben Beobachtung- auch verhaltensrelevante Aufgaben. (von Schlippe u. Schweitzer, 1997, S.37) Natrlich ist es nicht immer einfach, eine klare Einschtzung und Zuordnung zwischen den drei Kategorien vorzunehmen. Wenn der Therapeut unsicher ist, z.B. zwischen Kunde und Klagender schwankt, dann ist es besser vorsichtig zu sein und eine Beobachtungsaufgabe (Standardaufgabe der ersten Sitzung - siehe Punkt Hausaufgaben und Standardaufgaben-) zu stellen. Ein solcher Klient wird zunchst in die Kategorie des Klagenden eingeordnet. Es ist durchaus mglich, dass aus dem Klagenden ein Kunde wird, mglicherweise als Resultat des Erstgesprchs und/oder seiner Beobachtungsaufgabe
4.2. Das Passen entwickeln
Unter Passen, im amerikanischen Original fit genannt, wird eine bestimmte Art von Beziehung zwischen Therapeut und Klient verstanden. Ihre Merkmale sind:
zeitliche Begrenzung besondere Nhe Aufgeschlossenheit/Harmonie
Gelingt es, das Passen herzustellen, dann ist zu erwarten, dass alle Teilnehmer aufmerksam zuhren. Passen ist ein gegenseitiger Prozess, an dem sowohl der Therapeut, als auch die Menschen, die zu ihm mit einem Anliegen kommen, beteiligt sind. Im Verlauf der therapeutischen Beziehung beginnen sie sich zu vertrauen, schenken einander groe Beachtung und akzeptieren die jeweiligen Weltbilder als einleuchtend, wertvoll und bedeutsam. Wenn ein Therapeut das Weltbild seines Klienten akzeptiert, kann er sehr viel dazu beitragen, das Problem, das den Klienten beschftigt so einfach und leicht wie mglich zu lsen. (vgl. de Shazer, 1989, S. 107)
Entscheidend dabei ist die Haltung des Therapeuten. Er sollte dem Klienten durch sein Verhalten signalisieren, dass dieser alle Fhigkeiten besitzt, die ntig sind um ein Problem zu lsen. Durch das feste Vertrauen in die Fhigkeiten des Klienten, der selbst oft nicht wei , dass er bereits wei wie er sein Problem lsen kann, entwickelt sich mit der Zeit ein Selbstvertrauen in dessen eigene Fhigkeiten schwierige Situationen zu meistern. Dazu Erickson: Ihr bewusster Verstand ist sehr intelligent und Ihr Unbewusstes ist noch ein ganzes Stck schlauer als Sie. (de Shazer, 1989, S. 108)
Rasche erfolgreiche Vernderungen, die in de Shazers Konzept schon sogleich mit Beginn der Therapie angestrebt werden, ermutigen den Klienten sich auf die Beziehung zum Therapeuten einzulassen.
Die Suche nach Ausnahmen gestattet es dem Therapeuten das Gesprch darauf zu fokussieren, was der Klient bereits Richtiges und Sinnvolles tut, und deshalb kann das Passen relativ leicht entwickelt werden. Es ist fr alle Beteiligten angenehmer ber die positive Seite von Dingen zu sprechen.
Das Passen wird gefrdert, wenn Ziele gesteckt werden, die helfen festzustellen, wie Klient und Therapeut herausfinden knnen, wann ein beklagter Sachverhalt gelst ist. Beide, Therapeut und Klient sind so leichter in der Lage herauszufinden, wann eine Therapie erfolgreich ist. Beide knnen sich daran erfreuen und Mut fassen fr etwaige weitere Schritte.
Die Therapeuten am BFTC beginnen Interventionen oft mit einer Reihe von Komplimenten. Es sind Aussagen des Therapeuten darber, was der Klient Ntzliches, Wirksames, Gutes oder Lustiges gesagt hat. Diese Komplimente tragen auch dazu bei, das Passen zwischen Klient und Therapeut und damit die Kooperation bei der anstehenden Arbeit zu frdern. Komplimente enthalten meist Aussagen ber die Schwierigkeit, das gewnschte Ziel zu erreichen und die Fortschritte, die schon in diese Richtung gemacht wurden.
Fr de Shazer ist Passen ein qualitativer Begriff, der die Beziehung zwischen Klienten und Therapeuten, die Richtung, die das Gesprch nimmt, und das/die Ziel(e) einbezieht. All das trgt dazu bei, die Wichtigkeit der Gegenwart fr die Zukunft hervorzuheben, und damit der Therapiesituation Sinn zu verleihen. (vgl. de Shazer, 1989, S. 114f)
4.3. Hausaufgaben und Standardaufgaben
De Shazer gibt einen Vergleich:
Ziele sind wie Zielscheiben, auf die der Therapeut und der Klient zielen die Aufgaben sind wie Pfeile. D.h. die Aufgaben sind so konzipiert, dass das Ziel erreicht wird, so wie ein Pfeil so konstruiert ist, dass er die Scheibe trifft. Ein guter Pfeil kann besser ins Schwarze treffen eine gut durchdachte Aufgabe besser das Ziel treffen! Aufgaben sollten den Klienten logisch und vernnftig erscheinen. Die Logik entsteht, indem whrend der Sitzung ber Vernderung gesprochen wird. (vgl. de Shazer, 1989, S. 114f)
De Shazer nennt sieben allgemeine Richtlinien fr Aufgaben:
1.
Stelle fest, welche Dinge die Klienten tun, die gut, ntzlich und wirksam sind.
2. Stelle den Unterschied fest zwischen dem, was geschieht, wenn eine Ausnahme vorkommt und dem, was geschieht, wenn die Beschwerde auftritt. Frdere das erstere.
3.
Wenn mglich, lasse dir jede Ausnahme Schritt fr Schritt beschreiben. a. b. Finde heraus, was funktioniert, bzw. finde heraus, was funktioniert hat, bzw.
finde heraus, was funktionieren knnte; dann
c.-
verschreibe das Leichteste.
Sind Aspekte der Ausnahme (oder der Beschwerde) irgendwie zufllig, dann d. baue etwas Willkrliches oder einen Zufallsfaktor in die Aufgabe ein. Wenn ntig, lass dir die Beschwerde Schritt fr Schritt beschreiben.
4.
5.
Stelle Unterschiede zwischen hypothetischen Lsungen und der Beschwerde fest.
6.
Stelle dir eine Lsungsversion der problematischen Situation vor, indem du a. Ausnahmen zur Regel machst, b. den Ort des Beschwerdemusters vernderst, c. d. e. f. g. h. i. in der Zusammensetzung, der am Beschwerdemuster Beteiligten eine nderung bewirkst,
die Reihenfolge der beteiligten Schritte vernderst, dem Beschwerdemuster ein neues Element oder einen neuen Schritt hinzufgst, die Dauer des Musters verlngerst, zuflliges Anfangen und Beenden einfhrst, die Hufigkeit des Musters erhhst, die Modalitt des problematischen Verhaltens nderst.
7. Entscheide, was fr den Klagenden/Kunden passt, d.h. welche Aufgabe, basierend auf welcher Variablen (a-i) einem bestimmten Klienten vernnftig erscheinen wird. Welche wird der Klagende am ehesten akzeptieren? Welche wird der Kunde am ehesten ausfhren? Z.B.: Hat ein Paar eine gemeinsame Beschwerde, gib beiden eine gemeinsame, kooperative Aufgabe. Unterbreitet nur ein Partner die Beschwerde wie ein Kunde, gib dem Kunden eine Aufgabe, bei der er etwas tun muss, und dem anderen Partner eine Beobachtungsaufgabe. (vgl. de Shazer, 1989, 115f)
De Shazer hat ein Schema entwickelt, das er Entscheidungsbaum nennt. Dieses Schema hilft dem Therapeuten, in der bestmglichen Weise auf die Reaktionen des Klienten bezglich seiner Hausaufgaben einzugehen. Ziel dabei ist es, die Kooperation zu frdern und damit den Lsungsprozess zu untersttzen
Ein Beispiel: Der Therapeut erteilte eine konkrete Aufgabe nach der ersten Sitzung. Wenn der Klient diese zgig ausfhrt (d.h. die Intervention hat gepasst) dann sollte der Therapeut wiederum eine konkrete Hausaufgabe stellen. Der Therapeut kooperiert, indem auch er tut, was der Klient mit der vorhergegangenen Aufgabe getan hat. Wenn der Klient aber ohne seine Hausaufgaben gemacht zu haben zur nchsten Sitzung kommt, dann sollte der Therapeut in der Weise kooperieren und damit den Eindruck des passenden Vorgehens prsent halten, indem er diesem Klienten in dieser Sitzung keine konkrete Hausaufgabe mehr gibt. Wenn der Klient seine Hausaufgabe modifiziert hat, dann ist das ein Signal fr den Therapeuten, diesem Klienten eine leicht zu modifizierende Aufgabe oder eine Aufgabe mit mehreren Optionen und Wahlmglichkeiten zu stellen. Fr diesen Klienten sind solche Aufgaben passend, und darauf legt de Shazer
groen Wert um eine bestmgliche Kooperation mit dem jeweiligen Klienten zu erreichen (Tit for Tat). (vgl. de Shazer, 1997, S. 101)
In seinem Buch Der Dreh berichtet de Shazer ber eine Fokusverlagerung der Hausaufgaben und der Standardaufgaben. Diese wurden blicherweise am Schluss eines Therapiegesprchs dem Klienten mitgeteilt. De Shazer verlegte sie an den Beginn des Gesprchs. Durch eine gezielte Beobachtung eines Teams am BFTC von Erstgesprchen bemerkten sie, dass Klienten oft spontan von einer Vernderung im Problembereich sprachen, die sich unmittelbar vor der ersten Sitzung zugetragen hat. Das BFTC reagierte darauf, indem sie zum Verhalten fr die zweite Sitzung bergingen d.h. sie untersuchen eingehend die Vernderung, die bereits stattgefunden hat und frdern und untersttzen sie in den weiteren Interventionen. (vgl. die Shazer, 1989, S. 13)
Zuvor diente der Gesprchsprozess in erster Linie dazu eine passende Interventionsstrategie zu erarbeiten, die zur Aufgabenstellung fhren sollte. Die Aufgaben wurden als zentraler Punkt in der Therapie, als der Schlssel zur Lsung angesehen, der dem Klienten vom Therapeuten am Ende der Sitzung ausgehndigt wurde.
Dennoch behalten die Aufgaben ihre Bedeutung. Sie sind aber deutlicher mit dem Gesprchsprozess verknpft und hngen davon ab, wie Klient und Therapeut diesen konstruieren.
4.4. Ausnahmen
Beobachter beeinflussen nicht nur das, was sie beobachten, sondern, zumindest in Bezug auf Situationen der menschlichen Interaktion, tragen sie auch dazu bei, das zu schaffen, was sie beobachten. Als wir zum Beispiel die Vorstellung entwickelten, fr jede (Beschwerde-) Regel gibt es eine Ausnahme, fingen wir an die Klienten zu fragen: Was geschieht, wenn die Beschwerde nicht da ist? Das trug ganz konkret dazu bei, Ausnahmen zu erzeugen, schreibt de Shazer und weiter: Wie wir aus jahrelanger Erfahrung wissen, werden Ausnahmen selten spontan erwhnt. Wenn im wirklichen Leben eine Ausnahme auftreten sollte, wird sie vielleicht als glcklicher Zufall angesehen oder berhaupt nicht bemerkt und ist deshalb auch kein Unterschied, der einen Unterschied macht. Wenn wir also nicht fragen wrden, wrden die Klienten vermutlich nichts darber sagen. (de Shazer, 1989, S. 204f)
De Shazer definiert Ausnahmen als alles, was passiert, wenn die Beschwerde nicht vorhanden ist. (de Shazer, 1989, S. 70)
Die Therapeuten am BFTC nehmen sich sehr viel Zeit dafr, ihre Klienten nach Ausnahmen von der Regel zu fragen. In den meisten anderen Therapieformen wird sehr viel Zeit darauf verwendet, dem Klienten Raum fr die Beschreibung seiner Beschwerde oder seines Problems zu geben, die ihn dazu veranlasst hat eine therapeutische Behandlung zu beginnen. Der Therapeut wird dann hufig die Beschwerde sehr detailliert untersuchen, wenn sich auch das, was der Therapeut als wichtig erachtet, je nach Methode unterscheidet.
Mit der Weiterentwicklung eines lsungsor



![Terapia Breve Centrada en Soluc de Shazer Et Al[1]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/563dbb9c550346aa9aaeabb2/terapia-breve-centrada-en-soluc-de-shazer-et-al1.jpg)