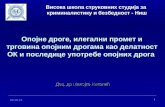Der Beifuß – Heilkraut und Droge, Gewürz und Allergen
-
Upload
thomas-junghans -
Category
Documents
-
view
216 -
download
4
Transcript of Der Beifuß – Heilkraut und Droge, Gewürz und Allergen
| FO RU M
© 2006 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.pharmuz.de 4/2006 (35) | Pharm. Unserer Zeit | 373
Die weltweit rund 300 Beifuß-Arten(Gattung Artemisia) kommen vor al-lem in den offenen Steppengebietenund den Halb- und Trockenwüstender Nordhalbkugel vor, wo einzelneArtemisia-Arten vegetationsbestim-mend sein können, wie z.B. Artemi-sia californica im Chaparral, einemverbuschten Grasland mit mediterra-nem Klima an der Küste Südkaliforni-ens. Die Dominanz der Beifuß-Pflan-zen beruht dabei ganz wesentlich aufder inhibitorischen Wirkung von Ter-pentoxinen, die die Samenkeimungund das Wachstum benachbarterPflanzen stark hemmen. Dieses alsAllelopathie bezeichnete Phänomenbedingt eine sehr charakteristischeZonierung der Vegetation, bei dereinzelne Büsche oder Gruppen vonBüschen von Kümmerwuchs umge-ben sind, auf den eine kahle Zonefolgt. Beifuß-Arten sind überwiegendHalbsträucher und ausdauerndeKräuter, die oft filzig behaart sindund häufig mehrfach tief-fieder-schnittige, fein zerteilte Blätter auf-weisen. Die Blütenköpfe dieser Ver-treter der Korbblütler sind meist sehrzahlreich und klein und bestehenausschließlich aus Röhrenblüten, diegelb, weiß oder rötlich gefärbt sind.
Innerhalb dieser Asteraceen-Gruppe vollzieht sich ein Übergangvon der Insekten- zur sekundärenWindblütigkeit. Mit der Anpassungan den unsteten BestäubungsvektorWind gehen dabei typische morpho-logische Veränderungen einher: Ver-mehrung der Zahl der Blütenköpf-chen, weit heraushängende Griffelder randständigen Blüten, abneh-mender Kittstoffgehalt der Pollen so-wie eine glatte Oberfläche der Pol-lenkörner. Einen Eindruck von derenormen Anzahl der gebildeten Pol-lenkörner bekommt man, wenn manbedenkt, dass z.B. große Exemplaredes Gemeinen Beifuß (Artemisia vul-garis) 500.000 Köpfchen mit bis zu
10 Millionen Blüten enthalten. Dieaus diesen von etwa Juli bis Septem-ber freigesetzten Pollen wirken dabeiähnlich wie Gräser- und Baumpollenals Allergene. So ist denn auch dieBeifuß-Allergie die am häufigstenauftretende Soforttypallergie aufKräuterpollen in Mitteleuropa.
Neben Artemisia können auchVertreter der nah verwandten, ausNordamerika mit Vogelfutter oderdurch den internationalen Reise-verkehr eingeschleppten GattungAmbrosia als Allergene fungierenund dabei die Wirkung des Beifußüberlagern. Hier ist besonders dieBeifuß-Ambrosie (Ambrosia artemi-siifolia) zu nennen, die in ihrer nord-amerikanischen Heimat Hauptverur-sacher des Spätsommer-Heuschnup-fens ist. Obwohl die Art in Deutsch-land bislang nur meist kleinere undunbeständige Vorkommen zeigt, gehen trotzdem bereits rund 1 % der allergischen Erkrankungen mit etwa32 Millionen Euro an Behandlungs-kosten auf ihr Konto, wie eine Studiedes Umweltbundesamts zu den öko-nomischen Folgen der Ausbreitung
nichteinhei-mischer Tier- undPflanzenarten ge-zeigt hat.
Aufgrund desVorhandenseinsätherischer Ölewerden die aro-matisch riechen-den und bitterschmeckendenBeifuß-Arten be-reits seit demAltertum als Heil-und Gewürz-pflanze verwen-det. Ein bekann-tes Beispiel istder Estragon (Ar-temisia dracunculus). Das aus Asienstammende Artemisia annua wirdals Lieferant des Artemisinins auch inMitteleuropa angebaut. An demNachweis über die vermutete Wirk-samkeit dieses Sesquiterpenlactonsmit Endoperoxidbrücke gegen Malaria und Krebs wird intensiv ge-forscht. Ebenfalls seit der Antikewird der Wermut oder Absinth (Arte-misia absinthium) kultiviert, in Süd-deutschland, z.B. am Bodensee, istder feldmäßige Anbau seit dem 9. Jahrhundert belegt. Besonders En-de des 19. bzw. Anfang des 20. Jahr-hunderts – und vor allem in Frank-reich – wurde der Absinth als ge-süßte Mischung aus Wermutöl, Alko-hol, Anis, Zitronenmelisse und weite-ren Zutaten zum ausgesprochen po-pulären Modegetränk, vor allem derKünstler. Die mit dem Absinth-Ge-nuss einhergehenden schweren psy-chischen Störungen resultieren ausder neurotoxischen, halluzinogenenund psychoaktiven Wirksamkeit desThujons, denen z.B. auch der abhän-gige Absinthtrinker Vincent van Gogh zum Opfer fiel. Nachdem Her-stellung und Verkauf lange Zeit ver-boten waren, erlebt der Absinth seiteinigen Jahren eine ebenso zwei-felhafte wie unheilvolle Renaissanceals nostalgisches Szene- und Modege-tränk.
Thomas Junghans und Petra Stüttgen, Bammental
P F L A N Z E N P O R T R A I T |Der Beifuß – Heilkraut und Droge, Gewürz und Allergen
A B B . 1 Der Ab-sinth (Artemisiaabsinthium) besie-delt mäßig trocke-ne, sandige bissteinige Standortewie Wegränderund Ruderalstel-len in wärmerenLandesteilen wiehier in der nörd-lichen Ober-rheinebene bei Mannheim.
A B B . 2 Die berühmte Artemis-Statueim Ephesos-Museum in Selçuk in derSüdwest-Türkei zeigt die griechischeGöttin, Herrin und Beschützerin der Na-tur mit den als Brüsten oder Stierhodengedeuteten Fruchtbarkeitssymbolen.
373_PHA_forum_Beifuß 19.06.2006 8:26 Uhr Seite 373