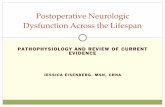ZFA 10 2014 - online-zfa.de · Abszess eröffnet: Postoperative Antibiose? Abscess Opened:...
Transcript of ZFA 10 2014 - online-zfa.de · Abszess eröffnet: Postoperative Antibiose? Abscess Opened:...
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Z FAZeitschrift für Allgemeinmedizin
German Journal of Family Medicine
Oktober 2014 – Seite 385-432 – 90. Jahrgang www.online-zfa.de
10 / 2014
Im Fokus
Beratungsanlass Beinödem – diagnostisches Vorgehen in der Hausarztpraxis
Stillen – ein Thema für die Hausarztpraxis
HZV in Baden- Württemberg
Europäische Taskforce Palliativversorgung
Dauerthema eGesundheitskarte
Was motiviert unsere Studierenden?
Organ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM),der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA), der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM), der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM), der Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM) und der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)
Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians, the Society of Professors of Family Medicine, the Salzburg Society of Family Medicine, the Southtyrolean College of General Practitioners, the Tyrolean College of General Practitioners and the Vorarlberg Society of Family Medicine
This journal is regularly listed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus and CCMED/MEDPILOT
DP AG Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – 4402 – Heft 10 / 2014 Deutscher Ärzte-Verlag GmbH – Postfach 40 02 65 – 50832 Köln
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)Mehr Informationen: www.aerzteverlag.de
QEP Qualitätsmanagement –Profitieren Sie von klaren Praxisabläufen
Irrt
üm
eru
nd
Prei
sän
deru
nge
nvo
rbeh
alte
n.P
reis
ezz
gl.V
ersa
nds
pese
n€
4,50
.Deu
tsch
erÄ
rzte
-Ver
lag
Gm
bH–
Sitz
Köln
–H
RB10
6A
mts
geri
cht
Köln
.G
esch
äfts
füh
run
g:N
orbe
rtA
.Fro
itzh
eim
,Jü
rgen
Füh
rer
B E S T E L L S C H E I N
Ja, hiermit bestelle ich mit 14-tägigem Rückgaberecht
___ QEP Manual 199,– €
___ QEP Qualitätsziel-Katalog 29,95 €
� Herr � Frau
Name, Vorname
Fachgebiet
Klinik/Praxis/Firma
Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail-Adresse � (Die Deutsche Ärzte-Verlag GmbH darf mich per E-Mail zuWerbezwecken über verschiedene Angebote informieren)
✗ Datum ✗ Unterschrift
E-Mail: [email protected]: 02234 7011-314, Fax: 02234 7011-476Postfach 400244, 50832 KölnVersandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands bei Online-Bestellung A
32001M
M2//ZFA
Franziska Diel/Bernhard Gibis (Hrsg.), KBVQEP ManualFür Praxen. Für Kooperationen. Für MVZ. Version 20102012, 2. Auflage, 2 Ordner DIN A 4,494 Seiten, inklusive QEP-Handbuch (Leerordner),CD-ROM.ISBN 978-3-7691-3304-2
€ 199,–
Franziska Diel/Bernhard Gibis (Hrsg.), KBVQEP Qualitätsziel-KatalogFür Praxen. Für Kooperationen. Für MVZ. Version 20102011, 2. Auflage, broschiert, DIN A 4, 199 SeitenISBN 978-3-7691-3303-5
€ 29,95
Das QEP Manual bietet Ihnen• Umfassend überarbeitete und ergänzte Umsetzungs-
vorschläge und Tipps• Über 200 individuell anpassbare Musterdokumente und
weitere Informationen auf CD-ROM• Verlinktes Quellen- und Inhaltsverzeichnis, elektronische
Ordnerstruktur• Kopiervorlagen für Checklisten, Zeit- und Maßnahmenpläne• Leicht verständliche Arbeitshilfen
Ihre Vorteile• Speziell für Praxen und MVZ entwickelt von Ärzten für Ärzte• Spart Zeit und Kosten durch strukturierte Abläufe• Erfüllt gesetzliche Vorgaben• Sorgt für mehr Sicherheit in der
Patientenversorgung
Musterdokumente undweitere Infos und Materialien
Version 2010Aktualisierung 2012
®
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Licht am Ende des Tunnels …
Hamburg war eine Reise wert. Der dort vor wenigen Wochen zu Ende gegange-ne 48. DEGAM-Kongress war in jeder Hinsicht ein Er-folg. Eine Rekordteilneh-merzahl (mehr als 700), überwiegend junge Kolle-ginnen und Kollegen aus Praxen und universitären Einrichtungen, viele Stu-dierende, unsere DEGAM-Nachwuchsakademie, die Absolventen des Professio-nalisierungskurses, die den Staffelstab an ihre Nachfol-
ger übergaben sowie eine hohe wissenschaftliche Qualität und auch Praxisrelevanz der Poster, Vorträge und Workshops spre-chen für sich. Die spürbare Aufbruchsstimmung wurde beför-dert durch einen strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Manche, so war zu hören, hätten sich noch mehr Zeit ge-wünscht für den Austausch und Begegnungen am Rande des Kongresses. Den Organisatoren des Kongresses, Martin Scherer und seinem Team, der DEGAM-Geschäftsstelle und allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, ein herzliches Danke-schön.
Auf Vorschlag des DEGAM-Präsidiums wählte die Mitglie-derversammlung am 18. September 2014 Michael M. Kochen zum ersten Ehrenpräsidenten unserer Fachgesellschaft. Sie würdigte damit seinen jahrzehntelangen Einsatz für die All-gemeinmedizin und die Hausärzteschaft in Deutschland und weit darüber hinaus. Michael Kochen war seit 1985 Präsidi-umsmitglied der DEGAM, von 2004–2010 deren Präsident und
ist seither Sonderbeauftragter für die DEGAM-Benefits. Micha-el Kochen hat diese Art des Wissenstransfers zu einer unver-wechselbaren Marke der „gelebten“ evidenzbasierten Medizin entwickelt und seit 2004 mehr als 500 DEGAM-Benefits er-stellt. Wir hoffen, dass noch viele derartige „Wohltaten“ folgen mögen und senden auf diesem Weg unsere herzlichsten Glück-wünsche nach Freiburg.
Neben den oben geschilderten, durchaus subjektiv erleb-ten Indikatoren dafür, dass es mit der Allgemeinmedizin wie-der vorwärts geht, gibt es auch „harte Daten“. Die akademische Institutionalisierung kommt voran; in den letzten Monaten wurde eine Reihe von Lehrstühlen besetzt und neue Ausschrei-bungen sind auf dem Weg. Die Zahl der Weiterbildungsverbün-de als ein wichtiger Garant für Planungssicherheit in der beruf-lichen Karriere unseres Nachwuchses steigt. Die Akzeptanz un-seres Faches bei den Studierenden ist im Aufwind, wie das von der KBV in Auftrag gegebene „Berufsmonitoring Medizinstu-denten 2014“ belegt. Die politischen Rahmenbedingungen mit dem erklärten Willen der „Stärkung der Allgemeinmedi-zin“ sind so günstig wie noch nie. Sie sollen mit dem bevorste-henden „Versorgungsstärkungsgesetz“ in Paragrafen gegossen werden. Nicht zuletzt zeigen die kürzlich präsentierten Ergeb-nisse der wissenschaftlichen Evaluation der Hausarztzentrier-ten Versorgung in Baden-Württemberg aller anfänglichen Skepsis zum Trotz, dass besonders ältere und chronisch Kranke von der patientenorientierten Versorgung durch engagierte Hausärzte und ihrem Mitarbeiterteam profitieren.
Es gilt nun auf diesen Wegen weiter zu gehen, sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen. Ich ganz persönlich sehe Licht am Ende eines langen Tunnels.
Mit herzlichen GrüßenW. Niebling
385EDITORIAL / EDITORIAL
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
386 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS
ZFAZeitschrift für Allgemeinmedizin
Organ der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien-medizin (DEGAM), der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA), der Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM), der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM),der Tiroler Gesellschaft für Allgemein-medizin (TGAM),der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)
Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians,the Society of Professors of Family Medicine, the Salzburg Society of Family Medicine,the Southtyrolean College of General Practitioners,the Tyrolean College of General Practitioners,the Vorarlberg Society of Family Medicine
Herausgeber/Editors M. M. Kochen, Freiburg (federführend) H.-H. Abholz, Düsseldorf S. Rabady, Windigsteig W. Niebling, Freiburg im Breisgau A. Sönnichsen, Witten
Internationaler Beirat/International Advisory Board J. Beasley, Madison/Wisconsin, USA; F. Buntinx, Leuven/Belgien; G.-J. Dinant, Maastricht/NL; M. Egger, Bern/CH; E. Garrett, Columbia/Missouri, USA; P. Glasziou, Robina/Australien; T. Greenhalgh, London/UK; P. Hjort-dahl, Oslo/Norwegen; E. Kahana, Cleve-land/Ohio, USA; A. Knottnerus, Maas-tricht/NL; J. Lexchin, Toronto/Ontario, Kanada; C. del Mar, Robina/Australien; J. de Maeseneer, Gent/Belgien; P. van Royen, Antwerpen/ Belgien; F. Sullivan, Dundee/Schottland, UK; C. van Weel, Nijmegen/NL; Y. Yaphe, Porto/Portugal
Koordination/Coordination J. Bluhme-Rasmussen
This journal is regularly listed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus and CCMED/MEDPILOT
Dieselstraße 2, 50859 KölnPostfach/P.O. Box 40 02 54,50832 KölnTelefon/Phone: (0 22 34) 70 11–0www.aerzteverlag.dewww.online-zfa.de
EDITORIAL / EDITORIAL 385...........................................................
DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS 387.....................................
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPERDiagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative Untersuchung Diagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative StudyStefan Bösner, Judith Diederich, Simone Hartel, Erika Baum 391..............................
DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLEInternationale Expertise zur Entwicklung der Palliativversorgung in der Primärversorgung International Experts’ Report for the Development of Palliative Care in Primary CareNils Schneider 398.....................................................................................
ZWISCHEN DEN ZEILEN / BETWEEN THE LINESVergütung von Palliativmedizin in der hausarztzentrierten Versorgung Jörg Schelling 402......................................................................................
KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINIONElektronische Gesundheitskarte – wie Ärzte geködert und Patienten hinters Licht geführt werdenWilfried Deiß 404......................................................................................
FORTBILDUNG / CONTINUING MEDICAL EDUCATIONFortbildungsstrukturen des Landesverbandes Baden-Württemberg für Medizinische Fachangestellte (MFAs) 406........................................
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPERGerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family PracticeKarola Mergenthal, Corina Güthlin, Lisa-Rebekka Ulrich, Juliana J. Petersen, Julia Hirschfeld, Andrea Siebenhofer 409...........................................................
ÜBERSICHT / REVIEW„Selbsthilfefreundlichkeit“ als Ansatz der Kooperation von Selbsthilfegruppen und niedergelassenen ÄrztenSelf-Help Friendliness as an Approach to Collaboration Between Self-Help Groups and Doctors Alf Trojan 415..........................................................................................
ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPEREine qualitative Untersuchung zur Entwicklung der Studienmotivation angehender HumanmedizinerA Qualitative Analysis Regarding the Development of Future Physicians’ Studies-Related MotivationAnn Margareta Bernhardt, Martin Träder 419.....................................................
ÜBERSICHT / REVIEWBeratungsanlass „Fragen zum Stillen“ – was jeder Hausarzt wissen sollteQuestions Related to Breastfeeding – What Every Family Physician Should KnowChristine Bruni, Jost Steinhäuser 424...............................................................
DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS 428..................................
DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND / GERMAN ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS 430....................
BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW 431.....................................
IMPRESSUM / IMPRINT 432..............................................................
Titelfoto: © Wilfried Deiß
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
DEGAM-BenefitsDEGAM Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Freiburg
29.000-mal teurer als Gold: Alemtuzumab (Lemtrada®) gegen Multiple Sklerose 29.000 Times as Much as Gold: Alemtuzumab Against Multiple Sklerosis
Was waren das noch für Zeiten, als ein Buch mit dem Titel „Neunmal teurer als Gold“* Schlagzeilen machen konnte. Vor gut 45 Jahren stand das Antidiabetikum Euglucon® mit dem Wirkstoff Glibencla-mid im Fokus, heute ein Cent-Artikel. Jetzt bringt Sanofi-Aventis den Antikörper
Alemtuzumab als Lemtrada® gegen Multiple Sklerose (MS) für das 29.000-fache des Goldpreises neu in den Handel (1 Injektionsfla-sche zu 12 mg für 10.653,50 Euro, ent-sprechend 888 Euro pro mg)**, eine stra-tegisch vorbereitete
gigantische Verteue-rung des Wirkstoffes.
Erst vor einem Jahr hat die Firma das Alemtuzumab-haltige Mabcampath, das der Behandlung von chronisch lymphati-scher Leukämie vom B-Zell-Typ (B-CLL) diente, aus dem Handel gezogen. Damals kostete Alemtuzumab noch „lediglich“ 21,07 Euro pro mg (1.897 Euro für 3 x 30 mg Infusionskonzentrat). Die Strategie der Firma – Verzicht auf Zulassung gegen B-CLL, dem Sanofi-Aventis damals durch-aus einen unternehmerischen Aspekt ein-räumte (a-t 2012; 43: 73–4), und Neueta -blierung als 40-fach teureres Mittel gegen MS – war und ist durchsichtig. Sanofi will zudem ein neues Hochpreisniveau für MS-Mittel etablieren. Waren wir im vori-gen Jahr noch von einem anzunehmen-den Preisniveau für Lemtrada® etwa auf der Höhe eines bereits teuren MS-Mittels
wie beispielsweise Fingolimod (Gilenya®: 2.325 Euro/4 Wochen) ausgegangen, sind für Lemtrada® jetzt pro 4 Wochen rech-nerisch 3.278 Euro*** aufzuwenden, also 41 % mehr.
Redaktion arznei-telegramm A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin GmbH Bergstr. 38 A, Wasserturm, D-12169 Berlin, www.arznei-telegramm.de [email protected]
* Friedrich V, Hehn A, Rosenbrock R. Neunmal teurer
als Gold – Die Arzneimittelversorgung in der Bundes-
republik. rororo aktuell Nr. 4067, 1977
** 1 Feinunze Gold (31,1 g) kostet 966,04 Euro (7.
Okt. 2013), das sind 0,03 Euro pro Milligramm.
*** In zwei Jahren werden 8 Infusionen zu 12 mg
(85.228 Euro) gegeben. Heruntergerechnet auf 4 Wo-
chen entspricht dies Kosten von 3.278 Euro.Foto
: fot
olia
/Hay
ati K
ayha
n
Abszess eröffnet: Postoperative Antibiose?Abscess Opened: Postoperative Antibiotic Treatment?
When given in addition to incision and drainage, systemic antibiotics do not sig-nificantly improve the percentage of pa-tients with complete resolution of their abscesses
Wie wir alle im Studium gelernt haben, sollen (nach dem Hippokrates zuge-schriebenen Satz „Ubi Pus, ibi evacua“) Abszesse inzidiert und entleert werden. Nach vorliegenden Zahlen erscheinen Patienten mit Abszessen offenbar immer häufiger in Praxen und Kliniken. In den USA hat die Zahl der entsprechenden Be-suche in Notfallstationen zwischen 1996 und 2005 von 1,2 auf 3,3 Millionen zuge-
nommen (die Gesamtzahl der Besuche stieg hingegen deutlich langsamer an).
Auch wenn Sie das vielleicht mit un-gläubigem Staunen zur Kenntnis neh-men, erhalten laut Studien rund die Hälfte aller Abszess-Patienten in Notfall-stationen der Vereinigten Staaten nach erfolgter chirurgischer Behandlung An-tibiotika (davon 51 % Trimethoprim-Sulfamethoxazol).
Muss man (ansonsten unkompli-zierte) Abszesse lediglich operieren oder sind danach auch noch Antibiotika in-diziert?
Eine kürzlich publizierte Metaanaly-se fand in der Literatur zwar 106 Studien
zu diesem Thema, davon waren aber ge-rade einmal vier randomisiert und pla-cebokontrolliert (rekrutiert: 428 Er-wachsene und 161 Kinder). Die Teilneh-mer wurden entweder einem Antibioti-kum (Cefridin, Cefalexin, TMP-SMZ) oder einem Placebo zugeteilt.
Nach Ablauf von mindestens sieben und maximal zehn Tagen ergaben sich keine signifikanten Vorteile einer Anti-biose nach Inzision und Drainage.
Singer AJ, Thode HC. Systemic antibiotics after incision and drainage of simple ab-scesses: a meta-analysis. Emerg Med J 2014; 31: 576–578
387DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
388 DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
13-jähriges Mädchen mit Fieber, Halsschmerzen und CäsarenhalsA 13 Year Old Girl with Fever, Sore Throat and Bull Neck
Ein 13-jähriges Mädchen (Abb. 1) stellte sich in der Notfallaufnahme eines Kran-kenhauses in Kalkutta vor. Seit acht Ta-gen klagte sie über Fieber, starke Hals-schmerzen, eine heisere Stimme und Atembeschwerden. Im Foto ist eine Ver-breiterung des Halses sichtbar, die im Englischen „bull neck“ und im Deut-schen „Cäsarenhals“ genannt wird. Der Blutdruck war normal, die Herzfrequenz tachykard.
Beim Blick in den Rachen offenbarte sich der Anblick in Abbildung 2. Bei der Ab-nahme eines Rachenabstrichs blutete es.
Obwohl die Mehrheit von Ihnen noch nie eine solche Patientin gesehen hat, sind die Bilder doch ziemlich ein-deutig und erlauben die Diagnose: Diphtherie
Bleibt noch zu sagen, dass das Mäd-chen zwar geimpft war, aber lediglich ei-
ne der empfohlenen drei Dosen der ent-sprechenden Vakzine erhalten hatte. Die Patientin wurde mit initial 80.000 IU Antiserum, 10 Tage lang mit 2 x 600.000 IU Penicillin G intramuskulär und anschließend vier Tage lang mit 4 x
250.000 IU Penicillin V oral – erfolgreich – behandelt.
Kole AK, Roy R. Respiratory diphtheria. NEJM 2013; 369: 1544
Abbildung 1 13-jähriges Mädchen mit
Verbreiterung des Halses [Kole, Roy 2013]
Abbildung 2 Blick in den Rachen [Kole, Roy
2013]
Wie hilfreich ist die „Massai-Barfußtechnik“?Masai Barefoot Technology: Really Helpful?
According to scientific evidence normal shoes seem to be the better alternative compared to „Masai Barefoot Technol-ogy“ shoes.
Schon mal den Begriff „Massai-Barfuß-technik“ gehört? Unter dem englischen Namen „Masai Barefoot Technology“ (MBT) fungieren Schuhe eines Schwei-zer Herstellers in Winterthur. Wikipedia entnehme ich den folgenden Text:
„Kennzeichnend für die MBT ist ei-ne konvex in Laufrichtung abgerundete Sohlenform mit einem eingefügten Fer-
senweichteil (dem „Masai-Sensor“). Be-dingt durch die dadurch absichtlich weich und „wabbelig“ gemachte Schuh-bodenkonstruktion verliert der Fuß den für eine physiologische Fortbewegung kennzeichnenden Halt. Das wirkt sich auf größere Teile der Halte- und Stütz-muskulatur aus, weil der Körper aktiv im Gleichgewicht gehalten werden muss. Dies soll, nach Angaben des Herstellers, die Koordinationsfähigkeit verbessern und zusätzliche Teile der Skelettmusku-latur beanspruchen“.
Auf seiner Internetseite wirbt der Hersteller explizit mit der Aussage, MBTs „können helfen, Schmerzen im unteren Rücken zu reduzieren“.
Britische und amerikanische Wis-senschaftler haben jetzt in der für das Themengebiet renommiertesten Zeit-schrift Spine eine randomisierte, (für die Auswerter) einfach-blinde Studie ver-öffentlicht, in der sie 115 Personen mit chronischen Rückenschmerzen entwe-der einer MBT- oder einer „Normal-schuh“-Gruppe zuordneten. Sie muss-ten die Schuhe mindesten zwei Stunden
täglich tragen und einen Monat lang einmal pro Woche ein Übungspro-gramm absolvieren.
Nach sechs Wochen, sechs Monaten und einem Jahr wurde mithilfe eines va-lidierten Fragebogens ausgewertet (93 Teilnehmer; intention-to-treat-Metho-dik), ob sich u.a. Schmerz, Funktion und Lebensqualität gebessert haben. Obwohl die Unterschiede gering waren, stellten sich normale Schuhe als die bessere Al-ternative heraus. Angesichts der nicht gerade günstigen Preise für die MTBs auch eine Wohltat für den Geldbeutel ...
NB: Das Unternehmen meldete am 9. Mai 2012 Insolvenz an, die mit einer ge-richtlichen Beschwerde aber gestoppt wurde. Inzwischen werden die Schuhe auf diversen Verkaufsforen wieder mun-ter angeboten.
MacRae CS, Lewis JS, Shortland AP, Mor-rissey MC, Critchley D. Effectiveness of rocker sole shoes in the management of chronic low back pain. Spine 2013; 38: 1905–1912
Abbildung MBT-Schuh [Wikipedia/Gmhof-
mann]
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
389DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
Pankreaskarzinom: „Revolutionäre“ Verlängerung der ÜberlebenszeitPancreatic Carcinoma: „Revolutionary“ Extension of Survival Time
Drug companies and sponsors of drug studies along with their medical partners frequently focus on statistically signifi-cant results which in daily life mean little to nothing. In this particular case sur-vival rate after one year was 22 % in the gemcitabine group but 35 % in the com-bination group. The mean absolute dif-ference, however, was merely 7,2 weeks.
Der weitverbreitete US-amerikanische Informations- (und Werbe!)dienst „Medscape“, den vielleicht auch einige von Ihnen beziehen, kam kürzlich mit der nachfolgenden Schlagzeile heraus: „Chemotherapie-Kombination verlän-gert Leben bei Pankreas-Karzinom“. Im Untertitel hieß es: „Wie eine Phase-III-Studie zeigte, verbesserte eine Kombina-tion aus Chemotherapeutika signifi-kant die Überlebenszeit von Patienten mit metastasierendem Pankreas-Karzi-nom“.
Diese Meldung bezog sich auf eine am selben Tag online veröffentlichte Studie aus dem New England Journal of Medicine mit dem Titel „Increased Survi-
val in Pancreatic Cancer with nab-Paclita-
xel plus Gemcitabine“. In dieser Unter-suchung wurden 861 Patienten mit ei-nem Pankreaskarzinom und einem Kar-nofsky-Index [0–100] von mindestens 70 in zwei Gruppen randomisiert:
• 430 Patienten erhielten Gemcitabin, das als Standard für inoperabel Kranke gilt.
• 431 Patienten bekamen (an Albumin gebundenes) Paclitaxel gefolgt von Gemcitabin.
Mit den genauen Therapiemodalitäten verschone ich Sie an dieser Stelle. Primä-rer, klinischer Endpunkt war die Ge-samtsterblichkeit.
Nach einem Jahr betrug die Über-lebensrate in der Gemcitabin-Gruppe 22 %, in der Kombinationsgruppe 35 %; nach zwei Jahren lauteten die Zahlen 4 % versus 9 %.
Klingt gut, finden Sie nicht? Diese auf den ersten Blick imposanten Daten stellen – pardon – ein geschöntes mathe-matisches Zahlenspiel dar, das sich in Sekundärpublikationen, insbesondere für Laien, aber auch für Ärzte (s.o.) öf-fentlichkeitswirksam als Erfolg verkau-fen lässt.
Wie aber steht es um den eigentli-chen Endpunkt? Wenn Sie mich fragen, sind die Differenzen weniger als beschei-den: Der Unterschied in der mittle-ren Überlebenszeit betrug genau 7,2 Wochen, • mit Gemcitabin 6,7 Monate,• mit nab-Paclitaxel plus Gemcitabin
8,5 Monate.
Nun wäre über diese Studie mit den sta-tistisch signifikanten, klinisch aber irre-levanten Resultaten fast schon alles ge-sagt. Bleibt noch die eine oder andere Kleinigkeit: So erlitten unter Standard-therapie bzw. der gepriesenen „Innova-tion“ 27 % bzw. 38 % der Patienten eine Neutropenie und 1 % bzw. 17 % eine Neuropathie, um lediglich einige der unerwünschten Wirkungen zu erwäh-nen. Über die z.T. enorm hohen Preise bräuchte man nicht weiter zu diskutie-ren, wenn sie denn für Arzneimittel aus-gegeben werden, die mehr bringen als nur einen Überlebensvorteil von gut sie-ben Wochen.
Gehörte man selbst zu den Unglück-lichen mit einem solchen Malignom, würde man (gut verständlich) nach je-dem kleinen Strohhalm greifen – koste es, was es wolle. Leider ist zu vermuten, dass der Hersteller und gleichzeitige Stu-diensponsor und seine ärztlichen Part-ner (in diesem Falle Kliniker aus den USA, Kanada, Australien, Belgien und Spanien) genau auf solche Abläufe set-zen, wenn sie der Öffentlichkeit eine Maus für einen Elefanten verkaufen.
Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. In-creased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013; 369: 1691–703
Für Ihre längerfristige Planung
49. DEGAM-Jahreskongress in Bozen/Südtirol vom 17. bis 19. September 201550. DEGAM-Jahreskongress in Frankfurt/Main vom 15. bis 17. September 2016
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
390 DEGAM-BENEFITS / DEGAM BENEFITS
Eine ungewöhnliche FingerverletzungAn Unusual Finger Injury
A case report about a patient´s skin dis-colouration due to millipede exposure.
An was würden Sie denken, wenn Sie ei-nen Patienten Mitte Zwanzig vor sich se-hen, der beim Arbeiten mit Handschu-hen „irgendetwas“ am vierten Finger der rechten Hand, jedoch keinen Schmerz oder gar einen Biss fühlte? Der Mann schüttelte beide Handschuhe aus, zer-quetschte das, was da herauskam und ar-beitete weiter. Nach zwei Stunden sah sein 4. Finger dunkel-violett, wie nach einer starken Kontusion aus (Abb. 1). Das Zerquetschte brachte der Mann gleich mit (Abb. 2).
Zur Verdeutlichung sehen Sie in Ab-bildung 3 eine größere Aufnahme eines unversehrten Exemplars.
Ein Tausendfüßler hatte sich in den Handschuh des Mannes verkrochen. Wenn sich diese Spezies angegriffen fühlt, sezerniert sie diverse Stoffe wie Chinone, Aldehyde oder Wasserstoff-cyanide, welche die Färbung der Haut verursachen. Die meisten Fälle gehen nach Händewaschen spontan zurück, bei Schwellung oder Juckreiz hilft eine
Steroidcreme. In die Nähe eines Auges sollte solch ein Tier allerdings besser nicht gelangen …
Manternach S, Armenian P. Finger injury. Emerg Med J 2014; 31:352
Abbildung 1 Finger der rechten Hand [Manternach, Ar-menian 2014]Abbildung 2 Zerquetschtes Objekt [Manternach, Armenian 2014]Abbildung 3 Tausendfüßler (Myriapoda)
1
3
2
DEGAM im Netz
www.degam.dewww.degam-leitlinien.dewww.degam-patienteninfo.dewww.tag-der-allgemeinmedizin.dewww.degam2014.dewww.online-zfa.dewww.degam-famulaturboerse.dewww.facebook.com/degam.allgemeinmedizin
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
391ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative StudyStefan Bösner, Judith Diederich, Simone Hartel, Erika Baum
Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin, Philipps Universität MarburgPeer reviewed article eingereicht: 26.05.2014, akzeptiert: 12.06.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0391–0397
Hintergrund: Ein- oder beidseitige Beinödeme sind als Symptom ein regelmäßiger Beratungsanlass in der Pri-märversorgung, dem eine Vielzahl verschiedener Ursa-chen zugrunde liegen kann. Der Hausarzt ist der primäre Ansprechpartner für die meisten dieser Patienten. Ziel der Studie war es, das diagnostische Vorgehen von Hausärz-ten bei Patienten mit Beinödemen zu analysieren.Methode: In semi-strukturierten Interviews wurden 15 Hausärzte gebeten, ihre persönliche Vorgehensweise be-züglich der Diagnose bei dem Symptom Beinödem dar-zulegen. Dies erfolgte anhand von Patienten mit Beinöde-men, die die Ärzte prospektiv über einen vierwöchigen Zeitraum identifiziert hatten. Die Interviews wurden auf-genommen, verbatim transkribiert und qualitativ von zwei unabhängigen Untersuchern nach Erstellen eines Ko-dierungsbaumes inhaltsanalytisch ausgewertet.Ergebnisse: Der erste Eindruck des Patienten und die er-lebte Anamnese spielen eine wichtige Rolle bei der Abklä-rung von Patienten mit Beinödemen. Die Anamnese, für die die meisten befragten Ärzte eine individuelle Vor-gehensweise entwickelt haben und die klinische Unter-suchung bilden die Eckpunkte der Diagnostik, apparative Untersuchungen werden teilweise als nachrangig bewer-tet. Der fachliche Austausch mit Kollegen und gezielte Ein- oder Überweisung reduzieren die von den meisten befragten Ärzten angegebene diagnostische Unsicherheit.Schlussfolgerungen: Weitere Untersuchungen wie z.B. symptomevaluierende Studien zur diagnostischen Aus-sagekraft von Anamnese und Untersuchungsbefund bzgl. verschiedener dem Symptom Beinödem zugrunde liegen-der Ätiologien wären zu begrüßen. Daraus gewonnene Erkenntnisse könnten in zukünftige Leitlinien einfließen.
Schlüsselwörter: Beinödeme; Allgemeinmedizin; Diagnose/diagnostische Forschung; Qualitative Forschung
Background: The symptom uni- or bilateral leg oedema represents a broad range of possible underlying aetiol-ogies. The background of leg oedema is multifactorial and usually the GP is the first contact point for patients presenting with this symptom. We aimed to identify GPs’ diagnostic approaches in patients presenting with leg oedema.Method: Interviews with 15 GPs (20–30 minutes) using a semi-structured interview-guideline were conducted. GPs described their individual diagnostic strategies con-cerning all patients presenting with leg oedema they had prospectively identified during the previous four weeks. Interviews were taped and transcribed verbatim. Quali-tative analysis was conducted by two independent raters.Results: First impression of the patient together with knowledge of the past history plays an important role in the workup of patients with leg oedema. Individualised approaches to history taking and clinical examination are the cornerstones of diagnosis, the value und contribution of further technical examinations are judged differently by GPs. Collegial feedback and patient referral are the main strategies used by GPs to reduce diagnostic uncer-tainty. Conclusion: Further research in regard to diagnostic ac-curacy of symptoms and signs for patients with leg oede-ma is necessary. Results of this research should be incor-porated in future guidelines.
Keywords [MeSH]: Leg Oedema, General Practice/Family Medicine, Diagnosis/Diagnostic Research, Qualitative Designs and Methods
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Hintergrund
Beinödeme sind ein häufiges Symptom in der allgemeinen Bevölkerung, das oft multifaktoriell bedingt ist [1]. In ei-ner 2003 veröffentlichten randomi-sierten Querschnittsstudie (Bonner Ve-nenstudie), die über 3000 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren unter-suchte, wurden Beinschwellungen von jedem sechsten Mann (16,2 %) und na-hezu von jeder zweiten Frau (42,1 %) angegeben [2]. Über die Häufigkeit von Beinödemen als Beratungsanlass in der hausärztlichen Praxis gibt es nur weni-ge verlässliche epidemiologische Da-ten [3]; die Häufigkeit von Bein-beschwerden bei Frauen in der Alters-gruppe von > 65 Jahren liegt bei unge-fähr 1,5 % [4]. Da sich Beinödeme als Symptom in der Regel früh im Krank-heitsverlauf manifestieren, wird dem Leitsymptom Beinödem in der Früh-erkennung der tatsächlich zugrunde liegenden Erkrankung ein hoher Stel-lenwert eingeräumt [5, 6]. So kann ei-nem ungünstigen Verlauf chronischer Erkrankungen wie der Herzinsuffi-zienz, der pulmonalen Hypertonie, ei-ner Niereninsuffizienz oder einem Lymphödem rechtzeitig begegnet wer-den. Hinzu kommt die Identifizierung akut abwendbar gefährlicher Verläufe wie der akuten Herzinsuffizienz, der tiefen Beinvenenthrombose (BVT) oder einer Lungenembolie [7].
Die Anamnese in Kombination mit einer zielgerichteten klinischen Unter-suchung stellt zum einen die generelle Grundlage für verschiedenste diagnosti-sche Strategien in der Primärversorgung [8] wie auch für die differenzialdiagnos-tische Abklärung von Patienten mit dem Leitsymptom Beinödem dar [3, 5, 7]. Es gibt unseres Wissens nach bisher keine qualitativen Daten darüber, wie Haus-ärzte in der Differenzialdiagnostik von Beinödemen vorgehen und welche Stra-tegien und Heuristiken dabei zum Ein-satz kommen. In einer anderen Publika-tion haben wir das differenzialdiagnos-tische Vorgehen von Hausärzten bei Beinödem-Patienten beschrieben, das sich in defensive und offensive Strate-gien unterteilen lässt [9]. In diesem Arti-kel berichten wir ergänzend über das all-gemeine diagnostische Vorgehen von Hausärzten (Anamnese, körperliche Un-tersuchung, Ausschluss von abwendbar gefährlichen Verläufen, Umgang mit di-
agnostischer Unsicherheit) bei der Ab-klärung von Patienten mit dem Leit-symptom Beinödem.
Methoden
Studien-Design
Wir wählten einen qualitativen Ansatz, um unsere Studienfrage zu beantwor-ten, da wir einen tieferen Einblick in das individuelle Vorgehen von Hausärzten bei der Abklärung von Beinödemen ge-winnen wollten. Wir entschieden uns hierbei für leitfadengestützte Interviews mit einzelnen Hausärzten als die geeig-netste Methode der Datenerhebung, da wir basierend auf realen Patientenfällen mit jedem Arzt über individuelle diag-nostische Strategien reden wollten.
Studiensetting und Datenerhebung
Die Rekrutierung der Hausärzte erfolgte in zwei Stufen. In Stufe eins kontaktier-ten wir Allgemeinarztpraxen über per-sönliche Kontakte und über gezielte An-rufe bei Studienpraxen der Abteilung für Allgemeinmedizin; weitere Ärzte wurden nach dem Schneeballsystem re-krutiert. In diesem ersten Kontakt wur-de die Bereitschaft für ein ca. 20- bis max. 30-minütiges Interview erfragt. Bei Interesse wurde in Stufe zwei mit den Ärzten ein erster persönlicher Ge-sprächstermin vereinbart, im Rahmen dessen die Studienaufklärung erfolgte. Die Hausärzte wurden darin umfassend informiert. Unter anderem darüber, dass das Interview auf Tonband digital aufgenommen wird, es wurde auf die Garantie der Anonymität der Erhe-bungsdaten verwiesen und die weiteren Auswertungsschritte der Daten erläu-tert. In Vorbereitung auf das später fol-gende Interview wurden die Ärzte gebe-ten, sich über einen Zeitraum von vier Wochen jeden Patienten, der sich mit dem Symptom Beinödem in seiner Pra-xis vorstellt, meist mit Namen und ge-stellter Diagnose zu notieren. Diese Auf-listung sollte dann als Grundlage die-nen, um im Interview gezielt Fragen zu den eigenen Patienten, zur durch-geführten Diagnostik stellen zu kön-nen. Diese Merkhilfen verblieben bei dem Arzt und dienten lediglich als Ge-sprächsgrundlage für das Interview, das circa einen Monat später stattfand. Die-
ser „stimulated recall“ [10] sollte es dem Arzt erleichtern, anhand von Beispielen konkrete und reale Diagnostikprozesse darzustellen.
Für diese Interviews wurde metho-disch das „problemzentrierte Interview“ (PZI) gewählt. Das PZI [11] verbindet als ein theoriegenerierendes Verfahren in sich die Strategie des „Theorie-geleitet-sein“ mit dem sog. „Offenheitsprinzip“. Der semistrukturierte Leitfaden deckte alle relevanten Themen (Anamnese-erhebung, körperliche Untersuchung, Identifikation von Red Flags, individuel-le Vorgehensweisen, Einfluss von Intui-tion und Bauchgefühl, differenzialdiag-nostische Überlegungen, Überweisungs-verhalten) ab. Alle Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät vollständig aufgezeichnet.
Datenanalyse
Alle Interviews wurden nach vorher festgelegten Regeln mit dem Programm F4 [12] transkribiert und mithilfe des Programms MAXQDA-10 analysiert [13]. Unsere Analyse kann als sogenann-te thematische Umfrage („thematic sur-vey“) klassifiziert werden [14]. In einem ersten deduktiven Schritt entwickelten wir ausgehend von dem Interviewleitfa-den einen Kodebaum, der anschließend an den ersten Interviews getestet wurde. Der Kodebaum wurde im Verlauf durch die in den Interviews erhobenen Daten induktiv ergänzt und mehrfach revi-diert. Alle Interviews wurden mit die-sem Baum von zwei unabhängigen Ra-tern (JD und SH) nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse kodiert. Unterschiedliche Kodierungen wurden zwischen den Ratern und teilweise auch in der qualitativen Forschungsgruppe unserer Abteilung besprochen.
Die gesamte Studie wurde von der Kommission für Ethik in der ärztlichen Forschung, Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg bewilligt (AZ 193/09).
Ergebnisse
Arzt und Patientencharakteristika
Wir rekrutierten insgesamt 15 Hausärz-te. Die Interviews fanden bei allen Ärz-ten in den eigenen Praxisräumen statt und variierten von der Gesprächsdauer
392
Bösner et al.:Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative Study
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
zwischen 20 und 30 Minuten. Tabelle 1 fasst die Charakteristika unserer Stich-probe zusammen.
Die an der Studie teilnehmenden Ärzte dokumentierten insgesamt 187 Patienten, die sich mit Beinödemen vor-gestellt hatten. Tabelle 2 fasst die von den Ärzten gestellten zugrunde liegen-den Diagnosen zusammen.
Erster Eindruck
Der erste Eindruck des Patienten liefert den Hausärzten sehr früh in der Konsul-tation wertvolle Informationen. „Das
Allermeiste sieht man ja, […] wenn der Pa-
tient die Tür reinkommt.“ (A12; 90–92). Der erste Kontakt und alle damit ver-bundenen Wahrnehmungen, zum Bei-spiel wie der Patient ins Zimmer geht, wie er spricht, seine Gestik und Mimik, sind für sechs der von uns befragten Hausärzte sehr entscheidend für das weitere diagnostische Procedere. „Also,
ja […], wenn die Leute mir so nebenbei er-
zählen, ohne großen Leidensdruck zu ha-
ben, sondern das nur feststellen, dann bin
ich meistens schon ein wenig beruhigt.
Wenn die natürlich sagen: ‚Gestern auf ein-
mal war es dick‘, dann wird man eben ner-
vös ein bisschen, ja.“ (A8, 15–16) „Stellen
Sie sich mal vor, es ist eine schwangere Frau,
die kommt herein mit dicken Beinen! Da
brauche ich doch keinen Tumor aus-
zuschließen!“ (A 15, 40)In dieser Phase spielen eigene
Bauchgefühle oder die Wahrnehmung eines diskrepanten Patientenverhaltens für viele Ärzte eine Rolle. „Es gibt Patien-
ten, die adipös sind, die sowieso schon sol-
che Beine haben […]. Da kommt die Frau in
die Sprechstunde […] und sagt: ‚Ich habe
Schmerzen im rechten Bein.‘ […] So, der ers-
te Eindruck-Adipositas, Wirbelsäulenbelas-
tung, Beschwerden angegeben wie ein Ischi-
as. Dann denkt man erst, es ist ein Ischias,
ja. Dann hatte ich aber das Gefühl, es ist
aber doch nicht der Ischias.“ (A6, 24–25)
Vorgeschichte und Kenntnis des Patienten
Zwölf der fünfzehn befragten Hausärzte gaben an, aktuelle Beschwerden bei ih-ren bekannten Patienten schneller und differenzierter als bei ihnen unbekann-ten Patienten diagnostisch einordnen zu können. „Ich hatte ja schon vorher ge-
sagt, wenn man den Patienten kennt, kann
man natürlich auch eher bewerten, wie er
die Sache schildert. Wenn das ein ‚indolen-
ter‘ Mensch ist, der wird die Sache anders
darstellen, als wie jemand, der da eher zum
Dramatisieren neigt.“ (A1, 47–47)Bei unbekannten Patienten führen
acht der fünfzehn Hausärzte aufgrund des fehlenden Hintergrundwissens ein umfangreicheres diagnostisches Pro-gramm durch. „Also, es ist so, wenn ich ei-
nen Patienten neu habe, dann nehme ich
mir die Zeit, und frage sie Anamnese, die
Familienanamnese, Eigenanamnese ab. Ich
mache mir also einen Fahrplan.“ (A1, 31)
Eckpunkte der Anamnese
Die Anamnese ist für die befragten Ärzte neben der klinischen Untersuchung das wichtigste Instrument zur diagnosti-schen Abklärung von Patienten mit Beinödemen. Die allgemeine Anamne-seerhebung erfolgt in der Regel indivi-duell nach einem eigenen festgelegten Schema. Hierbei wird die Diagnostik mit einheitlichen Standardfragen eingelei-tet. Damit grenzen die Ärzte die für sie infrage kommenden Krankheitsbilder ein, um anschließend in einem nachfol-genden zweiten Schritt die Anamnese mit zielgerichteten Fragen für die jewei-ligen Verdachtsdiagnosen fortzusetzen. „Auch die Anamnese, also der Patient sagt,
seit wann bestehen die Ödeme. Man fragt,
ob die beidseitig sind, ob sie schmerzhaft
sind die Schwellungen, ob die gerötet oder
entzündet sind. Das ist anamnestisch wich-
tig.“ (A5, 10–11)„Ja, da frage ich eben, wie häufig das ist,
ob das jeden Tag auftritt, ob das differiert,
wenn sie Mittag die Füße hochlegen, ob es
dann wieder abläuft. […] Also, ich frage den
Patienten hauptsächlich nach dem Beginn.
Ob es langsam mehr geworden ist, frage
nach dem persönlichen Verhalten, was sie
den ganzen Tag machen, wie viel sie so trin-
ken, ob sie auch mal die Beine hochlegen. Ja,
und dann schaue ich, welche Medikamente
sie nehmen, und es gibt eben ein paar, (.) die
kann man dafür anschuldigen, dass sie
selbst so etwas machen.“ (A8, 27–31)
Klinische Untersuchung
Ähnlich wie in der Anamnese, bevor-zugen die interviewten Hausärzte auch in der klinischen Untersuchung feste Abläufe. Das Tasten der Fußpulse, die Be-urteilung der Haut (Turgor, Verfärbun-gen, Temperatur), die Beschaffenheit des Ödems, das Tasten der Lymphkno-ten der Leiste und den unteren Extre-mitäten sowie die Inspektion von mögli-chen Varizen wurden von fast allen Ärz-ten als wesentliche Eckpunkte genannt. „Ja, die Fußpulse gehören auf jeden Fall da-
zu, bei der Untersuchung, denke ich mal. [I:
Ja.] Ja, das waren die Fußpulse. (.) Dass
man auf Eindrückbarkeit achtet, dass man
Überwärmung abcheckt, ob das Bein warm
oder kalt ist.“ (A1, 50–51)
Tabelle 1 Charakteristika der teilneh-
menden Ärzte (n = 15)
Tabelle 2 Zugrunde liegende Diagnosen
der von den teilnehmenden Ärzten doku-
mentierten Patienten (n = 187)
393
Bösner et al.:Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative Study
Geschlecht
Männlich
Weiblich
Berufserfahrung (Jahre)
< 10
10–20
> 20
Praxislokalisation
Stadt
Land
11
4
2
6
7
5
10
Diagnose
Kardial bedingte Beinödeme
Venostatische Beinödeme/Varikososis
Entzündliche Beinödeme/Erysipel
Medikamenteninduzierte Beinödeme
Beinlymphödem (prim./sek.)
Nephrologisch bedingte Beinödeme
Lipödeme
Beinödeme bei TVT/post-thrombotisches Syndrom
Sonstige Beinödeme
Keine Angabe der ärztlichen Diagnose
Anzahl der Patienten
57
49
12
5
4
4
3
2
7
33
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
„Erst einmal Blickdiagnose. Da sieht
man meistens, dass die Haut gespannt ist.
Weil die älteren Ladys und Jungs sind dann
doch etwas schrumpelig. […] Und da fällt
einem schon auf, dass der Oberschenkel
halt faltig ist, und der Unterschenkel immer
mehr spannt. Die werden dann auch so
richtig schön glasig. So wie bei einer Throm-
bose, aber beidseitig […]. Und wenn man
da ja den Daumen […] eine Delle, in die
Haut reindrückt, dann bleibt die Delle drin.
[…] Und das kann verschiedene Ausprägun-
gen annehmen.“ (A2, 97–98)Bei einseitiger Beinschwellung wer-
den von allen befragten Hausärzten die Beine auf Wadenklopfschmerz, Span-nungserhöhung der Haut und Schmerz-lokalisation untersucht. Knapp die Hälf-te der Ärzte führt in diesem Zusammen-hang eine zusätzliche Beinumfangsmes-sung durch. „Kommt eine Beinvenen-
thrombose in Betracht. Ja? Dann habe ich
eine Abfolge. Die Abfolge wäre die klinische
Untersuchung, die üblichen klinischen Zei-
chen. Also Schwellung, Umfangdifferenz,
Warnvenen, Kompressionsschmerz, Druck-
schmerz und so.[…].“ (A 13, 40–43) „Ja
gut, die Umfangmessung ist […] natürlich
immer dabei. […] Pulse ja auch, klar!“ (A1, 58–62)
Als apparative Untersuchungen wer-den am häufigsten Laboruntersuchun-gen, Duplexsonografie, Kompressions-sonografie, EKG und Urinstatus durch-geführt. Jeder der Hausärzte beschrieb hierbei eigene Vorlieben und diagnosti-sche Schwerpunkte. „Also als erstes na-
türlich angucken! Bezüglich Krampfadern,
Herz untersuchen, EKG schreiben und eine
kleine Laborlatte machen, nicht? Niere,
Schilddrüse, Eiweiße, Leber. Das sind ja al-
les Möglichkeiten für Ödeme.[…].“ (A3, 31–32)
Bewertung von Anamnese, klinischer Untersuchung und apparativer Diagnostik
Alle fünfzehn Ärzte gaben im Interview an, dass die Anamnese und die klinische Untersuchung den Eckpunkt für die Di-agnostik von Beinödemen in der Haus-arztpraxis darstellen. „Ich kann ja hier bei
uns sehr viel machen! […] Sie müssen ein-
fach überlegen, dass achtzig Prozent der
Krankheiten die Anamnese ist! Das hat un-
ser alter Chef schon gepredigt früher, dieses
‚dumme‘ Zuhören! Zuhören, was hast du
gemacht, was ist passiert, damit kommt
man schon relativ dicht ans Krankheitsbild!
Den Rest machen die Maschinen und die
Technik.“ (A15, 51)Bezüglich weiterer apparativer Maß-
nahmen zeigten sich unterschiedliche Meinungen. Der Großteil der befragten Ärzte gab an, dass die Bestimmung be-stimmter Laborparameter (wie D-Dime-re, Elektrolyte, Kreatinin) für die Diag-nosestellung hilfreich sei. Die Durch-führung und Aussagekraft von Ultra-schalluntersuchungen (wie Kompressi-onssonografie, Duplexsonografie, Echo-kardiografie) wird hierbei unterschied-lich bewertet. „Also, mache ich das so,
dass ich dann hier entweder den Schallkopf
draufhalte oder wir haben auch einen
Schnelltest auf D-Dimer, der aber auch un-
ter Umständen verfälscht sein kann […].“ (A2, 64–67)
„Also Umfangsmessungen vertraue ich
nicht, […] und deswegen mache ich es eben
zur Motivation des Patienten […], dass ich
Blut abnehme. Anschließend schicke ich
den Patienten zur Phlebografie oder Du-
plexsonografie. Aber trauen tue ich dem
nicht. […] D-Dimer-Test ist das A und das
O […].“ (A11, 78–79)„Ich mache keinen Duplex, dauert viel
zu lange, ist völliger Schwachsinn! Kom-
pressionssonografie und ich habe als Luxus
noch das D-Dimer. Das hilft für den hun-
dertprozentigen Ausschluss […].“ (A13, 43–43)
Erkennen von Red Flags und ab-wendbar gefährlichen Verläufen
Dyspnoe in Kombination in Verbin-dung mit Beinödemen wurde von allen fünfzehn befragten Ärzten als wichtiges Signal beschrieben, welches schnellst möglich abzuklären sei. Bei sichtbarer Umfangsdifferenz der Beine werden zwölf von fünfzehn Hausärzten sofort misstrauisch. „Das bedeutet der Patient
mit einer Lungenembolie, den erkenne ich
daran, dass er da [A12: zeigt auf Praxisein-
gang] (.) die Treppe nicht raufkommt. Der
kommt die Treppe nicht rauf, sagt: ‚Mein
Bein ist so dick!‘“ (A12, 66)„Generell eben, Luftnot und Schmerz
sind immer ein Alarmzeichen, ja! Und, ich
habe mir […] einen Sättigungsmesser ge-
kauft. Damit kann man gefährliche Verläu-
fe immer ganz gut unterscheiden.“ (A7, 27–30)
„Ja, zum Beispiel wenn es einseitig ist,
oder wenn es mit Schmerz verbunden ist.
Wegen der Thrombose! Das ist jetzt was
ganz Akutes.“ (A3, 43)
Sechs der fünfzehn Hausärzte beun-ruhigt eine akute Schwellung der Beine, die sich innerhalb von wenigen Stunden entwickelt hat und fünf der befragten Ärzte äußerten, dass sie bei einseitiger Beinschwellung explizit nach bekann-ten Risikofaktoren für eine Thrombose fragen. „Wenn die natürlich sagen: ‚Ges-
tern auf einmal war es dick‘, dann wird
man eben nervös ein bisschen, ja.“ (A5, 16)„Also […] die Wahrscheinlichkeit der
Thrombose steigt ja mit den Risikofaktoren.
Risikofaktoren sind Bettlägerigkeit, OP, Im-
mobilität, vorangegangene Thrombose,
Rauchen, positive Familienanamnese und
so fort.“ (A13, 23)Als weitere Red Flags wurden Alter
unter 30 Jahren, Lippenzyanose, Rassel-geräusche der Lunge, lokale Schmerzen, Druckgefühl auf dem Thorax oder das sehr akute Auftreten einer Dyspnoe (in-nerhalb weniger Stunden) genannt.
Für vierzehn der fünfzehn befragten Hausärzte ist das frühe Erkennen bzw. Ausschließen einer tiefen Beinvenen-thrombose (BVT) am wichtigsten. Leit-befunde sind hierbei Einseitigkeit des Beinödems, akutes Auftreten und Schmerz. „Das ist eigentlich, wenn jemand
mit einer akut […] aufgetretenen ödematö-
sen Verschlimmerung kommt, dann ist ei-
gentlich das erste was ich ausschließe, ob da
ein akut lokales Geschehen vorliegt, also ei-
ne Unterschenkelthrombose.“ (A9, 18)Die Angst vor einer Lungenembolie
veranlasst neun der fünfzehn Hausärzte außerdem bei jeglichem Verdacht auf ei-ne BVT sofort eine gezielte Diagnostik (z.B. Kompressionssonografie, Test auf D-Dimere u.a.) durchzuführen. „Die ka-
men schon herein und sagten: ‚Das Bein tut
so weh! Seit kurzem tut es weh (…), hat eine
Schwellung!‘ Das läuft bei mir Schema F:
Also ich weiß, dass fünfzig Prozent der
Thrombosen nicht erkannt werden, und
dass zehn Prozent in jeder Allgemeinarzt-
praxis als Lungenembolien vorkommt. Und
in der Karriere eines erfahrenen Allgemein-
mediziners kommt das bei jedem auch vor,
dass man Lungenembolien erlebt, dass
Beinthrombosen gestreut haben, die derjeni-
ge hatte, aber die nicht erkannt wurden. Be-
sonders das möchte ich vermeiden.“ (A11, 47–49)
„Eine Lungenembolie ist in der Regel,
[…] so gut wie nie vernünftig [zu] diagnos-
tizieren. […] Wenn Sie jemanden mit einer
einseitigen Beinschwellung haben, […] und
der keine Luft bekommt, wenn er rein-
kommt, solche Patienten sehen […] wir eher
394
Bösner et al.:Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative Study
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
schen Entscheidungsfindung in der Pri-märversorgung.
Die Hausärzte räumten der Anamne-se zusammen mit der nachfolgenden klinischen Untersuchung eine hohe Priorität ein. Der Stellenwert der Anam-nese für die hausärztliche Diagnosefin-dung ist in der Literatur breit belegt [15–17]. Während verschiedene Auto-ren die Wichtigkeit der Familienanam-nese, gerade im Hinblick auf die Identifi-zierung von Risikofaktoren für chro-nische Erkrankungen betonen [18, 19], spielte diese bei den von uns befragten Ärzten nur eine untergeordnete Rolle – eine Diskrepanz, die in einer anderen Studie bestätigt wird [20].
Zum Ausschluss akut gefährlicher Verläufe legten die von uns befragten Hausärzte besonderen Wert auf das frü-he Abklären von Red Flags. Die Eignung dieser Strategie als Methode zur schnel-len und wirksamen Diagnostik akut ge-fährlicher Krankheitsbilder ist für ver-schiedene Erkrankungen in der Primär-versorgung [21, 22] sowie für das Leit-symptom Beinödemen [7] belegt.
Interessant ist hier die Diskrepanz zwischen der im Interview eingeschätz-ten Gefahr einer möglichen BVT und/oder Lungenembolie durch die befragten Hausärzte und der Anzahl der tatsächlich dokumentierten Diagnosen von nur zwei Fällen von BVT. Ein ähnliches Phänomen ist für das Symptom des chronischen Hustens beschrieben [23] und eine mög-liche Erklärung könnte in der zu hohen Einschätzung der Vortestwahrscheinlich-keit für in dem Niedrigprävalenzbereich der Primärversorgung selten auftretender Erkrankungen liegen [24]. Als alternative Erklärung kann eine auffällig sicherheits-bezogene Haltung gegenüber bestimm-ten Erkrankungen wie der BVT dienen, die mit potenziell letalen Folgen (Lun-genembolie) einhergehen können. Eine andere Studie aus der Primärversorgung zeigte eine ähnlich vorsichtig-besorgte
Haltung gegenüber der Koronaren Herz-krankheit bzw. dem akuten Koronarsyn-drom als Ursache für Brustschmerz in der Primärversorgung [25].
Die von uns befragten Hausärzte ver-wendeten verschiedene Strategien, um mit diagnostischer Unsicherheit umzu-gehen. Ein Teil der Ärzte nutzte die offene Kommunikation mit dem Patienten über die limitierten diagnostischen Möglich-keiten des hausärztlichen Settings und die damit verbundene Restunsicherheit bei der Diagnosestellung. Andere Unter-suchungen unterstreichen den Wert ei-ner stabilen Arzt-Patienten-Beziehung bezüglich des gemeinsamen Tragens di-agnostischer Unsicherheit und die da-raus resultierenden positiven Auswirkun-gen auf das Überweisungsverhalten [26, 27]. Zusätzlich verwendeten viele der be-fragten Hausärzte mittels des gezielten fachlichen Austausches mit Kollegen (z.B. in der eigenen Praxis) eine etablierte Strategie, die gerade in schwierigen Ent-scheidungssituationen hilft, Unsicher-heit zu reduzieren [28]. Andere etablierte Methoden für den Umgang mit diagnos-tischer Unsicherheit wie „shared decisi-on making“ [29] oder das gezielte An-wenden evidenzbasierter Medizin [30] wurden nur vereinzelt eingesetzt.
Studienlimitationen
Unsere Studie hat verschiedene Limita-tionen. So hätten z.B. auf Video auf-genommene Konsultationen eventuell eine höhere interne Validität gehabt. Diese Methode ist jedoch schwierig im hausärztlichen Setting zu implementie-ren. Eine Alternative wäre der Einsatz von Schauspielpatienten gewesen. Diese Methode hätte jedoch nicht die diag-nostische Bedeutung einer langjährigen Arzt-Patienten-Beziehung abgebildet.
Eine Stärke unserer Studie liegt in der prospektiven Identifikation von Pa-
tienten, die dann im Interview als Ge-sprächsgrundlage dienten. So konnten wir den diagnostischen Prozess mit den Hausärzten für einen definierten kli-nischen Kontext diskutieren. Trotz die-ser Maßnahme lässt sich nicht aus-schließen, dass die teilnehmenden Ärz-te ihr initiales diagnostisches Vorgehen während des Interviews noch einmal neu interpretierten oder initiale Hypo-thesen und Gedankengänge durch ra-tionaler erscheinende Argumente er-setzten. Wir versuchten diese Art von Bias zu minimieren, indem wir die Ärzte ermutigten, ihre ganz persönlichen di-agnostischen Vorgehensweisen zu schildern. Wir betonten hierbei den Mangel an Forschungsdaten zu diesem Thema, was zu einer Atmosphäre der of-fenen und kritischen Selbstreflexion beitrug.
Schlussfolgerungen
Die von uns befragten Ärzte zeigten zwar eine große Bandbreite individuel-ler Vorgehensweisen bei der Abklärung von Beinödemen, als verbindendes Ele-ment stehen jedoch bei allen Ärzten ei-ne ausführliche Anamnese und zielge-richtete körperliche Untersuchung im Mittelpunkt der diagnostischen Abklä-rung. Da es insgesamt nur sehr wenige Studien zu diesem in der Hausarztpra-xis regelmäßig vorkommenden Bera-tungsanlass gibt, wären weitere Unter-suchungen wie z.B. symptomevaluie-rende Studien zur diagnostischen Aus-sagekraft von Anamnese und Unter-suchungsbefunden für verschiedene zugrunde liegende Ätiologien zu begrü-ßen. Daraus gewonnene Erkenntnisse könnten in zukünftige Leitlinien ein-fließen.
Interessenkonflikte: keine angege-ben.
PD Dr. Stefan Bösner, MPH
Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventi-
ve und Rehabilitative Medizin
Universität Marburg
Karl-von-Frisch-Str. 4
35043 Marburg
Tel.: 06421 2865122
Korrespondenzadresse
396
Bösner et al.:Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative Study
… ist Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Gemeinschaftspra-
xis in Marburg. Zusätzliche Tätigkeit als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Allgemeinmedizin der Philipps Univer-
sität Marburg.
PD Dr. Stefan Bösner, MPH …
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
1. Heidenreich S. Der Patient mit Bein-ödemen. Medizinische Klinik 2004; 99: 383–9
2. Rabe E, Pannier-Fischer F, Bromen K, et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebolo-gie 2003; 32: 1–14
3. Rabady S. Beratungsanlass Bein-schwelllung: Differenzialdiagnose in der Allgemeinmedizin. Z Allg Med 2012; 10: 6
4. Kühlein T, Gunter Laux G, Gutscher A, Szecsenyi J. Kontinuierliche Morbidi-tätsregistrierung in der Hausarztpraxis: Vom Beratungsanlass zum Beratungs-ergebnis. München: Urban & Vogel, 2008
5. Blankfield RP, Finkelhor RS, Alexander JJ, et al. Etiology and diagnosis of bila-teral leg edema in primary care. Am J Med 1998; 105: 192–7
6. Blankfield RP. Obstructive sleep apnea associated with leg edema. Am Fam Physician 2006; 73: 589; author reply 589
7. Ely JW, Osheroff JA, Chambliss ML, Ebell MH. Approach to leg edema of unclear etiology. J Am Board Fam Med 2006; 19: 148–60
8. Heneghan C, Glasziou P, Thompson M, et al. Diagnostic strategies used in pri-mary care. BMJ 2009; 338: b946
9. Diederich J. Strategies for Diagnosing Leg Oedema in Primary Care: a Qualita-tive Study of GPs’ Approaches. Europe-an Journal of General Practice: in print
10. Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Me-dical problem solving: An analysis of clinical reasoning. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1978
11. Witzel A. Das problemzentrierte Inter-view. In: Jüttemann G (Hrsg.). Qualita-
tive Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, An-wendungsfelder. Heidelberg: Asanger, 1995: 227–256
12. Dresing T, Pehl T. Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ For-schende. Marburg, 2011
13. MAXQDA. Berlin: VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH, 2010
14. Sandelowski M, Barroso J. Classifying the findings in qualitative studies. Qual Health Res 2003; 13: 905–23
15. Summerton N. The medical history as a diagnostic technology. Br J Gen Pract 2008; 58: 273–6
16. Almond SC, Summerton N. Diagnosis in General Practice. Test of time. BMJ 2009; 338: b1878
17. Hampton JR, Harrison MJ, Mitchell JR, Prichard JS, Seymour C. Relative contri-butions of history-taking, physical examination, and laboratory investiga-tion to diagnosis and management of medical outpatients. Br Med J 1975; 2: 486–9
18. Summerton N, Garrood PV. The family history in family practice: a question-naire study. Fam Pract 1997; 14: 285–8
19. Acheson LS, Wang C, Zyzanski SJ, et al. Family history and perceptions about risk and prevention for chronic disea-ses in primary care: a report from the fa-mily healthware impact trial. Genet Med 2010; 12: 212–8
20. Fuller M, Myers M, Webb T, Tabangin M, Prows C. Primary care providers’ re-sponses to patient-generated family history. J Genet Couns 2010; 19: 84–96
21. Murtagh J. Common problems: a safe diagnostic strategy. Aust Fam Physician 1990; 19: 733
22. Thompson MJ, Harnden A, Del Mar C. Excluding serious illness in feverish children in primary care: restricted ru-le-out method for diagnosis. BMJ 2009; 338
23. Barraclough K. Chronic cough in adults. BMJ 2009; 338: b1218
24. Pewsner D, Battaglia M, Minder C, Marx A, Bucher HC, Egger M. Ruling a diagnosis in or out with „SpPIn“ and „SnNOut“: a note of caution. BMJ 2004; 329: 209–13
25. Hani MA, Keller H, Vandenesch J, Sön-nichsen AC, Griffiths F, Donner-Banz-hoff N. Different from what the text-books say: how GPs diagnose coronary heart disease. Fam Pract 2007; 24: 622–7
26. Redelmeier DA. Improving patient ca-re. The cognitive psychology of missed diagnoses. Ann Intern Med 2005; 142: 115–20
27. O‘Riordan M, Dahinden A, Aktürk Z, et al. Dealing with uncertainty in general practice: an essential skill for the gene-ral practitioner. Qual Prim Care 2011; 19: 175–81
28. Donner-Banzhoff N. Umgang mit Un-sicherheit in der Allgemeinmedizin. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 2008; 102: 13–8
29. Müller-Engelmann M, Keller H, Don-ner-Banzhoff N, Krones T. Shared deci-sion making in medicine: the influence of situational treatment factors. Patient Educ Couns 2011; 82: 240–6
30. Donner-Banzhoff N. Die Evidenzba-sierte Medizin: gescheitert oder einfach nur anders? Z Arztl Fortbild Qualitats-sich 2007; 101: 441–4
Literatur
397
Bösner et al.:Diagnostisches Vorgehen bei Patienten mit Beinödemen in der Hausarztpraxis – eine qualitative UntersuchungDiagnostic Procedures in Primary Care Patients With Leg Edema – a Qualitative Study
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
398 DER BESONDERE ARTIKEL / SPECIAL ARTICLE
Internationale Expertise zur Entwicklung der Palliativversorgung in der Primärversorgung International Experts’ Report for the Development of Palliative Care in Primary CareNils Schneider
Institut für Allgemeinmedizin, Medizinische Hochschule Hannover Peer reviewed article eingereicht: 04.08.2014, akzeptiert: 08.09.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0398–0401
Zusammenfassung: Auf europäischer Ebene wurde im Jahr 2012 die „Taskforce in Primary Palliative Care“ ge-gründet, um die Primärversorgung von Menschen am Le-bensende weiterzuentwickeln. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Expertengruppe vorgestellt. Der Beitrag ist in weiten Teilen eine deutsche Übersetzung der englischsprachigen Originalversion, die auf der Internetseite der European Association for Palli -ative Care (EAPC) veröffentlicht ist.
Schlüsselwörter: Primärversorgung; Versorgung am Lebensende; Palliativversorgung; Versorgungspolitik
Summary: In 2012, the European Association for Palli-ative Care established the “Taskforce in Primary Palliative Care“ to further develop primary care for people facing the end of life. In this article, the findings and recommen-dations of the task force are presented. In large parts the article is the German translation of the original English version available on the website of the European Associ-ation for Palliative Care (EAPC).
Keywords: Primary Care; End-of-Life Care; Palliative Care; Health Policy
Hintergrund und Ziele
Das vorliegende Dokument wurde von der „Taskforce Primary Palliative Care“ der EAPC (Europäische Gesellschaft für Palliative Care) in Zusammenarbeit mit WONCA (World Organisation of Family Doctors) entwickelt und soll Einzelper-sonen und Organisationen in Europa und darüber hinaus als Unterstützung und Leitfaden dienen, um die Palliativ-versorgung innerhalb der Primärversor-gung weiter auszubauen [1]. Politisch gestützt wird diese Arbeit unter anderem durch die Grundsätze der Prager Charta der EAPC, wonach der Zugang zur Pallia-tivversorgung ein Menschenrecht ist [2].
Die vorliegende Arbeit ist eine inter-nationale Bestandsaufnahme und bietet darauf aufbauend übergeordnete ge-sundheitspolitische und praktische Empfehlungen für die Weiterentwick-
lung der Palliativversorgung in der Pri-märversorgung. Die Zusammensetzung der verantwortlichen Expertengruppe, ihre Arbeitsweise und Methoden sind an früherer Stelle beschrieben [3]. Der fol-gende Text ist in weiten Teilen eine deut-sche Übersetzung der englischsprachi-gen Originalversion [1].
Warum ist der Ausbau der Palliativversorgung in der Primärversorgung wichtig?
Wenn die Palliativversorgung und Ver-sorgung in der letzten Lebensphase auf lokaler Ebene durch Angebote der Pri-märversorgung erfolgt, kann die größt-mögliche Anzahl von Menschen hier-von profitieren. Um dies zu erreichen, benötigen die lokal tätigen Hausärzte und Pflegekräfte eine adäquate Qualifi-
kation und bei Bedarf die Unterstützung durch spezialisierte Palliativteams. Sie benötigen außerdem ausreichend Zeit, finanzielle und praktische Ressourcen sowie die Befähigung, falls nicht vor-handen, die notwendigen Medikamente (z.B. Opiate) zu verschreiben.
Die Akteure der Primärversorgung sind in einer besonders guten Position, eine effektive Palliativversorgung zu er-bringen, denn die Primärversorgung kann:• Patienten mit allen lebensbedrohli-
chen Krankheiten erreichen;• bereits in frühen Phasen einer unheil-
baren Erkrankung mit einer palliati-ven Versorgung beginnen;
• das gesamte Umfeld abdecken: kör-perlich, sozial, psychisch und spiritu-ell;
• die Versorgung in Praxen, Pflegehei-men und im häuslichen Umfeld
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
durchführen und so unnötige Kran-kenhausaufenthalte vermeiden;
• Angehörige unterstützen und Trauer-begleitung bieten.
Gegenwärtige Situation
Es wurden Länderprofile für 20 europäi-sche Nationen erstellt und hemmende und fördernde Faktoren für die Entwick-lung der primären Palliativversorgung aufgezeigt. Diese Fallberichte zeigen, dass es trotz teilweise hervorragender Beispiele in der internationalen Gesamt-schau noch immer zahlreiche Defizite gibt. Tabelle 1 stellt die wesentlichen hemmenden und fördernden Faktoren gegenüber.
Entwicklungsansätze
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt vier Domänen für die Ent-wicklung der Palliativversorgung: politi-sche Strategien, Qualifizierung, Imple-mentierung, Verfügbarkeit von Arznei-mitteln [4]. Innerhalb dieses konzeptio-nellen Rahmens werden im Folgenden exemplarisch Beispiele und Ansätze für die Primärversorgung vorgestellt, die sich in unterschiedlichen Ländern be-währt haben.
Politische Strategien in Europa
Um die Entwicklung der Palliativversor-gung in der Primärversorgung zu er-leichtern, ist eine umfassende Unter-stützung durch die nationale Politik notwendig. Mehrere Länder haben er-folgreich Strategien für die Versorgung am Lebensende (End-of-Life Care) auf nationaler Ebene entwickelt, die u.a. Schwerpunkte bei der Primärversorgung setzen:• Rechtsanspruch auf spezialisierte Pal-
liativversorgung und „Charta zur Be-treuung schwerstkranker und sterben-der Menschen“ (Deutschland),
• Nationaler Lenkungsausschuss für primäre Palliativversorgung (Irland),
• Landesplan für Palliativversorgung (Portugal),
• Strategie für die Entwicklung der Pal-liativversorgung (Serbien),
• Nationale Strategie für Palliativversor-gung mit Schwerpunkt auf lokaler Ebene (Schweiz),
• Nationales Programm für die Versor-gung am Lebensende (England),
• „Gut Leben und Sterben“ (Schott-land),
• Aktionsplan des Gesundheitsministe-riums (Albanien).
Diese nationalen Strategien können wertvolle Anregungen geben, um die Palliativversorgung in der Fläche und
auf allen Ebenen des Gesundheits- und Sozialsystems weiter zu entwickeln.
Qualifizierungsmaßnahmen
Die Strategie der Weltgesundheitsorga-nisation für die Palliativversorgung empfiehlt Bildungsinitiativen, die sich sowohl an die Öffentlichkeit, wie auch an die im Gesundheitswesen tätigen Personen richten. Beispiele hierfür, wie die „Dying Matters Coalition“ in Eng-land und „Good life, Good death, Good grief“ in Schottland, sind mit dem Ziel gegründet worden, die Gesellschaft da-zu zu bringen, ein offeneres Verhältnis zum Tod, dem Sterben und der Trauer zu entwickeln.
In vielen Ländern – z.B. in Italien und Spanien – sind außerdem Curricula für die Qualifizierung der Hausärzte ent-wickelt worden mit der Möglichkeit, postgraduale Zertifikate und Diplome im Bereich der Palliativversorgung u.a. per Fernstudium zu erlangen (z.B. RCGP Curriculum Statement on End-of-Life Care; Cardiff University Palliative Care Education).
Implementierung
Ein gutes Beispiel dafür, wie der palliati-ve Versorgungsansatz auf lokaler Ebene integriert werden kann, ist „The Gold Standards Framework“ (GSF) – ein syste-matischer, evidenzbasierter Ansatz aus Großbritannien zur Optimierung der Versorgung von Patienten während ih-rer letzten Lebensmonate durch die Hausärzte. Der ,,Gold Standards Frame-work“ zielt darauf ab, Patienten ein gu-tes Leben bis zum Tod zu ermöglichen, und schließt die Versorgung von Men-schen unabhängig von ihrer Grund-erkrankung in den letzten Lebensjahren ein.
Das „NECPAL CCOM-ICO Pro-gramm“ (NECPAL) in Spanien liefert ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Maßnahme, die Ausbildung, strategi-sche Planung und Leitlinien für die Pra-xis einbezieht.
GSF und NECPAL beinhalten Orien-tierungshilfen, die die Gesundheitspro-fessionen dabei unterstützen, diejeni-gen Patienten zu identifizieren, die von einem palliativen Versorgungsansatz profitieren können. Die Unsicherheit darüber, welche Patienten Palliativver-sorgung benötigen, stellt ein wesentli-
Tabelle 1 Hemmende und fördernde Faktoren für die Entwicklung der primären Palliativversor-
gung auf Basis von 20 Länderprofilen
Hemmende Faktoren
Mangel an Fachwissen und Kompetenzen bei Hausärzten und Pflegefachkräften
Finanzierungssysteme, welche die Palliativ-versorgung nicht sachgerecht erstatten
Aspekte, welche die Verschreibung von Opiaten erschweren
Fehlende fachliche Unterstützung
Unzureichende Identifikation von Patienten, die eine Palliativversorgung benötigen
Begrenztes Verständnis in der Gesellschaft und Stigmatisierung der Palliativversorgung
Fördernde Faktoren
Qualifizierungsmöglichkeiten, in einigen Ländern bereits verfügbar
Beispiele von etablierter Primärversorgung
Neue nationale Strategien, welche die Palliativversorgung unterstützen
Ausbau von klinisch-praktischen Netzwer-ken in vielen Ländern
Alle Patienten haben einen Zugang zur Primärversorgung.
Steigende Unterstützung durch die Politik
399
Schneider:Internationale Expertise zur Entwicklung der Palliativversorgung in der Primärversorgung International Experts’ Report for the Development of Palliative Care in Primary Care
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
ches Hindernis für den Zugang zur Pal-liativversorgung in der Primärversor-gung dar. Deshalb ist die Entwicklung von Instrumenten zur Identifikation von Patienten, die eine Palliativversor-gung benötigen, ein Forschungsschwer-punkt. Wichtig ist es vor Ort heraus-zufinden, welche Instrumente und Akti-vitäten es gibt, und wie diese umgesetzt werden können. Eine kürzlich publizier-te systematische Übersichtsarbeit [4] hat unter anderem folgende bereits imple-mentierte Ansätze identifiziert:• GSF Prognostic Indicator Guidance,• Supportive and Palliative Care Indica-
tors Tool (SPICT),• Radboud Indicators for Palliative Care
Need (RADPAC),• The NECPAL Tool,• Quick Guide.
Verfügbarkeit von Medikamenten
Eine detaillierte Bewertung von Opiaten wurde innerhalb der „European Pain Po-licy Initiative“ (Europäische Initiative für Strategien der Schmerztherapie) durchgeführt, ein gemeinsames Arbeits-programm der Europäischen Gesell-schaft für Medizinische Onkologie (ES-MO) und der Europäischen Gesellschaft für Palliativversorgung (EAPC). Die we-sentlichen Empfehlungen sind [5]:1. Beschränkungen bezüglich der Arz-
neimittellisten: Die ESMO und EAPC unterstützen die Standards der WHO-Liste von essenziellen Medika-menten als einen minimalen Stan-dard für die Opiate. Diese Mindest-anforderungen sollten orales Codein, nicht retardiertes Morphin, retardier-tes Morphin und injizierbares Mor-phin beinhalten. Die Empfehlungen stehen in Übereinstimmung mit der weiterreichenden Arzneimittelliste der IAHPC (Internationale Gesell-schaft für Hospiz- und Palliativver-sorgung).
2. Beschränkungen bezüglich der Regu-lierung: Die ESMO und die EAPC for-
dern gemeinsam mit der WHO und dem INCB (Internationaler Sucht -stoffkontrollrat) die staatlichen Arz-neimittelkontrollbehörden dazu auf, unverhältnismäßige Kontrollen und Beschränkungen aufzuheben, die eine angemessene medizinische Versor-gung bei Schmerzen behindern. Dazu gehören zum Beispiel Beschränkun-gen auf bestimmte Patientengruppen oder auf fachärztliche Praxen be-schränkte Verschreibungsrechte.
3. Notfallverschreibungen: Es sollte ge-setzlich festgelegte Regelungen für die Notfallverschreibung von Opioi-den für Patienten geben, die unter starken Schmerzen leiden und die sich kein Rezept in Papierform be-schaffen können. Die ESMO und die EAPC unterstützen den Ansatz der US „Drug Enforcement Administration“ (Drogenvollzugsbehörde), die eine Notfallverschreibung per Telefon oder Fax an den Apotheker erlaubt. Der Apotheker muss die Authentizi-tät und die Gültigkeit der Verord-nung überprüfen, bevor er das Betäu-bungsmittel abgibt, und er muss die Verordnung auf Papier übertragen und verwahren.
4. Spezielle Verordnungsformulare: Die Vorgabe von speziellen Verschrei-bungsformularen wird an sich nicht als eine übermäßige Belastung erach-tet. Die Formulare müssen für die ver-ordnenden Personen jederzeit verfüg-bar, und der Beschaffungsprozess darf nicht übermäßig umständlich und womöglich demotivierend sein.
5. Medikamentenabgabe: Die Apotheker müssen autorisiert sein, formale Feh-ler nach Rücksprache mit dem verord-nenden Arzt zu korrigieren.
Bewertung und Ausblick
Dieses auf europäischer Ebene ent-wickelte Expertenpapier ist nicht in al-len Punkten auf die Versorgungssituati-
on in Deutschland anzuwenden, zumal diese auch innerhalb Deutschland er-heblich variiert. Es ist als übergeord-netes politisches Strategiepapier zu ver-stehen, das darauf abzielt, die Position der Hausärzte in der Palliativversorgung zu stärken. Adressaten sind somit vor al-lem Fachgesellschaften, Berufsverbän-de, die Selbstverwaltung und die Politik. Aber auch regionale Netzwerke und Hausarztpraxen können aus dem Exper-tenpapier konkrete Argumentationshil-fen und Anregungen ziehen, um auf lo-kaler Ebene die Versorgung von Pallia-tivpatienten mitzugestalten.
Abschließend empfiehlt die interna-tionale Expertengruppe, abhängig vom Stand der Palliativversorgung in dem je-weiligen Land beziehungsweise der je-weiligen Region: 1. Identifikation von Schlüsselpersonen
oder Organisationen, die Interesse am Ausbau der Palliativversorgung in der Primärversorgung haben, z.B. haus-ärztliche Fachverbände, palliativme-dizinische Spezialisten.
2. Nutzung der Datenbank der „EAPC Taskforce in Primary Palliative Care“, um Kollegen zu kontaktieren, die viel-leicht dazu in der Lage sind, eine ge-zielte Beratung in Bezug auf bestimm-te Aspekte zu bieten.
3. Bemühungen um Verbesserungen in den vier Bereichen des skizzierten WHO Public Health-Modells [4], um ein ausgewogenes Versorgungssystem zu schaffen. Auswertung der in die-sem Papier skizzierten Ressourcen und Quellen, um potenzielle Hand-lungsansätze herauszuarbeiten, die für Ihr Gebiet relevant sind.
4. Beteiligung an Forschungsprojekten (z.B. Bedarf an und Effekte von Pallia-tivversorgung in der Primärversor-gung).
Interessenkonflikte: Der Autor ist Mitglied der Taskforce Primary Palliative Care der European Association for Pal-liative Care (EAPC).
Prof. Dr. Nils Schneider, MPH
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Allgemeinmedizin
Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover
Tel.: 0511 532–2744
Korrespondenzadresse
… ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung
Palliativmedizin. Er ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedi-
zin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Zu seinen For-
schungsschwerpunkten gehört die hausärztliche Palliativversor-
gung.
Prof. Dr. med. Nils Schneider …
400
Schneider:Internationale Expertise zur Entwicklung der Palliativversorgung in der Primärversorgung International Experts’ Report for the Development of Palliative Care in Primary Care
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
1. http://www.eapcnet.eu/Themes/Organisation/Primarycare.aspx (letzter Zugriff am 01.08.2014)
2. http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=eGslUTKJxhs%3D&tabid=1871 (letzter Zugriff am 01.08.2014)
3. Schneider N. Primärversorgung von Menschen am Lebensende. Internatio-
nale Task Force erarbeitet Empfehlun-gen. Z Allg Med 2012; 88: 138–139
4. Sternsward J, Foley K, Ferris F. The pu-blic health strategy for palliative care. J Pain Symptom Manage 2007; 33: 486–493
5. Maas EAT, Murray SA, Engels Y, Camp-bell C. What tools are available to iden-
tify patients with palliative care needs in primary care: a systematic literature review and survey of European practi-ce. BMJ Support Palliat Care 2013; 3: 444–451
6. http://www.eapcnet.eu/Themes/Policy/OpioidaccessibilityEurope.aspx (letzter Zugriff am 01.08.2014)
Literatur
401
Schneider:Internationale Expertise zur Entwicklung der Palliativversorgung in der Primärversorgung International Experts’ Report for the Development of Palliative Care in Primary Care
Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin
Einladung zur Mitgliederversammlung
Zeit: Freitag den 07. 11. 2014 um 18:00 Uhr
Ort: Tagungshotel Franz, Steeler Str. 261, 45138 EssenEin Bettenkontingent für GHA Mitglieder ist abrufbar
Tagesordnung: TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung mit evtl. Anträgen
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2013
TOP 3: Bericht aus dem Vorstand
TOP 4: Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
TOP 5: Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes
TOP 6: Vorstellung der neu aufgenommenen Mitglieder
TOP 7: Berichte aus den Fakultäten – Was gibt es Neues?
TOP 8: Verschiedenes
Hinweisen möchten wir schon hier auf das Seminar Lehre und Didaktik am Samstag 8.11.14 im Lehrgebäude der Medizi-nischen Fakultät u.a. mit Workshops zu folgenden Themenkreisen:• Das Ansprechen schwieriger Themen – Vermittlung im studentischen Unterricht• Diagnostische Entscheidung in der Allgemeinmedizin: Lehrinhalte und Formate• POL-Planspiel: Lösungsstrategien für die Akquise und Pflege geeigneter Lehrpraxen
Parallel dazu wird ein ganztägiger Prüferworkshop für die letzte Staatsexamensprüfung angeboten.Ein Bus-Shuttleservice ist eingerichtet
Nähere Informationen: www.gha-info.de
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
402 ZWISCHEN DEN ZEILEN / BETWEEN THE LINES
Vergütung von Palliativmedizin in der hausarztzentrierten VersorgungEine Kurzübersicht auf Anregung von Kollegen
Jörg Schelling
„Als Hausarzt in der hausarztzentrierten Versorgung – eine Einladung zur Diskus-sion“ hieß der Titel eines kurzen Textes, den ich in der Aprilausgabe der Zeit-schrift für Allgemeinmedizin publizie-ren konnte. Für die engagierten Schrei-ben, die mich danach erreicht haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Ich würde mich freuen, wenn die Haus-arztzentrierte Versorgung (HZV) mit all ihren Facetten in der ZFA auch weiterhin ein Forum erhält. In diesem Sinne möchte ich zunächst den Brief des Kollegen Dr. Steffen Fimpel aus Gschwend wiedergeben, der mich zum Schreiben dieses zweiten Artikels moti-viert hat:
„… ich bin ausgesprochen dankbar für
Ihren in der ZFA 4/2014 veröffentlichten
Artikel und den Aufruf, Gedanken kon-
struktiv einzubringen. Als Mitglieder der
DEGAM wollen wir ja zum einen ein hohes
fachliches Niveau in der Allgemeinmedizin
anstreben, und zwar auch ‚in der Fläche‘,
d.h. im Alltag. Zum anderen schreiben Sie
völlig klar und zu Recht: ‚Jede Gebührenord-
nung hat einen enormen Steuerungseffekt
auf das Handeln und Denken von Hausärz-
ten.‘ In anderen Worten: Leistungen, die
vergütet werden (da Abrechnungsziffer vor-
handen), werden auch erbracht. Leistungen,
die nicht vergütet werden (da keine Abrech-
nungsziffer vorhanden), werden auch nicht
oder nur minimal erbracht. Oder nochmals
anders formuliert: Das Geld soll der Leis-
tung folgen. Ich möchte im HZV die Pallia-
tivversorgung ansprechen, d.h. eine sachge-
mäße, kompetente, empathische, respekt-
volle, kooperative ärztliche Betreuung von
Sterbenden in den letzten Tagen oder Wo-
chen Ihres Lebens. Was gibt es da nicht alles
zu bedenken und zu tun! Jeder Allgemein-
arzt weiß, dass er hier viel zum Positiven
wenden kann – wenn, ja wenn diese an-
spruchsvolle Tätigkeit auch entsprechend
bezahlt werden würde. Ich möchte die all-
seitigen Vorteile einer angemessenen haus-
ärztlichen Palliativziffer nicht weiter dis-
kutieren oder begründen. Es liegt auf der
Hand, wie wichtig diese sehr verantwor-
tungsvolle Tätigkeit des Hausarztes ist.“
Wie sieht es mit der Vergütung haus-ärztlich-palliativer Tätigkeit innerhalb der HZV aus? Beispielhaft habe ich mir die bayerischen HZV-Verträge (Stand 01.06.2014) angesehen. Die AOK Bay-ern (4,3 Millionen Versicherte und ein Marktanteil von rund 40 Prozent) und die Betriebskrankenkassen in Bayern (2,1 Millionen Versicherte) haben die hausärztliche oder allgemeine ambulan-te Palliativversorgung (AAPV) in ihre Verträge und Vergütungsschematik auf-genommen.
Was gilt innerhalb der Verträge, in denen eine solche Tätigkeit extra vergü-tet wird? Die Palliativpauschale im AOK- und BKK-HZV-Vertrag ist unter folgen-den Voraussetzungen abrechenbar: „Be-treuung von Patienten mit einer Pallia -tiverkrankung gemäß Definition der WHO.“ Weiter heißt es in den Vertrags-unterlagen: „Ein Palliativpatient ist der-jenige Patient mit einer weit fort-geschrittenen (progredienten) Erkran-kung und einer begrenzten Lebens-erwartung zu der Zeit, in der die Erkran-kung nicht mehr auf eine kurative Be-handlung anspricht und die Beherr-schung von Schmerzen, anderen Krank-heitsbeschwerden, psychologischen, so-zialen und spirituellen Problemen höchste Priorität besitzt. Primäre Zielset-zung ist die Lebensqualitätserhaltung bzw. -steigerung im finalen Krankheits-stadium.“
Die Palliativpauschale ist maximal einmal pro Quartal abrechenbar und
nicht neben der normalen Grundpau-schale (0000) und der Chronikerpau-schale (0003 oder BBP). Sie ist außerdem nicht abrechenbar, wenn der HZV-Be-treuerarzt Leistungen der SAPV (Spezia-lisierte ambulante Palliativversorgung) für den HZV-Patienten abrechnet. Na-türlich gilt auch hier die Grundregel: „Nur für Patienten mit mindestens ei-nem Arzt-Patienten-Kontakt im Abrech-nungsquartal“. Des Weiteren kann der Betreuerarzt zusätzlich zu den Besuchs-leistungen einen Besuchszuschlag für Palliativpatienten abrechnen.
Nun gibt es ja im EBM seit 01.10.2014 auch sogenannte Palliativ-ziffern: 03370, 03371, 03372 und 03373. Diese sind teils dem Hausbesuch als Zuschlag zugeordnet oder sind für die Ersterhebung des Patientenstatus inkl. Behandlungsplan anzusetzen. Pa-rallel zu allen Palliativziffern im EBM darf in derselben Sitzung keine Chroni-kerziffer (03320, 03321), keine Ger-iatrieziffer (03362) und kein Basis -assessement (03360) berechnet werden. Zum Teil ist auch die Gesprächsziffer (03230) nicht möglich. Für unterschied-liche Hausbesuchsziffern sind unter-schiedliche Zuschläge anzusetzen.
Analog zur HZV gilt: „Die Gebüh-renordnungspositionen 03370 bis 03373 sind nicht berechnungsfähig, wenn der behandelnde Vertragsarzt äquivalente Leistungen bei dem Patien-ten im Rahmen der spezialisierten am-bulanten Palliativversorgung erbringt.“ Leider kommt hier jedoch in Bezug auf die Zuschläge und die Behandlung in der Praxis noch folgender Hinweis dazu: „Die Gebührenordnungspositionen 03371, 03372 und 03373 sind nicht bei Patienten berechnungsfähig, die eine Vollversorgung in spezialisierter am-
Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Bereich Allgemeinmedizin, Klinikum der Universität MünchenPeer reviewed article eingereicht: 12.06.2014, akzeptiert: 02.07.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0402–0403
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
bulanter Palliativversorgung (SAPV) erhalten.“
Dennoch kann bei zahlreichen Arzt-Patienten-Kontakten durch struk-turiertes Einsetzen der Leistungsziffern ein hoher Fallwert erreicht werden, der sich aus Ordination, Chroniker-zuschlägen, Geriatrieziffern (beim Pa-tienten über 70 Jahren) und Palliativ-ziffern in Verbindung mit Hausbesu-chen ergibt.
Insgesamt ist aus meiner Sicht die Abrechnung in der HZV (bei den oben genannten Verträgen) aber wesentlich einfacher: Palliativpauschale + Besuche (zu Hause oder im Heim) + Besuchs-zuschlag. Vielleicht hat man dann den Rücken frei für die wirklich wichtigen Aspekte der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, die Kollege Fimpel in seinem Brief beschrieben hat. Positiv ist auch, dass die parallele Versorgung unserer Patienten durch ein Team der SAPV die Vergütungspositionen nicht beeinflusst.
Zusammengefasst:Es gibt HZV-Ziffern für AAPV beim Hausarzt.Die SAPV (wenn nicht selbst durchge-führt) ist davon unbenommen.Innerhalb der HZV gibt es diese Zif-fern teils seit Jahren.
– Es gibt noch keine flächendeckende Vertragssituation, die diese Vergütung beinhaltet.
– Mit geschicktem Abrechnen inner-halb des EBM lassen sich höhere Fall-werte generieren.
Ob, wie Kollege Fimpel schreibt „eine
sachgemäße, kompetente, empathische,
respektvolle, kooperative ärztliche Betreu-
ung von Sterbenden in den letzten Tagen
oder Wochen Ihres Lebens“ durch die oben genannten Zahlen ausreichend vergütet wird oder nicht, soll an dieser Stelle nicht bewertet werden. Viele von uns haben über Jahre die genannten Leis-tungen für unsere Patienten ohne spe-zielle Ziffern oder Benennungen er-
bracht. Positiv ist zu werten, dass diese Position innerhalb der hausärztlichen Vergütung jetzt sowohl im EBM als auch in der HZV Eingang gefunden hat. Nach meiner Überzeugung kann ein hausärzt-licher Berufsverband die Weiterentwick-lung und Stärkung dieser Vergütungs-positionen voranbringen. Es ist eine der Aufgaben unserer Fachgesellschaft, die Qualität und die Strukturen und Abläufe innerhalb der AAPV (allgemeine ambu-lante Palliativversorgung) und SAPV zu beforschen und wissenschaftlich zu kommentieren.
Tabelle 1 Übersicht über die relevanten Leistungen (beispielhaft in Bayern): Bei fehlenden Eurobeträgen ist die Leistung entweder in der Grund-
pauschale enthalten oder nicht als Einzelleistung abrechenbar.
Dr. med. Jörg Schelling
Klinikum der Universität München
Medizinische Klinik und Poliklinik IV
Bereich Allgemeinmedizin
Pettenkoferstraße 8 a, 80336 München
Tel.: 089 5160-3779
Korrespondenzadresse
Kontaktabhängige (Quartals-) Pauschale für Palliativpatienten
Zuschlag je Besuch Palliativpatient
Heimbesuch
Regelbesuch
AOK Bayern
120 €
20 €
18 €
30 €
Ersatz- kassen (ohne TK)
–
–
–
30 €
BKK Bayern
120 €
20 €
18 €
30 €
Techniker KK
–
–
–
30 €
LKK
–
85 €
18 €
30 €
Bosch BKK
–
–
–
–
IKK classic
-
-
-
-
403ZWISCHEN DEN ZEILEN / BETWEEN THE LINES
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
404 KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINION
Elektronische Gesundheitskarte – wie Ärzte geködert und Patienten hinters Licht geführt werdenWilfried Deiß
Vor wenigen Tagen habe ich als nieder-gelassener Arzt Post vom Hersteller un-serer Praxis-Software bekommen. Es geht um Teilnahme an der ersten Stufe der Tests zur Elektronischen Gesund-heitskarte/Telematik. Darin werden mir als Praxisinhaber einer Gemeinschafts-praxis eine einmalige „Aufwandsent-schädigung“ von 7.500 Euro und eine Monatspauschale von 975 Euro bis zum Ende des Testlaufes angeboten, wenn ich den Vertrag zur Teilnahme am „On-line-rollout Stufe 1“ unterschreibe. Ähn-liche Angebote dürften derzeit sehr viele Ärztinnen und Ärzte bekommen.
Da inzwischen weit über 95 % der gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland die Elektronische Gesund-heitskarte (eGK) als Nachfolger der bis-herigen Krankenversichertenkarte mit sich führen und die Solidargemein-schaft der Versicherten letztlich der „Kostenträger“ für das Projekt ist, geht das Thema fast jeden an.
Noch immer ist dem allergrößten Teil der Versicherten nicht klar, dass es bei dem Milliardenprojekt Gesundheits-karte nur am Rande um die eGK = Plas-tikkarte geht, sondern vor allem um ein bundesweites Datennetzwerk. Für die geplante „Vernetzung“ des Gesund-heitswesens ist die Karte in der Hand des Patienten nur ein Schlüssel. Außer Ver-waltungsdaten und einigen zusätzli-chen Informationen kann die Gesund-heitskarte nichts speichern, zum Bei-spiel keine Arztberichte, Krankenhaus-berichte, Röntgenbilder usw. All diese Daten sollen mittelfristig im Datennetz-werk gespeichert werden, sodass sie von überall her jederzeit abrufbar sind, wenn der Patient das mit seinem „Schlüssel“ erlaubt.
Einen Sinn hätte das nur, wenn mehrere Bedingungen erfüllt wären:
• Erstens müsste eine große Mehrheit der Patienten gefragt worden sein und sagen: Ja, ich bin damit einverstan-den, dass meine persönlichen Kran-kenberichte in Zukunft nicht mehr in der Praxis des Arztes/Hausarztes ge-sammelt, sondern in einem bundes-weiten Datennetz dauerhaft gespei-chert werden. Diese Frage ist aber nie gestellt worden.
• Zweitens müsste ein funktionierendes Modellprojekt existieren, anhand des-sen sich Ärzte und vor allem Patienten einen Eindruck verschaffen könnten, was überhaupt wie werden soll. Ein solches Modellprojekt existiert aber nicht. Noch nicht einmal die Planun-gen, wie über das geplante Netz Arzt-briefe verschickt werden könnten, sind abgeschlossen.
• Drittens müsste das funktionierende Modellprojekt sich für Ärzte und Pa-tienten als alltagstauglich erwiesen haben.
• Und viertens müsste ein im Alltag er-wiesenermaßen nicht störendes Pro-jekt von den Teilnehmern des Modell-projektes (Patienten, Ärzte, Apothe-ken und Krankenhäuser) mit großer Mehrheit als merkliche Verbesserung der medizinischen Abläufe und als nachweisbare Verbesserung der medi-zinischen Versorgung angesehen wer-den. Aber nichts von all dem liegt vor (nähere Infos gewünscht? Siehe z.B. Rubrik „eGK“ auf unserer Praxishome-page http://praxiswilfrieddeiss.de/no-online-egk/).
Erst dann, wenn diese Punkte gewähr-leistet wären, hätte das Projekt über-haupt gestartet werden dürfen. So ha-ben wir bisher nichts weiter als eine Plas-tikkarte in der Tasche, die sich nur durch ein Foto vom Vorgänger unterscheidet,
deren Einführung aber bereits hunderte Millionen Euro gekostet hat. Dazu die neuen Lesegeräte in den Praxen. Neben-bei wurde bei den Fotos für die Karte nicht einmal die Identität des Versicher-ten geprüft, was erst auffiel, als Karten das Profil von Mickey Mouse oder Darth Vader trugen. Und zudem müssen die bisher sinnlosen Karten sehr bald wieder durch neue ersetzt werden, weil ein elek-tronisches Zertifikat ausläuft – wieder ei-nige Hundert Millionen Euro an Gel-dern der Solidargemeinschaft.
Hier werden uns voraussichtlich 10–15 Milliarden Euro an Kosten auf-gebürdet für ein wundersames Vehikel, von dem nicht einmal das Fahrwerk fer-tig ist. In Großbritannien wurde die Ge-samtvernetzung des Gesundheitswesens übrigens vor einigen Jahren durch einen politischen Beschluss beendet, nach-dem etliche Milliarden Pfund in den Sand gesetzt wurden, ohne dass bis da-hin eine Alltagstauglichkeit oder ein medizinischer Vorteil erkennbar gewe-sen wäre.
Und dann noch der Datenschutz: Nicht erst seit Snowden und NSA ist be-kannt, welche Begehrlichkeiten eine solch gigantische Datensammlung weckt. Und wir sind hier nicht im Penta-gon. Es geht um ein Datennetzwerk, an das hundertausende Ärzte, zehntausen-de Apotheker, tausende Krankenhäuser und hunderte von Krankenkassen mit insgesamt Millionen von Mitarbeitern angeschlossen sein würden – nicht zu re-den von vielen tausend Computertech-nikern, die das Ganze aufbauen und warten.
Bei dem aktuellen Teilnahme-Ver-trag geht es um die Stufe 1 des „Roll-out“. Wenn ich den Vertrag, der hier ge-rade vor mir liegt, unterschreiben wür-de, dann bekomme ich Aufwandsent-
Facharzt für Innere Medizin/Hausarzt, SiegenDOI 10.3238/zfa.2014.0404–0405
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
schädigung und Monatspauschale und lasse dafür zu, dass Computertechniker in unsere Praxis kommen und das Pra-xisnetzwerk auf eine spezielle Weise mit dem Internet verbinden, um zunächst eine Verbindung mit den Computern der Krankenkassen herzustellen. Wenn Sie dann als Patient in die Praxis kom-men, dann geschieht Folgendes: Sie wer-den gar nicht gefragt, Ihre eGK wird scheinbar wie üblich eingelesen, aber gleichzeitig stellt der Praxisrechner eine Verbindung mit Ihrer Krankenkasse her und die Daten werden abgeglichen. Ne-benbei weiß die Krankenkasse dann auch immer sekundengenau, wann Sie sich bei welchem Arzt eingecheckt ha-ben. Das nennt sich dann „Versicherten-Stammdaten-Management“. Übrigens gibt es in dem Vertrag eine Klausel zur Geheimhaltung, die besagt, dass ich als teilnehmender Arzt über den Ablauf der Tests nichts in die Öffentlichkeit drin-gen lassen dürfte.
Und warum wird den Ärzten so viel Geld angeboten? Ganz einfach, weil der Widerstand zu groß ist und die Akzep-tanz gering. Alle Ärztetage der vergange-nen Jahre haben sich klar gegen die Plä-ne in dieser Form positioniert. Und das aus wirklich guten Gründen, denn was da klammheimlich im Verborgenen
Schritt für Schritt aufgebaut wird und aktuell mit diesem Köder ans Licht kommt, wird sehr wahrscheinlich den medizinischen Alltag erheblich er-schweren, keinen relevanten medizi-nischen Vorteil für Patienten haben, ei-ne gigantische Verschwendung von Ver-sichertengeldern sein, letztlich nur den IT-Firmen nutzen und sehr wahrschein-lich auch nur von einer Minderheit der Patienten gewollt werden.
Was ist, wenn nur 5 % der Patienten sagen: Ja, ich möchte, dass meine Arzt-berichte und Krankenhausberichte ab sofort nicht mehr bei meinem Hausarzt aufbewahrt, sondern in einem bundes-weiten Datennetz dauerhaft gespeichert werden. Jetzt kommt das Pikante: Auch wenn nur 5 % das wollen, MUSS das Netz in voller Größe gespannt und auf-rechterhalten werden. Den Profiteuren in der IT-Branche kann es also egal sein, wie stark das Telematik-Netz frequen-tiert wird – das Geschäft bleibt gleich. Je-denfalls kann man beim Thema eGK der Ärzteschaft nicht vorwerfen, es ginge ums eigene Geld. Dann würden sich ak-tuell scharenweise Ärzte finden, die für 7.500/975 Euro den Teilnahme-Vertrag unterschreiben. Es scheint aber sehr schwer zu sein, Teilnehmer zu finden, und das ist auch gut so.
Und Sie als Patienten? Sie sollten spätestens jetzt die Frage beantworten: Möchten Sie, dass Ihre Gesundheits-daten in Zukunft nicht mehr beim Arzt, sondern in einem bundesweiten Com-puternetz gespeichert werden? Wenn NEIN, dann sollten Sie das ihrem Arzt und ihrer Krankenkasse mitteilen. Eine politische Entscheidung zum Abbruch des unsinnigen Projektes wird es nur ge-ben, wenn genügend öffentlicher Druck da ist. Wenn das nicht gelingt, werden mindestens 10 Milliarden Euro der Soli-dargemeinschaft entzogen und es wird eine Autobahn gebaut, die keiner braucht, weil es inzwischen viel ein-fachere und effektivere Wege zur Ziel-erreichung gibt, die zudem nicht nur verschwenderisch teuer, sondern auch noch sehr gefährlich ist.
Interessenkonflikte: keine angege-ben.
Wilfried Deiß
Internist – Hausarzt
Koblenzer Straße 109
57072 Siegen
Korrespondenzadresse
405KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINION
Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den „Tagen der Allgemeinmedizin“ finden Sie unter
www.tag-der-allgemeinmedizin.de
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
nötigen. Die Erreichbarkeitszeiten sind bewusst so gewählt, dass die MFAs außer-halb der Sprechstundenzeiten und mit ein wenig Zeit anrufen können.
MFA-Portal
Unser MFA-Portal bietet erstmals auch für MFAs die Möglichkeit, ihre Teilnah-me an unseren Fortbildungen struktu-riert zu erfassen und sich jederzeit ei-nen Überblick über besuchte Schulun-gen, Qualitätszirkel, usw. zu verschaf-fen.
Im vierten Quartal 2014 erhalten al-le bei uns registrierten MFAs ihren per-sönlichen Fortbildungsausweis mit ihrer persönlichen MFA ID (Abb. 1).
Unsere Veranstalter, z.B. unsere Qualitätszirkel-Moderatorinnen, wer-den von uns mit einem Scanner aus-gestattet. Künftig wird bei jeder unse-rer Veranstaltungen der Barcode von den Fortbildungsausweisen der MFAs
abgescannt, die Daten werden dann elektronisch an das MFA-Portal über-mittelt.
Unter www.mfa-portal.de wird für jede MFA ein persönlicher Bereich ein-gerichtet. Dort erhalten die MFAs eine Übersicht über alle von Ihnen besuch-
ten Veranstaltungen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich nach jeder Veranstal-tung ein Zertifikat auszudrucken.
Auf unsere Homepage unter www.hausarzt-bw.de/mfa finden Sie weitere Informationen zu unseren Angeboten für MFAs.
Abbildung 3 MFA-Qualitätszirkel
Claudia Schieche aus der Praxis Dr. Erlewein in StuttgartIch nehme aus jedem Qualitätszirkel immer wieder ein Stück neues Wissen mit. Davon
profitieren auch meine Kolleginnen und meine Chefs. Für mich ist es auch immer viel ein-
facher, von Neuerungen zu hören, anstatt in der Praxis auf die Schnelle zu lesen. Darüber
hinaus ist es auch sehr interessant, wie andere Praxen mit Problemen umgehen. Es werden
auch immer medizinische Themen angesprochen, sodass auch hier manche Wissens-
lücken gestopft werden. Von den neuen MFA-Workshops habe ich viel mit in die Praxis
mitnehmen können und es ist zeitlich so gut verpackt, dass man nicht irgendwann müde
wird!
Alexandra Ilg aus der Praxis Geis in StuttgartMan kann noch so viele Jahre im Beruf arbeiten – es gibt immer etwas Neues zu lernen –
Gott sei Dank. Es ist toll, eine Anlaufstelle für das manchmal nicht so durchschaubare
QM, Ziffern, HZV und Formularchaos zu haben.
Julia Schwarz aus der Praxis Schunder in StuttgartIch besuche den MFA-Qualitätszirkel, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Den
Austausch mit den Kolleginnen empfinde ich für mich als sehr wichtig. Vorschläge und
Tipps für den Umgang mit neuen Regelungen, Lösungen für die Umsetzung, jedes Mal be-
sprechen wir ein anderes medizinisches Thema, um unser Wissen aufzufrischen und das
immer in einer tollen Atmosphäre.
408 FORTBILDUNG / CONTINUING MEDICAL EDUCATION
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
409ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Gerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family PracticeKarola Mergenthal, Corina Güthlin, Lisa-Rebekka Ulrich, Juliana J. Petersen, Julia Hirschfeld, Andrea Siebenhofer
Institut für Allgemeinmedizin, Goethe-Universität Frankfurt am Main Peer reviewed article eingereicht: 27.04.2014, akzeptiert: 17.06.2014 DOI 10.3238/zfa.2014.0409–0414
Hintergrund: Gerinnungsmanagement ist komplex und stellt für Patienten und für Hausärzte eine Herausforde-rung dar; vor allem, wenn Personen mit Migrationshinter-grund (MH) und mangelnden Deutschkenntnissen ver-sorgt werden müssen. In dieser Studie wurde untersucht, ob Unterschiede in der gerinnungshemmenden Versor-gung von Patienten mit und ohne MH bestehen.Methode: Bei der Rekrutierung von Teilnehmern zur Pri-mary Care Management for Optimized Antithrombotic Treatment (PICANT)-Studie, einer clusterrandomisierten klinischen Studie zum Gerinnungsmanagement in Haus-arztpraxen, wurden Daten zur Indikation, Art und Quali-tät der gerinnungshemmenden Versorgung erhoben. An-gaben der Ärzte zur Compliance, zum Migrationsstatus und zur deutschen Sprachkompetenz ergänzten die Da-tenerhebung. Unterschiede wurden auf statistische Sig-nifikanz geprüft.Ergebnisse: Unter den 1.757 gescreenten Personen be-fanden sich 160 (9,1 %) mit MH. Alter, Geschlecht, Indi-kation und die gerinnungshemmende Versorgung waren vergleichbar; jeweils 93 % in jeder Gruppe nahmen einen Vitamin-K-Antagonisten ein. 92 % der Personen ohne MH und 93 % der Migranten hatten eine Indikation zur ora-len Antikoagulation (OAK) und erhielten auch eine. Mit ihrem INR-Wert im Zielbereich waren 67 % der Personen ohne MH und 63 % der Migranten, je 10% führten Pa-tientenselbstmanagement durch. Hausärzte schätzten Personen mit MH als weniger compliant ein (p = 0,04). Die Migranten kamen aus 28 verschiedenen Ländern und 60 % hatten gute deutsche Sprachkenntnisse.Diskussion/Schlussfolgerungen: Der Anteil der Pa-tienten mit einer gerinnungshemmenden Über- oder Un-tertherapie war insgesamt gering und unterschied sich zwischen den Gruppen mit und ohne MH nicht bedeut-sam. Trotz vergleichbar guter gerinnungshemmender Ver-sorgung schätzten Hausärzte die Compliance von Patien-ten mit MH schlechter ein. Diese subjektive Einschätzung der Hausärzte sollte im Hinblick auf ihr Verhalten bei der Versorgung genauer untersucht und gegebenenfalls be-rücksichtigt werden.
Schlüsselwörter: Orale Antikoagulation; Migration; Versorgungsforschung; Hausarztpraxis; interkulturell
Background: Coagulation management is complicated and is a challenge for both patients and their family phys-icians (FPs), particularly when the person receiving care has a migratory background (MB) and speaks German poorly. In this study, we examine whether there is a differ-ence in anticoagulation therapy between patients with and without an MB.Method: When participants were being recruited for the Primary Care Management for Optimized Antithrombotic Treatment (PICANT) trial, a cluster-randomized clinical study on coagulation management in family practice, in-formation was collected on the indication, type and quality of anticoagulation therapy patients were under-going. Further data were gathered from the doctors on adherence, immigration status and German language ability. Differences were tested for statistical significance.Results: Of the 1,757 screened persons, 160 (9.1 %) had a migratory background. Age, gender, indication and anticoagulation therapy were comparable, and 93 % of each group was taking a vitamin K antagonist. Oral anti-coagulation (OAC) was indicated and taken by 93 % of persons with and 92 % without an MB. 63 % of migrants and 67 % of non-migrants had values within their thera-peutic INR range, and 10 % of each group was perform-ing INR self-management. FPs reckoned patients with a migratory background showed poorer adherence (p = 0.04). The immigrants came from 28 different coun-tries and 60 % spoke German well.Discussion/Conclusions: The proportion of patients showing under- or overtreatment with oral anticoagulants was low overall and there was no significant difference between the two groups. Despite comparably good re-sults, FPs judged adherence among patients with an MB to be worse. This subjective assessment by FPs should be examined in more detail and possibly taken into account when considering their behavior when providing care.
Keywords: Oral Anticoagulation; Health Services Research; Family Practice; Intercultural
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Hintergrund
Die gesundheitliche Versorgung von Migranten/Personen mit Migrations-hintergrund (MH)* in Deutschland ist schlechter als die der einheimischen Be-völkerung [1]. Sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede können zu einer erschwerten Kommunikation zwi-schen Arzt** und Patient und damit zu einer Beeinträchtigung der Qualität der Versorgung führen [2]. Gerade bei einer komplexen Behandlung wie dem Gerin-nungsmanagement mit oralen Anti-koagulanzien (OAK) ist der Therapie-erfolg abhängig davon, ob die Patienten die Therapieempfehlungen verstehen und umsetzen können. Es ist eine hohe Compliance erforderlich, um das Risiko für Nebenwirkungen gering zu halten [3].
Mit der Hemmung der Blutgerin-nung (Antikoagulation) wird thrombo-embolischen Komplikationen bei Pa-tienten mit Vorhofflimmern oder ande-ren Indikationen wirksam vorgebeugt und das Schlaganfallrisiko gesenkt. Die Verabreichung von OAK erfordert ein sorgfältiges Sicherheitsmanagement wie z.B. die regelmäßige Überwachung der Blutwerte (INR-Messung) und eine An-passung der Medikamententherapie [3]. Aus dem Register des Deutschen Kom-petenznetzes Vorhofflimmern (AFNET), das zwar überwiegend Daten von kar-diologisch/internistischen Spezialisten, aber auch aus 23 deutschen Hausarzt-praxen enthält, weiß man, dass nur 72 % eine OAK erhalten, 17 % erhalten lediglich Plättchenaggregationshemmer und 11 % werden nicht antithrombo-tisch versorgt, obwohl keine Kontraindi-kation ersichtlich ist [4]. Mögliche Gründe für eine Unterversorgung wur-den bei 459 britischen Allgemeinmedi-zinern erfragt. Genannt wurden fehlen-de Zeit für die Einstellung, Verzögerung beim Erhalt der Laborwerte, Interaktion mit anderen Medikamenten und die Angst vor rechtlichen Komplikationen [5]. Obwohl sich das englische Gesund-
heitssystem grundsätzlich vom deut-schen unterscheidet, könnten diese Gründe auch in deutschen Hausarztpra-xen eine Rolle spielen. Geschulte Patien-ten können selbst die INR-Bestimmung und die Dosisanpassung in Form eines Patientenselbstmanagements (PSM) übernehmen. Zahlreiche randomisierte kontrollierte Studien bestätigen, dass thromboembolische Ereignisse bei PSM seltener auftreten und sich die Gerin-nungseinstellung verbessern lässt [6, 7]. Dies gilt auch für ältere Patienten [8].
Ziel der hier vorgestellten Erhebung war es, zu untersuchen, ob sich die ge-rinnungshemmende Versorgung von gescreenten Patienten mit und ohne MH in der Indikation, Art und Qualität der Versorgung unterscheidet, und ob Unterschiede in der Einschätzung der Compliance durch die Hausärzte beste-hen. Zusätzlich wurden Informationen zur Herkunft und zur eingeschätzten Sprachkompetenz berücksichtigt.
Methode
Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen der Rekrutierungsphase (Juli bis Oktober 2012) für die PICANT-Studie (Primary
Care Management for Optimized Anti-
thrombotic Treatment), einer clusterran-domisierten kontrollierten Studie, in der untersucht wird, ob eine komplexe Inter-vention das Gerinnungsmanagement in Hausarztpraxen verbessert [9]. Die Fall-zahlplanung ergab eine Stichprobengrö-ße von 690 Patienten aus 52 Hausarzt-praxen. Zur Praxisrekrutierung wurde ei-ne zufallsgenerierte Stichprobe aus allen bei der KV Hessen registrierten, hausärzt-lich tätigen Ärzten gezogen. Die 568 Ärz-te dieser Stichprobe erhielten Studien-informationen und wurden um Teilnah-me gebeten. Teilnehmende Praxen iden-tifizierten prinzipiell geeignete Patienten zufallsgeneriert aus der Praxis-Daten-bank und anonymisierten die Daten.
2.036 Patienten wurden gescreent, um die notwendige Teilnehmerzahl zu erreichen. In die Auswertung flossen ex-plizit die Daten aller gescreenten Patien-ten ein, unabhängig davon, ob Studien-ausschlussgründe vorlagen bzw. ob sie später an der Studie teilnahmen oder nicht. Die alleinige Betrachtung der Stu-dienteilnehmer hätte zu einer Selektion von Patienten geführt, in der Personen mit MH meist unterrepräsentiert sind.
Die Hausärzte wurden hinsichtlich der Langzeitindikation befragt. Um die Art der gerinnungshemmenden Versor-gung abzubilden, erfolgte ein Vergleich der medikamentösen Therapie (Cumari-ne, Dabigatran, Rivaroxaban, ASS/Clo-pidogrel). Zur Abbildung der Qualität wurde aus der Kombination einer Lang-zeitindikation zur OAK und den ver-abreichten Medikamenten beurteilt, ob eine angemessene Therapie oder eine Über- oder Untertherapie vorlag. Eine Untertherapie lag vor, wenn eine Lang-zeitindikation zur OAK vorhanden war und kein Medikament verabreicht wur-de. Eine Übertherapie war gegeben, wenn eine Verabreichung eines OAK er-folgte, obwohl keine Langzeitindikation zur OAK bestand. Bei Patienten mit Cu-marintherapie wurde verglichen, ob sich der letzte erhobene INR-Wert im Zielbereich befand und wie hoch der Anteil der Patienten mit PSM war. Zu-sätzlich bewerteten die Hausärzte die Compliance der Patienten (Untertei-lung in „sehr compliant“, „mittelmäßig compliant“ oder „nicht compliant“), den Migrationsstatus und ggf. die Sprachkompetenz. Basisdaten wie Ge-schlecht und Geburtsjahr vervollstän-digten die Erhebung.
Die Auswertung umfasste deskripti-ve und bivariate Analysen (Mann-Whit-ney-Test bei nicht Normalverteilung von kontinuierlichen Daten und Chi-Quadrat-Test bei kategorialen Daten). Das Signifikanzniveau für alle statisti-schen Tests wurde auf α ≤ 0,05 festgelegt. Ein positives Ethikvotum (vom 26.06.2012) der Ethik-Kommission der Goethe-Universität in Frankfurt am Main liegt vor.
Ergebnisse
Insgesamt wurden Daten von 2.036 Per-sonen erhoben. Bei 275 Personen stellte sich während des Screenings heraus, dass keine Langzeitindikation und keine OAK-Gabe vorlagen. Bei vier Personen fehlten die Angaben zum Migrationssta-tus, daher flossen die Datensätze von 1.757 Patienten in die Auswertung ein, wovon 160 Personen einen MH (9,1 %) hatten.
Die Personengruppe mit MH war signifikant jünger (s. Tab. 1); deren Al-tersdurchschnitt betrug 70,7 Jahre (SD 10,7) gegenüber 75 Jahren (SD 10,2) in
* Zu diesem Personenkreis gehören nach der Defini-tion des Statistischen Bundesamtes alle Menschen, die selber oder deren Eltern (mindestens ein Eltern-teil) im Ausland geboren sind, unabhängig davon, ob sie die deutsche oder ausländische Staatsbürger-schaft besitzen. Die Bezeichnung „Personen mit Mi-grationshintergrund“ und „Migranten“ wird in dem vorliegenden Artikel synonym verwendet.** Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die getrenn-te Erwähnung beider Geschlechter verzichtet. Es sind stets beide Geschlechter gemeint.
410
Mergenthal et al.:Gerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family Practice
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Tabelle 1 Vergleich von Personen mit und ohne Migrationshintergrund
411
Mergenthal et al.:Gerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family Practice
Ergebnisse
Alter
Geschlecht
Diagnosen für eine Langzeitindikation zur oralen Antikoagulation3
Chron. Vorhofflimmern/Vorhofflattern
Tiefe Venenthrombose (hohes Rezidiv-Risiko)
Lungenarterienthrombose (hohes Rezidiv-Risiko)
Mechanischer Herzklappenersatz
Andere Indikation
Keine Indikation
Art der Versorgung (gerinnungshemmende Medikation)
Vitamin-K-Antagnonisten (Phenprocoumon [Marcumar®] und Coumadin)
Direkte orale Antikoagulanzien (Dabigatran [Pradaxa®] und Rivaroxaban [Xarelto®])
Qualität der Versorgung
Patient hat Langzeitindikation zur OAK und erhält auch eine.
Patient hat Langzeitindikation zur OAK, erhält aber keine.
Patient hat keine Langzeitindikation zur OAK, erhält aber eine.
Gerinnungseinstellung bei Cumarin-Therapie
INR-Wert im Zielbereich
INR-Wert nicht im Zielbereich
Patientenselbstmanagement (PSM)
Kein Patientenselbstmanagement
Patientenselbstmanagement
Einschätzung der Compliance durch den Hausarzt
Sehr compliant
Mittelmäßig compliant
Nicht compliant
1 Mann-Whitney-Test2 Chi2-Test3 Langzeitindikation für eine orale Antikoagulation: Vorhofflimmern/-flattern, rezidivierende Thromboembolien oder rezidivierende Lungenembolien, mechanische Herzklappe oder seltene Voraussetzungen, die eine orale Antikoagulation mit Cumarinen erfordern (hereditäre Koagulopathien, intrakardiale Thromben)Signifikante Ergebnisse fett markiert
Mittleres Alter in Jahren (SD)
Range
Weiblich
Männlich
Personen mit MH (n = 160)
70,7 (10,7)
38–92
83 (51,9 %)
77 (52,7 %)
124 (77,5)
9 (5,6)
1 (0,6)
17 (10,6)
4 (2,5)
5 (3,1)
n = 150 (%)
140 (93,3)
10 (6,7)
n = 160 (%)
147 (91,9)
8 (5,0)
5 (3,1)
n = 138 (%)
87 (63,0)
51 (37,0)
n = 53 (%)
128 (89,5)
15 (10,5)
n = 158 (%)
91 (57,6)
52 (32,9)
15 (9,6)
Personen ohne MH (n = 1.597)
75,0 (10,2)
23–100
750 (47,0 %)
847 (53,0 %)
1.268 (79,4)
137 (8,6)
33 (2,1)
99 (6,2)
24 (1,5)
36 (2,3)
n = 1.509 (%)
1.412 (93,6)
97 (6,4)
n = 1.597 (%)
1.491 (93,4)
70 (4,4)
36 (2,3)
n = 1.367 (%)
917 (67,1)
449 (32,9)
n = 90 (%)
1.288 (90,4)
135 (9,5)
n = 1.577 (%)
1.065 (67,5)
398 (25,2)
114 (7,2)
p-Wert
<0,0001
0,2362
0,0422
0,8622
0,5072
0,3312
0,4552
0,0412
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
der Personengruppe ohne MH. In bei-den Gruppen bestand beim Großteil der Patienten Vorhofflimmern als Indikati-on zur OAK (79,4 % ohne MH vs. 77,5 % mit MH).
Art und Qualität der Versorgung mit Gerinnungshemmern
Jeweils 93 % der Personen mit und ohne MH nahmen einen Vitamin-K-Antago-nisten ein. Auch der Anteil der Patien-ten, die ein Cumarin zur OAK erhielten, war in beiden Gruppen gleich hoch mit 87,5 % (n = 140 mit MH vs. n = 1.397 oh-ne MH). In der Gruppe der Personen mit MH war der Anteil der Übertherapie mit 5,0 % (n = 8) höher als in der Gruppe der Personen ohne MH mit 4,4 % (n = 70). Auch von einer Untertherapie waren ge-ringfügig mehr Migranten betroffen (3,1 %; n = 5 vs. 2,3 %; n = 36). Ein statis-tisch signifikanter Unterschied ließ sich nicht nachweisen.
Unter Cumarin waren weniger Mig-ranten mit ihrem INR-Wert innerhalb des therapeutischen Zielbereichs mit 63 % (n = 87) gegenüber Personen ohne MH mit 67 % (n = 917), wobei der Unter-schied nicht statistisch signifikant war. Innerhalb der Gruppe der Migranten führte mit 10,5 % (n = 15) ein größerer Anteil PSM durch als in der Gruppe oh-ne MH mit 9,5 % (n = 135). Die neuen Antithrombotika waren zu Studien-beginn im Jahr 2012 erst kürzlich zuge-lassen und demnach nur in geringem Maß in Verwendung (vgl. Tab. 1).
Einschätzung der Compliance durch die Hausärzte
Die Hausärzte schätzten die Compliance von Personen ohne MH signifikant hö-her ein (67,5 %; n = 1.065) als von Per-sonen mit MH (57,6 %; n = 91) und be-schrieben bei den Migranten signifikant häufiger „mittelmäßige Compliance“ (32,9 %; n = 52 vs. 25,2 %; n = 398) oder „keine Compliance“ (9,6 %; n = 15 vs. 7,2 %; n = 114) (vgl. Tab. 1).
Herkunft und Sprachkompetenz
Unter den Personen mit MH waren nach den Angaben der jeweiligen Hausärzte 2,5 % (n = 4) in Deutschland geboren, für 73,3 % (n = 118) wurde ein anderes Geburtsland angegeben und bei 23,8 % (n = 38) war das Geburtsland nicht be-
kannt. Insgesamt wurden neben dem Geburtsland Deutschland noch weitere 28 verschiedene Herkunftsländer ge-nannt. Die drei am häufigsten genann-ten Länder waren:• Tschechien mit 11,9 % (n = 19)• Italien mit 10,6 % (n = 17)• Polen mit 8,1 % (n = 13)
Die Hausärzte schätzten die Sprachkom-petenz von 96 Personen (60,4 %) mit MH in der Stichprobe als sehr gut oder gut und von 63 Personen (39,6 %) als be-friedigend bis ungenügend ein. Für eine Person lag keine Einschätzung zur Sprachkompetenz vor.
Diskussion
Hinsichtlich der gerinnungshemmen-den Versorgung von Personen mit und ohne MH zeigte sich in dieser Studie, dass keine bedeutsamen Unterschiede bestehen. Dies gilt auch für die Errei-chung eines INR-Zielwertes bei Patien-ten mit Cumarin. Trotzdem schätzten Hausärzte Personen mit MH als weniger compliant ein.
Art und Qualität der gerinnungs-hemmenden Versorgung
Bei über 90 % der Patienten entsprach die Behandlung in beiden verglichenen Gruppen den aktuellen Leitlinien, wel-che zur OAK eine an das individuelle Ri-siko der Patienten angepasste Behand-lung empfehlen [10]. Damit ist der An-teil der angemessenen Therapie sowohl bei den Migranten als auch in der Ver-gleichsgruppe sehr hoch gegenüber an-deren Studien. Ogilvie et al. zeigten in einem systematischen Review auf [11], dass Patienten mit Vorhofflimmern und einem hohen Schlaganfallrisiko in der Mehrzahl der identifizierten Studien un-tertherapiert waren. Reynolds et al. [12] beschreiben in den USA und Kanada ei-ne hohe Abbruchrate der Warfarin ein -nahme 2–2,5 Jahren nach Ersteinnah-me. Cohen et al. [13] identifizierten in einer israelischen Studie als Einflussfak-toren für eine Untertherapie hohes Alter (> 80 Jahre) und mangelnde hebräische Sprachkenntnisse. In deutschen Haus-arztpraxen findet eine engmaschige Kontrolle und Überwachung der INR-Werte statt, sodass dadurch ein Thera-pieabbruch und eine Untertherapie
auch der älteren Population (in der Stu-die waren 33,7 % > 80 Jahre) verhindert werden kann. Die Gruppe der Patienten mit deutschen Sprachschwierigkeiten war in der PICANT-Studie sehr klein (n = 63), und es fanden sich keine sig-nifikanten Unterschiede in der Versor-gung.
Bei 63 % der Migranten und 67 % der Personen ohne MH war der einmalig erhobene INR-Wert innerhalb des thera-peutischen Zielbereiches. Daten aus ei-ner Metaanalyse von Wan et al. [14] zei-gen, dass nur etwa die Hälfte der unter-suchten Population im Zielbereich lag. In einer deutschen Studie aus dem Jahr 2007 [15] waren nur etwa 55 % der Pa-tienten mit Vorhofflimmern innerhalb ihres empfohlenen Zielbereiches. Im Vergleich dazu sind die Ergebnisse in der vorgestellten Studienpopulation zufrie-denstellend.
Der Anteil der neuen oralen Anti-koagulanzien (NOAK) spielte zu Beginn dieser Studie in der hausärztlichen Be-handlung noch eine untergeordnete Rolle. Gerade für die NOAK muss auf-merksam beobachtet werden, ob die postulierten Vorteile wie das fehlende Monitoring sich auch im Versorgungs-alltag bewähren [16]. Gründe von Haus-ärzten für die Initiierung oder die Um-stellung auf die NOAK werden am Studi-enende von PICANT im Rahmen von qualitativen Erhebungen in den teilneh-menden Praxen untersucht [9]. PSM wurde insgesamt selten, bei Migranten – vermutlich aufgrund des geringeren Al-ters – etwas häufiger als in der Ver-gleichsgruppe ohne MH durchgeführt. Bereits im Jahr 2009 führten ca. 150.000 Patienten in Deutschland PSM durch. Bei einer geschätzten Zahl von 1,8 Mio. Menschen mit Vorhofflimmern ist der Anteil an PSM in Deutschland ins-gesamt sehr gering. Ein Grund könnte darin liegen, dass von den Hausärzten der tatsächliche Anteil von Patienten (mit und ohne MH), die PSM durchfüh-ren können, unterschätzt wird [6]. Dass auch ältere Personen von PSM profitie-ren, belegen die Ergebnisse der SPOG-60+-Studie, in der das Durch-schnittsalter 69 Jahre betrug und über eine dreijährige Beobachtungszeit die Überlegenheit bei der Verhütung schwe-rer thromboembolischer Ereignisse und Blutungskomplikationen festgestellt werden konnte [8].
412
Mergenthal et al.:Gerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family Practice
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Einschätzung der Compliance
Personen mit MH wurden von den Hausärzten in dieser Studie signifikant häufiger als „nicht compliant“ einge-schätzt, obwohl sich dies in den Ergeb-nissen zur Qualität der gerinnungs-hemmenden Versorgung, v.a. im Errei-chen des INR-Zielwertes nicht wider-spiegelt. Interkulturell kompetenten Ärzten und Praxisteams sollte bewusst sein, dass das Therapieverhalten von bestimmten Migrantengruppen durch zusätzliche Faktoren wie z.B. dem kul-turellen Hintergrund beeinflusst wird [17]. Die kulturbedingte unterschiedli-che Auffassung von Krankheit und Ge-sundheit bestimmt das Krankheitserle-ben und dadurch auch den Umgang mit chronischen Krankheiten [18]. Ei-ne Unterschätzung der Compliance birgt die Gefahr, dass der Fokus auf das individuelle Gesundheitsverhalten ge-legt wird, ohne die Bedürfnisse und Wertevorstellungen der Migranten zu hinterfragen, zu verstehen und zu ak-zeptieren und so die Motivationslage nicht optimal einzuschätzen. Gerade Hausärzte sollten auf diesen Aspekt stärker sensibilisiert werden, da Mig-ranten ihren Hausarzt häufiger auf-suchen als Deutsche [19].
Stärken und Schwächen der Studie
Es ist davon auszugehen, dass vor allem motivierte und interessierte Hausärzte teilnahmen, was sich in der überdurch-schnittlich guten Versorgung der ge-screenten Patienten zeigt. Welchen Ein-fluss dies auf die Versorgung von Patien-ten mit MH hat, kann nicht beurteilt werden. Die anonymisierte Datenerhe-bung vor Beginn der eigentlichen kli-nischen Studie (im Screeningprozess) hat den Vorteil, dass Daten von Patien-ten, die aufgrund mangelnder Sprach-kenntnisse nicht an der Studie teilneh-men konnten, mit in die Auswertungen einbezogen wurden. Von Nachteil war, dass durch diese Konstruktion keine di-rekte Patientenbefragung möglich war. So konnte die tatsächliche Compliance nicht überprüft werden. Für die Kalkula-tion der INR-Werte haben wir zu Studi-enbeginn nur einen einzigen Messwert erhoben, weshalb eine TTR (Time in Therapeutic Range) Kalkulation nicht möglich war. Für die finale Auswertung nach Studienende von PICANT sind je-doch detaillierte Auswertungen zur Ge-rinnungsqualität vorgesehen. Die Er-gebnisse sind auf keine spezielle kultu-relle Bevölkerungsgruppe übertragbar,
da es sich um eine sehr heterogene Gruppe aus vielen verschiedenen Her-kunftsländern handelt.
Schlussfolgerungen
Der demografische Wandel sowie die pro gnostizierte Zunahme der Indikatio-nen für OAK lassen für die Zukunft ei-nen erhöhten Versorgungsbedarf beim Gerinnungsmanagement erwarten. Die Qualität der gerinnungshemmenden Versorgung von Personen mit und ohne MH war in der vorliegenden Studie sehr hoch. Die subjektive Einschätzung der Compliance durch die Hausärzte sollte im Hinblick auf ihr Verhalten bei der Versorgung genauer untersucht und ge-gebenenfalls berücksichtigt werden. Da-zu könnte man die interkulturelle Kom-petenz des gesamten Praxisteams erhö-hen.
Förderung: Die Studie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt (Förderkennzei-chen 01GYM45).
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Karola Mergenthal, M. Sc. Public Health
Institut für Allgemeinmedizin
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt a. Main
Tel.: 069 6301 6281
frankfurt.de
Korrespondenzadresse
413
Mergenthal et al.:Gerinnungsmanagement bei Migranten in der HausarztpraxisCoagulation Management Among Migrants Attending Family Practice
… ist Gesundheitswissenschaftlerin (Master of Science für Pu-
blic Health). Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dokto-
randin am Institut für Allgemeinmedizin an der Goethe-Univer-
sität, Frankfurt am Main. Interessenschwerpunkte sind neben
der hausärztlichen Versorgung von Migranten vor allem die
Forschung für und mit Medizinischen Fachangestellten in der
Hausarztpraxis.
Karola Mergenthal …
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
414 FORTBILDUNG / CONTINUING MEDICAL EDUCATION
1. Razum O, Zeeb H, Meesmann U, et al. Migration und Gesundheit. Schwer-punktbericht der Gesundheitsbericht-erstattung des Bundes. Berlin: Robert-Koch-Institut, 2008
2. Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis. Gesundheitliche Versorgungssituation von Migrantinnen und Migranten im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Hei-delberg. http://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis/get/792363/Bericht-zur-gesundheitli-chen-Versorgungssituation.pdf (letzter Zugriff 26.04.2014)
3. Hua TD, Vormfelde SV, Abed MA, Schneider-Rudt H, Sobotta P, Chenot JF. Orale Antikoagulation in der Hausarzt-praxis. Z Allg Med 2010; 86: 382–389
4. Breithardt G, Dobrey D, Doll N, et al. The German Competence Network on Atrial Fibrillation (AFNET). Herz 2008, 33: 548–555
5. Rodgers H, Sudlow M, Dobson R, Ken-ny RA, Thomson RG. Warfarin anticoa-gulation in primary care: a regional sur-vey of present practice and clinicians’ views. Br J Gen Pract 1997; 47: 309–310
6. Heneghan C, Ward A, Perera R, et al. Self-monitoring of oral anticoagulati-on: systematic review and meta-ana-lysis of individual patient data. Lancet 2012; 379: 322–334
7. Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K, Ha-bacher W, Schmidt L, Semlitsch T. Self-management of oral Anticoagulation. Dtsch Arztebl Int 2014; 6: 83–91
8. Siebenhofer A, Rakovac I, Kleespies C, Piso B, Didjurgeit U. Self-management of oral anticoagulation reduces major outcomes in the elderly. A randomized controlled trial. Thromb Haemost 2008; 100: 1089–1098
9. Siebenhofer A, Ulrich LR, Mergenthal K, et al. Primary care management for optimized antithrombotic treatment PICANT: study protocol for a cluster-randomized controlled trial. Imple-ment Sci 2012; 7: 79
10. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, et al. Guidelines for the management of atri-al fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010; 12: 2369–2429
11. Ogilvie IM, Newton N, Welner SA, Co-well W, Lip GYH. Underuse of oral anti-coagulants in atrial fibrillation: a syste-matic review. Am J Med 2010; 123: 638–645
12. Reynolds MR, Shah J, Essebag V, et al. Patterns and predictors of warfarin use in patients with new-onset atrial fibril-lation from the FRACTAL registry. Am J cardiol 2006; 97: 538–543
13. Cohen N, Almoznino-Sarafian D, Alon I, et al. Warfarin for stroke prevention still underused in atrial fibrillation pat-terns of omission. Stroke 2000; 31: 1217–1222
14. Wan Y, Heneghan C, Perera R, et al. An-ticoagulation control and prediction of adverse events in patients with atrial fi-brillation: a systematic review. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2008; 1: 84–91
15. McBride D, Brüggenjürgen B, Roll S, Willich SN. Anticoagulation treatment for the reduction of stroke in atrial fi-brillation: a cohort study to examine the gap between guidelines and routine medical practice. J Thromb Thromoly-sis 2007; 24: 65–72
16. Innasimuthu AL, Kumar S, Akter S, Bo-rer JS. New oral anticoagulants: great promise for therapeutic advance but great knowledge gaps remain to be fil-led. Cardiology 2013; 126: 41–49
17. Bermejo I, Hölzel LP, Kriston L, Härter M. Subjektiv erlebte Barrieren von Per-sonen mit Migrationshintergrund bei der Inanspruchnahme von Gesund-heitsmaßnahmen. Bundesgesund-heitsbl 2012; 55: 944–953
18. Brzoska P, Razum O. Krankheitsbewäl-tigung bei Menschen mit Migrations-hintergrund im Kontext von Kultur und Religion. Z Med Psychol 2009; 18: 151–161
19. Palecek F. Ältere MigrantInnen – Sozia-le Lage und Gesundheit. http://heimat-kunde.boell.de/2013/11/18/%C3%A4ltere-migrantin-nen-soziale-lage-und-gesundheit (letz-ter Zugriff 26.04.2014)
Literatur
XXVI. Internationaler Fortbildungskurs
in praktisch-klinischer Diabetologie für Fortgeschrittene
In Kooperation mit der DEGAM
14.–16. November 2014 in Jena
In Fortsetzung der bekannten diabetologischen kritischen „Gut Höhne“-Veranstaltungen von Michael Berger findet in Jena seit einigen Jahren im Herbst eine entsprechende Veranstaltung statt, diesmal in Kooperation mit der DEGAM – Arbeitsgruppe Diabetes.
Das Programm ist voll von kritischer, EBM-getragener Aufarbeitung – diesmal insbesondere zu den Themen: Screening – Prävention – Kooperation von Spezialisten mit Generalisten – Pro und Contra BZ-Kontrollen – Praktische Übungen/Seminare.
Und was die Veranstaltung noch auszeichnet: Viel Raum zum entspannten Gespräch in sehr persönlicher Atmosphäre in einer sehr schönen Stadt.
Details zum Programm und den Konditionen der Tagung: www.diabetologie-tagung.de
Wir empfehlen zu kommen: Günther Egidi, Till Uebel, Heinz-Harald Abholz
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
415ÜBERSICHT / REVIEW
„Selbsthilfefreundlichkeit“ als Ansatz der Kooperation von Selbsthilfegruppen und niedergelassenen ÄrztenSelf-Help Friendliness as an Approach to Collaboration Between Self-Help Groups and DoctorsAlf Trojan
Institut für Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum Hamburg-EppendorfPeer reviewed article eingereicht: 20.05.2014, akzeptiert: 02.07.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0415–0418
Hintergrund: Dass Ärzte mit Patienten „als Bündnispart-ner“ in der Qualitätsentwicklung des Gesundheitswesens zusammenarbeiten, ist ein wichtiges Gesundheitsziel. Viele berufspolitische ärztliche Institutionen versuchen, die Zu-sammenarbeit zu fördern. Es mangelt aber an systema-tisch-fachlichen Ansätzen. Unter der Überschrift „Selbsthil-fefreundlichkeit“ wurde in den vergangenen 10 Jahren ein solcher Ansatz für alle Versorgungsbereiche des Gesund-heitswesens entwickelt und erprobt. In dem vorliegenden Beitrag sollen Grundzüge und aktueller Entwicklungsstand speziell für die ambulante Versorgung aufgezeigt werden.Methode: Narrativer Überblick auf Basis einer pragmati-schen und systematischen LiteraturrechercheErgebnisse: In einem Modellversuch mit sechs Arztpraxen wurden konsensual zwischen Ärzten, Selbsthilfeunterstüt-zungsstellen und Selbsthilfegruppen Qualitätskriterien der Selbsthilfefreundlichkeit definiert und ihre erfolgreiche Um-setzung systematisch aufbereitet und dokumentiert. Die Kriterien wurden nicht nur in das interne Qualitätsmanage-ment der beteiligten Praxen aufgenommen, sondern fan-den auch Eingang in bundesweite Qualitätsmanagement-systeme wie QEP und EPA. Zwei innovative, selbsthilfe-freundliche Praxisnetze und ihre Konzeption von selbsthil-febezogener Patientenorientierung werden beschrieben.Diskussion: Die Akzeptanz der Kriterien guter Kooperati-on bei den Beteiligten, ihre Berücksichtigung in Qualitäts-managementsystemen und eine von den Krankenkassen geförderte Bundeskoordinationsstelle des Netzwerks „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen“ (www.selbsthilfefreundlichkeit.de) sind Faktoren, welche die weitere Ausbreitung des Ansat-zes fördern können. Es gibt aber auch bei allen Beteiligten Probleme oder Vorbehalte, die eine schnelle Verbreitung unwahrscheinlich erscheinen lassen.
Schlüsselwörter: Patientenorientierung; Selbsthilfefreundlichkeit; Kooperation mit Selbsthilfegruppen; Qualitätsmanagement; ambulante Versorgung
Introduction: Building coalitions between doctors and patients for quality improvement of health services is an important goal of German health policy. Many organi-sations of the medical profession try to promote such col-laboration. However, there is a lack of systematic profes-sionally grounded approaches. During the past 10 years under the heading of „self-help friendliness“ a new ap-proach has been developed and tested for all areas of health services provision. This paper will present basic fea-tures and the present state of this approach in ambula-tory care.Method: Narrative overview based on a pragmatic and a systematic literature searchResults: In a demonstration project with six practices quality criteria of self-help friendliness were developed in a consensus process between doctors, self-help clearing-houses and self-help groups. The implementation has been well documented and is publicly available. The crite-ria were integrated into the internal quality management of practices as well as into nation-wide accreditation sys-tems, such as QEP and EPA. Two innovative self-help friendly regional health care provider networks and their conception of self-help related patient centredness were identified and will be described.Discussion: Factors, such as good acceptance of the quality criteria, their introduction into formal German ac-creditation systems, and a national coordination office, funded by major health insurance companies, might foster the spreading of the approach. At the same time, however, all parties involved have some problems or res-ervations. Therefore, a rapid growth of self-help friendly healthcare institutions seems rather unlikely.
Keywords: Self-Help Groups; Quality Management; Ambulatory Care
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Hintergrund
Selbsthilfegruppen (SHG) und Selbst-hilfeorganisationen (SHO) sind eine zentrale Quelle für die Gesundheits-kompetenz der Menschen und die Über-windung von Gesundheitsproblemen [1]. Daher stellt die Verwirklichung ei-ner „selbsthilfefreundlichen Kultur“ in der gesamten und damit auch der ambu-lanten Versorgung eine zentrale Heraus-forderung für die Effektivität des Ge-sundheitssystems dar. Dieser Beitrag fo-kussiert auf eine besondere Rolle von Pa-tienten, die im Rahmen der Formulie-rung nationaler Gesundheitsziele als „Bündnispartner von Qualitätsexperten in der Verbesserung von Versorgungs-strukturen“ charakterisiert wurde [2].
Es gibt zahlreiche Beispiele einer be-rufspolitisch motivierten und ideell so-wie materiell unterstützten Kooperation mit Selbsthilfegruppen [z.B. 3]. In die-sem Zusammenhang entstand das Schlagwort von „selbsthilfefreundli-chen“ Einrichtungen im Gesundheits-wesen. Damit sind Einrichtungen ge-meint, die den Unterstützungs- und Par-tizipationswünschen von Selbsthilfe-gruppen in strukturierter Weise dauer-haft nachkommen.
Aufgrund einer Initiative des „Aus-schusses der Ärztekammer Hamburg für die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegrup-pen“ und der lokalen Kontaktstelle zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen be-gann im Herbst 2004 ein Modellprojekt zur Entwicklung eines Qualitätssiegels „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“. Seither wurde der Ansatz, Gesundheitsein-richtungen zur Selbsthilfefreundlichkeit zu qualifizieren, auch auf andere Bereiche ausgedehnt [4]. Für die Leserschaft dieser Zeitschrift sollen die Entwicklung und der aktuelle Stand im vertragsärztlichen Be-reich referiert und diskutiert werden. Auf evaluative Literatur wird verwiesen.
Methoden
Die pragmatische Recherche stützt sich auf die relevanten deutschen Quellen, in denen die Kooperation von Selbsthil-fe und Ärzten dokumentiert und reflek-tiert wird, insbesondere auf die Clea-ring- und Dokumentationsstelle für Selbsthilfeforschung (www.medsoz.uni-freiburg.de/cds/welcome.htm; http://elearn.hawk-hhg.de/projekte/
wise/), auf die Internetseiten der Natio-nalen Kontaktstelle für Selbsthilfegrup-pen (www.nakos.de) sowie des Netz-werks „Selbsthilfefreundlichkeit und Pa-tientenorientierung im Gesundheitswe-sen“ (www.selbsthilfefreundlichkeit.de) und das auf den entsprechenden Websi-tes zugängliche Quellenmaterial.
Die systematische Literatursuche (self-help OR „mutual help“ OR „mutual aid“ OR „support group“ OR „patient group“) AND (hospital OR care OR „health ser-vices“ OR practice) AND (cooperation OR collaboration OR „patient participation“ OR “patient invol vement” OR patient-centeredness) erfolgte in Pubmed and PsycINFO (03.02.2014). Pubmed ergab 648 Publikationen, PsycINFO 129 (ad-vanced search: title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures). Es wur-den (mit Ausnahme einer eigenen) nur deutsche Publikationen zum Thema Selbsthilfefreundlichkeit (weniger als bei der pragmatischen Suche) gefunden. Fast alle übrigen Aufsätze behandelten kli-nische Themen, bei denen Selbsthilfe-gruppen erwähnt wurden (z.B. als Zu-gang zur untersuchten Patientengruppe), jedoch nicht im Zentrum standen.
Ergebnisse
Das Verhältnis zwischen Selbsthilfe und Professionellen, insbesondere Ärzten, ist in allgemeinen [z.B. 5] und speziellen ärztebezogenen Studien [z.B. 6] zum Thema gemacht worden.
Die Ergebnisse eines jüngeren zu-sammenfassenden Rückblicks [7] sind ambivalent: Zwar haben sich seit An-fang der 1980er-Jahre wichtige positive Entwicklungen im Sinne sich wandeln-der wechselseitiger Wahrnehmungen und zunehmender Interaktionen zwi-schen Ärzten und Selbsthilfegruppen er-geben, aber selbst eine entschiedene Rü-ckenstärkung durch Kassenärztliche Vereinigungen oder Ärztekammern war nicht in der Lage, eine kontinuierliche Zusammenarbeit bei einer nennenswer-ten Zahl von Ärzten zu garantieren.
Im Folgenden sollen Basisinforma-tionen zu einem methodisch-fachlichen Ansatz dargestellt werden, der dem Mangel an systematischer Kooperations-gestaltung tendenziell abhelfen könnte. Zunächst wird die Entstehung von „Selbsthilfefreundlichen Arztpraxen“
im Rahmen eines Modellprojekts ge-schildert. Im nächsten Schritt wird zu-sammengefasst, in wieweit die im Mo-dellversuch entwickelten Kriterien und Abläufe Eingang in Qualitätsmanage-mentsysteme gefunden haben. Als drit-ter Aspekt wird exemplarisch die Zusam-menarbeit mit Selbsthilfegruppen in neuen kooperativen Versorgungsfor-men, wie Ärztenetzen, behandelt.
Modellversuch Selbsthilfe-freundliche Arztpraxen
Der Modellversuch „Selbsthilfefreundli-che Praxis NRW“ wurde durch mehrere Studien vorbereitet [8–10]. Er wurde von der Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW in Zusammenarbeit mit der Koope-rationsberatung für Selbsthilfegruppen und Ärzte (KOSA), der Kassenärzt lichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sowie mit Unterstützung der Selbsthilfe-kontaktstelle Dortmund, im Zeitraum 2009–2011 durchgeführt. Sechs Dort-munder Arztpraxen nahmen teil.
Ziel des Modellversuchs war es, Qua-litätskriterien zur Selbsthilfefreundlich-keit zu entwickeln und ihre Umsetzung zu erproben. Die Qualitätskriterien (s. un-ten) entstanden als ein einheitlicher und von den Beteiligten anerkannter Stan-dard, nach dem eine Zusammenarbeit unabhängig von der einzelnen Arztpraxis bzw. einer einzelnen Selbsthilfegruppe initiiert und praktiziert werden kann.
Der Modellversuch „Selbsthilfe-freundliche Praxis NRW“ [11] hat gezeigt, dass es möglich ist, Zusammenarbeit mit beidseitigem Gewinn zu gestalten.
Integration von Qualitätskriterien der Kooperation ins Qualitätsmanagement
Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz wurden die Ärzte 2004 verpflichtet, ein praxisinternes QM (Qualitätsmanage-ment) einzuführen und weiterzuent-wickeln. Die entsprechende QM-Richtli-nie des Gemeinsamen Bundesausschus-ses (G-BA) vom 18.10.2005 fordert: „sys-tematische Patientenorientierung; alle an der Versorgung Beteiligten angemes-sen einbeziehen; strukturierte Koope-ration an den Nahtstellen der Versor-gung.“ Die systematische Kooperation mit der organisierten Selbsthilfe kann ein entscheidendes Element sein, um
416
Trojan:„Selbsthilfefreundlichkeit“ als Ansatz der Kooperation von Selbsthilfegruppen und niedergelassenen ÄrztenSelf-Help Friendliness as an Approach to Collaboration Between Self-Help Groups and Doctors
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
diese Ziele zu erreichen bzw. die Grund-elemente mit Leben zu erfüllen.
Der Modellversuch „Selbsthilfe-freundliche Praxis NRW“ diente als Nachweis für die Praktikabilität der kon-sentierten Qualitätskriterien und des sys-tematischen Vorgehens zu ihrer Imple-mentation. Sie gelten derzeitig als Stan-dard guter Kooperation für Arztpraxen:• Informationen zur Selbsthilfe sind
übersichtlich an zentraler Stelle in den Praxisräumen für Patienten zu-gänglich.
• Die Praxis weist auf die Zusammenar-beit mit der Selbsthilfe in ihren Me-dien und innerhalb der Praxisräume hin.
• Der Arzt/Psychotherapeut gibt ins-besondere bei einer seltenen Erkran-kung den konkreten Hinweis auf die Selbsthilfe.
• Die Praxis benennt für die Selbsthilfe einen Ansprechpartner.
• Praxis und Selbsthilfe treffen Verein-barungen zur Zusammenarbeit.
• Die Praxis ist über die Strukturen und Arbeitsweise der Selbsthilfe durch re-gelmäßigen Erfahrungsaustausch in-formiert.
Nach Abschluss des Modellprojekts wurde das „KVWL-Praxis-QualitätsManagement (KPQM)“ im Bereich Patientenorientie-rung durch einen „Musterprozess“ zur Selbsthilfefreundlichkeit erweitert [12]. Eine Vorlage zur Implementierung der Qualitätskriterien Selbsthilfefreundlich-keit in das KV-Praxis-Qualitätsmanage-ment (KPQM) steht als strukturierte Anlei-tung für weitere interessierte Praxen im Internet (www.kvwl.de) zur Verfügung.
Das System „Qualität und Entwick-lung in Praxen“ (QEP) der Kassenärzt-lichen Bundesvereinigung und der KVen hatte schon im Manual 2005 im Kernziel 1.3.5 die Kooperation mit loka-len Selbsthilfekontaktstellen und Selbst-hilfegruppen abgefragt. Im aktualisier-ten Qualitätsziel-Katalog 2010 wird die Selbsthilfefreundlichkeit (jetzt beim Qualitätsziel 1.3.6) stärker akzentuiert und konkreter ausformuliert [13].
Selbsthilfefreundlichkeit in kooperativen Versorgungsformen
Die Tendenz heutiger Praxisausübung geht weg von der Einzelpraxis hin zu kooperativen Versorgungsformen wie MVZ und integrierten regionalen Ver-
sorgungssystemen. Bei dem QM-Sys-tem EPA (Europäisches Praxis Assess-ment; www.epa-qm.de) existieren bei der Version „EPA für Medizinische Ver-sorgungszentren“ innerhalb des Be-reichs „Bedarfsorientierte Ausrichtung der Versorgung“ vier Qualitätsindikato-ren, die einen Selbsthilfebezug haben [14]. Bekannt ist auch, dass Onkologi-sche Zentren für ihre formelle Anerken-nung eine Zusammenarbeit mit SHG vorweisen müssen. In diesem Bereich dürften viele Zentren zumindest einige der Qualitätskriterien für Zusammenar-beit erfüllen.
In zwei besonders qualitätsorientier-ten Versorgungsnetzen deutet sich an, wie der Ansatz Selbsthilfefreundlichkeit für kooperative Versorgungsformen an-gepasst, umgesetzt und implementiert werden kann.
Integriertes Versorgungsmo -dell Kinzigtal: Dieses Versorgungsmo-dell setzt in vielfältiger Form auf die in-tensive Kooperation mit den Patienten und Patientengruppen [15]. Dazu gehö-ren beispielsweise die Aushändigung ei-ner Charta der Patientenrechte bei Ein-tritt in das Versorgungsmodell, eine Ombudsperson, also ein Ansprechpart-ner für die Patienten, ein Patientenbei-rat und die enge Kooperation mit loka-len Gruppen und Vereinen (www.gesundes-kinzigtal.de).
Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz Nürnberg e.G. (QuE) – Das Selbsthilfefreundliche Praxis-netz: QuE hat für die Metropolregion Nürnberg erfolgreich ein integriertes Versorgungsmodell etabliert. Der Selbst-hilfefreundlichkeit wird in diesem Ko-operationsnetzwerk explizit eine be-deutsame Rolle zugedacht (www.gesundheitsnetznuernberg.de). Die „Selbsthil-fefreundliche Netzorganisation“ wird folgendermaßen konkretisiert:• Sie thematisiert Selbsthilfe im Rah-
men ihres Praxisqualitätsmanage-ments (z.B. in Form einer Selbstbewer-tung).
• Selbsthilfe wird zum regelmäßigen Thema in den Netzmedien, z.B. in der QuE-Patientenzeitung „Doktors Bes-tes“, die einmal im Quartal in einer Auflage von 11.000 Stück erscheint.
• Selbsthilfe erhält eine Darstellungs-plattform im Rahmen ärztlicher QuE-Veranstaltungen, z.B. gemeinsame Teilnahme an der KBV-Messe Versor-gungsinnovation 2012 in Berlin.
• Selbsthilfebeauftragte auf Netz- und Praxisebene.
Rückenwind für eine systematische Ko-operation mit Selbsthilfegruppen findet sich auch in der „Rahmenvorgabe der KBV für die Anerkennung von Praxis-netzen nach § 87b Abs. 4 SGB V – Versor-gungsziele, Kriterien, Qualitätsanforde-rungen zur Anerkennung von Praxisnet-zen im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband“ (vom 16.4.2013). Für die höchste Qualitätsstufe wird beim Kriterium „Befähigung“ u.a. ein/e Selbsthilfebeauftragte/r gefordert.
Diskussion: Entwicklungsperspektiven
Bei allen Beteiligten hat sich in verschie-denen Studien eine große Akzeptanz ge-zeigt [16]. Als Infrastruktur für die weite-re Verbreitung hat sich das Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit im Gesund-heitswesen“ gebildet (www.selbsthilfefreundlichkeit.de). Auch die Integration der konsentierten Qualitätskriterien von Selbsthilfefreundlichkeit in wichti-ge bundesweit verbreitete Qualitäts-managementsysteme könnte ein Anreiz für Praxen sein, die Kooperation aktiv zu suchen und zu gestalten.
Trotzdem gibt es Vorbehalte und Probleme bei allen Beteiligten des Bünd-nisses, die in Rechnung zu stellen sind. Aufseiten der Selbsthilfeverbände wurden Sorgen geäußert, dass die Grenze von „Beteiligung“ zu „Missbrauch der Selbst-hilfegruppen“ fließend sei. Ein markan-tes Zitat aus dem Fragebogen einer Stu-die lautete: „Wenn hier, ‚ Zusammen-arbeit’ angeboten wird, muss man sein ‚ Holzauge’ auf äußerst wachen Betrieb stellen, denn die Instrumentalisierung droht allerorten.“[17]
Selbsthilfekontaktstellen als Brücke und Unterstützer von lokalen Selbsthil-fegruppen bei der Umsetzung haben noch nicht immer das nötige Know-how und die zeitlichen Ressourcen für eine Begleitung von Gesundheitsein-richtungen auf dem Weg zur Selbsthilfe-freundlichkeit. Es gibt jedoch seit Kur-zem eine spezifische Qualifizierungs -broschüre für diese Zielgruppe (http:// www.nakos.de/site/materialien/ fachpublikationen/konzepte/).
Aufseiten der Ärzte im ambulanten Bereich gibt es verbal zwar überwiegend
417
Trojan:„Selbsthilfefreundlichkeit“ als Ansatz der Kooperation von Selbsthilfegruppen und niedergelassenen ÄrztenSelf-Help Friendliness as an Approach to Collaboration Between Self-Help Groups and Doctors
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Zustimmung zur Zusammenarbeit; eine empirische Studie zeigte aber gleichzei-tig, dass Moderatoren von ärztlichen Qualitätszirkeln zu etwa Dreiviertel meinten, dass ihre Kollegen noch nicht genügend Informationen über Selbsthil-fegruppen und die Gestaltung von Zu-sammenarbeit haben [10].
Für den Hausarzt sind viele Möglich-keiten der Kooperation gegeben: Bei häufigen Erkrankungen wie Alkohol -abusus oder Tumoren entlasten Selbst-hilfegruppen ihn bei der Nachsorge. Bei seltenen Erkrankungen können sie kompetenter Kooperationspartner bei
der Suche und Auswahl geeigneter Hil-fen sein [18]. Es muss aber kritisch ge-fragt werden, ob das in dem Modellver-such entwickelte Vorgehen nicht zu auf-wendig für die meisten Einzelpraxen ist, zumal nicht in jeder Praxis in gleicher Weise eine Zusammenarbeit sinnvoll oder wichtig ist. Auf der Ebene von Arzt- oder Versorgungsnetzen und kooperati-ven ärztlichen Versorgungsinstitutio-nen erscheint es praktikabler, Selbsthil-fefreundlichkeit zu entwickeln und zu implementieren. Erstens ist die zeitliche Anfangsinvestition ökonomischer, weil sie nicht nur einem oder wenigen Ärz-
ten, sondern einer größeren Anzahl von Nutzen ist. Zweitens ergeben sich durch andere Vergütungsformen, z.B. nach §140a SGB V neue Möglichkeiten für Anreize und Gestaltung.
Interessenkonflikte: AT ist Mitglied im Steuerungskreis des Netzwerks „Selbsthilfefreundlichkeit und Patien-tenorientierung im Gesundheitswesen“, d.h. ehrenamtliche Beratungstätigkeit; Projektleiter von Studien und Autor oder Mitautor zahlreicher Publikatio-nen zu diesem Ansatz.
Prof. Dr. Dr. Alf Trojan
Institut für Medizinische Soziologie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52
20246 Hamburg
Tel. 040–3905602
Korrespondenzadresse
1. Borgetto B. Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland. Stand der Forschung. Baden-Baden: Nomos, 2002
2. gesundheitsziele.de. Bericht vom 14. Februar 2003; http://gesundheitszie-le.de/cms/medium/30/Be-richt_BMG_2003.pdf, S.168/169 (letz-ter Zugriff am 10.5.2014)
3. Fischer J, Litschel A, Meye MR, Schlö-mann D, Theiß S, Ueffing G. Leitlinien für Kooperationen. In: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Hrsg.). Kooperationshandbuch – ein Leitfaden für Ärzte, Psychotherapeuten und Selbsthilfe. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2004: 124–126
4. Trojan A, Bellwinkel M, Bobzien M, Ko-fahl C, Nickel S (Hrsg.). Selbsthilfe-freundlichkeit im Gesundheitswesen. Wie sich selbsthilfebezogene Patien-tenorientierung systematisch ent-wickeln und verankern lässt. Bremer-haven: Wirtschaftsverlag NW, 2012
5. Trojan A, Estorff-Klee A (Hrsg.). 25 Jah-re Selbsthilfeunterstützung in Ham-burg. Studienergebnisse zu Unterstüt-zungserfahrungen und -bedarf. Ham-burg: LIT Verlag, 2004
6. Litschel A. Kooperation von Ärzte-schaft und Selbsthilfe. Bundesgesund-heitsbl Gesundheitsforsch Gesund-heitsschutz 2009; 52: 40–46
7. Trojan A, Nickel S. Selbsthilfefreundli-che Arztpraxen: die Entstehungs-geschichte der Zusammenarbeit. In: Trojan A, Bellwinkel M, Bobzien M, Ko-fahl C, Nicken S (Hrsg.). Selbsthilfe-freundlichkeit im Gesundheitswesen. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, 2012: 206–211
8. Trojan A, Huber E, Nickel S, Kofahl C. Selbsthilfefreundlichkeit als Qualitäts-ziel in der vertragsärztlichen Versor-gung. Gesundheitswesen 2009; 71: 628–637
9. Scholze P. Selbsthilfegruppen im Fokus: KVB stellt Umfrageergebnisse vor. Bayr Ärztebl 2008; Nr. 3: 150–152
10. Nickel S, Trojan A, Kofahl C. Increasing patient centredness in outpatient care through closer collaboration with pa-tient groups? Health Policy 2012; 107: 249–257
11. Bobzien M, Schlömann D, Trojan A. Modellprojekt „Selbsthilfefreundliche Praxis“ Nordrhein-Westfalen. In Trojan A, Bellwinkel M, Bobzien M, Kofahl C, Nicken S (Hrsg.). Selbsthilfefreundlich-keit im Gesundheitswesen. Bremerha-ven: Wirtschaftsverlag NW, 2012: 240–258
12. Kassenärztliche Vereinigung West-falen-Lippe (KVWL) (Hrsg.). Selbsthil-fefreundliche Praxis in Westfalen-Lip-pe. Pluspunkt Nr. 1: 24
13. Diel F, Gibis B (Hrsg.). QEP – Qualitäts-ziel-Katalog. Für Praxen. Für Koope-rationen. Für MVZ. Version 2010. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2011
14. Grote Westrick M, Schwenk, U. Quali-tät in integrierten Versorgungsstruktu-ren – Qualitätsindikatoren für medizi-nische Versorgungszentren. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2010
15. Siegel A, Zimmermann L, Stößel U. Di-mensionen der Patientenorientierung in der Integrierten Versorgung am Bei-spiel Gesundes Kinzigtal. Public Health Forum 2011; 19: 70
16. Nickel S, Trojan A. Akzeptanz und Um-setzbarkeit von Qualitätskriterien der selbsthilfebezogenen Patientenorien-tierung. Ergebnisse einer explorativen Befragung bei Selbsthilfeorganisatio-nen und Visitoren des Qualitätsmana-gementsystems KTQ. DMW 2012; 137: 17–23
17. Nickel S, Trojan A. Ist nachhaltige und gute Kooperation von Gesundheitsein-richtungen mit der Selbsthilfe mög-lich? In: Selbsthilfegruppenjahrbuch 2013. Gießen: Eigenverlag, 2013: 153–161
18. Lau D. Selbsthilfe als Hausarzt erlebt. In: Döhner H, Kaupen-Haas H, v d Kne-sebeck O (Hrsg.). Medizinsoziologie in Wissenschaft und Praxis. Berlin: LIT Verlag, 2009: 233–240
Literatur
418
Trojan:„Selbsthilfefreundlichkeit“ als Ansatz der Kooperation von Selbsthilfegruppen und niedergelassenen ÄrztenSelf-Help Friendliness as an Approach to Collaboration Between Self-Help Groups and Doctors
… Mediziner, Soziologe, ehemaliger Direktor des Instituts für Me-
dizinische Soziologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf; seit über 40 Jahren Forschung und Lehre in Medizinischer
Soziologie, Sozialmedizin und Public Health. Arbeitsschwerpunk-
te: Bürgerbeteiligung, Soziale Netzwerke und Selbsthilfe; Kom-
munale Gesundheitsförderung; Patienten- und Mitarbeiterbefra-
gung im Krankenhaus.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Alf Trojan, M.Sc. (London) …
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
419ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER
Eine qualitative Untersuchung zur Entwicklung der Studienmotivation angehender HumanmedizinerA Qualitative Analysis Regarding the Development of Future Physicians’ Studies-Related MotivationAnn Margareta Bernhardt, Jens-Martin Träder
Hintergrund: Die vorliegende Studie untersucht die zentralen Einflussfaktoren der Studienmotivation ange-hender Humanmediziner an der Universität zu Lübeck und deren zeitliche Entwicklung. Die Identifikation dieser Faktoren ermöglicht Rückschlüsse darauf, wie die univer-sitäre Lehre die Zufriedenheit, Gesundheit und das Enga-gement künftiger Mediziner bestmöglich fördern kann. Dies hätte auch positive Auswirkungen auf die Quote der Absolventen, die nach erfolgreichem Medizinstudium in Deutschland als Ärzte tätig werden, anstatt ins Ausland oder in nichtärztliche Tätigkeiten abzuwandern.Methoden: Die Ergebnisse wurden aus der qualitativen Auswertung leitfadengestützter Gruppengespräche abge-leitet, die in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring erfolgte.Ergebnisse: Bezüglich des zeitlichen Verlaufes der Moti-vation lassen sich vier Studierendengruppen unterschei-den (konstanter Verlauf, steigende Motivation, sinkende Motivation, häufiges „Auf und Ab“ der Motivation). Gruppenübergreifend wurden der vorklinische Abschnitt des Studiums und das Physikum zumeist als besondere Belastung der Studienmotivation empfunden. Die Gruppe mit im Verlauf gesunkener Motivation zeigt starke psy-chische Belastung und eine erhebliche Desillusionierung. Der Zusammenhalt unter Kommilitonen, der Kontakt mit ärztlichen Vorbildern, spezielles Interesse an einer Fach-richtung und das Ziel, ein guter Arzt zu werden, wirken besonders motivierend. Demotivierend hingegen seien mangelnder Patientenkontakt, die unzureichende Vermitt-lung praktischer und kommunikativer Fähigkeiten sowie der Kontakt mit überlasteten und desillusionierten Ärzten.Schlussfolgerungen: Zentrale Empfehlungen für die universitäre Ausbildung beziehen sich auf einen stärkeren Praxisbezug, auf die Vermittlung kommunikativer Fähig-keiten, auf die Förderung der psycho-physischen Gesund-heit der Studierenden sowie auf eine didaktisch höher-
Introduction: This study analyses central factors of in-fluence on the studies-related motivation of prospective physicians at the University of Lübeck and its devel-opment over time. The identification of these factors allows for inferences regarding how academic teaching can stimulate contentment, health, and commitment of future doctors optimally. This might also impact the share of alumni who work as physicians in Germany after their graduation instead of moving abroad or working in non-medical functions.Methods: The results have been obtained by qualitative analysis of guideline-based group discussions according to the qualitative content analysis of Mayring.Results: Regarding the development of the motivation over time, four groups of students are to be distinguished (rather constant motivation, increasing motivation, de-creasing motivation, frequent ’up and down’ of the moti-vation). Generally, the pre-clinical phase and the prelimi-nary medical examination were evaluated as a profound stress to the motivation. The group with a decreasing motivation shows significant mental burden and disil-lusionment. Solidarity among fellow students, the pres-ence of medical role models, strong interests in a particu-lar field of medicine, and the aim to become a ’good’ physician are particularly motivating. Particularly discour-aging were insufficient contact with patients, a deficient teaching of practical and communicative skills, and the contact with overburdened and disillusioned physicians.Conclusions: Central recommendations for medical edu-cation relate to a stronger focus on practical and com-municative skills, to the support of students’ mental-physical health, and to a didactically more valuable de-sign of academic teaching. These recommendations give evidence of a benefit by the introduction or expansion of pre-existing electives in family medicine as well as by the introduction of an mandatory quarter in family medicine.
Institut für Allgemeinmedizin, Universität zu LübeckPeer reviewed article eingereicht: 08.07.2014, akzeptiert: 12.08.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0419–0423
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Einleitung
Die medizinische Versorgung der Bevöl-kerung in der Bundesrepublik Deutsch-land befindet sich in einem tiefgreifen-den Wandel. In immer mehr Kom-munen ist der „wohnortnahe Zugang zu ärztlichen Leistungen nicht mehr gege-ben oder zumindest eingeschränkt“ [1]. Gerade in ländlichen Regionen fehlen niedergelassene Haus- und Fachärzte, „aber auch in den Krankenhäusern sind bundesweit mehr als 6.000 Arztstellen unbesetzt“ [1]. Zudem führen hohe Ar-beitsbelastung und ein unausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit zu ei-ner anhaltenden Abwanderung von Me-dizinern in das Ausland oder in medi-zinferne Berufe.
Insgesamt scheint die Attraktivität des Arztberufes zu leiden. Die Ursachen dieser Problematik sind vielfältig. Eine alleinige Konzentration auf den ärzt-lichen Berufsalltag würde dabei zu kurz greifen, denn schon zu Beginn des be-ruflichen Werdegangs, nämlich im Stu-dium, finden sich Treiber der Unzufrie-denheit und damit erste Anlässe für spä-tere Auswanderung oder für die Wahl ei-ner nichtärztlichen Tätigkeit nach dem Studienabschluss.
Zwar zählt die Humanmedizin mit fast fünf Bewerbern pro Studienplatz zu den beliebtesten Studienfächern [2], je-doch liegen die Studienabbrecherquo-ten bei knapp zehn Prozent [3].
Nicht selten kommt es bei Medizin-studenten im Verlauf ihres Studiums zu einem Desillusionierungsprozess [4]. Häufig müssen Vorstellungen und Ziele, mit denen das Medizinstudium begon-nen wurde, an die Anforderungen der Realität angepasst werden. Dies allein ist sicher kein auf das Medizinstudium be-grenztes Phänomen. Jedoch besteht der Verdacht, dass Studierende der Human-
medizin psychisch besonders stark be-lastet sind [5] und dass viele von ihnen am Ende ihres Studiums Resignation mit Burnout-Tendenzen oder Schonverhal-ten aufweisen [6]. Auch eine Befragung von Lübecker Studenten ist zu dem Er-gebnis gekommen, dass Medizinstuden-ten im Verlaufe ihres Studiums zuneh-mend gesundheitliche Risikomuster und eine reduzierte Studienmotivation zeigen [7].
In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie sich die Studienmotiva-tion von Studierenden der Humanmedi-zin an der Universität zu Lübeck im Lau-fe des Studiums verändert und welche Faktoren zur Motivation beziehungs-weise Demotivation im Studienverlauf beitragen. Weiterhin wurden Empfeh-lungen für eine die Studienmotivation generell fördernde Gestaltung der uni-versitären Lehre in der Humanmedizin abgeleitet.
Material und Methoden
Die Datenerhebung erfolgte durch meh-rere Gruppengespräche. Diese stellen ei-ne offene, unter Verwendung von Leit-fadenfragen teilstrukturierte Form des Interviews dar. Insgesamt wurden für die vorliegende Studie sechs Gesprächs-gruppen mit je fünf bis sieben Studieren-den der Universität zu Lübeck gebildet. In den Gruppen befanden sich jeweils sämtliche Teilnehmer im selben Studi-enjahr.
Die Teilnehmer waren nicht auf be-stimmte Aussagemöglichkeiten be-schränkt. Vielmehr war es ein Ziel der of-fenen Gesprächsführung, die Teilneh-mer zur ausführlichen Wiedergabe sub-jektiv als relevant eingeschätzter Erfah-rungen und Einschätzungen zu motivie-ren.
Die ersten beiden Leitfragen richte-ten sich an die einzelnen Teilnehmer und sollten von diesen einzeln beant-wortet werden.1. Was war Eure Motivation, das Medi-
zinstudium zu beginnen?2. Was ist Eure aktuelle Motivation, das
Medizinstudium fortzuführen? In-wieweit hat sich diese Motivation seit Studienbeginn verändert? Wie erklärt Ihr Euch ggf. diese Veränderung?
Die dritte und vierte Leitfrage richteten sich an die Gesprächsgruppe insgesamt. Ziel war ein offener Meinungs- und Er-fahrungsaustausch zwischen den Teil-nehmern.3. Was hat Euch bisher im Medizinstudi-
um demotiviert?4. Was hat Euch bisher im Medizinstudi-
um motiviert?
Die Sitzungen fanden an einem neutra-len Ort statt, der mit der Thematik der Diskussion nicht in direktem Bezug stand. Sie dauerten jeweils ca. 90 bis 140 Minuten, wurden per Audio-Aufnahme-gerät dokumentiert und transkribiert. Die Transkripte umfassten ca. 330 DIN A4-Seiten.
Anschließend wurde eine qualitati-ve Auswertung durchgeführt. Diese er-folgte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (Typ Zu-sammenfassung). In einem schrittwei-sen Prozess wurde dabei ein Kategorien-system gebildet, wobei für die Datenver-waltung die Software MAXqda einge-setzt wurde. Die in Kategorien geord-neten Aussagen der Teilnehmer wurden in der Folge zunächst beschrieben und später gewertet.
Alle Teilnehmer inklusive der Mode-ratorin haben vor den Sitzungen eine Schweigepflichtserklärung abgegeben. Des Weiteren haben die Teilnehmer im
wertige Gestaltung der universitären Lehre. Diese Emp-fehlungen geben Hinweise auf einen Benefit durch die Einführung bzw. die Ausweitung vorbestehender Block-praktika im Fach Allgemeinmedizin sowie durch die Ein-führung eines Wahltertials bzw. eines Pflichtquartals in der Allgemeinmedizin.
Schlüsselwörter: Studienmotivation; Einflussfaktoren; Medi-zinstudium; Qualitative Untersuchung
Keywords: Studies-Related Motivation; Factors of Influence; Medical Studies; Qualitative Analysis
420
Bernhardt, Träder:Eine qualitative Untersuchung zur Entwicklung der Studienmotivation angehender HumanmedizinerA Qualitative Analysis Regarding the Development of Future Physicians’ Studies-Related Motivation
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Anschluss an die Sitzung einen Kurzfra-genbogen zu personenbezogenen Anga-ben ausgefüllt. Die Untersuchung wurde von der Ethikkommission der Univer-sität zu Lübeck begutachtet und geneh-migt.
Ergebnisse
Die Tabellen 1–4 zeigen eine Übersicht des eben beschriebenen Kategoriensys-tems. Dabei sind die motivierenden Fak-
toren und die demotivierenden Fak-toren in einer Gruppe zusammenge-fasst. Ihre gemeinsame Darstellung in Tabelle 4 und in den folgenden Erläute-rungen ist darin begründet, dass viele der Gesprächsteilnehmer Aussagen zu motivierenden Faktoren eng mit Aus-sagen zu demotivierenden Faktoren ver-knüpften und umgekehrt. Eine separate Auswertung der beiden Leitfragen wür-de diese Verknüpfungen auflösen und die adäquate Auswertung der Aussagen erschweren.
Diskussion
Wie entwickelt sich die Studien-motivation angehender Human-mediziner im Laufe des Studiums?
Anhand der Gesprächstranskripte und der anschließenden Auswertung lassen sich vier Gruppen von Studierenden ausmachen, deren Studienmotivation sich im Verlauf des Studiums unter-schiedlich entwickelt. Allen vier Grup-pen ist gemeinsam, dass der vorklinische Abschnitt des Studiums und insbeson-dere das Physikum zumeist eine beson-dere Belastung der Studienmotivation darstellen. Die Teilnehmer waren sich mit wenigen Ausnahmen einig, dass die stark naturwissenschaftlich orientierte Vorklinik samt ihrer Abschlussprüfung in Form des Physikums eher negative Auswirkungen auf ihre Studienmotivati-on hatte. Zu diesem Ergebnis, dass der vorklinische Studienabschnitt wenig motivierend auf die Studierenden wirke, kamen beispielsweise auch Kohler und van den Bussche [8] bei der Befragung von Hamburger Medizinstudenten.
Im weiteren Studienverlauf lassen sich die o.g. vier Gruppen unterschei-den (Abb. 1): Bei der ersten Gruppe (A) sind die Veränderungen der Motivation im Zeitverlauf trotz des Tiefpunktes um das Physikum sehr gering. Die Studien-motivation ist somit im Verlauf etwa gleich geblieben. Die zweite Gruppe (B) verzeichnet im Gesamtverlauf eher eine steigende und die dritte Gruppe (C) eine sinkende Studienmotivation. Bei der vierten Gruppe (D) ist keine grundlegen-de Tendenz auszumachen, hier wech-seln sich motivierende und demotivie-rende Phasen im Verlauf des Studiums ab.
Als problematisch ist insbesondere die Situation in der Gruppe von Studie-renden zu sehen, die eine sinkende Stu-dienmotivation verzeichnet. Das Studi-um wird primär als belastend erlebt, und es kommt meist zu einer starken Desillusionierung. Es ist zu befürchten, dass sich dieser Verlauf im Berufsleben fortsetzt und folglich weder gesunde noch zufriedene Ärzte hervorbringt. Auch Aster-Schenck et al. [1] fanden in ihrer Studie, dass Studierende am Ende ihres Studiums nicht selten ein resig-natives Verhalten mit Burnout-Tenden-zen oder ausgeprägtem Schonverhalten zeigen.
Tabelle 1 Eingangsmotivation
Tabelle 2 Aktuelle Motivation
Tabelle 3 Entwicklung der Motivation im Studium
Langfristiger Berufswunsch ohne bewusste Ursache
Externe Einflussnahme durch Eltern, Familie, Freunde, Bekannte, Lehrer, Gesellschaft
Eigene Fähigkeiten
Eigene Interessen Interesse an Medizin/Naturwissenschaften handwerkliches Interesse Interesse an Arbeit im Ausland Interesse am Kontakt mit Menschen Interesse daran, zu helfen und „Gutes“ zu tun Interesse am Berufsbild des Arztes
Erfahrungen aus der eigenen Biografie eigene Erkrankungen oder Erkrankung im nahen Umfeld eigene medizinische Arbeit/Ausbildung/Praktika
Zufriedenheit mit dem Studium Freude am Studiumbisheriger Erfolg im StudiumKontakt zu interessanten Menschen
Verbesserung nach dem Physikum
„Durchhalten“
Studium als Voraussetzung für den ArztberufZiel, ein guter Arzt zu werdenWunsch, eigenverantwortlich zu arbeitenStudium als Vorbereitung auf die hohe Verantwortung im Beruf
Studienunabhängige Belohnung
Qualitative Veränderung qualitativ ähnliche Studienmotivation im Zeitverlaufqualitativ veränderte Studienmotivation im Zeitverlauf
Quantitative Veränderungquantitativ ähnliche Studienmotivation im ZeitverlaufAbnahme der Studienmotivation im ZeitverlaufZunahme der Studienmotivation im Zeitverlauf„Auf und Ab“ der Studienmotivation im Zeitverlauf
421
Bernhardt, Träder:Eine qualitative Untersuchung zur Entwicklung der Studienmotivation angehender HumanmedizinerA Qualitative Analysis Regarding the Development of Future Physicians’ Studies-Related Motivation
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
vation von Studierenden der Human-medizin zu unterstützen oder günstige Rahmenbedingungen zu fördern. Dabei ist zum Beispiel die Vergabe eines Lehr-preises für Dozenten aus der Sektion Me-dizin, ein Mentorenprogramm, regel-mäßige Studienevaluationen oder ein Kurs zur Anatomie am Lebenden in der Vorklinik zu nennen.
Die vorliegende Studie zeigt jedoch, dass darüber hinaus erheblicher Reform-bedarf beispielsweise in den Bereichen Kommunikationstraining, Förderung der psychophysischen Gesundheit, Er-lernen praktischer Fähigkeiten, Einbin-dung in die Klinik und qualitative Auf-wertung der Lehrtätigkeit besteht.
Ausdrücklich bemängelten die Stu-dierenden in den Gruppengesprächen den geringen Anteil praktischer Tätig-keiten im Studium und damit die unzu-reichende Vorbereitung auf ihre spätere Berufspraxis. Insbesondere der Patien-tenkontakt und die Einbindung in kli-
nische Abläufe seien während der ge-samten Studienzeit unterrepräsentiert. Etwa die verstärkte Präsentation von Fallbeispielen mithilfe von Patienten in Vorlesungen, Kurse zum Erlernen von praktischen Fähigkeiten und Unter-suchungstechniken sowie im Curricu-lum vorgesehene, regelmäßige studenti-sche Mitarbeit auf geeigneten Stationen sind denkbare Möglichkeiten der Um-setzung.
In den Jahren nach der Befragung wurden an der Universität zu Lübeck Projekte wie beispielsweise ein Kom-munikationstraining, ein „Skills-Trai-ning Innere Medizin“ oder ein Leit-symptomseminar im Rahmen des Prak-tischen Jahres realisiert. Diese Bemü-hungen zeigen, dass der große Reform-bedarf, der in der vorliegenden Studie deutlich wird, auch vonseiten der Lehr-beauftragten im Fachbereich Medizin erkannt wurde. Nun gilt es, die Über-arbeitung des Curriculums mitsamt sei-
ner Rahmenbedingungen ehrgeizig wei-terzuverfolgen.
Schlussfolgerungen
Aus den Ergebnissen dieser Studie lassen sich Empfehlungen für die universitäre Ausbildung ableiten. Diese liegen ins-besondere in einem stärkeren Praxisbezug, in der Vermittlung kommunikativer Fä-higkeiten, in der Förderung der psycho-physischen Gesundheit der Studierenden sowie in einer didaktisch höherwertigen Gestaltung der universitären Lehre.
Diese Empfehlungen geben Hinwei-se auf einen Benefit durch die Einfüh-rung bzw. die Ausweitung vorbestehen-der Blockpraktika im Fach Allgemein-medizin sowie durch die Einführung ei-nes Wahltertials bzw. eines Pflichtquar-tals in der Allgemeinmedizin.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Prof. Dr. Jens-Martin Träder
Institut für Allgemeinmedizin
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck, Tel.: 0451 501816
Korrespondenzadresse
1. Bundesärztekammer (2012). Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31. Dezember 2012. Kein Widerspruch – Ärztemangel trotz moderat steigender Arztzahlen. http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.3.11372 (letzter Zugriff am 28.01.2014)
2. Stiftung für Hochschulzulassung (2013). Wintersemester 2013/14, Da-ten der bundesweit zulassungs-beschränkten Studiengänge an Univer-sitäten. http://www.hochschulstart.de/fileadmin/downloads/NC/Wi-Se2013_14/bew_medizin_ws13.pdf (letzter Zugriff am 28.01.2014)
3. Heublein U, Richter J, Schmelzer R, Sommer D. Die Entwicklung der Schwund- und Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. Statis-
tische Berechnungen auf der Basis des Absolventenjahrgangs 2010. Hanno-ver, 2012
4. Dettmer S, Kuhlmey A. Studienzufrie-denheit und berufliche Zukunftspla-nung von Medizinstudierenden – ein Vergleich zweier Ausbildungskonzepte. In: Schwartz FW, Angerer P (Hrsg.) Ar-beitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten. Befunde und In-terventionen (= Band 2 der Reihe Re-port Versorgungsforschung). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2010: 103–115
5. Raj SR, Simpson CS, Hopman WM, Sin-ger MA. Health-related quality of life among final-year medical students. CMAJ 2000; 162: 509–510
6. Aster-Schenck I-U, Schuler M, Fischer MR, Neuderth S. Psychosoziale Res-
sourcen und Risikomuster für Burnout bei Medizinstudenten: Querschnittstu-die und Bedürfnisanalyse Präventiver Curricularer Angebote. GMS Z Med Ausbild 2010; 27: 15
7. Voltmer E, Kötter T, Spahn C. Perceived medical school stress and the develop-ment of behavior and experience pat-terns in German medical students.“ Med Teacher 2012; 34: 840–847
8. Kohler N, van den Bussche H. Je schwieriger, desto beliebter. Nutzen, di-daktische Qualitfit und Schwierigkeits-grad des vorklinischen Lehrangebots aus der Sicht von Hamburger Medizin-studenten. Ann Anat 2004; 186: 283–288
Literatur
… Assistenzärztin in Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin.
Studium der Humanmedizin von 2004–2011 an der Universität
zu Lübeck. Berufsziel: Fachärztin für Allgemeinmedizin; Nieder-
lassung in einer Hausarztpraxis im ländlichen Raum
Ann Margareta Bernhardt …
423
Bernhardt, Träder:Eine qualitative Untersuchung zur Entwicklung der Studienmotivation angehender HumanmedizinerA Qualitative Analysis Regarding the Development of Future Physicians’ Studies-Related Motivation
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
424 ÜBERSICHT / REVIEW
Beratungsanlass „Fragen zum Stillen“ – was jeder Hausarzt wissen sollteQuestions Related to Breastfeeding – What Every Family Physician Should KnowChristine Bruni1, Jost Steinhäuser2
Einleitung
Familienmedizin, die generationsüber-greifende Betreuung und Gesundheits-fürsorge von Familien, ist eine „besonde-re Chance und Verantwortung“ der All-gemeinmedizin [1]. Als Allgemeinarzt ist man „spezialisiert auf den ganzen Men-schen“ und ist erster ärztlicher Ansprech-partner für Patienten aller Altersgruppen [1]. Die International Classification of Pri-mary Care (ICPC) listet von der dadurch entstehenden Vielfalt an Beratungsanläs-sen solche auf, die eine Prävalenz von mindestens 1 % aufweisen. Unter „W19“ werden solche zu Brust-/Stillsymptom-beschwerden subsumiert [2]. Da mit künstlicher Säuglingsnahrung ernährte Kinder häufiger Infektionserkrankungen haben als gestillte Kinder, sollte Stillen als
Präventionsmaßnahme eine bedeutende Rolle in der Hausarztpraxis einnehmen [3, 4]. Die WHO-Richtlinie „International Code of Marketing of Breast-milk Substi-tutes“ hat die Förderung des Stillens als Ziel und empfiehlt die Beschränkung der direkten Werbung über künstliche Säug-lingsnahrung, Flaschen und Sauger an werdende Eltern [5].
Frauen in Deutschland interessieren sich in den letzten Jahren zunehmend für das Stillen. Die Tendenz geht zudem in Richtung einer längeren Stillzeit [6]. Kompetente Stillberatung durch Ärzte er-höht die Stillrate und Stilldauer [7]. Daher gehört das Thema Stillen mit zu dem Kompetenzfeld eines Allgemeinarztes.
Ziel dieses Beitrages ist es, das grund-legende Wissen über die Physiologie des Stillens zu vermitteln und zu ausgewähl-
ten Beratungsanlässen des Themas Stillen praxisnahe Informationen zu geben (s. Textkasten 1).
Gesundheit und Stillen
Muttermilch ist genau an die Bedürfnisse des neuen menschlichen Lebewesens an-gepasst und unterstützt Infektionsschutz und Gedeihen [8: 117–161]. Gegenüber künstlicher Säuglingsnahrung gibt es fol-gende Unterschiede:• Muttermilch enthält lebende Immun-
zellen z.B. Makrophagen und Lympho-zyten [8: 117–161]. Sie enthält mehr als 200 Bestandteile, einschließlich Wachstumshormone, Enzyme und entzündungshemmender Komponen-ten [9: 91].
1 Angestellte Ärztin in einer allgemeinmedizinischen Praxis in Mannheim2 Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum HeidelbergPeer reviewed article eingereicht: 23.05.2014, akzeptiert: 09.07.2014DOI 10.3238/zfa.2014.0424–0427
Zusammenfassung: Beratungsanlässe rund um das Thema Stillen gehören in den Kompetenzbereich der All-gemeinmedizin. Das Stillen, ein natürliches Gesundheits-verhalten, fördert Infektionsschutz und Gedeihen des Säuglings. Kompetente Stillberatung durch Ärzte fördert die Stillrate und Stilldauer. Zur Beratung gehört ein grundlegendes Wissen über die Physiologie des Stillens sowie praxisrelevante Handlungskompetenz bezüglich der Kontraindikationen, Medikamentenverordnung, Milch-menge und Behandlung häufiger Brustsymptome. Ein Hausarzt kann sich bei seiner Laktationsberatung verschie-dener Informationsquellen bedienen. Da positive Gesund-heitswirkungen während der ganzen Stillperiode zu er-warten sind, sollte unnötiges Abstillen vermieden werden.
Schlüsselwörter: Stillen; Allgemeinmedizin; Laktationsberatung
Summary: Questions related to breastfeeding may be a reason for consulting a family doctor and belong in family medicine’s spectrum of competence. Breastfeeding, a natural health behavior, protects the infant from infection and promotes development. Competent advice on lac-tation given by physicians promotes breastfeeding rates and duration. Lactation counselling includes a basic understanding of the physiology of lactation, as well as practice related skills pertaining to contraindications, pre-scription of medications, milk supply and treatment of common breast symptoms. A family doctor can resort to many sources of information for support. Since positive health effects continue throughout the breastfeeding period, unnecessary weaning should be avoided.
Keywords: Breastfeeding; Family Medicine, Lactation Counselling
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
• Künstliche Säuglingsnahrung enthält speziesfremde Eiweiße, die Allergien auslösen können, wenn sie die unreife Magen-Darm-Wand passieren [9: 175–176].
• Flaschennahrung wird oft ohne den entwicklungsfördernden Haut-zu-Hautkontakt gegeben [8: 222].
• Künstliche Nahrung über die Flasche erschwert selbstbestimmtes Essen und birgt die Gefahr der Überfütterung [10].
Evidenzberichte der „American Academy of Pediatrics“ und der „US Agency for He-althcare Research and Quality“ zeigen, dass Säuglinge, die künstlich ernährt wer-den, ein höheres Krankheitsrisiko haben (s. Textkasten 2) [3, 4].
Bekannt ist zudem, dass eine längere Stilldauer länger schützt. Das Risiko an ei-ner Pneumonie zu erkranken erhöht sich um das Vierfache, wenn ein Kind vier Mo-nate statt sechs Monate ausschließlich ge-stillt wird [3]. Der zusätzliche Schutz des Stillens bei gastrointestinalen Infekten wirkt zwei Monate über den Abstillzeit-punkt hinaus [3].
Auch Frauen gehen ein höheres Ge-sundheitsrisiko ein, wenn sie nicht stillen [3]:• Sie haben einen höheren Blutverlust
durch die langsamere Rückbildung der Gebärmutter nach der Geburt.
• Sie entwickeln häufiger einen Diabetes mellitus Typ II.
• Sie erleben eine höhere Inzidenz an postpartaler Depression.
• Sie haben ein höheres Risiko, an Brust-krebs oder einem Ovarialkarzinom zu erkranken [3].
Neben den dargestellten positiven kör-perlichen Gesundheitswirkungen entste-hen durch das Stillen auch bindungsför-dernde Interaktionen zwischen Mutter und Kind. Diese werden durch die regel-mäßige Ausschüttung des „bindungsför-derlichen“ Hormons Oxytozin und die entspannende Wirkung von Prolaktin unterstützt [11].
Stilldauer und Beikost
Es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem abge-stillt werden muss. Die Nationale Still-kommission in Deutschland vertritt fol-genden Standpunkt: „Der endgültige Zeit-
punkt des Abstillens ist eine individuelle Ent-
scheidung, die gemeinsam von Mutter und
Kind getroffen wird“ [12]. Diese Sicht wird
auch von der „American Academy of Fa-mily Physicians” geteilt: „Breastfeeding
beyond the first year offers considerable bene-
fits for both mother and child and should
continue as long as mutually desired. […] If
the child is younger than two years of age, the
child is at increased risk of illness if weaned” [13].
Das heißt nicht, dass Kleinkinder ge-nauso oft gestillt werden wie Neugebore-ne. Mit der Einführung der Beikost in der Mitte des ersten Lebensjahres und der Entwicklung der Mobilität verringern sich die Mahlzeiten mit der Zeit ganz von alleine. Wie sollten Ärzte Beikost empfeh-len? Die WHO/UNICEF-Initiative „Baby-freundliches Krankenhaus“ hat hierzu ei-ne Empfehlung veröffentlicht [14]. Bei-kosteinführung erfolgt parallel zum Stil-len ohne die Mahlzeiten zu ersetzen und bedeutet nicht das Ende der Stillzeit. Mut-termilch ist die Hauptkalorienquelle im ersten Lebensjahr. So wird die Beikost oh-ne Druck oder Zwang und entwicklungs-gerecht dem Kind vorgestellt.
Häufige Beratungsanlässe
Wann ist das Stillen kontraindiziert?
Es gibt nur wenige Situationen, bei denen nicht gestillt werden sollte. Die „Ame-rican Academy of Pediatrics“ hat eine Lis-te der Kontraindikationen veröffentlicht [3]. Vor allem wenn die Mutter eine Che-motherapie erhalten muss, bei mütterli-cher Drogenabhängigkeit von Kokain oder Heroin, bei der seltenen Galaktosä-mie des Neugeborenen und, in Industrie-ländern, bei HIV-Infektion der Mutter ist Stillen kontraindiziert.
Infektiöse Herpesläsionen an der Brust sowie eine Varizellenerkrankung der Mutter perinatal sind ebenfalls ein Grund, um den direkten Kontakt (mit
den Viren der Haut) zu vermeiden. Auch eine aktive Tuberkulose bedarf einer vorü-bergehenden Trennung von Mutter und Kind wegen des Risikos einer respiratori-schen Übertragung. Die Muttermilch kann dennoch gegeben werden, da sie nicht infektiös ist. Bei radioaktiven Diag-nostika kann, je nach Halbwertzeit des Mittels, eine Unterbrechung des Stillens notwendig werden. Die Mutter kann vo-rübergehend ihre Muttermilch abpum-pen und verwerfen, um die Milchbildung in Gang zu halten und kann später wieder weiterstillen. Es gibt nur wenige Medika-mentengruppen, die beim Stillen kontra-indiziert sind (z.B. Amphetamine, Ergota-mine und Statine).
Sofern eine Kontraindikation bereits während der Schwangerschaft bekannt ist, wird initial vom Stillen abgeraten. Ein medikamentöses Abstillen wird wegen schwerwiegender Nebenwirkungen nicht mehr empfohlen. Abstillen, wenn medi-zinisch notwendig, erfolgt ansonsten durch eine Reduktion der Stillhäufigkeit und Einführung von künstlicher Säug-lingsnahrung.
Bei welchen Medikamenten kann weiter gestillt werden?
Für die meisten häufig in der Allgemein-arztpraxis verordneten Medikamenten-gruppen können Therapeutika gefunden werden, die mit dem Stillen vereinbar sind. Um konkrete Fragestellungen zu klären, bieten sich Nachschlagwerke für die tägliche Arbeit in der Praxis an, bei-spielsweise „Arzneiverordnung in der Schwangerschaft und Stillzeit“ von Schaefer et al. [15]. Im Kapitel „Spezielle Arzneimitteltherapie in der Stillzeit“ fin-det der Arzt für jede Medikamentengrup-pe in kurzen Zusammenfassungen eine Empfehlung für die Praxis. Unter Anti-infektiva z.B. steht: „Penicillinderivate und
Cephalosporine gehören zu den Antibiotika
Textkasten 1 Seminar „Beratungsanlass Stillen“
425
Bruni, Steinhäuser:Beratungsanlass „Fragen zum Stillen“ – was jeder Hausarzt wissen sollteQuestions Related to Breastfeeding – What Every Family Physician Should Know
Im Rahmen der Verbundweiterbildungplus werden für die teilnehmenden Ärzte in Weiterbildung begleitend über die gesamte Zeit der Weiterbildung pro Jahr sechs Schulungstage zu hausarztrelevanten Themen angeboten. An einem Schulungstag können aus 9–12 Seminaren drei ausgewählt werden. Hierbei gehört zum Konzept, dass auch Teilnehmer für andere Teilnehmer Seminare erarbeiten und durchfüh-ren. Eines dieser Seminare im Jahr 2013 behandelte den „Beratungsanlass Stillen“ und stellt die Grundlage dieses Beitrages dar.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
der Wahl in der Stillzeit“ [15: 612]. Auch Analgetika können während des Stillens verordnet werden: „Paracetamol gehört mit
Ibuprofen zu den Analgetika der Wahl in der
Stillzeit“ [15: 579]. Unter www.embryotox.de (Tel.: 030 30308–111) können sich Ärzte zudem direkt informieren. Eine wei-tere Informationsquelle ist die „National Library of Medicine/National Institutes of Health bei LactMed” (http://tox-net.nlm.nih.gov). Diese Datenbank ist besonders aktuell und umfassend [3]. Stil-len verzögert den Eisprung und das Ein-setzen der Monatsblutungen, verhütet aber nicht hundertprozentig, daher gibt es in der „International Lactation Consul-tant Association (ILCA)-Leitlinie“ Emp-fehlungen zu wirksamen Verhütungsmit-teln, die während der Stillzeit eingesetzt werden können [18].
Nicht genug Milch?
Die meisten Frauen können genug Milch bilden. Auch Zwillinge können aus-schließlich gestillt werden [8: 276]. Zu den Differenzialdiagnosen der seltenen Ursachen einer unzureichenden Milch-menge gehören eine nicht behandelte Unterfunktion der Schilddrüse, Plazenta-reste, polyzystische Ovarien oder eine vo-rangegangene milchgangverletzende Brustoperation [8: 339]. Die Milchmenge wird durch die Trinkmenge der Mutter nicht beeinflusst, daher wird allgemein empfohlen, nach eigenem Wunsch zu trinken. Die normale Milchbildung kommt durch eine bindungsfördernde
Stillkultur in Gang: frühes Anlegen nach der Geburt, häufiges Stillen ohne Ein-schränkung, nach Bedarf und nicht nach Zeitplan („Watch the baby, not the clock“ [8: 221]) und Vermeidung von künstlichen Saugern in den ersten 5 Wochen. Da die Physiologie der Brust so ausgelegt ist, dass sich die Milchmenge auf Nachfrage des Säuglings steigert, führt das Zufüttern zum Milchrückgang in der Brust [8: 265–267]. Daher wird in der ILCA-Leit-linie empfohlen, „den Gebrauch von Beru-
higungssaugern, Flaschensaugern und Zufüt-
tern [zu] vermeiden, es sei denn, er ist medizi-
nisch indiziert“ [18]. „Frühes Zufüttern so-
wie der frühzeitige Einsatz von Beruhigungs-
saugern stehen in Zusammenhang mit einem
erhöhten Risiko des vorzeitigen Abstillens“ [18]. Bei den vorhersagbaren Wachstums-schüben des Säuglings (meist 2.–3. Le-benswoche, 6. Lebenswoche, 3. Monat und 6. Monat) ist eine Häufung des Stil-lens zu erwarten [16]. Dies bedeutet nicht, dass die Milchmenge nicht reicht. Im Ge-genteil, die Wachstumsschübe führen zu einer Milchsteigerung. Bis zur 5. Lebens-woche sind mindestens 3 Stuhlgänge und 5–6 nasse Windeln in 24 Std. ein Indiz, dass das Neugeborene genug Milch be-kommt. Die Gewichtszunahme sollte vom niedrigsten Gewicht nach der Ge-burt berechnet werden. Ein Säugling nimmt bei den Stillmahlzeiten unter-schiedliche Mengen an Milch zu sich, so-dass ein Wiegen vor und nach dem Stillen nicht empfohlen wird. Damit nicht un-nötig Druck auf die Mutter ausgeübt wird, sollte das Wiegen auf das Notwendigste
beschränkt werden, um die Gewichtsent-wicklung zu dokumentieren. Bei der Ge-wichtsentwicklung sollten die WHO-Wachstumskurven für Stillkinder heran-gezogen werden [17, 18, 19].
Wunde Brustwarzen
Durch schmerzfreies Anlegen können wunde Brustwarzen vorgebeugt werden. Übliche Empfehlungen gehen dahin, dass dafür der Säugling seine Zunge unter die Brustwarze legen und mit weit geöff-netem Mund (ca. 120° am Mundwinkel) den ganzen Warzenhof umschließen soll. Die Lippen sollten dabei nach außen ge-richtet und nicht eingerollt sein. Grund-voraussetzung ist eine frei bewegliche Zunge. Allerdings ist nur selten ein zu kur-zes Zungenbändchen für wunde Brust-warzen verantwortlich. Dieses muss dann gegebenenfalls durchtrennt werden [8: 259–261, 100].
Manchmal können der kindliche Mund und die Brust von Soor befallen sein. Soortypische Symptome bei der Mutter sind rote, schuppige, juckende oder brennende Brustwarzen. Die Ursa-che, Candida albicans, kann durch eine lokale, antimykotische Therapie (z.B. Clotrimazol zweimal täglich) behandelt werden. Zeitgleich wird der Säugling mit antimykotischem Mundgel behandelt. Die Behandlung sollte noch einige Tage nach Abklingen der Symptome erfolgen, um einen Rückfall zu verhindern. Wenn keine Besserung bei der Mutter erfolgt, wird Fluconazol eingesetzt (400 mg an Tag 1, dann 100 mg zweimal täglich, bis mindestens 1 Woche nach Abklingen der Symptome) [20; 8: 300–305].
Milchstau und Mastitis
Eine unzureichende Entleerung der Brust durch zu lange Stillpausen oder Stillen nach Zeitplan kann zu einem Milchstau oder Mastitis führen. Rötung, Überwär-mung und Schmerzen an einer Stelle der Brust, bei Mastitis zusätzlich einher-gehend mit Fieber, können die Folge sein. Die Mutter sollte ermutigt werden, häufig an der betroffenen Brust zu stillen, denn eine effektive Milchentleerung ist wich-tig. Ruhe und Schonung der Mutter soll-ten empfohlen werden. Ein Kühlen des Brustgewebes zwischen dem Stillen hilft gegen die Entzündung. Falls sich das Fie-ber durch diese Maßnahmen nicht bes-sert, wird mit Flucloxacillin 500 mg vier-
Textkasten 2 Vergleich künstlich ernährte Kinder vs. gestillte Kinder
426
Bruni, Steinhäuser:Beratungsanlass „Fragen zum Stillen“ – was jeder Hausarzt wissen sollteQuestions Related to Breastfeeding – What Every Family Physician Should Know
Die „US Agency for Healthcare Research and Quality“ und die „American Academy of Pediatrics“ haben Evidenzberichte veröffentlicht, die zeigen, dass nicht nur in sogenannten Entwicklungsländern, sondern auch in den USA und Europa mit künstlicher Säuglingsnahrung ernährte Kinder häufiger erkranken [3, 4]. Im Ver-gleich zu gestillten Kindern, haben sie z.B. häufiger: • Bronchitis/Pneumonie (72 %)• Respiratory-Syncitial-Virus Bronchiolitis (74 %)• Gastrointestinale Infekte (64 %)• Nekrotisierende Enterokolitis bei Frühchen (58 %)• Gluteninduzierte Enteropathien bei Säuglingen die bei Gluteneinführung
nicht gestillt wurden (52 %)• Otitis media (50 %)• Plötzlicher Kindstod (36 %)• Diabetes mellitus Typ I (30 %) und Diabetes mellitus Typ II (40 %)• Entzündliche Darmerkrankungen in der Kindheit (31 %)• Leukämie (15–20 %)
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
mal tägl. begonnen. Ibuprofen kann ge-gen Schmerzen gegeben werden [8: 293–299].
Weitere Informationsquellen für den Hausarzt
Hebammen sind oft eine niedrigschwelli-ge Informationsquelle, wenn sie eine for-melle Ausbildung in der Stillberatung ha-ben. In Deutschland gibt es ausgebildete Stillberaterinnen (International Board Certified Lactation Consultant = IBCLC), an die Allgemeinärzte ihre stillenden Pa-tientinnen verweisen können. Diese Still-beraterinnen durchlaufen eine anerkann-te Ausbildung und Zertifizierung. Auch Stillgruppen, z.B. von der La Leche Liga, die sich regelmäßig treffen, können Müt-tern wertvolle Informationen geben. Die „Academy of Breastfeeding Medicine“ (www.bfmed.org), eine internationale fachübergreifende Organisation von Ärz-ten der Laktationsmedizin, veröffentlicht Protokolle im Internet für spezielle Fra-gestellungen und Stillsituationen. Juristi-sche Informationen können im Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter
(Mutterschutzgesetz – MuSchG), im spe-ziellen unter § 7 „Stillzeit“ eingesehen werden.
Schlussfolgerung
Ziel einer einfühlsamen Stillberatung ist gemeinsam mit der Mutter den besten Weg für das jeweilige Mutter-Kind-Paar zu finden. Wie in der Allgemeinmedizin üb-lich, sollte jede Beratung eine gemein-same Entscheidungsfindung beinhalten und die Selbstwirksamkeit der Mutter wahren.
Stillen hat einen großen Stellenwert in der Gesundheitsförderung des Säug-lings. Frauen brauchen hier evidenzba-sierten Rat und emotionale Unterstüt-
zung. Unnötiges Abstillen birgt medizini-sche Risiken und sollte vermieden wer-den, denn ein erhöhtes Risiko für Infek-tionen und der Verlust der bindungsför-dernden Stillhormone ist die Folge. Stil-len ist ein natürliches Gesundheitsverhal-ten, dessen Auswirkungen für Mutter und Kind weit in die Zukunft hineinreichen.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Christine Bruni, MD MPH IBCLC
Traubenweg 8
69493 Hirschberg
Tel.: 06201 959176
Korrespondenzadresse
1. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinme-dizin und Familienmedizin. DEGAM-Zukunftspositionen 2012: 13. http://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Ueber_uns/Positionspapie-re/DEGAM_Zukunftspositionen.pdf (letzter Zugriff am 20.05.14)
2. WONCA. International classification of primary care, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998
3. American Academy of Pediatrics. Breast-feeding and the use of human milk. Pe-diatrics 2012; 115: 496. http://pedia-trics.aappublications.org/content/ear-ly/2012/02/22/peds.2011–3552 (letzter Zugriff am 24.02.14)
4. Ip S, Chung M, Raman G, et al. Breastfee-ding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Rock-ville(MD): Agency for Healthcare Re-search and Quality (US), 2007
5. World Health Organization. Internatio-nal code of marketing of breast-milk sub-stitutes. Geneva: WHO, 1981
6. Lange C, Schenk L, Bergmann R. Verbrei-tung, Dauer und zeitlicher Trend des Stil-lens in Deutschland. Bundesgesundhbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 2007; 50: 624–33
7. Feldman-Winter L, Barone L, Milcarek B, et al. Residency curriculum improves
breastfeeding care. Pediatrics 2010; 126: 298–297
8. Riordan J, Wambach K (Hrsg.). Breastfee-ding and human lactation, 4th ed. Bos-ton: Jones and Bartlett, 2005
9. Lawrence RA. Breastfeeding: A guide for the medical profession, 4th ed. New York: Mosby, 1994
10. Fisher JO, Birch LL, Smiciklas-Wright H, Picciano MF. Breast-feeding through the first year predicts maternal control in feeding and subsequent toddler energy intakes. J Am Diet Assoc 2000; 100: 641–646
11. Uvnas-Moberg K. Neuroendocrinology of the mother-child interaction. Trends Endocrinol Metab 1996; 7: 126–31
12. Empfehlung der Nationalen Stillkom-mission am Bundesinstitut für Risiko-bewertung vom 1. März 2004. http://www.bfr.bund.de/cm/343/stilldauer.pdf (letzter Zugriff am 24.02.14)
13. American Academy of Family Practice. Breastfeeding, family physicians suppor-ting (position paper). http://www.aafp.org/about/policies/all/breastfeeding-support.html (letzter Zugriff am 24.02.14)
14. WHO/UNICEF-Initiative „Babyfreundli-ches Krankenhaus“. Beikostempfeh-lung. 2013. http://www.babyfreundlich.
org/fileadmin/user_upload/download/info_material/Empfehlungen/Empfeh-lung_Beikost_Eltern.pdf (letzter Zugriff am 20.05.14)
15. Schaefer C, Spielmann H, Vetter K. Arz-neiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit. München: Urban & Fischer, 2011
16. La Leche League International. The wo-manly art of breastfeeding, 8th ed. New York: Ballantine Books; 2010: 139
17. Guoth-Gumberger M, Hemmelmayr A. Das gestillte Kind auf der Waage – Teil 1. 2010. http://www.springermedizin.at/artikel/16773-das-gestillte-Kind-auf-der-waage-teil-1 (letzter Zugriff am 24.02.14)
18. International Lactation Consultant As-sociation ILCA, Verband Europäischer Laktationsberaterinnen VELB (Hrsg.): Klinische Leitlinie zur Etablierung des ausschließlichen Stillens. 2005. http://www.stillen-institut.com/de/leitlinien.html (letzter Zugriff am 24.02.14)
19. DeOnis M, Garza C, Onyango AW, Rol-land-Cachera MF. WHO growth stan-dards for infants and young children. Arch Pediatr 2009; 16: 47–53
20. Abou-Dakn M. Stillen. In: Kainer F (Hrsg.). Facharzt Geburtsmedizin. Mün-chen: Urban & Fischer, 2006: 1091–111
Literatur
… ist seit 2014 Fachärztin für Allgemeinmedizin; seit 2008 Acade-
my of Breastfeeding Medicine Ethics Committee; Zertifizierung
als International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC);
ehrenamtliche Stillberatung und Leitung einer Stillgruppe; Mas-
ter of Public Health, University of Illinois at Chicago.
Christine Bruni, MD MPH IBCLC …
427
Bruni, Steinhäuser:Beratungsanlass „Fragen zum Stillen“ – was jeder Hausarzt wissen sollteQuestions Related to Breastfeeding – What Every Family Physician Should Know
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
428 DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS
DEGAM-Kongress in Hamburg: Interesse an wissenschaftlicher Allgemeinmedizin steigt kontinuierlich
Wenn man denkt, dass es nicht mehr besser geht, überrascht die DEGAM im-mer wieder. Denn war schon der Jahres-kongress in München mit 670 Teilneh-mern ein voller Erfolg, so stellt der 48. Kongress für Allgemeinmedizin und Fa-milienmedizin nun einen neuen Rekord auf: Insgesamt 720 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden vom 18. bis 20. September 2014 den Weg ans Univer-sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Be-sonders erfreulich ist zudem, dass mit 112 Studierenden (also gut 15 Prozent) eine ganz wichtige Zielgruppe vor Ort war: der medizinische und im besten Fall hausärztliche Nachwuchs.
„Allgemeinmedizin: Spezialisiert auf den ganzen Menschen“ lautete das Kon-gressmotto, das mit dem Generalismus einen wesentlichen Kern des Fachs adressiere, wie DEGAM-Präsident Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach in der Eröff-nungsveranstaltung betonte. Denn bei diesem Konzept wird nicht von einzel-nen Methoden oder Organen ausgegan-gen, sondern vom konkreten Menschen und seiner Erkrankung. Hausärztinnen
und Hausärzten als Spezialisten für den ganzen Menschen, die den Überblick be-halten, würden angesichts vieler Patien-ten mit Mehrfacherkrankungen sogar mehr denn je gebraucht. Im Programm spiegelte sich die ganze Bandbreite wi-der: Einige Vorträge und Workshops be-schäftigten sich mit Konzepten zur Nachwuchsgewinnung sowie der Si-cherstellung der Versorgung im ländli-chen Raum. Große Bedeutung galt darü-ber hinaus den klinischen Kompetenzen des Fachs, beispielsweise epidemiologi-schen Aspekten sowie der Versorgungs-forschung.
Im Rahmen des Gesellschaftsabends im Historischen Speicherboden begrüß-te Prof. Stefan Wilm, Direktor des Insti-tuts für Allgemeinmedizin in Düssel-dorf, die insgesamt 20 neuen Mitglieder des achten Professionalisierungskurses, der zur Förderung des allgemeinmedizi-nischen akademischen Nachwuchses gegründet wurde. Die Gruppe über-nahm den Staffelstab vom siebten Kurs, der in diesem Rahmen offiziell ver-abschiedet wurde.
Kongresspräsident Prof. Martin Scherer zeigte sich bei der Abschluss-veranstaltung sehr zufrieden mit dem Kongressverlauf, lobte die positive Stimmung und das hohe wissenschaft-liche Niveau. Ein musikalischer Aus-klang am Klavier durfte, wie bei der Er-öffnungsveranstaltung, natürlich nicht fehlen. Für die Organisatoren wie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt aber auch diesmal: Nach dem Kon-gress ist vor dem Kongress. Mit viel Rü-ckenwind aus Hamburg freuen wir uns auf den 49. Kongress für Allgemeinme-dizin und Familienmedizin, der als „Drei-Länder-Kongress“ (Deutschland, Österreich, Südtirol) in Bozen stattfin-det.
Quelle: Verkehrsamt der Stadt Bozen Quelle:Verkehrsamt der Stadt Bozen Quelle: Süd rol Marke ng/Valen n Pardeller
49. Kongress für Allgemeinmedizin und FamilienmedizinBedeutung der Allgemeinmedizin: für Pa ent, Familie und Gesellscha
vom 17. – 19. September 2015 in Bozen – Süd rol DEGA
M
Deutsche Gesellschaft fürAllgemeinmedizin und Familienmedizin
Süd roler Gesellscha für Allgemeinmedizin
Società Altoatesina di Medicina Generale
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
49. Kongress für Allgemeinmedizin und FamilienmedizinBedeutung der Allgemeinmedizin: für Pa ent, Familie und Gesellscha
Gefördert von: Verkehrsamt der Stadt Bozen und der Sparkasse Bozen
Programm, Informa on und Anmeldung unter www.degam2015.de - geschae [email protected] Güns ger Bustransfer vom Flughafen München nach Bozen kann organisiert werden.HOTEL INFO: Verkehrsamt der Stadt Bozen - [email protected]
• Erlebte Anamnese• Ressourcenak vierung• Pa ent Empowerment• Bio-psycho-soziales Modell• Familienmedizin• Ökologie der Allgemeinmedizin
429DEGAM-NACHRICHTEN / DEGAM NEWS
DEGAM-Nachwuchsakademie: Neuer Jahrgang ausgeschrieben, erster Jahrgang verabschiedet
Medizinstudierende zwischen dem vier-ten und achten Semester können sich ab sofort für den neuen, mittlerweile vierten Jahrgang der Nachwuchsakademie be-werben. Die wissenschaftliche Fachge-sellschaft hofft, die Studierenden durch den intensiven Kontakt frühzeitig für die Hausarztmedizin begeistern zu können und möchte sie darüber hinaus konstruk-tiv auf ihrem Ausbildungsweg begleiten.
Zur Förderung durch die DEGAM ge-hören exklusive Klausurwochenenden, die kostenlose Teilnahme an den DE-GAM-Jahreskongressen und an einer Summerschool für Allgemeinmedizin. Auf Wunsch erhalten die Studierenden zudem ein individuelles Mentoring
durch erfahrene Allgemeinmediziner so-wie Hilfe bei Studium, Promotion und Berufsplanung. Eine kostenlose DEGAM-Mitgliedschaft, die auch allen anderen interessierten Medizinstudierenden mög-lich ist, versteht sich von selbst. Das Kon-zept der DEGAM-Nachwuchsakademie sieht eine Förderdauer von drei Jahren vor. 15 Bewerber werden für den kom-menden Jahrgang ausgewählt. Der offi-zielle Startschuss fällt im Rahmen eines Klausurwochenendes im Frühjahr 2015. Die Nachwuchsakademie wird vom Deutschen Hausärzteverband, der Gesell-schaft der Hochschullehrer für All-gemeinmedizin (GHA) sowie der Techni-ker Krankenkasse unterstützt.
Informationen sowie die Bewer-bungsunterlagen sind unter www.degam.de/allgemeine-infos.html verfüg-bar. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2015.
Während der nächste Jahrgang der-zeit gesucht wird, wurde während des DEGAM-Kongresses in Hamburg der ers-te Jahrgang, der die Nachwuchsakademie von 2012 bis 2014 besuchte, verabschie-det. Zum Abschluss erhielten alle Teil-nehmerinnen und Teilnehmer als kleine Erinnerung ein Jahrgangsbuch. Die DE-GAM wünscht „ihrem“ allgemeinmedi-zinischen Nachwuchs alles Gute auf ih-rem zukünftigen Weg.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Professor Gerlach und die ewige Kontroverse
Der Vorsitzende des Sachverständigen-rates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein-medizin und Familienmedizin (DE-GAM), Professor Dr. Ferdinand Gerlach, hat auf der Grundlage der Arbeit des Sachverständigenrates in der Sommer-pause in Vorträgen vor Gesundheits-politikern und Interviews mit Journalis-ten Missstände und Verbesserungsmög-lichkeiten im deutschen Gesundheits-wesen angesprochen.
Die Situation erinnert an Diskussio-nen, die bereits in den achtziger Jahren geführt wurden: Es ging und geht immer noch um die Sicherstellung der hausärzt-lichen Versorgung in Quantität und Qua-lität, vor allem auf dem Land. Das über-proportionale Wachstum der Facharzt-zahlen im Vergleich zu denen der Haus-ärzte und die unterschiedliche Versor-gungsdichte in Stadt und Land waren auch damals bereits aufregende Themen.
Allerdings hat sich eines geändert: In der vorigen Generation waren diese Probleme mit einer massiven Zunahme der Arztzahlen verbunden, von der man befürchtete, sie werde den ambulanten Sektor überschwemmen. Dies hat die Bedarfsplanung mittlerweile verhin-dert. Die sogenannte Ärzteschwemme ist im Krankenhaus „gelandet“ bezie-hungsweise „gestrandet“ und dort durch die tarifpolitischen Erfolge des Marburger Bundes auch finanziert wor-den.
Geblieben ist hingegen das Problem der ungleichen Verteilung der Ärzte zwi-schen Stadt und Land und der Arztzah-len bei Hausärzten und Fachärzten. Ge-
blieben ist auch die robuste Ignoranz und „organisierte Verantwortungslosig-keit“, so Gerlach, mit der viele Funktio-näre aus den Körperschaften und dem Facharztlager den gut dokumentierten Problemen begegnen. Sicher kann und muss man über einige seiner Thesen dis-kutieren. Aber in der Tendenz hat er vollkommen recht.
Seit vielen Jahren steigt die Lebens-erwartung der Bevölkerung in Deutsch-land bei zunehmender Zahl chronischer Erkrankungen und wachsender Multi-morbidität. Ebenso lange wissen wir, dass das Koordinationsproblem im deutschen Gesundheitswesen ungelöst ist. Über-, Unter- und Fehlversorgung sind trotz steigender Facharztzahlen nicht beseitigt. Die Beliebigkeit der soge-nannten freien Arztwahl durch Patien-tinnen und Patienten führt dazu, dass ungeeignete Versorgungsorte und -ebe-nen in Anspruch genommen werden, weil das Gesundheitswesen in Deutsch-land nicht durch fachkundige Entschei-dungen von Hausärzten, sondern durch subjektive Wünsche und Wertungen von Laien gesteuert wird.
Retrospektiv betrachtet fehlt uns in Deutschland seit mindestens 50 Jahren ein Primärarztsystem, das der vielfälti-gen und teuren Fachversorgung so vor-geschaltet werden müsste, dass dieses tä-tig wird – wann und wo es notwendig und zweckmäßig ist. Stattdessen ver-stopft die Versorgungsroutine bei Baga-tellfällen die Facharztpraxen sogar in den Ballungsgebieten.
Dort führt der Wettbewerbsdruck als Folge einer Facharztschwemme zu per-manenten Wiederbestellungen von Pa-tienten zur diagnostischen Kontrolle, durch die das deutsche Gesundheits-wesen wegen der Dominanz von Einzel-leistungsvergütungen (bei Kappung der Honorare durch Zeit- und Mengenpau-schalen) gekennzeichnet ist. Genau dies hat der KBV eine wenig willkommene Diskussion um die bürokratische Rege-lung von Wartezeiten auf der Facharzt-ebene beschert.
In den Selektivverträgen der Haus-ärztlichen Vertragsgemeinschaft und des Hausärzteverbandes mit den Kran-kenkassen sind diese Probleme gelöst: Hier regelt der Hausarzt das Therapiema-nagement und verhindert somit unko-ordinierte Facharztbesuche.
Man steckt in einem Dilemma. Der Mangel an Hausärzten, beispielsweise am Stadtrand, macht aus der Sicht man-cher Patientinnen und Patienten den Einsatz von Fachärzten erforderlich. Man sollte aber erkennen, dass dies eine Folge der Tatsache ist, dass man in „or-ganisierter Verantwortungslosigkeit“ die hausärztliche Versorgung trotz Be-darfsplanung nicht hat steuern können. Seit Horst Seehofer diese als Bundes-gesundheitsminister 1993 eingeführt hat, ist die Zahl der Spezialisten unter den Vertragsärzten um 56 Prozent ge-stiegen und die der Hausärzte um zehn Prozent gefallen, so die Zahlen im Sach-verständigengutachten.
Die Gesundheitspolitik hat somit das vorher bereits existierende Problem des Hausarztmangels durch die Bedarfs-planung auch noch erheblich ver-schärft. Der Politiker und Soziologe Ralf Dahrendorf hat recht behalten, als er postulierte: „Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum!“ Jedenfalls ist das dann der Fall, wenn man einerseits den Wettbewerb zur Ideologie erhebt und andererseits eine Mengensteuerung anstrebt.
Viele andere europäische Staaten haben wenigstens dieses Problem in den Griff bekommen. Dort sind Patienten gesetzlich verpflichtet, sich einen für sie verantwortlichen Hausarzt zu wählen, der die knappe und teure Inanspruch-nahme von Fachärzten steuert. Teurer als das deutsche System ist nur das der USA.
Wir sind Gerlach zu Dank verpflich-tet, dass er uns auf diese Zusammenhän-ge hingewiesen hat. Die deutsche Politik wäre gut beraten, sich mit seinen Thesen und den Resultaten des Sachverständi-genrates zu befassen.
Prof. Dr. med. Klaus Dieter Kossowist Arzt für Allgemein-medizin und Ehren-vorsitzender des Deut-schen Hausärzte- verbands.
430 DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND / GERMAN ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
431BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
Praxisleitfaden Allgemeinmedizin
Auf 1.776 Seiten bietet der jetzt in der 7. Auflage vorliegende Praxisleitfaden ei-nen umfassenden Ein- und Überblick über das breite Aufgabenspektrum des praktizierenden Allgemeinarztes. Alle relevanten Fachthemen werden unter Einbezug von aktuellen Leitlinien unter besonderer Berücksichtigung der haus-ärztlichen Leitlinien der DEGAM, Disease-Management-Programmen, Impfempfehlungen und weiteren Hin-weisen etwa zu Laboruntersuchungen, der Arzneitherapie und Abrechnungs-fragen strukturiert dargestellt. Neben den Kernfächern der Stoffgebiete der In-neren Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Or-thopädie, Neurologie/Psychiatrie wer-den die sogenannten kleinen Fächer, z.B. Haut, HNO, Augen und weitere wichtige Fachgebiete, z.B. Reisemedi-zin, Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, an-gemessen unter Implikation der besten verfügbaren externen Evidenz behan-delt. Weitere Spezialgebiete, etwa Impf-empfehlungen, die Schmerztherapie oder die Palliativmedizin, erfahren eine entsprechende Würdigung. Internet-adressen am Ende der meisten Kapitel und Adressen im Anhang, etwa Gift-informationszentren, liefern wichtige Zusatzinformationen.
Die durchgehende Gliederung der einzelnen Beratungsursachen (Behand-lungsanlässe) nach Ätiologie, Klinik, Di-agnostik, Differenzialdiagnostik, Thera-pie und Komplikationen sichert Nutz-wert und Praktikabilität bei der Infor-mationssuche im Stichwortverzeichnis. Der Allgemeinarzt kann sich über die zweckdienliche Vorgehens- und Verfah-
rensweise bei der Beratung, Behand-lung, Betreuung und Begleitung seiner Patienten bei unterschiedlichen Be-schwerden, Funktionsstörungen und Erkrankungen rasch orientieren und nutzt damit eine bewährte sach- und fachkundige praxisrelevante Arbeitshil-fe. Die Ausführungen im Text werden durch zahlreiche anschauliche Abbil-dungen und instruktive Übersichtsta-bellen ergänzt und unterstrichen.
Es versteht sich von selbst, dass bei Umfang und Vielfalt der abgehandelten Themen eine Beschränkung auf die wesentlichen an den konkreten praktischen Problemen von Diag-nostik und Therapie ori-entierten Fakten not-wendig erfolgen muss. Theoretische Grund-lagen der Pathophysio-logie oder der allgemei-nen Pharmakologie blei-ben weitgehend ausgespart. Der vorlie-gende Leitfaden stellt mit seiner Kon-zeption ein einmaliges Praxisbuch, ei-nen aktuellen Ratgeber und ein Nach-schlagwerk mit einer hohen Informati-onsdichte dar, der Prozeduren und Handlungsempfehlungen mit dem fun-diert begründeten und kompetenten di-agnostischen und therapeutischen Vor-gehen im Praxisalltag des Allgemeinarz-tes miteinander verbindet. Darüber hi-naus werden wichtige Grundzüge der allgemeinärztlichen Arbeitsweise deut-lich und auch auf die Besonderheiten der Problematik von Multimorbidität
und Chronizität der Erkrankungen ei-ner älter werdenden Bevölkerung nicht nur im Kapitel Geriatrie eingegangen. Einen weiteren Zusatznutzen bietet der Leitfaden mit dem zeitlich begrenzten kostenlosen Online-Zugriff auf den Buchinhalt und die Abbildungen mit der im Leitfaden gelisteten persönli-chen PIN-Nummer. Ein Arbeitsbuch im eigentlichen Wortsinn für die all-gemeinärztliche Praxis, das konkret und pragmatisch Hilfe zur Bewältigung der
ganz unterschiedlichen Herausforde-rungen im Praxisalltag des Allgemein-arztes auf einen hohen qualitativen Le-vel gewährleistet. „Der nichts von allem weiß“, kann sich mit diesem Leitfaden erfolgreich in die Arbeit stürzen.
Paul Kokott
Gesenhues, Stefan; Ziesché, Rainer H.; Breetholt, Anne (Hrsg.)
Praxisleitfaden Allgemeinmedizin
7. Auflage
2014. 1.750 Seiten, 210 farbige Abb., 363 farbige Tab.
Urban & Fischer, Elsevier, München
Preis: 74,99 €
Dr. med. Paul Kokott
Stormstraße 21
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Korrespondenzadresse
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Organschaft / AffiliationDeutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM; www.degam.de),DEGAM-Bundesgeschäftsstelle Goethe-Universität, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15, 4. OG, 60590 Frankfurt; Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA; www.gha-info.de); Salzburger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SAGAM; www.oegam.at/c1/page.asp?id=35);Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM; www.suegam.it); Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (TGAM; www.tgam.at);Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin (VGAM)Official Journal of the German College of General Practitioners and Family Physicians, the Society of Professors of Family Medicine, the Salzburg Society of Family Medicine, the South-tyrolean College of General Practitioners, the Tyrolean College of General Practitioners and the Vorarlberg Society of Family Medicine
Herausgeber / EditorsProf. Dr. med. Heinz-Harald Abholz Facharzt für Allgemeinmedizin Abt. Allgemeinmedizin (Emeritus) Heinrich-Heine-UniversitätMoorenstraße 5 40225 Düsseldorf E-Mail: [email protected] http://www.uniklinik-duesseldorf.de/ allgemeinmedizin
Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP Facharzt für Allgemeinmedizin Institut für Allgemeinmedizin (Emeritus)Georg-August-Universität GöttingenLudwigstraße 37 79104 Freiburg E-Mail: [email protected] http://www.allgemeinmedizin. med.uni-goettingen.de
Prof. Dr. med. Wilhelm Niebling Facharzt für Allgemeinmedizin Lehrbereich Allgemeinmedizin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Schwarzwaldstraße 6979822 Titisee-Neustadt E-Mail: [email protected] http://www.ukl.uni-freiburg.de/med/lehre/lehrbereich/niebling.htm
Dr. med. Susanne Rabady Ärztin für AllgemeinmedizinParacelsus Medizinische Privatuniversität Landstraße 2A-3841 Windigsteig E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Andreas SönnichsenFacharzt für Allgemeinmedizin Institut für Allgemeinmedizin und FamilienmedizinUniversität Witten/HerdeckeAlfred-Herrhausen-Straße 5058448 WittenE-Mail: [email protected]://www.uni-wh.de/gesundheit/lehrstuhl-institut-allgemeinmedizin-familienmedizin/
Internationaler Beirat / International Advisory BoardJ. Beasley, Madison/Wisconsin, USA; F. Buntinx, Leuven/Belgien; G.-J. Dinant, Maastricht/NLM. Egger, Bern/CH ; E. Garrett, Columbia/ Missouri, USA; P. Glasziou, Robina/Australien
T. Greenhalgh, London/UK; P. Hjortdahl, Oslo/Norwegen; E. Kahana, Cleveland/Ohio, USAA. Knottnerus, Maastricht/NL; J. Lexchin, Toronto/Ontario, Kanada; C. del Mar, Robina/Australien; J. de Maeseneer, Gent/BelgienP. van Royen, Antwerpen/Belgien; F. Sullivan, Dundee/Schottland, UK; C. van Weel, Nijmegen/NL; Y. Yaphe, Porto/Portugal
Verlag / PublisherDeutscher Ärzte-Verlag GmbHDieselstr. 2, 50859 KölnPostfach 40 02 65, 50832 KölnTel.: +49 2234 7011–0 www.aerzteverlag.dewww.online-zfa.de
Geschäftsführung / Management of the CompanyNorbert A. Froitzheim (Verleger), Jürgen Führer
Leiterin Produktbereich / Leader Product Division: Katrin Groos
Produktmanagement / Product ManagerMarie-Luise BertramTel.: +49 2234 7011–389Fax: +49 2234 7011–6389E-Mail: [email protected]
Koordination / CoordinationJürgen Bluhme-RasmussenTel.: +49 2234 7011–512Fax: +49 2234 7011–6512E-Mail: [email protected]
AbonnementserviceTel.: +49 2234 7011–520Fax: +49 2234 7011–[email protected]
Leiter Kunden Center / Leader Customer Service: Michael Heinrich Tel. +49 2234 7011–233 E-Mail: [email protected]
Leiterin Anzeigenmanagement und verantwortlich für den Anzeigenteil / Advertising CoordinatorMarga Pinsdorf, Tel.: +49 2234 7011–243 E-Mail: [email protected]
Key Account Manager KAM Medizin Marek Hetmann Tel.: +49 2234 7011–318 E-Mail: [email protected]
Verlagsrepräsentanten / Publishers’ Representatives
Verkaufsgebiete Nord/OstGötz KneiselerUhlandstraße 161, 10719 BerlinTel.: +49 30 88682873Fax: +49 30 88682874Mobil: +49 172 3103383E-Mail: [email protected]
Verkaufsgebiet WestEric Le GallKönigsberger Str.11, 51469 Bergisch GladbachTel.: +49 2202 9649510Fax: +49 2202 9649509Mobil: +49 172 2575333E-Mail: [email protected]
Verkaufsgebiet SüdPeter Ocklenburg
Langenbachweg 2, 79215 BiederbachTel.: +49 7682 9265020Fax: +49 7682 9265022Mobil: +49 178 8749013E-Mail: [email protected]
Leiter Medienproduktion / Leader Media Production: Bernd Schunk Tel.: +49/2234 7011–280, [email protected]
Herstellung / Production DepartmentDeutscher Ärzte-Verlag GmbH, KölnAlexander Krauth, Tel.: +49 2234 7011–278 E-Mail: [email protected]
Layout / LayoutSybille Rommerskirchen
Druckerei / PrinteryDruckerei farbo print+media GmbH Bischofsweg 48, 50969 Köln
Erscheinungsweise / FrequencyDie Zeitschrift erscheint 11 x jährlichJahresbezugspreis Inland: 114,00 €Ermäßigter Preis für Studenten jährlich: 84,00 €Jahresbezugspreis Ausland: 141,60 €Ermäßigter Preis für Studenten jährlich Ausland: 111,60 €Einzelheftpreis: 10,40 €Preise inkl. Porto und 7 % MwSt.Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Ende des Kalenderjahres. Gerichtsstand Köln. Für Mit-glieder der DEGAM ist der Bezug im Mitglieds-beitrag enthalten.
Konten / AccountDeutsche Apotheker- und Ärztebank, Köln, Kto. 010 1107410 (BLZ 30060601), IBAN: DE 2830 0606 0101 0110 7410 BIC: DAAEDEDD Postbank Köln, Kto. 192 50–506 (BLZ 37010050) IBAN: DE 8337 0100 5000 1925 0506 BIC: PBNKDEFF
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 6, gültig ab 1. 1. 2014
Druckauflage: 9.200 Ex.
Der Verlag ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft LA-MED Kommunikationsforschung im Gesundheitswesen e.V.
90. Jahrgang
ISSN 1433-6251
Urheber- und Verlagsrecht / Copyright and Right of PublicationDie Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein -zelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-rechtlich geschützt. Mit Annahme des Manu-skriptes gehen das Recht der Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Spei-cherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Gren-zen ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
© Copyright by Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln
Z FAZeitschrift für Allgemeinmedizin
German Journal of Family Medicine
Oktober 2014 – Seite 385–432 – 90. Jahrgang www.online-zfa.de
432 IMPRESSUM / IMPRINT
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Von bis Z gut eingestellt: Weil wir die größte Auswahl imärztlichen Stellenmarkt haben. Wöchentlich im Deutschen Ärzteblatt.
Sofort unter www.aerztestellen.de
NGEBOTE.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (10)
Ja, hiermit bestelle ich mit 14-tägigem Rückgaberecht
� Herr � Frau
Name, Vorname
Fachgebiet
Praxis/Firma
Straße, Nr. PLZ, Ort
E-Mail-Adresse � (Die Deutsche Ärzte-Verlag GmbH darf mich per E-Mail zuWerbezwecken über verschiedene Angebote informieren)
Datum Unterschrift
Mehr Informationen: www.patientenschulungsprogramme.de
Irrt
ümer
und
Prei
sänd
erun
gen
vorb
ehal
ten.
Prei
sezz
gl.V
ersa
ndsp
esen
.D
euts
cher
Ärz
te-V
erla
gG
mbH
–Si
tzKö
ln–
HRB
106
Am
tsge
rich
tKö
ln.
Ges
chäf
tsfü
hrun
g:N
orbe
rtA
.Fro
itzh
eim
,Jür
gen
Führ
er
B E S T E L L S C H E I N
Ausfüllen und an den Deutschen Ärzte-Verlag senden.
Fax und fertig: 02234 7011-476E-Mail: [email protected]: 02234 7011-314 oder per Post
Deutscher Ärzte-Verlag GmbHFrau Pia SchnitzlerPostfach 40024450832 Köln
A32
06
3MM
5PSZ
FA
Anzahl ISBN Titel
✗ ✗
Diabetes mellitus und HypertoniePatienten erfolgreich schulen
Ihr Unterrichtsmaterial
Verbrauchsmaterial für Ihre Patienten
Neue
Auflage
Ihre Vorteile auf einen Blick
✓ Sie rechnen Schulungen und Patientenmaterialien imRahmen der DMPs mit den Kostenträgern ab.
✓ Sie erhalten aktuelle und patientengerechte Materialien.
✓ Ihre Schulungskraft führt die Schulungen durch,Sie gewinnen Zeit.
Ohne InsulinbehandlungBehandlungs- und Schulungsprogramm für Typ-2-Diabetiker,die nicht Insulin spritzenUnterrichtsmaterial € 189,– (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7034-4Verbrauchsmaterial € 89,95 (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7047-4
Konventionelle InsulinbehandlungBehandlungs- und Schulungsprogramm für Typ-2-Diabetiker,die Insulin spritzenUnterrichtsmaterial € 189,– (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7043-6Verbrauchsmaterial € 89,95 (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7078-8
Insulinbehandlung vor dem EssenBehandlungs- und Schulungsprogramm für Typ-2-Diabetiker,die Normalinsulin spritzenUnterrichtsmaterial € 189,– (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7081-8Verbrauchsmaterial € 89,95 (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7082-5
Intensivierte InsulinbehandlungBehandlungs- und Schulungsprogramm für intensivierte InsulintherapieUnterrichtsmaterial € 349,– (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7103-7Verbrauchsmaterial € 89,95 (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-8740-9238-8
Bluthochdruck/HypertonieBehandlungs- und Schulungsprogramm für Patienten mit HypertonieUnterrichtsmaterial Hypertonie € 189,– (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7063-4Verbrauchsmaterial Hypertonie € 89,95 (inkl. MwSt.) ISBN 978-3-7691-7080-1