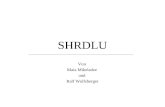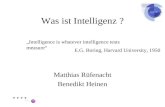ws0405_32060_empathie+intelligenz
Click here to load reader
-
Upload
neagu-emanuel -
Category
Documents
-
view
9 -
download
6
Transcript of ws0405_32060_empathie+intelligenz

1
Universität Regensburg WS 2004/2005 Institut für Experimentelle Psychologie Lehrstuhl Prof. Dr. Lukesch Pflichtwahlpraktikum: Empirische Erhebungen zum Bereich der Medien- und Gesund-heitspsychologie (Prof. Dr. Lukesch)
Empathie und Intelligenz
Leila Cubasch Benjamin Haas
Anna-Sofie Kunz Thomas Meier

Einleitung _____________________________________________________________________________________
2
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 1.1 Emotionale Intelligenz 1.2 Empathie 2. Hypothesen 3. Methoden 3.1 Vorstellung der verwendeten Inventare 3.1.1 Der FEPAA 3.1.2 Der CFT 3.2 Stichprobenbeschreibung 3.3 Versuchsdurchführung 3.4 Datenauswertungsmethoden 4. Ergebnisse 4.1 Ergebnisse zu Hypothese 1 (Empathie und Intelligenz) 4.2 Ergebnisse zu Hypothese 2 (Prosozialität und Intelligenz) 4.3 Ergebnisse zu Hypothese 3 (Aggressionslegitimation und Intelligenz) 4.4 Ergebnisse zu Hypothese 4 (Aggressionshäufigkeit und Intelligenz) 4.5 Ergebnisse zu Hypothese 5 (Lügenskala und Intelligenz) 4.6 Ergebnisse zu Hypothese 6 (Alter und Empathie) 4.7 Ergebnisse zu Hypothese 7 (Intelligenz und Geschlecht) 5. Diskussion 5.1 Empathie und Intelligenz 5.2 Prosozialität und Intelligenz 5.3 Aggressionslegitimation und Intelligenz 5.4 Aggressionshäufigkeit und Intelligenz 5.5 Lügen und Intelligenz 5.6 Alter und Empathie 5.7 Intelligenz und Geschlecht 5.8 Ausblick 6. Zusammenfassung Literatur

Einleitung _____________________________________________________________________________________
3
1.1. Emotionale Intelligenz Seit der Veröffentlichung von Golemans Buch „emotionale Intelligenz“ (1996) ist das
Konstrukt der emotionalen Intelligenz in der Laien-Presse sehr beliebt geworden. Der
IQ kann nach Meinung des Autors „kaum etwas über den späteren Erfolg im Leben
vorhersagen“; „höchstens 20 %“ (a. a. O., S. 54). Worauf es ankommt, seien die Fähig-
keiten, die neben der Intelligenz zum Erfolg führen. Goleman definiert dabei die „emo-
tionale Intelligenz“ als etwas anderes als die analytische Intelligenz. Was er genau dazu
rechnet, hat Goleman angeblich aus Beobachtungen an anderen Menschen seines Le-
bensumfeldes und sich selbst geschlussfolgert. Dazu gehören:
• „Achtsamkeit, [was] in einer bestimmten Bedeutung die fortwährende Wahr-
nehmung der eigenen inneren Zustände bezeichnet“ (a. a. O., S. 67). Die Fähig-
keit „sich der eigenen Gefühle in dem Augenblick, da sie auftreten, bewußt zu
werden“ sei der „Grundpfeiler der emotionalen Intelligenz“ (a. a. O., S. 67).
• „Die Fähigkeit, eine schlechte Stimmung abzuschütteln“ (a. a. O., S. 78). Diese
Fähigkeit wird von Goleman auch als emotionale Selbstregulierung bezeichnet.
Denn „starke negative Emotionen lenken [...] die Aufmerksamkeit auf ihre Fi-
xierungen und machen es schwer, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Es
ist sogar eines der Kennzeichen, daß Gefühle die Grenze zum Pathologischen
überschritten haben, daß sie sich einem dermaßen aufdrängen, daß sie jeden an-
deren Gedanken beiseite schieben und jeden Versuch, sich auf eine vorliegende
Aufgabe zu konzentrieren, vereiteln“ (a. a. O., S. 107).
• Die „übergeordnete Fähigkeit“ (a. a. O., S. 110). Es ist die Fähigkeit, „seine
Emotionen zu nutzen um sich selbst zu motivieren“ (a. a. O., S. 113). So
schreibt Goleman: „In dem Maße, wie uns Gefühle des Enthusiasmus und der
Freude an dem, was wir tun, motivieren – manchmal genügt auch ein optimales
Maß an Angst –, treiben sie uns zu Höchstleistungen an“ (a. a. O., S. 108). Als
Beispiele nennt er Hoffnung, Optimismus und „die erhabenen Momente, wenn
Menschen sich selbst übertreffen“ (a. a. O., S 114). Das letztgenannte Beispiel
nennt er auch „Fließen“ und definiert es folgendermaßen: „Beim Fließen sind
die Emotionen nicht bloß beherrscht und kanalisiert, sondern positiv, voller
Spannung und auf die vorliegende Aufgabe ausgerichtet“ (a. a. O., S. 120). Au-
ßerdem zählt er Impulskontrolle, Beharrlichkeit und die Fähigkeit Belohnungen
aufzuschieben ebenfalls zu der übergeordneten Fähigkeit, wobei aber unklar ist,

Einleitung _____________________________________________________________________________________
4
warum dies Fähigkeiten sind, bei denen Emotionen genutzt werden, um etwas
zu erreichen. Vielmehr werden hier Emotionen reguliert.
• Empathie. Dazu schreibt Goleman folgendes: „[Das] Unvermögen, Gefühle an-
derer wahrzunehmen, ist ein großer Mangel an emotionaler Intelligenz und ein
tragisches Defizit an Menschlichkeit. Denn der psychische Kontakt, der jeder
mitmenschlichen Regung zugrunde liegt, beruht auf Empathie, der Fähigkeit,
sich emotional auf andere einzustellen [bzw.] zu erkennen, was ein anderer
empfindet“ (a. a. O., S. 127).
• Die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten. Dafür notwendig ist „die emotionale
Fähigkeit [...] die Gefühle eines anderen zu erkennen und in einer Weise zu
handeln, die auf die Entwicklung dieser Gefühle einwirkt“ (a. a. O., S. 146).
Wie es die teils sehr unwissenschaftliche Darstellung der emotionalen Intelligenz durch
Goleman anklingen lässt, so zeigt der Blick in die wissenschaftliche Literatur Folgen-
des: Insofern überhaupt Arbeiten zu Golemans Konstrukt der emotionalen Intelligenz zu
finden sind, so stellt sich heraus, dass sein Konstrukt die Anforderungen, um als solches
zu gelten, nicht erfüllt. Zum einen ist der dazugehörige, ebensfalls von Goleman entwi-
ckelte Test nicht einmal mehr verfügbar. War er noch 1998 im Internet unter der Adres-
se http://www.utne.com/interact/test_iq.html (zitiert nach Davies, Stankov & Roberts,
1998, S. 1014) auffindbar, so findet sich jetzt dort nur noch der Hinweis „The emotional
intelligence test has been removed at the request of the author“ [Stand: 2005-08-01].
Die Gründe sind nicht bekannt und genau dies verleiht der Sache einen schlechten Bei-
geschmack.
Zum anderen ergaben die von Davies, Stankov und Roberts (1998) durchgeführten
Korrelationsberechnungen des EQ-Tests von Goleman mit der kristallinen und fluiden
Intelligenz, dass Golemans emotionale Intelligenz keine kognitive Fähigkeit sein kann.
Jede der beiden Intelligenzformen wurde durch drei verschiedene Intelligenztests opera-
tionalisiert. Die kristalline Intelligenz wurde mit dem Vocabulary Test, dem Esoteric
Analogies Test und dem General Knowledge Test und die fluide mit Cattell’s Matrices,
dem Letter Counting Test und dem Letter Series Test gemessen. Die Korrelationen zwi-
schen der emotionalen Intelligenz und der kristallinen bzw . fluiden Intelligenz erreich-
ten Werte von .14, -.04 und .09 für die kristalline und Werte von -.08, .04 und .03 für
die fluide Intelligenz (keiner der Werte wurde signifikant, a. a. O., S. 998 f). Zwischen
der emotionalen und der analytischen Intelligenz besteht damit kein Zusammenhang.

Einleitung _____________________________________________________________________________________
5
Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, dass die emotionale Intelligenz nach
Goleman keine kognitive Fähigkeit ist, da sie nicht durch die allgemeine Intelligenz
beeinflusst wird. Eine andere, jedoch in die gleiche Richtung gehende Interpretation ist,
dass die emotionale Intelligenz keine gemessene Leistung ist, wenn sie mit Golemans
EQ-Test gemessen wird. Dieser Schluss lässt sich eigentlich schon aus der Tatsache
ziehen, dass der EQ-Test eine Selbstauskunftserhebung darstellt. Intelligenz ist aber
nach psychologischem Verständnis ein Leistungs- bzw. ein Dispositionskonzept. Und
wenn das Konstrukt der Intelligenz schon erweitert werden muss, was bereits an sich
ein Problem darstellt, worauf später noch eingegangen werden soll, dann muss sie ein
Leistungskonzept bleiben und entsprechend in einer Leistungssituation gemessen wer-
den.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass der von Goleman vorgeschlagene EQ-
Test nicht einmal reliabel ist (a. a. O., S. 1012).
Ein anderes Konzept der emotionalen Intelligenz wurde von Mayer und Salovey
(2004) entwickelt. Konzeptuell werden hier nicht wie bei Goleman die verschiedenen
Bereiche Motivation, Emotion, Kognition, Persönlichkeit und Empathie zusammenge-
würfelt. Sie nehmen die Bezeichnung emotionale Intelligenz terminologisch ernst und
verbinden nur die Bereiche der Emotion und Kognition miteinander. Sie definieren die
emotionale Intelligenz als „das Vermögen, über Emotionen nachdenken zu können und
das Vermögen Emotionen zu nutzen, um das Denken zu verbessern“ (Mayer, Salovey &
Caruso, 2004, S. 197). Von dieser Definition leiten sie ein Modell ab, das vier Bereiche
von Fähigkeiten umfasst: Die Fähigkeit sind:
1. Emotionen wahrnehmen zu können,
2. Emotionen zu nutzen, um das Denken zu verbessern,
3. Emotionen zu verstehen und
4. Emotionen zu handhaben.
Der Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) wurde entwickelt,
um jeden dieser vier Bereiche mittels je zweier Subtests zu messen.
Die Fähigkeit Emotionen wahrnehmen zu können, wird erfasst, indem (a) Gesichter
dargeboten werden und die Versuchspersonen (Vpn) das dargestellte Gefühl erkennen
müssen und (b) Landschaftsbilder dargeboten werden, wobei die Vp die durch die
Landschaft vermittelte Stimmung erkennen muss.
Die Fähigkeit Emotionen zu nutzen, um das Denken zu verbessern, wird durch fol-
gende Tests gemessen: (c) Die Vp muss Emotionen mit taktilen und sensorischen Sti-

Einleitung _____________________________________________________________________________________
6
muli vergleichen und (d) die Vp muss für eine bestimmte Art des Denkens (z. B. Prob-
lemslösen) eine Emotion angeben, die diese Form des Denkens erleichtert.
Die Fähigkeit Emotionen zu verstehen, wird durch folgende Tests gemessen: (e) Die
Vp muss angeben, unter welchen Umständen sich die Intensität einer Emotion vermin-
dert oder verstärkt und wie man einen emotionalen Zustand in einen anderen überführen
kann und (f) die Vp muss angeben, aus welchen diskreten Emotionen eine bestimmte
komplexe zusammengesetzt ist.
Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu handhaben, wird durch folgende Tests ge-
messen: (g) Den Vpn werden hypothetische Szenarien dargeboten und die Vp muss an-
geben, wie sie es erreicht, ihre Stimmung entweder beizubehalten oder zu ändern und
(h) die Vp wird gefragt, wie sie die Emotionen anderer lenkt, um einen bestimmten
Endzustand zu erreichen.
Emotionale Intelligenz kann mit dem MSCEIT mit rtt = . 91 reliabel gemessen wer-
den (Mayer, Salovey & Caruso, 2004, S. 202). Um die Frage der diskriminanten Validi-
tät zu beantworten, korrelierten Mayer, Salovey und Caruso (2004) die mit dem
MSCEIT gemessene emotionale Intelligenz mit dem verbalen IQ (drei verschiedene
Tests), dem perceptual-organizational IQ (ein Test) und dem allgemeinem IQ (drei
Tests). Es ergaben sich Korrelationen von .36, .32, .27 / .14 / .32, .23 und .25 (alle Kor-
relationen sind signifikant, a. a. O., S. 204). Die mäßigen Korrelationen zwischen der
allgemeinen Intelligenz und der emotionalen Intelligenz sprechen dafür, dass die emoti-
onale Intelligenz von der allgemeinen abhängt, gleichzeitig aber nicht exakt dasselbe ist.
Grundsätzlich ist es jedoch problematisch, ein bereits bestehendes und durch lange
Forschungstradition begründetes Konstrukt wie das der Intelligenz mehr oder minder
willkürlich zu erweitern. Gerade bzgl. der Intelligenz wurde in jüngster Zeit immer
wieder versucht, „diese mit dem Verstand verbundene geistige Fähigkeit in ihrer poten-
tiellen und dynamischen Bedeutung“ (Dorsch, 2004) auf andere Bereiche zu übertragen.
Versuche, diese Fähigkeit auf andere Bereiche zu übertragen, wie es u. a. durch die
Konstruktion der sozialen Intelligenz geschehen sollte, schlugen allerdings fehl. Denn
die Korrelationen zwischen der allgemeinen und der sozialen Intelligenz, gleichgültig
mit welchem der verschiedenen Tests der sozialen Intelligenz (z. B. George Washington
Social Intelligence Test) sie erhoben wurde, waren so hoch, dass davon ausgegangen
werden musste, dass diese Tests schlicht und einfach doch nur die analytische Intelli-
genz maßen (für einen Überblick vgl. Cantor & Kihlstrom, 2000).

Einleitung _____________________________________________________________________________________
7
Zudem wird durch eine ständige Erweiterung der Bedeutung von Intelligenz der Beg-
riff selbst inhaltsleer. Plötzlich wäre dann jedes Verhalten intelligent. Was damit jedoch
nicht ausgeschlossen ist, ist eine Bewertung des Verhaltens, z. B. im sozialen Bereich.
Dies muss dann eben mit bereichsspezifischen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen getan
werden.
1.2. Empathie Eine Fähigkeit, die sich auf den sozialen Bereich bezieht, ist die Empathie. Es ist die
Fähigkeit, Emotionen eines anderen wahrzunehmen, sie nachzuempfinden und entspre-
chend der Emotion eventuell prosozial zu handeln. In der Literatur finden sich zwei
verschiedene Sichtweisen bzgl. der Konzeption der Empathie. So ist die Empathie ein-
mal als affektives Konstrukt konzipiert, wobei das Empfinden der bei einem anderen
wahrgenommenen Emotion im Vordergrund steht. Dem steht die Ansicht der Empathie
als kognitive Fähigkeit gegenüber, wobei im Vordergrund steht, „die Gedanken, Per-
spektiven und Gefühle eines anderen zu erkennen und zu verstehen“ (Friedlmeier, 1993,
S. 31).
Empathie kann u. a. mit dem Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität,
Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA) gemessen werden (Lu-
kesch, 2004).
Genauso wie eine neue Konzeption der Intelligenz, muss auch eine kognitive Fähig-
keit, die Verhalten anderer bewerten soll, bestimmte Vorraussetzungen erfüllen. Eine
kognitive Fähigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Intelligenz beeinflusst
wird. Sie müsste also eine positive Korrelation zur allgemeinen Intelligenz aufweisen.
Außerdem verändern sich kognitive Fähigkeiten mit dem Lebensalter. Es ist damit wei-
terhin anzunehmen, dass die Empathie mit zunehmendem Alter stärker ausprägt ist.

Hypothesen _____________________________________________________________________________________
8
2. Hypothesen
Aus der Konzeption des FEPAA, der vier verschiedene Bereiche erfasst (Empathie,
Prosozialität, Aggressivität und Aggressionsverhalten) ergeben sich die untenstehenden
Hypothesen:
H1: Zwischen Empathie und Intelligenz besteht ein positiver Zusammenhang.
H2: Zwischen Prosozialität und Intelligenz besteht ein positiver Zusammenhang.
H3: Zwischen Aggressionslegitimation und Intelligenz besteht ein negativer Zusam-
menhang.
H4: Zwischen Aggressionshäufigkeit und Intelligenz besteht ein negativer Zusammen-
hang.
H5: Zwischen Lügen und Intelligenz besteht ein negativer Zusammenhang.
H6: Zwischen Alter und Empathie besteht ein positiver Zusammenhang.
H7: Zwischen Intelligenz und Geschlecht besteht kein Zusammenhang.

Methode _____________________________________________________________________________________
9
3. Methode
3.1 Verwendete Messinstrumente
Im Folgenden werden die für diese Untersuchung verwendeten Tests (FEPAA und CFT
20) in Form einer kurzen Zusammenfassung vorgestellt.
3.1.1 Der FEPAA Der FEPAA ist ein Fragebogen zur Erfassung der Empathie, Prosozialität, Aggressions-
bereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA). Dieser Fragebogen geht von „Empa-
thie im Sinne der kognitiven Fähigkeit, sich in die Situation eines anderen (= Rollen-
oder Perspektivenübernahme)“ (Lukesch, 2004) aus. Er beinhaltet vier Skalen positiven
und negativen Sozialverhaltens, wobei positives Sozialverhalten durch Empathie und
Prosozialität, negatives Sozialverhalten durch Aggressivität (operationalisiert durch
Gewaltlegitimation) und Aggressionshäufigkeit gekennzeichnet ist. Das positive und
negative Sozialverhalten wird sowohl auf Dispositionsebene (mittels Vorgabe von sozi-
alen Situationen, zu denen Stellung genommen werden soll) wie auch auf Verhaltens-
ebene (hier über Zustimmung / Ablehnung zu vorgegebenen Statements) erfasst. Wei-
terhin enthält der FEPAA eine Lügenskala nach Schmidt (1981), die den möglichen
Einfluss sozialer Erwünschtheit untersucht. Diese Skala wird allerdings für die Endver-
sion der FEPAA nicht mehr eingesetzt, da sie hohe Überlappungen zu dem Konzept des
prosozialen Verhaltens aufweist.
Im Folgenden wird kurz auf die einzelnen Skalen eingegangen.
1. Empathie
Zur Erfassung der Empathie werden 28 Situationen, je Parallelform 14, mit jeweils zwei
Handelnden vorgegeben. Diese gilt es in der Position des Experten über drei alternative
Antwortmöglichkeiten zu beurteilen, wobei eine der Antwortmöglichkeiten dem Kon-
zept der Empathie entspricht, die zwei anderen Lösungen hingegen nicht bzw. nur in
verringertem Ausmaß.
Beispiel 1:
Anette hat endlich ihren Schwarm Max zu einem Treffen eingeladen. Am besagten A-
bend wird Max jedoch von Anette versetzt, weil sie in den falschen Bus eingestiegen
ist. Wie fühlt sich Max, als er versetzt wird?

Methode _____________________________________________________________________________________
10
• Er ist traurig, weil er den Abend allein verbringen muss.
• Er ist froh, weil er sich Geld sparen kann.
• Er ist enttäuscht.
Was denkt Anette?
• Es ist ihr egal.
• Sie hat Angst, dass Max nichts mehr von ihr wissen will.
• Sie denkt sich, dass man die Verabredung ja nachholen kann.
2. Prosozialität
Die Prosozialitätsskala enthält 26 Items, je Parallelform 13, mit dem alternativen Ant-
wortformat: stimmt / stimmt nicht. Die Items beziehen sich auf die Themen Helfen,
Teilen / Schenken, Unterstützen / Kooperieren, wobei auch invers formulierte Items
enthalten sind.
3. Aggressivität
Zur Erfassung der Aggressivität enthält der FEPAA eine Skala mit 26 Situationen, je
Parallelform 13, die sowohl direkte Formen, als auch indirekte Formen von Aggressivi-
tät enthalten. Das dargestellte Verhalten soll mittels eines 7-stufigen Antwortformates
dahingegen beurteilt werden, ob das Verhalten als gerechtfertigt oder nicht gerechtfer-
tigt angesehen wird.
4. Aggressivitätshäufigkeit
Die Aggressivitätshäufigkeit wird mit jeweils 15 Items, die mit den Antwortalternativen
stimmt / stimmt nicht zu beurteilen sind, erhoben.
3.1.2 Der CFT
Der CFT 20 ist die deutsche Adaptation des „Culture Fair Intelligence Test – Scale 2“
von R. B. Catell (1960, zit. n. Weiß, 2002). Er besteht aus zwei Parallelformen, Form A
und Form B, in denen lediglich die Reihenfolge der Aufgaben und Lösungspositionen
verändert ist. Der CFT 20 enthält zwei Testteile mit je 46 Items, die sich in folgende
Subtests gliedern: Reihenfortsetzen, Klassifikationen, Matrizen und topologische
Schlussfolgerungen. Die Antworten müssen in Multiple-Choice-Form aus je fünf Ant-
wortalternativen gewählt werden.

Methode _____________________________________________________________________________________
11
3.2 Stichprobenbeschreibung
An der Untersuchung nahmen 82 Hauptschüler der Jahrgangsstufen 6., 8. und 9. teil,
wobei sieben Schüler wegen unvollständiger Fragebogenbeantwortung ausgeschlossen
werden mussten. Letztendlich gingen 46 Buben und 29 Mädchen im Alter von 10,3 bis
17 Jahren in die Auswertung ein. Das durchschnittliche Alter lag zwischen 12 und 14
Jahren.
3.3 Versuchsdurchführung Die Untersuchung wurde mit den insgesamt 82 Schülern im Klassenverband durchge-
führt. Die Erhebungen fanden im Dezember statt. Nach einer kurzen Instruktion wurde
von den Schülern der FEPAA und der CFT 20 ausgefüllt, wobei die Reihenfolge vari-
iert wurde. Es war stets ein Versuchsleiter anwesend. Für die Test- und Fragebogenbe-
antwortung wurde ein Zeitrahmen von zwei Schulstunden gesetzt. Als zusätzliche Krite-
rien wurden die demographischen Merkmale Alter und Geschlecht erhoben.
3.4 Datenauswertungsmethoden
In der Auswertung der Studie wurden Zusammenhangsmaße nach Pearson zwischen
Intelligenz, Empathie, Prosozialität, Aggression und Aggressionshäufigkeit berechnet,
sowie Zusammenhangsmaße zwischen Alter und Empathie und Geschlecht und Intelli-
genz. Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS für Win-
dows.

Diskussion _____________________________________________________________________________________
12
4. Ergebnisse
4.1. Ergebnisse zu Hypothese 1 (Empathie und Intelligenz)
Die erste Hypothese besagt, dass zwischen Empathie und Intelligenz ein signifikanter
positiver Zusammenhang besteht. In der folgenden Tabelle 1 sind die Ergebnisse aufge-
führt.
Tabelle 4.1: Zusammenhang zwischen Empathie und Intelligenz (Hypothese 1) Intelligenz Rohwert Empathie Korrelation nach Pearson .142 .218 Empathie partielle Korrelation .073 .143 Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (einseitig) nicht signifikant. Den Ergebnis-
sen zufolge besteht also zwischen den Empathie und Intelligenz kein signifikanter posi-
tiver Zusammenhang. Empathische Kinder sind nicht intelligenter. Somit kann die
Hypothese H1, „zwischen Empathie und Intelligenz besteht ein positiver Zusammen-
hang“ nicht bestätigt werden.
4.2. Ergebnisse zu Hypothese 2 (Prosozialität und Intelligenz)
Die zweite Hypothese besagt, dass zwischen Prosozialität und Intelligenz ein signifikan-
ter positiver Zusammenhang besteht. Die Korrelationsberechnung führte zu folgenden
Ergebnissen:
Tabelle 4.2: Zusammenhang zwischen Prosozialität und Intelligenz (Hypothese 2) Intelligenz Rohwert Prosozialität Korrelation nach Pearson .082 .055 Prosozialität partielle Korrelation .098 .075 Auch diese Korrelation ist nicht signifikant auf dem Niveau von 0.05 (einseitig). Dem-
nach besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Prosozialität und Intelligenz.

_____________________________________________________________________________________
13
4.3. Ergebnisse zu Hypothese 3 (Aggressionslegitimation und Intelligenz)
Die Hypothese H3 vermutet, dass zwischen Aggressionslegitimation und Intelligenz ein
negativer Zusammenhang besteht. Als Ergebnisse kamen heraus:
Tabelle 4.3: Zusammenhang zwischen Aggressionslegitimation und Intelligenz (Hypo-
these 3) Intelligenz Rohwert Aggressionslegitimation Korrelation nach Pearson -.009 -.042 Aggressionslegitimation partielle Korrelation -.007 -.045 Die Korrelation ist nicht signifikant auf dem Niveau von 0.05 (einseitig). Den Ergebnis-
sen zufolge besteht zwischen Aggressionslegitimation und Intelligenz kein signifikanter
negativer Zusammenhang.
4.4. Ergebnisse zu Hypothese 4 (Aggressionshäufigkeit und Intelligenz)
Die vierte Hypothese besagt, dass zwischen Aggressionshäufigkeit und Intelligenz ein
signifikanter negativer Zusammenhang besteht. In der folgenden Tabelle sind die Er-
gebnisse aufgeführt:
Tabelle 4.4: Zusammenhang zwischen Aggressionshäufigkeit und Intelligenz (Hypothe-
se 4) Intelligenz Rohwert Aggressionshäufigkeit Korrelation nach Pearson .117 .082 Aggressionshäufigkeit partielle Korrelation .131 .083 Die Korrelation ist nicht signifikant auf dem Niveau von 0.05 (einseitig). Den Ergebnis-
sen zufolge besteht zwischen Aggressionshäufigkeit und Intelligenz kein signifikanter
positiver Zusammenhang.

_____________________________________________________________________________________
14
4.5. Ergebnisse zu Hypothese 5 (Lügenskala und Intelligenz)
Mit der fünften Hypothese wird vermutet, dass zwischen der Lügenskala und Intelligenz
ein signifikanter negativer Zusammenhang besteht. In der folgenden Tabelle sind die
diesbezüglichen Ergebnisse aufgeführt:
Tabelle 4.5: Zusammenhang zwischen Lügenskala und Intelligenz (Hypothese 5) Intelligenz Rohwert Lügenskala Korrelation nach Pearson -.102 -.125 Lügenskala partielle Korrelation -.043 -.051 Die Korrelation ist nicht signifikant auf dem Niveau von 0.05 (einseitig). Den Ergebnis-
sen zufolge besteht also zwischen Lügenskala und Intelligenz kein signifikanter positi-
ver Zusammenhang.
4.6. Ergebnisse zu Hypothese 6 (Alter und Empathie)
Die sechste Hypothese besagt, dass zwischen Alter und Empathie ein signifikanter posi-
tiver Zusammenhang besteht. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse aufgeführt:
Tabelle 4.6: Zusammenhang zwischen Empathie und Alter (Hypothese 6) Alter Empathie Korrelation nach Pearson .254*
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (einseitig) signifikant. Damit gilt die
Hypothese als bestätigt und es kann davon ausgegangen werden, dass mit steigendem
Alter auch die Empathie zunimmt.

_____________________________________________________________________________________
15
4.7. Ergebnisse zu Hypothese 7 (Intelligenz und Geschlecht)
Mit der siebten Hypothese wird vermutet, dass zwischen Intelligenz und Geschlecht
kein signifikanter Zusammenhang besteht. Als Ergebnis kam heraus:
Tabelle 4.7: Unterschiede (t-Test) zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich Intelli-genz (Hypothese 6)
Geschlecht
Intelligenz t-Test für die Mittelwertgleichheit .495 Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen hinsichtlich Intelligenz bestehen.

Diskussion _____________________________________________________________________________________
16
5. Diskussion
5.1 Empathie und Intelligenz
Anders als vorhergesagt konnte kein positiver Zusammenhang zwischen der Fähigkeit
zu Empathie und der Intelligenz gefunden werden. Dies würde bedeuten, weniger intel-
ligente Kinder könnten genauso empathisch sein, wie intelligentere. Bevor jedoch die
Annahme der Empathie als kognitive Fähigkeit in Frage gestellt wird, lohnt eine genau-
ere Betrachtung individueller IQ-Werte der Probanden. Hier zeigt sich, dass bei acht der
75 Probanden der gemessene IQ unterhalb von 80 liegt, bei einem Probanden gar bei
nur 55. Werte unter 80 gelten als pathologisch. Personen mit einer Intelligenzminderung
zeigen zudem ein abnormes Begabungsprofil. So sind soziale Kompetenzen noch ver-
hältnismäßig stark ausgeprägt, während andere kognitive Fähigkeiten, v. a. die des abs-
trakten Denkens und die des Problemlösens stärker beeinträchtigt sind. Wenn nun ein
nicht unerheblicher Teil der Stichprobe davon betroffen ist, ist es nicht auszuschließen,
dass diese Besonderheit zu einer Verzerrung des untersuchten Zusammenhangs führte.
5.2 Prosozialität und Intelligenz
Auch zwischen der Prosozialität und der Intelligenz konnte kein signifikant positiver
Zusammenhang festgestellt werden. Das würde bedeuten, weniger intelligente Kinder
verhielten sich genau so prosozial wie intelligentere. Wenn jedoch davon ausgegangen
werden kann, dass mit steigender Intelligenz auch die Empathie als kognitive Fähigkeit
stärker ausgeprägt ist, mit steigender Empathie wiederum die Häufigkeit prosozialen
Handelns, so sollte es eigentlich auch einen positiven Zusammenhang zwischen Intelli-
genz und Prosozialität geben. Dass dieser nicht gefunden wurde, könnte konsequenter-
weise wiederum an der unter 5.1 beschriebenen Stichprobenauffälligkeit liegen.
Schließlich kann Prosozialität als Manifestation von Empathie auf der Verhaltensebene
verstanden werden.
5.3 Aggressionslegitimation und Intelligenz
Der vorhergesagte negative Zusammenhang zwischen Aggressionslegitimation und In-
telligenz konnte nicht bestätigt werden. Intelligentere Personen würden demnach nicht
weniger Aggression als Verhaltensmöglichkeit legitimieren, als weniger intelligente. Da
Empathie und Aggressionslegitimation als antagonistisch begriffen werden können,

Anhang _____________________________________________________________________________________
17
sollte analog zu 5.1 mit steigender Intelligenz auch die Legitimation aggressiven Ver-
haltens sinken. Dass dies in dieser Untersuchung nicht festgestellt werden konnte, sollte
an dem bereits erwähnten Stichprobenproblem liegen (vgl. 5.1).
5.4 Aggressionshäufigkeit und Intelligenz
Auch der vermutete negative Zusammenhang zwischen Aggressionshäufigkeit und In-
telligenz konnte nicht gefunden werden. Doch sollte dies Folge des diskutierten Ergeb-
nisses von 5.3 sein. Schließlich ist es nahe liegend und wurde bislang auch so bestätigt,
dass jemand, der Aggression legitimiert, auch häufiger aggressives Verhalten zeigt.
Wenn in dieser Stichprobe nun schon nicht mit steigender Intelligenz Aggression zu-
nehmend weniger legitimiert wird, so wird konsequenterweise auch nicht weniger ag-
gressiv gehandelt. Auch hier sollte deshalb die Stichprobenbesonderheit Einfluss haben.
5.5 Lügentendenz und Intelligenz
Auch der besagte negative Zusammenhang zwischen Lügen und Intelligenz konnte
nicht belegt werden. In dieser Untersuchung hatte Intelligenz mit zunehmender Ausprä-
gung keinen Einfluss darauf, ob Probanden zu Gunsten sozial erwünschter Antworten
lügen oder nicht. Möglicherweise findet auch hier die vermutete Verzerrung durch die
Stichprobenzusammensetzung Niederschlag.
5.6 Alter und Empathie
Wie erwartet, konnte gezeigt werden, dass mit steigendem Alter Empathie stärker aus-
geprägt ist. Das heißt, je älter die Kinder sind, desto empathischer sind sie auch. Dieses
Ergebnis ist konform mit der Annahme der Empathie als kognitive Fähigkeit. Schließ-
lich verbessern sich im Normalfall kognitive Fähigkeiten durch Lernen und Erfahrung
über die Lebensspanne, bevor dann durch das Altern Einbußen hinzunehmen sind.

Anhang _____________________________________________________________________________________
18
5.7 Intelligenz und Geschlecht
Wie vorhergesagt, konnte zwischen dem Geschlecht der Probanden und deren Intelli-
genz kein signifikanter Zusammenhang gefunden werden. Das bedeutet, dass es für die
Ausprägung der Intelligenz keine Rolle spielt, welches Geschlecht die Kinder haben.
5.8 Ausblick
Allem voran gibt der bereits unter 5.1 erwähnte große Anteil an Probanden, deren Intel-
ligenzausprägung als pathologisch eingestuft werden muss, Anlass dazu, die Untersu-
chung erneut durchzuführen. Schließlich traten bei allen untersuchten Zusammenhängen
mit Beteiligung der Variable Intelligenz andere Ergebnisse auf als theoretisch abgeleitet
und vorhergesagt wurde. Es ergibt sich daher die Forderung, alle Kinder mit einem IQ
unter 80 auszuschließen. Sollten sich die Ergebnisse dennoch wiederholen, so sollte das
Konzept der emotionalen Intelligenz als kognitive Fähigkeit und Bestandteil der analy-
tischen Intelligenz in Frage gestellt werden.
Überdies stellt eine Probandenzahl von 75 eine relativ kleine Stichprobe dar. Im
Zuge einer neuerlichen Untersuchung sollte die Stichprobenzahl noch deutlich ausge-
weitet werden, um die Validität der Ergebnisse zu erhöhen.

Anhang _____________________________________________________________________________________
19
Literatur Cantor, N. & Kihlstrom, J. F. (2000). Social Intelligence. In R. J. Sternberg (Hrsg.),
Handbook of intelligence (2. Auflage, pp . 359-379). Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Davies, M., Stankov, L. & Roberst, R. D. (1998). Emotional intelligence: In search of
an elusive construct. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 989-1015.
Dorsch, F., Häcker, H. & Stapf, K. H. (2004). Dorsch Psychologisches Wörterbuch (14.
Auflage). Bern: Huber.
Friedlmeier, W.(1993). Entwicklung von Empathie, Selbstkonzept und prosozialem
Handeln in der Kindheit. Konstanz: Hartung-Gorre.
Goleman, D. (1996). Emotionale Intelligenz. München: Carl Hanser.
Lukesch, H. (2004. Fragebogen zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressi-
onsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPAA). Universität Regensburg: Un-
veröffentlichter Bericht.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intellligence: Theory,
findings, and implications Psychological Inquiry, 15 (3), 197-215.
Weiß, R. (2002). CFT 20. Grundintelligenztest Skala 2 (CFT 20) mit Wortschatztest
(WS) und Zahlenfolgentest (ZF) (4. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.