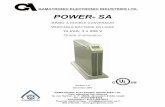Überprüfung der Wirksamkeit des „Trainings mit sozial...
-
Upload
truongtuong -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of Überprüfung der Wirksamkeit des „Trainings mit sozial...
Überprüfung der Wirksamkeit des
„Trainings mit sozial unsicheren Kindern“
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde durch den
Promotionsausschuss Dr. phil. der Universität Bremen
vorgelegt von
Dipl.-Psych. Christine Möller
(geb. Ortbandt)
Bremen, im März 2013
1. Gutachterin: Frau Prof. Dr. Ulrike Petermann
2. Gutachterin: Frau Prof. Dr. Ute Koglin
Das Promotionskolloquium fand am 28.02.2014 statt.
Danksagung I
Danksagung
Ich freue mich, an dieser Stelle allen Personen danken zu dürfen, die mich bei der Verwirk-
lichung meines Dissertationsvorhabens und bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt
haben.
Mein herzlicher Dank gilt Frau Prof. Dr. Ulrike Petermann, die es mir ermöglicht hat, meine
Dissertation über ein Thema zu schreiben, das mir sehr am Herzen liegt. Ihre fachliche
Begleitung und wohlwollende Unterstützung während meiner Promotionszeit waren für
mich sehr bereichernd. Ich bin dafür dankbar, dass sie mein wissenschaftliches Arbeiten
engagiert und nachhaltig gefördert hat.
Frau Prof. Dr. Ute Koglin danke ich für ihre sehr gute Beratung und hilfreiche Unterstützung
bei der Anfertigung dieser Arbeit. Es hat mich ganz besonders gefreut, dass sie stets ein
offenes Ohr für Fragen hatte und mir bei Problemen immer helfend zur Seite stand.
Ich danke auch den beiden Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten Dr. Claus Jacobs
und Dr. Stephanie Ender, die mich in meiner therapeutischen Arbeit verlässlich begleitet und
nachhaltig gefördert haben.
Meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich dankbar dafür, dass sie mir immer aufmunternd,
anregend und fachkundig zur Seite standen. Stellvertretend möchte ich hier Dr. Johanna
Helmsen, Mara Zoe Krummrich, Dr. Maike Lipsius, Dr. Dennis Nitkowski, Dr. Ina Schreyer-
Mehlhop und Dr. Ilva Schulte nennen. Dr. Dennis Nitkowski gebührt zusätzlich ein spezieller
Dank für seine kompetenten Hinweise zur statistischen Auswertung des Datenmaterials.
Mein ganz besonderer Dank gilt den Psychologiestudierenden Miriam Beck, Sandra Cammin-
Nowak, Philipp Heffter, Joana Heino, Nina Sanders, Marcin Sielicki, Cathrin Siener und Ilona
Steppa-Kolasa, die mich (vor allem) bei der Trainingsdurchführung tatkräftig unterstützt
haben. Ihnen danke ich sehr herzlich für ihre begeisterte, verantwortungsbewusste und
engagierte Mitarbeit.
Ein großer Dank geht an die Kinder und ihre Familien, die mir ihr Vertrauen geschenkt und
an der Studie teilgenommen haben. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.
Danksagung II
Meinen Freundinnen und Kolleginnen Katja Schmuck und Danielle Reuber-Linder danke ich
für die sehr guten methodischen und inhaltlichen Anregungen sowie für das ausführliche
und hilfreiche Korrekturlesen der vorliegenden Arbeit. Ihre freundschaftliche Verbunden-
heit hat mich – besonders in schwierigen Situationen – immer gestärkt. Auch Aron Kischke-
witz gilt mein Dank für das zügige und äußerst gründliche Korrekturlesen dieser umfang-
reichen Arbeit.
Meinen Eltern und Geschwistern, insbesondere meiner Schwester Carola Ortbandt, danke ich
für ihr großes Interesse, ihren wohltuenden Zuspruch und ihren stärkenden Rückhalt. Ein
zusätzlicher Dank gilt meinem Vater Andreas Ortbandt für seinen zuverlässigen und uner-
müdlichen Einsatz bei auftretenden technischen Fragen und Schwierigkeiten.
Mein tiefer Dank gebührt meiner Frau Martina Möller für ihre beflügelnde Liebe, ihr groß-
herziges Verständnis und ihre unendliche Geduld. Sie hat mir in schwierigen Situationen
immer wieder Mut gemacht und Kraft geschenkt. Ihre vorbehaltlose Unterstützung hat
maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen!
Inhaltsverzeichnis III
Inhaltsverzeichnis
Danksagung ........................................................................................................................................ I
Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................ III
Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................................... V
Tabellenverzeichnis .......................................................................................................................VII
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................... XI
1 Einleitung ............................................................................................................................... 12
2 Theorie .................................................................................................................................... 15
2.1 Darstellung von Angststörungen im Kindesalter ............................................. 15
2.1.1 Klinisches Erscheinungsbild und Klassifikation .............................. 15
2.1.2 Epidemiologie ........................................................................................ 25
2.1.3 Störungsbeginn und Verlauf ................................................................ 27
2.1.4 Komorbidität ......................................................................................... 29
2.1.5 Inanspruchnahmeverhalten und Behandlungsquoten ..................... 31
2.2 Ursachen von Angststörungen im Kindesalter ................................................. 33
2.2.1 Risikofaktoren ....................................................................................... 33
2.2.2 Theoretische Modelle ........................................................................... 39
2.3 Diagnostik von Angststörungen im Kindesalter .............................................. 43
2.3.1 Diagnostisches Vorgehen .................................................................... 43
2.3.2 Diagnostische Erhebungsmethoden .................................................. 45
2.3.3 Beurteilerübereinstimmung ................................................................. 52
2.4 Behandlung von Angststörungen im Kindesalter ............................................ 57
2.4.1 Behandlungsverfahren .......................................................................... 57
2.4.2 Behandlungssettings ............................................................................. 63
2.4.3 Behandlungsmethoden ......................................................................... 65
2.4.4 Behandlungsprogramme ...................................................................... 70
3 Training mit sozial unsicheren Kindern ............................................................................. 83
3.1 Aufbau des Trainings ............................................................................................ 83
3.2 Inhalte des Trainings ............................................................................................ 85
3.2.1 Trainingsinhalte für Kinder ................................................................. 85
3.2.2 Trainingsinhalte für Eltern .................................................................. 90
3.3 Bisherige Wirksamkeitsnachweise ...................................................................... 93
4 Fragestellung .......................................................................................................................... 99
Inhaltsverzeichnis IV
5 Methoden ............................................................................................................................ 103
5.1 Studiendesign ...................................................................................................... 103
5.2 Untersuchungsablauf ......................................................................................... 107
5.3 Erhebungsinstrumente ...................................................................................... 112
5.4 Stichprobenbeschreibung .................................................................................. 120
5.5 Statistische Auswertung .................................................................................... 125
6 Ergebnisse ........................................................................................................................... 128
6.1 Kurzfristige Wirksamkeit des Trainings ......................................................... 128
6.1.1 Trainingseffekte im Kinderurteil ..................................................... 128
6.1.2 Trainingseffekte im Elternurteil ....................................................... 130
6.1.3 Trainingseffekte im Lehrerurteil ...................................................... 136
6.2 Langfristige Wirksamkeit des Trainings .......................................................... 143
6.2.1 Trainingseffekte im Kinderurteil ..................................................... 143
6.2.2 Trainingseffekte im Elternurteil ....................................................... 146
6.2.3 Trainingseffekte im Lehrerurteil ...................................................... 153
6.3 Differentielle Effekte des Trainings ................................................................ 159
6.4 Beurteilerübereinstimmung .............................................................................. 167
6.5 Rückmeldung der Eltern nach dem Training ................................................. 169
7 Diskussion ........................................................................................................................... 171
7.1 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse............................................ 171
7.1.1 Kurzfristige Trainingseffekte............................................................ 171
7.1.2 Langfristige Trainingseffekte ............................................................ 178
7.1.3 Differentielle Trainingseffekte ......................................................... 184
7.1.4 Beurteilereffekte ................................................................................. 187
7.2 Zusammenfassende Diskussion der Methoden ............................................. 190
7.2.1 Studiendesign ...................................................................................... 190
7.2.2 Stichprobe ........................................................................................... 192
7.2.3 Erhebungsinstrumente ...................................................................... 193
7.2.4 Statistische Auswertung .................................................................... 195
7.3 Abschließende Bewertung des Trainings und Ausblick ............................... 197
8 Zusammenfassung ............................................................................................................. 200
9 Literatur ............................................................................................................................... 203
10 Anhang ................................................................................................................................. 235
Eidesstattliche Erklärung ............................................................................................................. 260
Abkürzungsverzeichnis V
Abkürzungsverzeichnis
Reliabilitätskoeffizient (nach Cronbach) 2(k) Prüfgröße des Chi-Quadrat-Tests mit k Freiheitsgraden
CBCL/4-18 Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugend-lichen im Alter von 4 bis 18 Jahren (Child Behavior Checklist 4-18)
CFT 1 Grundintelligenztest Skala 1 CFT 20-R Grundintelligenztest Skala 2 – Revision d / d‘ Maß für die Effektstärke bei Mittelwertsvergleichen mit t-Tests für
unabhängige bzw. abhängige Stichproben (nach Cohen) df Freiheitsgrade DISYPS-KJ Diagnostik-System für psychische Störungen des Kindes- und
Jugendalters nach ICD-10 und DSM-IV DSM-IV Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen F Prüfgröße des F-Tests (im Rahmen der Varianzanalyse) FBB-ANG Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen FBB-ANG – TREN FBB-ANG – Skala Trennungsangst FBB-ANG – GEN FBB-ANG – Skala Generalisierte Angst FBB-ANG – SOZ FBB-ANG – Skala Soziale Phobie FBB-ANG – SPEZ FBB-ANG – Skala Spezifische Phobie FBB-ANG – ANG FBB-ANG – Gesamtskala Angststörungen FBB-DES Fremdbeurteilungsbogen Depressive Störungen FBB-DES – DEP FBB-DES – Skala Depressive Symptome FBB-DES – SOM FBB-DES – Skala Somatisches Syndrom FBB-DES – DYS FBB-DES – Skala Dysthymia (nach ICD-10) FBB-DES – DYST FBB-DES – Skala Dysthyme Störung (nach DSM-IV) FBB-DES – DES FBB-DES – Gesamtskala Depressive Störungen ICC Intraklassen-Korrelationskoeffizient g Maß für die Effektstärke bei Mittelwertsvergleichen mit t-Tests für
unabhängige bzw. abhängige Stichproben (nach Hedges) ICD-10 Internationale Klassifikation Psychischer Störungen IG Interventionsgruppe IQ Intelligenzquotient KG (Warte-)Kontrollgruppe LSL Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten LSL – KOOP LSL – Skala Kooperation LSL – WAHR LSL – Skala Selbstwahrnehmung LSL – KONT LSL – Skala Selbstkontrolle LSL – HILF LSL – Skala Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft
Abkürzungsverzeichnis VI
LSL – BEHA LSL – Skala Angemessene Selbstbehauptung LSL – SOZI LSL – Skala Sozialkontakt M Mittelwert N Stichprobenumfang (Gesamtstichprobe) n Stichprobenumfang (Teilstichprobe) n. s. nicht signifikant
p2 Partielles Eta-Quadrat; Maß für die Effektstärke bei Mittel-
wertsvergleichen mit Varianzanalysen MZP Messzeitpunkt p Signifikanzniveau PR Prozentrang r Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient (nach Pearson) SASC-R-D Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version SASC-R-D – FNE SASC-R-D – Skala „Furcht vor negativer Bewertung” SASC-R-D – SAD SASC-R-D – Skala „Vermeidung von und Belastung durch soziale
Situationen“ SD Standardabweichung t Prüfgröße des t-Tests für unabhängige und abhängige Stichproben TSUK Training mit sozial unsicheren Kindern t1 1. Messzeitpunkt t2 2. Messzeitpunkt t3 3. Messzeitpunkt t4 4. Messzeitpunkt z Prüfgröße des Mann-Whitney-U-Tests und des Wilcoxon-Tests
Tabellenverzeichnis VII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Störung mit Trennungsangst nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 194 f) und DSM-IV-TR (APA, 2003, S. 160) ......................................................................................................... 18
Tabelle 2: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Sozialen Phobie nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 116 f.) und DSM-IV (APA, 2003, S. 507 f.) .................... 22
Tabelle 3: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Generalisierten Angststörung des Kindesalters nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 197 f.) und DSM-IV (APA, 2003, S. 528 f.) ..................................................................................... 24
Tabelle 4: Prävalenzraten für ausgewählte Angststörungen des Kindes- und Jugendalters in verschiedenen deutschen Studien (Angaben in Prozent) (modifiziert nach Schneider & In-Albon, 2010, S. 527) ............................................ 26
Tabelle 5: Typische Ängste und mögliche Angststörungen bei Kindern und Jugend-lichen im Entwicklungsverlauf (modifiziert nach Schneider, 2004a, S. 10) ............ 44
Tabelle 6: Selbstbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen (modifiziert nach In-Albon, 2011, S. 86 f.) ............ 48
Tabelle 7: Fremdbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen (modifiziert nach In-Albon, 2011, S. 89 f.) .................................................................................................................... 50
Tabelle 8: Therapiemanuale für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter ........................ 72
Tabelle 9: Therapiemanuale mit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ausrichtung zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter im deutschen Sprachraum ....................................................................................................................... 74
Tabelle 10: Wirksamkeitsstudien zu kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapiemanualen für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter im deutschen Sprachraum .................................................................................................... 76
Tabelle 11: Überblick über die Module des Einzeltrainings mit den Kindern: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b) .......................................................................................................... 88
Tabelle 12: Überblick über die Module des Gruppentrainings mit den Kindern: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b) .......................................................................................................... 89
Tabelle 13: Überblick über die Module der Eltern- bzw. Familienberatung: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b) ................................................................................................................................ 92
Tabelle 14: Übersicht über mögliche Phasen eines Ausblendungsdesigns (entnommen aus Petermann & Petermann, 2006b, S. 265) .............................................................. 93
Tabellenverzeichnis VIII
Tabelle 15: Untersuchungen zur Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) .............................................................. 97
Tabelle 16: Studiendesign ................................................................................................................. 103
Tabelle 17: Studiendesign mit allen Erhebungsinstrumenten ..................................................... 106
Tabelle 18: Zeitlicher Ablauf der Trainingsdurchführung ........................................................... 110
Tabelle 19: Items der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) .................................................................................................................... 115
Tabelle 20: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe und Prüfung von Mittelwertsunterschieden zwischen Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe ..................................................................................................... 121
Tabelle 21: Psychische Auffälligkeiten der Stichprobe (gemäß CBCL/4-18) und Prüfung von Mittelwertsunterschieden zwischen Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe ..................................................................................................... 122
Tabelle 22: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinder-urteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) ................................................................................... 128
Tabelle 23: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinder-urteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) ..................................................................................................... 129
Tabelle 24: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Eltern-urteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) ...................................................................................... 131
Tabelle 25: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Eltern-urteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG).................................................................................................................... 132
Tabelle 26: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) ............................................................................. 135
Tabelle 27: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianz-analysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) ............................................................................. 136
Tabelle 28: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrer-urteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) ...................................................................................... 137
Tabelle 29: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrer-urteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG).................................................................................................................... 138
Tabellenverzeichnis IX
Tabelle 30: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozial-verhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) ................................................................................. 139
Tabelle 31: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozial-verhaltens im Lehrerurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) ...................................................................................................... 140
Tabelle 32: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinder-urteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe ................................. 143
Tabelle 33: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe .................................................... 144
Tabelle 34: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe ...................................... 147
Tabelle 35: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe ................................................................... 148
Tabelle 36: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventionsgruppe ............................. 151
Tabelle 37: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) ............................................................................. 152
Tabelle 38: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe ...................................... 154
Tabelle 39: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe ................................................................... 155
Tabelle 40: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozial-verhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe ................................. 156
Tabelle 41: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zum schulbezogenen Sozialverhalten im
Tabellenverzeichnis X
Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe ...................................................... 157
Tabelle 42: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter, Intelligenz und Depressivität der Kinder ................................................................... 163
Tabelle 43: Einfluss verschiedener Merkmale auf die Reduktion der Angstsymptomatik aus Sicht der Eltern gemessen mit den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) - Ergebnisse der univariaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen ...................................................... 165
Tabelle 44: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Kinder- und Elternurteil zum ersten Messzeitpunkt a .................................................................................................. 167
Tabelle 45: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Eltern- und Lehrerurteil zum ersten Messzeitpunkt a .................................................................................................. 168
Tabelle 46: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Kinder- und Lehrerurteil zum ersten Messzeitpunkt a .................................................................................................. 168
Tabelle 47: Retrospektive Beurteilung des Trainings durch die Eltern der Interventionsgruppe – Häufigkeitsangaben (Prozentangaben in Klammern) ...... 169
Abbildungsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Integratives Modell für die Entwicklung einer Angststörung im Kindes- und Jugendalter (nach Lyneham & Rapee, 2004; zitiert nach In-Albon, 2011, S. 70) .................................................................................................................. 41
Abbildung 2: Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten in der Gesamtstichprobe – Erfassung mittels CBCL/4-18 (unter Verwendung von Cut-off-Werten für klinische Auffälligkeit) ....................................................................................... 122
Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Diagnosen (nach ICD-10), getrennt nach Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe .................................................. 123
Abbildung 4: Mittelwerte der Angstsymptomatik im Elternurteil vor und nach dem Training auf der Skala „Soziale Phobie“ (links) und auf der Gesamtskala „Angststörungen“ (rechts) des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) ................................................................................. 133
Abbildung 5: Mittelwerte des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil vor und nach dem Training auf den Skalen „Kooperation“ (links) und „Selbstkontrolle“ (rechts) der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) ................................................................................................. 141
Abbildung 6: Verlauf der Mittelwerte im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe ................................................................................................ 144
Abbildung 7: Verlauf der Mittelwerte im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe ................................................................................................ 148
Abbildung 8: Verlauf der Mittelwerte im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventionsgruppe ................................................................................................ 151
Abbildung 9: Verlauf der Mittelwerte zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe .............................................................. 154
Abbildung 10: Verlauf der Mittelwerte des Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe ..................................................................................... 157
1 Einleitung 12
1 Einleitung
Angst ist ein grundlegendes Gefühl, das jeder Mensch kennt. Angst tritt in Situationen auf,
die als bedrohlich, gefährlich und/oder nicht bewältigbar erlebt werden. Obwohl Angst fast
immer als unangenehm erlebt wird, ist sie nicht gefährlich. Ein gewisses Maß an Angst
kann sogar sinnvoll und nützlich sein, um Gefahren (z. B. im Straßenverkehr durch ein
entgegenkommendes Auto) rechtzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Ängste sind weit verbreitet und gehören zur normalen Entwicklung eines Kindes oder
Jugendlichen dazu. Fast alle Kinder oder Jugendlichen einer Altersstufe zeigen normale,
entwicklungsphasentypische Ängste (z. B. die Angst vor der Trennung von den Bezugs-
personen im Alter von 6 bis 12 Monaten). In der Regel sind diese altersspezifischen Ängste
vergleichsweise mild und gehen nach einiger Zeit wieder vorüber.
Doch etwa 5 % der Kinder und Jugendlichen weisen übermäßig stark ausgeprägte, lang
anhaltende Ängste auf, die die schulische Leistungsfähigkeit und die sozialen Beziehungen
nachhaltig beeinträchtigen (Ravens-Sieberer et al., 2008). So zeigen die betroffenen Kinder
und Jugendlichen schlechtere Schulleistungen (Mychailyszyn, Mendez & Kendall, 2010),
haben weniger Kontakte zu gleichaltrigen Kindern und sind weniger in alterstypische
soziale Aktivitäten eingebunden (Melfsen & Warnke, 2004). Zudem gehen soziale Ängste
häufig auch mit einem geringeren Selbstwertgefühl einher.
Mia (9 Jahre) besucht seit ein paar Monaten die 4. Klasse der Grundschule. Sie beteiligt sich schon lange nicht mehr freiwillig am Unterricht. Die meiste Zeit des Schultages hat Mia Angst davor, von ihrer Lehrerin aufgerufen zu werden. Sie befürchtet, eine falsche oder dumme Antwort zu geben und von ihren Mitschülern ausgelacht zu werden. Im Unterricht spricht Mia so leise, dass keiner sie versteht, nicht einmal ihre Sitznachbarin. In den meisten Pausen steht Mia alleine auf dem Schulhof und sieht den anderen Mädchen beim Seilspringen zu. Anfangs haben die Mädchen sie noch gefragt, ob sie mitmachen will. Doch weil sie immer ablehnt, wird sie inzwischen nicht einmal mehr gefragt. Wenn ihre einzige Freundin am Nachmittag keine Zeit zum Spielen hat, zieht sie sich zu Hause in ihr Zimmer zurück und liest ein Kinderbuch. Sie hat Angst davor, ein Mädchen aus der Nachbarschaft zum Spielen einzuladen, weil es die Einladung ausschlagen könnte. Obwohl Mia sehr gern tanzt, hat sie es bisher nicht geschafft, sich einer Ballettgruppe anzuschließen, weil sie den Kontakt mit ihr unbekannten Kindern scheut.
1 Einleitung 13
Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugend-
alter und stellen – auch wegen ihres frühen Störungsbeginns und ihres stabilen Verlaufs –
einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen im
Erwachsenenalter dar. Obwohl die internationale Forschung in den letzten Jahren gezeigt
hat, dass Angststörungen mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen erfolg-
reich behandelt werden können, erhalten die betroffenen Kinder und Jugendlichen häufig
keine adäquate Behandlung. Das Ziel muss daher sein, Angststörungen bei Kindern und
Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und wirksam zu behandeln, um bereits bestehende
Störungen zu beseitigen und mögliche weitere Störungen zu verhindern.
Im deutschsprachigen Raum war Ulrike Petermann im Jahr 1983 eine der ersten Wissen-
schaftlerinnen, die ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Programm zur Behandlung von
sozialen Ängsten im Kindes- und Jugendalter entwickelt und veröffentlicht hat. Mit dem
„Training mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) liegt ein viel-
versprechendes Behandlungskonzept vor, das bereits seit vielen Jahren in der psychothera-
peutischen Versorgung erfolgreich eingesetzt wird. Dabei ist das „Training mit sozial unsi-
cheren Kindern“ das einzige Trainingsprogramm im deutschsprachigen Raum, das Einzel-
und Gruppentherapie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen
kombiniert. Die Wirksamkeit dieses Trainingsprogramms wurde jedoch bisher nur mit ein-
zelfallbezogenen Untersuchungen bestätigt. Einzelfallstudien haben gegenüber Gruppen-
studien den Nachteil, dass die beobachteten Veränderungen nicht eindeutig auf das
Training zurückgeführt (geringere interne Validität) und nicht sicher für andere Patienten1
Die weitere Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: In Kapitel 2 werden die theoretischen
Grundlagen der vorliegenden Arbeit umfassend dargestellt. So werden die einzelnen
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter ausführlich beschrieben (Abschnitt 2.1),
verschiedene Ursachen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen
verallgemeinert (geringere externe Validität) werden können. Aus diesem Grund wurde die
generelle und differentielle Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“
(Petermann & Petermann, 2006b) im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstmals mit einer
randomisierten Kontrollgruppenstudie überprüft.
1 Die männliche Form wird in der vorliegenden Arbeit als grammatikalische Neutralität verstanden und daher
durchgehend verwendet, sofern ein Begriff nicht ausschließlich auf das weibliche Geschlecht zutrifft; zur Vereinfachung sind mit der männlichen Form grundsätzlich beide Geschlechter angesprochen.
1 Einleitung 14
vorgestellt (Abschnitt 2.2) und geeignete Methoden zur Diagnostik von Angststörungen
aufgezeigt (Abschnitt 2.3). Darüber hinaus wird ein aktueller Überblick über empirisch
überprüfte Verfahren, Methoden und Programme zur Behandlung von Angststörungen im
Kindes- und Jugendalter gegeben (Abschnitt 2.4). In Kapitel 3 wird das „Training mit
sozial unsicheren Kindern” (Petermann & Petermann, 2006b) vorgestellt, dessen Wirksam-
keit im Rahmen der vorliegenden Arbeit überprüft wird. In diesem Kapitel werden der
Aufbau (Abschnitt 3.1) und die Inhalte (Abschnitt 3.2) des kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Trainingsprogramms für sozial ängstliche Kinder und deren Eltern bzw. Fami-
lien beschrieben und die Ergebnisse aus bisher durchgeführten Einzelfallstudien zur Wirk-
samkeit des Trainings (Abschnitt 3.3) zusammenfassend dargestellt. Aus den theoretischen
Grundlagen wird in Kapitel 4 zunächst die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung
hergeleitet; anschließend werden die aus der Fragestellung resultierenden Hypothesen for-
muliert. Die Wirksamkeit des Trainings wird mit einem (Warte-)Kontrollgruppendesign
überprüft, dessen methodische Umsetzung in Kapitel 5 erläutert wird. Dabei werden nach-
einander das gewählte Studiendesign (Abschnitt 5.1), der geplante Untersuchungsablauf
(Abschnitt 5.2), die verwendeten Erhebungsinstrumente (Abschnitt 5.3), die rekrutierte
Stichprobe (Abschnitt 5.4) und die eingesetzten statistischen Auswertungsverfahren (Ab-
schnitt 5.5) ausführlich beschrieben. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung dargestellt und interpretiert. Dabei wird schwerpunktmäßig auf die kurz-
und langfristigen Effekte des Trainingsprogramms (Abschnitte 6.1 und 6.2) eingegangen.
In weiteren Abschnitten wird über die differentiellen Effekte des Trainingsprogramms
(Abschnitt 6.3), den Grad der Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beurteilern
(Kinder, Eltern, Lehrer) (Abschnitt 6.4) und die Rückmeldungen der Eltern zur Zufrieden-
heit mit den erzielten Trainingserfolgen (Abschnitt 6.5) berichtet. In Kapitel 7 werden die
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zusammengefasst und unter Berücksichtigung
der aktuellen Ergebnisse vergleichbarer Studien diskutiert (Abschnitt 7.1). Zudem werden
einerseits die methodischen Schwächen der Arbeit kritisch reflektiert, andererseits die
methodischen Stärken gewürdigt (Abschnitt 7.2) und erörtert, wie die Untersuchungs-
ergebnisse für Forschung und Praxis genutzt werden können (Abschnitt 7.3). Den Ab-
schluss der vorliegenden Arbeit bildet die Zusammenfassung in Kapitel 8.
2 Theorie 15
2 Theorie
2.1 Darstellung von Angststörungen im Kindesalter
2.1.1 Klinisches Erscheinungsbild und Klassifikation
Der Begriff „Soziale Unsicherheit“ wird von Petermann und Petermann (2006b, S. 3) für
Verhaltensweisen verwendet, „die sich auf Trennungsängste, soziale Ängste, soziale
Phobien und generalisierte Ängste beziehen“. Die Autoren des „Trainings mit sozial
unsicheren Kindern“ haben damit „eine verhaltensnahe Sammelbezeichnung gewählt, die
verschiedene Ängste einschließt, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit
sozialen Situationen stehen“. Demzufolge fasst der Begriff die im Kindes- und Jugendalter
wichtigsten Angststörungen zusammen: die Emotionale Störung mit Trennungsangst des
Kindesalters, die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters bzw. die Soziale
Phobie und die Generalisierte Angststörung des Kindesalters.
Die Internationale Klassifikation Psychischer Störungen (ICD-10; WHO, 2010, 2011) und das
Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM-IV-TR; APA, 2000, deutsch:
2003) sind die beiden wichtigsten Klassifikationssysteme für psychische Störungen im
Kindes- und Jugendalter. Die aktuellen Versionen beider Klassifikationssysteme stimmen
in großen Teilen überein und unterscheiden sich nur in wenigen Einzelheiten. Beide Klassi-
fikationssysteme haben eigene Abschnitte für die im Kindes- und Jugendalter beginnenden
psychischen Störungen. Dennoch gibt es keine eindeutige Trennung zwischen Störungen
bei Kindern und Jugendlichen einerseits und Erwachsenen andererseits. In der ICD-10
werden die Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F93.0), die Störung
mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2) und die Generalisierte Angststörung des
Kindesalters (F93.80) als Störungen des Kindes- und Jugendalters betrachtet. Allerdings
wird die Generalisierte Angststörung des Kindesalters nicht in den klinisch-diagnostischen
Leitlinien (WHO, 2010), sondern nur in den Forschungskriterien (WHO, 2011) aufgeführt.
Zusätzlich können Kinder und Jugendliche – wenn nötig – aber auch die Diagnose einer
Angststörung des Erwachsenenalters (z. B. F40.1 Soziale Phobie) erhalten. Im DSM-IV-TR
ist die Störung mit Trennungsangst (309.21) die einzige Angststörung, die den Störungen
2 Theorie 16
des Kindes- und Jugendalters zugeordnet wird. Alle anderen Angststörungen (z. B. 300.23
Soziale Phobie; 300.02 Generalisierte Angststörung) können sowohl auf Kinder und
Jugendliche als auch auf Erwachsene angewendet werden. In den entsprechenden Katego-
rien des DSM-IV-TR wird jedoch auf alters- bzw. entwicklungsspezifische Besonderheiten
bei Kindern und Jugendlichen hingewiesen.
Ausgehend von der von Petermann und Petermann (2006b) gewählten Definition sozialer
Unsicherheit werden nachfolgend die vier Angststörungen (des Kindes- und Jugendalters)
entsprechend den diagnostischen Kriterien des Klassifikationssystems ICD-10 beschrieben.
Darüber hinaus werden die Klassifikationskriterien von ICD-10 und DSM-IV-TR für die
einzelnen Angststörungen einander tabellarisch gegenübergestellt und wesentliche Unter-
schiede zwischen beiden Klassifikationssystemen durch kursive Schrift hervorgehoben.
Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (ICD-10: F93.0; DSM-IV-TR: 309.21)
Die Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters zeigt sich in einer übermäßig
stark ausgeprägten Angst vor der Trennung von wichtigen Bezugspersonen (z. B. Eltern,
Großeltern). Für die Diagnose einer Trennungsangst nach ICD-10 (WHO, 2011) müssen
mindestens drei der folgenden acht Kriterien erfüllt sein: (1) Die betroffenen Kinder
äußern die unrealistische Befürchtung, dass den Bezugspersonen etwas zustoßen könnte
(z. B. Krankheit, Unfall, Tod) oder dass die Bezugspersonen weggehen und nicht wieder-
kommen könnten. (2) Sie zeigen die unrealistische Besorgnis darüber, dass sie durch ein
Unglück dauerhaft von den Bezugspersonen getrennt werden könnten, beispielsweise dass
sie verloren gehen oder entführt werden könnten. (3) Aufgrund dieser anhaltenden, unan-
gemessenen Sorgen vermeiden die betroffenen Kinder Trennungssituationen: Sie bleiben
weder allein noch ohne eine wichtige Bezugsperson zu Hause oder in einem anderen Um-
feld. (4) Aus Angst vor der Trennung von den Bezugspersonen (und nicht aus Angst vor
bestimmten Ereignissen im Kindergarten bzw. in der Schule) zeigen diese Kinder die
andauernde Abneigung oder Weigerung, in den Kindergarten bzw. in die Schule zu gehen.
(5) Die Trennungsangst dieser Kinder ist auch am Abend erkennbar, und zwar daran, dass
die Kinder die anhaltende Abneigung oder Weigerung zeigen, am Abend ohne die Anwe-
senheit oder Nähe einer wichtigen Bezugsperson schlafen zu gehen, dass sie nachts häufig
aufstehen, um sich von der Anwesenheit der Bezugspersonen zu überzeugen und/oder um
bei den Bezugspersonen zu schlafen oder dass sie die andauernde Abneigung oder Weige-
2 Theorie 17
rung zeigen, auswärts zu übernachten (z. B. Klassenfahrten, Ferienfahrten, Urlaub). (6) Die
von Trennungsangst betroffenen Kinder klagen wiederholt über Alpträume, in denen ihre
Trennungsängste zum Ausdruck kommen. (7) Das übermäßig starke Leiden dieser Kinder
kann sich vor, während oder nach der Trennung von wichtigen Bezugspersonen äußern,
beispielsweise in Form von Anklammern, Weinen, Schreien, Wutausbrüchen, Passivität,
Rückzug oder in der Weigerung, das Haus zu verlassen bzw. in dem Wunsch, nach Hause
zurückzukehren. (8) Bei einer bevorstehenden oder stattfindenden Trennung von wichtigen
Bezugspersonen treten bei trennungsängstlichen Kindern wiederholt körperliche
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen auf.
Nach ICD-10 (WHO, 2011) muss die Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kin-
desalters vor dem 6. Lebensjahr beginnen und mindestens 4 Wochen andauern. Sie darf
nicht Teil einer Generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80) sein. Eine Emotio-
nale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters sollte nur diagnostiziert werden, wenn
sie nicht im Rahmen einer umfassenderen Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens
oder der Persönlichkeit oder im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer
psychotischen Störung oder einer substanzbedingten Störung auftritt.
Die Diagnosekriterien des DSM-IV-TR (APA, 2000, deutsch 2003) für die „Störung mit
Trennungsangst“ unterscheiden sich von denen der ICD-10 (WHO, 2011) nicht wesentlich
(vgl. Tabelle 1). Unterschiede zwischen den beiden Klassifikationssystemen beziehen sich
vor allem auf den Beginn der Störung. Für die Vergabe einer Diagnose nach DSM-IV-TR
muss die Störung vor dem 18. Lebensjahr beginnen, während die ICD-10 einen Störungs-
beginn vor dem 6. Lebensjahr fordert. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die
Störung mit Trennungsangst und die Panikstörung mit Agoraphobie im DSM-IV-TR, im
Gegensatz zur ICD-10, nicht gleichzeitig diagnostiziert werden dürfen. Bei Jugendlichen
und Erwachsenen sollte die Störung mit Trennungsangst nur dann diagnostiziert werden,
wenn sie nicht besser durch eine Panikstörung mit Agoraphobie erklärt werden kann.
2 Theorie 18
Tabelle 1: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Störung mit Trennungs-angst nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 194 f) und DSM-IV-TR (APA, 2003, S. 160)
ICD-10: F93.0 DSM-IV-TR: 309.21
A Mindestens 3 der folgenden Kriterien: 1. unrealistische und anhaltende Besorgnis über
mögliches Unheil, das den Bezugspersonen zustoßen könnte oder über den möglichen Verlust oder Tod der Bezugspersonen
2. unrealistische und anhaltende Besorgnis, dass ein unglückliches Ereignis das Kind von den Bezugspersonen trennen könnte
3. andauernde Abneigung oder Verweigerung, die Schule zu besuchen
4. Trennungsschwierigkeiten am Abend: a. anhaltende Abneigung oder Weigerung,
ohne die Anwesenheit oder Nähe einer Bezugsperson schlafen zu gehen
b. häufiges nächtliches Aufstehen, um die Anwesenheit der Bezugspersonen zu über-prüfen oder um bei ihnen zu schlafen
oder
c. anhaltende Abneigung oder Weigerung, auswärts zu schlafen
oder
5. unangemessene und anhaltende Angst davor, allein zu sein oder tagsüber ohne die Bezugs-personen zu Hause zu sein
6. wiederholte Alpträume zu Trennungsthemen 7. wiederholtes Auftreten somatischer Symptome
in Trennungssituationen: Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
8. extremes und wiederholtes Leiden vor, während oder
nach einer Trennung von den Bezugspersonen (z. B. Angst, Schreien, Wutausbrüche, Rückzug)
A Mindestens 3 der folgenden Kriterien: 1. wiederholter übermäßiger Kummer bei einer möglichen
oder tatsächlichen Trennung von zu Hause oder von den Bezugspersonen
2. andauernde und übermäßige Besorgnis, dass das Kind die Bezugspersonen verlieren könnte oder dass den Bezugspersonen etwas zustoßen könnte
3. andauernde und übermäßige Besorgnis, dass ein Unglück das Kind von den Bezugs-personen trennen könnte
4. andauernder Widerwillen oder Weigerung, zur Schule oder an einen anderen Ort zu gehen
6. a. andauernder Widerwillen oder Weigerung,
ohne die Nähe der Bezugspersonen schlafen zu gehen oder
b. andauernder Widerwillen oder Weigerung, auswärts zu übernachten
5. ständige und übermäßige Furcht oder Abneigung, allein oder ohne Bezugspersonen zu Hause oder ohne wichtige Erwachsene in einem anderen Umfeld zu bleiben
7. wiederholte Alpträume von Trennungen 8. wiederholtes Klagen über körperliche
Beschwerden in Trennungssituationen: Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
B Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80)
C Beginn vor dem 6. Lebensjahr C Beginn vor dem Alter von 18 Jahren
D Störung verursacht klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
D Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenderen Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit auf Störung tritt nicht im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psychotischen Stö-rung oder einer substanzbedingten Störung auf
E Störung tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder einer psychotischen Störung auf Störung kann nicht durch eine Panikstörung mit Agoraphobie besser erklärt werden
E Dauer mindestens 4 Wochen B Dauer mindestens 4 Wochen
Bestimme, ob: Früher Beginn vor dem Alter von 6 Jahren
Anmerkung: Unterschiede zwischen den beiden Klassifikationssystemen sind kursiv hervorgehoben.
2 Theorie 19
Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (ICD-10: F93.2)
Die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters ist durch eine übermäßig stark aus-
geprägte Angst vor fremden Personen gekennzeichnet. Für die Diagnose einer Sozialen
Ängstlichkeit nach ICD-10 (WHO, 2011) müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein: Die
betroffenen Kinder zeigen eine anhaltende Angst in sozialen Situationen, in denen sie auf
fremde gleichaltrige Kinder und/oder fremde Erwachsene treffen. Diese Kinder meiden
oder verweigern Situationen, die einen Kontakt mit unbekannten Personen erwarten lassen
(z. B. Spielplatz, Geburtstagsfeier, Sportverein). Sie zeigen Befangenheit, Verlegenheit oder
übertriebene Sorge darüber, ob ihr Verhalten fremden Personen gegenüber angemessen ist.
Können die betroffenen Kinder den angstauslösenden Situationen nicht entfliehen, ist ihr
Unglücklichsein und Leiden an folgenden Verhaltensweisen deutlich erkennbar: Sie weinen,
schweigen, erstarren, weichen aus oder ziehen sich zurück. Infolgedessen sind ihre sozialen
Beziehungen zu und Aktivitäten mit gleichaltrigen Kindern und/oder Erwachsenen deut-
lich beeinträchtigt und verringert. Gleichzeitig haben diese Kinder jedoch befriedigende
soziale Beziehungen zu den Familienmitgliedern (z. B. Eltern, Großeltern, Geschwister)
und zu gut bekannten gleichaltrigen Kindern (z. B. Freund/in).
Nach ICD-10 (WHO, 2011) muss die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
vor dem 6. Lebensjahr beginnen und mindestens 4 Wochen andauern. Sie darf nicht mit
einer Generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80) einhergehen. Eine Störung
mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters sollte nur diagnostiziert werden, wenn sie nicht
im Rahmen einer umfassenderen Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens oder der
Persönlichkeit oder im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psycho-
tischen Störung oder einer substanzbedingten Störung auftritt.
Im DSM-IV-TR (APA, 2000, deutsch: 2003) gibt es keine Diagnose, die der Störung mit
sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters entspricht. Die in DSM-III (APA, 1980, deutsch:
1984) und DSM-III-R (APA, 1987, deutsch: 1989) aufgeführte „Störung mit Kontaktver-
meidung“ wurde mit der Einführung des DSM-IV (APA, 1994, deutsch: 1996) aufgegeben.
Seitdem wird eine bei Kindern und Jugendlichen auftretende Angst vor unbekannten Per-
sonen als „Soziale Phobie“ (300.23) diagnostiziert.
2 Theorie 20
Soziale Phobie (ICD-10: F40.1; DSM-IV-TR: 300.23)
Die Soziale Phobie besteht in einer übermäßig stark ausgeprägten Angst, der Aufmerksam-
keit und Bewertung anderer Personen in verhältnismäßig kleinen Gruppen (nicht dagegen
in Menschenmengen) ausgesetzt zu sein. Für die Diagnose einer Sozialen Phobie nach
ICD-10 (WHO, 2011) müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein: Die betroffenen Kinder
zeigen entweder deutliche Angst vor und/oder deutliches Vermeidungsverhalten in Situati-
onen, in denen die Aufmerksamkeit anderer Personen auf sie gerichtet ist oder sie befürch-
ten, ein Verhalten zu zeigen, das sie als peinlich oder erniedrigend empfinden und/oder
vermeiden Situationen, in denen sie befürchten, dass sie sich blamieren oder bloßstellen
könnten. Die Ängste dieser Kinder sind meist auf bestimmte soziale Situationen begrenzt,
wie beispielsweise das Essen, Trinken, Schreiben oder Sprechen in der Öffentlichkeit, die
Begegnung mit Bekannten in der Öffentlichkeit, die Teilnahme an Feiern oder das Halten
von Referaten vor der Klasse. Sie können sich jedoch auf fast alle sozialen Situationen
außerhalb der Familie ausdehnen. Seit dem Auftreten der Störung müssen die sozial phobi-
schen Kinder in den gefürchteten Situationen mindestens einmal zwei der folgenden vier-
zehn körperlichen Symptome erlebt haben, wobei auch eines der ersten vier Symptome
aufgetreten sein muss: (1) Palpitationen, Herzklopfen oder Herzrasen, (2) Schweißaus-
brüche, (3) Tremor, (4) Mundtrockenheit, (5) Atembeschwerden, (6) Beklemmungsgefühl,
(7) Missempfindungen oder Schmerzen im Brustkorb, (8) Übelkeit oder Unruhegefühl im
Magen, (9) Gefühl von Schwindel, Schwäche oder Benommenheit, (10) Gefühl, dass die
Dinge um einen herum unwirklich sind (Derealisation) oder dass man selbst weit entfernt
oder „nicht wirklich hier“ ist (Depersonalisation), (11) Angst vor Kontrollverlust oder
Angst, verrückt zu werden, (12) Angst zu sterben, (13) Hitzewallungen oder Kälteschauer
oder (14) Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle. Zusätzlich muss mindestens eines von drei
für die Soziale Phobie spezifischen Symptomen vorhanden sein: (1) Erröten oder Zittern,
(2) Angst vor Erbrechen oder (3) (Angst vor) Miktions- oder Defäkationsdrang. Die von
Sozialer Phobie betroffenen Kinder erleben die Angstsymptome und/oder das Vermei-
dungsverhalten als deutliche emotionale Belastung. Sie erkennen, dass die Angstsymptome
und/oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind. Die auftretenden
Symptome beschränken sich ausschließlich oder überwiegend auf die gefürchteten Situati-
onen oder auf Gedanken an diese Situationen.
2 Theorie 21
In der ICD-10 (WHO, 2011) gibt es für die Diagnose einer Sozialen Phobie keine Kriterien
bezüglich Beginn und Mindestdauer der Störung. Eine Soziale Phobie sollte nur dann
diagnostiziert werden, wenn die Angst und das Vermeidungsverhalten nicht auf Wahn-
gedanken, Halluzinationen oder andere Symptome einer organischen psychischen Störung,
einer psychotischen Störung, einer affektiven Störung oder einer Zwangsstörung zurückzu-
führen sind. Weiterhin sollte diese Diagnose nur vergeben werden, wenn die beiden
Hauptmerkmale der Störung nicht Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung sind.
Die Diagnosekriterien des DSM-IV-TR (APA, 2000, deutsch: 2003) stimmen weitgehend
mit denen der ICD-10 (WHO, 2011) überein (vgl. Tabelle 2). Ein entscheidender Unter-
schied zwischen den beiden Klassifikationssystemen besteht darin, dass die körperlichen
Angstsymptome im DSM-IV-TR kein verbindliches Kriterium für die Diagnose der Sozia-
len Phobie darstellen. Allerdings erlaubt das DSM-IV-TR im Gegensatz zur ICD-10 eine
Differenzierung in einen spezifischen Subtypen (= Angst in einer oder mehreren sozialen
Situationen) und einen generalisierten Subtypen (= Angst in fast allen sozialen Situationen).
Mit der Einführung des DSM-IV (APA, 1994, deutsch: 1996) wurde die kindspezifische
„Störung mit Kontaktvermeidung“ in die Diagnose der „Sozialen Phobie“ überführt. In
diesem Zusammenhang wurden Besonderheiten des Störungsbildes im Kindes- und
Jugendalter spezifiziert. Für die Vergabe einer Diagnose nach DSM-IV-TR muss die Angst
nicht nur in Gegenwart von Erwachsenen, sondern auch im Kontakt mit gleichaltrigen
Kindern auftreten. Im Kindesalter kann sich die Angst auch durch Weinen, Wutanfälle,
Passivität und Rückzug aus sozialen Situationen äußern. Im Unterschied zur ICD-10
fordert das DSM-IV-TR nicht, dass Kinder ihre Angst als übertrieben und unbegründet
einschätzen. Dagegen verlangt das DSM-IV-TR, dass die Symptome bei Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren mindestens 6 Monate andauern, bevor eine Soziale Phobie
diagnostiziert wird.
Generalisierte Angststörung des Kindesalters (ICD-10: F93.80; DSM-IV-TR: 300.02)
Die Generalisierte Angststörung des Kindesalters bezieht sich auf übermäßig stark ausge-
prägte Ängste über verschiedenste Situationen und Lebensbereiche hinweg. Für die Diag-
nose einer Generalisierten Angststörung nach ICD-10 (WHO, 2011) müssen die folgenden
Kriterien erfüllt sein: Die betroffenen Kinder zeigen intensive Ängste und Sorgen im Hin-
blick auf alltägliche Ereignisse und Aktivitäten, die sich im Zusammenhang mit schulischen
2 Theorie 22
Tabelle 2: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Sozialen Phobie nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 116 f.) und DSM-IV (APA, 2003, S. 507 f.)
ICD-10: F40.1 DSM-IV-TR: 300.23
A Entweder 1. oder 2.: 1. deutliche Furcht im Zentrum der Aufmerk-
samkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
2. deutliche Vermeidung im Zentrum der Auf-merksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten
A Ausgeprägte und anhaltende Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungs-situationen, in denen die Person mit unbekannten Personen konfrontiert ist oder von anderen Personen beurteilt werden könnte Betroffener befürchtet, ein Verhalten zu zeigen, das demütigend oder peinlich sein könnte BBeachte: Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass sie im Umgang mit bekannten Personen über die alters-entsprechende soziale Kompetenz verfügen, und die Angst muss gegenüber Gleichaltrigen und nicht nur in der Interaktion mit Erwachsenen auftreten.
D Gefürchtete soziale oder Leistungssituationen werden vermieden oder nur unter intensiver Angst oder Unwohlsein ertragen
B Mindestens 2 Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit Auftreten der Störung, wie in F40.0, Kriterium B, definiert, sowie zusätzlich mindestens 1 der folgenden Symptome: 1. Erröten oder Zittern 2. Angst zu erbrechen 3. (Angst vor) Miktions- oder Defäkationsdrang
B Konfrontation mit der gefürchteten sozialen Situation ruft fast immer eine unmittelbare Angstreaktion hervor, die das Erscheinungsbild einer situationsgebundenen oder einer situati-onsbegünstigten Panikattacke annehmen kann BBeachte: Bei Kindern kann sich die Angst durch Weinen, Wutanfälle, Erstarren oder Zurückweichen von sozialen Situationen mit unvertrauten Personen ausdrücken.
C Einsicht, dass Symptome oder Vermeidungs-verhalten übertrieben und unvernünftig sind Deutliche emotionale Belastung durch Angst-symptome oder Vermeidungsverhalten
C Person erkennt, dass die Angst übertrieben und unbegründet ist BBeachte: Bei Kindern darf dieses Kriterium fehlen.
E Vermeidungsverhalten, ängstliche Erwartungs-haltung oder starkes Unbehagen in den gefürchteten sozialen oder Leistungssituationen beeinträchtigen deutlich die normale Lebens-führung der Person, ihre berufliche Leistung oder soziale Aktivitäten oder Beziehungen, oder die Phobie verursacht erhebliches Leiden
D Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder auf Gedanken an diese
E Symptome der Kriterien A und B sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, psychotische Störungen, affektive Störungen oder Zwangs-störungen oder sind nicht Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung
G H
Angst oder Vermeidung geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück und kann nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden Falls ein medizinischer Krankheitsfaktor oder eine andere psychische Störung vorliegen, so stehen diese nicht im Zusammenhang mit der unter Kriterium A beschriebenen Angst
F Dauer mindestens 6 Monate bei Personen unter 18 Jahren
Bestimme, ob: Generalisiert: Angst in fast allen sozialen Situationen
Anmerkung: Unterschiede zwischen den beiden Klassifikationssystemen sind kursiv hervorgehoben.
2 Theorie 23
Angelegenheiten (z. B. Blackout bei einer Klassenarbeit) sowie familiären und freund-
schaftlichen Beziehungen (z. B. Verspätung bei einer Verabredung) ergeben können. Diese
Ängste und Sorgen treten in mindestens zwei Situationen, Zusammenhängen oder Um-
ständen auf. Sie sind nicht auf ein einzelnes Hauptthema, wie beispielsweise die Angst vor
der Trennung von den Bezugspersonen (bei der Emotionalen Störung mit Trennungsangst
des Kindesalters), beschränkt. Die Ängste und Sorgen müssen mindestens 6 Monate
andauern und an mindestens der Hälfte der Tage vorhanden sein. Kinder mit einer Genera-
lisierten Angststörung bezweifeln, dass sie die Anforderungen des Alltags bewältigen kön-
nen. Sie haben Schwierigkeiten, ihre ängstlichen und sorgenvollen Gedanken zu kontrollie-
ren bzw. zu stoppen. Ihre Ängste und Sorgen sind mit mindestens drei der folgenden sechs
körperlichen Symptome verbunden, wobei mindestens zwei Symptome an mindestens der
Hälfte der Tage vorliegen müssen: (1) Ruhelosigkeit, Nervosität oder Unfähigkeit zur Ent-
spannung, (2) Gefühl von Erschöpfung oder Müdigkeit, (3) Konzentrationsschwierigkeiten
oder Gefühl von Leere im Kopf, (4) Reizbarkeit, (5) Muskelverspannungen oder (6) Schlaf-
störungen (u. a. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen). Die Ängste, die Sorgen oder
die körperlichen Symptome verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigungen in
sozialen, schulischen und anderen wichtigen Lebens- und Funktionsbereichen.
Nach ICD-10 (WHO, 2011) muss die Generalisierte Angststörung des Kindesalters vor
dem 18. Lebensjahr beginnen. Eine Generalisierte Angststörung des Kindesalters sollte nur
diagnostiziert werden, wenn die Störung keine direkte Folge einer Substanzaufnahme (z. B.
psychotrope Substanzen, Medikamente) oder einer organischen Krankheit (z. B. Hyper-
thyreose) ist und nicht ausschließlich im Rahmen einer affektiven oder psychotischen
Störung oder im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung auftritt.
Mit der Einführung des DSM-IV (APA, 1994, deutsch: 1996) wurde die im DSM-III-R
(APA, 1987, deutsch: 1989) noch aufgeführte „Störung mit Überängstlichkeit des Kindes-
alters“ in die Erwachsenenkategorie „Generalisierte Angststörung“ eingeschlossen.
Zwischen den derzeit gültigen Versionen der beiden Klassifikationssysteme DSM-IV-TR
(APA, 2000, deutsch: 2003) und ICD-10 (WHO, 2011) gibt es keine grundsätzlichen
Unterschiede in den Diagnosekriterien (vgl. Tabelle 3). Bei der Vergabe der DSM-Diagnose
„Generalisierte Angststörung“ an Kinder ist zu beachten, dass im Unterschied zur ICD-
Diagnose „Generalisierte Angststörung des Kindesalters“ nur eines der oben genannten
körperlichen Symptome vorliegen muss.
2 Theorie 24
Tabelle 3: Vergleich der relevanten diagnostischen Kriterien der Generalisierten Angst-störung des Kindesalters nach ICD-10 (WHO, 2011, S. 197 f.) und DSM-IV (APA, 2003, S. 528 f.)
ICD-10: F93.80 DSM-IV-TR: 300.02
A Intensive Ängste und Sorgen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten an mindestens der Hälfte der Tage Ängste und Sorgen beziehen sich auf mindestens einige Ereignisse und Aktivitäten
A Übermäßige Angst und Sorge, die während mindestens 6 Monaten an der Mehrzahl der Tage auftreten Angst und Sorge bezüglich mehrerer Ereignisse oder Tätigkeiten
B Betroffene finden es schwierig, mit den Sorgen fertig zu werden
B Person hat Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren
C Ängste und Sorgen sind mit mindestens 3 der folgenden 6 Symptome verbunden (mindestens 2 Symptome an mindestens der Hälfte der Tage): 1. Ruhelosigkeit, Gefühl, überdreht zu sein 2. Gefühl von Müdigkeit oder Erschöpfung 3. Konzentrationsschwierigkeiten oder Gefühl,
der Kopf sei leer 4. Reizbarkeit 5. Muskelverspannung 6. Schlafstörung
C Angst und Sorge sind mit mindestens 3 der folgenden 6 Symptome verbunden (zumindest einige der Symptome an der Mehrzahl der Tage) BBeachte: Bei Kindern genügt ein Symptom. 1. Ruhelosigkeit oder ständiges „auf dem Sprung
sein“ 2. leichte Ermüdbarkeit 3. Konzentrationsschwierigkeiten oder Leere im
Kopf 4. Reizbarkeit 5. Muskelspannung 6. Schlafstörungen
D Ängste und Sorgen treten in mindestens 2 Situa-tionen, Zusammenhängen oder Umständen auf Sorgen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Hauptthema (wie bei der Störung mit Trennungsangst oder der Phobischen Störung des Kindesalters) Störung tritt nicht in einzelnen paroxysmalen Episoden (wie die Panikstörung) auf
D Angst und Sorge sind nicht auf Merkmale einer Achse I-Störung beschränkt, Angst und Sorge beziehen sich nicht darauf, z. B. eine Panikattacke zu haben (wie bei der Panikstörung), von zu Hause oder engen Angehörigen weit entfernt zu sein (wie bei der Störung mit Trennungsangst) oder sich in der Öffentlichkeit zu blamieren (wie bei der Sozialen Phobie) Angst und Sorge treten nicht ausschließlich im Verlauf einer Posttraumatischen Belastungsstörung auf
E Beginn in der Kindheit oder in der Adoleszenz (vor dem 18. Lebensjahr)
F Ängste, Sorgen oder körperliche Symptome verursachen eindeutiges Leiden oder Beeinträch-tigungen in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Lebens- und Funktionsbereichen
E Angst, Sorge oder körperliche Symptome verur-sachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
G Störung ist keine direkte Folge einer Substanz-aufnahme oder einer organischen Krankheit Störung tritt nicht ausschließlich im Rahmen einer affektiven Störung, einer psychotischen Störung oder einer tiefgreifenden Entwicklungs-störung auf
F Störung geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz oder eines medizini-schen Krankheitsfaktors zurück Störung tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer affektiven Störung, einer psychotischen Störung oder einer tiefgreifenden Entwicklungs-störung auf
Anmerkung: Unterschiede zwischen den beiden Klassifikationssystemen sind kursiv hervorgehoben.
2 Theorie 25
2.1.2 Epidemiologie
Zwischen den Prävalenzraten, die in verschiedenen epidemiologischen Studien für Angst-
störungen im Kindes- und Jugendalter ermittelt wurden, bestehen erhebliche Unterschiede.
Dabei variieren die Prävalenzraten in Abhängigkeit von der befragten Altersgruppe, den
eingesetzten Erhebungsinstrumenten und den zugrunde gelegten Klassifikationskriterien.
In einer Übersicht über internationale epidemiologische Studien zur Häufigkeit von Angst-
störungen im Kindesalter (bis 12 Jahre) berichten Cartwright-Hatton, McNicol und
Doubleday (2006) Prävalenzraten, die für die Störung mit Trennungsangst zwischen 0.50 %
und 20.20 %, für die Generalisierte Angststörung zwischen 0.16 % und 11.10 % und für
die Soziale Phobie zwischen 0.08 % und 0.90 % schwanken.
Bisher haben nur wenige Studien die Häufigkeit von Angststörungen im Kindes- und
Jugendalter anhand der aktuell gültigen diagnostischen Kriterien von ICD-10 und DSM-IV
untersucht. In einer großen epidemiologischen Studie in den USA, der Great Smoky
Mountains Study (GSMS; N = 1 420), untersuchten Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler und
Angold (2003) die Häufigkeit verschiedener Angststörungen (nach DSM-IV) bei Kindern
im Alter von 9 bis 13 Jahren: Die Drei-Monats-Prävalenz für die Störung mit Trennungs-
angst betrug 4.1 % bei 9- bis 10-jährigen Kindern bzw. 1.2 % bei 11-jährigen Kindern, für
die Generalisierte Angststörung 0.7 % bzw. 0.9 % und für die Soziale Phobie in beiden
Altersgruppen 0.3 %. Ford, Goodman und Meltzer (2003) ermittelten im British Child and
Adolescent Mental Health Survey, einer der wichtigsten europäischen Studien zur Epide-
miologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter (N = 10 438), dass 3.77 %
aller Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 15 Jahren an einer Angststörung (nach
DSM-IV) leiden. Dabei trat die Störung mit Trennungsangst bei 1.17 %, die Generalisierte
Angststörung bei 0.65 % und die Soziale Phobie bei 0.32 % der Kinder und Jugendlichen
auf. Die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS), der bisher größ-
ten Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (N = 2 863),
deuten darauf hin, dass 14.3 % der Kinder zwischen 7 und 10 Jahren sowie 9.9 % der Kin-
der und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren eine Angststörung aufweisen (Ravens-
Sieberer et al., 2008). Die Prävalenzraten sinken jedoch auf 6.3 % bzw. 4.0 %, wenn neben
den Symptomkriterien das Kriterium der Funktionseinschränkung herangezogen wird.
Prävalenzangaben aus weiteren deutschen Studien können Tabelle 4 entnommen werden.
2 Theorie 26
Tabelle 4: Prävalenzraten für ausgewählte Angststörungen des Kindes- und Jugendalters in verschiedenen deutschen Studien (Angaben in Prozent) (modifiziert nach Schneider & In-Albon, 2010, S. 527)
Alter (in Jahren) Prävalenzzeitraum
Federer et al. (2000) 8 Jahre 6 Monate
Steinhausen et al. (1998) 7 - 16 Jahre 6 Monate
Essau et al. (1998) 12 - 17 Jahre 12 Monate / LZ
Wittchen et al. (1998) 14 - 24 Jahre 12 Monate / LZ
Trennungsangst 2.80 0.80 - / - - / -
Soziale Phobie 0.40 4.70 1.40 / 1.60 2.60 / 3.50
Generalisierte Angststörung
1.40 0.60 0.20 / 0.40 0.50 / 0.80
Anmerkungen: - Störung wurde nicht erfasst; LZ = Lebenszeit.
Nach den derzeit gültigen ICD-10- bzw. DSM-IV-Kriterien liegen Schätzungen aus inter-
nationalen Studien für die Lebenszeitprävalenz von Angststörungen zwischen 13.6 %
(ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators, 2004) und 28.8 % (Kessler et al., 2005). Die
Arbeitsgruppe um Kessler (2005) ermittelte im Rahmen der National Comorbidity Survey
Replication (NCS-R), einer umfangreichen retrospektiven Befragung der amerikanischen
Allgemeinbevölkerung (über 18 Jahre) (N = 9 282), eine Lebenszeitprävalenz von 5.2 % für
die Störung mit Trennungsangst, von 5.7 % für die Generalisierte Angststörung und von
12.1 % für die Soziale Phobie. Im dazugehörigen Adolescent Supplement (NCS-A) stellten
Merikangas und Kollegen (2010) bei der Befragung von 10 123 Jugendlichen zwischen
13 und 18 Jahren eine Lebenszeitprävalenz von 7.6 % ohne Beeinträchtigung bzw. 0.6 %
mit Beeinträchtigung für die Störung mit Trennungsangst, von 2.2 % bzw. 0.9 % für die
Generalisierte Angststörung und von 9.1 % bzw. 1.3 % für die Soziale Phobie fest. In der
Bremer Jugendstudie (BJS; N = 1 035) erfüllten 0.4 % der Jugendlichen im Alter von 12 bis
17 Jahren irgendwann in ihrem Leben die Kriterien für eine Generalisierte Angststörung
und 1.6 % der Jugendlichen die Kriterien für eine Soziale Phobie (Essau, Conradt &
Petermann, 2000). Von allen in dieser Studie erhobenen psychischen Störungen traten die
Angststörungen mit einer Lebenszeitprävalenz von 18.6 % am häufigsten auf. Damit gehö-
ren Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter.
Im Hinblick auf Altersunterschiede zeigt sich in vielen Studien (u. a. Essau, Karpinski,
Petermann & Conradt, 1998; Ford et al., 2003; Merikangas et al., 2010), dass die Häufigkeit
von Angststörungen mit dem Alter ansteigt (z. B. 5 bis 7 Jahre: 3.19 %; 8 bis 10 Jahre: 3.05
%; 11 bis 12 Jahre: 3.95 %; 13 bis 15 Jahre: 5.04 %; Ford et al., 2003). Bei der Betrachtung
von Geschlechtsunterschieden kommen viele Studien (u. a. Essau et al., 1998; Ford et al.,
2 Theorie 27
2003; Ravens-Sieberer et al., 2008; Merikangas et al., 2010) übereinstimmend zu dem
Ergebnis, dass Mädchen etwas häufiger an einer Angststörung erkranken als Jungen, wobei
das Geschlechtsverhältnis zwischen 1:1 und 2:1 schwankt (z. B. Mädchen: 4.04 %, Jungen:
3.50 %; Ford et al., 2003).
2.1.3 Störungsbeginn und Verlauf
Sowohl retrospektive Querschnittsstudien als auch prospektive Längsschnittstudien zeigen,
dass 50 % aller psychischen Störungen bereits vor dem 15. Lebensjahr und 75 % aller
psychischen Störungen vor dem 25. Lebensjahr beginnen (Kessler et al., 2005; Kessler et
al., 2007; Kim-Cohen et al., 2003). Dabei haben Angststörungen einen vergleichsweise
frühen Beginn, der jedoch in Abhängigkeit von der Art der Angststörung variieren kann.
Die National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) liefert Daten zum Erstauftretens-
alter von Angststörungen (Kessler et al., 2005). Die retrospektive Befragung von 9 282
Erwachsenen (über 18 Jahren) ergab, dass der Erkrankungsbeginn für alle Angststörungen
im Median bei 11 Jahren lag. Dabei wies die Störung mit Trennungsangst mit einem Me-
dian von 7 Jahren den frühesten Beginn auf. Für den Störungsbeginn der Sozialen Phobie
wurde ein Median von 13 Jahren ermittelt. Bei der Generalisierten Angststörung lag der
Median für das erstmalige Auftreten bei 31 Jahren. Alle weiteren Angststörungen begannen
im Median zwischen 19 und 24 Jahren. Insgesamt hatten 75 % aller Angststörungen bis
zum Alter von 21 Jahren begonnen. Den Ergebnissen dieser Studie zufolge ist es also
wesentlich wahrscheinlicher, im Kindes- und Jugendalter erstmals an einer Angststörung zu
erkranken als im Erwachsenenalter.
Über das Alter bei Störungsbeginn hinaus kann der weitere Verlauf von Angststörungen
durch die Dauer, die Stabilität, die Remission und die Übergänge in weitere psychische
Störungen charakterisiert werden. Der unbehandelte Verlauf von Angststörungen wird in
retrospektiven Studien mit Erwachsenen häufig als langjährig und chronisch beschrieben
(z. B. Chartier, Hazen & Stein, 1998; Davidson, Hughes, George & Blazer, 1993). In
prospektiven Studien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigt sich eine
insgesamt moderate Stabilität von Angststörungen mit einem eher fluktuierenden Verlauf.
Die aus verschiedenen Studien stammenden Befunde zur Stabilität von Angststörungen
sind dabei durchaus widersprüchlich (für einen Überblick siehe Weems, 2008).
2 Theorie 28
Ein Teil der Studien verweist auf einen stabilen Verlauf der Angststörungen von der Kind-
heit über das Jugendalter bis ins Erwachsenenalter (z. B. Beidel, Fink & Turner, 1996; Co-
hen, Cohen & Brook, 1993; Newman et al., 1996; Carballo et al., 2010). Im Rahmen einer
prospektiven Längsschnittstudie untersuchten Newman und Kollegen (1996) über 10 Jahre
hinweg den Entwicklungsverlauf einer Geburtskohorte von 1 037 Kindern und Jugendli-
chen mit Angststörungen. Von den 195 Studienteilnehmern, die im Alter von 21 Jahren die
Kriterien für eine Angststörung (nach DSM-III-R) erfüllten, litten 80.5 % bereits im Alter
von 11, 13, 15 oder 18 Jahren unter einer Angststörung (79.3 % Soziale Phobie; 88.5 %
Generalisierte Angststörung). Auch in der Studie von Carballo und Kollegen (2010) zeich-
neten sich die verschiedenen Angststörungen (nach ICD-10) durch eine hohe Stabilität aus
(z. B. 72.0 % Soziale Ängstlichkeit/Soziale Phobie). In einer Längsschnittstudie zum Ver-
lauf der Sozialen Phobie trat eine vollständige Remission bei 8 % der Teilnehmer nach
6 Monaten, bei 20 % nach 2 Jahren, bei 27 % nach 5 Jahren und bei 36 % nach 8 Jahren
ein. Bei etwa einem Drittel der Personen mit einer vollständigen Remission der Sozialen
Phobie erfolgte allerdings innerhalb von 4 bis 5 Jahren ein Rückfall (Keller, 2003). Die
Arbeitsgruppe um Keller (1992) ermittelte für die Störung mit Trennungsangst und für die
Störung mit Überängstlichkeit (Generalisierte Angststörung) eine durchschnittliche Dauer
von 4 Jahren. 8 Jahre nach dem erstmaligen Auftreten dieser beiden Angststörungen waren
noch immer 46 % der Kinder erkrankt. 31 % der Kinder, deren Angststörung bereits
remittiert war, erlitten einen Rückfall.
Der andere Teil der Studien verweist auf eine geringe Stabilität von Angststörungen im
Kindes- und Jugendalter (z. B. Essau, Conradt & Petermann, 2002; Last, Perrin, Hersen &
Kazdin, 1996; Wittchen, Lieb, Pfister & Schuster, 2000). So erfüllten in der EDSP-Studie
(Early Developmental Stages of Psychopathology Study; N = 3 021; 14 bis 24 Jahre) zum
2-Jahres-Follow-up beispielsweise nur noch 19.7 % der Jugendlichen die Kriterien für eine
Angststörung (nach DSM-IV) (Wittchen et al., 2000). Dabei zeigten sich große Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Angststörungen. Zum 10-Jahres-Follow-up erfüllten
41.0 % der Studienteilnehmer erneut die Kriterien für eine Spezifische Phobie (Emmel-
kamp & Wittchen, 2009), aber nur 15.5 % erneut die Kriterien für eine Soziale Phobie
(Beesdo-Baum et al., 2012). Auch in der Bremer Jugendstudie (BJS; N = 1 035; 12 bis 17
Jahre) wiesen zum Follow-up nach 15 Monaten nur noch 22.6 % der Jugendlichen eine
Angststörung (nach DSM-IV) auf. Allerdings hatten 17.7 % der Studienteilnehmer wäh-
rend des Beobachtungszeitraums eine Depressive Störung, 27.4 % eine Somatoforme Stö-
2 Theorie 29
rung und 6.5 % eine Substanzstörung entwickelt. Immerhin 41.9 % der Jugendlichen litten
zum Katamnesezeitpunkt nicht mehr unter einer psychischen Störung (Essau et al., 2002).
Auch Last und Kollegen (1996) konnten nachweisen, dass 82.0 % der als ängstlich diagnos-
tizierten Kinder und Jugendlichen (N = 84; 5 bis 18 Jahre) nach 3 bis 4 Jahren die Kriterien
der ursprünglichen Angststörung nicht mehr erfüllten. Allerdings hatten 30.0 % der ängst-
lichen Kinder und Jugendlichen während dieses Zeitraums eine andere psychische Störung
entwickelt; in der Hälfte dieser Fälle (16.0 %) hatte sich eine weitere Angststörung
ausgebildet.
Das Vorliegen einer Angststörung im Kindes- und Jugendalter erhöht die Wahrscheinlich-
keit für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen im Erwachsenenalter. In den ver-
gangenen Jahrzehnten haben prospektive Längsschnittstudien wiederholt nachgewiesen,
dass Angststörungen im Kindes- und Jugendalter anderen Angststörungen, Affektiven
Störungen, Substanzstörungen und Störungen des Sozialverhaltens vorausgehen (Bittner et
al., 2007; Brückl et al., 2007; Copeland, Shanahan, Costello & Angold, 2009). In vielen
Fällen sind Angststörungen, die erstmalig im Kindes- und Jugendalter aufgetreten sind, zu
einem späteren Zeitpunkt mit der gleichen (z. B. Bittner et al., 2007; Gregory et al., 2007;
Merikangas, Avenevoli, Acharyya, Zhang & Angst, 2002) oder einer (weiteren) anderen
Angststörung (z. B. Brückl et al., 2007; Gregory et al., 2007; Pine et al., 1998) assoziiert.
Zudem haben Kinder und Jugendliche mit einer Angststörung ein höheres Risiko für die
Entwicklung einer sekundären Depressiven Störung als Kinder und Jugendliche ohne eine
(vorausgehende) Angststörung (z. B. Beesdo et al., 2007; Bittner et al., 2004; Bittner et al.,
2007; Pine et al., 1998). Dieses erhöhte Risiko scheint unabhängig vom Alter des erstmali-
gen Auftretens und der Dauer der Angststörung zu sein (Beesdo et al., 2007). Dagegen
lassen ein hoher Schweregrad der Angststörung, eine hohe Anzahl komorbider Angst-
störungen, eine hohe Persistenz der Angststörung und ein hoher Grad der Beeinträchti-
gung durch die Angststörung die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer nach-
folgenden Depressiven Störung steigen (Beesdo et al., 2007; Bittner et al., 2004).
2.1.4 Komorbidität
Angststörungen treten auch im Kindes- und Jugendalter häufig zusammen mit weiteren
psychischen Störungen auf. Die in verschiedenen Studien ermittelten Komorbiditätsraten
2 Theorie 30
schwanken zwischen 27 % (Ford et al., 2007) und 80 % (Müller, 2002). Im British Child
and Adolescent Mental Health Survey, einer epidemiologischen Studie (N = 10 438, Alter:
5 bis 15 Jahre), betrug die Komorbiditätsrate bei Angststörungen 27 %, wobei die meisten
Kinder und Jugendlichen weitere Angststörungen, Depressive Störungen und Externalisie-
rende Verhaltensstörungen aufwiesen. Von den 391 Kindern mit Angststörungen hatten
57 Kinder (15.0 %) zwei Angststörungen, 15 Kinder (4.0 %) drei Angststörungen und
2 Kinder (0.5 %) vier Angststörungen. Dabei trat die Störung mit Trennungsangst in 15
Fällen zusammen mit der Generalisierten Angststörung, in 12 Fällen zusammen mit der
Sozialen Phobie und in 12 Fällen zusammen mit der Spezifischen Phobie auf (Ford et al.,
2003). Alle anderen Angststörungen traten weniger als zehnmal gemeinsam auf. Kendall,
Brady und Verduin (2001) untersuchten die Komorbiditätsraten von Angststörungen in
einer klinischen Studie (mit einer Inanspruchnahmestichprobe): Hier erfüllten 79 % der
Kinder mit einer primären Angststörung (58.4 % Generalisierte Angststörung, 22.2 %
Störung mit Trennungsangst, 18.8 % Soziale Phobie) die Kriterien für mindestens eine
weitere Diagnose. So wiesen 46.2 % der Kinder zusätzlich eine Spezifische Phobie, 33.5 %
eine Soziale Phobie, 29.0 % eine Generalisierte Angststörung und 17.0 % eine Störung mit
Trennungsangst auf. Auch in anderen Studien ließen sich hohe Komorbiditätsraten
zwischen verschiedenen Angststörungen feststellen (z. B. Marmorstein, 2006; Verduin &
Kendall, 2003).
Darüber hinaus leidet ein hoher Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen nicht nur unter
einer Angststörung, sondern auch unter einer Depressiven Störung. In der Bremer Jugend-
studie (N = 1 035; 12 bis 17 Jahre) wurde für den Zusammenhang zwischen Angststörun-
gen und Depressiven Störungen eine Komorbiditätsrate von 30.2 % gefunden (Essau et al.,
2000). In weiteren Studien wurden ebenfalls überwiegend hohe Komorbiditätsraten zwi-
schen Angststörungen und Depressiven Störungen ermittelt (z. B. Beesdo et al., 2007;
Chavira, Stein, Bailey & Stein, 2004; Verduin & Kendall, 2003; Wittchen, Stein & Kessler,
1999). Dabei gehen die Angststörungen den Depressiven Störungen in vielen Fällen voraus
(Beesdo et al., 2007; Chartier, Walker & Stein, 2003; Essau et al., 2000).
Daneben treten Angststörungen aber auch häufig zusammen mit externalisierenden Ver-
haltensstörungen wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) oder
Störungen des Sozialverhaltens auf (Ford et al., 2003; Kendall et al., 2001; Marmorstein,
2006). In der Studie von Kendall und Mitarbeitern (2001) erfüllten 15.0 % der Kinder und
2 Theorie 31
Jugendlichen mit einer Angststörung gleichzeitig die Kriterien für eine Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstörung und 10.4 % für eine Störung des Sozialverhaltens. Darüber
hinaus müssen als zusätzlich auftretende Störungen auch Zwangsstörungen, Essstörungen,
Ausscheidungsstörungen sowie Substanzstörungen in Betracht gezogen werden (z. B.
Chartier et al., 2003; Essau et al., 2000; Verduin & Kendall, 2003).
2.1.5 Inanspruchnahmeverhalten und Behandlungsquoten
Damit Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen bedarfsgerecht versorgt werden,
müssen Eltern einerseits erkennen, dass ihre Kinder behandlungsbedürftig sind, und ande-
rerseits bereit sein, psychiatrische und/oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Darüber hinaus müssen Eltern aber auch in der Lage sein, mögliche Hindernisse
auf dem Weg zur Psychotherapie zu überwinden (z. B. lange Wartezeiten, aufwendige
Antragsverfahren, weite Fahrtwege) und die Psychotherapie in den Alltag der Familie zu
integrieren. Erfahrungsgemäß nehmen Eltern psychotherapeutische Hilfe für ihre Kinder
häufiger in Anspruch, wenn es sich um eine chronische oder stark beeinträchtigende
Störung handelt, wenn innerhalb der Familie ein hoher Leidensdruck herrscht und wenn
die Bereitschaft zur Öffnung nach außen vorhanden ist (Ihle, Frenzel & Esser, 2006).
Behandlungsquoten sind aber nicht nur vom Inanspruchnahmeverhalten der Kinder bzw.
Jugendlichen und ihrer Eltern, sondern auch von den regionalen Versorgungsstrukturen
und -kapazitäten abhängig (z. B. Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Fachärzten bzw.
Psychotherapeuten / Psychotherapeutendichte; West-Ost-Gefälle, Stadt-Land-Gefälle).
In Ermangelung umfassenden und zuverlässigen Datenmaterials zur Versorgungssituation
psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter wurde zusätzlich auf Datenmaterial zur
Versorgungslage im Erwachsenenalter zurückgegriffen. Für das Erwachsenenalter liegen
Daten zur Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland aus dem Bundes-
Gesundheitssurvey 1998 (BGS 98) vor. Diese epidemiologische Studie (N = 4 181; 18 bis
65 Jahre) zeigt, dass nur 36.4 % aller Erwachsenen mit psychischen Störungen in den
letzten zwölf Monaten behandelt wurden. Von den an einer Angststörung erkrankten
Personen gaben immerhin 43.6 % der Befragten an, in diesem Zeitraum eine Behandlung
erhalten zu haben (Wittchen & Jacobi, 2001). Obwohl sich nur ein Drittel der von psychi-
2 Theorie 32
schen Störungen betroffenen Erwachsenen überhaupt in Behandlung befand, ist diese
Behandlungsquote im internationalen Vergleich hoch (Bijl et al., 2003).
Im Rahmen der EDSP-Studie wurde bei einer Befragung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (N = 3 021; 14 bis 34 Jahre) die Versorgungssituation im Großraum Mün-
chen erfasst. 42.6 % der von einer Angststörung betroffenen Personen gaben an, einmal in
ihrem Leben irgendeine Behandlung in Anspruch genommen zu haben; nur 27.8 % der
Erkrankten berichteten, einmal einen Psychotherapeuten aufgesucht zu haben. In der
Altersgruppe der 14- bis 20-Jährigen hatten bei Vorliegen einer Angststörung 30.6 % der
betroffenen Personen irgendeine Behandlung und nur 16.4 % eine Psychotherapie erhalten
(Runge, Beesdo, Lieb & Wittchen, 2008).
Für das Kindes- und Jugendalter liegen seit kurzem Schätzungen zur Versorgungssituation
aus dem ersten Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) vor. Die Befragung der
Eltern im Rahmen des KiGGS deutet darauf hin, dass nur 40.2 % aller psychisch auffälli-
gen Kinder und Jugendlichen (7 bis 10 Jahre: 34.4 %; 11 bis 17 Jahre: 45.8 %) zum Befra-
gungszeitpunkt als behandlungsbedürftig eingeschätzt bzw. behandelt wurden. Von den
Kindern und Jugendlichen, die unter Ängsten leiden, wurden sogar nur 26.3 % der 7- bis
10-Jährigen (Mädchen: 14.3 %, Jungen: 43.8 %) und nur 41.9 % der 11- bis 17-Jährigen
(Mädchen: 41.2 %, Jungen: 42.6 %) als behandlungsbedürftig eingeschätzt bzw. behandelt
(Ravens-Sieberer et al., 2008). Zudem müssen die von einer Angststörung betroffenen
Kinder und Jugendlichen durchschnittlich 10 Wochen (Baden-Württemberg; Nübling,
Reisch & Raymann, 2006) bis 24 Wochen (Hessen; PtK Hessen, 2006) auf einen Therapie-
platz warten. Aufgrund der unterschiedlichen psychotherapeutischen Versorgungsdichte
kommt es in einigen Regionen Deutschlands allerdings zu deutlich längeren Wartezeiten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Bereich der Behandlung psychischer Stö-
rungen eine erhebliche Unterversorgung vorherrscht (z. B. BPtK, 2006, 2007; Könning,
2007; Nübling, Reisch & Raymann, 2006): Mehr als die Hälfte der betroffenen Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen befinden sich nicht in Behandlung, wobei Kinder und
Jugendliche offensichtlich noch etwas schlechter versorgt werden als Erwachsene.
2 Theorie 33
2.2 Ursachen von Angststörungen im Kindesalter
2.2.1 Risikofaktoren
Für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen im Kindes- und Jugend-
alter werden verschiedene Risikofaktoren diskutiert, von denen die wichtigsten nachfolgend
kurz vorgestellt werden sollen. Nach dem derzeitigen Forschungsstand ist von einer multi-
faktoriellen Verursachung der Angststörungen auszugehen, wobei das genaue Zusammen-
wirken der verschiedenen Risikofaktoren noch weitgehend ungeklärt ist. Da sich die bishe-
rige Forschung zur Ätiologie kindlicher Angststörungen hauptsächlich auf die gemeinsame
Untersuchung der verschiedenen Angststörungen beschränkt hat, können (fast) keine Aus-
sagen über störungsspezifische Risikofaktoren getroffen werden.
Elterliche Psychopathologie
In verschiedenen Studien wurde die Psychopathologie der Eltern als Risikofaktor für die
Entwicklung einer Angststörung im Kindes- und Jugendalter identifiziert (vgl. für einen
Überblick Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Bögels & Phares, 2008). Einerseits weisen
die Eltern (v. a. die Mütter) von ängstlichen Kindern häufiger eine Angststörung auf als die
Eltern von gesunden Kindern (z. B. Cooper, Fearn, Willets, Seabrook & Parkinson, 2006;
Last, Hersen, Kazdin, Francis & Grubb, 1987; Last, Hersen, Kazdin, Orvashel & Perrin,
1991); andererseits haben die Kinder von Eltern mit Angststörungen ein höheres Risiko,
eine Angststörung zu entwickeln, als die Kinder von gesunden Eltern (z. B. Beidel &
Turner, 1997; Biederman, Rosenbaum, Bolduc, Faraone & Hirshfeld, 1991; Merikangas,
Dierker & Szatmari, 1998). Dabei ist das Risiko für die Ausbildung einer Angststörung für
diese Kinder um mehr als das Doppelte erhöht (Merikangas et al., 1998). In der von Micco
und Kollegen (2009) durchgeführten Meta-Analyse wurden die Prävalenzraten von psychi-
schen Störungen bei Kindern von Eltern mit Angststörungen (N = 1 892; 4 bis 25 Jahre)
untersucht. Im Vergleich zu Kindern einer gesunden und einer klinischen Kontrollgruppe
zeigte sich, dass die Kinder von Eltern mit Angststörungen einem höheren Risiko ausge-
setzt sind, selbst an einer Angststörung zu erkranken. Bisher lassen sich allerdings noch
keine eindeutigen Aussagen zur spezifischen Weitergabe der Angststörungen (gleiche
Angststörung bei Kindern und Eltern) machen. Einzelne Studien liefern jedoch Hinweise
2 Theorie 34
darauf, dass es ein spezifisches Erkrankungsrisiko bei der Sozialen Phobie gibt (Lieb et al.,
2000; Merikangas, Lieb, Wittchen & Avenevoli, 2003).
Als Ursachen für die empirisch gut belegte familiäre Häufung von Angststörungen müssen
Einflüsse der Vererbung und der Umwelt in Betracht gezogen werden. Nach derzeitigem
Forschungsstand kann von einer allgemeinen genetischen Prädisposition für Angst und
Depression ausgegangen werden, die die Entwicklung einer Angststörung begünstigt
(Bögels & Brechman-Toussaint, 2006). Aber auch Umwelteinflüsse (z. B. Modellverhalten,
Erziehungsstil, Lebensereignisse) spielen bei der Entwicklung von Angststörungen eine
wichtige Rolle (Burt, 2009). Welche spezifische Angststörung ein Kind bzw. Jugendlicher
entwickelt, scheint dabei vor allem von individuumsspezifischen Umweltfaktoren abzu-
hängen (Bolton et al., 2006; Kendler et al., 1995).
Temperament
Zahlreiche Studien konnten nachweisen, dass das Temperamentsmerkmal Verhaltens-
hemmung ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Angststörung ist (vgl. für einen Über-
blick Degnan & Fox, 2007; Degnan, Almas & Fox, 2010). Das Temperamentsmerkmal
Verhaltenshemmung (behavioral inhibition; Kagan, 1994) bezeichnet eine frühe und stabile
Persönlichkeitseigenschaft, die durch vorsichtiges, schüchternes, zurückgezogenes und
vermeidendes Verhalten gegenüber neuen und unvertrauten Personen, Objekten und Situa-
tionen charakterisiert ist (Kagan, Reznick, Clarke, Snidman & Garcia-Coll, 1984). Diesen
Studien zufolge haben Kinder, die das Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung auf-
weisen, ein höheres Risiko, an einer der verschiedenen Angststörungen des Kindes- und
Jugendalters zu erkranken, als Kinder, bei denen dieses Temperamentsmerkmal nicht
vorliegt (z. B. Biederman et al., 1990, 1993; Bosquet & Egeland, 2006; Shamir-Essakow,
Ungerer & Rapee, 2005). Allerdings gibt es auch einige Studien, die nur einen Zusammen-
hang zwischen Verhaltenshemmung und Sozialer Phobie fanden (Chronis-Tuscano et al.,
2009; Essex, Klein, Slattery, Hill Goldsmith & Kalin, 2010; Hirshfeld-Becker et al., 2007).
Bindung
Bindung ist die Bezeichnung für eine enge und dauerhafte emotionale Beziehung zwischen
zwei Menschen, die häufig im Hinblick auf die Beziehung zwischen Kindern und ihren
Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen diskutiert wird (attachment; Bowlby, 1973).
2 Theorie 35
Das Bindungsverhalten bzw. Bindungsmuster eines Kindes entsteht durch die Anpassung
an das Verhalten der zur Verfügung stehenden Bezugsperson, d. h. es geht aus der erlebten
Interaktion mit dieser Bezugsperson hervor. Bisher haben nur wenige Studien den
Zusammenhang zwischen Bindungstyp und Angststörungen untersucht. Dabei hat sich
herausgestellt, dass die verschiedenen Typen unsicherer Bindung zwischen Kindern und
ihren Eltern bzw. Bezugspersonen in einem Zusammenhang mit der Angststörung des
Kindes stehen (vgl. für einen Überblick Bögels & Brechman-Toussaint, 2006). In mehreren
Studien wiesen die Kinder mit einer unsicheren Bindung ein höheres Maß an Angst auf als
die Kinder mit einer sicheren Bindung (z. B. Manassis, Bradley, Goldberg, Hood &
Swinson, 1994, 1995; Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997; Shamir-Essakow et al.,
2005). Ein unsicher-vermeidendes Bindungsmuster im Säuglings- bzw. Kleinkindalter, das
durch das Fehlen enger emotionaler Beziehungen und die Zurückweisung solcher Bezie-
hungen gekennzeichnet ist, verdoppelte das Risiko für die Entwicklung einer Angststörung
im Alter von 17 Jahren (Warren et al., 1997).
Kognitive Risikofaktoren
Kinder und Jugendliche mit Angststörungen weisen häufig eine fehlerhafte und verzerrte
Informationsverarbeitung auf (vgl. für einen Überblick Alfano, Beidel & Turner, 2002;
Hadwin, Garner & Perez-Olivas, 2006). Dabei können in erster Linie die drei folgenden
kognitiven Verzerrungen beobachtet werden: Aufmerksamkeitsbias, Interpretationsbias
und Gedächtnisbias. Der Aufmerksamkeitsbias beschreibt die (vermutlich erworbene)
Tendenz, die Aufmerksamkeit selektiv auf Bedrohung und Gefahr auszurichten. Mehrere
Studien haben gezeigt, dass Kinder mit Angststörungen emotional bedrohlichen Informa-
tionen mehr Aufmerksamkeit schenken als Kinder ohne Angststörungen (z. B. In-Albon,
Kossowsky & Schneider, 2010; Martin, Horder & Jones, 1992; Vasey, Daleiden, Williams &
Brown, 1995). Der Interpretationsbias bezeichnet die Tendenz, mehrdeutige angstrelevante
Informationen eher als bedrohlich und gefährlich zu bewerten. Diese Tendenz wurde bei
Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen in empirischen Untersuchungen wiederholt
bestätigt: Kinder mit starker Angst interpretierten uneindeutige Informationen eher als
bedrohlich als Kinder mit geringer Angst (z. B. Barrett, Rapee, Dadds & Ryan, 1996; Higa
& Daleiden, 2008; Muris, Merckelbach & Damsma, 2000). Unter dem Gedächtnisbias wird
die Tendenz verstanden, sich an bedrohliche Informationen besser zu erinnern als an
nicht-bedrohliche Informationen. Die wenigen empirischen Studien zum selektiven
2 Theorie 36
Gedächtnis ergaben, dass Kinder mit hoher Ängstlichkeit in unterschiedlichen Gedächtnis-
aufgaben mehr bedrohliche Wörter erinnerten als Kinder mit niedriger Ängstlichkeit (z. B.
Daleiden, 1998; Potter, 1999). Diese kognitiven Besonderheiten spielen bei der Aufrechter-
haltung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter eine wesentliche Rolle (Vasey &
McLeod, 2001). Die vorliegenden Ergebnisse sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert wer-
den, weil bisher nur vergleichsweise wenige Studien durchgeführt wurden und die Ergeb-
nisse nicht immer konsistent waren.
Soziale Kompetenzdefizite
Der Begriff „Soziale Kompetenz“ wird von Hinsch und Pfingsten (2007, S. 90) „als die
Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltens-
weisen definiert , die in bestimmten Situationen zu einem langfristig günstigen Verhältnis
von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen“. Nach dieser
Definition gelten diejenigen Kinder und Jugendlichen als sozial kompetent, die über die
Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine gelungene zwischenmenschliche Interaktion verfügen
und diese auch erfolgreich einsetzen.
Die Frage, ob Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen soziale Kompetenzen fehlen,
wurde noch nicht hinreichend geklärt; die wenigen, bisher vorliegenden Studien kommen
diesbezüglich zu divergenten Ergebnissen. Während der eine Teil der Studien soziale
Kompetenzdefizite bei (sozial) ängstlichen Kindern und Jugendlichen nachweisen konnte
(z. B. Alfano, Beidel & Turner, 2006; Dodd et al., 2011; Motoca, Williams & Silverman,
2012; Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 1999), fand der andere Teil der Studien
keine sozialen Kompetenzdefizite (z. B. Cartwright-Hatton, Hodges & Porter, 2003;
Cartwright-Hatton, Tschernitz & Gomersall, 2005; Himeno & Shimada, 2008). In den
meisten Studien stützt sich der Nachweis von sozialen Kompetenzdefiziten allerdings (nur)
auf das Selbsturteil der Kinder bzw. Jugendlichen.
Aktuelle kognitive Erklärungsmodelle (z. B. Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg,
1997) gehen davon aus, dass sozial phobische Kinder und Jugendliche ihre Kompetenzen
deutlich unterschätzen – und zwar unabhängig von ihrem tatsächlichen Verhalten. Dass
diese Kinder und Jugendlichen ihre sozialen Kompetenzen im Vergleich zu unabhängigen
Beurteilern unterschätzen, wurde bereits in einigen Studien gezeigt (z. B. Cartwright-
Hatton et al., 2003; Cartwright-Hatton et al., 2005; Himeno & Shimada, 2008).
2 Theorie 37
Cartwright-Hatton und Kollegen (2003) untersuchten eine nicht-klinische Stichprobe von
110 Schulkindern im Alter von 8 bis 11 Jahren. Sie baten die Kinder, eine zweiminütige
Rede vor einer Kamera zu halten. Dabei fanden die Autoren zwar einen Zusammenhang
zwischen der Angst und den subjektiv eingeschätzten sozialen Fertigkeiten, nicht jedoch
zwischen der Angst und den objektiv erfassten sozialen Fertigkeiten. In der Studie von
Himeno und Shimada (2008) sollten 19 Schulkinder der 5. und 6. Klasse eine Rede vor
ihrer Klasse halten. Hinsichtlich der sozialen Kompetenz wurde kein Unterschied zwischen
den Kindern mit geringer Angst und den Kindern mit starker Angst gefunden; die objekti-
ven Beurteiler konnten die Kinder der beiden Gruppen nicht unterscheiden. Die Kinder
mit starker Angst schätzten sich im Hinblick auf langsames und lautes Sprechen jedoch
selbst als weniger kompetent ein als die Kinder mit geringer Angst.
Dass die soziale Kompetenz die Beziehung zwischen Angststörungen und Interaktionen
mit gleichaltrigen Kindern vermittelt, wird durch die Ergebnisse einer Studie von Motoca,
Williams und Silverman (2012) (N = 397; 7 bis 16 Jahre; Angststörung nach DSM-IV)
gestützt: Während starke Angst mit geringer sozialer Kompetenz assoziiert ist, steht geringe
soziale Kompetenz in Zusammenhang mit wenigen positiven und vielen negativen Inter-
aktionen mit gleichaltrigen Kindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder und Jugendliche mit Angststörungen nicht
notwendigerweise tatsächliche soziale Kompetenzdefizite aufweisen; vielmehr sind sie oft
nur der subjektiven Überzeugung, dass ihnen soziale Kompetenzen fehlen würden. Dem-
entsprechend sollte das soziale Kompetenztraining nicht allein durchgeführt, sondern mit
kognitiven Interventionen kombiniert werden.
Elterlicher Erziehungsstil
Der Erziehungsstil beschreibt Einstellungen und Verhaltensweisen, die Eltern und andere
Bezugspersonen bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen erkennen lassen. Bislang
gibt es keine prospektiven Studien, die den Einfluss des elterlichen Erziehungsstils auf die
Entwicklung von Angststörungen untersucht haben. Die Ergebnisse, die aus retrospektiven
und korrelativen Studien vorliegen, zeigen, dass ein Erziehungsstil, der einerseits durch
starke Überbehütung und Kontrolle, andererseits durch geringe emotionale Wärme und
Feinfühligkeit gekennzeichnet ist, als Risikofaktor für die Entstehung und Aufrecht-
erhaltung einer Angststörung gelten kann (vgl. für einen Überblick Bögels & Brechman-
2 Theorie 38
Toussaint, 2006; Degnan et al., 2010; Rapee, 1997; Wood, McLeod, Sigman, Hwang &
Chu, 2003). Gar und Hudson (2008) konnten nachweisen, dass die Mütter von ängstlichen
Kindern mehr überbehütendes und kritisches Erziehungsverhalten zeigten als die Mütter
von nicht-ängstlichen Kindern. In einer von McLeod, Wood und Weisz (2007) durchge-
führten Meta-Analyse wurden 47 Studien berücksichtigt, die den Zusammenhang zwischen
elterlichem Erziehungsverhalten und auftretenden Angststörungen untersucht hatten.
Dabei zeigte sich, dass starke Ablehnung und Kontrolle durch die Eltern bzw. Bezugsper-
sonen mit hoher Angst auf Seiten der Kinder bzw. Jugendlichen assoziiert ist. Über alle
Studien hinweg erklärte das elterliche Erziehungsverhalten allerdings nur 4 % der Varianz
von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, was vermutlich einerseits auf die metho-
dischen Einschränkungen, andererseits auf die inkonsistenten Befunde der zugrundeliegen-
den Studien zurückzuführen ist. Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass das Erziehungs-
verhalten unabhängig von der Psychopathologie der Eltern zu sein scheint. Van der
Bruggen, Stams und Bögels (2008) fanden in ihrer meta-analytischen Überblicksarbeit
keinen signifikanten Zusammenhang zwischen elterlichen Ängsten und kontrollierendem
Erziehungsverhalten.
Belastende Lebensereignisse
Im Kindes- und Jugendalter können Angststörungen sowohl durch normative (z. B. Über-
gang vom Kindergarten in die Schule) als auch durch nicht-normative Lebensereignisse
(z. B. Krankheit und Tod eines Geschwisterkindes) ausgelöst werden. Zu den auslösenden
Risikofaktoren können beispielsweise dauerhafte Veränderungen der Lebensumstände
(z. B. Schuleintritt, Klassen- oder Schulwechsel, Umzug, Wegzug des besten Freundes) und
Veränderungen der Familiensituation (z. B. Geburt eines Geschwisterkindes, Scheidung der
Kindeseltern, Tod eines nahen Angehörigen) gezählt werden. Bei den auslösenden Risiko-
faktoren kann es sich aber auch um einzelne, zeitlich begrenzte Ereignisse im Leben eines
Kindes oder Jugendlichen handeln (z. B. Ablehnung durch gleichaltrige Kinder, Trennung
des Kindes von den Eltern (i. S. eines kurzzeitigen Verlorengehens), Biss eines Hundes).
Bisher gibt es nur wenige Studien, die den Einfluss belastender Lebensereignisse auf die
Entwicklung von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen untersucht haben. Einige
Studien konnten zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen mit Angststörungen in ihrem
bisherigen Leben mehr belastende Ereignisse erlebt hatten als die Kinder und Jugendlichen
der Kontrollgruppen (Allen & Rapee, 2009; Boer et al., 2002; Eley & Stevenson, 2000;
2 Theorie 39
Rapee & Szollos, 2002). Dabei wiesen die Kinder mit einer weiteren psychischen Störung
die höchste Rate an belastenden Lebensereignissen auf (Allen & Rapee, 2009). Auch in der
von Legerstee, Garnefski, Jellesma, Verhulst und Utens (2010) durchgeführten Studie
berichteten ängstliche Kinder (N = 131; 9 bis 11 Jahre; Angststörung nach DSM-IV) über
deutlich mehr negative Lebensereignisse als gesunde Kinder (N = 452; 9 bis 11 Jahre). Zur
Bewältigung dieser Lebensereignisse setzten die ängstlichen Kinder weniger funktionale
(kognitive) Strategien (z. B. positive Neubewertung, Handlungsplanung) und mehr dys-
funktionale (kognitive) Strategien (z. B. Selbstvorwürfe, Grübeln, Katastrophisieren) ein als
die gesunden Kinder.
2.2.2 Theoretische Modelle
Theoretische Modelle kombinieren verschiedene Risikofaktoren (vgl. Abschnitt 2.2.1), um
die Entwicklung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter zu erklären. Nach-
folgend werden ausgewählte theoretische Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung
von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter vorgestellt, und zwar das Integrierte
Behavioral-Inhibition-Attachment-Modell (Manassis & Bradley, 1994), das Kognitive
Modell (Kendall & Ronan, 1990) und das Integrative Modell für die Entwicklung einer
Angststörung im Kindes- und Jugendalter (Rapee, 2001). Die meisten Modelle zur Erklä-
rung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter wurden störungsunspezifisch formu-
liert; d. h. sie haben den Anspruch, für alle Angststörungen des Kindes- und Jugendalters
gleichermaßen zu gelten.
Mit dem Integrierten Behavioral-Inhibition-Attachment-Modell (Manassis & Bradley, 1994) wurde
ein allgemeines Modell entwickelt, das vorwiegend die Entstehung von Angststörungen im
Kindes- und Jugendalter erklärt. Es verbindet die Annahmen des Behavioral-Inhibition-
Konzepts (Verhaltenshemmung; Kagan, 1994) mit denjenigen des Attachment-Konzepts
(Bindung; Bowlby, 1973). Dabei wird davon ausgegangen, dass das Temperamentsmerkmal
Verhaltenshemmung eine genetische Prädisposition für Angststörungen darstellt, die durch
die Art der Bindung verringert oder verstärkt werden kann. Diesem Erklärungsmodell
zufolge führt erst die Kombination von sozialer Gehemmtheit und unsicherem Bindungs-
stil zur Entwicklung einer Angststörung. Zentrale Annahmen dieses Modells, insbesondere
der Zusammenhang zwischen dem Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung und den
2 Theorie 40
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, konnten in empirischen Untersuchungen
bestätigt werden: Einerseits weisen verhaltensgehemmte Kinder häufiger Angststörungen
auf als nicht-verhaltensgehemmte Kinder (z. B. Biederman et al., 1990, 1993; Bosquet &
Egeland, 2006; Shamir-Essakow et al, 2005). Andererseits entwickeln Kinder mit einer
unsicheren Bindung häufiger eine Angststörung als Kinder mit einer sicheren Bindung
(z. B. Manassis et al., 1995; Warren et al., 1997; Shamir-Essakow et al., 2005). Weiterhin
konnte gezeigt werden, dass dahingehend eine Wechselwirkung zwischen Temperament,
Bindung und Angststörung besteht, dass Kinder und Jugendliche, die verhaltensgehemmt
und unsicher gebunden sind, das höchste Angstniveau aufweisen (Manassis et al., 1995;
Muris & Meesters, 2002; Muris, van Brakel, Arntz & Schouten, 2011). Die bisherigen
Ergebnisse zur Interaktion von Verhaltenshemmung und Bindung sollten allerdings noch
mit Vorsicht interpretiert werden, weil sie überwiegend aus retrospektiven und korrelativen
Studien stammen.
Das Kognitive Modell von Kendall und Ronan (1990) ist ein allgemeines Modell, mit dem sich
auch die Aufrechterhaltung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter erklären lässt.
Die Autoren gehen davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit Angststörungen häufig
kognitive Defizite (nicht ausreichend angewendete oder fehlende kognitive Fertigkeiten)
und kognitive Verzerrungen (einseitige oder falsche Informationsverarbeitungsprozesse)
aufweisen. Diese kognitiven Einschränkungen ziehen oftmals dysfunktionale Verhaltens-
weisen (z. B. Vermeidungsverhalten) nach sich. Weiterhin nehmen die Autoren an, dass die
Informationsnetzwerke (kognitive Schemata), die Bedrohung und/oder Gefahr beinhalten,
bei ängstlichen Kindern und Jugendlichen chronisch überaktiviert sind. Infolgedessen
werden bedrohliche und/oder gefährliche Informationen von diesen Kindern bevorzugt
wahrgenommen. Kognitive Schemata steuern die Wahrnehmung, die Informations-
verarbeitung und das Handeln eines Kindes bzw. Jugendlichen, indem sie darüber
entscheiden, wie aufgenommene Informationen ausgewählt, interpretiert und umgesetzt
werden. Die Überaktivierung der kognitiven Gefahren-Schemata führt dazu, dass Kinder
und Jugendliche mit Angststörungen dazu neigen, die von einer Situation ausgehende
Bedrohung bzw. Gefahr zu überschätzen sowie die eigenen Kontroll- und Bewältigungs-
möglichkeiten zu unterschätzen (Schneider & Blatter, 2006). Die zentrale Bedeutung von
Kognitionen für die Aufrechterhaltung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter
lässt sich empirisch gut belegen (vgl. Alfano et al., 2002; Watts & Weems, 2006).
2 Theorie 41
Ein erstes integratives Modell für die Entwicklung einer Angststörung im Kindes- und Jugendalter
wurde von Rapee (2001) vorgelegt (vgl. Abbildung 1).
Vulnerabilität für Angst
Abbildung 1: Integratives Modell für die Entwicklung einer Angststörung im Kindes- und Jugendalter (nach Lyneham & Rapee, 2004; zitiert nach In-Albon, 2011, S. 70)
Das Modell geht von der Annahme aus, dass Kinder und Jugendliche eine unterschiedlich
stark ausgeprägte Vulnerabilität für die Entwicklung einer Angststörung aufweisen. Diese
Vulnerabilität wird einerseits durch Einflüsse der Vererbung (z. B. Temperament), anderer-
seits durch Einflüsse der Umwelt (z. B. Modellverhalten, Erziehungsstil) bestimmt. Kinder
und Jugendliche mit einer solchen Vulnerabilität zeichnen sich durch eine erhöhte physio-
logische Erregbarkeit, eine verzerrte Informationsverarbeitung und einen vermeidenden
Bewältigungsstil aus. Ihr ängstliches Temperament führt dazu, dass sie neue und uneindeu-
tige Situationen als bedrohlich interpretieren und infolgedessen vermeiden. So können sich
die Kinder weder an die vermeintlich bedrohlichen Situationen gewöhnen noch erfolgrei-
che Bewältigungsstrategien erlernen. Reagieren Eltern mit überfürsorglichem und beschüt-
zendem Verhalten (Aufmerksamkeit für ängstliches Verhalten, Unterstützung von Vermei-
dungsverhalten), verstärken sie die Angst des Kindes weiter. Die Eltern von ängstlichen
Kindern weisen häufig ebenfalls eine Angststörung auf (familiäre Häufung). Das ungünsti-
ge Modellverhalten ängstlicher Eltern verstärkt die Angstneigung eines Kindes, weil das
Kind durch die Beobachtung und Nachahmung der Eltern angstförderndes Verhalten
(z. B. Vermeidungsverhalten) lernt. Darüber hinaus kann das Kind in seinem Umfeld aber
Genetische Faktoren Elterliche Angst
Unterstützung von Vermeidung durch Umwelt
Auswirkungen der sozialen Umwelt
Angststörung
Erregung und Emotionalität
Vermeidung Verzerrung der Informationsverarbeitung
Externe umweltbedingte Ereignisse
2 Theorie 42
auch auf andere ängstliche Modelle treffen (z. B. ängstliche Mitschüler). Im Laufe ihres
Lebens sind Kinder und Jugendliche auch belastenden Lebensereignissen (z. B. Scheidung
der Kindeseltern) ausgesetzt. Belastende Lebensereignisse können Angststörungen auslö-
sen, wobei eine bestehende Vulnerabilität im Sinne einer Angstbereitschaft die Wahrschein-
lichkeit für die Entwicklung einer Angststörung erhöht. Das vorliegende Modell nimmt an,
dass bereits einer der genannten Risikofaktoren ausreicht, um eine Angststörung auszulö-
sen. Es ist allerdings wahrscheinlicher, dass ein Kind oder Jugendlicher an einer Angst-
störung erkrankt, wenn mehrere oder alle Risikofaktoren zusammen auftreten.
2 Theorie 43
2.3 Diagnostik von Angststörungen im Kindesalter
2.3.1 Diagnostisches Vorgehen
Die Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter umfasst in erster Linie
eine detaillierte Beschreibung und präzise Einordnung der psychischen Auffälligkeiten von
Kindern und Jugendlichen sowie eine differenzierte Analyse der Bedingungen, die zur Ent-
stehung und Aufrechterhaltung dieser psychischen Auffälligkeiten beitragen. Damit dient
die Diagnostik der Indikationsstellung und Therapieplanung. Die Leitlinien der Fachgruppe
Klinische Psychologie und Psychotherapie in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
empfehlen für die Diagnostik von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter folgendes
Vorgehen (vgl. Schneider & Döpfner, 2004):
(1) Erstgespräch: Das gemeinsame Erstgespräch mit Eltern und Kind dient dazu, einen
orientierenden Überblick über die psychischen Auffälligkeiten des Kindes und die aktuelle
Situation des Kindes in Familie, Schule und Freizeit zu erhalten. Für den Aufbau einer
guten therapeutischen Beziehung ist es hilfreich, alle Gesprächsteilnehmer aktiv ins Erst-
gespräch einzubeziehen und alle Gesprächsbeiträge gleichermaßen wichtig zu nehmen. Bei
der Exploration des Kindes ist außerdem darauf zu achten, dass der kognitive, sprachliche
und emotionale Entwicklungsstand des Kindes altersangemessen berücksichtigt wird.
(2) Diagnosestellung und Psychologische Differentialdiagnostik: Mit Hilfe standardisierter Verfahren
(z. B. Diagnose-Checklisten, Strukturierte Interviews; vgl. auch Kapitel 2.3.2) erfolgt die
diagnostische Einordnung der psychischen Auffälligkeiten, jeweils in einem mit Eltern und
Kind getrennt geführten Gespräch. Dabei müssen die berichteten Ängste immer auch von
entwicklungsphasentypischen Ängsten abgegrenzt werden, die fast alle Kinder einer Alters-
stufe zeigen (z. B. Angst vor der Trennung von den Bezugspersonen, Angst vor fremden
Menschen, Angst vor schlechten schulischen Leistungen; vgl. Tabelle 5). Im Rahmen der
psychologischen Differentialdiagnostik wird neben den Ängsten auch das Vorliegen
anderer, komorbider psychischer Störungen (z. B. Depressive Störungen, Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen, Ausscheidungsstörungen; vgl. auch Kapitel 2.1.4)
systematisch überprüft. Werden zwei oder mehr psychische Störungen diagnostiziert, sollte
zwischen primärer und sekundärer Störung unterschieden werden.
2 Theorie 44
Tabelle 5: Typische Ängste und mögliche Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen im Entwicklungsverlauf (modifiziert nach Schneider, 2004a, S. 10)
Alter Entwicklungsphasentypische Ängste Beginnende Angststörungen
0 - 6 Monate Verlust von körperlichem Halt und Zuwendung Intensive sensorische Reize (z. B. laute Geräusche)
6 - 12 Monate Trennung von der Bezugsperson Fremde Menschen
2 - 4 Jahre Fantasiegestalten (z. B. Gespenster, Monster) Einbrecher Dunkelheit
Trennungsangst Spezifische Phobie (u. a. vor Dunkelheit und Monstern)
5 - 7 Jahre Naturkatastrophen (z. B. Sturm, Gewitter, Feuer) Verletzungen, Krankheiten, Tod Tiere (z. B. Hunde, Pferde)
Spezifische Phobie (u. a. vor Tieren, Blut und medizinischen Eingriffen)
8 - 11 Jahre Schlechte schulische oder sportliche Leistungen Prüfungsangst
12 - 18 Jahre Ablehnung durch Gleichaltrige Soziale Phobie Agoraphobie Panikstörung
(3) Medizinische Differentialdiagnostik: Da starke Angstsymptome auch als Folge körperlicher
Erkrankungen auftreten können, muss eine medizinische Differentialdiagnostik mögliche
körperliche Ursachen (z. B. Schilddrüsenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Lungenerkrankungen, Tumore) für die psychischen Auffälligkeiten ausschließen.
(4) Zusätzliche Verfahren: Für eine umfassende Einschätzung der psychischen Auffälligkeiten
des Kindes oder Jugendlichen sollten möglichst weitere diagnostische Verfahren eingesetzt
werden. Dabei erweist es sich als vorteilhaft, unterschiedliche Methoden (z. B. Fragebogen,
Testleistungen, Verhaltensbeobachtungen, Psychophysiologische Messungen; vgl. auch
Kapitel 2.3.2) und verschiedene Beurteiler (z. B. Kind, Eltern, Erzieher, Lehrer) heranzu-
ziehen. Eine Intelligenzdiagnostik ist nicht zwingend erforderlich, kann aber orientierend
hilfreich sein (z. B. CFT 20-R; Weiß, 2006). Bei schulischen Leistungsproblemen und
schulbezogenen Ängsten sollte jedoch immer eine differenzierte Intelligenz- und Leis-
tungsdiagnostik (z. B. WISC-IV; Petermann & Petermann, 2011) erfolgen. Eine Familien-
diagnostik ist ergänzend sinnvoll, um die Ängste der Eltern (z. B. Beck-Angst-Inventar
(BAI), Margraf & Ehlers, 2007), das Erziehungsverhalten der Eltern (z. B. Erziehungsstil-
Inventar (ESI), Krohne & Pulsack, 1995) und die Beziehungen innerhalb der Familie (z. B.
Familien- und Kindergarten-Interaktions-Test (FIT-KIT), Sturzbecher & Freytag, 2000;
Familiensystemtest (FAST), Gehring, 1998) zu erfassen.
2 Theorie 45
(5) Verhaltensanalyse: Das Ziel der Verhaltensanalyse besteht darin, die auslösenden und
aufrechterhaltenden Bedingungen des untersuchten Problemverhaltens zu identifizieren.
Die Verhaltensanalyse kann mit dem Kind und den Eltern gemeinsam oder getrennt
durchgeführt werden. Im Rahmen der Verhaltensanalyse sollten die konkreten angstauslö-
senden Reize (z. B. Situationen, Personen, Tiere, Objekte, Gedanken), die Reaktionen des
Kindes auf die angstauslösenden Reize (Körperliche Symptome, Gedanken, Gefühle,
Verhalten), die Reaktionen der Eltern in den für das Kind angstauslösenden Situationen
(z. B. übertriebene Beruhigung, übermäßige Zuwendung), das Modellverhalten der Eltern
(z. B. Ängste der Eltern, Umgang der Eltern mit eigenen Ängsten) und die Eltern-Kind-
Interaktionen (z. B. überbehütendes Verhalten) erfragt werden. Die gewonnenen Informa-
tionen werden für die differenzierte Planung notwendiger Interventionen verwendet.
Der Erfolg einer durchgeführten Behandlung sollte in regelmäßigen Abständen überprüft
und dokumentiert werden. Eine solche Überprüfung kann zu Beginn, in der Mitte und am
Ende einer Behandlung erfolgen, wenn möglich auch nach einem festgelegten Katamnese-
zeitraum (z. B. nach 6 oder 12 Monaten). Mit Hilfe von Interview- und Fragebogenverfah-
ren lässt sich feststellen, ob die Kriterien der diagnostizierten Störungen noch erfüllt sind
und/oder ob sich die Ausprägung der Symptomatik verringert hat.
2.3.2 Diagnostische Erhebungsmethoden
Interviews
Im Rahmen der multimodalen Diagnostik liefern Interviewverfahren einen gleichermaßen
differenzierten wie umfassenden Überblick über die vorliegenden psychischen Störungen
und erlauben eine zuverlässige Diagnosestellung nach den beiden international anerkannten
Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV. Im deutschen Sprachraum existieren bisher
nur wenige strukturierte Interviewverfahren zur Erfassung psychischer Störungen im
Kindes- und Jugendalter.
Mit dem Psychopathologischen Befund-System für Kinder und Jugendliche (CASCAP-D; Döpfner,
Berner, Flechtner, Lehmkuhl & Steinhausen, 1999) liegt ein halbstrukturiertes Interview
vor, das die wichtigsten Merkmale psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter er-
fasst. Die klinische Beurteilung der einzelnen psychopathologischen Merkmale (Symptome)
2 Theorie 46
basiert auf den Informationen aus der Exploration des Kindes bzw. Jugendlichen und der
begleitenden Bezugsperson sowie auf der Verhaltensbeobachtung des Kindes bzw. Jugend-
lichen in der Untersuchungssituation.
Das Mannheimer Eltern-Interview (MEI; Esser, Blanz, Geisel & Laucht, 1989) ist ein struktu-
riertes Interview, das bedeutsame Hinweise für das Vorliegen einer behandlungsbedürfti-
gen psychischen Störung liefert. Anhand der Informationen aus der Exploration des Kin-
des bzw. Jugendlichen (Kinderversion) und/oder der Eltern (Elternversion) können Aus-
sagen über die Art, den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung
getroffen werden. Beide Interviewverfahren liefern wesentliche Informationen für die Ver-
gabe einer Diagnose nach ICD-10 und/oder DSM-IV; die Zuordnung der Diagnose muss
jedoch von einem erfahrenen Kliniker vorgenommen werden.
Mit den Diagnose-Checklisten (DCL) aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-
10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche II (DISYPS-II; Döpfner, Görtz-Dorten, Lehmkuhl,
Breuer & Goletz, 2008) stehen für die wichtigsten Störungsbereiche im Kindes- und
Jugendalter strukturierte Interviewleitfäden zur Verfügung. Die Diagnose-Checklisten
werden für die Exploration des Kindes bzw. Jugendlichen und/oder der Bezugspersonen
eingesetzt. Die Bestimmung der Diagnose kann – unter Zuhilfenahme von Entscheidungs-
bäumen – wahlweise nach ICD-10 oder DSM-IV erfolgen.
Darüber hinaus existiert mit dem Diagnostischen Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und
Jugendalter (Kinder-DIPS; Unnewehr, Schneider & Margraf, 2009) ein hochstrukturiertes
Interview, das die differenzierte Klassifikation der wichtigsten psychischen Störungen im
Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV-TR ermöglicht. Das für die klinische
Exploration entwickelte Interviewverfahren liegt als Kinder- und Elternversion vor.
Fragebogen
Mit Hilfe von Fragebogenverfahren ist es möglich, die psychischen Auffälligkeiten eines
Kindes oder Jugendlichen auf einfache und ökonomische Weise zu erfassen. Dabei wird
zwischen störungsübergreifenden und störungsspezifischen Fragebogenverfahren unter-
schieden. Störungsübergreifende Fragebogen (sog. Breitbandverfahren), die ein breites
Spektrum psychischer Störungen abdecken, werden eingesetzt, um einen guten Überblick
über psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Kompetenzen zu bekommen. Beispiel-
2 Theorie 47
haft seien hier der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4-18;
Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a), der Lehrerfragebogen über das Ver-
halten von Kindern und Jugendlichen (TRF; Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist,
1993) und der Fragebogen für Jugendliche (YSR; Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior
Checklist, 1998b) genannt. Um eine bestimmte Störung bzw. einen bestimmten Störungs-
bereich differenziert zu erfassen, werden störungsspezifische Fragebogen eingesetzt. Zu
den störungsspezifischen Fragebogen gehören beispielsweise der Elternfragebogen zu sozialen
Ängsten im Kindes- und Jugendalter (ESAK; Weinbrenner, 2005) und das Sozialphobie und -angst-
inventar für Kinder (SPAIK; Melfsen, Florin & Warnke, 2001). Mit Hilfe von Fragebogen-
systemen, wie beispielsweise dem Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und
DSM-IV für Kinder und Jugendliche II (DISYPS-II; Döpfner et al., 2008), können Informatio-
nen von verschiedenen Beurteilern (z. B. Kind, Eltern, Erzieher, Lehrer) in vergleichbarer
Weise eingeholt und direkt miteinander verglichen werden (vgl. auch Kapitel 2.3.3).
Die beiden nachfolgenden Tabellen führen die wichtigsten Fragebogenverfahren zur Erfas-
sung von Angst und Angststörungen im Kindes- und Jugendalter auf, getrennt nach Selbst-
(vgl. Tabelle 6) und Fremdbeurteilungsfragebogen (vgl. Tabelle 7). Mit dem „klassischen“
Fragebogen lässt sich das Selbsturteil von Kindern erst ab einem Alter von etwa 8 Jahren
zuverlässig erheben. Um auch jüngere Kinder zu ihrem Angsterleben befragen zu können,
wurden in den letzten Jahren mehrere bildbasierte Interviewverfahren entwickelt:
Das Angst-Interview (Becker, Lohaus, Frebel & Kiefert, 2002) wurde als standardisiertes
Interview zur Erfassung von Ängsten bei 5- bis 6-jährigen Kindern entwickelt. Es berück-
sichtigt sieben für das Vorschulalter typische Ängste von Kindern: die Angst vor Tieren,
die Angst vor fremden Personen, die Angst vor imaginären Kreaturen, die Angst vor der
Trennung von Bezugspersonen, die Angst vor Dunkelheit, die Angst vor sozialen Situatio-
nen und die Angst vor körperlichen Verletzungen. Mit einer illustrierenden Zeichnung und
einer kurzen Geschichte werden die einzelnen Angstbereiche eingeführt; anschließend
werden die Kinder zu ihrem Angsterleben in der jeweiligen Situation befragt.
Auch das Bochumer Angstverfahren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (BAV 3-11,
Mackowiak & Lengning, 2010) ist ein anhand von Bildern durchgeführtes Interview für
Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren. Anhand von 26 alltäglichen Situationen können
verschiedene im Kindesalter auftretende Ängste erfasst werden: Soziale Ängste, Kognitive
2 Theorie 48
Tabelle 6: Selbstbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen (modifiziert nach In-Albon, 2011, S. 86 f.)
Art der Angststörung Fragebogen/Autoren Beschreibung Altersbereich
Trennungsangst KASI
Kinder-Angstsensitivitätsindex (Schneider & Silverman, in Vorbereitung)
17 Items, 1 Skala: - Angstsensitivität
8 - 17 Jahre
TAI-K
Trennungsangst Inventar (Kindversion) (In-Albon & Schneider, 2011)
16 Items, 1 Skala: - Vermeidungsverhalten
5 - 16 Jahre
Soziale Ängstlichkeit Soziale Phobie
FESUK
Fragebogen zur Erfassung sozialer Unsicherheit bei Kindern (Saile & Kison, 2002)
94 Items, 10 Skalen: - 3 Verarbeitungsebenen x
3 verschiedene soziale Situationen - Soziale Angst - Gesamtwert Verarbeitungsebenen - Gesamtwert Soziale Situationen - Gesamtwert Soziale Unsicherheit
9 - 15 Jahre
SASC-R-D
Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (Kindversion) (Melfsen & Florin, 1997)
18 Items, 2 Skalen: - Furcht vor negativer Bewertung - Vermeidung von und Belastung
durch soziale Situationen
8 - 16 Jahre
SPAIK
Sozialphobie und -angst- inventar für Kinder (Melfsen et al., 2001)
26 Items, 1 Skala: - Angst in sozialen Situationen
8 - 16 Jahre
SÄKK
Fragebogen zur Erfas-sung sozial ängstlicher Kognitionen bei Kindern und Jugendlichen (Gra et al., 2007)
27 Items, 3 Skalen: - Negative Selbstbewertung - Positive Selbstbewertung - Bewältigungsgedanken
8 - 13 Jahre
Generalisierte Angststörung
KAT-II
Kinder-Angst-Test II (Thurner & Tewes, 2000)
38 Items, 3 Skalen: - Ängstlichkeit - Angstzustand: Erwartungsangst - Angstzustand: Erinnerte Angst
9 - 15 Jahre
Spezifische Phobie BAK
Bereichsspezifischer Angstfragebogen für Kinder (Kindversion) (Mack, 2007)
56 Items, 7 Skalen: Ängste vor verschiedenen Objekten und Situationen, u. a. - Angst vor Trennung/
Unbekanntem - Angst vor Fehlern/Kritik - Angst im Schulbereich
9 - 16 Jahre
2 Theorie 49
Art der Angststörung Fragebogen/Autoren Beschreibung Altersbereich
PHOKI
Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche (Döpfner et al., 2006)
96 Items, 7 Skalen Ängste vor verschiedenen Objekten und Situationen, u. a. - Trennungsängste - Soziale Ängste - Schul- und Leistungsängste
8 - 18 Jahre
Schulangst AFS
Angstfragebogen für Schüler (Wieczerkowski et al., 1981)
50 Items, 4 Skalen - Prüfungsangst - Manifeste Angst - Schulunlust - Soziale Erwünschtheit
9 - 17 Jahre
Manifeste Angst RCMAS-G
Revidierte Manifeste-Angst-Skala für Kinder – Deutsche Version (Boehnke et al., 1986)
37 Items, 2 Skalen: - Angstskala (28 Items) - Lügenskala (9 Items)
6 - 18 Jahre
Verschiedene Angststörungen
SCAS-D
Spence Children’s Anxiety Scale – Deutsche Version (Essau et al., 2002)
38 Items, 6 Skalen Screeningverfahren für verschiedene Angststörungen (nach DSM-IV): - Trennungsangst - Soziale Phobie - Generalisierte Angststörung - Panikstörung/Agoraphobie - Angst vor körperlicher Verletzung - Zwangsstörung
8 - 12 Jahre
SCARED
Screen for Child Anxiety Related Emotional Dis-order (Deutsche Version) (Essau et al., 2002)
41 Items, 5 Skalen Screeningverfahren für verschiedene Angststörungen (nach DSM-IV): - Trennungsangst - Soziale Phobie - Generalisierte Angststörung - Panikstörung - Schulangst
7 - 18 Jahre
Alle Angststörungen DISYPS-II: SBB-ANZ
Selbstbeurteilungsbogen Angststörungen (Döpfner et al., 2008)
33 Items, 4 Skalen Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV für folgende Störungen: - Trennungsangst - Soziale Phobie - Generalisierte Angststörung - Spezifische Phobie
11 - 18 Jahre
2 Theorie 50
Tabelle 7: Fremdbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen (modifiziert nach In-Albon, 2011, S. 89 f.)
Art der Angststörung Fragebogen/Autoren Beschreibung Altersbereich
Trennungsangst TAI-E
Trennungsangst Inventar (Elternversion) (In-Albon & Schneider, 2011)
16 Items, 1 Skala: - Vermeidungsverhalten
5 - 16 Jahre
Soziale Ängstlichkeit Soziale Phobie
ESAK
Elternfragebogen zu sozialen Ängsten im Kindes- und Jugendalter (Weinbrenner, 2005)
18 Items, 3 Skalen: - Negative Kognitionen - Körperliche Erregung - Vermeidungsverhalten
8 - 19 Jahre
L-ESAK
Lehrerfragebogen zu sozialen Ängsten im Kindes- und Jugendalter (Stenzel et al., 2009)
18 Items, 3 Skalen: - Negative Kognitionen - Körperliche Erregung - Vermeidungsverhalten
8 - 18 Jahre
SASC-R-D
Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (Elternversion) (Schreier & Heinrichs, 2008)
18 Items, 2 Skalen: - Furcht vor negativer Bewertung - Vermeidung von und Belastung
durch soziale Situationen
8 - 16 Jahre
VBV 3-6
Verhaltensbeurteilungs-bogen für Vorschulkinder (Döpfner et al., 1993)
11 Items (Eltern), 21 Items (Erzieher) Screeningverfahren für verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, u. a. für - Emotionale Auffälligkeiten
3 - 6 Jahre
Verschiedene Angststörungen
BAV 3-11
Bochumer Angst-verfahren für Kinder im Vorschul- und Grund-schulalter (Mackowiak & Lengning, 2010)
26 Items, 4 Skalen: - Soziale Ängste - Kognitive Ängste - Ängste vor Tieren - Ängste vor Verletzung und
körperlicher Beeinträchtigung
3 - 11 Jahre
Alle Angststörungen DISYPS-II: FBB-ANZ
Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (Döpfner et al., 2008)
33 Items, 4 Skalen Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV für folgende Störungen: - Trennungsangst - Soziale Phobie - Generalisierte Angst - Spezifische Phobie
4 - 18 Jahre
2 Theorie 51
Ängste, Sorgen und Befürchtungen, Ängste vor Tieren sowie Ängste vor Verletzung und
körperlicher Beeinträchtigung.
Der Basler Bilder-Angst-Test (B-BAT; Schneider, in Druck) ist ein standardisiertes Interview
zur Erfassung von Angst, Vermeidung und Belastung bzw. Beeinträchtigung durch angst-
auslösende Situationen bei Kindern zwischen 4 und 8 Jahren. Anhand von 21 Zeichnungen
werden die im Kindesalter relevanten Angststörungen (Trennungsangst, Soziale Phobie,
Spezifische Phobie, Generalisierte Angststörung) auf kindgerechte Art und Weise erhoben.
Verhaltensbeobachtung
Im Gegensatz zu Interview- und Fragebogenverfahren, die ein retrospektives Urteil über
das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen in einem bestimmten Zeitraum einholen,
erlauben Beobachtungsverfahren die direkte Erfassung eines bestimmten Verhaltens.
Demzufolge können Beobachtungsverfahren im Rahmen der Diagnostik ergänzend einge-
setzt werden, um die vom Kind und/oder von den Eltern berichteten Verhaltensprobleme
zu überprüfen und zu präzisieren.
Die Methoden der Verhaltensbeobachtung können einerseits nach ihrem Ort (diagnostisch
vs. natürlich), andererseits nach ihrem Strukturierungsgrad (niedrig vs. hoch) unterschieden
werden. Zudem können Verhaltensbeobachtungen vom Untersucher und/oder von den
Bezugspersonen des Kindes (z. B. Eltern, Erzieher, Lehrer) durchgeführt werden. Im diag-
nostischen Setting beobachtet der Untersucher das Verhalten des Kindes oder Jugend-
lichen häufig in niedrig strukturierten Situationen, beispielsweise in Untersuchungs-, Test-
und Spielsituationen. Seine Beobachtungen fließen anschließend in das klinische Urteil und
die psychopathologische Beurteilung des Kindes oder Jugendlichen ein. Darüber hinaus
kann der Untersucher eine höher strukturierte, systematische Verhaltensbeobachtung
durchführen, indem er eine möglichst realitätsnahe soziale Situation in einem diagnosti-
schen Rollenspiel simuliert. In dieser künstlich hergestellten Interaktionssituation wird das
Kind oder der Jugendliche mit einer bestimmten Aufgabe konfrontiert, beispielsweise mit
dem Halten einer kurzen Rede vor einer Gruppe von Zuhörern oder mit dem Führen eines
Gesprächs mit einer unbekannten Person. Die Ratingskala für soziale Kompetenz (RSK;
Fydrich & Bürgener, 2005) ist ein Beobachtungsverfahren, das für die standardisierte Aus-
wertung solcher Verhaltensbeobachtungen entwickelt wurde. Zur Beurteilung der sozialen
Kompetenz werden fünf Kategorien herangezogen, die klar definierte Beobachtungskriteri-
2 Theorie 52
en wie die Dauer des Blickkontakts, die Häufigkeit des Lächelns, die Lautstärke der Stimme
und die Dauer des Sprechens beinhalten. Der Untersucher muss allerdings immer überprü-
fen, ob ein im diagnostischen Setting beobachtetes Verhalten für ein Kind bzw. einen
Jugendlichen typisch ist, indem er seine Verhaltensbeobachtungen mit anderen Informa-
tionen (z. B. mit Beobachtungen der Eltern im natürlichen Setting) abgleicht. Im natür-
lichen Setting beobachten der Untersucher und/oder die Bezugspersonen das Verhalten
des Kindes oder Jugendlichen in realen sozialen Situationen (z. B. Kindergarten, Schule,
Sportverein, Spielplatz). Wenn die Verhaltensbeobachtung von den Bezugspersonen des
Kindes bzw. Jugendlichen durchgeführt wird, sollte die Beobachtung möglichst einfach
gestaltet und das Verhalten möglichst genau eingegrenzt werden, weil die Bezugspersonen
an der zu beobachtenden Situation häufig auch aktiv beteiligt sind. In diesem Zusammen-
hang hat es sich als hilfreich erwiesen, sowohl Hilfsmittel wie Beobachtungsbogen oder
Tagebücher einzusetzen als auch Ton- oder Videoaufzeichnungen anzufertigen. Der
Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten (BSU; Petermann & Petermann, 2010) kann für
die systematische Verhaltensbeobachtung eines Kindes oder Jugendlichen im natürlichen
Umfeld verwendet werden. Dieses Beobachtungsverfahren umfasst zwölf Kategorien, die
sich einerseits auf das Problemverhalten (10 Kategorien; z. B. nicht sprechen, nicht bewe-
gen), andererseits auf das Zielverhalten (2 Kategorien; z. B. mit anderen Kindern spielen,
eine eigene Meinung äußern) beziehen.
2.3.3 Beurteilerübereinstimmung
Wenn Informationen von verschiedenen Beurteilern eingeholt werden, treten häufig Dis-
krepanzen zwischen deren Angaben auf. Viele empirische Studien haben gezeigt, dass die
Korrelationen zwischen Kinder-, Eltern- und Lehrerurteilen eher im unteren bis mittleren
Bereich liegen. Nachfolgend sollen die wichtigsten deutschen und internationalen Studien
zur Beurteilerübereinstimmung bei der Diagnostik psychischer Auffälligkeiten im Kindes-
und Jugendalter vorgestellt werden. Dabei lassen sich die dargestellten Studien hinsichtlich
der eingesetzten Erhebungsinstrumente (Fragebogenverfahren vs. Interviewverfahren)
unterscheiden.
2 Theorie 53
Kinder- und Elternurteile
In Deutschland gibt es bisher nur wenige Studien, die bei der Beurteilung psychischer Auf-
fälligkeiten im Kindes- und Jugendalter unterschiedliche Informationsquellen heranziehen.
Im Rahmen der PAK-KID-Studie (Psychische Auffälligkeiten und Kompetenzen bei Kin-
dern und Jugendlichen in Deutschland) untersuchten Plück, Döpfner und Lehmkuhl (2000)
mit einem störungsübergreifenden Fragebogenverfahren, dem Elternfragebogen über das
Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4-18; Arbeitsgruppe Deutsche Child
Behavior Checklist, 1998a) und dem daraus abgeleiteten Fragebogen für Jugendliche (YSR;
Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998b), die Übereinstimmung zwischen
der Selbsteinschätzung der Jugendlichen und dem Fremdurteil der Eltern. Anhand einer
repräsentativen Stichprobe von 1 757 Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren und ihren
Eltern ermittelten die Autoren für die drei Primärskalen Sozialer Rückzug (r = .46), Körperliche
Beschwerden (r = .46) und Ängstlichkeit/Depressivität (r = .47) sowie für die Sekundärskala
Internalisierende Auffälligkeiten (r = .50) Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdurteil, die
nach den Kriterien von Cohen (1988) bestenfalls einen mittelstarken Zusammenhang
beschreiben. In einer Studie von Salbach-Andrae, Klinkowski, Lenz und Lehmkuhl (2009)
wurde die Beurteilerübereinstimmung im Hinblick auf die psychischen Auffälligkeiten von
Jugendlichen an einer klinischen Stichprobe untersucht. Die störungsübergreifenden
Fragebogenverfahren CBCL/4-18 und YSR wurden auch hier eingesetzt, um die 1 718
deutschen Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren und ihre Eltern nach psychischen
Auffälligkeiten zu befragen. Für die Sekundärskala Internalisierende Auffälligkeiten wurde bei
allen Jugendlichen, egal ob ohne Diagnose (N = 189; r = 0.24), mit einer Diagnose (N =
938; r = 0.24) oder mit zwei und mehr Diagnosen (N = 591; r = 0.23), eine geringe Über-
einstimmung zwischen Selbst- und Fremdurteil festgestellt.
Dagegen wurden bereits viele internationale Studien zur Beurteilerübereinstimmung bei
psychischen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter durchgeführt. Für eine von
Achenbach, McConaughy und Howell (1987) erstellte Meta-Analyse zur Beurteiler-
übereinstimmung von psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen 1 und 19 Jahren wurden 119 Studien ausgewertet, die psychische Auffälligkeiten
anhand von Fragebogen und Interviews erfasst hatten. In 11 dieser Studien wurde die
Übereinstimmung zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und Eltern untersucht. Es wurde
2 Theorie 54
eine durchschnittliche Korrelation von r = .25 ermittelt, die auf eine geringe Übereinstim-
mung des Selbst- und Fremdurteils hinweist.
Ferdinand, van der Ende und Verhulst (2004) verglichen die mit den Fragebogenverfahren
CBCL/4-18 und YSR erhobenen Angaben zu psychischen Auffälligkeiten von 431 Jugend-
lichen (15 bis 18 Jahre) und ihren Eltern aus der niederländischen Bevölkerung. Für die
Primärskalen Sozialer Rückzug (r = .50), Körperliche Beschwerden (r = .53) und Ängstlichkeit/
Depressivität (r = .46) wurden mittlere Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdurteil
gefunden. In einer 20 Länder umfassenden Studie mit den Fragebogenverfahren CBCL/
4-18 und YSR stellte Ginzburg (2009) für die Skala Internalisierende Auffälligkeiten eine eher
geringe Korrelation des Selbst- (Jugendliche) und Fremdurteils (Eltern) von r = .41 fest.
Edelbrock, Costello, Dulcan, Conover und Kalas (1986) gehörten zu den Ersten, die eine
Untersuchung zur Beurteilerübereinstimmung bei psychischen Auffälligkeiten im Kindes-
und Jugendalter auf der Basis eines strukturierten Interviewverfahrens durchführten. Sie
befragten eine klinische Stichprobe von 299 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18
Jahren und ihre Eltern mit dem Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC) (Cos-
tello et al., 1984), das als Kinder- (DISC-C) und Elternversion (DISC-P) vorliegt. Die Kor-
relationen zwischen Selbst- und Fremdurteil lagen für alle Angststörungen (Trennungsangst,
r = .16; Soziale Phobie, r = .24; Spezifische Phobie, r = .29; Generalisierte Angststörung, r = .20) im
unteren Bereich. In einer aktuelleren Studie von Comer und Kendall (2004) wurden 98
Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, die die Kriterien für eine Angststörung (nach DSM-
IV) erfüllten, und ihre Eltern mit dem halbstrukturierten Anxiety Disorders Interview
Schedule for Children and Parents (ADIS-C/P; Silverman & Albano, 1996) untersucht. Die
Eltern-Kind-Übereinstimmung variierte in Abhängigkeit von der psychischen Störung und
fiel auf der Ebene der Symptome (S) höher aus als auf der Ebene der Diagnosen (D) (Tren-
nungsangst – D: 36.17 %, S: 63.44 %; Soziale Phobie – D: 42.86 %, S: 63.43 %; Generalisierte
Angststörung – D: 42.86 %, S: 54.06 %; Alle Angststörungen – D: 41.04 %, S: 61.06 %). In
weiteren klinischen Studien auf der Basis von Interviewverfahren wurden ebenfalls über-
wiegend geringe bis mittlere Zusammenhänge zwischen den Urteilen der Kinder und
Eltern ermittelt (z. B. Choudhury, Pimentel & Kendall, 2003; Grills & Ollendick, 2003).
2 Theorie 55
Eltern- und Lehrerurteile
Achenbach und Mitarbeiter (1987) bezogen in ihre Meta-Analyse zur Beurteilerüberein-
stimmung bei psychischen Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen 26 Studien ein,
die den Zusammenhang zwischen Eltern- und Lehrerurteilen untersucht hatten. Die von
den Autoren ermittelte Korrelation in Höhe von r = .27 beschreibt eine geringe Überein-
stimmung der beiden Fremdurteile. Eine in den USA durchgeführte repräsentative Studie
zur Übereinstimmung von Eltern und Lehrern bei der Beurteilung der psychischen Auffäl-
ligkeiten von 1.028 Kindern bzw. Jugendlichen (11 bis 18 Jahre) mit den Fragebogen-
verfahren CBCL/4-18 (Achenbach, 1991a) und TRF (Achenbach, 1991b) ergab ebenfalls
nur eine niedrige Korrelation von r = .36 (Achenbach, Dumenci & Rescorla, 2002). Auch
die von Ferdinand, van der Ende und Verhulst (2007) mit denselben Fragebogenverfahren
an einer klinischen Stichprobe (N = 532) gewonnenen Daten zeigen, dass Eltern und
Lehrer bei der Beurteilung psychischer Auffälligkeiten kaum übereinstimmen. Die Korrela-
tionen für die Primärskalen Sozialer Rückzug (r = .29), Körperliche Beschwerden (r = .24) und
Ängstlichkeit/Depressivität (r = .24) fielen gering aus. Auch in weiteren Studien wurden nur
geringe bis mittlere Zusammenhänge zwischen den Urteilen der Eltern und Lehrer gefun-
den (z. B. Epkins, 1996; Grietens et al., 2004; Javo, Ronning, Handegard & Rudmin, 2009;
Salbach-Andrae, Lenz & Lehmkuhl, 2009).
Kinder- und Lehrerurteile
In der Meta-Analyse von Achenbach und Mitarbeitern (1987) wurden 17 Studien berück-
sichtigt, die die Übereinstimmung zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Lehrern
bei der Beurteilung psychischer Auffälligkeiten untersucht hatten. Die durchschnittliche
Korrelation zwischen Selbst- und Fremdurteil lag mit r = .20 im unteren Bereich; sie fiel
schlechter aus als die Korrelation zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Eltern.
Zum exakt gleichen Ergebnis kommen Achenbach und Mitarbeiter (2002) in ihrer Unter-
suchung zur Beurteilerübereinstimmung zwischen 1.030 Kindern bzw. Jugendlichen und
ihren Lehrern mit den Fragebogenverfahren YSR (Achenbach, 1991c) und TRF (Achen-
bach, 1991b). Salbach-Andrae, Lenz und Lehmkuhl (2009) untersuchten die Beurteiler-
übereinstimmung im Hinblick auf die psychischen Auffälligkeiten von Jugendlichen an
einer klinischen Stichprobe. Die 611 deutschen Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren
und ihre Lehrer wurden mit YSR (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist,
2 Theorie 56
1998b) und TRF (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1993) nach psychi-
schen Auffälligkeiten befragt. Für die Sekundärskala Internalisierende Auffälligkeiten wurde mit
einer Korrelation von r = .24 eine geringe Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremd-
urteil festgestellt.
2 Theorie 57
2.4 Behandlung von Angststörungen im Kindesalter
2.4.1 Behandlungsverfahren
Überblick
Das Interesse an der Psychotherapieforschung im Bereich der Angststörungen des Kindes-
und Jugendalters hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Damit gingen auch
verstärkte Bemühungen einher, die Wirksamkeit der etablierten Behandlungsverfahren
empirisch zu überprüfen. Bei der Beurteilung der Evidenzbasierung eines Behandlungs-
verfahrens kommt den von der American Psychological Association (APA, 1995)
veröffentlichten Kriterien eine besondere Bedeutung zu. Verschiedene Überblicksarbeiten
(z. B. Chambless & Ollendick, 2001; King & Ollendick, 1998; Ollendick & King, 1998;
Silverman, Pina & Viswesvaran, 2008) haben die Wirksamkeit unterschiedlicher Therapie-
verfahren auf der Grundlage dieser Kriterien eingeschätzt. Der umfassenden Überblicks-
arbeit von Chambless und Ollendick (2001) zufolge kann für die Behandlung von
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter nur die Kognitive Verhaltenstherapie (mit und
ohne Einbezug der Eltern bzw. Familien) als wahrscheinlich wirksam eingeschätzt werden.
Für andere Therapieverfahren (z. B. Psychoanalytische Therapie, Systemische Therapie)
liegen keine hinreichenden Wirksamkeitsnachweise vor (Chambless & Ollendick, 2001;
Connolly & Bernstein, 2007); sie können nur als möglicherweise wirksam eingeordnet wer-
den. Es fehlen ausreichend Studien, die die geforderten methodischen Standards erfüllen,
um diese Therapieverfahren als evidenzbasiert zu beurteilen (z. B. Target & Fonagy, 1994).
Da die meisten Therapiestudien für die Kognitive Verhaltenstherapie vorliegen und sich
auch die vorliegende Arbeit mit der empirischen Überprüfung einer kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Intervention beschäftigt, beschränken sich alle nachfolgenden
Darstellungen auf diese Therapieform.
Allgemeine Wirksamkeit
Silverman und Kollegen (2008) nahmen eine Aktualisierung der Überblicksarbeit von
Chambless und Ollendick (2001) vor und kamen dabei zu ähnlichen Ergebnissen. Auch
ihrer Einschätzung nach gibt es derzeit keine kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interven-
tionen für Kinder und Jugendliche mit Angststörungen, die die Kriterien für ein gut wirk-
2 Theorie 58
sames und gut überprüftes Behandlungsverfahren erfüllen, was darauf zurückzuführen ist, dass
nicht genug Gruppenvergleichsstudien vorliegen, die die Wirksamkeit der Kognitiven Ver-
haltenstherapie mit einer Placebo-Behandlung, einer pharmakologischen Behandlung oder
einer anderen (bereits etablierten) therapeutischen Behandlung vergleichen. Zu den wahr-
scheinlich wirksamen, aber (noch) nicht ausreichend überprüften Behandlungsverfahren gehören u. a.
die Kognitive Verhaltenstherapie als Einzeltherapie (IKVT ohne Eltern; z. B. Barrett, Dadds
& Rapee, 1996; Cobham, Dadds & Spence, 1998; Flannery-Schroeder & Kendall, 2000;
Kendall et al., 1997; Kendall, Hudson, Gosch, Flannery-Schroeder & Suveg, 2008) und als
Gruppentherapie (GKVT ohne Eltern; z. B. Barrett, 1998; Flannery-Schroeder & Kendall,
2000; Mendlowitz et al., 1999) sowie die Kognitive Verhaltenstherapie als Gruppentherapie
mit (zusätzlichem) Einbezug der Eltern (GKVT mit Eltern; z. B. Barrett, 1998; Manassis et
al., 2002; Silverman et al., 1999a). Diese Interventionen erfüllen die von der APA-
Arbeitsgruppe aufgestellten Kriterien (vgl. Chambless et al., 1998; Chambless & Ollendick,
2001) für ein wahrscheinlich wirksames Behandlungsverfahren, weil jeweils mindestens
zwei Gruppenvergleichsstudien von verschiedenen Arbeitsgruppen die (statistisch signifi-
kante) Überlegenheit gegenüber einer (Warte-)Kontrollgruppe nachweisen. Wenn für ein
Behandlungsverfahren bisher nur eine Gruppenvergleichsstudie vorliegt oder mehrere
Gruppenvergleichsstudien nur von einer Arbeitsgruppe durchgeführt wurden, wird dieses
Behandlungsverfahren als möglicherweise wirksam, aber nicht angemessen überprüft bezeichnet. Zu
diesen Interventionen zählen beispielsweise die Kognitive Verhaltenstherapie als Einzel-
therapie mit (zusätzlichem) Einbezug der Eltern (IKVT mit Eltern; z. B. Barrett et al., 1996;
Cobham et al., 1998; Manassis et al., 2002; Nauta, Scholing, Emmelkamp & Minderaa,
2003) sowie die Kognitive Verhaltenstherapie für Familien (KVT für Familien; z. B. Bögels
& Siqueland, 2006; Kendall et al., 2008; Wood, Piacentini, Southam-Gerow, Chu &
Sigman, 2006).
Um die allgemeine Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie besser einschätzen zu
können, werden die Ergebnisse der zahlreichen Therapiestudien in Überblicksarbeiten und
Meta-Analysen systematisch zusammengefasst. So zeigen verschiedene Überblicksarbeiten,
dass inzwischen evidenzbasierte, kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen für eine
erfolgreiche Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter zur Verfügung
stehen (z. B. Bachmann, Bachmann, Rief & Mattejat, 2008; Compton et al., 2004; Ed-
munds, O’Neil & Kendall, 2011; Silverman et al., 2008). In den letzten Jahrzehnten wurden
allerdings nur wenige Meta-Analysen durchgeführt, die die Wirksamkeit der kognitiven
2 Theorie 59
Verhaltenstherapie bei Angststörungen im Kindes- und Jugendalter untersucht haben (In-
Albon & Schneider, 2007; Ishikawa, Okajima, Matsuoka & Sakano, 2007; Silverman et al.,
2008; Weisz, Weiss, Alicke & Klotz, 1987; Weisz, Weiss, Han, Granger & Morton, 1995).
Da in den meisten Therapiestudien Kinder mit verschiedenen Angststörungen gemeinsam
behandelt werden (mit Ausnahme der Sozialen Phobie), sind gegenwärtig fast keine Aus-
sagen über die Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungen bei spezifi-
schen Angststörungen möglich. In der von In-Albon und Schneider (2007) durchgeführten
Meta-Analyse wurden 24 randomisierte, kontrollierte Therapiestudien berücksichtigt, die
bis März 2005 in deutscher oder englischer Sprache veröffentlicht worden waren. In den
Interventionsgruppen wurde für die kurzfristige Wirksamkeit der kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Interventionen eine durchschnittliche Effektstärke von 0.86 und für die
langfristige Wirksamkeit (nach einem Zeitraum von etwa 10 Monaten) eine durchschnittli-
che Effektstärke von 1.36 ermittelt. Wenn die Interventions- und Kontrollgruppen zum
Zeitpunkt nach der Intervention bzw. Wartezeit miteinander verglichen wurden, fiel die
durchschnittliche Effektstärke mit 0.66 moderat aus. Nach der Intervention bzw. Wartezeit
erfüllten nur noch 31 % der Kinder in den Interventionsgruppen, aber immer noch 81 %
der Kinder in den Kontrollgruppen die Kriterien für ihre ursprüngliche Diagnose. In einer
anderen Meta-Analyse errechneten Ishikawa und Kollegen (2007) über 20 randomisierte,
kontrollierte Therapiestudien für die kurzfristige Wirksamkeit innerhalb der Interventions-
gruppen eine durchschnittliche Effektstärke von 0.94; dieser Effekt blieb bis zu 24 Monate
nach Therapieende stabil. Für den Vergleich zwischen den Interventions- und Kontroll-
gruppen zum Zeitpunkt nach der Intervention bzw. Wartezeit ergab sich mit 0.61 auch hier
eine moderate durchschnittliche Effektstärke. Die Ergebnisse dieser beiden Meta-Analysen
liegen mit durchschnittlichen Effektstärken von 0.86 und 0.94 für den Prä-Post-Vergleich
in den Interventionsgruppen sowie von 0.61 und 0.66 für den Vergleich zwischen den
Interventions- und Kontrollgruppen zum Posttest sehr nah beieinander.
Während die kurzfristige Wirksamkeit der Kognitiven Verhaltenstherapie für ängstliche
Kinder und Jugendliche bereits vielfach nachgewiesen wurde, gibt es nur vergleichsweise
wenige Studien, die die Stabilität der Behandlungserfolge über einen Katamnesezeitraum
von mehr als 12 Monaten untersuchen. Die derzeit verfügbaren Langzeitstudien wurden
von den Arbeitsgruppen um Barrett (Barrett, Duffy, Dadds & Rapee, 2001), Beidel (Beidel,
Turner, Young & Paulson, 2005; Beidel, Turner & Young, 2006), Kendall (Kendall,
Safford, Flannery-Schroeder & Webb, 2004; Kendall & Southam-Gerow, 1996), Manassis
2 Theorie 60
(Manassis, Avery, Butalia & Mendlowitz, 2004) und Silverman (Saavedra, Silverman,
Morgan-Lopez & Kurtines, 2010) durchgeführt. Diese Studien beeindrucken mit dem
Ergebnis, dass die Behandlungserfolge bis zu 13 Jahre nach Therapieende aufrechterhalten
und teilweise sogar noch verbessert werden konnten. Im Rahmen ihrer Meta-Analyse
errechneten In-Albon und Schneider (2007) mittlere bis große Effektstärken für die Ka-
tamnesestudien von Kendall und Southam-Gerow (1996; 3-Jahres-Katamnese: d‘ = 0.61),
Barrett und Kollegen (2001; 6-Jahres-Katamnese: d‘ = 0.82) sowie Kendall und Kollegen
(2004; 7-Jahres-Katamnese: d‘ = 1.13 im Kinderurteil, d‘ = 1.54 im Elternurteil). In der
Katamnesestudie von Saavedra und Kollegen (2010) wurden 67 junge Erwachsene unter-
sucht, die vor 8 bis 13 Jahren an einer Therapiestudie teilgenommen hatten (Silverman et
al., 1999a, b). Zum Zeitpunkt der Katamnese erfüllten 92.5 % der Studienteilnehmer die
Diagnosekriterien ihrer ursprünglichen Angststörung nicht mehr. Zudem wiesen 82.1 %
der Studienteilnehmer keine neue Diagnose auf. Diese Ergebnisse zeigen eindrucksvoll,
dass die Kognitive Verhaltenstherapie zu einer nachhaltigen Verbesserung der psychischen
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen führt.
In etlichen Studien beschränkten sich die Behandlungserfolge nicht nur auf den Rückgang
der Angstsymptomatik, sondern zeigten sich auch in einer signifikanten Verringerung der
komorbiden depressiven Symptomatik. Manassis und Mitarbeiter (2002) untersuchten den
Einfluss von Einzel- und Gruppentherapie (mit Einbezug der Eltern) auf die von den
Kindern berichtete depressive Symptomatik. An ihrer Studie nahmen 78 Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahren teil, die eine Angststörung nach DSM-IV (Trennungsangst, Soziale
Phobie, Generalisierte Angststörung, Panikstörung) aufwiesen. Neben der Abnahme der
Angstsymptomatik und der Zunahme der allgemeinen Funktionsfähigkeit zeigte sich nach
Behandlungsende in beiden Gruppen auch eine signifikante Verringerung der depressiven
Symptomatik. Suveg und Kollegen (2009) verglichen die Wirksamkeit kind- und familien-
zentrierter Interventionen: In allen Behandlungsgruppen zeigten Kinder und Jugendliche
(N = 161; 7 bis 14 Jahre; Angststörung nach DSM-IV) eine signifikante Verringerung der
selbst berichteten depressiven Symptomatik (d = 0.65). Ähnliche Ergebnisse wurden auch
in anderen Studien gefunden (z. B. Farrell, Barrett & Claassens, 2005; Kendall, 1994; Ken-
dall et al., 1997; Kendall, Safford et al., 2004; Nauta et al., 2003; Silverman et al., 1999b).
Die Ergebnisse der Meta-Analyse von In-Albon und Schneider (2007) liefern weitere empi-
rische Hinweise für eine signifikante Verringerung der depressiven Symptomatik. Zum
Zeitpunkt nach der Intervention bzw. Wartezeit wurde für die Reduktion der depressiven
2 Theorie 61
Symptomatik eine durchschnittliche Effektstärke von 0.70 in den Interventionsgruppen
und von 0.20 in den Kontrollgruppen ermittelt. Wurden die Interventions- und Kontroll-
gruppen miteinander verglichen, fiel die durchschnittliche Effektstärke mit 0.66 moderat
aus. In früheren Meta-Analysen wurden ähnliche (z. B. Weisz et al., 1995) oder höhere
Effektstärken (z. B. Weisz et al., 1987) für die psychotherapeutische Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Depressiven Störungen erzielt. Dieser Zusammenhang lässt sich
unter anderem damit erklären, dass Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter häu-
fig als Folge von Angststörungen auftreten (Cole, Peeke, Martin, Truglio & Seroczynski,
1998), so dass die Behandlung von Angststörungen folgerichtig zu einer Verringerung der
depressiven Symptomatik führen sollte. Darüber hinaus weisen die kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Therapieprogramme, die für die Behandlung von Depressiven Störungen
im Kindes- und Jugendalter entwickelt wurden (z. B. Abel & Hautzinger, 2013; Harrington,
2001), eine große Ähnlichkeit mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprogrammen
zur Behandlung von Angststörungen auf. Aufgrund dieser inhaltlichen Überschneidung
(z. B. Kognitive Umstrukturierung, Soziales Kompetenztraining) überrascht es nicht, dass
mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen zur Behandlung von Angststörun-
gen auch komorbide Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen positiv beein-
flusst werden können.
Differentielle Wirksamkeit
Zur differentiellen Wirksamkeit von kognitiver Verhaltenstherapie bei Angststörungen im
Kindes- und Jugendalter sind noch viele offene Fragen zu klären. In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig, Mediatoren (z. B. Therapieprozesse wie Gesprächsführung, Beziehungs-
gestaltung, Motivationsarbeit) und Moderatoren (z. B. Merkmale des Kindes, der Familie, des
Umfeldes) zu untersuchen, um Aussagen darüber treffen zu können, welche Wirkfaktoren
für einen Therapieerfolg verantwortlich sind. Bisher liegen nur wenige Studien vor, die den
Einfluss von soziodemografischen, psychosozialen und diagnostischen Merkmalen der
Patienten auf das Behandlungsergebnis untersucht haben (Moderatoren; vgl. für einen
Überblick Ollendick, Jarrett, Grills-Taquechel, Hovey & Wolff, 2008; Silverman et al.,
2008). Im englischen Sprachraum untersuchten beispielsweise Kendall und Kollegen (z. B.
Kendall, 1994; Kendall et al., 1997; Kendall, Brady & Verduin, 2001; Southam-Gerow,
Kendall & Weersing, 2001; Treadwell, Flannery-Schroeder & Kendall, 1995) das
Geschlecht der Kinder, die ethnische Zugehörigkeit der Familien, die komorbiden
2 Theorie 62
psychischen Störungen des Kindes, die Wahrnehmung der therapeutischen Beziehung aus
Sicht des Kindes und die Wahrnehmung des elterlichen Engagements aus Sicht des
Therapeuten als mögliche Prädiktoren des Behandlungserfolgs. Keines der genannten
Merkmale stellte sich als bedeutsamer Prädiktor bei der kognitiv-verhaltenstherapeutischen
Behandlung von Angststörungen heraus. Auch Silverman und Kollegen (z. B. Berman,
Weems, Silverman & Kurtines, 2000) fanden keinen Einfluss des Geschlechts, des Alters,
der ethnischen Zugehörigkeit, des Familieneinkommens, der Anzahl der Diagnosen, der
Komorbidität und des Schweregrads der Symptomatik auf das Behandlungsergebnis. Im
deutschen Sprachraum konnte Ahrens-Eipper (2003) zeigen, dass sich keiner der von ihr
untersuchten Faktoren (u. a. Geschlecht, Alter, Temperamentsmerkmale, Komorbidität)
auf die Wirksamkeit eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Trainings für sozial unsichere
Kinder ungünstig auswirkte. Auch Kühl (2005) konnte feststellen, dass das Geschlecht, das
Alter, der Schweregrad der Symptomatik und die Komorbidität keinen Einfluss auf die
Wirksamkeit eines Therapieprogramms hatten; alle sozial ängstlichen Kinder profitierten
gleichermaßen von der Behandlung. Dagegen wurden bisher nur einzelne Merkmale identi-
fiziert, die den Behandlungserfolg nachweislich beeinflussen. So führen beispielsweise elter-
liche Depressivität (Berman et al., 2000), dysfunktionale Familienbeziehungen, erziehungs-
bedingter Stress und elterliche Frustration (Crawford & Manassis, 2001) zu einem schlech-
teren Behandlungsergebnis.
Werden die Ergebnisse der bisher vorliegenden Studien zusammengefasst, kann kein Zu-
sammenhang zwischen dem Geschlecht oder Alter der Kinder und dem Behandlungserfolg
festgestellt werden (z. B. Ahrens-Eipper, 2003; Alfano et al., 2009; Beidel, Turner & Mor-
ris, 2000; Berman, Weems, Silverman & Kurtines, 2000; Kendall et al., 1997; Kühl, 2005;
Suveg et al., 2009); d. h. der Behandlungserfolg wird weder durch das Geschlecht noch
durch das Alter des Kindes moderiert. Hinsichtlich der Komorbidität als weiterem Moderator
haben verschiedene Forschergruppen übereinstimmend festgestellt, dass Anzahl und Art
der komorbiden psychischen Störungen das Ergebnis einer Psychotherapie bei verschiede-
nen Angststörungen im Kindes- und Jugendalter nicht signifikant beeinflussen (z. B.
Alfano et al., 2009; Kendall et al., 2001; Shortt, Barrett, Dadds & Fox, 2001; Silverman et
al., 1999b). Nur in wenigen Studien führte das Vorliegen einer komorbiden psychischen
Störung zu einer signifikanten, aber geringfügigen Abschwächung des Therapieerfolgs
(Berman et al., 2000; Crawley, Beidas, Benjamin, Martin & Kendall, 2008; Rapee, 2003). Im
Rahmen einer Therapiestudie mit Kindern und Jugendlichen (N = 106; 6 bis 17 Jahre;
2 Theorie 63
Angststörung nach DSM-III-R) untersuchten Berman und Kollegen (2000) verschiedene
Prädiktoren des Therapieerfolgs. Die Autoren stellten fest, dass sich die Studienteilnehmer
mit gutem und schlechtem Behandlungsergebnis weder in der Anzahl der Diagnosen noch
im Vorliegen der komorbiden psychischen Störungen unterschieden. Zwischen beiden
Gruppen zeigten sich jedoch Unterschiede beim Vorliegen einer komorbiden depressiven
Störung, und zwar dahingehend, dass die Kinder, die eine komorbide depressive Störung
aufwiesen, mit höherer Wahrscheinlichkeit ein schlechteres Behandlungsergebnis erzielten.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Crawley und Kollegen (2008), die Kinder und Jugend-
liche mit verschiedenen Angststörungen (Trennungsangst, Soziale Phobie, Generalisierte
Angststörung) verglichen. Die Kinder mit Sozialer Phobie profitierten weniger von der
kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung als die Kinder mit Trennungsangst oder
Generalisierter Angststörung. Dieser Unterschied verschwand, wenn die sozial phobischen
Kinder mit komorbider depressiver Störung aus den Analysen ausgeschlossen wurden.
Übereinstimmend mit Berman et al. (2000) zeigte sich in einer aktuellen Studie von O’Neil
und Kendall (2012), dass von den Kindern (N = 72, 7 bis 14 Jahre; Angststörung nach
DSM-IV) berichtete, höhere Depressionswerte (im Sinne einer begleitenden depressiven
Symptomatik) das Behandlungsergebnis ungünstig beeinflussten. Gleichzeitig stellte sich
jedoch heraus, dass die Diagnose einer komorbiden depressiven Störung keinen Einfluss
auf das Behandlungsergebnis hatte – ein Ergebnis, das im Widerspruch zu den früheren
Forschungsergebnissen von Berman et al. (2000) und Crawley et al. (2008) steht.
2.4.2 Behandlungssettings
Bei der Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter stellt sich auch die
Frage, ob die Art des Therapiesettings (Einzel- vs. Gruppentherapie, Kind- vs. Familien-
zentrierte Therapie) einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis hat. Bisher liegen nur
wenige direkte Vergleiche zur Wirksamkeit von Einzel- und Gruppentherapie bei Angst-
störungen im Kindes- und Jugendalter vor (Flannery-Schroeder & Kendall, 2000; Manassis
et al., 2002; Muris, Mayer, Bartelds, Tierney & Bogie, 2001). Diese Studien kommen über-
einstimmend zu dem Ergebnis, dass Einzel- und Gruppentherapie vergleichbar effektiv
sind. Auch in der Meta-Analyse von In-Albon und Schneider (2007) zeigte sich, dass Ein-
zel- und Gruppentherapie sowohl beim Prä-Post-Vergleich innerhalb der Interventions-
2 Theorie 64
gruppen (d‘ = 1.00 bzw. 0.97) als auch beim Vergleich zwischen den Interventions- und
Kontrollgruppen zum Posttest (d = 0.52 bzw. 0.61) ähnlich große Effekte erzielten. 72.1 %
der Kinder, die Einzeltherapie bekommen hatten, und 66.0 % der Kinder, die Gruppen-
therapie erhalten hatten, erfüllten unmittelbar nach der Behandlung die ursprünglichen
Diagnosekriterien nicht mehr.
Die Wirksamkeit des Einbezugs von Eltern bzw. Familien in die Therapie ist noch nicht
hinreichend geklärt; hier kommen die bisher vorliegenden Studien zu divergenten Ergeb-
nissen (vgl. für einen Überblick Creswell & Cartwright-Hatton, 2007). Während einige
Studien eine verbesserte Effektivität durch den Einbezug der Eltern nachweisen konnten
(z. B. Barrett, 1998; Barrett, Dadds & Rapee, 1996; Mendlowitz et al., 1999; Wood et al.,
2006), fanden andere Studien keine Effektivitätsunterschiede zwischen kind- und familien-
zentrierten Interventionen (z. B. Barrett et al., 2001; Moreno, 2007; Nauta et al., 2003;
Siqueland, Rynn & Diamond, 2005; Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000). In-
Albon und Schneider (2007) konnten mit ihrer Meta-Analyse zeigen, dass beide Therapie-
settings erfolgreich sind und sich hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Effektstärken nicht
signifikant unterscheiden (Prä-Post-Effektstärken (nur IG): d‘ = 0.91 vs. 0.83, (IG vs. KG):
d‘ = 0.53 vs. 0.63). Auch Ishikawa und Kollegen (2007) fanden in ihrer Meta-Analyse kaum
einen Unterschied (0.03) zwischen der Wirksamkeit beider Therapiesettings. Es ist jedoch
noch immer weitgehend unklar, wer wann von welchem Therapiesetting (Einzel- oder
Gruppentherapie, Kind- oder Familienzentrierte Therapie) am besten profitiert. Laut
Barmish und Kendall (2005) kann der Einbezug der Eltern bzw. Familien zu einer besseren
Wirksamkeit der Therapie führen, wenn die Kinder jünger (als 11 Jahre) sind (z. B. Barrett
et al., 1996), wenn die Kinder unter Trennungsängsten leiden oder wenn die Eltern selbst
starke Ängste aufweisen (z. B. Cobham et al., 1998; Kendall et al., 2008). Zusammen-
fassend bedeutet dies, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen unabhängig
von der Art des Therapiesettings wirksam sind (In-Albon & Schneider, 2007; Ishikawa et
al., 2007; Silverman et al., 2008) und der Einbezug der Eltern für die erfolgreiche Behand-
lung einer Angststörung bei Kindern und Jugendlichen nicht zwingend erforderlich ist.
2 Theorie 65
2.4.3 Behandlungsmethoden
Die meisten kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprogramme zur Behandlung von
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter bestehen aus einer Kombination von Kon-
frontationsverfahren (91 %), kognitiven Interventionen (67 %), Entspannungsverfahren
(52 %) und Selbstinstruktionen (38 %) (In-Albon & Schneider, 2007). Darüber hinaus zäh-
len aber auch Psychoedukation, soziales Kompetenztraining, operante Methoden und
Hausaufgaben zu den gängigen Behandlungsmethoden. Werden die Eltern in die Behand-
lung des Kindes bzw. Jugendlichen einbezogen, werden häufig Hinweise für den Umgang
mit den Ängsten des Kindes bzw. Jugendlichen gegeben, Kommunikations- und Problem-
lösefertigkeiten vermittelt und Strategien für den Umgang mit eigenen Ängsten erarbeitet
(In-Albon & Schneider, 2007). Da sich die bisherige Forschung zur Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Angststörungen im Wesentlichen auf die Evaluation komplexer
Behandlungsprogramme beschränkt hat, können (fast) keine Aussagen zur Wirkungsweise
spezifischer Behandlungsmethoden getroffen werden (Edmunds et al., 2011; Hudson,
2005). Im Folgenden werden die wesentlichen Behandlungselemente einer Kognitiven
Verhaltenstherapie kurz vorgestellt (vgl. für mehr Informationen In-Albon, 2011).
Psychoedukation
Im Rahmen der Psychoedukation werden dem Kind bzw. dem Jugendlichen allgemeine
Informationen über Angst und Angststörungen vermittelt. So werden beispielsweise die
drei Komponenten der Angst (Körperliche Symptome, Gedanken, Verhalten) erläutert, der
Unterschied zwischen normaler und krankhafter Angst erklärt und die Symptomatik der
spezifischen Angststörung genau beschrieben. Für eine altersgerechte Vermittlung dieser
Informationen können anschauliche Bildmaterialien, Bücher, Hörspiele oder Filme heran-
gezogen werden (z. B. Schneider & Borer, 2007). Anschließend wird ein gemeinsames
Störungsmodell entwickelt, das die Entstehung und Aufrechterhaltung der spezifischen
Angststörung verständlich erklärt und aus dem sich das Behandlungskonzept überzeugend
ableiten lässt. Bei alledem ist es wichtig, die Überlegungen und Erfahrungen des Kindes
bzw. Jugendlichen zu erfragen und diese in die Informationsvermittlung einzubeziehen.
Die Psychoedukation zielt darauf ab, das Kind bzw. den Jugendlichen dabei zu unterstüt-
zen, seine eigenen Ängste und Bewältigungsstrategien zu entdecken und zu benennen.
2 Theorie 66
Kognitive Interventionen
Mit Hilfe kognitiver Interventionen wird das Kind bzw. der Jugendliche in die Lage ver-
setzt, seine (automatischen) angstauslösenden und/oder -aufrechterhaltenden Gedanken zu
erkennen, zu überprüfen und zu verändern (Kognitive Umstrukturierung). Nachdem der
Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten beispielsweise mit Bildern
oder Comicgeschichten herausgearbeitet wurde (z. B. Melfsen & Walitza, 2012; Petermann
& Petermann, 2010), werden gemeinsam mit dem Kind bzw. Jugendlichen alternative hilf-
reiche Gedanken und/oder positive Selbstinstruktionen entwickelt, um angstauslösende
Situationen zukünftig besser bewältigen zu können. Darüber hinaus können weitere kogni-
tive Techniken wie das Hinterfragen von Befürchtungen, das Testen von Vorhersagen und
die Überprüfung von Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sinnvoll eingesetzt werden. Für
die kognitive Umstrukturierung werden in vielen Therapiemanualen kindgerechte Arbeits-
materialien zur Verfügung gestellt (z. B. Büch & Döpfner, 2012; Tuschen-Caffier, Kühl &
Bender, 2009). Auch das an der Universität Zürich für 9- bis 13-jährige Kinder mit unter-
schiedlichen psychischen Störungen entwickelte Computerspiel „Die Schatzsuche“
(Brezinka, 2007) kann die kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung unterstützen. In
einer Studie untersuchten Kendall und seine Mitarbeiter (1997) die Wirksamkeit eines aus
zwei Teilen bestehenden Therapieprogramms für Kinder mit verschiedenen Angst-
störungen (N = 94; 9 bis 13 Jahre). Sie stellten fest, dass nicht allein die kognitiven Inter-
ventionen (erster Teil), sondern erst die Kombination aus kognitiven Interventionen und
anschließenden Expositionsübungen (zweiter Teil) entscheidende Verbesserungen bewirkt.
(Reiz-)Konfrontationsverfahren
Während der Expositionsübungen wird das Kind bzw. der Jugendliche mit den individuell
angstauslösenden Situationen (z. B. Trennung von der Bezugsperson, Kontakt mit fremder
Person, Prüfung) systematisch konfrontiert. Dabei wird verhindert, dass das Kind die
Situation vermeidet, aus der Situation flieht oder sich von der Situation ablenkt (Reaktions-
verhinderung). Das Ziel der Konfrontation besteht darin, dem Kind die Erfahrung zu ver-
mitteln, dass es sich an die Situation gewöhnt (Habituation) und die von ihm befürchteten
Konsequenzen nicht eintreten. Die Konfrontation (in vivo) erfolgt üblicherweise in fol-
genden Schritten: Zunächst wird gemeinsam mit dem Kind bzw. Jugendlichen eine indivi-
duelle Angsthierarchie erstellt. Nach einer sorgfältigen Vorbereitung wird mit der Durch-
2 Theorie 67
führung der Expositionsübungen begonnen, wobei für Kinder (bis 12 Jahre) ein graduiertes
Vorgehen empfohlen wird (Schneider & Blatter, 2006). Das Kind muss solange in der
angstauslösenden Situation verbleiben, bis es einen deutlichen Angstabfall erlebt; es darf
dabei jedoch keine angstreduzierenden Strategien wie Entspannung einsetzen. Um eine
anhaltende Verringerung der Angstsymptomatik zu erzielen, müssen diese Expositions-
übungen in möglichst kurzen Abständen wiederholt werden. Sie sollten also nicht nur wäh-
rend der Therapiesitzungen, sondern auch zwischen den Therapiesitzungen durchgeführt
und nach der Beendigung der Therapie fortgesetzt werden. Die Expositionsübungen kön-
nen mit einem Verstärkerprogramm kombiniert werden, um einen zusätzlichen Anreiz für
die Bewältigung der gefürchteten Situationen zu schaffen. Ausführlichere Informationen
zur Anwendung von Konfrontationsverfahren bei Kindern und Jugendlichen können ei-
nem Übersichtsartikel von Bouchard, Mendlowitz, Coles und Franklin (2004) entnommen
werden.
Operante Methoden
Mit positiver Verstärkung kann das Kind bzw. der Jugendliche für die erfolgreiche Bewälti-
gung der angstauslösenden Situationen belohnt werden. Damit wird die Auftretenswahr-
scheinlichkeit des bisher nicht (oder zu wenig) gezeigten angstbewältigenden Verhaltens
gezielt erhöht. Bei den sehr häufig eingesetzten Token-Systemen erfolgt die positive Ver-
stärkung durch die zeitnahe Vergabe von Tokens, die nach einer vorher vereinbarten Regel
gegen bestimmte Verstärker eingetauscht werden können. Diese Verstärker sollten indivi-
duell ausgewählt werden, wobei sozialen Verstärker (z. B. mit dem Kind ein Spiel spielen,
einen Freund besuchen, einen Ausflug machen) der Vorzug vor materiellen Verstärkern
(z. B. Süßigkeiten, Spielzeug, Geld) gegeben werden sollte. Die Implementierung eines
Verstärkerplans wird in einigen Therapiemanualen (z. B. Büch & Döpfner, 2012; Suhr-
Dachs & Döpfner, 2005) detailliert beschrieben.
Soziales Kompetenztraining
Kinder und Jugendliche mit Angststörungen, insbesondere diejenigen mit Sozialer Ängst-
lichkeit bzw. Sozialer Phobie, können auch soziale Kompetenzdefizite aufweisen. Dabei
kann ein Mangel an sozialen Fertigkeiten den Erfolg von Expositionsübungen gefährden.
Deshalb zielt ein Training sozialer Kompetenzen darauf ab, sozial kompetentes und selbst-
2 Theorie 68
sicheres Verhalten aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Dafür müssen die Kinder bzw.
Jugendlichen nicht nur soziale Fertigkeiten erwerben, sondern auch Hemmungen überwin-
den, um die erworbenen bzw. bereits vorhandenen Fertigkeiten in sozialen Situationen
zeigen zu können. Im Puppen- und/oder Rollenspiel sowie mit Hilfe von Verhaltens-
übungen werden grundlegende soziale Kompetenzen alltagsnah eingeübt (z. B. nach den
Hausaufgaben fragen, eine Verabredung treffen, eigene Interessen durchsetzen). Die korri-
gierenden und bestätigenden Rückmeldungen des Therapeuten oder anderer Patienten
(z. B. zur Dauer des Blickkontakts, zur Lautstärke beim Sprechen) helfen dabei, eine realis-
tische Selbsteinschätzung zu fördern und möglichen Unsicherheiten über die Angemessen-
heit des Verhaltens entgegenzuwirken. Um die Therapiefortschritte zu überprüfen, können
zusätzlich in regelmäßigen Abständen Videoaufzeichnungen angefertigt werden. In zahlrei-
chen Therapiemanualen wird ein inhaltlicher Schwerpunkt auf die Vermittlung sozialer
Kompetenzen gelegt (z. B. Beck, Cäsar & Leonhardt, 2008; Petermann & Petermann, 2010;
Tuschen-Caffier et al., 2009). Die Wirksamkeit sozialer Kompetenztrainings im Kindes-
und Jugendalter konnte in einer Meta-Analyse von Beelmann, Pfingsten und Lösel (1994)
nachgewiesen werden. Allerdings kann keine Aussage über den spezifischen Einsatz bei
Angststörungen getroffen werden, weil in dieser Studie nur zwischen Kindern mit internali-
sierenden und externalisierenden Auffälligkeiten unterschieden wurde.
Entspannungsverfahren
Der Einsatz von Entspannungstechniken kann bei einigen Kindern und Jugendlichen als
zusätzliche Behandlungsmethode durchaus hilfreich sein. Vor allem wenn körperliche
Symptome wie Anspannung, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit im Vordergrund stehen,
können Entspannungsverfahren wie Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training
oder Atemtraining sinnvoll eingesetzt werden, um das allgemeine Anspannungsniveau eines
Kindes bzw. Jugendlichen zu reduzieren. Aufgrund ihrer leichten Erlernbarkeit wird die
Progressive Muskelrelaxation (nach Jacobson) mit Kindern und Jugendlichen am häufig-
sten durchgeführt (z. B. Speck, 2005b). Bei dieser Methode soll durch die willentliche An-
spannung und Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung
erreicht werden. Damit das Kind die Entspannungsübung therapiebegleitend zu Hause
durchführen kann, sollte ihm eine Tonaufzeichnung zur Verfügung gestellt werden. Dafür
kann auch auf professionell produzierte Audio-CDs mit Entspannungsübungen für Kinder
und Jugendliche zurückgegriffen werden (z. B. Ahrens-Eipper, 2004; Klein-Heßling &
2 Theorie 69
Lohaus, 2003; Petermann & Petermann, 2007; Speck, 2005a). Die Wirksamkeit von Ent-
spannungsverfahren zur Behandlung von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen
wurde in einzelnen Studien (z. B. Rice, 2009) nachgewiesen, kann jedoch noch nicht als
empirisch ausreichend abgesichert gelten (vgl. für einen Überblick Santacruz et al., 2002).
Hausaufgaben
Um den Transfer der neu erworbenen Fertigkeiten in den Alltag zu gewährleisten, erhält
das Kind bzw. der Jugendliche am Ende jeder Therapiesitzung eine Aufgabe, die in der
darauffolgenden Woche erfüllt werden soll. Dabei beziehen sich die Hausaufgaben immer
auf die aktuellen Inhalte der Therapiesitzungen (vgl. zur Veranschaulichung Hudson &
Kendall, 2002), beispielsweise auf die Beobachtung von Angstsymptomen, auf die Anwen-
dung von Selbstinstruktionen oder die Durchführung von Expositionsübungen. Zusätzlich
sollten die Hausaufgaben flexibel und individuell an die Symptomatik des Kindes angepasst
werden (z. B. Kendall & Barmish, 2007). Für die Protokollierung der Hausaufgaben wer-
den in vielen Therapiemanualen kindgerechte Materialien zur Verfügung gestellt (z. B.
Ahrens-Eipper et al., 2009; Büch & Döpfner, 2012; Petermann & Petermann, 2010).
Obwohl Hausaufgaben zu den zentralen Bestandteilen in der Kognitiven Verhaltens-
therapie gehören, wurde die Wirksamkeit therapeutischer Hausaufgaben bisher nur in
wenigen Studien an erwachsenen Patienten untersucht (vgl. für einen Überblick Kazantzis,
Deane & Ronan, 2000; Kazantzis, Whittington & Dattilio, 2010). Hughes und Kendall
(2007) konnten in der Psychotherapie von Kindern mit verschiedenen Angststörungen
(N = 138; 9 bis 13 Jahre) keinen Zusammenhang zwischen der Hausaufgabenerledigung
und dem Behandlungsergebnis feststellen.
Einbezug der Eltern bzw. Familien
Die Eltern sollten in die Behandlung eines Kindes bzw. Jugendlichen einbezogen werden,
wenn das Kind noch im Vor- und Grundschulalter ist, wenn das Kind unter Trennungs-
ängsten (von den Eltern) leidet und/oder wenn das Verhalten der Eltern zur Entstehung
und Aufrechterhaltung der Ängste entscheidend beiträgt (Schneider & In-Albon, 2010).
Im Rahmen der Elternberatung werden die dysfunktionalen Gedanken der Eltern in Bezug
auf das Kind (z. B. „Ich muss verhindern, dass mein Kind Angst hat, weil Angst meinem
Kind schadet!“) und/oder die vom Kind gefürchteten Situationen (z. B. „Der Schulweg ist
2 Theorie 70
gefährlich!“) erfragt, überprüft und gegebenenfalls verändert. Den Eltern wird adäquates,
hilfreiches Erziehungsverhalten vermittelt, um das Kind bei der Bewältigung der angstaus-
lösenden Situationen aktiv unterstützen zu können. So wird den Eltern empfohlen, die
Ängste des Kindes grundsätzlich ernst zu nehmen und bei starken Angstreaktionen des
Kindes einfühlsam, beruhigend und geduldig zu reagieren. Die Eltern werden angehalten,
das ängstliche Verhalten des Kindes möglichst nicht mehr zu beachten, sondern stattdessen
mutiges, angstbewältigendes Verhalten zu loben und zu belohnen. Weiterhin werden die
Eltern angeleitet, die zunächst vom Therapeuten begleiteten Expositionsübungen im häus-
lichen Kontext mit dem Kind fortzuführen. Dabei werden die Eltern, insbesondere die-
jenigen mit einem überbehütenden Erziehungsstil, dazu ermutigt, dem Kind – seinem Alter
entsprechend – mehr Verantwortung zu übertragen und so seine Selbstständigkeit zu för-
dern (z. B. das Geburtstagsgeschenk für einen Freund kaufen). Sie werden darin bestärkt,
das bisher gezeigte Vermeidungsverhalten des Kindes in angstauslösenden Situationen zu
verhindern (z. B. zu Hause bleiben) und altersangemessene Forderungen durchzusetzen
(z. B. in die Schule gehen). Weist auch ein Elternteil stark ausgeprägte Ängste auf, werden
innerhalb der Elternberatung Strategien zum Umgang mit diesen Ängsten erarbeitet bzw.
wird dem Elternteil eine eigene Psychotherapie empfohlen. Das Ergebnis einer aktuellen
Studie zeigt, dass sich die psychische Entwicklung eines Kindes nach der erfolgreichen
Behandlung der elterlichen Angststörung verbessert, und zwar ohne das Erziehungsverhal-
ten der Eltern zu verändern oder eine Psychotherapie mit dem Kind durchzuführen
(Schneider et al., 2013). Umgekehrt kann aber auch die erfolgreiche Therapie eines Kindes
zu Veränderungen in den elterlichen Erwartungen und in den familiären Beziehungen füh-
ren (sog. therapeutic spill over; Kendall & Flannery-Schroeder, 1998).
2.4.4 Behandlungsprogramme
In der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen werden Therapiemanuale von der
großen Mehrheit der Psychotherapeuten regelmäßig eingesetzt (Döpfner, Kinnen & Peter-
mann, 2010). Typischerweise sind Therapiemanuale komplexe Behandlungsprogramme, in
denen die zuvor beschriebenen, empirisch validierten Methoden zur Behandlung von
Angststörungen sinnvoll miteinander kombiniert werden: Psychoedukation, Kognitive
2 Theorie 71
Interventionen, Konfrontationsverfahren, Operante Techniken, Soziales Kompetenz-
training, Entspannungsverfahren und Hausaufgaben (Schneider & In-Albon, 2010).
Der Einsatz von Therapiemanualen in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie wird
kontrovers diskutiert (z. B. Hibbs et al., 1997). Dabei hat die manualbasierte Durchführung
von Psychotherapie durchaus einige Vorteile: Manuale schaffen einen klaren und gut struk-
turierten Rahmen für die therapeutische Arbeit. Sie fokussieren auf die wesentlichen Ele-
mente der Therapie und beschreiben das therapeutische Vorgehen sehr genau. Sie bieten
dem Therapeuten die Möglichkeit, sich effizient in die Behandlung eines Störungsbilds
einzuarbeiten und das eigene Methodenrepertoire zu erweitern. Manuale tragen zu einer
höheren Standardisierung des therapeutischen Vorgehens bei und schaffen eine größere
Transparenz im therapeutischen Prozess. In der Psychotherapieforschung kann so die Ver-
gleichbarkeit und Replizierbarkeit des Vorgehens und der Ergebnisse gewährleistet werden.
Aus diesem Grund ist die sog. Manualtreue (treatment adherence) in Therapiestudien von gro-
ßer Bedeutung; sie scheint allerdings keinen entscheidenden Einfluss auf den Therapie-
erfolg zu haben (Kendall & Chu, 2000; Liber et al., 2010). Den genannten Vorteilen stehen
allerdings auch einige Nachteile gegenüber: So wird der Aufbau einer tragfähigen Thera-
peut-Patient-Beziehung und einer angemessenen Behandlungsmotivation in Therapie-
manualen häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Ebenso können Manuale die Kreativität
und Spontaneität des Therapeuten verringern, die Flexibilität seines Vorgehens einschrän-
ken und eine Individualisierung der Therapie erschweren. Allerdings scheint die Mehrheit
der Psychotherapeuten die Therapiemanuale im Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit flexibel
und patientenbezogen einzusetzen (Döpfner et al., 2010). Bei der Verwendung von Thera-
pieprogrammen überwiegen die Vorteile, wenn gezeigt werden kann, dass die Therapie
anhand eines Manuals erfolgreich durchgeführt werden kann. Eine individualisierte Thera-
pie und ein Einsatz von Therapiemanualen müssen sich also nicht gegenseitig ausschließen
(Eifert, Schulte, Zvolesky, Lejuez & Lau, 1997; Kendall, Chu, Gifford, Heyes & Nauta,
1998).
In den letzten Jahren wurden etliche kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapiemanuale
zur Behandlung der verschiedenen Angststörungen im Kindes- und Jugendalter entwickelt
und veröffentlicht (vgl. für einen Überblick Tabelle 8). Nachfolgend werden ausgewählte
Therapiemanuale zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter kurz
vorgestellt.
2 Theorie 72
Tabelle 8: Therapiemanuale für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter
Angststörung Therapiemanuale Autoren
Trennungsangst Trennungsangstprogramm für Familien Schneider (2004b)
Soziale Ängstlichkeit/ Soziale Phobie
Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „Sei kein Frosch“-Programm Cognitive-Behavioral Group Therapy for Social Phobia – Adolescents / Behandlung der Sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen Mutig werden mit Til Tiger Social Effectiveness Therapy for Children and Adolescents Soziale Ängste und Soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter Therapieprogramm für Kinder und Jugend-liche mit Angst- und Zwangsstörungen, Band 2: Soziale Ängste Training sozialer Fertigkeiten mit Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren
Melfsen & Walitza (2012) Albano et al. (1991); dt. Über-setzung und Bearbeitung von Joormann & Unnewehr (2002a) Ahrens-Eipper et al. (2009) Beidel et al. (2004) Tuschen-Caffier et al. (2009) Büch & Döpfner (2012) Beck et al. (2008)
Generalisierte Angst
Leistungsängste Therapieprogramm für Kinder und Jugend-liche mit Angst- und Zwangsstörungen, Band 1: Leistungsängste
Suhr-Dachs & Döpfner (2005)
Spezifische Phobie
Verschiedene Angststörungen
Cool Kids Coping Cat Friends / Freunde für Kinder Training mit sozial unsicheren Kindern
Lyneham et al. (2003) Kendall & Hedtke (2006) Barrett et al. (2000); dt. Über-setzung von Barrett et al. (2003) Petermann & Petermann (2010)
Im englischen Sprachraum gibt es mehrere störungsunspezifische Behandlungsprogramme,
so beispielsweise das Therapieprogramm Coping Cat (Kendall & Hedtke, 2006) und dessen
australische Modifikation Coping Koala (Barrett, Dadds & Rapee, 1991). Das Therapie-
programm Coping Cat aus der Arbeitsgruppe um Kendall wurde für die Behandlung ver-
schiedener Angststörungen (Trennungsangst, Soziale Phobie, Generalisierte Angst) im
Kindes- und Jugendalter (ab 7 Jahren) entwickelt. Das kognitiv-verhaltenstherapeutische
Therapieprogramm umfasst mindestens 16 wöchentliche Sitzungen (à 60 Minuten) für die
Kinder und 1 Sitzung für die Eltern. In den ersten 8 Therapiesitzungen (Trainingsphase)
werden grundlegende Fertigkeiten zur Identifikation von Angstgedanken und zur Entwick-
lung von Bewältigungsstrategien vermittelt; in weiteren 8 Therapiesitzungen (Umsetzungs-
phase) werden die erworbenen Fertigkeiten praktisch eingeübt. Dabei kommen Methoden
2 Theorie 73
wie Kognitive Umstrukturierung, Modelllernen, Rollenspiele, Konfrontationsübungen,
Entspannungstraining, Hausaufgaben und Kontingenzmanagement zur Anwendung.
Die Wirksamkeit dieses kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprogramms wurde
bereits in verschiedenen Studien (mit Wartekontrollgruppendesign) bestätigt. Dabei konnte
wiederholt gezeigt werden, dass die Angststörungen im Kindes- und Jugendalter sowohl
mit Einzeltherapie (Kendall, 1994; Kendall et al., 1997) als auch mit Gruppentherapie
(Flannery-Schroeder & Kendall, 2000; Flannery-Schroeder, Choudhury & Kendall, 2005;
Manassis et al., 2002; Silverman et al., 1999a) wirksam behandelt werden können. In weite-
ren Studien konnte nachgewiesen werden, dass die mit dem Coping Cat-Programm erziel-
ten Erfolge über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren nach Therapieende stabil blieben
(Kendall & Southam-Gerow, 1996; Kendall, Safford et al., 2004). Während unmittelbar
nach der Therapie noch 48.8 % der Kinder die diagnostischen Kriterien für die vor der
Behandlung festgestellte Angststörung erfüllten, waren es sieben Jahren später nur noch
19.5 % der Kinder. Im Zuge der Modifikation wurde das Therapieprogramm Coping Koala
von der Arbeitsgruppe um Barrett zwar auf 12 Sitzungen verkürzt, gleichzeitig wurde
jedoch die Länge der Sitzungen auf eine Dauer von 120 Minuten erhöht. Mehrere Studien
belegen nicht nur die kurzfristige, sondern auch die langfristige Wirksamkeit dieses modifi-
zierten Gruppentherapieprogramms (Barrett, 1998; Barrett, Dadds & Rapee, 1996; Barrett
et al., 2001). Da es einer zweiten, unabhängigen Arbeitsgruppe gelungen ist, einen Wirk-
samkeitsnachweis für das Coping Cat/Coping Koala-Programm zu erbringen, kann das
Therapieprogramm nach den Kriterien der APA Presidential Task Force on Evidence-
Based Practice zu den empirisch validierten Behandlungen für Angststörungen im Kindes-
und Jugendalter gezählt werden (Chambless et al., 1998; Chambless & Ollendick, 2001).
Die aktuell vorliegenden deutschsprachigen Therapiemanuale zur Behandlung von Angst-
störungen im Kindes- und Jugendalter werden in Tabelle 9 dargestellt. Eine Übersicht über
die jeweils durchgeführten Wirksamkeitsstudien kann Tabelle 10 entnommen werden.
2 Th
eorie
74
Ta
belle
9: T
hera
piem
anua
le m
it ko
gniti
v-ve
rhalt
ensth
erap
eutis
cher
Aus
richt
ung
zur
Beha
ndlu
ng v
on A
ngst
stör
unge
n im
Kin
des-
und
Jug
end-
alter
im d
euts
chen
Spr
achr
aum
Au
tore
n (
Jah
r)
Th
erap
iem
anu
al
Ind
ikat
ion
A
lter
sgru
pp
e In
terv
enti
onen
E
mp
iris
che
Üb
erp
rüfu
ng
Ahr
ens-
Eip
per,
Lep
low
&
Nel
ius (
2009
) M
utig
wer
den
mit
Til T
iger
Tr
ennu
ngsa
ngst
So
ziale
Äng
stlic
hkei
t So
ziale
Pho
bie
5 -
10 Ja
hre
Kin
dzen
trier
te In
terv
entio
nen
2 x
60
Min
. Ein
zelth
erap
ie
9 x
60
Min
. Gru
ppen
ther
apie
E
inbe
zug
der E
ltern
nac
h V
erfü
g-ba
rkei
t und
Bed
arf
Ahr
ens-
Eip
per (
2003
)
Barr
ett,
Web
ster
, Tur
-ne
r, E
ssau
& C
onra
dt
(200
3)
Freu
nde
für K
inde
r (b
asie
rend
auf
FRI
EN
DS;
Ba
rret
t, Lo
wry
-Web
ster
&
Turn
er, 2
000)
Tren
nung
sang
st
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e G
ener
alisie
rte A
ngst
D
epre
ssio
n
7 -
12 Ja
hre
Kin
dzen
trier
te In
terv
entio
nen
10 x
45-
60 M
in. G
rupp
enth
erap
ie
2 x
45-
60 M
in. A
uffr
ischu
ng
Elte
rnze
ntrie
rte In
terv
entio
nen
4 x
45-
60 M
in. E
ltern
bera
tung
Ess
au e
t al.
(200
4)
Ess
au e
t al.
(201
2)
Barr
ett e
t al.
(199
6)
Shor
t et a
l. (2
001)
Fa
rrel
l et a
l. (2
005)
Beck
, Cäs
ar &
Leo
n-ha
rdt (
2008
) Tr
ainin
g so
ziale
r Fer
tigke
iten
mit
Kin
dern
im A
lter v
on 8
bis
12 Ja
hren
(TSF
8-1
2)
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e 8
- 12
Jahr
e K
indz
entri
erte
Inte
rven
tione
n 10
x 6
0 M
in. G
rupp
enth
erap
ie
Elte
rnze
ntrie
rte In
terv
entio
nen
3 x
120
Min
. Elte
rnbe
ratu
ng
Büch
& D
öpfn
er (2
012)
Th
erap
iepr
ogra
mm
für K
inde
r un
d Ju
gend
liche
mit
Ang
st-
und
Zw
angs
stör
unge
n (T
HA
Z)
Band
2: S
ozial
e Ä
ngst
e
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e 8
- 14
Jahr
e K
indz
entri
erte
Inte
rven
tione
n E
inze
lther
apie
(var
iable
r Um
fang
) E
ltern
zent
rierte
Inte
rven
tione
n E
ltern
bera
tung
(var
iable
r Um
fang
)
Büch
& D
öpfn
er (2
011)
Joor
man
n &
Unn
eweh
r (2
002a
) Be
hand
lung
der
Soz
ialen
Ph
obie
bei
Kin
dern
und
Juge
ndlic
hen
(b
asie
rend
auf
CBG
T-A
;
Alb
ano
et a
l., 1
991)
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e 12
- 18
Jahr
e K
indz
entri
erte
Inte
rven
tione
n 16
x 9
0 M
in. G
rupp
enth
erap
ie
4 x
Ein
bezu
g de
r Elte
rn in
die
Gru
ppen
ther
apie
der
Kin
der
Joor
man
n &
Unn
eweh
r (2
002b
) A
lban
o et
al.
(199
5)
Gar
cia-
Lope
z et
al.
(200
2)
Gar
cia-
Lope
z et
al.
(200
6)
Mel
fsen
& W
alitz
a (2
012)
Be
hand
lung
sozi
aler Ä
ngst
e be
i K
inde
rn –
Das
„Se
i kei
n Fr
osch
“-Pr
ogra
mm
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e 8
- 12
Jahr
e K
indz
entri
erte
Inte
rven
tione
n 20
x 5
0 M
in. E
inze
lther
apie
E
ltern
zent
rierte
Inte
rven
tione
n 4
x 5
0 M
in. E
ltern
bera
tung
Mel
fsen
et a
l. (2
011)
2 Th
eorie
75
A
uto
ren
(Ja
hr)
T
her
apie
man
ual
In
dik
atio
n
Alt
ersg
rup
pe
Inte
rven
tion
en
Em
pir
isch
e Ü
ber
prü
fun
g
Pete
rman
n &
Pet
er-
man
n (2
010)
Train
ing
mit
sozi
al un
siche
ren
Kin
dern
(TSU
K)
Tren
nung
sang
st
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e G
ener
alisie
rte A
ngst
5 -
12 Ja
hre
Kin
dzen
trier
te In
terv
entio
nen
5 x
100
Min
. Ein
zelth
erap
ie
8 x
100
Min
. Gru
ppen
ther
apie
E
ltern
zent
rierte
Inte
rven
tione
n 5
x 1
00 M
in. E
ltern
bera
tung
Pete
rman
n &
Röt
tgen
(198
6)
Pete
rman
n &
Walt
er (1
989)
O
rtban
dt &
Pet
erm
ann
(200
9)
Möl
ler &
Pet
erm
ann
(201
1)
Schn
eide
r (20
04b)
Tren
nung
sang
stpr
ogra
mm
für
Fam
ilien
(TA
FF)
Tren
nung
sang
st
5 -
13 Ja
hre
Kin
dzen
trier
te In
terv
entio
nen
4 x
50
Min
. Ein
zelth
erap
ie
Elte
rnze
ntrie
rte In
terv
entio
nen
4 x
50
Min
. Elte
rnbe
ratu
ng
Fam
ilien
zent
rierte
Inte
rven
tione
n 8
x 5
0 M
in. F
amili
enth
erap
ie
Schn
eide
r et a
l. (2
011)
Suhr
-Dac
hs &
Döp
fner
(2
005)
Th
erap
iepr
ogra
mm
für K
inde
r un
d Ju
gend
liche
mit
Ang
st-
und
Zw
angs
stör
unge
n (T
HA
Z)
Band
1: L
eist
ungs
ängs
te
Leist
ungs
ängs
te
(Soz
iale
Phob
ie,
Spez
ifisc
he P
hobi
e)
6 -
16 Ja
hre
Kin
dzen
trier
te In
terv
entio
nen
Ein
zelth
erap
ie (v
ariab
ler U
mfa
ng)
Elte
rnze
ntrie
rte In
terv
entio
nen
Elte
rnbe
ratu
ng (v
ariab
ler U
mfa
ng)
Tusc
hen-
Caff
ier,
Küh
l &
Ben
der (
2009
)
Sozi
ale Ä
ngst
e un
d So
ziale
A
ngst
stör
ung
im K
inde
s- u
nd
Juge
ndalt
er
Sozi
ale Ä
ngst
lichk
eit
Sozi
ale P
hobi
e 8
- 14
Jahr
e K
indz
entri
erte
Inte
rven
tione
n 1
x 5
0 M
in. E
inze
lther
apie
16
x 9
0 M
in. G
rupp
enth
erap
ie
Elte
rnze
ntrie
rte In
terv
entio
nen
3 x
90
Min
. Elte
rnbe
ratu
ng
Küh
l (20
05)
Kle
y (2
011)
K
ley
et a
l. (2
012)
2 Th
eorie
76
Ta
belle
10:
Wirk
sam
keits
stud
ien
zu k
ogni
tiv-v
erha
ltens
ther
apeu
tisch
en T
hera
piem
anua
len
für
Ang
stst
örun
gen
im K
inde
s- u
nd J
ugen
dalte
r im
deut
sche
n Sp
rach
raum
Au
tore
n
Th
erap
iem
anu
al
Des
ign
Stic
hp
rob
e In
terv
enti
on
Eff
ekts
tärk
en
(Prä
/P
ost)
Ahr
ens-
Eip
per (
2003
)
Mut
ig w
erde
n m
it
Til T
iger
W
arte
kont
rollg
rupp
ende
sign
2 In
terv
entio
nsgr
uppe
n m
it un
ter-
schi
edlic
hen
Schw
erpu
nkte
n,
1 W
arte
kont
rollg
rupp
e 3
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est,
Post
-te
st, F
ollo
w u
p (n
ach
1 ½
Jahr
en)
N =
95;
5 -
12 Ja
hre
52
.6 %
Jung
en u
nd
47.4
% M
ädch
en
Sozi
ale U
nsic
herh
eit
gem
äß S
ASC
-R-D
(n
= 9
5)
Ver
halte
nstra
inin
g (n
= 3
5)
2 Si
tzun
gen
Ein
zelth
erap
ie
9 Si
tzun
gen
Gru
ppen
ther
apie
Pr
oble
mlö
setra
inin
g (n
= 2
5)
2 Si
tzun
gen
Ein
zelth
erap
ie
9 Si
tzun
gen
Gru
ppen
ther
apie
W
arte
kont
rollg
rupp
e (n
= 3
5)
War
teze
it vo
n 12
Woc
hen,
da
nach
The
rapi
eang
ebot
Ver
glei
ch IG
>K
G
Kin
d SA
SC-R
-D
FN
E:
2 p = 0
.18
SA
D:
2 p = 0
.00
Ver
glei
ch V
T>PT
K
ind
SASC
-R-D
F
NE
: 2 p =
0.1
3 S
AD
: 2 p
= 0
.18
Büch
(200
8)
Büch
& D
öpfn
er (2
011)
Th
erap
iepr
ogra
mm
für
Ang
st- u
nd Z
wan
gs-
stör
unge
n (T
HA
Z):
Band
2: S
ozial
e Ä
ngst
e
Eig
enko
ntro
llgru
ppen
desig
n („
With
in-S
ubje
ct“-
Des
ign)
7
Mes
szei
tpun
kte:
alle
6 W
oche
n
N =
11;
8 -
13 Ja
hre
9 Ju
ngen
, 2 M
ädch
en
Sozi
ale P
hobi
e na
ch
DSM
-IV
(n =
11)
6 W
oche
n W
arte
zeit
24 S
itzun
gen
Ein
zelth
erap
ie
4 S
itzun
gen
Elte
rnbe
ratu
ng
Kin
d SP
AIK
: d =
1.3
4 SC
AS-
D: d
= 1
.66
Elte
rn
ESA
K: d
= 0
.99
INT:
d =
0.6
8 FB
B-A
NG
: d =
1.3
2
Ess
au e
t al.
(201
2)
Fr
eund
e fü
r Kin
der
K
ontro
llgru
ppen
desig
n 4
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est,
Post
-te
st, F
ollo
w u
p (n
ach
½ Ja
hr u
nd
nach
1 Ja
hr)
N =
638
; 9 -
12 Ja
hre
346
Jung
en; 2
92 M
ädch
en
Inte
rven
tions
grup
pe (n
= 3
02)
10 S
itzun
gen
Gru
ppen
train
ing
4 S
itzun
gen
Elte
rnbe
ratu
ng
Kon
trollg
rupp
e (n
= 3
36)
kein
e In
terv
entio
n
Kin
d SC
AS-
D: p
<.0
01
RCA
DS:
p <
.05
CAPS
: p <
.001
CA
SAFS
: p <
.05
Joor
man
n &
Unn
eweh
r (2
002b
) Be
hand
lung
der
Soz
ia-le
n Ph
obie
be
i Kin
dern
und
Ju-
gend
liche
n
War
teko
ntro
llgru
ppen
desig
n 3
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est,
Post
-te
st, F
ollo
w u
p (n
ach
1 Ja
hr)
N =
18;
8 -
15 Ja
hre
8 Ju
ngen
, 10
Mäd
chen
So
ziale
Pho
bie
nach
D
SM-I
V (n
= 1
8)
Inte
rven
tions
grup
pe (n
= 9
) 16
Sitz
unge
n G
rupp
enth
erap
ie
4 x
Ein
bezu
g de
r Elte
rn in
d
ie G
rupp
enth
erap
ie
Kin
d SP
AIK
: d =
1.3
6 SA
SC-R
-D
FN
E: d
= 1
.17
SA
D: d
= 0
.89
2 Th
eorie
77
Au
tore
n
Th
erap
iem
anu
al
Des
ign
Stic
hp
rob
e In
terv
enti
on
Eff
ekts
tärk
en
(Prä
/P
ost)
War
teko
ntro
llgru
ppe
(n =
9)
War
teze
it vo
n 2
Mon
aten
, da
nach
The
rapi
eang
ebot
STA
IK: d
= 1
.55
KA
SI: d
= 1
.12
CAFC
: d =
1.4
0
Küh
l (20
05)
So
ziale
Äng
ste
und
Sozi
ale A
ngst
stör
ung
im K
inde
s- u
nd
Juge
ndalt
er
War
teko
ntro
llgru
ppen
desig
n ¾
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est (
1/2)
, Po
stte
st, F
ollo
w u
p (n
ach
½ Ja
hr)
Eig
enko
ntro
llgru
ppen
desig
n („
With
in-S
ubje
ct“-
Des
ign)
4
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est 1
und
2,
Post
test
, Fol
low
up
(nac
h ½
Jahr
)
N =
17;
8 -
13 Ja
hre
12 Ju
ngen
, 5 M
ädch
en
Sozi
ale P
hobi
e na
ch
DSM
-IV
(n =
17)
N
= 2
4; 8
- 15
Jahr
e 15
Jung
en, 9
Mäd
chen
So
ziale
Pho
bie
nach
D
SM-I
V (n
= 2
4)
Inte
rven
tions
grup
pe (n
= 1
0)
1 S
itzun
g E
inze
lther
apie
15
Sitz
unge
n G
rupp
enth
erap
ie
3 S
itzun
gen
Elte
rnbe
ratu
ng
War
teko
ntro
llgru
ppe
(n =
7)
War
teze
it vo
n 12
Woc
hen,
da
nach
The
rapi
eang
ebot
4
Mon
ate
War
teze
it 1
Sitz
ung
Ein
zelth
erap
ie
20 S
itzun
gen
Gru
ppen
ther
apie
3
Sitz
unge
n E
ltern
bera
tung
Kin
d D
IPS-
K: d
= 0
.60
SASC
-R-D
F
NE
: d =
0.4
5 S
AD
: d =
0.4
5 E
ltern
D
IPS-
K: d
= 1
.41
INT:
d =
0.6
7
Kin
d D
IPS-
K: d
= 0
.67
SASC
-R-D
F
NE
: d =
0.6
7 S
AD
: d =
0.3
4 E
ltern
D
IPS-
K: d
= 1
.74
INT:
d =
1.0
9
Mel
fsen
et a
l. (2
011)
Be
hand
lung
sozi
aler
Äng
ste
bei K
inde
rn –
D
as „
Sei k
ein
Fros
ch“-
Prog
ram
m
War
teko
ntro
llgru
ppen
desig
n 3
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est,
Post
-te
st, F
ollo
w u
p (n
ach
½ Ja
hr)
N =
44;
8 -
14 Ja
hre
23 Ju
ngen
, 21
Mäd
chen
So
ziale
Pho
bie
nach
D
SM-I
V (n
= 4
4)
Inte
rven
tions
grup
pe (n
= 2
1)
20 S
itzun
gen
Ein
zelth
erap
ie
4 S
itzun
gen
Elte
rnbe
ratu
ng
War
teko
ntro
llgru
ppe
(n =
23)
W
arte
zeit
von
4 M
onat
en,
dana
ch T
hera
piea
ngeb
ot
Kin
d SP
AIK
: g =
0.9
4 SÄ
KK
P
S: g
= 1
.34
NS:
g =
1.4
1 B
G: g
= 0
.86
Elte
rn
DIP
S-K
: g =
0.8
9
2 Th
eorie
78
Au
tore
n
Th
erap
iem
anu
al
Des
ign
Stic
hp
rob
e In
terv
enti
on
Eff
ekts
tärk
en
(Prä
/P
ost)
Schn
eide
r et a
l. (2
011)
Tr
ennu
ngsa
ngst
-pr
ogra
mm
für
Fam
ilien
(TA
FF)
War
teko
ntro
llgru
ppen
desig
n 5
Mes
szei
tpun
kte:
Prät
est,
Post
-te
st, F
ollo
w u
p (n
ach
4 W
oche
n,
nach
1 Ja
hr u
nd n
ach
2 Ja
hren
)
N =
43;
5 -
7 Ja
hre
18 Ju
ngen
, 25
Mäd
chen
Tr
ennu
ngsa
ngst
nac
h D
SM-I
V-T
R (n
= 4
3)
Inte
rven
tions
grup
pe (n
= 2
1)
4 Si
tzun
gen
Ein
zelth
erap
ie
4 Si
tzun
gen
Elte
rnbe
ratu
ng
8 Si
tzun
gen
Fam
ilien
ther
apie
W
arte
kont
rollg
rupp
e (n
= 2
2)
War
teze
it vo
n 12
Woc
hen,
da
nach
The
rapi
eang
ebot
Kin
d SA
I: d
= 0
.98
RCM
AS:
d =
0.9
1 M
utte
r SA
I: d
= 1
.31
RCM
AS:
d =
0.6
5
Anm
erkun
gen:
CAFC
= C
hild
Anx
iety
Fre
quen
cy S
cale
; CA
SAFS
= C
hild
and
Ado
lesc
ent
Soci
al an
d A
dapt
ive
Func
tioni
ng S
cale
; C
APS
= C
hild
and
Ado
lesc
ent
Perf
ectio
nism
Sca
le; D
IPS-
K =
Dia
gnos
tisch
es I
nter
view
bei
psy
chisc
hen
Stör
unge
n im
Kin
des-
und
Juge
ndalt
er; E
SAK
= E
ltern
frag
ebog
en z
u so
ziale
n Ä
ngst
en b
ei K
in-
dern
und
Jug
endl
iche
n; F
BB-A
NG
= F
rem
dbeu
rteilu
ngsb
ogen
Ang
stst
örun
gen
aus
dem
Diag
nost
ik-S
yste
m f
ür p
sych
ische
Stö
rung
en im
Kin
des-
und
Jug
enda
lter
nach
IC
D-1
0 un
d D
SM-I
V (D
ISY
PS-K
J); I
NT
= S
kala
Inte
rnali
siere
nde
Auf
fälli
gkei
ten
aus
dem
Elte
rnfr
ageb
ogen
übe
r da
s V
erha
lten
von
Kin
dern
und
Jug
endl
iche
n im
Alte
r vo
n 4
bis 1
8 Ja
hren
(Chi
ld B
ehav
ior C
heck
list /
4-1
8); K
ASI
= K
inde
r-Ang
stse
nsiti
vitä
tsin
dex;
PT
= P
robl
emlö
setra
inin
g; R
CAD
S =
Rev
ised
Child
Anx
iety
and
Dep
ress
ion
Scale
; RCM
AS
= R
evise
d Ch
ildre
n’s
Man
ifest
Anx
iety
Sca
le; S
ÄK
K =
Fra
gebo
gen
zur
Erf
assu
ng s
ozial
äng
stlic
her
Kog
nitio
nen
bei K
inde
rn u
nd J
ugen
dlic
hen;
SA
I =
Se
para
tion
Anx
iety
Inv
ento
ry fo
r Chi
ldre
n (P
S =
Ska
la Po
sitiv
e Se
lbst
bew
ertu
ng; N
S =
Ska
la N
egat
ive
Selb
stbe
wer
tung
; BG
= S
kala
Bew
ältig
ungs
geda
nken
); SA
SC-R
-D =
So
cial
Anx
iety
Sca
le fo
r Chi
ldre
n –
Revi
sed
– D
euts
che
Ver
sion
(FN
E =
Ska
la Fu
rcht
vor
neg
ativ
er B
ewer
tung
; SA
D =
Ska
la V
erm
eidu
ng v
on u
nd B
elas
tung
dur
ch so
ziale
Si
tuat
ione
n); S
CAS-
D =
Spe
nce
Child
ren’
s A
nxie
ty S
cale
– D
euts
che
Ver
sion;
SPA
IK =
Soz
ialph
obie
und
-ang
stin
vent
ar; S
TAIK
= S
tate
-Tra
it-A
ngst
-Inv
enta
r für
Kin
der;
VT
= V
erha
ltens
train
ing.
2 Theorie 79
Aus Tabelle 8 ist auch zu ersehen, dass es im deutschen Sprachraum neben den störungs-
übergreifenden Behandlungsprogrammen (z. B. Barrett et al., 2003; Petermann & Peter-
mann, 2010), die für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen
Angststörungen entwickelt wurden, zunehmend mehr störungsspezifische Behandlungs-
programme (z. B. Büch & Döpfner, 2012; Melfsen & Walitza, 2012; Tuschen-Caffier et al.,
2009) gibt, die nur für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit einer bestimm-
ten Angststörung vorgesehen sind. Während für die Behandlung der Sozialen Ängstlichkeit
bzw. der Sozialen Phobie inzwischen bereits etliche spezifische Therapiemanuale vorliegen,
existieren für die Behandlung der anderen Angststörungen bisher nur wenige oder noch gar
keine störungsspezifischen Therapiemanuale.
Bisher ist das Trennungsangstprogramm für Familien (TAFF; Schneider, 2004b) das einzige
störungsspezifische, kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapieprogramm für Kinder mit
Trennungsängsten. Das TAFF-Programm richtet sich an 5- bis 13-jährige Kinder und
deren Eltern. Es besteht aus insgesamt 16 Sitzungen, von denen 4 Sitzungen allein mit dem
Kind, 4 Sitzungen allein mit den Eltern und 8 Sitzungen gemeinsam mit Kind und Eltern
durchgeführt werden. Die ersten vier Kind- bzw. Elternsitzungen werden für die Psycho-
edukation, für die Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken und für die Vorbereitung auf die
Konfrontation genutzt. In den darauf folgenden acht Familiensitzungen werden die zuvor
festgelegten Konfrontationsübungen durchgeführt. Über die gesamte Therapiedauer hin-
weg wird den Eltern vermittelt, wie sie ihr Kind bei der Bewältigung seiner Angst unter-
stützen können. Auch ein Einbezug des Kindergartens oder der Schule in die Behandlung
des Kindes wird als sinnvoll erachtet. Die Wirksamkeit des bisher unveröffentlichten
Behandlungsprogramms wurde in einer Therapiestudie mit Wartekontrollgruppendesign
überprüft (Schneider et al., 2011). Nach der Behandlung erfüllten 76 % der Kinder in der
Interventionsgruppe im Vergleich zu 14 % der Kinder in der Wartekontrollgruppe die Kri-
terien für die Diagnose einer Trennungsangst (nach DSM-IV) nicht mehr. Die Kinder wie-
sen einen geringeren Leidensdruck, ein geringeres Beeinträchtigungsgefühl sowie eine hö-
here Lebensqualität auf. Diese Studie deutet auf die kurzfristige Wirksamkeit des Therapie-
programms hin; eine Überprüfung der langfristigen Wirksamkeit steht allerdings noch aus.
Für die kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung von Kindern mit Sozialer Ängstlich-
keit bzw. mit Sozialer Phobie stellten Melfsen und Walitza (2012) vor kurzem das Sei kein
Frosch-Programm vor. Dieses störungsspezifische Therapieprogramm wurde für Kinder im
2 Theorie 80
Alter von 8 bis 12 Jahren entwickelt und eignet sich besonders für den Einsatz im Einzel-
setting. Es besteht aus insgesamt 24 Therapiesitzungen, von denen 20 Sitzungen mit dem
Kind und 4 Sitzungen mit den Eltern durchgeführt werden. Mit dem Frosch wurde im
Unterschied zu anderen Therapieprogrammen ein ruhiges und eher schwaches Tier als
Therapiehelfer ausgewählt. Auch dieses Therapieprogramm beinhaltet Psychoedukation,
Kognitive Interventionen und Expositionsübungen. Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Expositionsübungen wird der Externalisierung der Selbstaufmerksamkeit und
dem Verzicht auf Sicherheitsverhalten besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Um die
Therapiesitzungen spielerisch und motivierend gestalten zu können, stellt das Programm
viele unterschiedliche Therapiematerialien zur Verfügung. Bei diesen Materialien handelt es
sich u. a. um therapeutische Spiele, Comicgeschichten, Kreuzworträtsel, Malvorlagen und
Bastelanleitungen. Die begleitende Elternberatung bildet einen wesentlichen Bestandteil der
Therapie. Das „Sei kein Frosch“-Programm wurde in einer Wartekontrollgruppenstudie
auf seine Wirksamkeit hin überprüft (Melfsen et al., 2011). Die Therapieteilnahme führte
bei den Kindern der Interventionsgruppe zu einer signifikanten Abnahme sozialer Ängste
und dysfunktionaler Kognitionen. Alle Kinder der Interventionsgruppe zeigten nach der
Therapie einen geringeren Schweregrad der Sozialen Phobie (nach DSM-IV) als die Kinder
der Wartekontrollgruppe. 33 % der Kinder in der Interventionsgruppe erhielten im Ver-
gleich zu 0 % der Kinder in der Wartekontrollgruppe keine Diagnose mehr. Die Veröffent-
lichung der Ergebnisse zur langfristigen Wirksamkeit des Therapieprogramms (6-Monats-
Follow up) wird derzeit vorbereitet.
Auch das Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ) -
Soziale Ängste (Büch & Döpfner, 2012) wurde für die kognitiv-verhaltenstherapeutische
Behandlung von Kindern mit Sozialer Ängstlichkeit bzw. mit Sozialer Phobie konzipiert.
Das THAZ-Programm wurde in erster Linie für die Einzeltherapie von 8- bis 14-jährigen
Kindern und Jugendlichen entwickelt, kann jedoch in modifizierter Form auch für die
Gruppentherapie eingesetzt werden. Das Therapieprogramm besteht aus kind- und eltern-
zentrierten Interventionen, die kognitive (Psychoedukation, Erarbeitung eines Störungs-
und Behandlungskonzepts, Kognitive Umstrukturierung), behaviorale (Kompetenztraining)
und emotional-physiologische Methoden (Expositionsübungen) miteinander kombinieren.
Es hat einen modularen Aufbau, so dass für die Therapie eines Kindes einzelne Behand-
lungsbausteine individuell ausgewählt und zusammengestellt werden können. Infolgedessen
ist die Anzahl der Therapiesitzungen vom Ausmaß der empfundenen Angst und vom Grad
2 Theorie 81
der erlebten Beeinträchtigung abhängig. Die Inhalte des Therapieprogramms sind in eine
Geschichte eingebettet, in der die Identifikationsfigur Kati Kool schrittweise ihre Angst
bewältigt. Die Wirksamkeit des störungsspezifischen Therapieprogramms wurde in einer
ersten Pilotstudie mit einem Eigenkontrollgruppendesign überprüft (Büch, 2008; Büch &
Döpfner, 2011). Im Urteil der Kinder reduzierten sich die sozialen Ängste während der
Therapiephase signifikant stärker als während der Baselinephase. Im Elternurteil wurde die
statistische Signifikanz knapp verfehlt. Dennoch konnten für beide Urteile große Effekte
nachgewiesen werden. Diese Therapieeffekte blieben auch während eines Katamnesezeit-
raums von sechs Monaten stabil. Die Pilotstudie liefert demzufolge erste Hinweise auf die
Wirksamkeit des Therapieprogramms, macht aber in jedem Fall weitere Forschung an
größeren Stichproben und mit einem randomisierten Kontrollgruppendesign notwendig.
Dagegen entwickelten Tuschen-Caffier, Kühl und Bender (2009) ein störungsspezifisches,
kognitiv-verhaltenstherapeutisches Training, das für den Einsatz im Gruppensetting (mit
vier bis acht Kindern) bestimmt ist. Ihr Programm richtet sich an 8- bis 14-jährige Kinder
und Jugendliche mit (subklinischen) sozialen Ängsten und sozialen Angststörungen. Es
kann sowohl zur indizierten Prävention (12 Sitzungen) als auch zur Therapie (20 Sitzungen)
eingesetzt werden. Die Eltern werden mit drei Elternabenden in die Behandlung des Kin-
des einbezogen. Zu den zentralen Elementen dieses Therapieprogramms gehören die
Veränderung der dysfunktionalen Kognitionen, die Verbesserung der sozialen Kompetenz
bzw. Performanz und die (graduierte) Konfrontation mit angstauslösenden Situationen.
Durch die Modularisierung des Therapieprogramms können je nach Belastungserleben der
Kinder unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und individualisierte Übungen
ausgewählt werden. Die Wirksamkeit des Interventionsprogramms wurde in einer Pilot-
studie (Wartekontrollgruppendesign; N = 17) mit 15 Gruppensitzungen und einer Haupt-
studie (Eigenkontrollgruppendesign; N = 24) mit 20 Gruppensitzungen überprüft (Kühl,
2005). In beiden Studien zeigte sich nach dem Training eine klinisch bedeutsame Verringe-
rung der sozialen Ängste, die über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil blieb. Nach
der Behandlung erfüllten nur noch 47 % (Pilotstudie) bzw. 17 % (Hauptstudie) der Kinder
die Kriterien für die Diagnose einer Sozialen Phobie (nach DSM-IV), sechs Monate später
waren es nur noch 29 % bzw. 13 %. Die beiden Studien zeigen, dass Kinder mit sozialen
Angststörungen von der längeren Trainingsvariante schneller und deutlicher profitieren.
Weitere Studien zur Wirksamkeit des Trainings als Präventions- bzw. Interventionspro-
2 Theorie 82
gramm werden bereits durchgeführt (Tuschen-Caffier et al., in Vorbereitung; zitiert nach
Kley, Heinrichs, Bender & Tuschen-Caffier, 2012).
Auch das Trainingsprogramm Mutig werden mit Til Tiger (Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius,
2009) wurde als Gruppentraining für unsichere, schüchterne und sozial ängstliche Kinder
im Alter von 5 bis 10 Jahren entwickelt. Dabei dient ein kleiner, schüchterner Tiger („Til
Tiger“) als kindgerechte Identifikationsfigur. Der Schwerpunkt dieses Trainingsprogramms
liegt auf dem Aufbau und der Förderung von sozialen Kompetenzen. In 2 Einzelstunden
und 9 Gruppenstunden (1 x Woche, 60 Minuten) wird mit den Kindern selbstsicheres
Verhalten theoretisch erarbeitet und/oder praktisch eingeübt. Mit Hilfe eines Selbst-
beobachtungsbogens („Wanderkarte“) werden die Kinder angeleitet, die neu erworbenen
Fertigkeiten (z. B. jemanden einladen, etwas ablehnen, alleine einkaufen) auch in alltäg-
lichen Situationen auszuprobieren. Die Eltern sollten – wenn möglich – in die Behandlung
des Kindes einbezogen werden, um ihr Kind bei der Bewältigung bisher angstauslösender
Situationen zu unterstützen. In einer Evaluationsstudie verglich Ahrens-Eipper (2003) eine
Wartekontrollgruppe mit zwei Interventionsgruppen, die entweder ein Verhaltenstraining
oder ein Problemlösetraining erhielten. Die beiden Versionen dieses störungsspezifischen
Therapieprogramms unterschieden sich nur in ihren Behandlungsschwerpunkten: Beim
Verhaltenstraining wurden überwiegend Rollenspiele, beim Problemlösetraining überwie-
gend Problemlösestrategien eingesetzt. Nach dem Training wiesen die Kinder der Interven-
tionsgruppe signifikant weniger soziale Ängste, eine höhere soziale Kompetenz und einen
höheren Selbstwert auf als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Die Anzahl der Kinder mit
klinisch bedeutsamen Ängsten nahm in der Interventionsgruppe (mit 51 %) stärker ab als
in der Wartekontrollgruppe (mit 13 %). Das Verhaltenstraining war dem Problemlösetrai-
ning etwas überlegen, weil die sozialen Ängste der Kinder in dieser Trainingsgruppe stärker
reduziert werden konnten. Die beiden Trainingsvarianten zeigten jedoch keine trainings-
spezifische Wirkung. Zur Nachuntersuchung nach etwa 1.5 Jahren hatten sich die sozialen
Ängste bei 80 % der Kinder vom dysfunktionalen in den funktionalen Bereich verbessert.
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 83
3 Training mit sozial unsicheren Kindern
3.1 Aufbau des Trainings
Das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) ist ein
kognitiv-verhaltenstherapeutisches Trainingsprogramm, das für schüchterne, gehemmte
und ängstliche Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren entwickelt wurde. Mit diesem
Programm können verschiedene kindliche Ängste behandelt werden, die in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit sozialen Situationen stehen: Trennungsängste, Soziale
Ängste, Soziale Phobien und Generalisierte Ängste (vgl. auch Kapitel 2.1.1). Das Ziel
dieses Trainings ist es, die sozialen Ängste der Kinder abzubauen und den Umgang mit
bisher angstauslösenden Situationen durch den Aufbau sozialer Fertigkeiten langfristig zu
verbessern. Dabei wird angestrebt, dass die Kinder insbesondere alltägliche Belastungs-
situationen (z. B. Schulbesuch, Spielplatz, Sportverein, Verabredungen) ihrem Alter ent-
sprechend sozial kompetent bewältigen können.
Eine grundlegende Orientierung erfährt das Trainingskonzept durch die Theorie der erlern-
ten Hilflosigkeit (Seligman, 2010). Seligman geht davon aus, dass Personen mit Hilflosigkeit
reagieren, wenn sie Ereignisse in ihrer Umwelt wiederholt als unkontrollierbar erleben und
erfahren, dass das eigene Handeln keinen Einfluss auf das Handlungsergebnis hat. Diese
Hilflosigkeit kann sich in motivationalen Störungen (z. B. Initiativlosigkeit, Passivität),
kognitiven Störungen (z. B. Wahrnehmung der Unabhängigkeit von Reaktion und Konse-
quenz) und emotionalen Störungen (z. B. Angst, Depression) äußern.
Bei der Entwicklung des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ wurde eine multi-
modale Behandlungsstrategie umgesetzt, die unterschiedliche Personen (z. B. Kind, Eltern,
Lehrer) und Lebensbereiche (z. B. Familie, Freizeit, Schule) berücksichtigt. Das vorliegende
Trainingsprogramm besteht aus kindzentrierten und familienzentrierten Interventionen, die
eng aufeinander bezogen sind. Dabei findet zunächst ein Training mit dem einzelnen Kind,
anschließend ein Training in der Kleingruppe mit drei bis vier Kindern statt. Das Training
für die Kinder wird mit einer begleitenden Eltern- bzw. Familienberatung kombiniert, um
diejenigen Bedingungen innerhalb der Familie zu verändern, die zur Aufrechterhaltung der
Symptomatik beitragen. Zusätzlich können schulzentrierte Interventionen durchgeführt
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 84
werden, um die Wirksamkeit des Trainings zu steigern und die Übertragbarkeit der Erfolge
auf den schulischen Alltag zu verbessern. Die Interventionen in der Schule stellen im
Wesentlichen Modifikationen der kind- und/oder familienzentrierten Interventionen an die
Bedingungen oder Probleme in der Schule dar.
Das Training erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens fünf Monaten, wobei die
Trainingssitzungen in wöchentlichem Abstand stattfinden. Idealerweise wird das Training
von zwei Trainern durchgeführt; dabei hat es sich in der Praxis als günstig erwiesen, einen
weiblichen und einen männlichen Trainer einzusetzen.
Das Training für Kinder und Eltern wird durch eine hierarchische Abfolge von Lernzielen
gegliedert. Jeder Behandlungsbaustein (Modul) stellt eine thematische Einheit mit konkre-
ten Zielen, praktischen Vorgehensweisen und entsprechenden Materialien dar. Auf die
modulspezifischen Ziele und Inhalte wird bei der Darstellung der Trainingsinhalte für
Kinder (vgl. Tabelle 11 und 12) und Eltern (vgl. Tabelle 13) ausführlich eingegangen. Ein
Modul wird in einer oder mehreren Trainingssitzungen bearbeitet. Wie viel Zeit für die
Bearbeitung eines Moduls benötigt wird, hängt vom Alter des Kindes, von der Intelligenz
des Kindes, vom Schweregrad der Angststörung, vom Vorliegen komorbider Störungen
und vom Umfang vorhandener Ressourcen ab. Für die Durchführung des Trainings mit
Schulkindern wird eine Sitzungslänge von 100 Minuten empfohlen. Die Sitzungslänge des
Einzeltrainings kann auf 50 Minuten verkürzt werden, wenn Kinder stark ausgeprägte
Ängste, kognitive Einschränkungen oder große Konzentrationsschwierigkeiten aufweisen.
Auch der Aufbau der einzelnen Trainingssitzungen folgt einer vorgegebenen Struktur (vgl.
Kapitel 3.2.1 für den Aufbau der Trainingssitzungen mit den Kindern und Kapitel 3.2.2 für
den Aufbau der Beratungsgespräche mit den Eltern).
Durch die festgelegte Abfolge von Lernzielen und die vorgegebene Struktur der Sitzungen
gibt das Training zwar einen Rahmen vor, bietet aber auch die Möglichkeit, diesen im Sinne
eines modularen Systems flexibel anzuwenden und individuell auszugestalten. Eine indivi-
duelle Abstimmung auf das Kind, seine Familie und seine Lebenssituation erfolgt über die
gewählten Inhalte, die eingesetzten Materialien, die notwendigen Konfrontationsübungen,
die Selbstbeobachtungsaufgaben und die Selbstinstruktionen. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, Inhalte entweder über mehrere Trainingssitzungen zu verteilen und wichtige
Materialien wiederholt einzusetzen (bei Überforderung des Kindes) oder auf einige, wenige
Trainingssitzungen zu begrenzen (bei Unterforderung des Kindes).
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 85
3.2 Inhalte des Trainings
3.2.1 Trainingsinhalte für Kinder
Die kindzentrierten Interventionen bestehen aus Einzel- und Gruppentraining, wobei das
Training mit dem einzelnen Kind dem Training mit der Kindergruppe vorangestellt ist. Sie
zielen darauf ab, sozial kompetentes Verhalten schrittweise aufzubauen. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen die Kinder einerseits soziale Fertigkeiten erwerben und andererseits so-
ziale Angst abbauen, um die erworbenen bzw. bereits vorhandenen Fertigkeiten in sozialen
Situationen anwenden zu können.
Zu den verhaltenstherapeutischen Interventionen, die im vorliegenden Trainingsprogramm
eingesetzt werden, zählen Psychoedukation, Kognitive Umstrukturierung, Konfrontations-
verfahren (vor allem graduiertes Vorgehen), Soziales Kompetenztraining, Operante
Methoden, Entspannungsverfahren und Hausaufgaben. Dabei sind Psychoedukation,
Kognitive Interventionen und Konfrontationsverfahren für eine erfolgreiche Behandlung
von Angststörungen von entscheidender Bedeutung (Schneider & In-Albon, 2006). In bis-
herigen Therapiestudien zeigten vor allem die Konfrontationsverfahren eine gute Wirk-
samkeit (vgl. Chambless & Ollendick, 2001; Schneider & Döpfner, 2004).
Das Einzeltraining besteht aus vier Behandlungsbausteinen (Modulen) und umfasst somit
mindestens vier Sitzungen à 100 Minuten oder acht Sitzungen à 50 Minuten (1 x Woche).
Es dient vor allem dem Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung zwischen
Kind und Therapeut. Darüber hinaus wird angestrebt, die einzelnen Kinder in ihrer Be-
handlungsmotivation zu stärken und auf das anschließende Gruppentraining vorzubereiten.
Um von den Verhaltensübungen im Gruppentraining gleichermaßen profitieren zu kön-
nen, müssen alle Kinder über wesentliche Informationen und grundlegende Fertigkeiten im
Bereich sozialer Kompetenzen verfügen. Tabelle 11 gibt einen Überblick über die Inhalte
und Ziele der vier verschiedenen Module des Einzeltrainings sowie die zugeordneten Ar-
beitsmaterialien, die in der Arbeit mit dem einzelnen Kind eingesetzt werden können. Nach
einer Einführung in das Trainingsprogramm folgt die altersgerechte Vermittlung von In-
formationen zum Thema Soziale Angst (z. B. Komponenten der Angst: Körperliche Symp-
tome, Gedanken, Verhalten; Unterschied zwischen normaler und pathologischer Angst).
Anschließend werden kognitive Interventionen eingesetzt, die darauf abzielen, die kindliche
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 86
Bewertung von Angstauslösern und Angstsymptomen zu verändern. Das Kind wird dazu
angeleitet, seine die Angst fördernden Gedanken zu erkennen, zu überprüfen und zu ver-
ändern. Nachdem der Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten her-
ausgearbeitet wurde, werden gemeinsam mit dem Kind alternative Gedanken (z. B. Stopp-
Signale, Selbstinstruktionen) entwickelt, um angstauslösende Situationen zukünftig besser
bewältigen zu können. Darüber hinaus findet im Puppen- und Rollenspiel ein Erwerb
grundlegender sozialer Kompetenzen statt. Die verhaltensbezogenen Rückmeldungen des
Trainers (z. B. Dauer des Blickkontakts, Lautstärke beim Sprechen) helfen dem Kind, mög-
liche Unsicherheiten über die Angemessenheit seines Verhaltens allmählich abzubauen.
Das Gruppentraining mit drei bis vier Kindern besteht aus sechs Behandlungsbausteinen
(Modulen), die in mindestens sechs Sitzungen à 100 Minuten oder zwölf Sitzungen à 50
Minuten bearbeitet werden (1 x Woche). Bevor mit der Durchführung der einzelnen Mo-
dule begonnen wird, findet eine Kennenlernphase (2 Sitzungen) statt, in der sich die Kinder im
Rahmen freier Spielaktivitäten gegenseitig kennen lernen können. Im Mittelpunkt des an-
schließenden Gruppentrainings steht das alltagsnahe Einüben sozial kompetenten Verhal-
tens. Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Inhalte und Ziele der sechs verschiedenen
Module des Gruppentrainings sowie die zugeordneten Arbeitsmaterialien, die in der Arbeit
mit der Kindergruppe eingesetzt werden können. Die sozialen Kompetenzen, die die Kin-
der zunächst in Rollenspielen, später in Alltagssituationen erwerben, beziehen sich auf
konkrete soziale Fertigkeiten, die im Umgang mit verschiedenen Interaktionspartnern (z. B.
Familie, Freunde, Mitschüler, Nachbarn, Verkäufer, Lehrer, Ärzte, Polizisten) erforderlich
sind. Die Komplexität der vorgegebenen Problemsituationen nimmt dabei im Verlauf des
Trainings zu: Im ersten Drittel des Gruppentrainings, der sogenannten Erlernphase (mind. 2
Sitzungen), werden einfache Problemsituationen und deren Lösungen vorgegeben, um den
Kindern die Gelegenheit zu geben, grundlegende soziale Fertigkeiten im Rollenspiel einzu-
üben (z. B. positive Gefühle gegenüber einer vertrauten Person zum Ausdruck bringen).
Im mittleren Drittel, der sogenannten Belastungsphase (mind. 2 Sitzungen), sollen die Kinder
im Rollenspiel lernen, auch mit komplexeren Problemsituationen sicher umzugehen (z. B.
Kontakt zu einer fremden Person aufnehmen). In dieser Phase gibt der Trainer nicht mehr
die vollständige Lösung vor, sondern unterstützt die Kinder bei der eigenständigen Lö-
sungssuche. Im letzten Drittel, der sogenannten Transferphase (mind. 2 Sitzungen), werden
die bereits erworbenen Fertigkeiten auf Alltagssituationen der Kinder übertragen: In dieser
Phase sollen die Kinder Problemsituationen aus ihrem Alltag schildern und selbstständig
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 87
nach Lösungen suchen (z. B. Ansichten und Kritik vor einer Personengruppe äußern).
Sobald die Kinder die einzelnen sozialen Fertigkeiten im Rollenspiel beherrschen, sollen sie
diese auch in Alltagssituationen einüben. Solche Konfrontationsübungen, die die Kinder
anfangs mit Unterstützung der Eltern, später selbstständig durchführen sollen, helfen da-
bei, die aktive Auseinandersetzung mit den gefürchteten Situationen zu fördern und bisher
gezeigtes Vermeidungsverhalten abzubauen.
Um Orientierung zu geben und Sicherheit zu vermitteln, haben die Trainingssitzungen mit
den Kindern eine aus vier Phasen bestehende, gleichbleibende Struktur: Zu Beginn der
Trainingssitzung wird mit dem einzelnen Kind bzw. mit der Kindergruppe die Trainings-
aufgabe aus der letzten Sitzung besprochen (ca. 15 Minuten). Dieses Auswertungsgespräch
bezieht sich auf den Detektivbogen, mit dessen Hilfe die Kinder angeleitet werden, ihr eigenes
sicheres und sozial kompetentes Verhalten im Alltag wie ein Detektiv zu beobachten und
zu protokollieren. Danach wird eine imaginative Entspannungsübung (Kapitän-Nemo-
Geschichten; Petermann, 2013) mit kognitiven Elementen des Autogenen Trainings (z. B.
Schwere- und Wärmeübung) und positiven Selbstinstruktionen (z. B. Kapitän-Nemo-
Spruch: „Nur ruhig Mut, dann geht alles gut!“) durchgeführt (ca. 20 Minuten). Die Ent-
spannungsübung dient dazu, das allgemeine Anspannungsniveau der ängstlichen Kinder zu
reduzieren. In der sich anschließenden Arbeitsphase werden die modulspezifischen Inhalte
erarbeitet (vgl. auch Tabellen 11 und 12), die dem Abbau sozialer Angst und dem Erwerb
sozialer Fertigkeiten dienen (ca. 40 Minuten). Zu diesem Zweck werden problembezogene
Materialien (z. B. Videofilme, Fotogeschichten, Comicgeschichten) bearbeitet und Rollen-
spiele durchgeführt. Durch Verstärker-Systeme (v. a. Token-Systeme) werden die Kinder
darin unterstützt, aktiv mitzuarbeiten und sich sozial kompetent zu verhalten. Haben die
Kinder die zuvor festgelegten Verhaltensweisen während der Arbeitsphase gezeigt, erhalten
sie Punkte (= Tokens), die sie gegen Spielminuten eintauschen können. Die Trainings-
sitzung endet also mit einer angeleiteten oder freien Spielzeit (max. 15 Minuten).
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 88
Tabelle 11: Überblick über die Module des Einzeltrainings mit den Kindern: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b)
Inhalt und Ziele Arbeitsmaterialien
Erstkontakt Der Erstkontakt dient vor allem dem Auf-bau einer therapeutischen Beziehung zum Kind. Es werden Informationen über den Aufbau des Trainings und den Ablauf der einzelnen Sitzungen gegeben sowie einige Trainingsmaterialien (z. B. Detektivbogen) beispielhaft vorgestellt. Am Ende des Erstkontakts wird ein Trainingsvertrag mit dem Kind geschlossen.
Arbeitsblatt ET 1 ET 2 ET 3 ET 4
Trainingsvertrag Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen Instruktionskarte: Kapitän-Nemo-Spruch Aufgabenliste für die Spielminuten
Modul I Im ersten Modul wird in das Thema „So-ziale Angst“ eingeführt. Eine Video- bzw. Fotogeschichte wird bearbeitet, um sozial ängstliches Verhalten anhand einer All-tagssituation zu verdeutlichen. Nach der Darstellung dieser Situation werden ver-schiedene Lösungsmöglichkeiten aufge-zeigt, die das Kind wahrnehmen, beschrei-ben und bewerten soll. In einem Puppen- oder Rollenspiel wird eine sozial sichere Verhaltensweise mit dem Kind eingeübt.
Videofilm oder Arbeitsblatt ET 5.1 ET 5.2 ET 5.3 ET 5.4 ET 5.5 ET 5.6 ET 2
Verhaltensgestörte Kinder Ich möchte auch gern damit spielen! Soll ich mitspielen? Vorlesen vor der Klasse Die Beleidigung Wie komme ich zu meinem Geld Eine Verabredung Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul II Im zweiten Modul wird der Zusammen-hang zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten erarbeitet. Das Kind soll ver-schiedenen Gesichtsausdrücken Gefühle und Gedanken zuordnen. Die in einer bestimmten Situation angsterzeugenden Gedanken werden identifiziert. Es werden alternative Gedanken entwickelt, die dem Kind helfen, angstauslösende Situationen zukünftig besser zu bewältigen.
Arbeitsblatt ET 6.1 - 6.6 ET 7.1 - 7.6 ET 8.1 - 8.2 ET 2
Sechs Wolkenköpfe ohne Selbst-instruktionen Sechs Wolkenköpfe mit Selbst-instruktionen Leere Gesichter in leeren Wolken-köpfen Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul III Im dritten Modul wird eine starke, mutige oder heldenhafte Identifikationsfigur ein-geführt. Das Kind soll sich zunächst mit den Ängsten dieser Identifikationsfigur, anschließend mit seinen eigenen Ängsten in sozialen Situationen auseinandersetzen. Ausgehend von den berichteten Ängsten werden gemeinsam mit dem Kind die wichtigsten Behandlungsziele festgelegt.
Arbeitsblatt ET 9 ET 10 ET 11 ET 12 ET 2
Wovor hat Superman Angst? Wovor hat Micky Maus Angst? Wovor habe ich Angst? Das Verlernen-Erlernen-Spiel Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul IV Im vierten Modul werden verschiedene Kriterien erarbeitet, anhand derer ein Verhalten in sozialen Situationen als sicher bzw. unsicher beurteilt werden kann. Aus Gestik, Mimik und Sprache der Inter-aktionspartner soll sich das Kind den Inhalt einer Geschichte erschließen. Das Verhalten eines sozial sicheren Kindes wird in einem Rollenspiel eingeübt.
Arbeitsblatt ET 13.1 ET 13.2 ET 13.3 ET 3 ET 2
Was will Ralf? Was hat Ralf nur? Svens Meinung/Jörgs Meinung Instruktionskarte: Kapitän-Nemo-Spruch Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 89
Tabelle 12: Überblick über die Module des Gruppentrainings mit den Kindern: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b)
Inhalt und Ziele Arbeitsmaterialien
Erstkontakt der Gruppe
Der Erstkontakt dient vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen der Gruppen-mitglieder (u. a. Kennenlernspiele). Zudem werden Regeln für einen fairen Umgang innerhalb der Gruppe ausgehandelt.
Spielmaterialien
Modul I Im ersten Modul wird sozial kompetentes Verhalten beim Zeigen und Mitteilen positiver Gefühle (vor allem Freude) in materialgestützten Gesprächen herausge-arbeitet und in Puppen- oder Rollenspie-len (mit Rollentausch) eingeübt.
Arbeitsblatt GT 1.1 GT 1.2 ET 2
Das Geburtstagsgeschenk von Ulf Das Geburtstagsgeschenk von Uschi Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul II Im zweiten Modul wird sozial kompeten-tes Verhalten beim Durchsetzen der eige-nen berechtigten Ansprüche und beim Erkennen der berechtigten Ansprüche anderer Personen in materialgestützten Gesprächen herausgearbeitet und in Rol-lenspielen (mit Rollentausch) eingeübt.
Arbeitsblatt GT 2 ET 2
Hausaufgaben erfragen Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul III Im dritten Modul wird sozial kompetentes Verhalten bei der Kontaktaufnahme zu fremden Personen sowie im Umgang mit berechtigter Kritik in Gesprächen und Rollenspielen (mit Rollentausch) herausge-arbeitet und eingeübt.
Arbeitsblatt GT 3.1 GT 3.2 ET 2
Fragen auf der Straße Der Deutsch-Aufsatz Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul IV Im vierten Modul wird den Kindern ein hohes Maß an Selbstbehauptung abver-langt, indem sie für eine vorgegebene Problemsituation eine Lösung mit sozial kompetentem Verhalten entwickeln und selbstständig als Hörspiel umsetzen sollen. Einfühlendes Verständnis und Verhalten wird in einem Rollenspiel mit Puppen oder Stofftieren eingeübt.
Videofilm oder Arbeitsblatt ET 5.6 ET 2
Verhaltensgestörte Kinder Eine Verabredung Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul V Im fünften Modul wird sozial kompeten-tes Verhalten beim Umgang mit sozialer Hervorhebung und beim Äußern von Gefühlen, Meinungen und Kritik in mate-rialgestützten Gesprächen herausgearbeitet und im Rollenspiel eingeübt. Die Ausei-nandersetzung mit diesen Themen wird als „Live-Situation“ innerhalb der Gruppe verwirklicht; beide Übungen werden auf-gezeichnet und nachbesprochen.
Arbeitsblatt GT 4.1 ET 3 KG 1.1 - 1.5 GT 4.2 ET 2
Aufgerufen werden in der Schule Instruktionskarte: Kapitän-Nemo-Spruch Verschiedene Instruktionskarten Diskutieren mit anderen Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
Modul VI Im sechsten Modul sollen die Kinder – vorbereitet durch materialgestützte Gespräche – selbstständig ein Rollenspiel entwickeln, um das Äußern von Lob und Anerkennung einzuüben. In einer freien Spielsituation sollen sie danach ihr koope-ratives Verhalten unter Beweis stellen.
Arbeitsblatt GT 5 ET 2
Mannschaftsspiel Detektivbogen zum Sammeln von Beweisen
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 90
Inhalt und Ziele Arbeitsmaterialien
Abschied Beim letzten Kontakt nehmen die Kinder und Trainer Abschied voneinander. Die Trainer verleihen den Kindern eine Urkunde für ihren Mut in bestimmten, bisher angstauslösenden Situationen.
Spielmaterialien Urkunden
3.2.2 Trainingsinhalte für Eltern
Das Training für die Kinder wird durch begleitend stattfindende Beratungsgespräche mit
den Eltern bzw. der Familie ergänzt. Die Eltern- bzw. Familienberatung besteht aus fünf
Behandlungsbausteinen (Modulen); die Eltern bzw. Familien werden also mit mindestens
fünf Sitzungen à 100 Minuten in die Behandlung der Kinder einbezogen (etwa 1 x Monat).
Durch den Einbezug der Eltern lassen sich die aufrechterhaltenden familiären Bedingun-
gen so verändern, dass aktuelle Probleme behoben und zukünftige Probleme vermieden
werden. Die entscheidende Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit ist der
Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung zwischen Eltern und Therapeut.
Einen Überblick über die Inhalte und Ziele der fünf verschiedenen Module der Eltern-
bzw. Familienberatung sowie die zugeordneten Arbeitsmaterialien, die in der Arbeit mit
den Eltern bzw. mit der Familie eingesetzt werden können, gibt Tabelle 13. Zu Beginn der
Beratung werden den Eltern die Ergebnisse der Diagnostik mitgeteilt und Informationen
über die bei ihrem Kind diagnostizierte Störung vermittelt. Anschließend wird gemeinsam
mit den Eltern ein Störungskonzept entwickelt und die im Rahmen des Trainings geplanten
Behandlungsschritte besprochen. Die Beratung wird schwerpunktmäßig dafür genutzt,
gemeinsam mit den Eltern Möglichkeiten zur Unterstützung des Kindes in angstauslösen-
den Situationen zu erarbeiten: So wird den Eltern empfohlen, bei starken Angstreaktionen
des Kindes grundsätzlich einfühlsam, beruhigend und geduldig zu reagieren. Die Eltern
werden angehalten, ängstliches Verhalten des Kindes möglichst nicht mehr zu beachten,
sondern stattdessen mutiges, angstbewältigendes Verhalten zu loben und gegebenenfalls
mit einem Token-System zu verstärken. Weiterhin werden die Eltern darin bestärkt,
Vermeidungsverhalten des Kindes in angstauslösenden Situationen zu verhindern (z. B. zu
Hause bleiben) und altersangemessene Forderungen durchzusetzen (z. B. in die Schule
gehen). Gleichzeitig werden die Eltern, insbesondere diejenigen mit überbehütendem
Erziehungsstil, dazu ermutigt, dem Kind – in Abhängigkeit von seinem Alter – mehr
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 91
Eigenverantwortung zu übergeben und so seine Selbstständigkeit zu fördern (z. B. Mithilfe
im Haushalt, Sozialkontakte, Freizeitaktivitäten). Es hat sich als hilfreich erwiesen, den El-
tern nicht nur genaue Verhaltensregeln vorzugeben, sondern diese auch anhand konkreter
Alltagssituationen im Rollenspiel einzuüben. Darüber hinaus werden die dysfunktionalen
Gedanken der Eltern in Bezug auf das Kind (z. B. „Das kann ich meinem Kind nicht
zumuten! Als gute Mutter bzw. guter Vater bin ich immer für mein Kind da!“) und/oder
auf die vom Kind gefürchteten Situationen (z. B. „Der Schulweg ist gefährlich!“) auf ihren
Realitätsgehalt überprüft und verändert. Weist auch ein Elternteil stark ausgeprägte Ängste
auf, sollten innerhalb der Beratung Strategien zum Umgang mit diesen Ängsten erarbeitet
bzw. dem Elternteil eine eigene Psychotherapie empfohlen werden. Zuletzt werden die
Eltern darauf vorbereitet, dass auch nach dem Ende des Trainings noch Probleme auf-
treten können (z. B. nach Krankheiten, nach Schulferien). Gemeinsam wird überlegt, wie
die Familie die neu erworbenen Fertigkeiten allein einsetzen kann, um möglicherweise
(wieder) auftretenden Problemen erfolgreich zu begegnen.
Auch die Beratungsgespräche mit den Eltern bzw. Familien besitzen eine gleich bleibende
Struktur: Zu Beginn des Gesprächs werden die Eltern über den Verlauf der Trainingssitzungen
mit dem einzelnen Kind bzw. mit der Kindergruppe informiert (v. a. Inhalt und Ziele der
Trainingssitzungen, Verhaltensbeobachtungen). Anschließend schildern die Eltern ihre
Beobachtungen aus dem Alltag mit ihrem Kind (Verhaltensprobleme, Verhaltensfortschritte).
Nach der gemeinsamen Auswertung des Wochenplans, der mit dem Detektivbogen für die
Kinder vergleichbar ist, also Trainingsaufgaben für die Eltern enthält, werden modulspezi-
fische Inhalte (vgl. Tabelle 13) besprochen. In dieser Arbeitsphase werden die Eltern in ihrer
Erziehungskompetenz gestärkt und angeleitet, ihr Kind bei der Bewältigung angstauslösen-
der Situationen wirkungsvoll zu unterstützen. Mit der Erarbeitung eines neuen Wochenplans
wird das Beratungsgespräch beendet.
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 92
Tabelle 13: Überblick über die Module der Eltern- bzw. Familienberatung: Inhalte und Ziele sowie zugeordnete Arbeitsmaterialien (vgl. Petermann & Petermann, 2006b)
Inhalt und Ziele Arbeitsmaterialien
Erstkontakt Der Erstkontakt dient vor allem dem Auf-bau einer therapeutischen Beziehung zu den Eltern. Die klinische Exploration der Eltern wird durchgeführt, um Informationen über die Probleme des Kindes zu gewinnen.
Arbeitsblatt D 5
Elternexplorationsbogen
Modul I Zunächst werden den Eltern die Ergebnisse der diagnostischen Untersuchungen mitge-teilt. Anschließend werden die Eltern über die Störung und die geplanten Behandlungs-schritte informiert. Danach werden die Erwartungen der Eltern erfragt und auf ihre Angemessenheit überprüft. Mit Hilfe eines Beobachtungsbogens werden die Eltern in die Verhaltensbeobachtung eingeführt.
Arbeitsblatt E 1 E 3 D 7 E 2
Elterninformation zum Training mit sozial unsicheren Kindern Wunschliste für Eltern Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten Hinweise zum Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten
Modul II Danach werden die einzelnen Behandlungs-ziele festgelegt, die sich auf Probleme des Kindes und der Familie beziehen können. Unter Zuhilfenahme mehrerer Beispiele wird eine gemeinsame Vorstellung über die Ursachen des Problemverhaltens erarbeitet. Anschließend werden alternative Problemlö-sungsstrategien erarbeitet, die als konkrete Aufgaben für Eltern und Kind in einen Wochenplan übertragen werden.
Arbeitsblatt E 4 E 5
Wie entsteht Verhalten? Unser Wochenplan
Modul III An dieser Stelle werden die positiven Ver-haltensänderungen beim Kind und bei den Eltern besprochen und verstärkt. Es wird ein weiterer Wochenplan erarbeitet, um die neu erworbenen Fertigkeiten zu stabilisieren und auf neue Alltagssituationen auszuweiten.
Aufzeichnungen aus den Trainingssitzungen (ggf. Audio- oder Videoaufzeichnungen)
Arbeitsblatt E 5
Unser Wochenplan
Modul IV Weiterhin werden ungünstige Einstellungen und Haltungen der Eltern in der Erziehung des Kindes bearbeitet. Daraus entwickelte alternative Verhaltensweisen werden mit einem weiteren Wochenplan verknüpft.
Arbeitsblatt E 6 E 5
Häufige Gedanken und Sorgen von Eltern Unser Wochenplan
Modul V Zuletzt wird mit den Eltern besprochen, wie erfolgreich das Training war, welche Ziele erreicht und welche Maßnahmen als hilf-reich erlebt wurden, welche Probleme noch bestehen und wie (wieder) auftretenden Problemen begegnet werden kann.
Aufzeichnungen aus den Trainingssitzungen (ggf. Audio- oder Videoaufzeichnungen)
Katamnese Das Nachsorgegespräch dient in erster Linie dazu, die weitere Entwicklung des Kindes zu besprechen. Die Eltern werden aufgefordert, über Veränderungen im Verhalten des Kin-des und in der Familie zu berichten (unsys-tematisch, systematisch). Abschließend wird geklärt, ob weiterer Hilfebedarf besteht.
Arbeitsblatt D 7 E 2
Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten Hinweise zum Beobachtungsbogen für sozial unsicheres Verhalten
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 93
3.3 Bisherige Wirksamkeitsnachweise
Die Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann,
2006b) wurde in verschiedenen Studien einzelfallstatistisch überprüft. Einen orientierenden
Überblick über die bisher durchgeführten Untersuchungen zur Wirksamkeit des Trainings
gibt Tabelle 15. Im Folgenden soll das methodische Vorgehen der tabellarisch aufgeführten
Einzelfallstudien zusammenfassend dargestellt werden.
In vielen Einzelfallanalysen wurde die Wirksamkeit des Trainings mit einem Ausblendungs-
design überprüft. Unter einem Ausblendungsdesign versteht man einen Versuchsplan, bei
dem das Training nach einer Interventionsphase oder zwischen zwei Interventionsphasen
für einige Zeit unterbrochen (= ausgeblendet) wird, um in dieser Beobachtungsphase (ohne
Intervention) die Auswirkungen der unmittelbar vorausgegangenen Intervention auf das
Verhalten zu überprüfen (vgl. Fichtner, 1996). Verschiedene Einzelfallversuchspläne unter-
scheiden sich vor allem darin, wie sich Interventions- und Beobachtungsphasen abwech-
seln. Dem Aufbau des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ folgend, das eine ge-
trennte Durchführung von Einzel- und Gruppentraining vorsieht, wurde in vielen Einzel-
fallanalysen ein Ausblendungsdesign mit den Phasen B - A - C umgesetzt. Zur Erklärung
dieser Phasen dient die nachfolgend aufgeführte Tabelle 14. Dabei ist zu beachten, dass
sich die Überprüfung der Effekte nur auf das Training mit den Kindern bezieht; mögliche
Effekte der Eltern- bzw. Familienberatung wurden nicht einzeln berücksichtigt.
Tabelle 14: Übersicht über mögliche Phasen eines Ausblendungsdesigns (entnommen aus Petermann & Petermann, 2006b, S. 265)
A-Phase: Beobachtungsphase, die Abschnitte bezeichnet, in denen keine Behandlung durchgeführt wird und die vor und/oder zwischen Behandlungsphasen liegen können (hier: Kennenlernphase zwischen Einzel- und Gruppentraining)
B-Phase: Behandlungsphase, die einen zeitlich vorgeordneten, meist weniger komplexen Trainings-abschnitt bezeichnet (hier: Einzeltraining)
C-Phase: Behandlungsphase, die einen zeitlich nachgeordneten, meist etwas komplexeren Trainings-abschnitt bezeichnet (hier: Gruppentraining)
BC-Phase: Kombinierte Behandlungsphase, die sich aus Bestandteilen der B- und C-Phase zusammensetzt (hier: Kombination von Einzel- und Gruppentraining)
Zur Einschätzung der sozialen Ängstlichkeit der Kinder wurden systematische Verhaltens-
beobachtungen mit Hilfe des „Beobachtungsbogens für sozial unsichere Kinder“ (BSU;
Petermann & Petermann, 2006b) durchgeführt. Dieser Beobachtungsbogen umfasst insge-
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 94
samt zwölf Kategorien, die sich einerseits auf das Problemverhalten (10 Kategorien) und
andererseits auf das Zielverhalten (2 Kategorien) beziehen. Der Ausprägungsgrad der ein-
zelnen Verhaltensweisen wird auf einer fünfstufigen Skala (von 1 = „tritt nie auf“ bis 5 =
„tritt sehr häufig auf“) eingeschätzt. In allen Untersuchungen beurteilten Eltern und/oder
Experten das Verhalten der Kinder wiederholt anhand von vier bis sechs relevanten, indi-
viduell ausgewählten Kategorien dieses Beobachtungsbogens (Problem- und Zielverhalten).
Eltern- und Expertenurteile beziehen sich dabei häufig auf unterschiedliche Erfahrungs-
bereiche mit den Kindern: das Urteil der Eltern auf den häuslichen Kontext, das Urteil der
Experten auf den therapeutischen Kontext.
Um die statistische Prüfung der Trainingseffekte im Einzelfall zu ermöglichen, müssen
mindestens 15 Messungen pro Phase vorliegen (vgl. Petermann & Petermann, 2006b). Bei
einem dreiphasigen Versuchsplan (hier: B - A - C) wurden also insgesamt mindestens 45
Messungen pro Einzelfall vorgenommen. Zu diesem Zweck nahmen die Eltern in der
Regel täglich eine Einschätzung des kindlichen Verhaltens anhand ausgewählter Kategorien
des BSU vor. Um die Expertenurteile zu gewinnen, wurden alle Trainingssitzungen mit den
Kindern auf Video aufgezeichnet und jede Trainingssitzung in (mindestens) drei gleich-
lange Sequenzen unterteilt. Für jede Sequenz gaben die Experten anhand ausgewählter
Kategorien des BSU ein Urteil zum Verhalten der Kinder ab. Durch diese Art der Daten-
erhebung lag schließlich eine ausreichende Anzahl von Messungen für jeden Einzelfall vor.
Die statistische Auswertung der gewonnenen Daten erfolgte entweder mit Hilfe der Zeit-
reihenanalyse (sog. ARIMA-Modell; vgl. Revenstorf & Keeser, 1996) oder mit Hilfe eines
multivariaten Kreuzklassifikationsverfahrens (sog. „DEL-Analyse“; vgl. Hildebrand, Laing
& Rosenthal, 1977). Diese quantitativen Beobachtungsdaten wurden durch qualitative
Informationen aus der trainingsbegleitenden Eltern- bzw. Familienberatung ergänzt. Durch
die qualitativen Informationen über den Alltag des Kindes und seiner Familie (in erster
Linie positive und negative Ereignisse in Familie, Schule und Freizeit) ließen sich die
gemessenen quantitativen Veränderungen leichter interpretieren.
In einer weiterführenden Interventionsstudie wurde die Wirksamkeit des „Trainings mit
sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) erstmals im Gruppen-
vergleich untersucht (Specht, 2000). Anhand einer Stichprobe von 20 Kindern mit einer
Angststörung (nach DSM-IV) wurde überprüft, ob die Anwendung des Trainings-
programms im ambulanten und stationären Bereich zu vergleichbaren Ergebnissen führt.
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 95
Dazu wurden 10 „Familienkinder“, die in ihren Herkunftsfamilien lebten (= ambulante
Behandlung), und 10 „Heimkinder“, die seit mehr als sechs Monaten in einer Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Kontakt zur Herkunftsfamilie) lebten (= stationäre
Behandlung), miteinander verglichen. Zur Indikationsstellung wurden das „Diagnostische
Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter“ (Kinder-DIPS;
Unnewehr, Schneider & Margraf, 1995) und der „Beobachtungsbogen für sozial unsichere
Kinder“ (BSU; Petermann & Petermann, 2006b) eingesetzt. Um den Therapieverlauf zu
überprüfen, wurde nach jeder Therapiestunde (jeweils 6 Stunden Einzel- und Gruppen-
training) eine systematische Verhaltensbeobachtung mit dem „Therapieverlaufsbogen für
ängstliche Kinder“ (TAK; Specht, 2000) durchgeführt, der in enger Anlehnung an den
„Beobachtungsbogen für sozial unsichere Kinder“ (BSU) entwickelt wurde. Die Nach-
untersuchungen (Katamnese) nach vier Wochen und nach sechs Monaten erfolgten mit
dem Kinder-DIPS und dem eigens für diese Studie entwickelten störungsspezifischen
„Therapiezielerreichungsbogen für Kinder“ (TZEB-K; Specht, 2000). Alle im Rahmen
dieser Studie erhobenen Daten wurden ausschließlich deskriptiv ausgewertet (nur Häufig-
keitsverteilungen). Auf den Einsatz von statistischen Verfahren zur Überprüfung von
Gruppenunterschieden wurde wegen der geringen Stichprobengröße verzichtet, das heißt
eine gruppenstatistische Auswertung der gewonnenen Daten wurde nicht vorgenommen.
Die bisherigen Befunde zur Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“
lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. auch Petermann & Petermann, 2010, S. 269 f.):
(1) Kurz- und langfristige Trainingseffekte: Die Effekte des Trainings wurden in allen Unter-
suchungen unmittelbar nach Trainingsende (kurzfristig) und acht Wochen nach Trainings-
ende (längerfristig) überprüft. Nach Einschätzung der Eltern und/oder Experten führte
das Training kurz- und längerfristig zu einer deutlichen Verringerung der ängstlichen
Symptomatik (vgl. Petermann, 1984; Petermann & Röttgen, 1986; Petermann & Sauerborn,
1989; Petermann & Senftleben, 1990; Petermann & Walter, 1989; Burk & Wittchen, 1991;
Specht, 2000). In einigen Untersuchungen wurden die Trainingseffekte nach sechs Mona-
ten (Specht, 2000) bzw. nach zwei Jahren (Petermann & Walter, 1989) erneut kontrolliert.
Dabei erwiesen sich die Trainingseffekte sowohl im Eltern- als auch im Expertenurteil als
langfristig stabil (vgl. Specht, 2000; Petermann & Walter, 1989).
(2) Effekte bei körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern: In einer Studie von Petermann und
Senftleben (1990) konnte die kurz- und längerfristige Wirksamkeit einer Trainings-
3 Training mit sozial unsicheren Kindern 96
modifikation auch bei sozial unsicheren und ängstlichen Kindern nachgewiesen werden, die
zusätzlich eine mittel- oder hochgradige Seh- und Lernbehinderung aufwiesen.
(3) Effekte bei sozial beeinträchtigten Kindern: Das Training stellte seine kurz- und längerfristige
Wirksamkeit auch in einer Untersuchung von Burk und Wittchen (1991; Burk, 1993) unter
Beweis. Die Autoren konnten zeigen, dass eine zielgruppenspezifische Modifikation des
Trainings (v. a. ohne intensive Elternberatung) bei sozial unsicheren, stark vernachlässigten
Kindern in einer teilstationären Einrichtung erfolgreich anwendbar ist.
(4) Effekte bei mehrfach beeinträchtigten Kindern: Petermann und Walter (1989) wiesen die kurz-
und langfristige Wirksamkeit des Trainings bei sozial unsicheren und ängstlichen Kindern
mit verschiedenen zusätzlichen Problemen (u. a. Unkonzentriertheit, Unruhe, Schul-
leistungsprobleme, Tics, Kopfschmerzen, Aggressivität, Einnässen) nach. In ihrer Studie
führte das Training nicht nur zu einer Verringerung der ängstlichen Symptomatik, sondern
ermöglichte auch eine erfolgreiche Bewältigung der zusätzlichen Beeinträchtigungen.
(5) Effekte der einzelnen Trainingsbausteine: Mit dem Einzeltraining wurden kurzfristige Effekte
erzielt; erst das Gruppentraining führte zu langfristigen, stabilen Effekten (vgl. Petermann,
1984; Petermann & Röttgen, 1986). Die Wirksamkeit beider Trainingsbausteine wurde
durch die begleitend stattfindende Eltern- bzw. Familienberatung gestützt.
3 Tr
ainin
g m
it so
zial
unsic
here
n K
inde
rn
97
Tabe
lle 1
5: U
nter
such
unge
n zu
r Wirk
sam
keit
des „
Train
ings
mit
sozi
al un
siche
ren
Kin
dern
“ (P
eter
man
n &
Pet
erm
ann,
200
6b)
Au
tore
n
Des
ign
St
ich
pro
be
Au
ffäl
ligke
iten
In
terv
enti
on
Dat
enge
win
nu
ng
E
rgeb
nis
se
Pete
rman
n (1
984)
E
inze
lfallb
ezog
ene
Unt
ersu
chun
g A
usbl
endu
ngsd
esig
n (V
ersu
chsp
lan B
- A
- C)
Fo
llow
up:
8 W
oche
n
N =
2 K
inde
r M
ädch
en, 7
;10
Jahr
e Ju
nge,
10;5
Jahr
e
Uns
iche
rhei
t, Ä
ngst
lichk
eit
TSU
K
Ein
zeltr
ainin
g +
Gru
ppen
train
ing
+
Elte
rnbe
ratu
ng +
Le
hrer
kont
akte
D
auer
: 3-4
Mon
ate
(1 S
itzun
g/W
oche
)
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
E
xper
ten-
und
Elte
rn-
urte
ile
gerin
ge E
ffek
te d
es
Ein
zeltr
ainin
gs
größ
ere
Eff
ekte
des
G
rupp
entra
inin
gs
verz
öger
te, a
ber l
änge
r-fr
istig
stab
ile E
ffekt
e de
s G
esam
ttrain
ings
Pete
rman
n &
Rö
ttgen
(198
6)
Ein
zelfa
llbez
ogen
e
Unt
ersu
chun
g A
usbl
endu
ngsd
esig
n (V
ersu
chsp
lan B
- A
- C)
Fo
llow
up:
8 W
oche
n
N =
6 K
inde
r M
ädch
en u
nd Ju
ngen
im
Alte
r zw
ische
n
9;8
und
12;3
Jahr
en
Uns
iche
rhei
t, Ä
ngst
lichk
eit
TSU
K
Ein
zeltr
ainin
g +
Gru
ppen
train
ing
+
Elte
rnbe
ratu
ng
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
E
xper
tenu
rteile
kurz
frist
ige
Erf
olge
des
E
inze
ltrain
ings
(ges
tütz
t du
rch
Elte
rnbe
ratu
ng)
nach
halti
ge E
ffek
te d
es
Gru
ppen
train
ings
län
gerf
ristig
stab
ile
Effe
kte
des G
esam
t-tra
inin
gs
Pete
rman
n &
Sa
uerb
orn
(198
9)
Ein
zelfa
llbez
ogen
e
Unt
ersu
chun
g 3
Beob
acht
ungs
phas
en
(jew
eils
14 T
age/
Kin
d):
-vo
r dem
Tra
inin
g -
nach
dem
Tra
inin
g -
acht
Woc
hen
nach
de
m T
rain
ing
N =
5 K
inde
r K
inde
r im
Alte
r von
4
bis 6
Jahr
en
Uns
iche
rhei
t, Ä
ngst
lichk
eit
TSU
K-M
odifi
katio
n fü
r das
Vor
schu
lalte
r E
inze
ltrain
ing
+
Gru
ppen
train
ing
+
Elte
rnbe
ratu
ng
Dau
er: 4
Mon
ate
(2 S
itzun
gen/
Woc
he)
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
alle
kind
spez
ifisc
hen
Hyp
othe
sen
best
ätig
t ku
rzfr
istig
e E
ffek
te d
es
Ges
amttr
ainin
gs
teilw
eise
läng
erfr
istig
st
abile
Eff
ekte
des
G
esam
ttrain
ings
Pete
rman
n &
Se
nftle
ben
(199
0)
Ein
zelfa
llbez
ogen
e U
nter
such
ung
(Ver
such
splan
B -
C - A
) Fo
llow
up:
8 W
oche
n
N =
4 K
inde
r M
ädch
en u
nd Ju
ngen
im
Gru
ndsc
hulal
ter
sozi
al un
siche
re,
meh
rfac
h be
ein-
träch
tigte
Kin
der
Uns
iche
rhei
t, Ä
ngst
lichk
eit
Seh-
und
Ler
n-be
hind
erun
g
TSU
K-M
odifi
katio
n E
inze
ltrain
ing
+
Gru
ppen
train
ing
+
Elte
rnbe
ratu
ng
Dau
er: 3
Mon
ate
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
E
xper
tenu
rteile
viel
e ki
ndsp
ezifi
sche
H
ypot
hese
n be
stät
igt
kurz
frist
ige
Eff
ekte
des
G
esam
ttrain
ings
te
ilwei
se lä
nger
frist
ig
stab
ile E
ffek
te d
es
Ges
amttr
ainin
gs
3 Tr
ainin
g m
it so
zial
unsic
here
n K
inde
rn
98
Au
tore
n
Des
ign
St
ich
pro
be
Au
ffäl
ligke
iten
In
terv
enti
on
Dat
enge
win
nu
ng
E
rgeb
nis
se
ziel
grup
pens
pezi
fisch
e Tr
ainin
gsm
odifi
katio
n er
folg
reic
h an
wen
dbar
Pe
term
ann
&
Walt
er (1
989)
E
inze
lfallb
ezog
ene
U
nter
such
ung
Aus
blen
dung
sdes
ign
(Ver
such
splan
B -
A -
C)
Follo
w u
p: 8
Woc
hen
+
2 Ja
hre
N =
3 K
inde
r Ju
ngen
im A
lter v
on
10 Ja
hren
so
zial
unsic
here
, m
ehrf
ach
beei
n-trä
chtig
te K
inde
r
Äng
ste
Schu
lleist
ungs
-pr
oble
me
Kon
zent
ratio
ns-
man
gel
Unr
uhe
Ein
näss
en
TSU
K-M
odifi
katio
n E
inze
ltrain
ing
+
Gru
ppen
train
ing
+
Elte
rnbe
ratu
ng +
Le
hrer
kont
akte
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
E
xper
ten-
und
E
ltern
urte
ile
kurz
frist
ige
Eff
ekte
des
G
esam
ttrain
ings
lan
gfris
tig st
abile
Eff
ekte
de
s Ges
amttr
ainin
gs
erfo
lgre
iche
Bew
ältig
ung
der w
eite
ren
Beei
nträ
ch-
tigun
gen
Burk
& W
ittch
en
(199
1);
Burk
(199
3)
Ein
zelfa
llbez
ogen
e U
nter
such
ung
Aus
blen
dung
sdes
ign
(Ver
such
splan
A
- B
- A -
C)
Follo
w u
p: 8
Woc
hen
N =
3 K
inde
r 1
Mäd
chen
, 9;8
Jahr
e 1
Jung
e, 11
;6 Ja
hre
1 Ju
nge,
11;1
0 Ja
hre
sozi
al un
siche
re,
star
k ve
rnac
hläs
sigte
K
inde
r ein
er T
ages
-he
imgr
uppe
(tei
lstat
i-on
är)
Äng
ste
Ein
näss
en
Schl
afst
örun
gen
Schm
erze
n A
ggre
ssiv
ität
Del
inqu
enz
TSU
K-M
odifi
katio
n E
inze
ltrain
ing
+
Gru
ppen
train
ing
+
Ein
bezu
g vo
n E
ltern
, E
rzie
hern
und
Leh
-re
rn (a
ber k
eine
E
ltern
bera
tung
) D
auer
: 8 M
onat
e
Syst
emat
ische
Ver
hal-
tens
beob
acht
ung
mit
Hilf
e de
s BSU
Z
iele
rrei
chun
gssk
ala
Exp
erte
n- u
nd
Erz
iehe
rurte
ile
Ver
bess
erun
gen
durc
h be
ide
Train
ings
baus
tein
e ku
rzfr
istig
e E
ffek
te d
es
Ges
amttr
ainin
gs
länge
rfris
tig st
abile
E
ffek
te d
es G
esam
t-tra
inin
gs
ziel
grup
pens
pezi
fisch
e Tr
ainin
gsm
odifi
katio
n er
folg
reic
h an
wen
dbar
Sp
echt
(200
0)
Inte
rven
tions
stud
ie
(Ver
such
splan
A -
B - C
) Fo
llow
up:
4 W
oche
n +
6 M
onat
e 2
Beha
ndlu
ngsg
rupp
en:
-Fa
mili
e (a
mbu
lant)
-Ju
gend
hilfe
einr
icht
ung
(Hei
m) (
stat
ionä
r)
N =
20
Kin
der
n =
10
(Fam
ilie)
+
n =
10
(Heim
) K
inde
r im
Alte
r von
9
bis 1
3 Ja
hren
Ang
stst
örun
g (n
ach
DSM
-IV
) -
6 x
309.
21
-9
x 30
0.23
-
5 x
300.
02
TSU
K-M
odifi
katio
n E
inze
ltrain
ing
+
Gru
ppen
train
ing
Dau
er: 3
-4 M
onat
e (1
Sitz
ung/
Woc
he)
Indi
katio
nsst
ellu
ng m
it K
inde
r-D
IPS
und
BSU
Th
erap
ieve
rlauf
sana
lyse
m
it H
ilfe
des T
AK
(a
ngel
ehnt
an
den
BSU
) K
atam
nese
mit
Kin
der-
DIP
S un
d TZ
EB-
K
Exp
erte
n un
d E
ltern
- bz
w. E
rzie
heru
rteile
kurz
frist
ige
Eff
ekte
des
G
esam
ttrain
ings
lan
gfris
tig st
abile
Eff
ekte
de
s Ges
amttr
ainin
gs
gerin
gfüg
ig b
esse
re
Eff
ekte
für d
ie F
amili
en-
kind
er
stör
ungs
spez
ifisc
he
Eff
ekte
: TA
> S
P >
GA
Anm
erku
ngen
: Pha
sen
der
einze
lfallb
ezog
enen
Ver
such
splän
e: A
= B
aseli
ne-P
hase
, d. h
. es
erfo
lgt k
eine
Beha
ndlu
ng (h
ier: K
enne
nler
npha
se);
B =
Beh
andl
ungs
phas
e (h
ier: E
inze
ltrain
ing)
; C =
Beh
andl
ungs
phas
e (h
ier: G
rupp
entra
inin
g); T
SUK
= T
rain
ing
mit
sozi
al un
siche
ren
Kin
dern
; BSU
= B
eoba
chtu
ngsb
ogen
für s
ozial
uns
icher
es V
erha
lten;
Kin
der-D
IPS
= D
iagno
stisc
hes I
nter
view
bei
psyc
hisc
hen
Stör
unge
n im
Kin
des-
und
Juge
ndalt
er; T
AK
= T
hera
piev
erlau
fsbo
gen
für ä
ngst
liche
Kin
der;
TZE
B-K
= T
hera
piez
ieler
reich
ungs
boge
n fü
r Kin
der;
TA =
Tre
nnun
gsan
gst;
SP =
Soz
iale
Phob
ie; G
A =
Gen
erali
sierte
Ang
st.
4 Fragestellung 99
4 Fragestellung
Die internationale Forschung zeigt eindrucksvoll, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische
Interventionen für die Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter erfolg-
reich eingesetzt werden können (z. B. Brendel, 2011; Cartwright-Hatton, Robert,
Chitsabesan, Fothergill & Harrington, 2004; In-Albon & Schneider, 2007; Ishikawa et al.,
2007; Silverman et al., 2008). Bisher wurden vor allem kognitiv-verhaltenstherapeutische
Therapieprogramme empirisch überprüft. Für diese Therapieprogramme konnte gezeigt
werden, dass sie unabhängig von der Art des Therapiesettings (Einzel- oder Gruppen-
therapie, Kind- oder Familienzentrierte Therapie) kurz- und langfristig wirksam sind
(In-Albon & Schneider, 2007; Silverman et al., 2008).
Das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) ist ein
kognitiv-verhaltenstherapeutisches Trainingsprogramm, das für die Behandlung von Kin-
dern mit Angststörungen entwickelt wurde. Die kurz- und langfristige Wirksamkeit dieses
Trainings wurde bereits in verschiedenen Einzelfallstudien (z. B. Petermann, 1984; Peter-
mann & Röttgen, 1986; Petermann & Sauerborn, 1989; Petermann & Senftleben, 1990;
Petermann & Walter, 1989) und einer weiteren Interventionsstudie (Specht, 2000) bestätigt.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die randomisierten Kontrollgruppenstudien
(Randomized Controlled Trials, RCTs) in der Psychotherapieforschung als „Goldstandard“
für die Überprüfung klinisch-psychologischer Interventionen etabliert (vgl. APA
Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006; Chambless & Ollendick, 2001).
Obwohl das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ bereits seit vielen Jahren in der
klinischen Praxis erfolgreich eingesetzt wird, steht eine Überprüfung seiner Wirksamkeit
mit einer solchen Kontrollgruppenstudie noch aus.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deshalb darin, die Wirksamkeit des „Trainings mit
sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) mit einer Kontrollgruppen-
studie zu überprüfen. Es wird angenommen, dass sich durch die Teilnahme der Kinder am
Training die sozialen Ängste verringern und die sozialen Fertigkeiten verbessern. Mit Hilfe
dieser Studie sollen Aussagen zur kurzfristigen, langfristigen und differentiellen Wirksam-
keit des Trainings getroffen werden. Um sicherstellen zu können, dass die erzielten Erfolge
auf das Training (und nicht auf andere Faktoren wie z. B. Entwicklung, Spontanremission)
4 Fragestellung 100
zurückgeführt werden können, werden eine Interventionsgruppe und eine Wartekontroll-
gruppe miteinander verglichen. Die Kinder der Wartekontrollgruppe unterscheiden sich
hinsichtlich wesentlicher Merkmale nicht von der Interventionsgruppe und erhalten das
Training erst zu einem späteren Zeitpunkt (nach etwa sechs Monaten Wartezeit). Um mög-
lichst zuverlässige Aussagen zur Wirksamkeit des Trainings machen zu können, wurden
neben den Angaben der Kinder (Selbsteinschätzung) auch die Auskünfte der Eltern und
Lehrer (Fremdeinschätzung) herangezogen.
Fragen
In der vorliegenden Arbeit gilt es somit folgende Fragen zu klären:
1. Ist das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ kurzfristig wirksam? Werden mit dem Training
kurzfristige Effekte auf die ängstliche Symptomatik, auf die gegebenenfalls vorhandene komorbide
depressive Symptomatik und auf das schulbezogene Sozialverhalten von 7- bis 12-jährigen ängstlichen
Kindern erzielt?
2. Ist das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ langfristig wirksam? Bleiben die durch das Training
erzielten Effekte auf die ängstliche Symptomatik, auf die gegebenenfalls vorhandene komorbide
depressive Symptomatik und auf das schulbezogene Sozialverhalten von 7- bis 12-jährigen ängstlichen
Kindern über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil?
3. Welchen Einfluss haben soziodemografische (z. B. Geschlecht, Alter, Intelligenz) und diagnostische
Merkmale (z. B. Depressivität) auf die Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“
bei 7- bis 12-jährigen ängstlichen Kindern?
4. Wie gut stimmen Kinder, Eltern und Lehrer bei der Beurteilung der Angstsymptomatik überein?
Hypothesen
Ausgehend von den in Abschnitt 2.4 vorgenommenen Ausführungen zur Wirksamkeit
kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden bei Angststörungen im Kindes-
und Jugendalter werden folgende Haupthypothesen formuliert:
4 Fragestellung 101
Hypothesen zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings
Hypothese 1a: Im Selbst- (Kinder) und Fremdurteil (Eltern, Lehrer) weisen die Kinder der Inter-
ventionsgruppe unmittelbar nach dem Training eine stärkere Reduktion der Angstsymptomatik auf als die
Kinder der Wartekontrollgruppe.
Hypothese 1b: Im Fremdurteil (Eltern) weisen die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training eine stärkere Reduktion der gegebenenfalls vorhandenen komorbiden depressiven Symptomatik auf
als die Kinder der Wartekontrollgruppe.
Hypothese 1c: Im Fremdurteil (Lehrer) zeigen die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training eine stärkere Verbesserung des schulbezogenen Sozialverhaltens als die Kinder der Wartekontroll-
gruppe, d. h. in der Interventionsgruppe zeigt sich eine stärkere Zunahme der Werte auf den Skalen
„Kooperation“, „Selbstwahrnehmung“, „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“, „Angemessene
Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ und eine stärkere Abnahme der Werte auf der Skala „Selbst-
kontrolle“ als in der Wartekontrollgruppe.
Hypothesen zur langfristigen Wirksamkeit des Trainings
Hypothese 2a: Im Selbst- (Kinder) und Fremdurteil (Eltern, Lehrer) bleibt die durch das Training
erzielte Reduktion der Angstsymptomatik über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil, d. h. die Angst-
symptomatik der Kinder verändert sich in den sechs Monaten nach dem Training nicht.
Hypothese 2b: Im Fremdurteil (Eltern) bleibt die durch das Training erzielte Reduktion der gegebenen-
falls vorhandenen komorbiden depressiven Symptomatik über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil,
d. h. die komorbide depressive Symptomatik der Kinder verändert sich in den sechs Monaten nach dem
Training nicht.
Hypothese 2c: Im Fremdurteil (Lehrer) bleibt die durch das Training erzielte Verbesserung des schul-
bezogenen Sozialverhaltens über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil, d. h. das schulbezogene Sozial-
verhalten der Kinder verändert sich in den sechs Monaten nach dem Training nicht.
Ausgehend von den Ausführungen zur Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer
Behandlungsmethoden bei Angststörungen im Kindes- und Jugendalter (Abschnitt 2.4)
und zur Beurteilerübereinstimmung bei psychischen Auffälligkeiten (Abschnitt 2.3.) werden
folgende Nebenhypothesen formuliert:
4 Fragestellung 102
Hypothesen zur differentiellen Wirksamkeit des Trainings
Hypothese 3a: Das Geschlecht der Kinder hat keinen Einfluss auf die Reduktion der Angstsymptoma-
tik, d. h. Mädchen und Jungen unterscheiden sich hinsichtlich der Reduktion der Angstsymptomatik nicht.
Hypothese 3b: Das Alter der Kinder hat keinen Einfluss auf die Reduktion der Angstsymptomatik,
d. h. jüngere und ältere Kinder unterscheiden sich hinsichtlich der Reduktion der Angstsymptomatik nicht.
Hypothese 3c: Die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder hat keinen Einfluss auf die Reduktion
der Angstsymptomatik, d. h. Kinder mit niedrigerer und höherer intellektueller Leistungsfähigkeit unter-
scheiden sich hinsichtlich der Reduktion der Angstsymptomatik nicht.
Hypothese 3d: Die depressive Symptomatik der Kinder hat einen ungünstigen Einfluss auf die Reduk-
tion der Angstsymptomatik, d. h. Kinder mit stärkerer depressiver Symptomatik weisen eine geringere
Reduktion der Angstsymptomatik auf als Kinder mit schwächerer depressiver Symptomatik.
Hypothesen zur Beurteilerübereinstimmung
Hypothese 4a: Kinder und Eltern unterscheiden sich in der Beurteilung der Angstsymptomatik des
Kindes, d. h. die Übereinstimmung zwischen Kinder- und Elternurteil ist gering.
Hypothese 4b: Kinder und Lehrer unterscheiden sich in der Beurteilung der Angstsymptomatik des
Kindes, d. h. die Übereinstimmung zwischen Kinder- und Lehrerurteil ist gering.
Hypothese 4c: Eltern und Lehrer unterscheiden sich in der Beurteilung der Angstsymptomatik des
Kindes, d. h. die Übereinstimmung zwischen Eltern- und Lehrerurteil ist gering.
5 Methoden 103
5 Methoden
5.1 Studiendesign
Die vorliegende Arbeit überprüft die Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren
Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b). Für diese Wirksamkeitsüberprüfung wird ein
Wartekontrollgruppendesign mit drei bzw. vier Messzeitpunkten verwirklicht. Eine Über-
sicht über das gewählte Studiendesign kann Tabelle 16 entnommen werden. Die Zuord-
nung der Kinder zur Interventions- bzw. Wartekontrollgruppe erfolgt zufällig. Wenn eine
zufällige Zuteilung der Kinder nicht möglich sein sollte, wird eine Parallelisierung der zu
vergleichenden Gruppen nach Alter und Geschlecht vorgenommen. Die an der Studie teil-
nehmenden Kinder werden vor dem Training (Prätest), unmittelbar nach dem Training
(Posttest) und sechs Monate nach dem Training (Follow up) untersucht.
Tabelle 16: Studiendesign
Gruppe Messzeitpunkte
Indikations-
stellung Effekt-kontrolle Effekt-
kontrolle Effekt-kontrolle
t1 t2 t3 t4
IG
(n = 14) X Intervention X X
Prätest Posttest Follow up
KG
(n = 11) X Wartezeit X Intervention X X
Prätest 1 Prätest 2 Posttest Follow up
Anmerkungen: IG = Interventionsgruppe; KG = Wartekontrollgruppe; X = Diagnostische Untersuchung.
Zum ersten Messzeitpunkt (t1) findet sowohl für die Interventionsgruppe als auch für die
Wartekontrollgruppe die Erhebung der Ausgangsdaten statt (Indikationsstellung, IG: Prä-
test, KG: Prätest 1). Anschließend wird das „Training mit sozial unsicheren Kindern“
(= Intervention) mit einer Dauer von etwa fünf Monaten für die Interventionsgruppe
durchgeführt; die Wartekontrollgruppe durchläuft währenddessen eine Wartezeit von der-
selben Dauer. Unmittelbar nach dem Training findet für beide Gruppen ein zweiter Unter-
suchungstermin (t2) statt, der für die Interventionsgruppe eine Nacherhebung (Effekt-
5 Methoden 104
kontrolle, Posttest) und für die Wartekontrollgruppe eine Aktualisierung der Ausgangs-
daten darstellt (Indikationsstellung, Prätest 2). Danach wird das Training mit der Warte-
kontrollgruppe durchgeführt; auch dieses Training wird nach etwa fünf Monaten mit einer
Nacherhebung (Effektkontrolle, Posttest) abgeschlossen. Jeweils sechs Monate nach dem
Ende des Trainings erfolgt für beide Gruppen eine abschließende Datenerhebung (Effekt-
kontrolle, Follow up). Insgesamt werden zu drei (Interventionsgruppe) bzw. vier Messzeit-
punkten (Wartekontrollgruppe) mittels verschiedener Selbst- und Fremdbeurteilungsbogen
Daten erhoben. Für die Wirksamkeitsüberprüfung anhand eines Wartekontrollgruppen-
designs können nur die zum ersten und zweiten Messzeitpunkt gewonnenen Daten der
Wartekontrollgruppe berücksichtigt werden, weil die Wartekontrollgruppe das Training
anschließend aus ethischen Gründen ebenfalls erhält und damit zu einer (nur im Anhang
dargestellten) Interventionsgruppe wird.
Mit Hilfe des gewählten Studiendesigns kann überprüft werden, welche zwischen dem
ersten und zweiten Messzeitpunkt auftretenden Veränderungen in den beiden Gruppen auf
das Training zurückzuführen sind. Dazu werden die während des Trainings in der Inter-
ventionsgruppe beobachteten Veränderungen und die während der Wartezeit in der Warte-
kontrollgruppe beobachteten Veränderungen miteinander verglichen. Dieses Vorgehen
erlaubt es, zuverlässige Aussagen über die kurzfristige Wirksamkeit des Trainings zu tref-
fen. Darüber hinaus können über die Messzeitpunkte hinweg auftretende Veränderungen
sowohl innerhalb der Interventionsgruppe als auch innerhalb der Wartekontrollgruppe
untersucht werden. Dabei erlauben es die nach dem Training erhobenen Daten (Posttest,
Follow up), Aussagen über die kurzfristige und langfristige Wirksamkeit des Trainings zu
treffen. Weiterhin kann festgestellt werden, ob verschiedene demografische und klinische
Merkmale die Wirksamkeit des Trainings beeinflussen und wie hoch die Übereinstimmung
zwischen Kindern, Eltern und Lehrern bei Beurteilung der Angstsymptomatik ausfällt.
Als unabhängige Variablen werden die Gruppenzugehörigkeit und der Messzeitpunkt erfasst.
Die Variable Gruppenzugehörigkeit hat die zwei Ausprägungen Interventionsgruppe und
Wartekontrollgruppe. Die Variable Messzeitpunkt ist dreifach gestuft (Prätest, Posttest,
Follow up). Als abhängige Variablen werden die ängstliche Symptomatik des Kindes, die
gegebenenfalls vorhandene komorbide depressive Symptomatik des Kindes und das schul-
bezogene Sozialverhalten des Kindes gewählt. Die Angstsymptomatik des Kindes wird als
Selbsturteil der Kinder über die Rohwerte der Social Anxiety Scale for Children – Revised
5 Methoden 105
– Deutsche Version (SASC-R-D; Melfsen, 1998) und als Fremdurteil der Eltern und Lehrer
über die Rohwerte des Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) aus dem
Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und
DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) erfasst. Die komorbide depressive Symp-
tomatik des Kindes wird als Fremdurteil der Eltern über die Rohwerte des Fremdbeurtei-
lungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) aus dem Diagnostik-System für psychische
Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner
& Lehmkuhl, 2000) erhoben. Das in der Schule gezeigte Sozialverhalten des Kindes wird als
Fremdurteil der Lehrer über die Rohwerte der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lern-
verhalten (LSL; Petermann & Petermann, 2006a) erfasst.
Als Kontrollvariablen werden das Geschlecht, das Alter, die Intelligenz und die komorbide
depressive Symptomatik der Kinder herangezogen. Die nominalskalierte Variable Geschlecht
der Kinder ist zweifach gestuft (Mädchen vs. Junge). Die verbleibenden, intervallskalierten
Variablen werden mittels Mediandichotomisierung (zum ersten Messzeitpunkt) in binäre
Merkmale überführt. Hinsichtlich des Alters der Kinder wird zwischen jüngeren und älteren
Kindern unterschieden. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder wird bei Kindern bis 8;4
Jahren mit dem Grundintelligenztest – Skala 1 (CFT 1; Weiß & Osterland, 1997) und bei
Kindern ab 8;5 Jahren mit dem Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R; Weiß,
2006) ermittelt. Durch die Mediandichotomisierung wird die Unterscheidung zwischen
Kindern mit niedrigerer und höherer Intelligenz ermöglicht. Die komorbide depressive
Symptomatik der Kinder wird als Elternurteil mit dem Fremdbeurteilungsbogen Depressive
Störungen (FBB-DES) aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes-
und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000)
erhoben. Die Kinder unterscheiden sich dabei im Ausmaß ihrer komorbiden depressiven
Symptomatik (schwächere Depressivität vs. stärkere Depressivität).
Die eingesetzten Erhebungsinstrumente werden in Tabelle 17 überblicksartig aufgeführt
und im Kapitel 5.3 ausführlich beschrieben.
5 Methoden 106
Tabelle 17: Studiendesign mit allen Erhebungsinstrumenten
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
1. MZP Indikationsstellung Beurteiler Erhebungsinstrument Beurteiler Erhebungsinstrument
Screening Eltern CBCL/4-18 Eltern CBCL/4-18
Anamnese Eltern Anamnesefragebogen Eltern Anamnesefragebogen
Klinische Exploration
Eltern Diagnose-Checklisten Eltern Diagnose-Checklisten
Explorationsfragebogen Explorationsfragebogen
Standardisierte Fragebogen
Eltern DISYPS-KJ Eltern DISYPS-KJ
Lehrer DISYPS-KJ Lehrer DISYPS-KJ
LSL LSL
Kind SASC-R-D Kind SASC-R-D
Intelligenztest CFT 1 bzw. CFT 20-R CFT 1 bzw. CFT 20-R Intervention TSUK WARTEZEIT 2. MZP Effektkontrolle Eltern DISYPS-KJ Eltern DISYPS-KJ
Lehrer DISYPS-KJ Lehrer DISYPS-KJ
LSL LSL
Kind SASC-R-D Kind SASC-R-D Intervention TSUK 3. MZP Effektkontrolle Eltern DISYPS-KJ Eltern DISYPS-KJ
Lehrer DISYPS-KJ Lehrer DISYPS-KJ
LSL LSL
Kind SASC-R-D Kind SASC-R-D
Eltern Zufriedenheitsfragebogen 4. MZP Effektkontrolle Eltern DISYPS-KJ
Lehrer DISYPS-KJ
LSL
Kind SASC-R-D
Eltern Zufriedenheitsfragebogen
Anmerkungen: CBCL/4-18 = Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen; DISYPS-KJ = Diagnostik-System für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 und DSM-IV: Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG), Fremdbeurteilungsbogen Depressive Störungen (FBB-DES); LSL = Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten; SASC-R-D = Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version; CFT 1 = Grundintelligenztest Skala 1; CFT 20-R = Grundintelli-genztest Skala 2 – Revision; TSUK = Training mit sozial unsicheren Kindern.
5 Methoden 107
5.2 Untersuchungsablauf
Rekrutierung und Eingangsuntersuchungen
Die Stichprobe wurde in der Zeit von Februar 2007 bis Juli 2008 durch Aushänge bzw.
Flyer in vielen Schulen sowie in verschiedenen Einrichtungen des Sozial- und Gesund-
heitswesens in Bremen und Umgebung rekrutiert. Zu diesen Einrichtungen gehörten die
psychosozialen Einrichtungen des Amtes für Soziale Dienste in Bremen (Erziehungs-
beratungsstellen, Häuser der Familie), die Psychologische Kinderambulanz der Universität
Bremen, die Psychotherapeutische Ambulanz der Universität Bremen, die Kinderklinik in
Delmenhorst und die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bremen.
Im Rahmen eines telefonischen Erstkontakts mit den Kindeseltern, in der Regel mit der
Kindesmutter, wurden die Ängste des angemeldeten Kindes erfragt. Ergaben sich aus dem
telefonischen Kontakt mit den Kindeseltern erste Hinweise auf eine soziale Angststörung,
wurden die Eltern zu einem Erstgespräch ins Zentrum für Klinische Psychologie und
Rehabilitation der Universität Bremen eingeladen. Zusammen mit der schriftlichen Bestäti-
gung des vereinbarten Termins wurde den Kindeseltern der Anamnesefragebogen und der
Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen zugeschickt. Die Kin-
deseltern wurden gebeten, beide Fragebogen vor dem Erstgespräch ausgefüllt ans Zentrum
für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen zurückzusenden.
In einem 100-minütigen Erstgespräch erhielten die Kindeseltern zunächst Informationen
über die diagnostische Untersuchung und die psychologische Behandlung ihres Kindes im
Rahmen des Forschungsprojekts zum „Training mit sozial unsicheren Kindern“ (Peter-
mann & Petermann, 2006b). Anschließend wurde eine ausführliche klinische Exploration
der Kindeseltern durchgeführt. In einem freien Gespräch wurden die aktuellen Vorstel-
lungsgründe, die derzeitige Situation des Kindes in Familie, Schule und Freizeit, die bishe-
rigen Behandlungsversuche und die an die Trainingsteilnahme geknüpften Erwartungen der
Kindeseltern erfragt. Im Anschluss an das Erstgespräch wurden die Kindeseltern gebeten,
die vier Diagnose-Checklisten aus dem „Training mit sozial unsicheren Kindern“ und die
zwei Fremdbeurteilungsbogen (FBB-ANG, FBB-DES) aus dem Diagnostik-System für
psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (DISYPS-KJ) auszufüllen.
5 Methoden 108
Ergaben sich aus dem ersten Gespräch mit den Kindeseltern deutliche Hinweise auf eine
behandlungsbedürftige Angststörung, wurde ein 50-minütiger, gemeinsamer Termin für
Eltern und Kind vereinbart. Nach der spielerischen Kontaktaufnahme wurde das Kind
mittels direkter Befragung zunächst im Beisein seiner Eltern, später allein exploriert. Gegen
Ende des Termins wurden das Kind gebeten, die deutschsprachige Version der Social
Anxiety Scale for Children – Revised (SASC-R-D) auszufüllen, wobei den jüngeren Kin-
dern der Fragebogen laut vorgelesen wurde. Ein weiterer, 50-minütiger Termin mit dem
Kind wurde genutzt, um die Intelligenzdiagnostik mit dem Grundintelligenztest – Skala 1
(CFT 1) bzw. mit dem Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R) durchzuführen.
Nach dem Erstgespräch mit den Kindeseltern erhielt auch der Klassen- bzw. Fachlehrer
des Kindes den Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) aus dem Diagnos-
tik-System für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (DISYPS-KJ) sowie die
Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL). Der Klassen- bzw. Fachlehrer
wurde gebeten, die ausgefüllten Fragebogen innerhalb von zwei Wochen an das Zentrum
für Klinische Psychologie und Rehabilitation zurückzusenden. Zusätzlich erfolgte ein tele-
fonischer Kontakt zum Klassen- bzw. Fachlehrer des Kindes, wenn es für diagnostische
Zwecke erforderlich war und von den Kindeseltern gestattet wurde.
Die Integration der diagnostischen Informationen diente letztlich dazu, ein Gesamtbild der
psychischen Auffälligkeiten, der intellektuellen Fähigkeiten und der psychosozialen Bedin-
gungen des Kindes zu erhalten. Die kategoriale Einordnung der psychischen Auffälligkei-
ten wurde – als klinisches Urteil – anhand des Klassifikationssystems ICD-10 vorgenom-
men. Auf dieser Grundlage wurde abschließend in einem zweiten, 100-minütigen Gespräch
mit den Kindeseltern eine Verhaltensanalyse angefertigt. Unter Zuhilfenahme eines stan-
dardisierten Interviewleitfadens, des Elternexplorationsbogens, wurden Hypothesen zur
Entstehung und Aufrechterhaltung der diagnostizierten Störung gebildet.
Einschluss- und Ausschlusskriterien
Um an der vorliegenden Studie teilnehmen zu können, mussten die Kinder die Kriterien
(nach ICD-10) für die Diagnose einer Emotionalen Störung mit Trennungsangst des Kin-
desalters (F93.0), einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2), einer
Sozialen Phobie (F40.1) oder einer Generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80)
erfüllen. Bei der diagnostizierten Angststörung sollte es sich um die primäre Störung der
5 Methoden 109
Kinder handeln; zusätzlich vorliegende psychische Auffälligkeiten oder Störungen im Sinne
einer sekundären Störung führten nicht zum Teilnahmeausschluss. Von der Teilnahme
ausgeschlossen waren Kinder, die eine Intelligenzminderung (IQ unter 70) aufwiesen,
deren Sprachvermögen unzureichend entwickelt war oder die nur über mangelnde (deut-
sche) Sprachkenntnisse verfügten. Zudem durften die Kinder in den sechs Monaten vor
der Studienteilnahme nicht wegen einer Angststörung in Behandlung gewesen sein. Für die
Kinder und deren Eltern bzw. Familien war eine Teilnahme an Training und Studie nur
möglich, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung der Kindeseltern vorlag.
66 Familien nahmen Kontakt zum Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation
der Universität Bremen auf, um ihr Interesse an einer Trainingsteilnahme zu bekunden.
Nach dem telefonischen Erstkontakt mit den Eltern wurden 11 Kinder weiterverwiesen,
weil sich bei diesen Kindern keine Hinweise auf eine Angststörung ergaben. Mit den ver-
bleibenden 55 Kindern wurden die diagnostischen Voruntersuchungen durchgeführt.
27 Kinder wurden anschließend von der Studienteilnahme ausgeschlossen, weil sie keine
behandlungsbedürftige Angststörung aufwiesen und damit die Einschlusskriterien nicht
erfüllten. Weitere zwei, zunächst interessierte Familien sagten die Trainingsteilnahme nach
den diagnostischen Voruntersuchungen wegen Vorbehalten gegenüber der Studie ab. Eine
weitere Familie brach das Training nach etwa drei Monaten wegen terminlicher Schwierig-
keiten ab. Mit knapp 4 % ist die Drop-out-Rate also vergleichsweise gering. Insgesamt
bildeten 25 Kinder die Stichprobe der vorliegenden Studie.
Durchführung des Trainings
Um allen interessierten Familien die Teilnahme am Training zu ermöglichen, wurde das
Training in Wohnortnähe durchgeführt, d. h. in der Psychotherapeutischen Ambulanz der
Universität Bremen, in einer Außenstelle der Psychologischen Kinderambulanz der Univer-
sität Bremen in Bremen-Nord, in einer mit der Psychologischen Kinderambulanz kooperie-
renden Kinderklinik in Delmenhorst und in einer mit der Psychologischen Kinder-
ambulanz kooperierenden Schule in Bremen. Die Durchführung des Trainingsprogramms
erstreckte sich über einen Zeitraum von etwa fünf Monaten, wobei die Trainingssitzungen
in wöchentlichem Abstand stattfanden. Das Training wurde von einer Diplom-Psychologin
mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich Klinischer Kinderpsychologie durchgeführt. Bei
der Trainingsdurchführung wurde die Diplom-Psychologin von acht gründlich geschulten
5 Methoden 110
Psychologiestudierenden unterstützt, die im Rahmen ihres Studiums mit Schwerpunkt
Klinische Psychologie ein Praktikum am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabili-
tation absolvierten. Ein approbierter Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut übernahm
die begleitende Supervision der Trainerinnen und Trainer. Um eine umfassende und quali-
tativ hochwertige Supervision zu ermöglichen, wurden alle Diagnostik- und Trainings-
sitzungen auf Video aufgezeichnet. Die Kinder und ihre Eltern hatten sich vor der Trai-
ningsteilnahme schriftlich damit einverstanden erklärt.
Die Studienteilnehmer wurden fortlaufend rekrutiert und zu insgesamt acht altershomo-
genen Gruppen mit jeweils drei bis vier Kindern zusammengestellt. Der zeitliche Ablauf
der Trainingsdurchführung ist in Tabelle 18 dargestellt. In allen Trainingsgruppen wurde
das Einzeltraining von einem Trainer, das Gruppentraining mit drei bis vier Kindern und
die Beratungsgespräche mit den Eltern von zwei Trainern durchgeführt.
Tabelle 18: Zeitlicher Ablauf der Trainingsdurchführung
Nr. Gruppen-zugehörigkeit
Zusammensetzung des Trainer-Teams
Anzahl der Kinder
Beginn des Trainings
Ende des Trainings
1 Interventionsgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainerin 3 04/2007 07/2007
2 Wartekontrollgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainer 3 10/2007 02/2008
3 Interventionsgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainer 4 03/2008 07/2008
4 Wartekontrollgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainerin 3 09/2008 02/2009
5 Interventionsgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainer 3 03/2008 07/2008
6 Wartekontrollgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainerin 3 09/2008 02/2009
7 Interventionsgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainerin 4 10/2008 02/2009
8 Wartekontrollgruppe 1 Trainerin, 1 Co-Trainerin 3 03/2009 07/2009
Die Teilnahme am Training war für die Familien kostenfrei. Um eine regelmäßige und
zuverlässige Teilnahme der Familien an allen Diagnostik- und Trainingssitzungen zu
gewährleisten, wurde vor Trainingsbeginn eine Kaution in Höhe von 50,- Euro erhoben.
Die Kaution konnte nach Abschluss der Studie an alle Familien zurückgezahlt werden. In
der vorliegenden Studie wurden 6 Sitzungen Einzeltraining und 12 Sitzungen Gruppen-
training mit den Kindern sowie 5 Beratungsgespräche mit den Eltern durchgeführt.
Die Kinder der Interventionsgruppe besuchten durchschnittlich 17.1 von 18 Trainings-
sitzungen (95.0 %). Die Eltern der Interventionsgruppe (4 Mütter, 1 Vater, 9 Elternpaare)
nahmen an allen 5 Beratungsgesprächen teil (100.0 %). Nach einer Wartezeit von sechs
5 Methoden 111
Monaten wurde das Training auch für die Wartekontrollgruppe durchgeführt. Die Kinder
der Wartekontrollgruppe besuchten durchschnittlich 17.6 von 18 Trainingssitzungen
(97.8 %). Die Eltern der Wartekontrollgruppe (4 Mütter, 6 Elternpaare, 1 Mutter mit
Großmutter) nahmen an 4.8 von 5 Beratungsgesprächen teil (98.0 %).
Nachuntersuchungen
Die diagnostischen Untersuchungen mit Kindern, Eltern und Lehrern wurden unmittelbar
nach dem Training und sechs Monate nach dem Training wiederholt. Bei den Nachunter-
suchungen wurden die gleichen standardisierten Fragebogen eingesetzt wie bei der Ein-
gangsuntersuchung (vgl. Tabelle 17); die Kindeseltern erhielten bei der letzten Nachunter-
suchung zusätzlich einen „Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem Training“. Die Familien
bekamen für die diagnostischen Nachuntersuchungen einen Termin am Zentrum für Klini-
sche Psychologie und Rehabilitation; den Lehrern wurden die Fragebogen zugeschickt.
5 Methoden 112
5.3 Erhebungsinstrumente
Screening
Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (4 - 18 Jahre) (Child Behavior
Checklist / 4-18, CBCL/4-18; Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a)
wurde als Screeningverfahren verwendet. Der von Achenbach (1991a) entwickelte Frage-
bogen ist ein Breitbandverfahren, das zur Erfassung von psychosozialen Kompetenzen
und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18
Jahren dient. Die Eltern werden gebeten, das Verhalten ihres Kindes in den letzten sechs
Monaten anhand einer dreistufigen Antwortskala (0 = nicht zutreffend; 1 = manchmal
oder etwas zutreffend; 2 = genau oder häufig zutreffend) einzuschätzen. Für das Ausfüllen
des Fragebogens benötigen die Eltern in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten. Aus den insge-
samt 120 vorgegebenen Items können die folgenden acht Syndromskalen (Primärskalen)
gebildet werden: Sozialer Rückzug (9 Items), Körperliche Beschwerden (9 Items), Ängstlich-
keit/Depressivität (14 Items), Soziale Probleme (8 Items), Schizoid/Zwanghaft (7 Items), Aufmerk-
samkeitsprobleme (11 Items), Dissoziales Verhalten (13 Items) und Aggressives Verhalten (20
Items). Neben der Bildung dieser Syndromskalen können übergeordnete Skalenwerte
(Sekundärskalen) für Internalisierende Auffälligkeiten (31 Items; bestehend aus den Skalen
Sozialer Rückzug, Körperliche Beschwerden und Ängstlichkeit/Depressivität) und Externa-
lisierende Auffälligkeiten (33 Items; bestehend aus den Skalen Dissoziales Verhalten und Ag-
gressives Verhalten) sowie ein Gesamtwert für Problemverhalten (115 Items) ermittelt werden.
Die Auswertung erfolgt für alle Skalen durch ungewichtete Addition der Itemwerte.
Es liegen geschlechtsspezifische Normen für Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren und für
Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren in Form von T-Werten und Prozenträngen vor.
Die Normierung erfolgte 1994 an einer Stichprobe von 2.856 deutschen Kindern und
Jugendlichen. Für die Primärskalen wurde der Cut-off-Wert für klinische Auffälligkeit bei
70 T-Wert-Punkten (Übergangsbereich von unauffälligen zu auffälligen Werten zwischen
67 und 70 T-Wert-Punkten), für die Sekundärskalen bei 63 T-Wert-Punkten (Grenz-
bereich zwischen 60 und 63 T-Wert-Punkten) festgelegt. Alle Primärskalen trennen signifi-
kant zwischen unauffälligen und klinisch auffälligen Kindern und Jugendlichen. Mit dem
Gesamtwert für Problemverhalten (Cut-off-Wert: T 60) können 83.3 % aller Kinder und
Jugendlichen korrekt klassifiziert werden (Schmeck et al., 2001). Die internen Konsistenzen
5 Methoden 113
(Cronbachs Alpha) der drei Sekundärskalen „Internalisierende Auffälligkeiten“ ( = .86),
„Externalisierende Auffälligkeiten“ ( = .93) und „Gesamtproblemwert“ ( = .94) in einer
klinischen Inanspruchnahmestichprobe können als gut bis sehr gut betrachtet werden
(Döpfner, Schmeck, Berner, Lehmkuhl & Poustka, 1994). Für die vorliegende Studie wurde
die Skala „Internalisierende Auffälligkeiten“ herangezogen, um diejenigen Kinder zu identi-
fizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Angststörung aufweisen.
Anamnese und Klinische Exploration
Ein Anamnesefragebogen (in Anlehnung an Deegener, 2001) wurde eingesetzt, um die Eltern
systematisch über die bisherige Entwicklung ihres Kindes zu befragen (Fremdanamnese).
Dieser Fragebogen gliedert sich in die Bereiche Vorstellungsgründe, Familienanamnese und
Patientenvorgeschichte. Die Eltern werden gebeten, Angaben zu Schwangerschaft, Geburt,
Stillzeit, Frühkindlicher Entwicklung, Kindergarten, Schule und Freizeit sowie zum Ver-
hältnis ihres Kindes zu Geschwistern, Eltern, Gleichaltrigen und Erwachsenen zu machen.
Darüber hinaus können die Eltern in einer Prüfliste angeben, welche Behinderungen,
Beschwerden oder Probleme bei ihrem Kind bereits bestanden und/oder noch bestehen.
Eine ausführliche Klinische Exploration des Kindes, der Eltern und gegebenenfalls weiterer
wichtiger Bezugspersonen (z. B. Großeltern, Erzieher, Lehrer) wurde durchgeführt, um die
psychischen Auffälligkeiten und Kompetenzen des Kindes, die kognitiven Defizite und
Fähigkeiten des Kindes sowie die psychosozialen Bedingungen (einschließlich der familiä-
ren Bedingungen) differenziert zu erheben.
Um die Symptome der verschiedenen Angststörungen des Kindes- und Jugendalters diffe-
renziert zu erfassen, wurden ergänzend die Checklisten aus dem „Training mit sozial unsicheren
Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) eingesetzt. Die Checklisten liegen für die Emo-
tionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F93.0), für die Störung mit sozialer
Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2), für die Soziale Phobie (F40.1) und für die Generali-
sierte Angststörung des Kindesalters (F93.80) vor. Sie werden von den Eltern durch
Ankreuzen der Antwortalternativen „ja“ bzw. „nein“ bezüglich des Vorliegens bestimmter
Symptome bearbeitet. Mit Hilfe dieser Checklisten kann also festgestellt werden, ob die
Klassifikationskriterien der ICD-10 für das Vorliegen einer Angststörung erfüllt sind.
5 Methoden 114
Nach der Diagnosestellung wurde mit einem standardisierten Interviewleitfaden, dem
Elternexplorationsbogen (Petermann & Petermann, 2006b), eine Verhaltensanalyse angefertigt.
Sie diente dazu, die Bedingungen zu analysieren, die im Einzelfall zur Entstehung und Auf-
rechterhaltung der psychischen Störung beitrugen. Die gewonnenen Informationen wurden
genutzt, um notwendige Interventionen abzuleiten und zu planen.
Weiterführende Diagnostik
Im Rahmen der weiterführenden Diagnostik wurden psychologische Testverfahren zur orien-
tierenden Erfassung der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit und standardisierte
Fragebogenverfahren zur differenzierten Erhebung der psychischen Auffälligkeiten eingesetzt.
Um Hinweisen auf schulische Leistungsprobleme (z. B. Leistungs- bzw. Prüfungsängste)
nachzugehen und eine Unter- bzw. Überforderung der Kinder bei der Trainingsdurch-
führung zu vermeiden, wurde eine Intelligenzdiagnostik durchgeführt.
Zur Erfassung des allgemeinen Intelligenzniveaus wurde bei Kindern bis 8;4 Jahren der
Grundintelligenztest – Skala 1 (CFT 1; Weiß & Osterland, 1997) und bei Kindern ab 8;5 Jah-
ren der Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R; Weiß, 2006) durchgeführt. Der
CFT 1 ist ein Intelligenztest für Kinder im Alter von 5;3 bis 9;5 Jahren; der CFT 20-R ein
Intelligenztest für Kinder und Jugendliche im Alter von 8;5 Jahren bis 19;11 Jahren sowie
für Erwachsene im Alter von 20 bis 60 Jahren. Beide Intelligenztests erfassen weitgehend
sprachfrei die Grundintelligenz im Sinne der „General Fluid Ability“ (nach Cattell), das
heißt die Fähigkeit eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen, figurale Beziehungen
und formal-logische Problemstellungen mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad zu erfas-
sen und innerhalb einer bestimmten Zeit zu lösen.
Um Veränderungen im Erleben und Verhalten der Kinder durch die Trainingsteilnahme
messbar zu machen, wurden vor und nach dem Training standardisierte Fragebogen für
Kinder, Eltern und Lehrer zur Erfassung der psychischen Auffälligkeiten eingesetzt.
Zur Erfassung der sozialen Angst aus Sicht des Kindes wurde die deutsche Version der
Social Anxiety Scale for Children – Revised (SASC-R-D; LaGreca & Stone, 1993; deutsch:
Melfsen & Florin, 1997; Melfsen, 1998) eingesetzt. Die SASC-R-D ist ein störungs-
spezifisches Selbstbeurteilungsverfahren für Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren, dessen
Bearbeitung je nach Altersstufe zwischen 10 und 20 Minuten in Anspruch nimmt. Dieser
5 Methoden 115
Fragebogen, der die Häufigkeit ängstlicher Kognitionen und Verhaltensweisen in sozialen
Situationen erfasst, besteht aus den beiden Skalen Furcht vor negativer Bewertung (Fear of
Negative Evaluation, FNE) (9 Items, z. B. „Ich habe Angst, dass andere Jungen und Mäd-
chen mich nicht mögen.“) und Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen (Social
Avoidance and Distress, SAD) (9 Items, z. B. „Ich spreche nur mit Jungen und Mädchen,
die ich gut kenne.“) (vgl. Tabelle 19). Die insgesamt 18 Items werden hinsichtlich ihrer
Häufigkeit auf einer fünfstufigen Likert-Skala mit 1 (= nie), 2 (= selten), 3 (= manchmal),
4 (= meistens) oder 5 (= immer) eingeschätzt. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt,
getrennt für die beiden Skalen, durch ungewichtete Addition der Itemwerte, so dass für
jede Skala ein minimaler Summenwert von 9 und ein maximaler Summenwert von 45
erreicht werden kann.
Tabelle 19: Items der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D)
Nr. Skala FNE Nr. Skala SAD
1 Ich habe Angst davor, geärgert zu werden. 2 Ich fühle mich unsicher bei Jungen und Mädchen, die ich nicht kenne.
3 Ich glaube, dass andere Jungen und Mädchen hinter meinem Rücken über mich reden.
4 Ich spreche nur mit Jungen und Mädchen, die ich gut kenne.
5 Ich mag nichts Neues vor anderen Jungen und Mädchen ausprobieren.
8 Ich bin aufgeregt, wenn ich mit Jungen und Mädchen rede, die ich nicht gut kenne.
6 Ich überlege mir, was andere Jungen und Mädchen von mir denken.
10 Wenn ich mit Jungen und Mädchen rede, die neu in die Klasse gekommen sind, bin ich aufgeregt.
7 Ich habe Angst, dass andere Jungen und Mädchen mich nicht mögen.
12 In einer Gruppe von Jungen und Mädchen bin ich ruhig und zurückhaltend.
9 Ich mache mir Gedanken, was andere Jungen und Mädchen wohl über mich sagen.
15 Ich habe Angst, andere zu mir nach Hause einzuladen, weil sie ablehnen könnten.
11 Ich frage mich, ob andere Jungen und Mädchen mich wohl mögen.
16 Bei bestimmten Jungen und Mädchen bin ich aufgeregt.
13 Ich glaube, dass andere Jungen und Mädchen sich über mich lustig machen.
17 Ich fühle mich unsicher, selbst bei Jungen und Mädchen, die ich sehr gut kenne.
14 Wenn ich mich mit einem anderen Jungen oder Mädchen streite, habe ich Angst, dass er oder sie mich nicht mehr mögen wird.
18 Es fällt mir schwer, andere Jungen und Mädchen zu fragen, ob sie mit mir spielen.
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung (Fear of Negative Evaluation); SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen (Social Avoidance and Distress).
Für beide Skalen liegen geschlechts- und altersstratifizierte Prozentrang-Normen vor, die
1997 an einer Stichprobe von 627 Schülern im Alter zwischen 8 und 16 Jahren gewonnen
wurden. Leider werden keine Cut-off-Werte zur Unterscheidung zwischen unauffälligen
5 Methoden 116
Ängsten, subklinischen Ängsten und klinisch auffälligen Ängsten angegeben. Die internen
Konsistenzen (Cronbachs Alpha) als Maß für die Reliabilität der Skalen „Furcht vor negati-
ver Bewertung“ ( = .83) und „Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen“
( = .71) können als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden. Die nach vier Wochen
ermittelte Test-Retest-Reliabilität beträgt rtt = .82 für die Skala „Furcht vor negativer
Bewertung“ und rtt = .85 für die Skala „Vermeidung von und Belastung durch soziale Situa-
tionen“. Zur Überprüfung der Validität wurde der Zusammenhang zwischen den Skalen
der SASC-R-D und verschiedenen anderen Angstfragebogen ermittelt. Es zeigten sich sig-
nifikante Zusammenhänge mit dem Sozialphobie und -angstinventar für Kinder (SPAIK;
Melfsen et al., 2001) (FNE: r = .59; SAD: r = .66). Weitere signifikante Korrelationen wur-
den mit den Skalen „Manifeste Angst“ (FNE: r = .59; SAD: r = .48) und „Prüfungsangst“
(FNE: r = .47; SAD: r = .35) des Angstfragebogens für Schüler (AFS; Wieczerkowski,
Nickel, Janowski, Fittkau & Rauer, 1974) sowie mit dem Kinder-Angst-Test (KAT; Thur-
ner & Tewes, 1969) (FNE: r = .49; SAD: r = .45) nachgewiesen.
Zur genaueren Einschätzung internalisierender Auffälligkeiten aus Sicht der Eltern und
Lehrer wurde das Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-
10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) eingesetzt. Das DISYPS-KJ
erfasst psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen entsprechend der Diagnose-
kriterien von ICD-10 und DSM-IV. Es kombiniert drei Beurteilungsebenen miteinander –
das klinische Urteil des Experten, das Fremdurteil der Eltern, Erzieher oder Lehrer und das
Selbsturteil des Kindes oder Jugendlichen. Zur Erfassung von Angststörungen und
Depressiven Störungen liegen jeweils eine Diagnose-Checkliste (DCL-ANG, DCL-DES),
ein Fremdbeurteilungsbogen (FBB-ANG, FBB-DES) und ein Selbstbeurteilungsbogen
(SBB-ANG, SBB-DES) vor. Auf diese Weise verbindet das Diagnostik-System die katego-
riale und die dimensionale Beurteilung psychischer Störungen. In der vorliegenden Studie
wurden der Fremdbeurteilungsbogen für Angststörungen (FBB-ANG) und der Fremd-
beurteilungsbogen für Depressive Störungen (FBB-DES) verwendet. Beide Fragebogen
machen es Eltern, Erziehern und Lehrern möglich, das Verhalten von Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 4;0 bis 17;11 Jahren zu beurteilen. Damit ist auf dimensionaler
Ebene ein direkter Vergleich zwischen den verschiedenen Fremdurteilen möglich. Die Be-
zugspersonen benötigen für das Ausfüllen der Fragebogen jeweils etwa 10 bis 20 Minuten.
5 Methoden 117
Der Fremdbeurteilungsbogen für Angststörungen (FBB-ANG) erfasst mit insgesamt 31 Items
(z. B. „hat eine ausgeprägte und anhaltende Angst, in Leistungssituationen zu versagen“)
die Symptomkriterien der verschiedenen Angststörungen. Dabei werden die Items von den
Bezugspersonen (z. B. Eltern, Erzieher, Lehrer) zweifach beurteilt. Zunächst geben die
Bezugspersonen anhand einer vierstufigen Antwortskala (0 = gar nicht, 1 = ein wenig, 2 =
weitgehend, 3 = besonders) für jedes Item an, wie zutreffend die Beschreibung für das
Verhalten des Kindes oder Jugendlichen in den letzten sechs Monaten ist. Anschließend
schätzen sie ebenfalls anhand einer vierstufigen Skala (0 = gar nicht, 1 = ein wenig, 2 =
ziemlich, 3 = sehr) ein, als wie problematisch sie das Verhalten des Kindes oder Jugend-
lichen erleben. Aus den 31 Items zur Erfassung der Symptomkriterien werden die vier stö-
rungsbezogenen Subskalen Trennungsangst (10 Items), Generalisierte Angst (7 Items), Soziale
Phobie (7 Items) und Spezifische Phobie (7 Items) sowie die Gesamtskala Angststörungen (31
Items) gebildet. Die Kennwerte für die einzelnen Skalen werden ermittelt, indem die Item-
werte addiert und durch die Anzahl der Items dividiert werden. Im Fremdbeurteilungsbo-
gen Angststörungen werden mit zusätzlichen Items die Störungsdauer, die Beziehungs-
fähigkeit (Zusatzkriterium für Soziale Ängstlichkeit bzw. Soziale Phobie) und die Auslöser
(Hinweis auf eine Anpassungsstörung) erfasst. Darüber hinaus werden der Leidensdruck
und die Beeinträchtigung der psychosozialen Anpassung (u. a. Beziehungs- und Leistungs-
fähigkeit) des Kindes oder Jugendlichen erfragt.
Der Fremdbeurteilungsbogen für Depressive Störungen (FBB-DES) erfasst mit insgesamt 29 Items
(z. B. „hat die meiste Zeit über kein Interesse und keine Freude an allen oder fast allen
Tätigkeiten“) die Symptomkriterien der Depressiven Störungen. Aus diesen 29 Items
werden die vier störungsbezogenen Subskalen Depressive Symptome (18 Items), Somatisches
Syndrom (9 Items), Dysthymia (nach ICD-10) (14 Items) und Dysthyme Störung (nach DSM-IV)
(11 Items) sowie die Gesamtskala Depressive Störungen (26 Items) gebildet. Antwortformat und
Auswertungsvorschriften stimmen mit denen des Fremdbeurteilungsbogens für Angst-
störungen überein. Im Fremdbeurteilungsbogen für Depressive Störungen werden mit
zusätzlichen Items die Störungsdauer, frühere Phasen (Hinweis auf eine rezidivierende
Störung) und Auslöser (Hinweis auf eine Anpassungsstörung) erhoben. Darüber hinaus
werden der Leidensdruck und die Beeinträchtigung der psychosozialen Anpassung (u. a.
Beziehungs- und Leistungsfähigkeit) des Kindes oder Jugendlichen erfragt.
5 Methoden 118
Für die inzwischen vorliegende, überarbeitete Auflage des DISYPS (DISYPS-II; Döpfner
et al., 2008) wurden an den verwendeten Fragebogen einige Veränderungen vorgenommen.
So wurde in den Fremdbeurteilungsbogen auf die zweite Einschätzung der Problemstärke
(„Wie problematisch erleben Sie das Verhalten?“) verzichtet, weil die Einschätzungen von
Schweregrad und Problemstärke sehr hohe Korrelationen aufweisen. Der Fremdbeurtei-
lungsbogen für Angststörungen wurde um zwei Items des Störungsbereichs Zwangs-
störungen ergänzt; dementsprechend wurde der Fragebogen in Fremdbeurteilungsbogen
für Angst- und Zwangsstörungen (FBB-ANZ) umbenannt. Im Zuge der Überarbeitung des
Diagnostik-Systems wurden die beiden verwendeten Fragebogen einer psychometrischen
Überprüfung unterzogen: Seitdem liegen für beide Fremdbeurteilungsbogen (FBB-ANZ,
FBB-DES) geschlechts- und altersstratifizierte Normen in Form von Prozenträngen und
Stanine-Werten vor. Beim Fremdbeurteilungsbogen Angst- und Zwangsstörungen liegen
die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) für die Subskalen „Trennungsangst“ ( =
.85), „Generalisierte Angst“ ( = .83), „Soziale Phobie“ ( = .80) und „Spezifische Pho-
bie“ ( = .73) sowie für die Gesamtskala „Angststörungen“ ( = .91) im zufriedenstellen-
den bis sehr guten Bereich (Görtz-Dorten & Döpfner, 2008). Beim Fremdbeurteilungs-
bogen Depressive Störungen liegt die interne Konsistenz für die Gesamtskala „Depressive
Störungen“ ( = .89) im guten Bereich (Döpfner et al., 2008).
Zur Beurteilung des schulbezogenen Sozialverhaltens als Indikator für soziale Kompetenz
wurde die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL; Petermann & Petermann,
2006a) eingesetzt. Die LSL ist ein Fragebogen für Lehrer, mit dessen Hilfe das Sozial- und
Lernverhalten von Schülern im Alter von 6;0 bis 19;11 Jahren beschrieben werden kann.
Die Bearbeitung des Fragebogens dauert etwa fünf Minuten. Der Fragebogen umfasst 10
Skalen, die aus jeweils 5 Items gebildet werden. Der Aussagenbereich Sozialverhalten gliedert
sich in die sechs Skalen Kooperation (z. B. „arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusam-
men“), Selbstwahrnehmung (z. B. „nimmt eigene Gefühle wahr“), Selbstkontrolle (z. B. „schiebt
eigene Bedürfnisse auf“), Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft (z. B. „teilt mit anderen“),
Angemessene Selbstbehauptung (z. B. „äußert eigene Meinungen angemessen“) und Sozial-
kontakt (z. B. „nimmt angemessen Kontakt auf“). Der Aussagenbereich Lernverhalten be-
steht aus den vier Skalen Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer (z. B. „strengt sich an, um eine
Aufgabe zu lösen“), Konzentration (z. B. „arbeitet ohne Unterbrechungen“), Selbstständigkeit
beim Lernen (z. B. „setzt sich erreichbare Ziele“) und Sorgfalt beim Lernen (z. B. „erledigt
5 Methoden 119
Hausaufgaben sorgfältig“). Die insgesamt 50 Items, die sich auf das in den letzten vier Wo-
chen beobachtete Schülerverhalten beziehen, werden vom Lehrer auf einer vierstufigen
Antwortskala (0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = häufig) eingeschätzt. Die Auswer-
tung des Fragebogens erfolgt skalenweise durch die Bildung von Summenwerten.
Für alle 10 Skalen liegen geschlechts- und altersdifferenzierte Normen in Form von T-
Werten und Prozenträngen vor. Diese Normierung wurde in den Jahren 2004 bis 2006 an
einer Stichprobe von 1.480 Schülern verschiedener Schultypen vorgenommen. Die inter-
nen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) der Skalen variieren zwischen = .82 und = .95,
wobei die meisten Kennwerte über = .90 liegen; sie können als gut bis sehr gut angese-
hen werden. In der vorliegenden Arbeit wurde nur der Aussagenbereich „Sozialverhalten“
als Maß für die in der Schule gezeigten sozialen Fertigkeiten berücksichtigt.
Abschließende Beurteilung
Im Rahmen der Nachsorgeuntersuchung (Katamnese) erhielten die Eltern einen Frage-
bogen zur retrospektiven Beurteilung des Trainings (vgl. Anhang 1). Die Eltern wurden
gebeten, anhand einer fünfstufigen Antwortskala (0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 =
oft, 4 = immer) einzuschätzen, wie gut sie die vermittelten Trainingsinhalte auf bekanntes
und unbekanntes Problemverhalten ihres Kindes anwenden konnten. Des Weiteren sollten
die Eltern anhand einer fünfstufigen Antwortskala (0 = gar nicht, 1 = kaum, 2 = etwas, 3 =
deutlich, 4 = stark) angeben, wie stark sich das Verhalten ihres Kindes durch die Trainings-
teilnahme verbessert hat und wie zufrieden sie mit diesen Veränderungen sind. Abschlie-
ßend wurde erfragt, ob die Eltern die Teilnahme am Training als hilfreich und unterstüt-
zend erlebt haben und das Training weiterempfehlen würden.
5 Methoden 120
5.4 Stichprobenbeschreibung
Soziodemografische Angaben
An der vorliegenden Studie nahmen insgesamt 25 Kinder (13 Mädchen, 12 Jungen) im
Alter von 7;2 bis 12;7 Jahren teil (M = 9.57; SD = 1.53). Die kognitive Leistungsfähigkeit
der Kinder lag im durchschnittlichen Bereich (M = 104.08; SD = 13.36); keines der Kinder
wies eine Intelligenzminderung (IQ < 70) auf. Von diesen Kindern besuchten 19 Kinder
(76 %) die Grundschule, 3 Kinder (12 %) das Gymnasium, 1 Kind (4 %) die Realschule,
1 Kind (4 %) die Hauptschule und 1 Kind (4 %) die Integrierte Haupt- und Realschule.
19 Elternpaare (76 %) waren verheiratet, 5 Elternpaare (20 %) lebten getrennt oder ge-
schieden und 1 Elternteil (4 %) war alleinstehend. 6 Kinder (24 %) hatten keine Geschwis-
ter, 14 Kinder (56 %) ein Geschwister und 5 Kinder (20 %) zwei oder drei Geschwister.
Die überwiegende Mehrheit der Väter (22 Väter; 88 %) war ganztags berufstätig; 1 Vater
(4 %) war nur halbtags berufstätig. Von 2 Vätern fehlten die Angaben zur Berufstätigkeit,
weil zwischen den Elternteilen kein Kontakt mehr bestand. Von den Müttern waren
4 (16 %) ganztags berufstätig, 16 (64 %) halbtags berufstätig und 5 (20 %) nicht berufstätig.
Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip einer Interventionsgruppe (n = 14; 56 %) und
einer Wartekontrollgruppe (n = 11; 44 %) zugeordnet. Tabelle 20 zeigt eine nach Gruppen-
zugehörigkeit getrennte Übersicht über die soziodemografischen Merkmale der Stichprobe.
Die Kinder beider Gruppen unterschieden sich hinsichtlich wesentlicher soziodemografi-
scher Merkmale (z. B. Geschlecht, Alter, Intelligenz) nicht signifikant voneinander. Für
zwei weniger relevante Merkmale, den Bildungsstand der Mutter und die Anzahl der
Geschwister, wurden jedoch signifikante Gruppenunterschiede festgestellt.
Psychische Auffälligkeiten
Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4-18),
ein störungsübergreifendes Screeningverfahren, lieferte erste Hinweise auf verschiedene
psychische Auffälligkeiten der Kinder (vgl. Abb. 2). Die überwiegende Mehrheit der Eltern
(88 %) hatte in den letzten sechs Monaten internalisierende Auffälligkeiten bei ihrem Kind
beobachtet: 68 % der Kinder fielen ihren Eltern durch sozialen Rückzug, 44 % durch
körperliche Beschwerden und 72 % durch ängstliches und/oder depressives Verhalten auf.
5 Methoden 121
Tabelle 20: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe und Prüfung von Mittelwerts-unterschieden zwischen Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe
Interventions-gruppe
Wartekontroll-gruppe
Prüfgröße Signifikanz
n % n % p
Geschlecht weiblich 7 50.00 6 54.50 2 = 0.05 df = 1
n. s. männlich 7 50.00 5 45.50
Alter M (SD) 9.49 (1.71) 9.70 (1.33) t = -0.33 n. s.
Intelligenz M (SD) 104.86 (11.46) 103.09 (15.99) t = 0.32 n. s.
Schulform Grundschule 11 78.60 8 72.70 2 = 3.50
df = 4 n. s.
Hauptschule 1 7.10
1 9.10 Realschule 1 7.10
Gymnasium 1 7.10 2 18.20
Bildungsstand der Mutter
Hauptschule 0 0.00 3 27.30
2 = 9.85 df = 3
.02 *
Realschule 12 85.70 3 27.30
Gymnasium 1 7.10 2 18.20
Studium 1 7.10 2 18.20
Promotion 0 0.00 1 9.10
Bildungsstand des Vaters
Hauptschule 1 7.10 1 9.10
2 = 1.58 df = 3
n. s.
Realschule 10 71.40 6 54.50
Gymnasium 0 0.00 0 0.00
Studium 3 21.40 2 18.20
Promotion 0 0.00 1 9.10
Berufstätigkeit der Mutter
keine 4 28.60 1 9.10 2 = 2.73
df = 2 n. s.
halbtags 9 64.30 7 63.60
ganztags 1 7.10 3 27.30
Berufstätigkeit des Vaters
keine 0 0.00 0 0.00 2 = 1.63
df = 1 n. s.
halbtags 0 0.00 1 9.10
ganztags 14 100.00 8 72.70
Familienstand der Eltern
alleinstehend 0 0.00 1 9.10 2 = 6.31
df = 3 n. s.
verheiratet 13 92.90 6 54.50
getrennt 0 0.00 3 27.30
geschieden 1 7.10 1 9.10
Geschwister keine 1 7.10 5 45.50 2 = 8.00
df = 3 .05 *
ein 11 78.60 3 27.30
zwei 2 14.30 2 18.20
drei 0 0.00 1 9.10
Anmerkungen: Zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01.
5 Methoden 122
0
5
10
15
20
25
unauffällig grenzwertig auffällig A
bsol
ute
Häu
figke
iten
Tabelle 21: Psychische Auffälligkeiten der Stichprobe (gemäß CBCL/4-18) und Prüfung von Mittelwertsunterschieden zwischen Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe
Interventions-gruppe
Wartekontroll-gruppe
Prüfgröße Signifikanz
CBCL/4-18 M (SD) M (SD) t p
Primärskalen
Sozialer Rückzug 8.57 (4.03) 7.45 (3.17) 0.75 n. s.
Körperliche Beschwerden 2.79 (3.24) 3.91 (3.96) -0.78 n. s.
Ängstlichkeit/Depressivität 8.57 (4.72) 13.00 (5.73) -2.12 0.05 *
Soziale Probleme 4.79 (3.75) 5.55 (4.06) -0.49 n. s.
Schizoid/Zwanghaft 2.79 (3.19) 1.91 (2.26) 0.77 n. s.
Aufmerksamkeitsprobleme 5.29 (5.06) 6.27 (3.38) -0.56 n. s.
Dissoziales Verhalten 1.50 (1.79) 2.55 (2.70) -1.16 n. s.
Aggressives Verhalten 8.50 (5.88) 11.64 (7.26) -1.20 n. s.
Sekundärskalen
Internalisierende Auffälligkeiten 18.93 (9.75) 23.36 (10.31) -1.10 n. s.
Externalisierende Auffälligkeiten 10.00 (7.15) 14.18 (9.57) -1.25 n. s.
Gesamt-Problemverhalten 48.07 (25.00) 57.36 (24.94) -0.92 n. s.
Anmerkungen: Zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01.
Abbildung 2: Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten in der Gesamtstichprobe – Erfassungmittels CBCL/4-18 (unter Verwendung von Cut-off-Werten für klinische Auffälligkeit)
5 Methoden 123
2
1
4
11
2
1
3
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Wartekontrollgruppe
Interventionsgruppe
Trennungsangst Soziale Ängstlichkeit Soziale Phobie Generalisierte Angst
Etwa die Hälfte der Kinder (48 %) wiesen nach Einschätzung ihrer Eltern auch soziale
Probleme auf. Darüber hinaus stellten einige Eltern bei ihren Kindern Auffälligkeiten in
den Bereichen Aufmerksamkeit (28 %), Aggressivität (28 %) und Dissozialität (8 %) fest.
Eine nach Gruppenzugehörigkeit getrennte Übersicht über die mit der CBCL/4-18 erfass-
ten psychischen Auffälligkeiten der Stichprobe zeigt Tabelle 21. Beim Mittelwertsvergleich
wurde auf den Skalen der CBCL/4-18 bis auf eine Ausnahme kein signifikanter Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen gefunden. Lediglich die Einschätzungen der Eltern
auf der Skala „Ängstlichkeit/Depressivität“ fielen in der Wartekontrollgruppe signifikant
höher aus als in der Interventionsgruppe (vgl. Tabelle 21). Auf der übergeordneten Skala
„Internalisierende Auffälligkeiten“, die sich aus den Skalen „Sozialer Rückzug“, „Körper-
liche Beschwerden“ und „Ängstlichkeit/Depressivität“ zusammensetzt, unterschieden sich
die Werte der beiden Gruppen jedoch nicht signifikant voneinander.
Die klinische Exploration des Kindes und seiner Eltern sowie die Diagnose-Checklisten
aus dem „Training mit sozial unsicheren Kindern“ wurden genutzt, um die Klassifikations-
kriterien der verschiedenen Angststörungen differenziert zu erfassen. Für die Diagnose-
stellung mussten alle Kriterien einer Angststörung laut Eltern- bzw. Expertenurteil erfüllt
sein. 15 Kinder (60 %) erfüllten die Kriterien für die Diagnose einer Störung mit sozialer
Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2). Bei 3 Kindern (12 %) lag eine Emotionale Störung
mit Trennungsangst des Kindesalters (F93.0) vor. 3 Kinder (12 %) wiesen eine Soziale
Phobie (F40.1) auf. Bei 4 Kindern (16 %) wurde eine Generalisierte Angststörung des Kin-
desalters (F93.80) festgestellt. Eine nach Gruppenzugehörigkeit getrennte Darstellung der
diagnostizierten Störungen kann Abbildung 3 entnommen werden. Hinsichtlich der Häu-
figkeitsverteilung der Diagnosen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden
Gruppen gefunden ( 2(3) = 4.64, n. s.).
Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Diagnosen (nach ICD-10), getrennt nachInterventionsgruppe und Wartekontrollgruppe
Absolute Häufigkeiten
5 Methoden 124
Hinsichtlich des Leidensdrucks gaben 44 % der Eltern im Diagnostik-System für psychi-
sche Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ) an,
dass ihre Kinder gar nicht oder nur ein wenig leiden, während 56% der Eltern erklärten,
dass ihre Kinder ziemlich oder sehr unter den von ihnen beschriebenen Problemen leiden.
Darüber hinaus seien die Beziehungen zu anderen Menschen und/oder die schulische Leis-
tungsfähigkeit nach Ansicht der Eltern bei 20 % der Kinder gar nicht oder nur ein wenig
beeinträchtigt, bei 80 % der Kinder ziemlich oder sehr beeinträchtigt. Die Kinder beider
Trainingsbedingungen unterschieden sich weder hinsichtlich ihres Leidensdrucks ( 2(3) =
3.22, n. s.) noch hinsichtlich der Beeinträchtigung ihrer Funktionsfähigkeit ( 2(3) = 2.07,
n. s.) signifikant voneinander.
5 Methoden 125
5.5 Statistische Auswertung
Für die statistischen Analysen zur Überprüfung der Wirksamkeit des Trainings wurden
parametrische Testverfahren verwendet – wie bei vergleichbaren Fragestellungen auch von
den Referenzarbeitsgruppen im deutsch- und englischsprachigen Raum (z. B. Ginsburg &
Drake, 2002; Joormann & Unnewehr, 2002b; Melfsen et al., 2011; Muris, Meesters & van
Melick, 2002; Schneider et al., 2011).
Bei der Auswahl der statistischen Verfahren wurde davon ausgegangen, dass die den Analy-
sen zugrunde liegenden Daten Intervallskalenniveau aufweisen. Die Voraussetzungen für
die Anwendung von t-Tests (Normalverteilung, Varianzhomogenität) und die zusätzlichen
Voraussetzungen für die Anwendung von Kovarianzanalysen (Reliabilität der Kovariate,
Linearität des Zusammenhangs zwischen der Kovariate und der abhängigen Variablen,
Homogenität der Regressionskoeffizienten) und Varianzanalysen mit Messwiederholung
(Sphärizität) wurden überprüft. Die statistische Überprüfung der abhängigen Variablen auf
Normalverteilung mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests ergab, dass die Werte aller
Skalen normalverteilt sind. Von Varianzhomogenität, überprüft durch den Levéne-Test auf
Varianzgleichheit, kann nicht bei allen abhängigen Variablen ausgegangen werden. Die An-
nahme der Zirkularität wurde mit dem Mauchley-Test auf Sphärizität überprüft. Bei einer
Verletzung dieser Voraussetzung wurde eine Korrektur der Freiheitsgrade nach
Greenhouse-Geisser vorgenommen. Da nicht alle ausgehändigten Fragebogen (vollständig)
ausgefüllt wurden, weisen die Analysen unterschiedliche Fallzahlen auf.
Aufgrund der geringen Stichprobengröße und der vereinzelten Verletzungen der Voraus-
setzung der Varianzhomogenität wurden für die Wirksamkeitsüberprüfung des Trainings
zusätzlich nicht-parametrische Testverfahren eingesetzt. Die mit den nicht-parametrischen
Tests erzielten Ergebnisse sind im Anhang dieser Arbeit detailliert aufgeführt. Sollten die
Ergebnisse der nicht-parametrischen Tests von denen der parametrischen Tests abweichen,
wird an den entsprechenden Stellen darauf hingewiesen.
Zur Überprüfung von Unterschieden zwischen der Interventionsgruppe und der Wartekontrollgruppe
vor Beginn des Trainings wurden bei intervallskalierten Daten t-Tests für unabhängige
Stichproben, bei nominal- oder ordinalskalierten Daten 2-Tests durchgeführt.
5 Methoden 126
Die Hypothesen zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings wurden beim Vergleich von
Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe mit univariaten, einfaktoriellen Kovarianz-
analysen bzw. Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter Residuen überprüft.
Die standardisierten Residuen wurden aus einer linearen Regression der Posttestwerte auf
die Prätestwerte gewonnen. Diese Residualwerte entsprechen den Abweichungen der tat-
sächlichen Posttestwerte von den durch die Prätestwerte vorhergesagten Posttestwerten.
Sie können als Daten betrachtet werden, die um den Einfluss des Prätests bereinigt wur-
den. Auch die Kovarianzanalyse mit den Prätestwerten als Kovariate erlaubt die Prüfung
der Posttestwerte, weil der Einfluss möglicherweise unterschiedlicher Prätestwerte statis-
tisch eliminiert wird. Die Kovarianzanalyse wurde der Varianzanalyse mit Messwieder-
holung vorgezogen, weil eine Kovarianzanalyse fast immer eine höhere Teststärke besitzt
und eine geringere Fehlervarianz aufweist (Kaluza & Schulze, 2000).
Die Hypothesen zur langfristigen Wirksamkeit des Trainings wurden mit univariaten, ein-
faktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung bzw. Wilcoxon-Tests (Vorzeichen-
Rang-Test) geprüft. Um die Gesamtsignifikanz der Varianzanalysen differenziert interpre-
tieren zu können, wurden anschließend paarweise Einzelvergleiche mit (Least Significant
Difference-Bonferroni) t-Tests für abhängige Stichproben durchgeführt. Die langfristige
Wirksamkeit des Trainings wurde getrennt für Interventionsgruppe (1., 2. und 3. Messzeit-
punkt) und Wartekontrollgruppe (2., 3. und 4. Messzeitpunkt) überprüft. Die Ergebnisse
der Interventionsgruppe werden im Text vollständig dargestellt; zum Vergleich können die
Ergebnisse der Wartekontrollgruppe dem Anhang dieser Arbeit entnommen werden.
Die Hypothesen zur differentiellen Wirksamkeit des Trainings wurden mit univariaten, zwei-
faktoriellen Kovarianzanalysen bzw. Kruskal-Wallis-H-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen überprüft. Um potentielle Einflussfaktoren (z. B. Geschlecht, Alter, Intelligenz)
auf die Angstsymptomatik und ihre Veränderungen in der Interventionsgruppe untersu-
chen zu können, wurde die Interventionsgruppe im Hinblick auf diese Einflussfaktoren
mittels Mediandichotomisierung (zum 1. Messzeitpunkt) in zwei Gruppen aufgeteilt und
mit der Wartekontrollgruppe kontrastiert. Um die Gesamtsignifikanz der Kovarianz-
analysen bzw. der Kruskal-Wallis-H-Tests differenziert interpretieren zu können, wurden
anschließend paarweise Einzelvergleiche mit (Least Significant Difference-Bonferroni)
t-Tests für unabhängige Stichproben bzw. Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt.
5 Methoden 127
Die Wahl einer geeigneten statistischen Auswertungsstrategie hängt hauptsächlich von der
jeweiligen Fragestellung und den vorliegenden Daten ab. Die in der vorliegenden Studie
eingesetzten Fragebogen bestehen jeweils aus mehreren Skalen, die sich inhaltlich nicht
sinnvoll zusammenfassen lassen (z. B. DISYPS-KJ: FBB-ANG). Aus dieser Überlegung
heraus wurde ein univariater Mittelwertsvergleich gewählt, der es erlaubt, die Gruppen-
unterschiede für jede einzelne abhängige Variable zu überprüfen. Dabei lässt sich der Ein-
satz des univariaten Ansatzes damit rechtfertigen, dass die abhängigen Variablen zumindest
theoretisch als wechselseitig unabhängig vorstellbar sind (Bortz & Schuster, 2010).
Das Signifikanzniveau wurde auf p = .05 festgelegt. In Bezug auf die differentielle Wirk-
samkeit des Trainings besitzt die vorliegende Studie explorativen Charakter. Um einem
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn nicht entgegenzustehen, wurden bei der Ergebnis-
darstellung auch statistische Tendenzen (p < .10) berücksichtigt. Da es sich bei den Hypo-
thesen der vorliegenden Arbeit um spezifische, a priori formulierte Einzelhypothesen han-
delt, kann bei simultanen Signifikanztests auf eine Korrektur des Signifikanzniveaus ver-
zichtet werden (Bortz, Lienert & Boehnke, 2008).
Um auch die klinische Bedeutsamkeit signifikanter Mittelwertsunterschiede beurteilen zu
können, wurden Effektstärken berechnet. Im Rahmen parametrischer Analysen wurden die
mit dem t-Test für unabhängige Stichproben (Effektstärke d) und mit dem t-Test für ab-
hängige Stichproben (Effektstärke d’) verbundenen Effektgrößen den Berechnungsvor-
schriften von Bortz und Döring (2006, S. 606 ff.) folgend gebildet. Bei der von Cohen
(1988) vorgeschlagenen Einteilung wird zwischen kleinen (d bzw. d’ > 0.20), mittleren
(d bzw. d’ > 0.50) und großen (d bzw. d’ > 0.80) Effekten unterschieden. Bei Varianz-
analysen wird das partielle Eta-Quadrat 2p als Maß für die Effektstärke berechnet. Nach
Cohen (1988; zitiert nach Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 453) handelt es sich bei 2p = .01
um einen kleinen, bei 2p = .06 um einen mittleren und bei 2
p = .14 um einen großen
Effekt. Da es bisher noch kein allgemein gültiges Effektstärkemaß für nicht-parametrische
Testverfahren gibt, empfehlen Bortz und Lienert (2008), sich auch bei nicht-parametri-
schen Analysen an den Effektstärkemaßen für parametrische Testverfahren zu orientieren.
Zur Analyse der Beurteilerübereinstimmung wurden Intraklassenkorrelationen (ICC) berechnet.
Dabei werden Werte im Allgemeinen als Indikator für eine gute Beurteilerüberein-
stimmung angesehen (Wirtz, 2006).
6 Ergebnisse 128
6 Ergebnisse
6.1 Kurzfristige Wirksamkeit des Trainings
6.1.1 Trainingseffekte im Kinderurteil
Um Aussagen zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Kinder treffen zu
können, wurde überprüft, ob die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training im Selbsturteil eine stärkere Reduktion der Angstsymptomatik aufweisen als die
Kinder der Wartekontrollgruppe (Hypothese 1a). Zur Erfassung der Angstsymptomatik
aus Sicht der Kinder wurde die deutsche Version der Social Anxiety Scale for Children – Revised
(SASC-R-D; Melfsen, 1998) eingesetzt. Die Mittelwerte und Standardabweichungen des
Kinderurteils auf den Skalen der SASC-R-D zu den ersten beiden Messzeitpunkten sind
– getrennt für Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe – in Tabelle 22 dargestellt.
Tabelle 22: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D)
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
Kinder M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
SASC-R-D (n = 14) (n = 11) (n = 14) (n = 11)
FNE 21.64 (7.51) 19.64 (5.30) 20.57 (7.55) 19.18 (4.36)
SAD 25.57 (5.10) 22.82 (5.88) 22.50 (4.93) 19.36 (5.61)
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen.
Auf den beiden Skalen der SASC-R-D zeigt sich deskriptiv eine Verringerung der Werte in
der Interventionsgruppe; allerdings findet sich eine vergleichbare Abnahme der Werte auch
in der Wartekontrollgruppe. Die zwischen beiden Gruppen bestehenden Unterschiede
wurden mit Hilfe von univariaten, einfaktoriellen Kovarianzanalysen mit dem Faktor
„Gruppenzugehörigkeit“ und den Prätestwerten als Kovariaten überprüft (vgl. Tabelle 23).
6 Ergebnisse 129
Tabelle 23: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinderurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe ANCOVA b
Kinder M (SD) M (adjust.) a M (SD) M (adjust.) a F 2p
SASC-R-D (n = 14) (n = 11)
FNE 20.57 (7.55) 20.36 19.18 (4.36) 19.45 0.12 .01
SAD 22.50 (4.93) 22.08 19.36 (5.61) 19.90 1.11 .05
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen; a Mittelwerte wurden an Prätest-Unterschiede angepasst; b Daten des ersten Messzeitpunkts dienten als Kovariate; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher
Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
In der kovarianzanalytischen Auswertung findet sich zum zweiten Messzeitpunkt für die
beiden Skalen der SASC-R-D kein signifikanter Haupteffekt „Gruppenzugehörigkeit“, was
bedeutet, dass sich die Interventionsgruppe und die Wartekontrollgruppe unmittelbar nach
dem Training hinsichtlich ihrer Angstsymptomatik nicht signifikant unterscheiden. Die
Effektstärken liegen für beide Skalen der SASC-R-D im geringfügigen Bereich.
Mit den zusätzlich durchgeführten Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen wurden die Ergebnisse der univariaten Kovarianzanalysen ausnahmslos bestätigt.
Im Selbsturteil der Kinder ließen sich zum zweiten Messzeitpunkt weder auf der Skala
„Furcht vor negativer Bewertung“ (FNE; z = -0.06; n. s.) noch auf der Skala „Vermeidung
von und Belastung durch soziale Situationen“ (SAD; z = -1.07; n. s.) signifikante Unter-
schiede zwischen den Werten der Interventionsgruppe und den Werten der Wartekontroll-
gruppe feststellen.
Für die Interpretation der Skalenwerte der SASC-R-D sei hier auf eine Validierungsstudie
von Melfsen (1999) verwiesen. Dieser Validierungsstudie zufolge liegen sowohl die Werte
der Interventionsgruppe als auch die Werte der Wartekontrollgruppe auf der Skala „Furcht
vor negativer Bewertung“ zum ersten und zweiten Messzeitpunkt zwischen den Werten
einer Gruppe mit subklinischen sozialen Ängsten (M = 23.42) und einer Kontrollgruppe
(M = 15.92). Auf der Skala „Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen“
sind die Werte der Interventionsgruppe zum ersten Messzeitpunkt mit den Werten einer
Gruppe mit klinischen sozialen Ängsten (M = 25.72) und die Werte der Wartekontroll-
gruppe mit den Werten einer Gruppe mit subklinischen sozialen Ängsten (M = 24.99) aus
6 Ergebnisse 130
der Validierungsstichprobe vergleichbar. Zum zweiten Messzeitpunkt liegen die Werte bei-
der Gruppen zwischen den Werten einer Gruppe mit subklinischen sozialen Ängsten und
einer Kontrollgruppe (M = 6.93).
Leider wurden im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der SASC-R-D-Normen
(Melfsen, 1998) keine Cut-off-Werte zur Unterscheidung zwischen unauffälligen Ängsten,
subklinischen Ängsten und klinisch auffälligen Ängsten angegeben. Petermann und Peter-
mann (2010) schlagen vor, Prozentrangwerte unter 90 als unauffällig, zwischen 90 und 94
als leicht auffällig und über 94 als deutlich auffällig zu interpretieren. Ein Vergleich mit den
von Melfsen (1998) berichteten Normwerten zeigt, dass bereits vor dem Training (1. Mess-
zeitpunkt) viele Kinder der Interventionsgruppe (FNE: 85.7 %; SAD: 64.3 %) und fast alle
Kinder der Wartekontrollgruppe (FNE: 100.0 %; SAD: 81.8 %) Prozentrangwerte unter 90
erzielen und damit hinsichtlich ihrer Angstsymptomatik als unauffällig eingestuft werden.
In beiden Gruppen berichten nur wenige Kinder über leicht oder deutlich auffällige Ängste
(IG – FNE: 14.3 % deutlich auffällig; SAD: 7.1 % leicht auffällig, 28.6 % deutlich auffällig;
KG – FNE: 0.0 % auffällig; SAD: 18.2% deutlich auffällig). Dennoch ist zu erkennen, dass
sich das Angsterleben der wenigen, zuvor als auffällig beurteilten Kinder der Interventions-
gruppe unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) verringert hat (FNE: 85.7 %
unauffällig, 7.1 % leicht auffällig, 7.1 % deutlich auffällig; SAD: 78.6 % unauffällig, 14.3 %
leicht auffällig, 7.1 % deutlich auffällig). In der Wartekontrollgruppe weisen zum zweiten
Messzeitpunkt alle Kinder Prozentrangwerte unter 90 auf und gelten damit hinsichtlich
ihrer Angstsymptomatik als unauffällig (FNE: 100.0 %; SAD: 100.0 %).
6.1.2 Trainingseffekte im Elternurteil
Um Aussagen zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Eltern treffen zu
können, wurde überprüft, ob die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training (2. Messzeitpunkt) im Elternurteil einerseits eine stärkere Reduktion der Angst-
symptomatik (Hypothese 1a) und andererseits eine stärkere Reduktion der komorbiden
depressiven Symptomatik (Hypothese 1b) aufweisen als die Kinder der Wartekontroll-
gruppe. Zur Erfassung der ängstlichen Symptomatik aus Sicht der Eltern wurde der Fremd-
beurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG), zur Erfassung der komorbiden depressiven
Symptomatik aus Sicht der Eltern der Fremdbeurteilungsbogen Depressive Störungen (FBB-DES)
6 Ergebnisse 131
aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und
DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) eingesetzt. Für die Datenauswertung
wurde bei beiden Fremdbeurteilungsbogen nur die Einschätzung des Schweregrades
berücksichtigt. Auf die Einschätzung der Problemstärke wurde verzichtet, weil die Ein-
schätzungen von Schweregrad und Problemstärke in der vorliegenden Arbeit sehr hohe
Korrelationen aufweisen (vgl. Anhang 2).
Angstsymptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Elternurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) sind getrennt für den ersten und zweiten
Messzeitpunkt sowie für die Interventionsgruppe und die Wartekontrollgruppe in Tabelle
24 dargestellt.
Tabelle 24: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
Eltern M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 14) (n = 11) (n = 14) (n = 11)
TREN 0.69 (0.66) 0.63 (0.32) 0.34 (0.60) 0.55 (0.41)
GEN 1.27 (0.75) 1.17 (0.57) 0.84 (0.81) 1.08 (0.55)
SOZ 1.96 (0.82) 1.66 (0.62) 1.21 (0.93) 1.61 (0.64)
SPEZ 0.81 (0.74) 0.61 (0.46) 0.53 (0.61) 0.70 (0.63)
ANG 1.13 (0.49) 0.98 (0.27) 0.69 (0.59) 0.94 (0.36)
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen.
Bei genauerer Betrachtung lässt sich bereits deskriptiv feststellen, dass sich die Werte der
Interventionsgruppe (mit Training) auf den Skalen des FBB-ANG zwischen dem ersten
und zweiten Messzeitpunkt verbessern, während die Werte der Wartekontrollgruppe (ohne
Training) auf denselben Skalen stagnieren. Um zwischen den beiden Gruppen bestehende
Unterschiede auch statistisch absichern zu können, wurden univariate, einfaktorielle
Kovarianzanalysen mit dem Faktor „Gruppenzugehörigkeit“ und den Prätestwerten als
Kovariaten durchgeführt (vgl. Tabelle 25).
6 Ergebnisse 132
Tabelle 25: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Elternurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe ANCOVA b
Eltern
M (SD) M (adjust.) a M (SD) M (adjust.) a F 2p
FBB-ANG (n = 14) (n = 11)
TREN 0.34 (0.60) 0.33 0.55 (0.41) 0.57 2.31 .10
GEN 0.84 (0.81) 0.80 1.08 (0.55) 1.12 3.34 .13
SOZ 1.21 (0.93) 1.12 1.61 (0.64) 1.73 5.24 * .19
SPEZ 0.53 (0.61) 0.47 0.70 (0.63) 0.77 2.54 .10
ANG 0.69 (0.59) 0.64 0.94 (0.36) 1.02 6.45 * .23
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a Mittelwerte wurden an Prätest-Unterschiede angepasst; b Daten des ersten Messzeitpunkts dienten als Kovariate; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p einge-teilt nach Cohen (1988): 2
p = .01 (schwacher Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
Im Elternurteil zur Angstsymptomatik ergibt sich zum zweiten Messzeitpunkt ein signifi-
kanter Haupteffekt „Gruppenzugehörigkeit“ für die Skala „Soziale Phobie“ und für die
Gesamtskala „Angststörungen“ (vgl. Abbildung 4). Unter Berücksichtigung der vor dem
Training bestehenden Gruppenunterschiede weisen die Kinder der Interventionsgruppe
unmittelbar nach dem Training auf beiden Skalen signifikant niedrigere Werte auf als die
Kinder der Wartekontrollgruppe. Diese Gruppenunterschiede erreichen das Ausmaß
großer Effekte. Für die Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und „Spezifische
Phobie“ ergibt sich bei der kovarianzanalytischen Auswertung kein signifikanter Haupt-
effekt „Gruppenzugehörigkeit“, d. h. die Skalenmittelwerte der beiden Gruppen unter-
scheiden sich zum zweiten Messzeitpunkt nicht signifikant voneinander. Die Effektstärken
für diese Gruppenunterschiede erreichen dennoch ein mittleres Ausmaß.
Mit den zusätzlich durchgeführten Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen wurden die Ergebnisse der univariaten Kovarianzanalysen weitgehend bestätigt
(vgl. Anhang 3). Allerdings weisen die Kinder der Interventionsgruppe hier zum zweiten
Messzeitpunkt nicht nur auf der Skala „Soziale Phobie“ und auf der Gesamtskala
„Angststörungen“, sondern auch auf den Skalen „Trennungsangst“ und „Spezifische Pho-
bie“ signifikant niedrigere Werte auf als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Dabei werden
für die Skalen „Trennungsangst“ und „Spezifische Phobie“ mittlere Effekte, für die Skala
„Soziale Phobie“ und für die Gesamtskala „Angststörungen“ große Effekte erzielt. Auf der
6 Ergebnisse 133
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Prätest Posttest
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Interventionsgruppe
Wartekontrollgruppe
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Prätest Posttest
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Interventionsgruppe
Wartekontrollgruppe
Abbildung 4: Mittelwerte der Angstsymptomatik im Elternurteil vor und nach dem Trai-ning auf der Skala „Soziale Phobie“ (links) und auf der Gesamtskala „Angststörungen“ (rechts) des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Skala „Generalisierte Angst“ lässt sich mit beiden statistischen Verfahren kein signifikanter
Unterschied zwischen den Gruppen feststellen.
Für die Interpretation der Skalenmittelwerte des FBB-ANG werden die von Döpfner und
Kollegen (2008) in Form von Prozenträngen veröffentlichten DISYPS-II-Normen heran-
gezogen. Die Autoren schlagen vor, Prozentrangwerte unter 90 als unauffällig, zwischen 90
und 96 als klinisch auffällig und über 96 als klinisch sehr auffällig zu bewerten. Ein Ver-
gleich mit diesen Normwerten zeigt, dass die Mittelwerte beider Gruppen auf den Skalen
„Generalisierte Angst“, „Soziale Phobie“ und „Spezifische Phobie“ zum ersten Messzeit-
punkt (Prätest) im auffälligen bis sehr auffälligen Bereich liegen. Zum zweiten Messzeit-
punkt (Posttest) haben sich die Mittelwerte auf diesen Skalen in der Interventionsgruppe
(teilweise signifikant) reduziert, befinden sich aber noch im auffälligen Bereich bzw. im
Grenzbereich zwischen unauffälligen und auffälligen Werten. Die Skalenmittelwerte der
Wartekontrollgruppe wurden zum zweiten Messzeitpunkt wiederholt als auffällig bis sehr
auffällig eingestuft. Die Mittelwerte auf der Skala „Trennungsangst“ liegen vor dem Trai-
ning (1. Messzeitpunkt) für beide Gruppen im Grenzbereich zwischen unauffälligen und
auffälligen Werten; sie haben sich unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) so
weit reduziert, dass sie für beide Gruppen im unauffälligen Bereich liegen. Darüber hinaus
deuten die DISYPS-II-Normen bereits an, dass vor dem Training auch die Mittelwerte auf
6 Ergebnisse 134
der Gesamtskala „Angststörungen“ bei beiden Gruppen im sehr auffälligen Bereich liegen.
Während sich die Angstsymptomatik in der Interventionsgruppe durch die Trainingsteil-
nahme signifikant reduziert und einen Skalenmittelwert im Grenzbereich zwischen unauf-
fälligen und auffälligen Werten erreicht, liegt der Skalenmittelwert der Wartekontrollgruppe
auch zum zweiten Messzeitpunkt noch im auffälligen bis sehr auffälligen Bereich. Eine
Übersicht über die Veränderung der klinischen Auffälligkeit innerhalb der beiden Gruppen
zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt kann Anhang 4 entnommen werden.
Bezüglich der Verwendung der Normen geben Döpfner und Kollegen (2008) zu bedenken,
dass die Normwerte bei einigen Selbst- und Fremdbeurteilungsbogen in bestimmten
Altersgruppen extrem schief verteilt sind, so dass bereits bei geringen Skalenmittelwerten
hohe Prozentrangwerte erzielt und damit die Angaben der Beurteiler als auffällig einge-
schätzt werden. Somit können diese Normwerte nur orientierende Bewertungshilfen sein.
Eine weitere Einschränkung erfährt die Anwendung der Normen in der vorliegenden
Arbeit dadurch, dass der Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen und dadurch auch die
Gesamtskala „Angststörungen“ um zwei Items des Störungsbereichs Zwangsstörungen
ergänzt wurde. Da sich die DISYPS-II-Normen auf die veränderte Gesamtskala „Angst-
und Zwangsstörungen“ beziehen, sind sie hier nur eingeschränkt aussagekräftig.
In der Interventionsgruppe gaben vor dem Training 28.6 % der Eltern an, dass ihre Kinder
gar nicht oder nur ein wenig unter den von ihnen beschriebenen Problemen leiden würden,
während 71.4 % der Eltern erklärten, dass ihre Kinder ziemlich oder sehr leiden würden. In
der Wartekontrollgruppe teilten die Eltern dagegen mit, dass 63.6 % ihrer Kinder gar nicht
oder nur ein wenig und 36.4 % ihrer Kinder ziemlich oder sehr unter den genannten Prob-
lemen leiden würden. Während sich der Leidensdruck der Kontrollgruppenkinder in der
Wartezeit nicht veränderte (2. Messzeitpunkt: 63.6 % gar nicht oder ein wenig; 36.4 %
ziemlich oder sehr), verringerte sich der Leidensdruck der Kinder in der Interventions-
gruppe deutlich: Unmittelbar nach dem Training teilten 78.6 % der Eltern mit, dass ihre
Kinder gar nicht mehr oder nur noch ein wenig unter den ursprünglichen Problemen lei-
den würden, während 21.4 % der Eltern angaben, dass ihre Kinder immer noch ziemlich
oder sehr leiden würden.
In der Interventionsgruppe waren die Beziehungen zu anderen Menschen und/oder die
schulische Leistungsfähigkeit – laut Elternurteil – vor dem Training bei 14.3 % der Kinder
gar nicht oder nur ein wenig und bei 85.7 % der Kinder ziemlich oder sehr beeinträchtigt.
6 Ergebnisse 135
In der Wartekontrollgruppe wurden 27.3 % der Kinder von ihren Eltern als gar nicht oder
ein wenig und 72.7 % der Kinder als ziemlich oder sehr beeinträchtigt beurteilt. Unmittel-
bar nach dem Training waren die Beziehungs- und Leistungsfähigkeit in der Interventions-
gruppe bei 64.3 % der Kinder gar nicht mehr oder nur noch ein wenig, bei 35.7 % der
Kinder immer noch ziemlich oder sehr beeinträchtigt. Aber auch in der Wartekontroll-
gruppe (ohne Training) verbesserten sich während der Wartezeit die Beziehungen zu ande-
ren Menschen und/oder die schulische Leistungsfähigkeit geringfügig (2. Messzeitpunkt:
54.5 % gar nicht oder ein wenig; 45.5 % ziemlich oder sehr).
Depressive Symptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Elternurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) sind getrennt für den ersten und
zweiten Messzeitpunkt sowie für die Interventionsgruppe und die Wartekontrollgruppe in
Tabelle 26 dargestellt. Aus dieser Tabelle wird bereits ersichtlich, dass sich die Werte der
Interventionsgruppe (mit Training) auf den Skalen des FBB-DES zwischen dem ersten und
zweiten Messzeitpunkt leicht verbessern; eine vergleichbare Verbesserung der Werte zeigt
sich allerdings auch in der Wartekontrollgruppe (ohne Training).
Tabelle 26: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störun-gen (FBB-DES)
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
Eltern M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-DES (n = 14) (n = 11) (n = 14) (n = 11)
DEP 0.74 (0.45) 0.83 (0.29) 0.46 (0.52) 0.62 (0.27)
SOM 0.64 (0.52) 0.48 (0.28) 0.40 (0.48) 0.40 (0.28)
DYS 0.85 (0.61) 0.94 (0.39) 0.59 (0.73) 0.75 (0.37)
DYST 0.90 (0.59) 0.98 (0.36) 0.55 (0.62) 0.72 (0.29)
DES 0.74 (0.47) 0.84 (0.35) 0.49 (0.56) 0.64 (0.30)
Anmerkungen: DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen.
Zwischen Interventionsgruppe und Wartekontrollgruppe bestehende Unterschiede wurden
anhand univariater, einfaktorieller Kovarianzanalysen mit dem Faktor „Gruppenzugehörig-
keit“ und den Prätestwerten als Kovariaten überprüft (vgl. Tabelle 27).
6 Ergebnisse 136
Tabelle 27: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe ANCOVA b
Eltern M (SD) M (adjust.) a M (SD) M (adjust.) a F 2p
FBB-DES (n = 14) (n = 11)
DEP 0.46 (0.52) 0.49 0.62 (0.27) 0.58 0.55 .03
SOM 0.40 (0.48) 0.36 0.40 (0.28) 0.45 0.41 .02
DYS 0.59 (0.73) 0.63 0.75 (0.37) 0.70 0.19 .01
DYST 0.55 (0.62) 0.57 0.72 (0.29) 0.69 0.68 .03
DES 0.49 (0.56) 0.53 0.64 (0.30) 0.60 0.30 .01
Anmerkungen: DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen; a Mittelwerte wurden an Prätest-Unterschiede angepasst; b Daten des ersten Messzeitpunkts dienten als Kovariate; * p < .05; ** p < .01;
Effektstärke 2p eingeteilt nach Cohen (1988): 2
p = .01 (schwacher Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
Im Elternurteil zur komorbiden depressiven Symptomatik ergibt sich zum zweiten Mess-
zeitpunkt kein signifikanter Haupteffekt „Gruppenzugehörigkeit“, weder für die vier Skalen
„Depressive Symptome“, „Somatisches Syndrom“, „Dysthymia“ und „Dysthyme Störung“
noch für die Gesamtskala „Depressive Störungen“. Die Skalenmittelwerte der beiden
Gruppen unterscheiden sich unmittelbar nach dem Training nicht signifikant voneinander.
Die Effektstärken liegen für alle Skalen im niedrigen Bereich.
Mit den zusätzlich durchgeführten Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen wurden die Ergebnisse der univariaten Kovarianzanalysen ausnahmslos bestätigt
(vgl. Anhang 3). Auch die Ergebnisse der Mann-Whitney-U-Tests zeigen, dass sich die bei-
den Gruppen hinsichtlich ihrer komorbiden depressiven Symptomatik zum zweiten Mess-
zeitpunkt auf keiner Skala des FBB-DES signifikant voneinander unterscheiden.
6.1.3 Trainingseffekte im Lehrerurteil
Um Aussagen zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Lehrer treffen zu
können, wurde überprüft, ob die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training (2. Messzeitpunkt) im Lehrerurteil einerseits eine stärkere Reduktion der Angst-
symptomatik (Hypothese 1a) und andererseits eine stärkere Verbesserung des schulbezo-
6 Ergebnisse 137
genen Sozialverhaltens (Hypothese 1c) aufweisen als die Kinder der Wartekontrollgruppe.
Zur Erfassung der Angstsymptomatik aus Sicht der Lehrer wurde der Fremdbeurteilungsbogen
Angststörungen (FBB-ANG) aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und
Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) eingesetzt.
Für die folgenden Analysen konnten nur die Skalen „Generalisierte Angst“ und „Soziale
Phobie“ berücksichtigt werden, weil viele Lehrer zu den Störungsbereichen „Trennungs-
angst“ und „Spezifische Phobie“ keine Auskünfte geben konnten. Zudem wurde nur die
von den Lehrern vorgenommene Einschätzung des Schweregrades berichtet. Auf die Ein-
schätzung der Problemstärke wurde verzichtet, weil die Einschätzungen von Schweregrad
und Problemstärke in der vorliegenden Arbeit sehr hohe Korrelationen aufweisen (vgl.
Anhang 2). Zur Beurteilung des schulbezogenen Sozialverhaltens wurde die Lehrereinschätz-
liste für Sozial- und Lernverhalten (LSL; Petermann & Petermann, 2006a) verwendet. Ein Kind
der Interventionsgruppe und zwei Kinder der Wartekontrollgruppe mussten aus den nach-
folgenden Analysen ausgeschlossen werden, weil von ihren Klassenlehrern für einen Mess-
zeitpunkt keine ausgefüllten Fragebogen vorlagen.
Angstsymptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Lehrerurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) sind getrennt für den ersten und zweiten
Messzeitpunkt sowie für die Interventionsgruppe und die Wartekontrollgruppe in Tabelle
28 dargestellt. Bei genauerer Betrachtung lässt sich bereits deskriptiv feststellen, dass sich
die Werte der Interventionsgruppe (mit Training) auf den Skalen des FBB-ANG zwischen
dem ersten und zweiten Messzeitpunkt verringern; allerdings vermindern sich die Werte
der Wartekontrollgruppe (ohne Training) in vergleichbarem Ausmaß.
Tabelle 28: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 13) (n = 9) (n = 13) (n = 9)
GEN 0.97 (0.64) 0.82 (0.40) 0.71 (0.54) 0.52 (0.50)
SOZ 1.25 (0.76) 1.03 (0.81) 1.00 (0.51) 0.83 (0.71)
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie.
6 Ergebnisse 138
Zwischen den beiden Gruppen bestehende Unterschiede wurden anhand von univariaten,
einfaktoriellen Kovarianzanalysen mit dem Faktor „Gruppenzugehörigkeit“ und den Prä-
testwerten als Kovariaten überprüft (vgl. Tabelle 29). Im Lehrerurteil zur Angstsympto-
matik ergibt sich zum zweiten Messzeitpunkt für die Skalen „Generalisierte Angst“ und
„Soziale Phobie“ kein signifikanter Haupteffekt „Gruppenzugehörigkeit“. Werden vor dem
Training bestehende Unterschiede zwischen den Skalenmittelwerten der Interventions-
gruppe und der Wartekontrollgruppe berücksichtigt, unterscheiden sich die beiden Grup-
pen unmittelbar nach dem Training hinsichtlich ihrer Angstsymptomatik nicht signifikant
voneinander. Demzufolge fallen auch die Effektstärken unbedeutend aus.
Tabelle 29: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrerurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe ANCOVA b
Lehrer M (SD) M (adjust.) a M (SD) M (adjust.) a F 2p
FBB-ANG (n = 13) (n = 9)
GEN 0.71 (0.54) 0.66 0.52 (0.50) 0.59 0.24 .01
SOZ 1.00 (0.51) 0.95 0.83 (0.71) 0.90 0.08 .00
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; a Mittelwerte wurden an Prätest-Unterschiede angepasst; b Daten des ersten Messzeitpunkts dienten als Kovariate; * p < .05; ** p < .01; Effekt-stärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2p = .14
(starker Effekt).
Mit den zusätzlich durchgeführten Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen wurden die Ergebnisse der univariaten Kovarianzanalysen bestätigt. Im Urteil der
Lehrer unterschieden sich die Werte der Interventionsgruppe und der Wartekontrollgruppe
zum zweiten Messzeitpunkt weder auf der Skala „Generalisierte Angst“ (z = -0.60, n. s.)
noch auf der Skala „Soziale Phobie“ (z = -0.27, n. s.) signifikant voneinander.
Da der Fremdbeurteilungsbogen Angst- und Zwangsstörungen (FBB-ANZ) aus dem
DISYPS-II (Döpfner et al., 2008) für Lehrer noch nicht normiert wurde, stehen für die
Interpretation der Skalenmittelwerte des FBB-ANG an dieser Stelle keine Normen zur
Verfügung. Als orientierende Bewertungshilfe schlagen Döpfner und Kollegen (2008) vor,
Skalenmittelwerte zwischen 0.00 und 0.49 als unauffällig, zwischen 0.50 und 0.99 als leicht
auffällig, zwischen 1.00 und 1.49 als auffällig und über 1.49 als sehr auffällig zu bewerten.
Ein Vergleich mit diesen Interpretationshinweisen zeigt, dass die Mittelwerte beider
6 Ergebnisse 139
Gruppen vor dem Training (1. Messzeitpunkt) auf der Skala „Generalisierte Angst“ im
leicht auffälligen Bereich und auf der Skala „Soziale Phobie“ im auffälligen Bereich liegen.
Unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) haben sich die Skalenmittelwerte beider
Gruppen reduziert, befinden sich auf der Skala „Generalisierte Angst“ noch im leicht auf-
fälligen Bereich, haben aber auch auf der Skala „Soziale Phobie“ den leicht auffälligen Be-
reich erreicht.
Schulbezogenes Sozialverhalten
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Lehrerurteils auf den sechs Skalen des
Aussagenbereichs „Sozialverhalten“ der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
(LSL) sind getrennt für den ersten und zweiten Messzeitpunkt sowie für die Interventions-
gruppe und die Wartekontrollgruppe in Tabelle 30 dargestellt.
Tabelle 30: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
LSL (n = 13) (n = 9) (n = 13) (n = 9)
KOOP 10.54 (2.99) 9.44 (4.22) 11.00 (3.06) 11.67 (2.69)
WAHR 9.15 (2.51) 8.89 (3.33) 9.92 (2.66) 10.56 (3.58)
KONT 10.54 (2.33) 9.56 (4.42) 9.54 (3.46) 10.67 (4.58)
HILF 7.38 (3.69) 9.78 (3.90) 8.77 (3.19) 10.56 (3.84)
BEHA 9.15 (3.24) 9.33 (4.53) 10.77 (3.83) 10.56 (3.50)
SOZI 7.85 (2.85) 8.33 (3.64) 9.31 (2.32) 9.56 (3.94)
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt.
Auf fast allen Skalen der LSL zeigt sich zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt
deskriptiv ein geringfügiger Anstieg der Werte in der Interventionsgruppe (mit Training);
allerdings findet sich eine vergleichbare Zunahme der Werte auch in der Wartekontroll-
gruppe (ohne Training). Zwischen den beiden Gruppen bestehende Unterschiede wurden
anhand von univariaten, einfaktoriellen Kovarianzanalysen mit dem Faktor „Gruppen-
zugehörigkeit“ und den Prätestwerten als Kovariaten überprüft (vgl. Tabelle 31).
6 Ergebnisse 140
Tabelle 31: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kovarianzanalysen auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe ANCOVA b
Lehrer M (SD) M (adjust.) a M (SD) M (adjust.) a F 2p
LSL (n = 13) (n = 9)
KOOP 11.00 (3.06) 10.85 11.67 (2.69) 11.88 0.73 .04
WAHR 9.92 (2.66) 9.85 10.56 (3.58) 10.67 0.67 .03
KONT 9.54 (3.46) 9.23 10.67 (4.58) 11.11 1.88 .09
HILF 8.77 (3.19) 9.36 10.56 (3.84) 9.71 0.08 .00
BEHA 10.77 (3.83) 10.80 10.56 (3.50) 10.51 0.04 .00
SOZI 9.31 (2.32) 9.36 9.56 (3.94) 9.48 0.01 .00
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; a Mittelwerte wurden an Prätest-Unterschiede angepasst; b Daten des ersten Messzeitpunkts dienten als Kova-riate; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
Im Lehrerurteil zum schulbezogenen Sozialverhalten lässt sich zum zweiten Messzeitpunkt
kein signifikanter Haupteffekt „Gruppenzugehörigkeit“ für die LSL-Skalen „Kooperation“,
„Selbstwahrnehmung“, „Selbstkontrolle“, „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“,
„Angemessene Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ feststellen (vgl. Tabelle 31). Wer-
den die vor dem Training (1. Messzeitpunkt) bestehenden Unterschiede zwischen der
Interventionsgruppe und der Wartekontrollgruppe berücksichtigt, unterscheiden sich die
beiden Gruppen unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) hinsichtlich ihres Sozi-
alverhaltens in der Schule nicht signifikant voneinander. Die Effektstärken für den Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen liegen überwiegend im geringfügigen Bereich.
Mit den zusätzlich durchgeführten Mann-Whitney-U-Tests auf der Basis standardisierter
Residuen wurden die Ergebnisse der univariaten Kovarianzanalysen weitgehend bestätigt
(vgl. Anhang 5). Auch hier lässt sich im Urteil der Lehrer auf den Skalen „Kooperation“,
„Selbstwahrnehmung“, „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“, „Angemessene
Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ zum zweiten Messzeitpunkt kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Gruppen finden. Lediglich auf der Skala „Selbst-
kontrolle“ weisen die Kinder der Wartekontrollgruppe unmittelbar nach dem Training
signifikant höhere Werte auf als die Kinder der Interventionsgruppe (vgl. Abbildung 5). Für
diese Skala wurde ein mittlerer Effekt erzielt.
6 Ergebnisse 141
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
Prätest Posttest
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Interventionsgruppe
Wartekontrollgruppe
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
Prätest Posttest
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Interventionsgruppe
Wartekontrollgruppe
Abbildung 5: Mittelwerte des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil vor und nach dem Training auf den Skalen „Kooperation“ (links) und „Selbstkontrolle“ (rechts) der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Für die Interpretation der Skalenwerte des LSL wurden die von Petermann und Petermann
(2006a) veröffentlichten Prozentrang-Normen herangezogen. Die Autoren schlagen vor,
Prozentrangwerte unter 10 als auffällig, zwischen 10 und 20 als grenzwertig und über 20 als
unauffällig zu bewerten. Ein Vergleich mit diesen Normwerten zeigt, dass zum ersten
Messzeitpunkt die Mittelwerte auf den Skalen „Kooperation“, „Selbstwahrnehmung“ und
„Selbstbehauptung“ in der Interventionsgruppe im unauffälligen Bereich und in der Warte-
kontrollgruppe im unauffälligen bis grenzwertigen Bereich liegen. Zum zweiten Messzeit-
punkt haben sich die Mittelwerte auf diesen Skalen erhöht und befinden sich jetzt für beide
Gruppen im unauffälligen Bereich. Auf der Skala „Selbstkontrolle“ sind die Mittelwerte
beider Gruppen sowohl vor dem Training (1. Messzeitpunkt) als auch unmittelbar nach
dem Training (2. Messzeitpunkt) unauffällig ausgeprägt. Die Mittelwerte auf den Skalen
„Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“ und „Sozialkontakt“ liegen zum ersten
Messzeitpunkt in der Interventionsgruppe im grenzwertigen bis auffälligen Bereich, in der
Wartekontrollgruppe im unauffälligen bis grenzwertigen Bereich. Unmittelbar nach dem
Training haben die Skalenmittelwerte beider Gruppen zugenommen; sie befinden sich jetzt
auf der Skala „Sozialkontakt“ immer noch im grenzwertigen (IG) bzw. unauffälligen bis
grenzwertigen (KG) Bereich, haben aber auf der Skala „Einfühlungsvermögen und Hilfs-
bereitschaft“ eine unauffällige bis grenzwertige (IG) bzw. unauffällige (KG) Ausprägung
angenommen. Eine detaillierte Übersicht über die Veränderung der Auffälligkeit des Sozial-
6 Ergebnisse 142
verhaltens innerhalb der beiden Gruppen zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt
kann Anhang 6 entnommen werden.
6 Ergebnisse 143
6.2 Langfristige Wirksamkeit des Trainings
6.2.1 Trainingseffekte im Kinderurteil
Um Aussagen über die langfristige Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Kinder machen
zu können, wurde nachfolgend überprüft, ob die durch das Training erzielte Reduktion der
Angstsymptomatik im Urteil der Kinder über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil
bleibt. Es wird angenommen, dass sich die Angstsymptomatik der Kinder in den sechs
Monaten nach dem Training nicht verändert (Hypothese 2a). Zur Erfassung der Angst-
symptomatik aus Sicht der Kinder wurde die deutsche Version der Social Anxiety Scale for
Children – Revised (SASC-R-D; Melfsen, 1998) eingesetzt. Im Folgenden werden nur die
Ergebnisse der Interventionsgruppe dargestellt; die Ergebnisse der Wartekontrollgruppe
können dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang 7 für Mittelwerte und Standardab-
weichungen, Anhang 8 für Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung).
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Kinderurteils auf den SASC-R-D-Skalen
für die drei Messzeitpunkte der Interventionsgruppe sind in Tabelle 32 wiedergegeben.
Tabelle 32: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt
Kinder M (SD) M (SD) M (SD)
SASC-R-D (n = 14) (n = 14) (n = 14)
FNE 21.64 (7.51) 20.57 (7.55) 18.36 (4.05)
SAD 25.57 (5.10) 22.50 (4.93) 19.36 (5.30)
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen.
Auf den Skalen der SASC-R-D lässt sich deskriptiv eine leichte, aber kontinuierliche
Verringerung der Mittelwerte in der Interventionsgruppe feststellen, und zwar sowohl zwi-
schen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt als auch zwischen dem zweiten und dritten
Messzeitpunkt (vgl. Abbildung 6).
6 Ergebnisse 144
Abbildung 6: Verlauf der Mittelwerte im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe
Über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg auftretende Veränderungen innerhalb der
Interventionsgruppe wurden mit univariaten Varianzanalysen mit Messwiederholung auf
dem Faktor „Zeit“ überprüft (vgl. Tabelle 33).
Tabelle 33: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Interventionsgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t1 t2 t1
Kinder F df p 2p p a p b p a
SASC-R-D (n = 14) (n = 14) (n = 14) (n = 14)
FNE 1.21 2, 26 .31 .09 .50 .83 .19
SAD 9.58 2, 26 .00 ** .43 .12 .05 * .00 **
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; 2
p = .01 (kleiner Effekt); Effekt-stärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2p = .14
(starker Effekt).
Während für die Skala „Furcht vor negativer Bewertung“ (FNE) keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den drei Messzeitpunkten festgestellt wurden, wurde für die Skala „Ver-
meidung von und Belastung durch soziale Situationen“ (SAD) ein signifikanter Haupteffekt
„Zeit“ erzielt. Die anschließenden Einzelvergleiche zeigten, dass sich die Mittelwerte der
Interventionsgruppe auf allen Skalen der SASC-R-D zwischen Prätest (1. Messzeitpunkt)
0
5
10
15
20
25
30
Prätest Posttest Follow up
Skal
ensu
mm
enw
ert
Messzeitpunkte
Furcht vor negativer Bewertung (FNE)
Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen (SAD)
6 Ergebnisse 145
und Posttest (2. Messzeitpunkt) nicht signifikant verbesserten. Auf der SAD-Skala redu-
zierten sich die Mittelwerte sowohl zwischen Posttest und Follow up (3. Messzeitpunkt) als
auch zwischen Prätest und Follow up signifikant. Die Effektstärken liegen für die Skala
FNE im mittleren Bereich und für die Skala SAD im hohen Bereich.
Mit den zusätzlich durchgeführten Wilcoxon-Tests wurden die Ergebnisse der univariaten
Varianzanalysen mit Messwiederholung weitestgehend bestätigt. Im Selbsturteil der Kinder
veränderte sich die Angstsymptomatik zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt
auch hier auf der Skala FNE (z = -0.67; n. s.) nicht signifikant. Dagegen verringerte sich die
Angstsymptomatik auf der Skala SAD signifikant (z = -2.36; p < .01). Zwischen dem zwei-
ten und dritten Messzeitpunkt veränderte sich die Angstsymptomatik auf der Skala FNE
nicht signifikant; sie blieb über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil (z = -0.66; n. s.).
Auf der Skala SAD beurteilten die Kinder ihre Angstsymptomatik sechs Monate nach dem
Training (3. Messzeitpunkt) hingegen als signifikant geringer als unmittelbar nach dem
Training (2. Messzeitpunkt) (z = -2.95; p < .01). Die Effektstärke für den Vergleich zwi-
schen diesen beiden Messzeitpunkten ist als mittelstark (d' = 0.67) einzuschätzen. Während
sich die Veränderungen in der Angstsymptomatik zwischen dem ersten und dritten Mess-
zeitpunkt im Selbsturteil der Kinder auf der Skala FNE als nicht signifikant herausstellten
(z = -1.35; n. s.), reduzierte sich die Angstsymptomatik der Kinder auf der Skala SAD in
signifikantem Maße (z = -2.83; p < .01). Der für die Skala SAD ermittelte Effekt (d’ = 1.00)
ist als stark einzuschätzen.
Für die Interpretation der Skalenwerte der SASC-R-D sei an dieser Stelle nochmals auf die
Validierungsstudie von Melfsen (1999) hingewiesen. Demzufolge lassen sich die Werte der
Interventionsgruppe auf der Skala „Furcht vor negativer Bewertung“ (FNE) vor dem Trai-
ning am ehesten mit den Werten einer Gruppe mit subklinischen sozialen Ängsten (M =
23.42) vergleichen. Unmittelbar nach dem Training liegen die Werte der Interventions-
gruppe – verglichen mit der Validierungsstichprobe – zwischen den Werten der Gruppe
mit subklinischen Ängsten und einer Kontrollgruppe (M = 15.92). Sechs Monate nach dem
Training lassen sich die Werte der Interventionsgruppe am ehesten mit den Werten der
Kontrollgruppe vergleichen. Auf der Skala „Vermeidung von und Belastung durch soziale
Situationen“ (SAD) sind die Werte der Interventionsgruppe vor dem Training mit den
Werten einer Gruppe mit klinischen sozialen Ängsten (M = 25.72) aus der Validierungs-
stichprobe vergleichbar. Zu beiden Messzeitpunkten nach dem Training liegen die Werte
6 Ergebnisse 146
der Interventionsgruppe zwischen den Werten einer Gruppe mit subklinischen sozialen
Ängsten (M = 24.99) und einer Kontrollgruppe (M = 6.92).
Die Anwendung der Normen für die deutsche Version der SASC-R-D (Melfsen, 1998)
zeigt, dass die Angstsymptomatik vieler Kinder der Interventionsgruppe bereits vor dem
Training als unauffällig eingestuft wird (FNE: 85.7 %; SAD: 64.3 %). Im Selbsturteil weisen
nur wenige Kinder vor dem Training leicht (FNE: 0.0 %; SAD: 7.1 %) oder deutliche auf-
fällige Ängste auf (FNE: 14.3 %; SAD: 28.6 %). Dennoch ist zu erkennen, dass sich das
Angsterleben der zuvor als auffällig eingestuften Kinder unmittelbar nach dem Training
verringert hat (FNE: 85.7 % unauffällig, 7.1 % leicht auffällig, 7.1 % deutlich auffällig;
SAD: 78.6 % unauffällig, 14.3 % leicht auffällig, 7.1 % deutlich auffällig). Sechs Monate
nach dem Training gilt die überwiegende Mehrheit der Kinder hinsichtlich ihrer Angst-
symptomatik als unauffällig (FNE: 92.9%; SAD: 92.9 %), nur wenige Kinder berichten
noch leichte Auffälligkeiten (FNE: 7.1 %; SAD: 7.1 %).
6.2.2 Trainingseffekte im Elternurteil
Um Aussagen über die langfristige Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Eltern machen
zu können, wurde nachfolgend überprüft, ob die durch das Training erzielte Reduktion der
ängstlichen und der depressiven Symptomatik im Urteil der Eltern über einen Zeitraum
von sechs Monaten stabil bleibt. Es wird angenommen, dass sich die ängstliche und die
depressive Symptomatik der Kinder in den sechs Monaten nach dem Training nicht verän-
dert (Hypothesen 2a, 2b). Zur Erfassung der Angstsymptomatik aus Sicht der Eltern wurde
der Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG), zur Erfassung der depressiven
Symptomatik aus Sicht der Eltern der Fremdbeurteilungsbogen Depressive Störungen (FBB-DES)
aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und
DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) eingesetzt. Im Folgenden werden nur
die Ergebnisse der Interventionsgruppe dargestellt; die Ergebnisse der Wartekontrollgrup-
pe können dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang 9 für Mittelwerte und Standard-
abweichungen, Anhang 10 für Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung).
6 Ergebnisse 147
Angstsymptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Elternurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Angststörungen sind für die drei Messzeitpunkte der Interventions-
gruppe in Tabelle 34 dargestellt.
Tabelle 34: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt
Eltern M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 14) (n = 14) (n = 14)
TREN 0.69 (0.66) 0.34 (0.60) 0.31 (0.41)
GEN 1.27 (0.75) 0.84 (0.81) 0.76 (0.63)
SOZ 1.96 (0.82) 1.21 (0.93) 0.88 (0.66)
SPEZ 0.81 (0.74) 0.53 (0.61) 0.49 (0.63)
ANG 1.13 (0.49) 0.69 (0.59) 0.58 (0.48)
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen.
Bei genauerer Betrachtung lässt sich deskriptiv feststellen, dass sich die Werte der Interven-
tionsgruppe zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt auf allen Skalen des FBB-
ANG deutlich verringern. Zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt bleiben die
Werte der Interventionsgruppe auf allen Skalen stabil bzw. nehmen auf der Skala „Soziale
Phobie“ sogar weiter ab (vgl. auch Abbildung 7).
Um über verschiedene Messzeitpunkte hinweg auftretende Veränderungen innerhalb der
Interventionsgruppe statistisch absichern zu können, wurden univariate Varianzanalysen
mit Messwiederholung auf dem Faktor „Messzeitpunkt“ durchgeführt (vgl. Tabelle 35).
Sowohl für die Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und „Soziale Phobie“ als
auch für die Gesamtskala „Angststörungen“ wurde ein signifikanter Haupteffekt „Mess-
zeitpunkt“ erzielt. Nur für die Skala „Spezifische Phobie“ wurde kein signifikanter Unter-
schied zwischen den drei Messzeitpunkten festgestellt. Für alle signifikanten Skalen wurden
große Effekte ermittelt. Die anschließenden Einzelvergleiche zeigten, dass sich die Werte
der Interventionsgruppe auf den Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und
„Soziale Phobie“ sowie auf der Gesamtskala „Angststörungen“ einerseits zwischen dem
6 Ergebnisse 148
ersten (Prätest) und zweiten Messzeitpunkt (Posttest) signifikant reduzierten, andererseits
zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt (Follow up) stabil blieben. Auch im lang-
fristigen Verlauf zwischen dem ersten und dritten Messzeitpunkt ließ sich auf diesen Skalen
eine signifikante Verringerung der Werte nachweisen.
Abbildung 7: Verlauf der Mittelwerte im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
Tabelle 35: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t1 t2 t1
Eltern F df p 2p p a p b p a
FBB-ANG (n = 14) (n = 14) (n = 14) (n = 14)
TREN 6.95 2, 26 .00 ** .35 .03 * 1.00 .01 **
GEN 11.59 2, 26 .00 ** .47 .01 ** 1.00 .00 ***
SOZ 21.71 2, 26 .00 ** .63 .00 ** .16 .00 ***
SPEZ 2.64 2, 26 .90 .17 .17 1.00 .13
ANG 19.10 2, 26 .00 ** .60 .00 ** .69 .00 ***
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt);
2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Prätest Posttest Follow up
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Trennungsangst Generalisierte Angst
Soziale Phobie Spezifische Phobie
Gesamtskala Angststörungen
6 Ergebnisse 149
Mit den zusätzlich durchgeführten Wilcoxon-Tests wurden die Ergebnisse der univariaten
Varianzanalysen mit Messwiederholung weitgehend bestätigt (vgl. Anhang 11). Im Urteil
der Eltern veränderte sich die Angstsymptomatik der Kinder zwischen dem ersten und
zweiten Messzeitpunkt sogar auf allen Skalen des FBB-ANG signifikant. Dabei wurden für
alle Skalen mittlere bis große Effekte ermittelt. Zwischen dem zweiten und dritten Mess-
zeitpunkt veränderte sich die Angstsymptomatik auf vier von fünf Skalen (TREN, GEN,
SPEZ, ANG) nicht signifikant; sie blieb über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil. Im
Unterschied zur varianzanalytischen Auswertung reduzierte sich die Angstsymptomatik
jedoch auf der Skala „Soziale Phobie“ zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt
signifikant; d. h. die Angstsymptomatik verbesserte sich auch nach der Teilnahme am Trai-
ning weiter. Für den Vergleich zwischen diesen beiden Messzeitpunkten liegt die Effekt-
stärke im mittleren Bereich. Zwischen erstem und drittem Messzeitpunkt wurden im Urteil
der Eltern auf den Skalen des FBB-ANG signifikante Veränderungen in der Angstsymp-
tomatik festgestellt. Für die Skala „Spezifische Phobie“ wurde ein mittlerer Effekt ermittelt;
für alle anderen Skalen (TREN, GEN, SOZ, ANG) wurden starke Effekte erzielt.
Ein Vergleich mit den DISYPS-II-Normen (Döpfner et al., 2008) zeigt, dass die Mittel-
werte der Interventionsgruppe auf der Skala „Trennungsangst“ vor dem Training (1. Mess-
zeitpunkt) im Grenzbereich zwischen unauffälligen und auffälligen Werten liegen; sie
haben sich unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) so weit reduziert, dass sie im
unauffälligen Bereich liegen. Auch sechs Monate nach dem Training (3. Messzeitpunkt)
befinden sich die Werte auf der Skala „Trennungsangst“ nahezu unverändert im unauf-
fälligen Bereich. Die Mittelwerte auf den Skalen „Generalisierte Angst“, „Soziale Phobie“
und „Spezifische Phobie“ liegen zum ersten Messzeitpunkt im auffälligen bis sehr auf-
fälligen Bereich. Zum zweiten Messzeitpunkt haben sich die Mittelwerte auf diesen Skalen
(teilweise signifikant) reduziert, befinden sich aber immer noch im auffälligen Bereich bzw.
im Grenzbereich zwischen unauffälligen und auffälligen Werten. Zum dritten Messzeit-
punkt erreicht der Wert auf der Skala „Generalisierte Angst“ eine unauffällige Ausprägung;
auf den Skalen „Soziale Phobie“ und „Spezifische Phobie“ liegen die Werte noch im
Grenzbereich zwischen unauffälligen und auffälligen Werten. Darüber hinaus deuten die
DISYPS-II-Normen an, dass die Mittelwerte der Interventionsgruppe auf der Gesamtskala
„Angststörungen“ vor dem Training im sehr auffälligen Bereich liegen. Durch die
Trainingsteilnahme verringert sich die Angstsymptomatik der Kinder signifikant; der Mit-
telwert der Gesamtskala nimmt unmittelbar nach dem Training einen Wert im Grenz-
6 Ergebnisse 150
bereich zwischen unauffälligen und auffälligen Werten an. Und auch sechs Monate nach
dem Training liegt der Skalenmittelwert noch in diesem Grenzbereich. Eine detaillierte
Übersicht über die Veränderung der klinischen Auffälligkeit in der Interventionsgruppe
kann Anhang 12 entnommen werden.
In der Interventionsgruppe gaben vor dem Training 28.6 % der Eltern an, dass ihre Kinder
gar nicht oder nur ein wenig unter den von ihnen beschriebenen Problemen leiden würden,
während 71.4 % der Eltern erklärten, dass ihre Kinder ziemlich oder sehr leiden würden.
Unmittelbar nach dem Training hatte sich der Leidensdruck der Kinder deutlich verringert:
78.6 % der Eltern teilten mit, dass ihre Kinder gar nicht mehr oder nur noch ein wenig
unter den ursprünglichen Problemen leiden würden, während 21.4 % der Eltern angaben,
dass ihre Kinder immer noch ziemlich oder sehr leiden würden. In den sechs Monaten
nach dem Training veränderte sich der Leidensdruck der Kinder nicht mehr (3. Messzeit-
punkt: 78.6 % gar nicht oder ein wenig; 21.4 % ziemlich oder sehr).
In der Interventionsgruppe waren die Beziehungen zu anderen Menschen und/oder die
schulische Leistungsfähigkeit – laut Elternurteil – vor dem Training bei 14.3 % der Kinder
gar nicht oder nur ein wenig und bei 85.7 % der Kinder ziemlich oder sehr beeinträchtigt.
Unmittelbar nach dem Training waren die Beziehungs- und Leistungsfähigkeit bei 64.3 %
der Kinder gar nicht mehr oder nur noch ein wenig, bei 35.7 % der Kinder immer noch
ziemlich oder sehr beeinträchtigt. Sechs Monate nach dem Training hatte sich die Funk-
tionsfähigkeit der Kinder sogar noch weiter verbessert (3. Messzeitpunkt: 78.6 % gar nicht
oder ein wenig; 21.4 % ziemlich oder sehr).
Depressive Symptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Elternurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) sind für die drei Messzeitpunkte der
Interventionsgruppe in Tabelle 36 dargestellt. Auf allen Skalen des FBB-DES lässt sich in
der Interventionsgruppe deskriptiv eine leichte Verringerung der Mittelwerte zwischen dem
ersten und zweiten Messzeitpunkt feststellen. Zwischen dem zweiten und dritten Messzeit-
punkt bleiben die Werte der Interventionsgruppe auf den Skalen des FBB-DES stabil (vgl.
auch Abbildung 8).
6 Ergebnisse 151
Tabelle 36: Mittelwerte und Standardabweichungen der Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventionsgruppe
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt
Eltern M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-DES (n = 14) (n = 14) (n = 14)
DEP 0.74 (0.45) 0.46 (0.52) 0.44 (0.43)
SOM 0.64 (0.52) 0.40 (0.48) 0.32 (0.39)
DYS 0.85 (0.61) 0.59 (0.73) 0.47 (0.55)
DYST 0.90 (0.59) 0.55 (0.62) 0.52 (0.47)
DES 0.74 (0.47) 0.49 (0.56) 0.43 (0.45)
Anmerkungen: DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen.
Abbildung 8: Verlauf der Mittelwerte im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventionsgruppe
Es wurden univariate Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor „Messzeit-
punkt“ durchgeführt, um über verschiedene Messzeitpunkte hinweg auftretende Verände-
rungen innerhalb der Interventionsgruppe feststellen zu können (vgl. Tabelle 37). Sowohl
für die vier Skalen „Depressive Symptome“, „Somatisches Syndrom“, „Dysthymia“ und
„Dysthyme Störung“ als auch für die Gesamtskala „Depressive Störungen“ wurde ein
signifikanter Haupteffekt „Messzeitpunkt“ erzielt. Für alle Skalen des FBB-DES wurden im
Elternurteil große Effekte ermittelt.
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Prätest Posttest Follow up
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Depressive Symptome Somatisches Syndrom
Dysthymia (ICD-10) Dysthyme Störung (DSM-IV)
Gesamtskala Depressive Störungen
6 Ergebnisse 152
Die anschließenden Einzelvergleiche zeigten, dass sich die Werte der Interventionsgruppe
auf den Skalen „Depressive Symptome“ und „Dysthyme Störung“ sowie auf der Gesamt-
skala „Depressive Störungen“ zwischen Prätest und Posttest signifikant reduzierten. Auf
den Skalen „Somatisches Syndrom“ und „Dysthymia“ wurde das Signifikanzniveau zwar
verfehlt; dennoch ist ein statistischer Trend erkennbar. Zwischen Posttest und Follow up
blieben die Mittelwerte auf allen Skalen des FBB-DES stabil. Auch im langfristigen Verlauf
zwischen dem Prätest und Follow up verringerten sich die Skalenmittelwerte der Inter-
ventionsgruppe signifikant (vgl. Tabelle 37).
Tabelle 37: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Depressive Störungen (FBB-DES)
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t1 t2 t1
Eltern F df p 2p p a p b p a
FBB-DES (n = 14) (n = 14) (n = 14) (n = 14)
DEP 9.33 2, 26 .00 *** .42 .01 ** 1.00 .00 **
SOM 4.87 2, 26 .02 * .27 .09 .97 .03 *
DYS 7.17 2, 26 .00 ** .36 .09 .41 .00 **
DYST 9.99 2, 26 .00 *** .44 .01 ** 1.00 .00 ***
DES 8.57 2, 26 .00 *** .40 .03 * 1.00 .00 **
Anmerkungen: DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01
(schwacher Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
Mit den zusätzlich durchgeführten Wilcoxon-Tests wurden die Ergebnisse der univariaten
Varianzanalysen mit Messwiederholung weitestgehend bestätigt (vgl. Anhang 11). Aller-
dings reduzierte sich die depressive Symptomatik zwischen dem ersten und zweiten Mess-
zeitpunkt bei der Anwendung des nicht-parametrischen Verfahrens auch auf den Skalen
„Somatisches Syndrom“ und „Dysthymia“ signifikant. Für den Vergleich zwischen dem
ersten und zweiten Messzeitpunkt wurden teils mittlere, teils große Effekte, für den
Vergleich zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt überwiegend kleine Effekte
und für den Vergleich zwischen dem ersten und dritten Messzeitpunkt überwiegend große
Effekte erzielt.
6 Ergebnisse 153
6.2.3 Trainingseffekte im Lehrerurteil
Um Aussagen über die langfristige Wirksamkeit des Trainings aus Sicht der Lehrer machen
zu können, wurde nachfolgend überprüft, ob die durch das Training erzielte Reduktion der
Angstsymptomatik und Verbesserung des schulbezogenen Sozialverhaltens im Urteil der
Lehrer über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil bleibt. Es wird also angenommen,
dass sich die Angstsymptomatik der Kinder und das schulbezogene Sozialverhalten der
Kinder in den sechs Monaten nach dem Training nicht verändert (Hypothesen 2a, 2c). Zur
Erfassung der Angstsymptomatik aus Sicht der Lehrer wurde der Fremdbeurteilungsbogen
Angststörungen (FBB-ANG) aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und
Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) eingesetzt.
Auch hier konnten nur die Skalen „Generalisierte Angst“ und „Soziale Phobie“ berücksich-
tigt werden, weil viele Lehrer zu den Störungsbereichen „Trennungsangst“ und „Spezifi-
sche Phobie“ keine Auskünfte geben konnten. Zur Beurteilung des schulbezogenen Sozial-
verhaltens wurde die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL; Petermann & Pe-
termann, 2006a) verwendet. Da ein Klassenlehrer die ausgehändigten Fragebogen zu einem
Messzeitpunkt nicht ausgefüllt hatte, musste ein Kind der Interventionsgruppe aus den
nachfolgenden Analysen ausgeschlossen werden. Im Folgenden werden nur die Ergebnisse
der Interventionsgruppe dargestellt; die Ergebnisse der Wartekontrollgruppe können dem
Anhang entnommen werden (vgl. Anhang 13 und 15 für Mittelwerte und Standardabwei-
chungen, Anhang 14 und 16 für Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung).
Angstsymptomatik
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Lehrerurteils auf den Skalen des Fremd-
beurteilungsbogens Angststörungen sind für alle drei Messzeitpunkte der Interventions-
gruppe in Tabelle 38 dargestellt. Auf den beiden Skalen des FBB-ANG lässt sich deskriptiv
eine leichte, aber kontinuierliche Verringerung der Mittelwerte in der Interventionsgruppe
feststellen, sowohl zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt als auch zwischen dem
zweiten und dritten Messzeitpunkt (vgl. auch Abbildung 9).
6 Ergebnisse 154
Tabelle 38: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 13) (n = 13) (n = 13)
GEN 0.97 (0.64) 0.71 (0.54) 0.49 (0.32)
SOZ 1.25 (0.76) 1.00 (0.51) 0.81 (0.50)
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie.
Abbildung 9: Verlauf der Mittelwerte zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
Die Veränderungen, die über verschiedene Messzeitpunkte hinweg in der Interventions-
gruppe auftreten, wurden mit univariaten Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem
Faktor „Messzeitpunkt“ überprüft (vgl. Tabelle 39). Sowohl für die Skala „Generalisierte
Angst“ als auch für die Skala „Soziale Phobie“ wurde ein signifikanter Haupteffekt „Mess-
zeitpunkt“ erzielt, was zum Ausdruck bringt, dass sich die Werte der Interventionsgruppe
zwischen den drei Messzeitpunkten signifikant verändern. Diese Veränderungen führen auf
beiden Skalen zu großen Effekten. Die anschließenden Einzelvergleiche zeigten, dass sich
die Werte der Interventionsgruppe auf der Skala „Generalisierte Angst“ zwischen dem ers-
ten (Prätest) und zweiten Messzeitpunkt (Posttest) signifikant reduzierten, während sie zwi-
schen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt (Follow up) stabil blieben. Auch im langfris-
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Prätest Posttest Follow up
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Generalisierte Angst Soziale Phobie
6 Ergebnisse 155
tigen Verlauf zwischen dem ersten und dritten Messzeitpunkt bleibt die signifikante Ver-
ringerung der Werte erhalten. Die Werte auf der Skala „Soziale Phobie“ nehmen dagegen
nur im langfristigen Verlauf zwischen dem ersten und dritten Messzeitpunkt signifikant ab.
Tabelle 39: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t1 t2 t1
Lehrer F df p 2p p a p b p a
FBB-ANG (n = 13) (n = 13) (n = 13) (n = 13)
GEN 7.36 2, 24 .00 ** .38 .05 * .48 .01 **
SOZ 3.82 2, 24 .04 * .24 .25 .67 .03 *
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (starker Effekt).
Die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen mit Messwiederholung konnten mit den
zusätzlich durchgeführten Wilcoxon-Tests ausnahmslos bestätigt werden (vgl. Anhang 17).
Für die Interpretation der Skalenmittelwerte des Lehrerurteils stehen noch keine Normen,
sondern nur eine orientierende Bewertungshilfe zur Verfügung (0.00 - 0.49 unauffällig, 0.50
- 0.99 leicht auffällig, 1.00 - 1.49 auffällig, sehr auffällig; Döpfner et al., 2008).
Diesen Interpretationshinweisen zufolge liegt der Mittelwert der Interventionsgruppe auf
der Skala „Generalisierte Angst“ vor dem Training (1. Messzeitpunkt) im leicht auffälligen
Bereich. Unmittelbar nach dem Training (2. Messzeitpunkt) hat sich der Skalenmittelwert
zwar reduziert, befindet sich aber immer noch im leicht auffälligen Bereich. Sechs Monate
nach dem Training (3. Messzeitpunkt) erreicht der Skalenmittelwert schließlich den unauf-
fälligen Bereich. Auf der Skala „Soziale Phobie“ liegt der Mittelwert der Interventions-
gruppe vor dem Training im auffälligen Bereich. Unmittelbar nach dem Training hat sich
auch dieser Skalenmittelwert reduziert, liegt aber noch im auffälligen Bereich. Erst sechs
Monate nach dem Training erreicht dieser Skalenmittelwert eine nur noch leicht auffällige
Ausprägung.
6 Ergebnisse 156
Schulbezogenes Sozialverhalten
Die Mittelwerte und Standardabweichungen des Lehrerurteils auf den sechs Skalen des
Aussagenbereichs „Sozialverhalten“ der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
(LSL) sind für alle drei Messzeitpunkte der Interventionsgruppe in Tabelle 40 dargestellt.
Tabelle 40: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
1. Messzeitpunkt 2. Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD)
LSL (n = 13) (n = 13) (n = 13)
KOOP 10.54 (2.99) 11.00 (3.06) 12.85 (1.73)
WAHR 9.15 (2.51) 9.92 (2.66) 11.15 (3.24)
KONT 10.54 (2.33) 9.54 (3.46) 11.62 (2.14)
HILF 7.38 (3.69) 8.77 (3.19) 10.08 (3.20)
BEHA 9.15 (3.24) 10.77 (3.83) 11.38 (2.57)
SOZI 7.85 (2.85) 9.31 (2.32) 10.15 (2.85)
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt.
Bis auf eine Ausnahme („Selbstkontrolle“) zeigt sich auf den Skalen der LSL zwischen dem
ersten und zweiten Messzeitpunkt deskriptiv ein geringfügiger Anstieg der Werte in der
Interventionsgruppe. Auf der Skala „Selbstkontrolle“ nehmen die Skalenmittelwerte im
Verlauf des Trainings nicht zu, sondern ab. Zwischen dem zweiten und dritten Messzeit-
punkt steigen die Werte der Interventionsgruppe auf allen Skalen des LSL weiter an (vgl.
auch Abbildung 10).
Es wurden univariate Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor „Messzeit-
punkt“ durchgeführt, um über verschiedene Messzeitpunkte hinweg auftretende Verände-
rungen innerhalb der Interventionsgruppe feststellen zu können (vgl. Tabelle 41). Für die
Skalen „Kooperation“, „Selbstwahrnehmung“, „Selbstkontrolle“ und „Einfühlungsvermö-
gen und Hilfsbereitschaft“ wurde ein signifikanter Haupteffekt „Messzeitpunkt“ erzielt.
Für die Skalen „Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ erbrachte die Varianzanalyse
keinen signifikanten Haupteffekt „Messzeitpunkt“. Für alle signifikanten Skalen der LSL
wurden im Lehrerurteil große Effekte ermittelt.
6 Ergebnisse 157
Abbildung 10: Verlauf der Mittelwerte des Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
Tabelle 41: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zum schulbezogenen Sozialverhalten im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t1 t2 t1
Lehrer F df p 2p p a p b p a
LSL (n = 13) (n = 13) (n = 13) (n = 13)
KOOP 3.84 2, 24 .04 * .24 .50 .08 .04 *
WAHR 3.49 2, 24 .05 * .23 .30 .42 .07
KONT 4.91 2, 24 .02 * .29 .29 .01 * .21
HILF 4.39 2, 24 .02 * .27 .26 .12 .05 *
BEHA 2.32 2, 24 .12 .16 .21 1.00 .02 *
SOZI 2.92 2, 24 .07 .20 .26 1.00 .04 *
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (schwacher Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2p = .14 (starker Effekt).
Die anschließenden Einzelvergleiche ergaben, dass sich die Mittelwerte der Interventions-
gruppe auf den Skalen der LSL bis auf eine Ausnahme (Skala „Selbstkontrolle“) zwischen
dem ersten und zweiten Messzeitpunkt sowie zwischen dem zweiten und dritten Messzeit-
punkt nicht signifikant verbesserten bzw. unterschieden. Erst im langfristigen Verlauf zwi-
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
Prätest Posttest Follow up
Skal
enm
itte
lwer
t
Messzeitpunkte
Kooperation Selbstwahrnehmung Selbstkontrolle
Hilfsbereitschaft Selbstbehauptung Sozialkontakt
6 Ergebnisse 158
schen dem ersten und dritten Messzeitpunkt wurde auf den Skalen „Kooperation“, „Hilfs-
bereitschaft und Einfühlungsvermögen“, „Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ ein
signifikanter Anstieg der Mittelwerte verzeichnet. Die Mittelwerte auf den Skalen „Selbst-
wahrnehmung“ und „Selbstkontrolle“ blieben auch diesmal unverändert.
Die zusätzlich durchgeführten Wilcoxon-Tests konnten die Ergebnisse der univariaten
Varianzanalysen mit Messwiederholung größtenteils bestätigen (vgl. Anhang 18), erbrach-
ten jedoch einige signifikante Ergebnisse mehr. Die Werte der Interventionsgruppe nah-
men im Lehrerurteil zusätzlich zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt auf der
Skala „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“, zwischen dem zweiten und dritten
Messzeitpunkt auf den Skalen „Kooperation“ und „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereit-
schaft“ sowie zwischen dem ersten und dritten Messzeitpunkt auf der Skala „Selbstwahr-
nehmung“ signifikant zu (mit Effektstärken im kleinen bis großen Bereich).
Ein Vergleich mit den LSL-Normen (Petermann & Petermann, 2006a) zeigt, dass die Mit-
telwerte der Interventionsgruppe auf den Skalen „Kooperation“, „Selbstwahrnehmung“,
„Selbstkontrolle“ und „Selbstbehauptung“ bereits vor dem Training (1. Messzeitpunkt) im
unauffälligen Bereich liegen und sich auch nach dem Training (2. und 3. Messzeitpunkt)
noch im unauffälligen Bereich befinden. Die Mittelwerte auf den Skalen „Einfühlungsver-
mögen und Hilfsbereitschaft“ und „Sozialkontakt“ liegen zum ersten Messzeitpunkt im
grenzwertigen bis auffälligen Bereich. Zum zweiten Messzeitpunkt haben sich die Mittel-
werte auf diesen Skalen (teilweise signifikant) erhöht, befinden sich aber immer noch im
grenzwertigen Bereich. Zum dritten Messzeitpunkt erreichen die Mittelwerte auf diesen
Skalen eine unauffällige Ausprägung. Eine detaillierte Übersicht über die Veränderung der
Auffälligkeit des schulbezogenen Sozialverhaltens in der Interventionsgruppe kann Anhang
19 entnommen werden.
6 Ergebnisse 159
6.3 Differentielle Effekte des Trainings
Für Aussagen zur differentiellen Wirksamkeit des Trainings wurde geprüft, welchen Ein-
fluss ausgewählte Merkmale (z. B. Geschlecht, Alter, Intelligenz, Depressivität) auf die
Wirksamkeit des Trainings (gemessen an der Reduktion der Angstsymptomatik) haben. Die
Angstsymptomatik wurde über den Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) aus
dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-
IV (DISYPS-KJ; Döpfner & Lehmkuhl, 2000) erfasst. Die Mittelwerte und Standard-
abweichungen des Elternurteils auf den Skalen des FBB-ANG sind – getrennt für die
Messzeitpunkte, Trainingsbedingungen und Einflussfaktoren – in Tabelle 42 dargestellt.
Die Auswirkungen dieser Merkmale auf die Veränderung der Angstsymptomatik wurde mit
Hilfe von univariaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen mit den Faktoren „Gruppen-
zugehörigkeit“ und „Einflussfaktor“ sowie den Prätestwerten als Kovariaten überprüft.
Voranalysen
Um sicherzustellen, dass sich die Kinder der beiden Gruppen vor dem Training hinsicht-
lich der untersuchten Einflussfaktoren nicht unterscheiden, wurden statistische Mittel-
wertsvergleiche durchgeführt: Die Kinder beider Gruppen unterschieden sich zum ersten
Messzeitpunkt weder hinsichtlich ihres Geschlechts noch hinsichtlich ihres Alters oder
ihrer Intelligenz signifikant voneinander (vgl. Tabelle 20). Auch hinsichtlich einer gegebe-
nenfalls vorhandenen depressiven Symptomatik wurden keine Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen festgestellt (t = -0.59; n. s.).
Geschlecht
Es wird angenommen, dass das Geschlecht der Kinder keinen Einfluss auf die Reduktion
der Angstsymptomatik hat, d. h. Mädchen und Jungen unterscheiden sich hinsichtlich der
Reduktion der Angstsymptomatik nicht (Hypothese 3a). Im Urteil der Eltern ergibt sich bei
kovarianzanalytischer Auswertung auf den Skalen des FBB-ANG zum zweiten Messzeit-
punkt kein signifikanter Haupteffekt „Geschlecht“, d. h. das Geschlecht der Kinder hat
keinen signifikanten Einfluss auf die Reduktion der Angstsymptomatik (vgl. Tabelle 43).
6 Ergebnisse 160
Mit den zusätzlich durchgeführten Kruskal-Wallis-H-Tests wurden die Ergebnisse der uni-
variaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen bestätigt (vgl. Anhang 20). Auch hier zeigten
sich auf den Skalen des FBB-ANG keine signifikanten Effekte des Geschlechts auf die
Reduktion der Angstsymptomatik.
Alter
Es wird angenommen, dass das Alter der Kinder keinen Einfluss auf die Reduktion der
Angstsymptomatik hat, d. h. jüngere und ältere Kinder unterscheiden sich hinsichtlich der
Reduktion der Angstsymptomatik nicht (Hypothese 3b). Im Elternurteil auf den Skalen des
FBB-ANG zeigt sich zum zweiten Messzeitpunkt kein signifikanter Haupteffekt „Alter“,
was bedeutet, dass das Alter der Kinder keinen signifikanten Einfluss auf die Reduktion der
Angstsymptomatik hat (vgl. Tabelle 43).
Die Ergebnisse der univariaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen wurden mit den zusätz-
lich durchgeführten Kruskal-Wallis-H-Tests bestätigt. Auch bei nicht-parametrischer Aus-
wertung hatte das Alter der Kinder keinen signifikanten Effekt auf die Reduktion der
Angstsymptomatik (gemessen mit den Skalen des FBB-ANG) (vgl. Anhang 20).
Intellektuelle Leistungsfähigkeit
Es wird angenommen, dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder keinen Einfluss
auf die Reduktion der Angstsymptomatik hat, d. h. Kinder mit niedriger und hoher intellek-
tueller Leistungsfähigkeit unterscheiden sich hinsichtlich der Reduktion der Angstsympto-
matik nicht (Hypothese 3c). Im Urteil der Eltern ergibt sich bei kovarianzanalytischer Aus-
wertung auf den Skalen des FBB-ANG zum zweiten Messzeitpunkt zwar kein signifikanter
Haupteffekt „Intellektuelle Leistungsfähigkeit“, jedoch ein signifikanter Interaktionseffekt
für die Skala „Spezifische Phobie“ sowie marginale Interaktionseffekte für die Skala „Ge-
neralisierte Angst“ und für die Gesamtskala „Angststörungen“ (vgl. Tabelle 43). Auf allen
drei Skalen ließ sich bei niedrigerer intellektueller Leistungsfähigkeit kein Unterschied
zwischen den Kindern der Interventionsgruppe und der Wartekontrollgruppe feststellen,
während bei höherer intellektueller Leistungsfähigkeit die Kinder der Interventionsgruppe
signifikant niedrigere Angstwerte aufwiesen als die Kinder der Wartekontrollgruppe.
6 Ergebnisse 161
Mit den zusätzlich durchgeführten Kruskal-Wallis-H-Tests wurden die Ergebnisse der uni-
variaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen überwiegend bestätigt (vgl. Anhang 20). Bei
nicht-parametrischer Auswertung ließ sich zwar ein signifikanter Effekt der intellektuellen
Leistungsfähigkeit auf die Angstreduktion für die Gesamtskala „Angststörungen“ nach-
weisen (vgl. Anhang 20); bei den anschließenden paarweisen Einzelvergleichen zeigte sich
allerdings kein signifikanter Unterschied zwischen den Kindern mit niedrigerer und höhe-
rer Intelligenz (z = -1.04; n. s.). Der allgemeine Effekt für die Gesamtskala „Angststörun-
gen“ ist allein darauf zurückzuführen, dass die Kinder mit höherer Intelligenz signifikant
niedrigere Angstwerte aufwiesen als die Kinder der Wartekontrollgruppe (z = -2.40; p <
.05). Für die Skalen „Trennungsangst“, Generalisierte Angst“, „Soziale Angst“ und „Spezi-
fische Phobie“ wurde kein signifikanter Effekt der intellektuellen Leistungsfähigkeit auf die
Reduktion der Angstsymptomatik festgestellt.
Depressive Symptomatik
Es wird angenommen, dass eine gegebenenfalls vorhandene depressive Symptomatik der
Kinder einen ungünstigen Einfluss auf die Reduktion der Angstsymptomatik hat, d. h.
Kinder mit starker depressiver Symptomatik weisen eine geringere Reduktion der Angst-
symptomatik auf als Kinder mit schwacher depressiver Symptomatik (Hypothese 3d). Im
Elternurteil auf den Skalen des FBB-ANG zeigt sich zum zweiten Messzeitpunkt kein sig-
nifikanter Haupteffekt „Depressivität“, d. h. die komorbide depressive Symptomatik hat
keinen signifikanten Einfluss auf die Reduktion der Angstsymptomatik (vgl. Tabelle 43).
Die Ergebnisse der univariaten, zweifaktoriellen Kovarianzanalysen wurden mit den zusätz-
lich durchgeführten Kruskal-Wallis-H-Tests nur teilweise bestätigt. Auch bei nicht-
parametrischer Auswertung zeigte sich auf den Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte
Angst“ und „Spezifische Phobie“ kein signifikanter Effekt der depressiven Symptomatik
auf die Reduktion der Angstsymptomatik; demgegenüber wurde auf der Skala „Soziale
Phobie“ ein marginal signifikanter Effekt und auf der Gesamtskala „Angststörungen“ ein
signifikanter Effekt nachgewiesen (vgl. Anhang 20). Bei den anschließenden Einzelverglei-
chen ließen sich auf der Skala „Soziale Phobie“ (SOZ) und auf der Gesamtskala „Angst-
störungen“ (ANG) jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Inter-
ventionsgruppen (schwache vs. starke depressive Symptomatik) finden (SOZ: z = -0.60;
ANG: z = -0.67; beide n. s.). Die Kinder mit schwächerer depressiver Symptomatik wiesen
6 Ergebnisse 162
allerdings signifikant niedrigere Angstwerte auf als die Kinder der Wartekontrollgruppe
(SOZ: z = -2.36; p < .01; ANG: z = -2.63; p < .01), während sich die Kinder mit stärkerer
depressiver Symptomatik und die Kinder der Wartekontrollgruppe nicht unterschieden
(SOZ: z = -1.25; ANG: z = -0.97; beide n. s.).
6 E
rgeb
niss
e 16
3 Ta
belle
42
: M
ittel
wer
te
und
Stan
dard
abw
eich
unge
n de
r A
ngst
sym
ptom
atik
im
E
ltern
urte
il au
f de
n Sk
alen
des
DIS
YPS
-KJ-F
rem
d-be
urte
ilung
sbog
ens A
ngst
stör
unge
n (F
BB-A
NG
) unt
er B
erüc
ksic
htig
ung
von
Ges
chle
cht,
Alte
r, In
telli
genz
und
Dep
ress
ivitä
t der
Kin
der
1.
Mes
szei
tpu
nkt
2.
Mes
szei
tpu
nkt
In
terv
enti
onsg
rup
pe
War
teko
ntr
ollg
rup
pe
Inte
rven
tion
sgru
pp
e W
arte
kon
trol
lgru
pp
e
Elt
ern
M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
)
FB
B-A
NG
(n
= 1
4)
(n =
11)
(n
= 1
4)
(n =
11)
Ges
chle
cht
Mäd
chen
(n
= 7
) Ju
ngen
(n
= 7
) M
ädch
en
(n =
5)
Jung
en
(n =
6)
Mäd
chen
(n
= 7
) Ju
ngen
(n
= 7
) M
ädch
en
(n =
5)
Jung
en
(n =
6)
Tren
nung
sang
st
1.03
(0
.73)
0.
34
(0.3
8)
0.52
(0
.38)
0.
76
(0.2
1)
0.56
(0
.80)
0.
13
(0.1
7)
0.38
(0
.39)
0.
74
(0.3
7)
Gen
erali
sierte
Ang
st
1.49
(0
.70)
1.
04
(0.7
8)
1.29
(0
.65)
1.
03
(0.4
9)
1.02
(0
.97)
0.
65
(0.6
4)
1.17
(0
.61)
0.
97
(0.5
3)
Sozi
ale A
ngst
2.
35
(0.4
7)
1.57
(0
.95)
1.
81
(0.7
3)
1.49
(0
.47)
1.
53
(0.8
9)
0.90
(0
.92)
1.
83
(0.7
7)
1.34
(0
.33)
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
96
(0.9
4)
0.65
(0
.49)
0.
74
(0.5
6)
0.46
(0
.27)
0.
71
(0.6
7)
0.35
(0
.52)
0.
98
(0.7
3)
0.37
(0
.30)
Ang
stst
örun
gen
1.41
(0
.41)
0.
85
(0.4
0)
1.03
(0
.34)
0.
92
(0.1
7)
0.92
(0
.71)
0.
47
(0.3
7)
1.02
(0
.40)
0.
85
(0.3
2)
Alt
er
Jung
(n
= 7
) A
lt (n
= 7
) Ju
ng
(n =
6)
Alt
(n =
5)
Jung
(n
= 7
) A
lt (n
= 7
) Ju
ng
(n =
6)
Alt
(n =
5)
Tren
nung
sang
st
0.51
(0
.50)
0.
86
(0.7
9)
0.60
(0
.35)
0.
66
(0.3
2)
0.20
(0
.21)
0.
49
(0.8
3)
0.63
(0
.48)
0.
44
(0.3
2)
Gen
erali
sierte
Ang
st
0.92
(0
.83)
1.
61
(0.5
1)
0.98
(0
.51)
1.
40
(0.5
9)
0.57
(0
.69)
1.
10
(0.8
9)
0.95
(0
.46)
1.
22
(0.6
7)
Sozi
ale A
ngst
1.
45
(0.8
5)
2.47
(0
.38)
1.
52
(0.4
3)
1.83
(0
.82)
0.
82
(0.9
2)
1.61
(0
.81)
1.
33
(0.6
0)
1.94
(0
.57)
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
57
(0.5
0)
1.04
(0
.89)
0.
38
(0.2
7)
0.89
(0
.51)
0.
31
(0.5
4)
0.76
(0
.63)
0.
36
(0.1
5)
1.11
(0
.77)
Ang
stst
örun
gen
0.83
(0
.39)
1.
43
(0.3
9)
0.84
(0
.16)
1.
14
(0.3
0)
0.45
(0
.37)
0.
94
(0.6
8)
0.80
(0
.32)
1.
11
(0.3
6)
Inte
llekt
uel
le
Lei
stu
ngs
fäh
igke
it
Nie
drig
(n
= 6
) H
och
(n =
8)
Nie
drig
(n
= 6
) H
och
(n =
5)
Nie
drig
(n
= 6
) H
och
(n =
8)
Nie
drig
(n
= 6
) H
och
(n =
5)
Tren
nung
sang
st
0.88
(0
.69)
0.
54
(0.6
4)
0.75
(0
.34)
0.
48
(0.2
6)
0.67
(0
.83)
0.
10
(0.1
2)
0.65
(0
.44)
0.
42
(0.3
6)
Gen
erali
sierte
Ang
st
1.71
(0
.79)
0.
93
(0.5
5)
1.07
(0
.47)
1.
29
(0.7
1)
1.45
(0
.90)
0.
38
(0.3
0)
0.93
(0
.48)
1.
26
(0.6
3)
6 E
rgeb
niss
e 16
4
1.
Mes
szei
tpu
nkt
2.
Mes
szei
tpu
nkt
In
terv
enti
onsg
rup
pe
War
teko
ntr
ollg
rup
pe
Inte
rven
tion
sgru
pp
e W
arte
kon
trol
lgru
pp
e
Elt
ern
M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
)
FB
B-A
NG
(n
= 1
4)
(n =
11)
(n
= 1
4)
(n =
11)
Sozi
ale A
ngst
2.
36
(0.5
6)
1.66
(0
.89)
1.
33
(0.5
2)
2.06
(0
.52)
1.
71
(1.0
1)
0.84
(0
.71)
1.
26
(0.3
5)
2.03
(0
.68)
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
90
(0.5
6)
0.73
(0
.88)
0.
60
(0.4
1)
0.63
(0
.56)
0.
81
(0.6
8)
0.32
(0
.49)
0.
52
(0.6
2)
0.91
(0
.65)
Ang
stst
örun
gen
1.41
(0
.37)
0.
92
(0.4
8)
0.92
(0
.16)
1.
05
(0.3
7)
1.11
(0
.69)
0.
38
(0.1
9)
0.83
(0
.38)
1.
08
(0.3
1)
Dep
ress
ivit
ät
Schw
ach
(n =
9)
Star
k (n
= 5
) Sc
hwac
h (n
= 4
) St
ark
(n =
7)
Schw
ach
(n =
9)
Star
k (n
= 5
) Sc
hwac
h (n
= 4
) St
ark
(n =
7)
Tren
nung
sang
st
0.54
(0
.60)
0.
94
(0.7
5)
0.68
(0
.41)
0.
60
(0.2
9)
0.14
(0
.15)
0.
70
(0.9
3)
0.60
(0
.37)
0.
51
(0.4
5)
Gen
erali
sierte
Ang
st
0.98
(0
.54)
1.
77
(0.8
7)
1.04
(0
.55)
1.
25
(0.6
0)
0.52
(0
.44)
1.
40
(1.0
7)
0.89
(0
.24)
1.
18
(0.6
7)
Sozi
ale A
ngst
1.
76
(0.9
0)
2.31
(0
.58)
1.
46
(0.5
1)
1.78
(0
.68)
0.
92
(0.7
3)
1.74
(1
.09)
1.
39
(0.7
0)
1.73
(0
.62)
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
57
(0.5
8)
1.23
(0
.87)
0.
25
(0.1
4)
0.82
(0
.45)
0.
30
(0.4
9)
0.94
(0
.62)
0.
32
(0.1
4)
0.92
(0
.71)
Ang
stst
örun
gen
0.93
(0
.42)
1.
50
(0.3
9)
0.84
(0
.17)
1.
06
(0.2
9)
0.44
(0
.25)
1.
15
(0.7
7)
0.78
(0
.18)
1.
03
(0.4
1)
6 E
rgeb
niss
e 16
5 Ta
belle
43:
Ein
fluss
ver
schi
eden
er M
erkm
ale a
uf d
ie R
eduk
tion
der
Ang
stsy
mpt
omat
ik a
us S
icht
der
Elte
rn g
emes
sen
mit
den
Skale
n de
s D
ISY
PS-K
J-Fre
mdb
eurte
ilung
sbog
ens A
ngst
stör
unge
n (F
BB-A
NG
) - E
rgeb
niss
e de
r uni
varia
ten,
zw
eifak
torie
llen
Kov
arian
zana
lysen
1.
Hau
pte
ffek
t 2.
Hau
pte
ffek
t In
tera
ktio
nse
ffek
t
Elt
ern
F
df p
2 p F
df p
2 p F
df p
2 p
FB
B-A
NG
Ges
chle
cht
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
Ges
chle
cht
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
x G
esch
lech
t
Tren
nung
sang
st
2.31
1
0.14
0.
10
0.39
1
0.54
0.
02
0.27
1
0.61
0.
01
Gen
erali
sierte
Ang
st
3.04
1
0.10
0.
13
0.01
1
0.93
0.
00
0.00
1
0.98
0.
00
Sozi
ale A
ngst
4.
40
1 0.
05 *
0.
18
0.48
1
0.50
0.
02
0.78
1
0.78
0.
00
Spez
ifisc
he P
hobi
e 2.
10
1 0.
16
0.10
2.
64
1 0.
12
0.12
0.
47
1 0.
50
0.02
Ang
stst
örun
gen
5.78
1
0.03
*
0.22
0.
00
1 0.
97
0.00
0.
16
1 0.
69
0.01
Alt
er
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
Alte
r G
rupp
enzu
gehö
rigke
it x
Alte
r
Tren
nung
sang
st
2.00
1
0.17
0.
09
0.26
1
0.61
0.
01
0.81
1
0.38
0.
04
Gen
erali
sierte
Ang
st
3.02
1
0.10
+
0.13
0.
16
1 0.
69
0.01
0.
00
1 0.
96
0.00
Sozi
ale A
ngst
4.
93
1 0.
04
0.20
0.
88
1 0.
36
0.04
0.
23
1 0.
64
0.01
Spez
ifisc
he P
hobi
e 2.
67
1 0.
12
0.12
2.
72
1 0.
12
0.12
0.
62
1 0.
44
0.03
Ang
stst
örun
gen
5.89
1
0.03
*
0.23
0.
00
1 0.
98
0.00
0.
07
1 0.
80
0.00
Inte
llige
nz
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
Inte
llige
nz
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
x In
telli
genz
Tren
nung
sang
st
1.75
1
0.20
0.
08
1.79
1
0.20
0.
08
0.88
1
0.36
0.
04
Gen
erali
sierte
Ang
st
2.76
1
0.11
0.
12
1.05
1
0.32
0.
05
3.83
1
0.06
+
0.16
Sozi
ale A
ngst
4.
12
1 0.
06 +
0.
17
0.06
1
0.81
0.
00
2.08
1
0.17
0.
09
Spez
ifisc
he P
hobi
e 2.
49
1 0.
13
0.11
0.
00
1 0.
98
0.00
4.
34
1 0.
05 *
0.
18
Ang
stst
örun
gen
5.11
1
0.04
0.
20
0.65
1
0.43
0.
03
3.54
1
0.07
+
0.15
6 E
rgeb
niss
e 16
6
1. H
aup
teff
ekt
2. H
aup
teff
ekt
Inte
rakt
ion
seff
ekt
Elt
ern
F
df p
2 p F
df p
2 p F
df p
2 p
FB
B-A
NG
Dep
ress
ivit
ät
Gru
ppen
zuge
hörig
keit
Dep
ress
ivitä
t G
rupp
enzu
gehö
rigke
it x
Dep
ress
ivitä
t
Tren
nung
sang
st
1.42
1
0.25
0.
07
0.70
1
0.41
0.
03
1.15
1
0.30
0.
05
Gen
erali
sierte
Ang
st
1.85
1
0.19
0.
09
0.97
1
0.34
0.
05
0.13
1
0.72
0.
01
Sozi
ale A
ngst
3.
06
1 0.
10 +
0.
13
1.21
1
0.28
0.
06
0.37
1
0.55
0.
02
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
96
1 0.
34
0.05
1.
51
1 0.
23
0.07
0.
00
1 0.
99
0.00
Ang
stst
örun
gen
3.28
1
0.09
+
0.14
1.
20
1 0.
29
0.06
0.
41
1 0.
53
0.02
Anm
erkun
gen: H
aupt
effe
kt G
rupp
enzu
gehö
rigke
it: In
terv
entio
nsgr
uppe
(n =
14)
vs.
War
teko
ntro
llgru
ppe
(n =
11)
; Hau
ptef
fekt
Ges
chle
cht:
Mäd
chen
(n =
12)
vs.
Jung
en (n
=
13);
Hau
ptef
fekt
Alte
r: Jü
nger
e K
inde
r (n
= 1
3) v
s. Ä
ltere
Kin
der (
n =
12)
; Hau
ptef
fekt
Int
ellig
enz:
Nie
drig
e In
telli
genz
(n =
12)
vs.
Hoh
e In
telli
genz
(n =
13)
; Hau
ptef
fekt
D
epre
ssiv
ität:
Schw
ache
Dep
ress
ivitä
t (n
= 1
3) v
s. St
arke
Dep
ress
ivitä
t (n
= 1
2); +
p <
.10;
* p
< .0
5; *
* p
< .0
1; E
ffek
tstä
rke
2 p e
inge
teilt
nac
h Co
hen
(198
8):
2 p =
.01
(kle
iner
E
ffek
t);
2 p =
.06
(mitt
lere
r Eff
ekt);
2 p
= .1
4 (g
roße
r Eff
ekt).
6 Ergebnisse 167
6.4 Beurteilerübereinstimmung
Für Aussagen zur Beurteilerübereinstimmung wurde geprüft, wie hoch die Übereinstim-
mung zwischen Kinder-, Eltern- und Lehrerurteilen ist. Es wird angenommen, dass sich
Kinder, Eltern und Lehrer in der Beurteilung der Angstsymptomatik des Kindes unter-
scheiden, d. h. die Übereinstimmung zwischen Kinder- und Elternurteilen (Hypothese 4a),
Eltern- und Lehrerurteilen (Hypothese 4b) sowie Kinder- und Lehrerurteilen (Hypothese
4c) ist gering. Zur Erfassung der Angstsymptomatik aus Sicht der Kinder wurde die deut-
sche Version der Social Anxiety Scale for Children – Revised (SASC-R-D; Melfsen, 1998) einge-
setzt. Zur Beurteilung der Angstsymptomatik aus Sicht der Eltern und Lehrer wurde der
Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) aus dem Diagnostik-System für psychische Stö-
rungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ; Döpfner &
Lehmkuhl, 2000) verwendet. In die Analysen zur Beurteilerübereinstimmung gingen nur
die Fälle ein, bei denen die Einschätzungen aller Beurteiler vollständig vorlagen (N = 22).
Übereinstimmung zwischen Kinder- und Elternurteilen
Beim Vergleich der Kinder- und Elternurteile liegen die ICC-Werte zwischen 0.08 und 0.34
mit einem Median von 0.24. Der höchste ICC-Wert wurde mit ICC = 0.34 für die Korrela-
tion zwischen der Skala „Furcht vor negativer Bewertung“ (FNE) und der Gesamtskala
„Angststörungen“ (ANG) erzielt. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass zwischen den
Urteilen der Kinder und Eltern nur eine geringe Übereinstimmung hinsichtlich der Beurtei-
lung der Angstsymptomatik besteht (vgl. Tabelle 44).
Tabelle 44: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Kinder- und Elternurteil zum ersten Messzeitpunkt a
Eltern
TREN GEN SOZ SPEZ ANG
Kinder
FNE 0.28 0.28 0.09 0.24 0.34
SAD 0.16 0.22 0.23 0.08 0.27
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen; TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezi-fische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a n = 22, zweiseitige Testung: * p < .05; ** p < .01.
6 Ergebnisse 168
Übereinstimmung zwischen Eltern- und Lehrerurteilen
Die Übereinstimmung zwischen den Eltern- und Lehrerurteilen reicht von ICC = -0.08 bis
ICC = 0.37 mit einem Median von 0.24. Die höchsten Intraklassenkorrelationen wurden
für die Skalen „Generalisierte Angst“ (ICC = 0.37) und „Soziale Angst“ (ICC = 0.34)
erzielt. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Eltern und Lehrer bei der Beurteilung der
Angstsymptomatik nicht gut übereinstimmen (vgl. Tabelle 45).
Tabelle 45: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Eltern- und Lehrerurteil zum ersten Messzeitpunkt a
Eltern
TREN GEN SOZ SPEZ ANG
Lehrer
GEN 0.16 0.37 * 0.32 - 0.08 0.31
SOZ 0.16 0.16 0.34 0.14 0.31
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a n = 22, zweiseitige Testung: * p < .05; ** p < .01.
Übereinstimmung zwischen Kinder- und Lehrerurteilen
Der Vergleich der Beurteilungen von Kindern und Lehrern zeigt Intraklassenkorrelationen
von 0.10 bis 0.31. Der Median dieser Intraklassenkorrelationen beträgt 0.16. Insgesamt
wird deutlich, dass zwischen Kindern und Lehrern nur eine geringe Übereinstimmung bei
der Beurteilung der Angstsymptomatik besteht (vgl. Tabelle 46).
Tabelle 46: Intraklassenkorrelationen (ICC) zwischen Kinder- und Lehrerurteil zum ersten Messzeitpunkt a
Lehrer
TREN GEN SOZ SPEZ ANG
Kinder
FNE 0.31 0.10
SAD 0.12 0.20
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen; TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezi-fische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a n = 22, zweiseitige Testung: * p < .05; ** p < .01.
6 Ergebnisse 169
6.5 Rückmeldung der Eltern nach dem Training
Die Eltern der Interventionsgruppe erhielten sechs Monate nach dem Training einen
Fragebogen zur retrospektiven Beurteilung des Trainings. In Tabelle 47 werden die Rück-
meldungen dieser Eltern dargestellt.
Tabelle 47: Retrospektive Beurteilung des Trainings durch die Eltern der Interventions-gruppe – Häufigkeitsangaben (Prozentangaben in Klammern)
Antwortformat Fragen
nie / gar nicht
selten / kaum
manchmal / etwas
oft / deutlich
immer / stark
1 Konnten Sie die in der Elternberatung besprochenen Inhalte umsetzen? 0 (0) 0 (0) 5 (36) 8 (57) 1 (7)
2 Hat Ihnen die Elternberatung gehol-fen, Ihr Kind besser zu verstehen? 0 (0) 1 (7) 3 (21) 10 (72) 0 (0)
3 Hat Ihnen die Elternberatung gehol-fen, den Zusammenhang zwischen Ihrem Verhalten und dem Verhalten Ihres Kindes besser zu verstehen?
0 (0) 0 (0) 5 (36) 6 (43) 3 (21)
4 Hat Ihnen die Elternberatung geholfen, Ihr Erziehungsverhalten zu verbessern?
0 (0) 1 (7) 9 (65) 3 (21) 1 (7)
5 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf bekanntes Problemverhalten Ihres Kindes anzuwenden?
0 (0) 0 (0) 6 (43) 8 (57) 0 (0)
6 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf unbekanntes Problemverhalten Ihres Kindes anzuwenden?
2 (15) 1 (7) 8 (57) 3 (21) 0 (0)
7 Hat sich das Verhalten Ihres Kindes verbessert? 0 (0) 0 (0) 5 (36) 6 (43) 3 (21)
8 Sind Sie mit den Fortschritten, die Ihr Kind gemacht hat, zufrieden? 0 (0) 0 (0) 4 (29) 7 (50) 3 (21)
9 Hat sich das Zusammenleben in der Familie verbessert? 0 (0) 1 (7) 6 (43) 7 (50) 0 (0)
10 Haben Sie sich von den Trainerinnen bzw. Trainern verstanden gefühlt? 0 (0) 0 (0) 1 (7) 6 (43) 7 (50)
11 Haben Sie die Teilnahme am Training als hilfreich empfunden? 0 (0) 0 (0) 3 (21) 4 (29) 7 (50)
Die Eltern- bzw. Familienberatung hat allen Eltern dabei geholfen, ihr Kind besser zu ver-
stehen. Ein großer Teil der Eltern (72 %) glaubt, ihr Kind seit der Teilnahme am Training
oft besser zu verstehen, ein kleinerer Teil der Eltern (28 %) meint, ihr Kind zumindest
manchmal oder selten besser zu verstehen. Vielen Eltern (64 %) hat die Elternberatung
6 Ergebnisse 170
auch dabei geholfen, den Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem Verhalten
ihres Kindes besser zu verstehen. Während der Trainingsteilnahme konnten alle Eltern die
in der Elternberatung besprochenen Inhalte im Alltag umsetzen, 64 % oft oder immer und
36 % manchmal. Nach dem Ende des Trainings waren noch 57 % der Eltern oft in der
Lage, die Inhalte der Elternberatung auf bekanntes Problemverhalten ihres Kindes anzu-
wenden. Den übrigen Eltern gelang dies nur manchmal (43 %). Die Inhalte der Elternbera-
tung nach Trainingsende auch auf unbekanntes Problemverhalten ihres Kindes anzuwen-
den, fiel den Eltern dagegen deutlich schwerer. Nur noch 21 % der Eltern fühlten sich oft
und 57 % der Eltern manchmal in der Lage, auf das unbekannte Problemverhalten ihres
Kindes angemessen zu reagieren. 28 % der Eltern waren davon überzeugt, dass die Eltern-
beratung dazu beigetragen habe, ihr Erziehungsverhalten deutlich oder stark zu verbessern.
Weitere 65 % der Eltern nahmen eine mittlere Verbesserung ihres Erziehungsverhaltens
durch die Elternberatung wahr.
Die überwiegende Mehrheit der Eltern (93 %) fühlte sich von den Trainern oft oder immer
verstanden. Alle Eltern erlebten die Teilnahme am Training als hilfreich; 79 % der Eltern
gaben an, dass sie die Trainingsteilnahme oft oder immer als hilfreich empfunden hatten
und 21 % der Eltern gaben an, dass sie die Trainingsteilnahme manchmal als hilfreich emp-
funden hatten. Nach dem Training bemerkten alle Eltern eine Veränderung im Verhalten
ihres Kindes. 64 % der Eltern berichteten, dass sich das Verhalten ihres Kindes deutlich
oder stark verbessert hatte und 36 % der Eltern berichteten, dass sich das Verhalten ihres
Kindes etwas verbessert hatte. Die Mehrheit der Eltern wies darauf hin, dass sich auch das
Zusammenleben in der Familie nach dem Training verbessert hatte, für 50 % der Eltern in
deutlichem Ausmaß und für 43 % der Eltern in mittlerem Ausmaß. 7 % der Eltern be-
merkten nur eine geringe Verbesserung, wobei diese Eltern ergänzt hatten, dass das Zu-
sammenleben in der Familie auch vor der Trainingsteilnahme bereits gut funktioniert hatte.
Alle Eltern waren mit den Fortschritten, die ihr Kind erzielt hatte, zufrieden, wobei 71 %
der Eltern deutlich oder sehr zufrieden und 29 % der Eltern etwas zufrieden waren. Fast
alle Eltern (93 %) würden das Training weiterempfehlen.
7 Diskussion 171
7 Diskussion
7.1 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
7.1.1 Kurzfristige Trainingseffekte
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die generelle und differentielle Wirksamkeit des
„Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) mit einer
randomisierten (Warte-)Kontrollgruppenstudie überprüft. Das Ziel des kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Trainingsprogramms bestand in erster Linie darin, die sozialen Ängste der
Kinder abzubauen und den Umgang mit bisher angstauslösenden Situationen durch den
Aufbau sozialer Fertigkeiten zu verbessern. Für die Überprüfung der kurz- und lang-
fristigen Wirksamkeit des Trainings wurden neben den Angaben der Kinder (Selbsturteil)
auch die Auskünfte der Eltern und Lehrer (Fremdurteil) herangezogen. Nachfolgend
werden die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studie zusammengefasst und vor dem
Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes interpretiert und diskutiert.
Angstsymptomatik
In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst überprüft, ob mit dem Training kurzfristige
Effekte auf die ängstliche Symptomatik der Kinder erzielt werden. Es wurde angenommen,
dass sich durch die Teilnahme am Training die sozialen Ängste der Kinder verringern, d. h.
die Kinder der Interventionsgruppe sollten unmittelbar nach dem Training eine stärkere
Reduktion der Angstsymptomatik aufweisen als die Kinder der Wartekontrollgruppe.
Im Urteil der Eltern zeigte sich erwartungsgemäß, dass die Teilnahme am Training einen
signifikanten Effekt auf die Verringerung der Angstsymptomatik (gemessen mit dem
DISYPS-KJ: FBB-ANG) hat. Unter Berücksichtigung der vor dem Training bestehenden
Gruppenunterschiede wiesen die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem
Training sowohl auf der Skala „Soziale Phobie“ als auch auf der Gesamtskala „Angst-
störungen“ signifikant niedrigere Werte auf als die noch unbehandelten Kinder der Warte-
kontrollgruppe. Für diese signifikanten Unterschiede konnten starke Effekte nachgewiesen
werden (Soziale Phobie: 2p = 0.19 bzw. d = 0.90; Angststörungen: 2
p = 0.23 bzw. d = 0.87).
7 Diskussion 172
Die Werte auf den Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und „Spezifische
Phobie“ reduzierten sich zwar nicht signifikant, erreichten aber dennoch das Ausmaß mitt-
lerer Effekte. Da sich die Inhalte des Trainings schwerpunktmäßig auf die „Störung mit
sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters“ beziehen und die Stichprobe überwiegend aus
Kindern mit dieser Störung bestand, ist es nicht verwunderlich, dass signifikante Ergebnis-
se zwar auf der Skala „Soziale Phobie“ und auf der Gesamtskala „Angststörungen“, nicht
jedoch auf den anderen Skalen des FBB-ANG erzielt wurden.
In ähnlichen Wirksamkeitsstudien wurden für den Vergleich zwischen der Interventions-
gruppe und der Kontrollgruppe zum Zeitpunkt nach der Intervention bzw. Wartezeit
vergleichbare Effektstärken erzielt (Heyne et al., 2002; Kley et al., 2012; Nauta et al., 2003;
Schneider et al., 2011; Silverman et al., 1999a). Die Ergebnisse der aktuellen Meta-Analysen
zur Wirksamkeit der Kognitiven Verhaltenstherapie bei Angststörungen im Kindes- und
Jugendalter fielen mit durchschnittlichen Effektstärken von d = 0.66 (In-Albon & Schnei-
der, 2007) und d = 0.61 (Ishikawa et al., 2007) etwas schlechter, aber immer noch moderat
aus. Damit bestätigen die Befunde der vorliegenden Studie die auf vergleichbarer Trainings-
grundlage einzelfallanalytisch erzielten Ergebnisse (Petermann & Röttgen, 1986; Petermann
& Walter, 1989). Die mit der vorliegenden Studie an einer kleinen Stichprobe gewonnenen,
statistisch signifikanten Ergebnisse sollten jedoch in weiteren Studien repliziert werden
(Bortz & Lienert, 2008).
Der aus der Angstsymptomatik entstandene Leidensdruck der Kinder verringerte sich
durch die Teilnahme am Training deutlich. Während vor dem Training noch 71.4 % der
Eltern in der Interventionsgruppe angaben, dass ihre Kinder unter den beschriebenen
Problemen ziemlich oder sehr leiden würden, waren es nach dem Training nur noch
21.4 % der Eltern. Demgegenüber veränderte sich der Leidensdruck der Kinder in der
Wartekontrollgruppe während des Wartezeitraums nicht. Mit der Verringerung der Angst-
symptomatik ging auch eine deutliche Zunahme der Funktionsfähigkeit einher. Während
die Beziehungen zu anderen Menschen und/oder die schulische Leistungsfähigkeit vor
dem Training noch bei 85.7 % der Kinder in der Interventionsgruppe ziemlich oder sehr
beeinträchtigt waren, zeigten unmittelbar nach dem Training nur noch 35.7 % der Kinder
eine entsprechende Beeinträchtigung. In der Wartekontrollgruppe verbesserten sich die
Beziehungen zu anderen Menschen und/oder die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder
während der Wartezeit nur geringfügig.
7 Diskussion 173
Während die Einschätzung der Eltern die kurzfristige Wirksamkeit des Trainings stützt,
bleibt unklar, warum sich dieser Therapieerfolg im Urteil der Kinder nicht widerspiegelt. Auf
den beiden Skalen der SASC-R-D „Furcht vor negativer Bewertung“ und „Vermeidung
von und Belastung durch soziale Situationen“ zeigte sich zwar eine Verringerung der
Angstsymptomatik in der Interventionsgruppe (mit Training); allerdings fand sich eine
vergleichbare Abnahme der Angstsymptomatik auch in der Wartekontrollgruppe (ohne
Training). Die in beiden Gruppen erzielten Veränderungen unterschieden sich daher nicht
signifikant voneinander. Dementsprechend konnte die Annahme, dass sich die Angst-
symptomatik der Kinder durch die Teilnahme am Training signifikant verringert, mit dem
Kinderurteil nicht bestätigt werden. Auch in anderen Studien beurteilten die Kinder die
Wirksamkeit der durchgeführten Intervention weniger positiv als ihre Eltern (z. B. Kühl,
2005; Melfsen, Osterlow, Beyer & Florin, 2003; Nauta et al., 2003; Schneider et al., 2011).
Möglicherweise unterscheiden sich Eltern und Kinder hinsichtlich der Fähigkeit und
Bereitschaft, ihre Wahrnehmungen im Rahmen einer standardisierten Befragungssituation
mitzuteilen. So könnte insbesondere den jüngeren Kindern (unter 10 Jahren) ein Beurtei-
lungsmaßstab fehlen, anhand dessen sie selbstbezogene Veränderungen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg zuverlässig wahrnehmen können (Edelbrock, Costello, Dulcan, Kalas
& Conover, 1985). Die Zuverlässigkeit der von Kindern gemachten Angaben steigt erst mit
zunehmendem Alter (Edelbrock et al., 1985; Fallon & Schwab-Stone, 1994; Silverman &
Eisen, 1992). Zudem könnten die Kinder aus Scham oder Angst vor Ablehnung davor
zurückschrecken, ihre sozialen Ängste offen zu benennen. Die insgesamt niedrigen Mittel-
werte im Selbsturteil der Kinder lassen auch vermuten, dass sozial ängstliche Kinder aus
der für dieses Störungsbild typischen Angst vor negativer Bewertung dazu neigen, sich
angepasst und sozial erwünscht darzustellen, um nicht unangenehm aufzufallen (DiBartolo,
Albano, Barlow & Heimberg, 1998). Dass diese Kinder ihre Angstsymptomatik bagatellisie-
ren oder verschweigen (Krain & Kendall, 2000; Kristensen & Torgersen, 2006), könnte
auch darauf zurückzuführen sein, dass der Behandlungswunsch häufig nicht von den Kin-
dern, sondern von den Eltern ausgeht. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Ska-
lenmittelwerte der meisten Kinder bereits vor dem Training nicht im klinisch auffälligen
Bereich lagen. Somit wird eine Reduktion der Angstsymptomatik nach dem Training auf-
grund der nach unten eingeschränkten Differenzierungsmöglichkeit unwahrscheinlicher
(Bodeneffekt). Auch in einer Studie von Barrington, Prior, Richardson und Allen (2005)
wiesen 10 % der Kinder, die die Kriterien für die Diagnose einer Angststörung (nach
7 Diskussion 174
DSM-IV) erfüllten, in einem Angstfragebogen (SCAS; Spence, 1998) Werte auf, die eine
Standardabweichung oder mehr unter dem Altersdurchschnitt lagen. Trotz dieser Ein-
schränkungen wird auch in vergleichbaren Studien das Ausmaß des Angsterlebens häufig
schon bei Kindern ab einem Alter von 8 Jahren erhoben, weil internalisierende Auffällig-
keiten nur eingeschränkt einer Beobachtung zugänglich sind und Eltern keine vollständigen
Informationen über das Erleben ihrer Kinder besitzen. Anderen Studien (z. B. Joormann &
Unnewehr, 2002b; Kley et al., 2012; Melfsen et al., 2003) ist es bisher gelungen, die Wirk-
samkeit der eingesetzten Interventionen auch anhand des Kinderurteils nachzuweisen.
Dass in diesen Studien bessere Ergebnisse erzielt wurden, könnte auf die größeren Stich-
proben und/oder das höhere Alter der Kinder zurückgeführt werden. Nichtsdestotrotz
wird anhand der angestellten Überlegungen deutlich, wie wichtig es ist, angenehme Rah-
menbedingungen für die diagnostische Untersuchung zu schaffen und geeignete Frage-
bogenverfahren zu verwenden, um den Kindern die Auseinandersetzung mit ihren Ängsten
zu erleichtern.
Im Hinblick auf die kurzfristige Wirksamkeit des Trainings fiel das Urteil der Lehrer zur
Angstsymptomatik erwartungswidrig aus: Aus Sicht der Lehrer hatte die Teilnahme am
Training keinen signifikanten Effekt auf die Verringerung der Angstsymptomatik der
Kinder (gemessen mit dem DISYPS-KJ: FBB-ANG). Auf den beiden Skalen „Soziale
Phobie“ und „Generalisierte Angst“ zeigte sich im Interventionszeitraum zwar eine
hypothesenkonforme Verringerung der Angstsymptomatik in der Interventionsgruppe;
allerdings fand sich eine vergleichbare Abnahme der Angstsymptomatik während des
Wartezeitraums auch in der Wartekontrollgruppe. Da sozial ängstliche Kinder gewöhnlich
angepasst und artig sind, wird ihr Verhalten von den Lehrern oft als unauffällig wahr-
genommen. Dass sich die Angstsymptomatik der Kinder in der Interventionsgruppe nicht
stärker verbessert hat als in der Wartekontrollgruppe, könnte also beispielsweise mit einem
Sensibilisierungseffekt zu erklären sein (Hinsch & Pfingsten, 2007): Demnach urteilen die
Lehrer in der Interventionsgruppe strenger, weil sie mit einer Verhaltensänderung durch
die Teilnahme am Training rechnen und besonders auf das Verhalten der am Training teil-
nehmenden Kinder achten. Durch den Sensibilisierungseffekt kann eine tatsächlich erzielte
Veränderung verringert bzw. kompensiert werden, so dass der (falsche) Eindruck entsteht,
dass sich am Verhalten der Kinder wenig bzw. nichts geändert hätte.
7 Diskussion 175
Die beiden Skalen „Trennungsangst“ und „Spezifische Phobie“ sowie die Gesamtskala
„Angststörungen“ konnten bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden, weil viele
Lehrer zu diesen Störungsbereichen keine Auskünfte geben konnten. Die für die Beant-
wortung des Fragebogens erforderlichen Informationen über die innere Befindlichkeit der
Kinder (u. a. Gedanken, Gefühle, Körperliche Symptome) waren den Lehrern offensicht-
lich nicht oder nur unzureichend zugänglich. Bisher gibt es nur wenige Studien, die die
Wirksamkeit eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprogramms unter Einbezug
eines Lehrerurteils überprüft haben. Auch diesen Studien (z. B. Heyne et al., 2002; King et
al., 1998) ist es bislang nicht gelungen, anhand des Lehrerurteils signifikante Therapie-
effekte nachzuweisen.
Depressive Symptomatik
Anschließend wurde anhand des Elternurteils der Frage nachgegangen, ob das für die
Behandlung von sozial ängstlichen Kindern entwickelte Training auch einen Einfluss auf
eine gegebenenfalls vorhandene komorbide depressive Symptomatik hat. Dabei wurde
angenommen, dass die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar nach dem Ende des
Trainings eine stärkere Reduktion der komorbiden depressiven Symptomatik aufweisen als
die Kinder der Wartekontrollgruppe.
Im Hinblick auf die kurzfristige Verringerung der komorbiden depressiven Symptomatik
(gemessen mit dem DISYPS-KJ: FBB-DES) ließ sich jedoch entgegen den Erwartungen
kein signifikanter Unterschied zwischen den Kindern beider Gruppen nachweisen. Somit
konnten die in früheren Studien gefundenen positiven Effekte von kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Interventionen zur Behandlung von Angststörungen auf die Depressivität
der Kinder (z. B. Farrell et al., 2005; Manassis et al., 2002; Suveg et al., 2009) nicht bestätigt
werden.
Dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung nicht mit den Befunden vergleichba-
rer Studien übereinstimmen, lässt sich möglicherweise damit erklären, dass für die Beurtei-
lung der depressiven Symptomatik unterschiedliche Informationsquellen herangezogen
wurden: Während in den meisten Studien das Selbsturteil der Kinder erfasst wurde (z. B.
Farrell et al., 2005; Kendall, Safford et al, 2004; Manassis et al., 2002; Muris et al., 2002;
Nauta et al., 2003; Suveg et al., 2009), wurde in der vorliegenden Studie das Fremdurteil der
Eltern erhoben. Wenn Informationen von verschiedenen Beurteilern eingeholt werden,
7 Diskussion 176
treten häufig Diskrepanzen zwischen den Angaben der Beurteiler auf (Achenbach et al.,
1987). Eine Ursache für die voneinander abweichenden Angaben kann, insbesondere bei
der Beurteilung von internalisierenden Auffälligkeiten, die unterschiedliche Informations-
grundlage der Beurteiler sein: Informationen über die innere Befindlichkeit eines Kindes
(u. a. Gedanken, Gefühle, Körperliche Symptome) sind den verschiedenen Beurteilern
(z. B. Kindern, Eltern) unterschiedlich gut zugänglich (Döpfner & Petermann, 2008).
Diesem Umstand sollte in zukünftigen Studien durch den zusätzlichen Einsatz von Selbst-
beurteilungsfragebogen zur Erfassung der komorbiden depressiven Symptomatik begegnet
werden (z. B. Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ), Stiensmeier-Pelster, Schür-
mann & Duda, 2000; Depressionstest für Kinder (DTK), Rossmann, 2005). Darüber hinaus
fällt bei genauerer Betrachtung der vorliegenden Daten auf, dass die Depressivitätswerte
der Kinder schon vor dem Training nicht im klinisch auffälligen Bereich lagen (vgl. Anhang
3). Die Mehrheit der Kinder wurde von den Eltern als gar nicht oder nur ein wenig depres-
siv eingeschätzt, was zur Folge hat, dass diese niedrigen Depressivitätswerte durch die Teil-
nahme am Training kaum noch verringert werden können (Bodeneffekt).
Schulbezogenes Sozialverhalten
Weiterhin wurde anhand des Urteils der Lehrer überprüft, ob mit dem Training kurzfristige
Effekte auf das in der Schule beobachtbare Sozialverhalten der Kinder erzielt werden. Es
wurde angenommen, dass sich durch die Teilnahme am Training die sozialen Fertigkeiten
der Kinder verbessern, d. h. die Kinder der Interventionsgruppe sollten unmittelbar nach
dem Training eine stärkere Verbesserung des schulbezogenen Sozialverhaltens aufweisen
als die Kinder der Wartekontrollgruppe.
Im Hinblick auf die kurzfristige Verbesserung des in der Schule gezeigten Sozialverhaltens
(gemessen mit der LSL) ließ sich jedoch entgegen den Erwartungen kein signifikanter Un-
terschied zwischen den Kindern beider Gruppen nachweisen. Wurden die vorliegenden
Daten mit nicht-parametrischen Testverfahren ausgewertet, fand sich dahingehend ein
hypothesenkonformer Unterschied, dass die Kinder der Interventionsgruppe unmittelbar
nach dem Training auf der Skala „Selbstkontrolle“ signifikant niedrigere Werte aufwiesen
als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Hier ergibt sich ein mittlerer Effekt zugunsten der
Interventionsgruppe. Bei (sozial) ängstlichen Kindern, die sich (nicht nur) im Schulalltag
7 Diskussion 177
überangepasst und sehr diszipliniert verhalten (Baumeister, 2001), ist die Verringerung der
Selbstkontrolle ein angestrebtes Therapieziel.
Auch in anderen Wirksamkeitsstudien ist es bisher nicht gelungen, die Verbesserung des
Sozialverhaltens mit Hilfe eines Fragebogenverfahrens nachzuweisen (Suveg et al., 2009;
Wekenmann, 2009). Möglicherweise bedarf es zur Erfassung der sozialen Kompetenz eines
differenzierteren und veränderungssensitiveren Messinstruments. Neben dem Einsatz von
Fragebogenverfahren sollten zukünftig auch systematische Verhaltensbeobachtungen
durchgeführt werden. Dabei könnten realitätsnahe soziale Situationen (z. B. ein Gespräch
mit einem neuen Mitschüler führen, einen Vortrag vor einer Klasse halten, in einer Diskus-
sion die eigene Meinung vertreten) im diagnostischen Rollenspiel simuliert werden, um
soziale Fertigkeiten mit Hilfe eines standardisierten Beobachtungsverfahrens zu erfassen.
Interventionen zur Förderung der sozialen Kompetenz sind deshalb nicht immer erfolg-
reich, weil der Anteil des sozialen Umfelds an den Problemen der Kinder außer Acht gelas-
sen wird (Hymel, Wagner & Butler, 1990). Um nachhaltige Behandlungserfolge zu erzielen,
müssen auch die Personen im sozialen Umfeld der Kinder bereit sein, ihr Verhalten zu
verändern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Kinder soziale Kompetenzen zwar
erwerben, aber nicht anwenden (Borg-Laufs, 2001). Das Lehrerurteil könnte auch darauf
hindeuten, dass die Anwendung der erworbenen bzw. bereits vorhandenen sozialen Fertig-
keiten im schulischen Alltag noch nicht ausreichend gelingt. Diesem Umstand könnte mit
einer stärkeren Einbindung der Lehrer in die Behandlung der Kinder begegnet werden (z.
B. Durchführung von Expositionsübungen in der Schule, Einsatz eines Verstärkerplans).
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Urteil der Eltern die kurzfristige Wirksamkeit
des vorliegenden Trainingsprogramms eindeutig bestätigt: Nach Ansicht der Eltern wurde
die Angstsymptomatik der Kinder durch die Teilnahme am Training signifikant verringert.
Im Urteil der Kinder und Lehrer ließen sich dagegen keine signifikanten Veränderungen in
der Angstsymptomatik nachweisen. Die Möglichkeit, mit einer größeren Stichprobe deut-
lichere Ergebnisse zu erzielen, erscheint aussichtsreich, weil sich die Skalenmittelwerte
zwischen den beiden Messzeitpunkten „Prätest“ und „Posttest“ im Kinder- und Lehrer-
urteil zwar (noch) nicht signifikant, so aber doch hypothesenkonform veränderten. Für die
7 Diskussion 178
depressive Symptomatik (Elternurteil) und das schulbezogene Sozialverhalten (Lehrerurteil)
konnten in der vorliegenden Studie keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden.
7.1.2 Langfristige Trainingseffekte
Weitere zu prüfende Annahmen der vorliegenden Studie betrafen die langfristige Wirksam-
keit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b). Die
langfristigen Effekte des Trainingsprogramms wurden getrennt für Interventionsgruppe
und Wartekontrollgruppe ermittelt; dabei wurden die über drei Messzeitpunkte hinweg
auftretenden Veränderungen innerhalb der beiden Gruppen betrachtet.
Angstsymptomatik
In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst überprüft, ob mit dem Training langfristige
Effekte auf die Angstsymptomatik der Kinder erzielt werden. Es wurde angenommen, dass
die durch das Training erzielte Reduktion der Angstsymptomatik über einen Zeitraum von
sechs Monaten stabil bleibt, d. h. die Angstsymptomatik der Kinder sollte sich in den sechs
Monaten nach dem Training nicht verändern.
Im Urteil der Eltern zeigte sich erwartungsgemäß, dass die durch die Trainingsteilnahme
erzielte Reduktion der Angstsymptomatik (gemessen mit dem DISYPS-KJ: FBB-ANG)
über einen Zeitraum von sechs Monaten aufrechterhalten wird. Während sich die Werte
im Interventionszeitraum auf den Skalen „Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und
„Soziale Phobie“ sowie auf der Gesamtskala „Angststörungen“ signifikant verringerten,
blieben die Werte zwischen den beiden Messzeitpunkten „Posttest“ und „Follow up“ auf
allen Skalen stabil bzw. nahmen in der Wartekontrollgruppe auf der Skala „Soziale Phobie“
sowie auf der Gesamtskala „Angststörungen“ noch weiter ab. Die signifikanten Ergebnisse
auf diesen beiden Skalen gehen über die zuvor formulierten Annahmen hinaus, können
aber aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe nicht eindeutig auf das Trainingsprogramm
zurückgeführt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Vermittlung grundlegender sozialer
Kompetenzen und der gelungene Transfer auf die verschiedenen Lebensbereiche zu dieser
weiteren Verbesserung der Angstsymptomatik geführt haben. Auch im langfristigen Ver-
lauf zwischen den Messzeitpunkten „Prätest“ und „Follow up“ ließ sich auf den Skalen
„Trennungsangst“, „Generalisierte Angst“ und „Soziale Phobie“ sowie auf der Gesamt-
7 Diskussion 179
skala „Angststörungen“ eine signifikante Verbesserung der Angstsymptomatik nachweisen;
in der Wartekontrollgruppe erstaunlicherweise auch auf der Skala „Spezifische Phobie“,
obwohl das vorliegende Trainingsprogramm nicht auf die Behandlung von Spezifischen
Phobien ausgerichtet ist.
Mit kleinen bis mittleren Effektstärken von d‘ = 0.09 bis d‘ = 0.57 für den Vergleich
zwischen den Messzeitpunkten „Posttest“ und „Follow up“ und großen Effektstärken von
d‘ = 0.88 bis d‘ = 2.12 für den Vergleich zwischen den Messzeitpunkten „Prätest“ und
„Follow up“ konnten in der vorliegenden Studie vergleichbare Ergebnisse erzielt werden
wie in ähnlichen Studien zur Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Therapie-
manuale bei Angststörungen im Kindes- und Jugendalter (Heyne et al., 2002; Kendall et al.,
2008; Silverman et al., 1999a). Auch die im Rahmen einer Meta-Analyse von In-Albon und
Schneider (2007) errechneten Effektstärken von d‘ = 0.61 (Kendall & Southam-Gerow,
1996), d‘ = 0.82 (Barrett et al., 2001) und d‘ = 1.54 (Kendall et al., 2004) für die langfristige
Wirksamkeit fielen vergleichbar hoch aus. Dementsprechend zeigen die Ergebnisse der
vorliegenden Studie in Übereinstimmung mit früheren Befunden, dass die Behandlungs-
erfolge über einen Zeitraum von sechs Monaten aufrechterhalten und teilweise sogar noch
verbessert werden können.
Der durch die Trainingsteilnahme bereits reduzierte Leidensdruck der Kinder veränderte
sich in den sechs Monaten nach dem Training nicht mehr. Unmittelbar nach dem Training
gaben 78.6 % (IG) bzw. 90.9 % (KG) der Eltern an, dass ihre Kinder unter der Angst-
symptomatik gar nicht mehr oder nur noch ein wenig leiden würden; sechs Monate nach
dem Training waren es sogar 78.6 % (IG) bzw. 100.0 % (KG) der Eltern. Auch die bereits
verbesserte Funktionsfähigkeit der Kinder konnte über einen Zeitraum von sechs Monaten
aufrechterhalten werden. Unmittelbar nach dem Training waren – laut Elternurteil – bei
64.3 % (IG) bzw. 63.6 % (KG) der Kinder die Beziehungen zu anderen Menschen
und/oder die schulische Leistungsfähigkeit gar nicht mehr oder nur noch ein wenig beein-
trächtigt; sechs Monate nach dem Training zeigten schon 78.6 % (IG) bzw. 72.7 % (KG)
der Kinder keine entsprechenden Beeinträchtigungen mehr.
In internationalen Studien zur Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Inter-
ventionen bei Angststörungen im Kindes- und Jugendalter wurden zum Katamnesezeit-
punkt (nach ½ bis 7 Jahren) Besserungsraten von 64 % bis 90 % ermittelt (z. B. Barrett
et al., 2001; Beidel et al., 2005, 2006; Kendall et al., 2004, 2008). Die in der vorliegenden
7 Diskussion 180
Studie erzielten Veränderungen vom dysfunktionalen in den funktionalen Bereich sind mit
diesen Ergebnissen annähernd vergleichbar und somit als zufriedenstellend zu bewerten.
Im Gegensatz zur Einschätzung der Eltern entsprach das Urteil der Kinder zur Angst-
symptomatik (gemessen mit der SASC-R-D) nicht den Erwartungen: Obwohl sich die
Werte auf der Skala „Furcht vor negativer Bewertung“ zwischen den drei Messzeitpunkten
(Prätest, Posttest, Follow up) kontinuierlich verringerten, erreichten diese Veränderungen
keine statistische Signifikanz. Auch die Werte auf der Skala „Vermeidung von und Belas-
tung durch soziale Situationen“ (SAD) verringerten sich im Interventionszeitraum nicht
signifikant. Erst im Katamnesezeitraum trat eine signifikante Verringerung der Angst-
symptomatik in der Interventionsgruppe ein, während die Angstsymptomatik in der Warte-
kontrollgruppe weiterhin unverändert blieb. Im langfristigen Verlauf zwischen den Mess-
zeitpunkten „Prätest“ und „Follow up“ ließ sich in der Interventionsgruppe auf der SAD-
Skala eine signifikante Verringerung der Angstsymptomatik mit großen Effekten nachwei-
sen. In der Wartekontrollgruppe wurde die Signifikanz auf der SAD-Skala knapp verfehlt.
Bei der genauen Betrachtung des kindlichen Urteils fällt auf, dass die Kinder zwar auf der
Verhaltensebene einzelne Erfolge erzielten, nicht jedoch auf der kognitiven Ebene. Das
könnte sich dadurch erklären lassen, dass im Rahmen des vorliegenden Trainings-
programms mehr verhaltenstherapeutische (wie z. B. Rollenspiele, Expositionsübungen,
Hausaufgaben) als kognitive Methoden (wie z. B. Selbstinstruktionen) eingesetzt werden.
Der zeitlich verzögerte Trainingseffekt auf der SAD-Skala könnte auf eine gesteigerte
Wahrnehmung (Sensibilisierungseffekt) und/oder Offenbarung von Angstsymptomen
(Verringerung der Dissimulationstendenz) zum Zeitpunkt unmittelbar nach dem Training
zurückzuführen sein. Diese beiden Aspekte könnten den Trainingserfolg im Kinderurteil
zunächst verringert haben, indem sie die Werte der Kinder im Posttest erhöht haben.
Im Hinblick auf die langfristige Wirksamkeit des Trainings fiel das Urteil der Lehrer zur
Angstsymptomatik (gemessen mit dem DISYPS-KJ: FBB-ANG) uneinheitlich aus:
Während sich die Werte der Interventionsgruppe auf der Skala „Generalisierte Angst“ im
Interventionszeitraum signifikant verringerten und zwischen den Messzeitpunkten „Post-
test“ und „Follow up“ stabil blieben, nahmen die Werte auf der Skala „Soziale Angst“ erst
im langfristigen Verlauf zwischen „Prätest“ und „Follow up“ signifikant ab. Auf beiden
Skalen erreichten diese Veränderungen das Ausmaß großer Effekte. Im Gegensatz dazu
veränderten sich die Werte der Wartekontrollgruppe über die verschiedenen Messzeit-
7 Diskussion 181
punkte hinweg nicht signifikant, wobei die Gründe für die uneinheitlichen Ergebnisse
unklar bleiben. Die beiden Skalen „Trennungsangst“ und „Spezifische Phobie“ sowie die
Gesamtskala „Angststörungen“ konnten bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden,
weil viele Lehrer zu diesen Störungsbereichen keine Auskünfte geben konnten. Somit kann
die Annahme, dass die mit dem Training erzielte Reduktion der Angstsymptomatik über
einen Zeitraum von sechs Monaten aufrechterhalten wird, anhand des Lehrerurteils vorerst
nicht bestätigt werden.
Bisher wurde das Lehrerurteil nur selten herangezogen, um die Wirksamkeit eines kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Therapieprogramms zu überprüfen. Hinsichtlich der Reduktion
internalisierender Auffälligkeiten fanden King und Kollegen (1998) im Lehrerurteil zwar
signifikante Unterschiede innerhalb der Interventionsgruppe (Prätest, Posttest, Follow up),
aber keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventionsgruppe und der Warte-
kontrollgruppe. Heyne und Kollegen (2002) berichteten, dass die aus Sicht der Lehrer
erzielten Behandlungserfolge in den Monaten nach der kognitiv-verhaltenstherapeutischen
Intervention nicht aufrechterhalten werden konnten. Es bliebe zu prüfen, ob der Transfer
in den schulischen Alltag und damit die Wirksamkeit der Therapie gesteigert werden kann,
wenn die Lehrer stärker in die Behandlung der Kinder einbezogen werden.
Depressive Symptomatik
Anschließend wurde anhand des Urteils der Eltern überprüft, ob mit dem Training auch
langfristige Effekte auf eine eventuell vorhandene komorbide depressive Symptomatik der
Kinder erzielt werden. Es wurde angenommen, dass die durch das Training erzielte Reduk-
tion der depressiven Symptomatik über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil bleibt,
d. h. die depressive Symptomatik der Kinder sollte sich in den sechs Monaten nach dem
Training nicht verändern.
Im Urteil der Eltern zeigte sich erwartungsgemäß, dass die Teilnahme am Training einen
signifikanten Effekt auf die Verringerung der depressiven Symptomatik (gemessen mit dem
DISYPS-KJ: FBB-DES) hat. Während sich die Werte auf der Gesamtskala „Depressive
Störungen“ im Interventionszeitraum signifikant verringerten, blieben die Werte zwischen
den beiden Messzeitpunkten „Posttest“ und „Follow up“ in der Interventionsgruppe stabil
bzw. nahmen in der Wartekontrollgruppe noch weiter ab. Auch im langfristigen Verlauf
zwischen den Messzeitpunkten „Prätest“ und „Follow up“ konnte auf der Gesamtskala
7 Diskussion 182
„Depressive Störungen“ eine signifikante Verringerung der depressiven Symptomatik
nachgewiesen werden. Für diese Veränderungen fielen die Effektstärken überwiegend groß
aus. Damit stehen die innerhalb beider Gruppen erzielten Ergebnisse der vorliegenden
Studie in Einklang mit den Ergebnissen früherer Studien, die die Effekte von kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Interventionen zur Behandlung von Angststörungen auf die
Depressivität von Kindern untersucht haben (z. B. Barrett et al., 2001; Kendall et al., 2004;
Kendall & Southam-Gerow, 1996).
Da Depressive Störungen häufig als Folge von Angststörungen auftreten (Cole et al., 1998),
hat die Behandlung der Angststörung vermutlich auch zu einer Verringerung der depressi-
ven Symptomatik geführt. Eine weitere mögliche Erklärung für die Verringerung der
depressiven Symptomatik könnten die inhaltlichen Überschneidungen (z. B. Kognitive
Umstrukturierung, Soziales Kompetenztraining) zwischen den kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Therapieprogrammen zur Behandlung von Angststörungen und Depressiven
Störungen sein.
Schulbezogenes Sozialverhalten
Zuletzt wurde anhand des Urteils der Lehrer überprüft, ob mit dem Training langfristige
Effekte auf das in der Schule beobachtbare Sozialverhalten der Kinder erzielt werden. Die
Annahme, dass die durch das Training erzielte Verbesserung des schulbezogenen Sozial-
verhaltens über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil bleibt, konnte nicht bestätigt
werden. Die von den Lehrern (anhand der LSL) vorgenommenen Einschätzungen führten
zu uneindeutigen Ergebnissen: Obwohl die Werte auf den Skalen „Kooperation“, „Selbst-
wahrnehmung“, „Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft“, „Selbstbehauptung“ und
„Sozialkontakt“ in der Interventionsgruppe zwischen den drei Messzeitpunkten (Prätest,
Posttest, Follow up) kontinuierlich anstiegen, erreichten diese Veränderungen keine statisti-
sche Signifikanz. Die Werte auf der Skala „Selbstkontrolle“ verringerten sich dagegen im
Interventionszeitraum, wenn auch nicht signifikant. Da es sich bei (sozial) ängstlichen
Kindern um überangepasste Schüler handelt, die sich (nicht nur) im Schulalltag sehr diszi-
pliniert verhalten (Baumeister, 2001), wird bei diesen Kindern eine Verringerung der
Selbstkontrolle ausdrücklich angestrebt. Allerdings stiegen die Werte auf der Skala „Selbst-
kontrolle“ im Katamnesezeitraum wieder signifikant an, so dass für diesen Aspekt des
Sozialverhaltens kein nachhaltiger Effekt erzielt wurde.
7 Diskussion 183
Erst im langfristigen Verlauf zwischen den Messzeitpunkten „Prätest“ und „Follow up“
ließ sich in der Interventionsgruppe auf den Skalen „Kooperation“, „Hilfsbereitschaft und
Einfühlungsvermögen“, „Selbstbehauptung“ und „Sozialkontakt“ eine signifikante Verbes-
serung des Sozialverhaltens nachweisen. Für diese Veränderungen wurden mittlere Effekt-
stärken berechnet. Die Werte auf den Skalen „Selbstwahrnehmung“ und „Selbstkontrolle“
veränderten sich bei der Betrachtung des gesamten Untersuchungszeitraums nicht signifi-
kant. Im Gegensatz dazu wurden in der Wartekontrollgruppe (so gut wie) keine signifikan-
ten Veränderungen des schulbezogenen Sozialverhaltens aus Sicht der Lehrer festgestellt.
Das Lehrerurteil lässt vermuten, dass die Anwendung der erworbenen bzw. bereits vor-
handenen sozialen Fertigkeiten im schulischen Alltag noch nicht ausreichend gelungen ist.
Dass die Lehrer die Verhaltensänderungen der Kinder erst verzögert wahrnehmen, könnte
ferner darauf hindeuten, dass die Kinder ihre Verhaltensänderungen über einen längeren
Zeitraum zeigen müssen, damit diese von den Lehrern nicht mehr als „zufällig“ bewertet
werden. Um den Transfer der Behandlungserfolge auf den schulischen Alltag zu verbessern
und die Wirksamkeit des Trainings zu steigern, sollten die Lehrer zukünftig stärker in die
Behandlung der Kinder einbezogen werden.
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kinder-, Eltern- und Lehrerurteile auf
die langfristige Stabilität der erzielten Behandlungserfolge hinweisen. Bei der Interpretation
der Ergebnisse zur langfristigen Wirksamkeit des Trainingsprogramms muss allerdings
berücksichtigt werden, dass die Aussagekraft der Ergebnisse durch den geringen Umfang
der Stichprobe und das Fehlen einer zum Katamnesezeitpunkt noch unbehandelten
Kontrollgruppe eingeschränkt ist. Die Forderung einer solchen Kontrollgruppe ist jedoch
ethisch umstritten, weil eine Wartezeit von (mehr als) 12 Monaten für die behandlungs-
bedürftigen Kinder nicht zumutbar wäre. Insgesamt zeigt sich, dass sich viele abhängige
Variablen zwar innerhalb der Gruppen signifikant veränderten, allerdings (noch) nicht so
stark, dass auch beim Vergleich von Interventions- und Wartekontrollgruppe signifikante
Ergebnisse erzielt worden wären.
7 Diskussion 184
7.1.3 Differentielle Trainingseffekte
Neben der Überprüfung der generellen Wirksamkeit des „Trainings mit sozial unsicheren
Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) wurde in der vorliegenden Arbeit erstmals
auch die differentielle Wirksamkeit dieses Trainingsprogramms untersucht. Anhand des
Elternurteils wurde der Frage nachgegangen, ob und gegebenenfalls wie das Geschlecht, das
Alter, die Intelligenz und die Depressivität der Kinder die Wirksamkeit des Trainings-
programms zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter beeinflussen.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die vorliegende Studie in Bezug
auf die Überprüfung der differentiellen Wirksamkeit lediglich explorativen Charakter besaß.
Geschlecht
Die Annahme, dass das Geschlecht der Kinder keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des
Trainings hat, konnte ausnahmslos bestätigt werden. Im Hinblick auf die Verringerung der
Angstsymptomatik ließ sich im Elternurteil erwartungsgemäß kein signifikanter Unterschied
zwischen Mädchen und Jungen nachweisen. Mädchen und Jungen profitierten gleicher-
maßen von der Teilnahme am Training. Auch in anderen Wirksamkeitsstudien konnte bis-
her kein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht des Kindes und dem Behandlungs-
erfolg festgestellt werden (z. B. Ahrens-Eipper, 2003; Beidel et al., 2000; Berman et al.,
2000; Kühl, 2005; Treadwell et al., 1995; Suveg et al., 2009). Aus der vorliegenden Studie
lassen sich keine Hinweise für die Notwendigkeit einer weiterführenden, geschlechts-
spezifischen Modifizierung des Trainings ableiten.
Alter
Auch die Annahme, dass das Alter der Kinder keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des
Trainings hat, konnte durchgehend bestätigt werden. Gemessen an der Verringerung der
Angstsymptomatik konnte im Urteil der Eltern hypothesenkonform kein Unterschied
zwischen jüngeren Kindern (7 bis 9 Jahre) und älteren Kindern (10 bis 12 Jahre) festgestellt
werden. Demzufolge profitierten Kinder unterschiedlichen Alters gleichermaßen von der
Teilnahme am Training. Dieser Befund stimmt mit den Ergebnissen bisheriger Forschung
überein, die aufzeigen, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapieprogramme zur
Behandlung von Angststörungen bei jüngeren Kindern genauso erfolgreich sind wie bei
7 Diskussion 185
älteren Kindern (z. B. Ahrens-Eipper, 2003; Alfano et al., 2009; Beidel et al., 2000; Berman
et al., 2000; Kendall et al., 1997; Kühl, 2005; Suveg et al., 2009). Ausgehend von den
Ergebnissen der vorliegenden Studie ergibt sich somit keine Notwendigkeit für eine alters-
spezifische Modifizierung des Trainings.
Intellektuelle Leistungsfähigkeit
Die Annahme, dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder keinen Einfluss auf die
Wirksamkeit des Trainings hat, konnte nicht eindeutig bestätigt werden. Kinder mit
niedrigerer Intelligenz (IQ 105) und Kinder mit höherer Intelligenz (IQ > 105)2
Depressive Symptomatik
unter-
schieden sich im Hinblick auf die Verringerung der Angstsymptomatik im Elternurteil zwar
erwartungsgemäß nicht signifikant voneinander; die Kinder mit höherer Intelligenz wiesen
jedoch im Gegensatz zu den Kindern mit niedrigerer Intelligenz auf einzelnen Skalen signi-
fikant niedrigere Angstwerte auf als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Dieses Ergebnis
lässt zwar vermuten, dass Kinder mit unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten in ähn-
lichem Maße von der Teilnahme am Training profitieren; es kann allerdings nicht sicher
ausgeschlossen werden, dass Kinder mit höherer Intelligenz dabei leicht im Vorteil sind.
Bislang liegen keine vergleichbaren Studien vor, die den Einfluss der intellektuellen
Leistungsfähigkeit auf die Wirksamkeit eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Trainings
zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter untersucht haben.
Die Annahme, dass das Vorliegen einer komorbiden depressiven Symptomatik einen
ungünstigen Einfluss auf die Wirksamkeit des Trainings hat, konnte nicht bestätigt werden.
Entgegen der formulierten Hypothese ließ sich im Urteil der Eltern kein signifikanter
Unterschied zwischen Kindern mit schwächerer depressiver Symptomatik und Kindern mit
stärkerer depressiver Symptomatik finden; alle Kinder wiesen – unabhängig vom Ausmaß
der depressiven Symptomatik – eine vergleichbare Verringerung der Angstsymptomatik
auf. Dieses Ergebnis legt die Vermutung nahe, dass Kinder mit unterschiedlicher Depressi-
vität gleichermaßen von der Teilnahme am Training profitieren. Die bisher vorliegenden
2 Die Interventionsgruppe wurde im Hinblick auf den Einflussfaktor „Intellektuelle Leistungsfähigkeit“
mittels Mediandichotomisierung (zum 1. Messzeitpunkt) in zwei Gruppen aufgeteilt und mit der Warte-kontrollgruppe verglichen.
7 Diskussion 186
Studien kommen hier zu divergenten Ergebnissen: Während sich in einigen Studien
ungünstige Effekte einer komorbiden depressiven Symptomatik auf den Erfolg eines kog-
nitiv-verhaltenstherapeutischen Therapieprogramms zur Behandlung von Angststörungen
im Kindes- und Jugendalter zeigten (z. B. Berman et al., 2000; Crawley et al., 2008; O’Neil
& Kendall, 2012), fanden zahlreiche Studien keine Effekte einer komorbiden psychischen
Störung auf das Behandlungsergebnis (z. B. Ahrens-Eipper, 2003; Alfano et al., 2009;
Kendall et al., 1997; Kendall et al., 2001).
Für die vorliegende Studie muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die zu
vergleichenden Gruppen (z. B. Kinder mit schwächerer vs. stärkerer depressiver Sympto-
matik) sehr klein waren, so dass die Ergebnisse zur differentiellen Wirksamkeit keine starke
Aussagekraft haben. Um den Einfluss verschiedener soziodemografischer, psychosozialer
und diagnostischer Merkmale auf die Wirksamkeit des Trainings genau und zuverlässig
beschreiben zu können, sollten zukünftige Untersuchungen mit größerem Stichproben-
umfang und höherer Teststärke durchgeführt werden. Weiterhin sollte ein strukturiertes,
klinisches Interviewverfahren eingesetzt werden, das eine differenzierte Klassifikation der
komorbiden psychischen Störungen nach ICD-10 und/oder DSM-IV-TR ermöglicht.
Dadurch ließe sich in weiteren Studien auch die Frage klären, ob und gegebenenfalls wie
sich verschiedene Komorbiditäten (z. B. internalisierende Störungen, externalisierende
Störungen, keine Komorbidität) auf die Wirksamkeit des Trainings auswirken.
Vor dem Hintergrund des häufigen gemeinsamen Auftretens von Angststörungen und
Depressiven Störungen sollte in Erwägung gezogen werden, die kognitiv-verhaltens-
therapeutische Behandlung von Angststörungen um einen Behandlungsbaustein zu ergän-
zen, der auf die depressive Symptomatik ausgerichtet ist (vgl. auch Crawley et al., 2008;
Hudson, Krain & Kendall, 2001). Ein solcher Behandlungsbaustein könnte beispielsweise
den zusätzlichen Aufbau von Aktivitäten beinhalten, um die Motivation und Mitarbeit des
Kindes im Rahmen der Behandlung zu steigern. Außerdem könnte er die Umstrukturie-
rung von depressiven Kognitionen einschließen, die sich vorwiegend um Themen wie Ver-
lust und Hoffnungslosigkeit drehen (Hudson et al., 2001). Aufgrund der hohen Komorbi-
ditätsraten von Angststörungen und Depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen
ist und bleibt es wichtig, therapeutische Interventionen zu entwickeln und einzusetzen, die
auf die Behandlung beider Störungen abzielen (z. B. Chu, Colognori, Weissman & Bannon,
7 Diskussion 187
2009; Ehrenreich, Goldstein, Wright & Barlow, 2009; Weersing, Gonzalez, Campo & Lu-
cas, 2008).
7.1.4 Beurteilereffekte
Abschließend wurde überprüft, wie gut Kinder, Eltern und Lehrer bei der Beurteilung der
Angstsymptomatik übereinstimmen. Es wurde angenommen, dass sich Kinder, Eltern und
Lehrer in der Beurteilung der Angstsymptomatik deutlich unterscheiden, d. h. dass die
Übereinstimmung zwischen diesen drei Beurteilern gering ist. Diese Hypothese konnte in
der vorliegenden Studie ausnahmslos bestätigt werden. In Übereinstimmung mit den
Ergebnissen früherer Studien (z. B. Edelbrock et al., 1986; Epkins, 1996; Ferdinand et al.,
2004, 2007; Salbach-Andrae, Lenz & Lehmkuhl, 2009) zeigte sich, dass die Korrelationen
zwischen Kinder-, Eltern- und Lehrerurteilen bei der Beurteilung internalisierender Auffäl-
ligkeiten eher im unteren bis mittleren Bereich liegen.
Diese insgesamt geringe Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Beurteilern lässt
sich nach Döpfner und Petermann (2008) grundsätzlich auf mehrere Ursachen zurückfüh-
ren: Neben den nicht zu vermeidenden Messfehlern der Erhebungsinstrumente kann die absichtli-
che Verfälschung von Untersuchungsergebnissen eine mögliche Ursache für die mangelnde Über-
einstimmung zwischen den verschiedenen Beurteilern sein. Da die Untersuchungsergebnis-
se beispielsweise darüber entscheiden, ob ein Kind oder Jugendlicher einen Therapieplatz
erhält, ist es nicht verwunderlich, wenn die Beurteiler sich darum bemühen, ihre Frage-
bogenergebnisse in einer für sie möglichst günstigen Weise zu „korrigieren“. So können
Krankheitsanzeichen von den Beurteilern einerseits dramatisiert oder vorgetäuscht werden,
um als krank zu gelten (Simulation), andererseits bagatellisiert oder verschwiegen werden,
um für gesund gehalten zu werden (Dissimulation). Darüber hinaus kann ein Fragebogen
auch durch die Tendenz zum sozial erwünschten Antworten „verfälscht“ werden. Aus Scham
oder Angst vor Ablehnung können Beurteiler in ihren Antworten zu angepasstem Verhal-
ten neigen und sich dabei an den gesellschaftlich akzeptierten Normen und Erwartungen
orientieren (z. B. DiBartolo et al., 1998). Weiterhin kann die geringe Übereinstimmung
zwischen den verschiedenen Beurteilern durch unterschiedliche Urteilsanker verursacht werden.
So können beispielweise Eltern bei der Beurteilung des kindlichen Verhaltens nur mit we-
nigen Geschwistern vergleichen, während Lehrer die Möglichkeit haben, viele gleichaltrige
7 Diskussion 188
Kinder aus der Klasse oder Schule zum Vergleich heranzuziehen. Ebenso können sich
psychische Belastungen auf Seiten des Beurteilers auf die Beurteilung des kindlichen
Verhaltens auswirken; so könnte beispielsweise eine Mutter mit ausgeprägt depressiver
Symptomatik die Verhaltensprobleme des Kindes aufgrund ihrer Depressivität verzerrt
wahrnehmen. Eine weitere Ursache für die voneinander abweichenden Angaben kann die
unterschiedliche Informationsgrundlage der Beurteiler sein. Informationen über die innere Befind-
lichkeit des Kindes (u. a. Gedanken, Gefühle, Körperliche Symptome, Leidensdruck) einer-
seits und das nach außen sichtbare Verhalten des Kindes (z. B. Verweigerung) andererseits
sind den Beurteilern unterschiedlich gut zugänglich. Dementsprechend ist der Grad der
Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beurteilern bei externalisierenden Auffällig-
keiten höher als bei internalisierenden Auffälligkeiten (z. B. Grietens et al., 2004; Javo et al.,
2009; Plück et al., 1997; Salbach-Andrae, Klinkowski et al., 2009). Schließlich können die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Beurteilern auch mit den situationsspezifisch auftre-
tenden Auffälligkeiten des Kindes oder Jugendlichen erklärt werden. Gerade aufgrund dieser
Situationsabhängigkeit ist es notwendig, von allen direkt beteiligten Bezugspersonen (z. B.
Eltern, Lehrer, Trainer) Informationen zum Erleben und Verhalten des Kindes oder
Jugendlichen in den verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule, Freizeit) einzuholen.
Jeder Beurteiler ist wichtig und sollte berücksichtigt werden, weil auch die Unterschiede
zwischen den Angaben verschiedener Beurteiler eine Bedeutung haben (Treutler & Epkins,
2003). Auch bei nicht-deckungsgleichen Informationen liefert erst der Einbezug und Ver-
gleich unterschiedlicher Informationsquellen ein vollständiges Bild und gewährleistet eine
zuverlässige Diagnostik von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter.
In der klinischen Praxis versucht der Diagnostiker, die erhobenen Daten zu analysieren und
anhand der vorliegenden Daten eine dimensionale und/oder kategoriale Einordnung der
psychischen Auffälligkeiten vorzunehmen (Klinisches Urteil). Wie in der vorliegenden
Studie wird dabei üblicherweise die sog. Oder-Regel angewendet, bei der Symptome
und/oder Störungen als vorhanden betrachtet werden, wenn die diagnostischen Kriterien
aus Sicht eines Beurteilers (z. B. Kind oder Eltern) erfüllt sind. Angesichts der geringen
Beurteilerübereinstimmung bei der Beurteilung von psychischen Auffälligkeiten erscheint
diese Regel praktischer als die sog. Und-Regel, der zufolge die diagnostischen Kriterien aus
Sicht mehrerer Beurteiler (z. B. Kind und Eltern) erfüllt sein müssen, damit Symptome
und/oder Störungen als vorhanden gelten (Comer & Kendall, 2004). Dennoch werfen die
Unterschiede zwischen den Angaben der verschiedenen Beurteiler vielfältige Probleme auf,
7 Diskussion 189
insbesondere bei der Diagnostik und Klassifikation von psychischen Störungen im Kindes-
und Jugendalter (vgl. für einen Überblick De Los Reyes & Kazdin, 2005). Um weniger
geeigneten Auswertungsstrategien (z. B. einen beliebigen Beurteiler auswählen, die Daten
aller Beurteiler getrennt auswerten) entgegenzuwirken, haben sich vereinzelte Forscher
bemüht, Modelle und Algorithmen für die Integration komplexer Datenmengen zu ent-
wickeln (z. B. De Los Reyes & Kazdin, 2005; Kraemer et al., 2003; Piacentini, Cohen &
Cohen, 1992). Mit Hilfe dieser Modelle sollen die Informationen verschiedener Beurteiler
integriert und Hypothesen abgeleitet werden, die sich experimentell überprüfen lassen.
Diese Modelle scheinen sich jedoch in der klinischen Forschung bisher nicht durchgesetzt
zu haben.
7 Diskussion 190
7.2 Zusammenfassende Diskussion der Methoden
7.2.1 Studiendesign
Bei der Bewertung der Ergebnisse sollten auch die folgenden methodischen Stärken und
Schwächen der Studie bedacht werden: Unter Berücksichtigung der Gütekriterien für
Therapiestudien (vgl. Rief, Exner & Martin, 2006) ist die randomisierte Zuordnung der
Patienten zu den beiden Behandlungsgruppen als besondere Stärke der vorliegenden
Untersuchung hervorzuheben. Denn nach wie vor gelten die randomisierten, klinischen
Studien (Randomized Clinical Trials, RCT) in der Therapieforschung als „Goldstandard“.
Weiterhin wurde für die Trainingsdurchführung ein ausführliches Behandlungsmanual ein-
gesetzt, das die Interventionstechniken detailliert beschreibt und dadurch die Vergleichbar-
keit und Replizierbarkeit des therapeutischen Vorgehens gewährleistet. Die Behandlungs-
integrität (treatment adherence), d. h. die strikte Einhaltung des Behandlungsmanuals, wurde
durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen der durchgeführten Trainingssitzungen
kontrolliert.
Die vergleichsweise geringe Berufserfahrung der Therapeutin und das noch nicht
abgeschlossene Studium der Co-Therapeuten mögen als methodische Einschränkung
erscheinen, zumal sich Therapeutenvariablen (z. B. Geschlecht, Ausbildungsstatus, Berufs-
erfahrung) als wesentliche Faktoren für das Zustandekommen von Therapieeffekten
herausgestellt haben (Beutler et al., 2004). Hinsichtlich der Effektivität zeigte sich jedoch in
vielen Studien, dass nonprofessionelle Therapeuten (z. B. Eltern, Lehrer) und semi-
professionelle Therapeuten (z. B. Studenten) den professionellen Therapeuten bei der
Behandlung psychischer Störungen zumindest ebenbürtig waren (vgl. Weisz et al., 1987,
1995, für Meta-Analysen über insgesamt 108 bzw. 150 Studien). Dabei wird deutlich, dass
der Therapieerfolg zumindest teilweise auch auf Kompetenzen beruht, die nicht nur in
einer professionellen Ausbildung vermittelt werden (Caspar & Grosse Holtforth, 2009).
Nichtsdestotrotz wurde in der vorliegenden Studie Wert auf die gründliche Schulung und
begleitende Supervision der Trainer gelegt, um die Qualität des therapeutischen Arbeitens
sicherzustellen und gegebenenfalls auch zu verbessern.
Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Erwartung von Behandlungseffekten
auf Seiten der Kinder und Eltern die Ergebnisse der vorliegenden Studie beeinflusst hat.
7 Diskussion 191
Dem sollte in zukünftigen Evaluationsstudien durch den zusätzlichen Einsatz „blinder“
Beurteiler begegnet werden, die den Zustand des Patienten beurteilen, ohne zu wissen,
welcher Behandlungsbedingung der Patient angehört. Im Sinne der Objektivität empfiehlt
es sich, diese „blinden“ Beurteiler sowohl für die Indikationsstellung als auch für die
Veränderungsmessung heranzuziehen.
Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass mit sechs Monaten ein relativ kurzer
Katamnesezeitraum gewählt wurde. In weiterführenden Studien sollte überprüft werden,
ob die nachgewiesenen Trainingserfolge auch über einen (deutlich längeren) Zeitraum von
mindestens einem Jahr bestehen bleiben. In diesem Zusammenhang sollte auch über die
Durchführung von Auffrischungssitzungen in kritischen Situationen, beispielsweise beim
Übergang in die weiterführende Schule, nachgedacht werden, um erzielte Behandlungs-
effekte weiter aufrechtzuhalten und mögliche Rückfälle zu verhindern.
Auch das Fehlen einer zum Katamnesezeitpunkt noch unbehandelten Kontrollgruppe ist
methodisch kritisch zu beurteilen. In der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung
müssen von den Patienten immer längere Wartezeiten vor Therapiebeginn hingenommen
werden (BPtK, 2011). Vor diesem Hintergrund werden auch in der Therapieforschung
bestimmte Wartezeiten von den Patienten akzeptiert. Aus ethischen Gründen wurde
jedoch darauf verzichtet, die hilfesuchenden Familien länger als sechs Monate auf den
dringend benötigten Therapieplatz warten zu lassen. Aufgrund der fehlenden Kontroll-
gruppe zum Katamnesezeitpunkt könnten die Ergebnisse zur langfristigen Wirksamkeit des
Trainings jedoch nicht nur auf das Training, sondern auch auf Störvariablen (z. B. Umzug,
Schulwechsel, zusätzliche Hilfsangebote) zurückgeführt werden und sollten demzufolge mit
Vorsicht interpretiert werden.
Die Güte eines Studiendesigns hängt neben der Kontrolle der Validität (z. B. durch
Randomisierung) auch entscheidend von der Wahl einer adäquaten Kontrollgruppe ab
(Kendall, Holmbeck & Verduin, 2004). Die Verwendung von (Warte-)Kontrollgruppen
(ohne bzw. mit verzögerter Behandlung) oder Placebo-Kontrollgruppen (mit unspezi-
fischer Behandlung, z. B. Gruppenspiele, Gruppendiskussionen) mag unter Umständen
ethisch fragwürdig erscheinen, wenn für ein Störungsbild bereits wissenschaftlich überprüf-
te und effektive Behandlungsverfahren vorliegen (Rief et al., 2006). In zukünftigen Studien
sollte das Training (= Interventionsgruppe) mit einem bereits bewährten Therapieverfahren
(= Kontrollgruppe mit alternativer Behandlung) verglichen werden, das gegenwärtig als
7 Diskussion 192
Standardbehandlung eingesetzt wird (treatment as usual). Auf diese Weise könnte das Trai-
ning seine Gleichwertigkeit oder Überlegenheit gegenüber den bekanntermaßen wirksamen
Verfahren zeigen. Allerdings ist die Wahl des Kontrollgruppendesigns an verschiedene
Voraussetzungen gebunden (u. a. Anzahl der Patienten, Randomisierung). Wenn diese
Voraussetzungen nicht gegeben sein sollten, müsste notfalls auf alternative Studiendesigns
(z. B. Eigenkontrollgruppendesign) zurückgegriffen werden, um die Wirksamkeit des Trai-
nings überprüfen zu können (vgl. für die Anwendung eines Eigenkontrollgruppendesigns
beispielhaft Büch & Döpfner, 2011; Kühl, 2005; Woitecki & Döpfner, 2011).
7.2.2 Stichprobe
An der vorliegenden Untersuchung sind einerseits die genaue Beschreibung der Stichprobe,
andererseits die umfassende Darstellung des Vorgehens bei der Stichprobenrekrutierung
positiv hervorzuheben. Um die Stichprobe möglichst differenziert beschreiben zu können,
wurden soziodemografische Merkmale des Kindes und seiner Eltern sowie psychische
Auffälligkeiten des Kindes detailliert erfasst. Nach randomisierter Zuordnung der Kinder
zur Interventions- bzw. Wartekontrollgruppe wurden bei nachträglichen Gruppenver-
gleichen (vor dem Training) keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich wesentlicher
soziodemografischer Merkmale und psychischer Auffälligkeiten festgestellt. Zudem können
die vergleichsweise geringe Drop-out-Rate sowie die zufriedenstellend hohen Rücklauf-
quoten bei den schriftlichen Befragungen als positiv beurteilt werden. Liegen überwiegend
vollständige Datensätze vor (mehr als 90 %), kann nach Rief und Kollegen (2006) davon
ausgegangen werden, dass Datenausfälle nicht systematisch mit der Intervention zusam-
menhängen, sondern durch Umzüge, Urlaube, Krankheiten etc. der Studienteilnehmer
bedingt sind.
Der geringe Stichprobenumfang gehört zu den methodischen Schwächen der vorliegenden
Studie und schränkt die Aussagekraft und Generalisierbarkeit der erzielten Ergebnisse ein.
In Anbetracht der niedrigen Prävalenzraten für Angststörungen im Kindes- und Jugend-
alter ist ein geringer Stichprobenumfang im Kontext praxisorientierter Therapieforschung
aber trotz sorgfältiger Planung häufig nicht zu vermeiden (Petermann, 2007). Deshalb
sollten klinische Studien mit signifikanten Ergebnissen nicht allein aufgrund ihres geringen
Stichprobenumfangs abgelehnt, sondern lediglich vorsichtig interpretiert werden (Streiner,
7 Diskussion 193
2006). Einschränkend muss auch darauf hingewiesen werden, dass ein möglicher
Selektionseffekt der Stichprobe nicht ausgeschlossen werden kann, weil es sich bei der
untersuchten Stichprobe um die Patienten einer psychotherapeutischen Versorgungs-
einrichtung handelt.
In zukünftigen Evaluationsstudien sollte eine größere Stichprobe herangezogen werden, in
der Interventions- und Wartekontrollgruppe möglichst gleich groß sind. Der optimale
Stichprobenumfang einer geplanten Untersuchung sollte so festgelegt werden, dass
Aussagen sowohl über die statistische Signifikanz als auch über die klinische Bedeutsamkeit
der erzielten Effekte möglich sind (vgl. Cohen, 1988). Dabei dient die Empfehlung von
mindestens 40 Patienten pro Behandlungsgruppe als grobe Orientierung (Rief et al., 2006).
7.2.3 Erhebungsinstrumente
Eine Stärke der vorliegenden Studie besteht darin, dass für die Wirksamkeitsüberprüfung
des Trainings mehrere, unterschiedliche Informationsquellen (Kind, Eltern, Lehrer) heran-
gezogen wurden. Um die Ergebnisqualität noch weiter zu erhöhen, könnten diese Selbst-
(Kind) und Fremdurteile (Eltern, Lehrer) in zukünftigen Studien noch durch die Einschät-
zungen von anderen Bezugspersonen, wie beispielsweise von Therapeuten, Ärzten, Gleich-
altrigen und/oder Geschwistern ergänzt werden.
Demgegenüber muss jedoch kritisch darauf hingewiesen werden, dass die Diagnosestellung
nicht anhand eines strukturierten klinischen Interviews erfolgte, sondern durch speziell für
die Diagnostik von Angststörungen entwickelte Diagnosechecklisten (Petermann & Peter-
mann, 2006b) unterstützt wurde. In zukünftigen Studien sollte ein strukturiertes, klinisches
Interviewverfahren eingesetzt werden, das die differenzierte und zuverlässige Klassifikation
aller wichtigen psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und/oder
DSM-IV ermöglicht (Silverman, Saavedra & Pina, 2001). Für diesen Zweck hat sich das
Diagnostische Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS;
Unnewehr et al., 2009), das aus einer Elternversion und einer parallelen Kinderversion
besteht, in vergleichbaren Studien als besonders geeignet erwiesen. Es erlaubt eine nach-
vollziehbare differentialdiagnostische Abklärung und angemessene Erfassung komorbider
7 Diskussion 194
psychischer Störungen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, das Interview nicht
nur zur Indikationsstellung, sondern auch zur Veränderungsmessung einzusetzen.
Eine weitere Einschränkung der Ergebnisse ergibt sich daraus, dass für die Wirksamkeits-
überprüfung ausschließlich Fragebogen eingesetzt wurden. Obwohl die Gütekriterien der
eingesetzten Fragebogenverfahren den wissenschaftlichen Standards (v. a. im Hinblick auf
Reliabilität und Validität) genügen (vgl. Kapitel 5.3), sollten in weiterführenden Studien für
eine noch zuverlässigere Messung des Therapieerfolgs zusätzliche Erhebungsverfahren wie
Interviewverfahren, Tagebuchmethoden, Rollenspieltests, Verhaltensbeobachtungen oder
Psychophysiologische Messungen herangezogen werden.
Als weiterer einschränkender Faktor ist die begrenzte Auswahl geeigneter, beurteilerüber-
greifender Fragebogenverfahren zur Erfassung von Angststörungen zu berücksichtigen.
Abgesehen von den Selbst- (Kind) und Fremdbeurteilungsbogen (Eltern, Erzieher, Lehrer)
aus dem Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (DISYPS-KJ) stand
zum Zeitpunkt der Untersuchungsplanung kein entsprechendes Erhebungsinstrument zur
Verfügung. Erfreulicherweise wurden inzwischen einige störungsspezifische Fragebogen-
verfahren entwickelt, die in verschiedenen Versionen für Kinder, Eltern und/oder Lehrer
vorliegen und somit auch die Vergleichbarkeit der gewonnenen Ergebnisse gewährleisten.
Dazu gehören im deutschen Sprachraum beispielsweise die Kinder- bzw. Elternversion des
Trennungsangst Inventars (TAI; In-Albon & Schneider, 2011) und der Social Anxiety Scale for
Children – Revised – German (SASC-R-D; Melfsen, 1998; Schreier & Heinrichs, 2008) sowie
der Eltern- bzw. Lehrerfragebogen zu sozialer Angst im Kindes- und Jugendalter (ESAK; Wein-
brenner, 2005; van Gemmeren, Bender, Pook & Tuschen-Caffier, 2008; Stenzel, Krumm &
Tuschen-Caffier, 2009).
Eine letzte Einschränkung besteht darin, dass die Behandlungszufriedenheit nicht mit
einem standardisierten und evaluierten Fragebogenverfahren, sondern mit einem selbst
entworfenen und auf das Forschungsprojekt zugeschnittenen Erhebungsinstrument erfasst
wurde. In weiteren Evaluationsstudien wäre der Einsatz des Fragebogens zur Beurteilung der
Behandlung (FBB; Mattejat & Remschmidt, 1999) vorzuziehen. Dieser Fragebogen ist eines
der wenigen Messinstrumente für die Therapieevaluation (Ergebnisqualität, Prozessqualität)
und Qualitätssicherung bei der Behandlung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.
Er liegt in unterschiedlichen Versionen für Patienten, Eltern und Therapeuten vor, so dass
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wäre. Ergänzend könnte auch die
7 Diskussion 195
Wahrnehmung bzw. das Erleben allgemeiner Wirkfaktoren (z. B. Motivation, Beziehung,
Unterstützung) im Verlauf der Psychotherapie von den Patienten und/oder Therapeuten
regelmäßig dokumentiert werden, beispielsweise mit Hilfe des Stundenbogens für die Allgemeine
und Differentielle Einzelpsychotherapie (STEP; Krampen, 2002).
7.2.4 Statistische Auswertung
Abschließend sollen einige Möglichkeiten aufgezeigt werden, mit denen sich die statistische
Auswertung der gewonnenen Daten in weiteren Evaluationsstudien noch verbessern ließe:
Vor der Durchführung einer geplanten Untersuchung sollte der erforderliche Stichproben-
umfang unter Berücksichtigung inhaltlicher und statistischer Gesichtspunkte bestimmt
werden. Eine statistische Methode zur Ermittlung des optimalen Stichprobenumfangs stellt
die sogenannte Power-Analyse (Cohen, 1988) dar, die auf die vier wechselseitig voneinander
abhängigen Einflussgrößen des Signifikanztests Stichprobenumfang, Signifikanzniveau,
Teststärke und Effektgröße zurückgreift. Auf diese Weise ließen sich die formulierten
Hypothesen mit größtmöglicher Genauigkeit untersuchen und Effekte finden, die sowohl
von statistischer als auch von klinischer Bedeutung sind (Bortz & Lienert, 2008).
Um bei der statistischen Auswertung systematische Verzerrungen der Ergebnisse durch
Datenausfälle zu verhindern, sollten in zukünftigen Studien sogenannte Intention-to-Treat-
Analysen durchgeführt werden. Bei dieser statistischen Auswertungsstrategie müssen die
Daten aller Studienteilnehmer berücksichtigt werden, und zwar unabhängig davon, ob die
Patienten eine Behandlung auch tatsächlich in der geplanten Form erhalten haben (Hollis
& Campbell, 1999). Folglich würden auch Patienten in die Analysen eingeschlossen, die
nicht zu den geplanten Untersuchungsterminen erschienen, die die Behandlung gegen ärzt-
lichen Rat abbrachen, die die therapeutischen Empfehlungen nicht (vorschriftsmäßig) um-
setzten oder die anderweitig vom Studienprotokoll abwichen. Dieses Vorgehen entspricht
am ehesten der Realität in der klinischen Praxis und verringert die Gefahr, die Wirksamkeit
einer Intervention bedeutend zu überschätzen (Lundh & Gøtzsche, 2008).
Neben der Angabe der statistischen Signifikanz sollte in weiteren Studien nicht nur die
Effektstärke als Maß für die klinische Bedeutsamkeit eines Ergebnisses angegeben werden.
Ergänzend könnte der Reliable Change Index (RCI), der eine reliable, statistisch signifikante
7 Diskussion 196
Verbesserung anzeigt, kombiniert mit definierten Cut-off-Werten, die eine Veränderung von
einem dysfunktionalen in einen funktionalen Wertebereich anzeigen (Genesung), für die
Beurteilung der klinischen Bedeutsamkeit herangezogen werden (Jacobson & Truax, 1991).
7 Diskussion 197
7.3 Abschließende Bewertung des Trainings und Ausblick
Abschließend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Studie zur Überprüfung der Wirk-
samkeit des „Trainings mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b)
trotz der genannten Einschränkungen einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der
Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen leistet. Die Ergebnisse dieser Studie weisen
darauf hin, dass die Angstsymptomatik und der damit verbundene Leidensdruck der Kin-
der durch das Training kurz- und langfristig verringert werden konnten. Die Eltern der
betroffenen Kinder erlebten das Training als hilfreich und waren mit den Behandlungser-
folgen zufrieden. Demzufolge kann das Training in der psychotherapeutischen Versorgung
zur Behandlung von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter, insbesondere zur Be-
handlung der Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters, erfolgreich eingesetzt
werden. Es ist davon auszugehen, dass durch eine frühzeitige Intervention das Risiko für
die Ausbildung weiterer psychischer Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter
(z. B. Depressive Störungen) verringert werden kann. Damit hat das Training nicht nur
therapeutischen, sondern auch präventiven Charakter.
In den letzten Jahren ist das Forschungsinteresse an der Behandlung von Angststörungen
im Kindes- und Jugendalter in Deutschland deutlich gestiegen. Im deutschsprachigen
Raum wurden seitdem einige neue kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapieprogramme
entwickelt und evaluiert (z. B. Büch & Döpfner, 2012; Melfsen & Walitza, 2012; Tuschen-
Caffier et al., 2009; vgl. für einen Überblick Kapitel 2.4.3). Trotz der zunehmenden
Forschungsbemühungen sind aber zahlreiche Forschungsfragen immer noch ungeklärt.
Für das vorliegende Trainingsprogramm sollten zunächst weitere Wirksamkeitsnachweise
erbracht werden. Es wäre wünschenswert, dass mindestens zwei Gruppenvergleichsstudien
unabhängiger Arbeitsgruppen nachweisen, dass das „Training mit sozial unsicheren
Kindern“ (Petermann & Petermann, 2010) eine vergleichbare oder bessere Wirksamkeit
aufweist als ein psychologisches Placebo oder eine andere (bereits etablierte) therapeutische
Behandlung. Sofern eine Placebo-Behandlung ethisch vertretbar ist, könnten die Kinder
beispielsweise an Gruppenspielen oder Gruppendiskussionen teilnehmen. Zum Vergleich
könnte allerdings auch ein alternatives, bereits etabliertes Therapieprogramm wie das
„Coping Cat“-Programm (Kendall & Hedtke, 2006) herangezogen werden. Solange nur
diese eine Gruppenvergleichsstudie vorliegt, gilt das Trainingsprogramm gemäß der APA-
7 Diskussion 198
Kriterien nur als möglicherweise wirksam, aber noch nicht angemessen überprüft (vgl.
Chambless et al., 1998; Chambless & Ollendick, 2001). In jedem Fall sollte angestrebt wer-
den, die Wirksamkeit des Trainingsprogramms auch zukünftig unter Alltagsbedingungen zu
überprüfen (Kriterium der Praxisbewährung: effectiveness; Seligman, 1995).
Um festzustellen, auf welche Wirkfaktoren die mit dem Trainingsprogramm erzielten
Erfolge zurückzuführen sind, sollten zukünftig weitere Moderator- und Mediatoranalysen
durchgeführt werden. Da erfahrungsgemäß nicht alle Kinder gleichermaßen von einer Be-
handlung profitieren, stellt sich die Frage, für welche Patienten das vorliegende Trainings-
programm am besten geeignet ist (Moderatoren). Das Trainingsprogramm sieht die
gemeinsame Behandlung von Kindern mit unterschiedlichen Angststörungen vor. Demzu-
folge überprüft die vorliegende Studie die Wirksamkeit des Trainingsprogramms für
mehrere Angststörungen, ohne dabei (aufgrund der geringen Stichprobengröße) zwischen
den verschiedenen Angststörungen unterscheiden zu können. In zukünftigen Studien mit
größeren Stichproben sollten die Behandlungserfolge getrennt für die spezifischen
Angststörungen untersucht werden. Darüber hinaus sollte auch der Frage nachgegangen
werden, ob die Wirksamkeit des Trainingsprogramms durch die Entwicklung zusätzlicher,
störungsspezifischer Module noch weiter gesteigert werden kann. Weiterhin sollte in Erfah-
rung gebracht werden, welcher Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der Sympto-
matik und dem Erfolg der Behandlung besteht. Bisherige Forschungsarbeiten weisen da-
rauf hin, dass ein höherer Schweregrad der Symptomatik den Behandlungserfolg ungünstig
beeinflusst (Berman et al., 2000; Liber et al., 2010; Southam-Gerow et al., 2001). Außerdem
bleibt zu klären, welchen Einfluss komorbide psychische Störungen auf das Behandlungs-
ergebnis haben. Dabei wäre es für die praktisch tätigen Psychotherapeuten von großem
Interesse zu wissen, ob und ggf. wie sich Patienten mit verschiedenen Komorbiditäten
(z. B. internalisierende vs. externalisierende Störungen) hinsichtlich ihres Behandlungs-
erfolgs unterscheiden. Das vorliegende Trainingsprogramm bezieht die Eltern mittels
regelmäßiger Beratungsgespräche in die Behandlung des Kindes mit ein, obwohl die Wirk-
samkeit des Einbezugs von Eltern bzw. Familien noch nicht hinreichend geklärt ist (vgl. für
einen Überblick Creswell & Cartwright-Hatton, 2007). Zukünftige Studien sollten sich da-
her mit der Frage beschäftigen, welche Merkmale des Kindes (z. B. Alter, Diagnose) oder
der Eltern (z. B. Psychopathologie) einen Einbezug der Familien in die Behandlung zwin-
gend erforderlich machen. Im Hinblick auf das vorliegende Trainingsprogramm bleibt
überdies offen, welche Interventionen des Trainingsprogramms (z. B. Einzeltraining vs.
7 Diskussion 199
Gruppentraining; Kindertraining vs. Elternberatung) die entscheidenden Veränderungen
bewirkt haben. Damit ist auch die Frage verbunden, ob sich die Wirksamkeit des Trainings
durch einen stärkeren Einbezug der Lehrer (z. B. Informations- und Beratungsgespräche,
Konfrontationsübungen in der Schule) weiter steigern lässt. Bei der Betrachtung der ver-
mittelnden Wirkfaktoren (Mediatoren) könnte weiterhin überprüft werden, welche Merk-
male des Therapieprozesses (z. B. Qualität der therapeutischen Beziehung, Angemessenheit
der Gesprächsführung, Grad der Manualtreue) sich als aussagekräftige Prädiktoren einer
erfolgreichen Behandlung erweisen.
8 Zusammenfassung 200
8 Zusammenfassung
Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugend-
alter und stellen einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entwicklung weiterer psychischer
Störungen im Erwachsenenalter dar. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben oft
einen hohen Leidensdruck und erleben eine starke Beeinträchtigung ihres alltäglichen
Lebens. Trotz der mit einer Angststörung verbundenen Belastungen und Risiken erhalten
viele Kinder und Jugendliche keine angemessene professionelle Hilfe. Dabei können
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter heute mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen
Interventionen erfolgreich behandelt werden.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluation des „Trainings mit sozial unsicheren
Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) im Rahmen einer Gruppenvergleichsstudie.
Das „Training mit sozial unsicheren Kindern“ ist ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches
Trainingsprogramm, das für 7- bis 12-jährige Kinder mit (sozialen) Angststörungen ent-
wickelt wurde. Mit diesem Trainingsprogramm sollen einerseits soziale Ängste verringert,
andererseits soziale Fertigkeiten vermittelt und eingeübt werden, so dass die Kinder bisher
angstauslösende Situationen (z. B. Schulbesuch, Sportverein, Verabredungen) zukünftig
besser bewältigen können. Das Trainingsprogramm besteht aus einem Einzeltraining (hier:
6 Sitzungen) und einem Gruppentraining (hier: 12 Sitzungen) für die Kinder. Die Eltern
bzw. Familien werden über eine begleitende Eltern- bzw. Familienberatung (hier: 5 Sitzun-
gen) in die Behandlung einbezogen. Die Trainingssitzungen mit einer Dauer von jeweils
100 Minuten finden in wöchentlichem Abstand statt; damit erstreckt sich das Training über
einen Zeitraum von etwa fünf Monaten.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stand die Frage, ob die Teilnahme am „Training
mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) kurz- und langfristig zu
einer Reduktion der Angstsymptomatik führt. Weiterhin wurde der Frage nachgegangen,
ob mit dem Training auch Effekte auf eine eventuell vorhandene komorbide depressive
Symptomatik und auf das schulbezogene Sozialverhalten erzielt werden. Zudem wurde
explorativ untersucht, welchen Einfluss soziodemografische und diagnostische Merkmale
auf die Wirksamkeit des Trainingsprogramms haben. Zuletzt war von Interesse, wie gut
Kinder, Eltern und Lehrer bei der Beurteilung der Angstsymptomatik übereinstimmen.
8 Zusammenfassung 201
Die generelle und differentielle Wirksamkeit des Trainingsprogramms wurde anhand eines
(Warte-)Kontrollgruppendesigns überprüft. Die Stichprobe dieser Studie bestand aus 25
Kindern (13 Mädchen, 12 Jungen) im Alter von 7 bis 12 Jahren, die die ICD-10-Kriterien
für eine Angststörung erfüllten. Diese Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip einer Inter-
ventionsgruppe (n = 14) oder einer Wartekontrollgruppe (n = 11) zugewiesen. Die Kinder
der Interventionsgruppe nahmen unmittelbar nach der ersten Datenerhebung am Training
teil, während die Kinder der Wartekontrollgruppe das Training erst nach der zweiten
Datenerhebung erhielten. Diese zweite Datenerhebung erfolgte unmittelbar nach der Trai-
ningsdurchführung in der Interventionsgruppe. Sechs Monate nach dem Training fand in
der Interventionsgruppe eine dritte Datenerhebung statt. Zur Erfassung der Angstsymp-
tomatik wurden vor und nach dem Training Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebogen
eingesetzt. Mit weiteren Fragebogen wurden eine gegebenenfalls vorhandene komorbide
depressive Symptomatik und das schulbezogene Sozialverhalten erfasst.
Die Ergebnisse zur kurzfristigen Wirksamkeit des Trainings zeigen, dass die Kinder der Inter-
ventionsgruppe nach der Teilnahme am Training im Elternurteil signifikant niedrigere
Angstwerte aufwiesen als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Für die Verringerung der
Angstsymptomatik wurden mittlere bis große Effekte erzielt. Im Selbsturteil der Kinder
und im Lehrerurteil ließen sich dagegen keine Veränderungen in der Angstsymptomatik
nachweisen. Weiterhin zeigte sich im Elternurteil, dass die Kinder der Interventionsgruppe
nach dem Training eine signifikant niedrigere depressive Symptomatik aufwiesen als vor
dem Training; diese Veränderung war aber nicht größer als in der Wartekontrollgruppe.
In den Ergebnissen zur langfristigen Wirksamkeit des Trainings wird deutlich, dass die im
Elternurteil nachgewiesene Verringerung der ängstlichen und der depressiven Symptomatik
über einen Zeitraum von sechs Monaten stabil bleibt. Im Urteil der Kinder und Lehrer
ließen sich die Verringerung der Angstsymptomatik und die Verbesserung des Sozialverhal-
tens in der Schule erst im langfristigen Verlauf feststellen. Für diese Veränderungen über
die Zeit wurden in beiden Gruppen große Effekte ermittelt.
Erste Ergebnisse zur differentiellen Wirksamkeit des Trainings weisen darauf hin, dass das
Geschlecht, das Alter, die Intelligenz und die Depressivität der Kinder keinen signifikanten
Einfluss auf die Wirksamkeit des Trainings haben. Kinder mit unterschiedlicher Merkmals-
ausprägung scheinen gleichermaßen von der Teilnahme am Training zu profitieren.
8 Zusammenfassung 202
Hinsichtlich der Beurteilerübereinstimmung sei noch erwähnt, dass zwischen Kindern, Eltern
und Lehrern nur eine geringe Übereinstimmung bei der Beurteilung der Angstsymptomatik
des Kindes (zum ersten Messzeitpunkt) bestand.
In der abschließenden Bewertung des Trainings zeigte sich, dass fast alle Eltern das Training als
problemmindernd und hilfreich erlebt hatten; dies spiegelte sich auch in den hohen Teil-
nahmequoten der Kinder und Eltern wider. Die überwiegende Mehrheit der Eltern war mit
den Fortschritten ihrer Kinder zufrieden und würde das Training weiterempfehlen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen die Wirksamkeit des „Trainings mit sozial
unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006b) bei der Behandlung von Angst-
störungen im Kindes- und Jugendalter. Für weitere Untersuchungen zur Wirksamkeit
dieses Trainingsprogramms wären ein größerer Stichprobenumfang, eine zum Zeitpunkt
der Nachuntersuchung noch unbehandelte Kontrollgruppe und Nachuntersuchungen über
einen längeren Zeitraum (mindestens ein Jahr) wünschenswert. In zukünftigen Studien
sollte vor allem die differentielle Wirksamkeit des Trainingsprogramms vertieft analysiert
werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Frage gelten, ob die Wirksamkeit des
Trainingsprogramms in Abhängigkeit von der Art der (sozialen) Angststörung variiert.
Weiterhin wäre es interessant zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie der Schweregrad
der Störung, das Ausmaß der Belastung und das Vorliegen von Komorbiditäten die Wirk-
samkeit des Trainingsprogramms beeinflussen.
9 Literatur 203
9 Literatur
Abel, U. & Hautzinger, M. (2013). Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer.
Achenbach, T. M. (1991a). Manual for the Child Behavior Checklist / 4-18 and 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Departure of Psychiatry.
Achenbach, T. M. (1991b). Manual for the Teacher’s Report Form and 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.
Achenbach, T. M. (1991c). Manual for the Youth Self-Report Form and 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.
Achenbach, T. M., Dumenci, L. & Rescorla, L. A. (2002). Ten-year comparisons of problems and competencies for national samples of youth: Self, parent and teacher reports. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10, 194-203.
Achenbach, T. M., McConaughy, S. H. & Howell, C. T. (1987). Child / Adolescent behavioral and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101, 213-232.
Ahrens-Eipper, S. (2003). Soziale Unsicherheit im Kindesalter – Indikation und Effektivität eines verhaltenstherapeutischen Trainings (Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Berlin: dissertation.de – Verlag im Internet.
Ahrens-Eipper, S. (2004). Mutig werden mit Til Tiger. CD mit Tigergeschichte und Entspannungs-übungen Audio-CD . Göttingen: Hogrefe.
Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2009). Mutig werden mit Til Tiger – Ein Trainings-programm für sozial unsichere Kinder (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
Albano, A. M., Marten, P. A., Holt, C. S., Heimberg, R. G. & Barlow, D. H. (1991). Cognitive-behavioral group treatment of adolescent social phobia (CBGT-A): A therapist manual. Unpublished manuscript.
Albano, A. M., Marten, P. A., Holt, C. S., Heimberg, R. G. & Barlow, D. H. (1995). Cognitive-behavioral group treatment for social phobia in adolescents: A prelimi-nary study. Journal of Nervous and Mental Disease, 183, 685-692.
Alfano, C. A., Beidel, D. C. & Turner, S. M. (2002). Cognition in childhood anxiety: Conceptual, methodological and developmental issues. Clinical Psychology Review, 22, 1209-1238.
9 Literatur 204
Alfano, C. A., Beidel, D. C. & Turner, S. M. (2006). Cognitive correlates of social phobia among children and adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 189-201.
Alfano, C. A., Pina, A. A., Villalta, I. K., Beidel, D. C., Ammermann, R. T. & Crosby, L. E. (2009). Mediators and moderators of outcome in the behavioral treatment of child-hood social phobia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 945-953.
Allen, J. L. & Rapee, R. M. (2009). Are reported differences in life events for anxious children and controls due to comorbid disorders? Journal of Anxiety Disorders, 23, 511-518.
American Psychiatric Association (APA) (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd Edition (DSM-III). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association (APA) (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd Edition – Revision (DSM-III-R). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition (DSM-IV). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition - Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association (APA) / Köhler, K. (Hrsg.). (1984). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 3. Auflage (DSM-III). Weinheim: Beltz.
American Psychiatric Association (APA) / Saß, H. & Houben, I. (Hrsg.). (1996). Diagnosti-sches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 4. Auflage (DSM-IV). Göttingen: Hogrefe.
American Psychiatric Association (APA) / Saß, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Houben, I. (Hrsg.). (2003). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 4. Auflage – Textrevision (DSM-IV-TR). Göttingen: Hogrefe.
American Psychiatric Association (APA) / Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (1989). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 3. Auflage – Revision (DSM-III-R). Weinheim: Beltz.
American Psychological Association (APA) (1995). Template for developing guidelines: Interventions for mental disorders and psychosocial aspects of physical disorders. Washington, DC: APA.
APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, 61, 271-285.
9 Literatur 205
Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist (Hrsg.). (1993). Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen; deutsche Bearbeitung der Teacher’s Report Form (TRF). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik.
Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist (Hrsg.). (1998a). Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen; deutsche Bearbeitung der Child Behavior Checklist (CBCL/4-18). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik.
Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist (Hrsg.). (1998b). Fragebogen für Jugendliche; deutsche Bearbeitung der Youth Self-Report Form (YSR). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik.
Bachmann, M., Bachmann, C., Rief, W. & Mattejat, F. (2008). Wirksamkeit psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlungen bei psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen – Eine systematische Auswertung der Ergebnisse von Meta-Analysen und Reviews, Teil 1: Angststörungen und Depressive Störungen. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 36, 309-320.
Barmish, A. J. & Kendall, P. C. (2005). Should parents be co-clients in cognitive-behavioral therapy for anxious youth? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 569-581.
Barrett, P. M. (1998). Evaluation of cognitive-behavioral group treatments for childhood anxiety disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 27, 459-468.
Barrett, P. M., Dadds, M. R. & Rapee, R. M. (1991). Coping Koala workbook. Unpublished manuscript, School of Applied Psychology, Griffith University, Nathah, Australia.
Barrett, P. M., Dadds, M. R. & Rapee, R. M. (1996). Family treatment of child anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting und Clinical Psychology, 64, 333-342.
Barrett, P. M., Duffy, A. L., Dadds, M. R. & Rapee, R. M. (2001). Cognitive-behavioral treatment of anxiety disorders in children: Long-term (6-year) follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 135-141.
Barrett, P. M., Lowry-Webster, H. & Turner, C. (2000). FRIENDS program for children: Group leaders manual. Brisbane: Australian Academic Press.
Barrett, P. M., Rapee, R. M., Dadds, M. R. & Ryan, S. M. (1996). Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 187-203.
Barrett, P. M., Webster, H., Turner, C., Essau, C. A. & Conradt, J. (2003). Freunde für Kinder. Gruppenleitermanual – Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression. München: Reinhardt.
9 Literatur 206
Barrington, J., Prior, M., Richardson, M. & Allen, K. (2005). Effectiveness of CBT versus standard treatment for childhood anxiety disorders in a community clinic setting. Behavior Change, 22, 29-43.
Baumeister, E. (2001). Schulphobie im Jugendalter – eine Nachuntersuchung stationär behandelter Patienten. München: Ludwig-Maximilians-Universität.
Beck, N., Cäsar, S. & Leonhardt, B. (2008). Training sozialer Fertigkeiten mit Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren (TSF 8-12) (2. Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.
Becker, B., Lohaus, A., Frebel, C. & Kiefert, U. (2002). Zur Erhebung von Ängsten bei fünf- bis sechsjährigen Vorschulkindern. Diagnostica, 48, 90-99.
Beelmann, A., Pfingsten, U. & Lösel, F. (1994). Effects of training social competence in children: A meta-analysis of recent evaluation studies. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 260-271.
Beesdo, K., Bittner, A., Pine, D. S., Stein, M. B., Höfler, M., Lieb, R. et al. (2007). Inci-dence of social anxiety disorder and the consistent risk for secondary depression in the first three decades of life. Archives of General Psychiatry, 64, 903-912.
Beesdo-Baum, K., Knappe, S., Fehm, L., Höfler, M., Lieb, R., Hofmann, S. G. et al. (2012). The natural course of social anxiety disorder among adolescents and young adults. Acta Psychiatrica Scandinavica. doi: 10.1111/j.1600-0447.2012.01886.x
Beidel, D. C., Fink, C. M. & Turner, S. M. (1996). Stability of anxious symptomatology in children. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 257-269.
Beidel, D. C. & Turner, S. M. (1997). At risk for anxiety: Psychopathology in the offspring of anxious parents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 918-924.
Beidel, D. C., Turner, S. M. & Morris, T. L. (2000). Behavioral treatment of childhood social phobia. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 1072-1080.
Beidel, D. C., Turner, S. M. & Morris, T. L. (2004). Social Effectiveness Therapy for Children and Adolescents (SET-C). Toronto: MHS.
Beidel., D. C., Turner, S. M. & Young, B. J. (2006). Social effectiveness therapy for chil-dren: Five years later. Behavior Therapy, 37, 416-425.
Beidel., D. C., Turner, S. M., Young, B. J. & Paulson, A. (2005). Social effectiveness thera-py for children: Three-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 17, 721-725.
9 Literatur 207
Berman, S. L., Weems, C. F., Silverman, W. K. & Kurtines, W. M. (2000). Predictors of outcome in exposure-based cognitive and behavioral treatments for phobic and anxiety disorders in children. Behavior Therapy, 31, 713-731.
Beutler, L. E., Malik, M. L., Alimohamed, S., Harwood, T. M., Talebi, H., Noble, S. et al. (2004). Therapist variables. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behavior change (pp. 227-306). New York: Wiley.
Biederman, J., Rosenbaum, J. F., Bolduc, E. A., Faraone, S. V. & Hirshfeld, D. R. (1991). A high risk study of young children of parents with panic disorder and agoraphobia with and without comorbid depression. Psychiatry Research, 37, 333-348.
Biederman, J., Rosenbaum, J. F., Bolduc-Murphy, E. A., Faraone, S. V., Chaloff, J., Hirshfeld, D. R. et al. (1993). A 3-year follow-up of children with and without behavioral inhibition. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 814-821.
Biederman, J., Rosenbaum, J. F., Hirshfeld, D. R., Faraone, S. V.; Bolduc, E. A. et al. (1990). Psychiatric correlates of behavioral inhibition in young children of parents with and without psychiatric disorders. Archives of General Psychiatry, 47, 21-26.
Bijl, R. V., de Graaf, R., Hiripi, E., Kessler, R. C., Kohn, R., Offord, D. R. et al. (2003). The prevalence of treated and untreated mental disorders in five countries. Health Affairs, 22, 122-133.
Bittner, A., Goodwin, D. R., Wittchen, H.-U., Beesdo, K., Höfler, M. & Lieb, R. (2004). What characteristics of primary anxiety disorders predict subsequent major depres-sive disorder? Journal of Clinical Psychiatry, 65, 618-626.
Bittner, A., Egger, H. L., Erkanli, A., Costello, E. J., Foley, D. L. & Angold, A. (2007). What do childhood anxiety disorders predict? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 12, 1174-1183.
Bögels, S. M. & Brechman-Toussaint, M. L. (2006). Family issues in child anxiety: attach-ment, family functioning, parental rearing and beliefs. Clinical Psychology Review, 26, 834-856.
Bögels, S. M. & Phares, V. (2008). Father’s role in the etiology, prevention and treatment of child anxiety: A review and new model. Clinical Psychology Review, 28, 539-558.
Bögels, S. M. & Siqueland, L. (2006). Family cognitive behavioral therapy for children and adolescents with clinical anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2, 134-141.
9 Literatur 208
Boehnke, K., Silbereisen, R. K., Reynolds, C. R. & Richmond, B. O. (1986). What I think and feel - German experience with the revised form of the Children's Manifest Anxiety Scale. Personality and Individual Differences, 7, 553-560.
Boer, F., Markus, M. T., Maingay, R., Lindhout, I. E., Borst, S. R. & Hoogendijk, T. H. G. (2002). Negative life events of anxiety disordered children: Bad fortune, vulnera-bility or reporter bias? Child Psychiatry and Human Development, 32, 187-199.
Bolton, D., Eley, T. C., O’Connor, T. G., Perrin, S., Rabe-Hesketh, S., F. Rijsdijk et al. (2006). Prevalence and genetic and environmental influences on anxiety disorders in 6-year-old twins. Psychological Medicine, 36, 335-344.
Borg-Laufs, M. (2001). Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen, Band 2: Interventionsmethoden. Tübingen: dgvt-Verlag.
Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin: Springer.
Bortz, J. & Lienert, G. A. (2008). Kurzgefasste Statistik für die klinische Forschung – Leitfaden für die verteilungsfreie Analyse kleiner Stichproben. Berlin: Springer.
Bortz, J., Lienert, G. A. & Boehnke, K. (2008). Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik. Berlin: Springer.
Bortz, J. & Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.
Bosquet, M. & Egeland, B. (2006). The development and maintenance of anxiety symp-toms from infancy through adolescence in a longitudinal sample. Development and Psychopathology, 18, 517-550.
Bouchard, S., Mendlowitz, S. L., Coles, M. E. & Franklin, M. (2004). Considerations in the use of exposure with children. Cognitive and Behavioral Practice, 11, 56-65.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss, Vol. 2: Separation: Anxiety and anger. New York: Basic Books.
Brendel, K. E. (2011). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of child-parent interventions for children and adolescents with anxiety disorders (Doctoral dissertation, Loyola University Chicago, 2011). Dissertation Abstracts International, 72, 2965.
Brezinka, V. (2007). Schatzsuche – Ein Computerspiel zur Unterstützung der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung von Kindern. Verhaltenstherapie, 17, 191-194.
Brückl, T. M., Wittchen, H.-U., Höfler, M., Pfister, H., Schneider, S. & Lieb, R. (2007). Childhood separation anxiety and the risk of subsequent psychopathology: Results from a community study. Psychotherapy and Psychosomatics, 76, 47-56.
9 Literatur 209
Büch, H. (2008). Konzeption und Evaluation eines kognitiv-behavioralen Therapieprogramms zur Behandlung sozialer Ängste im Kindesalter (THAZ – Soziale Ängste). Unveröffentlichte Dissertation, Universität zu Köln.
Büch, H. & Döpfner, M. (2011). Behandlung sozialer Ängste im Kindesalter mit einem individualisierten kognitiv-behavioralen Therapieprogramm (THAZ – Soziale Ängste) – Konzeption und Ergebnisse einer Pilotstudie. Verhaltenstherapie, 21, 41-47.
Büch, H. & Döpfner, M. (2012). Soziale Ängste – Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ), Band 2. Göttingen: Hogrefe.
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2006). Unterversorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher – Bestandsaufnahme/Handlungsbedarf. Zugriff am 17.09.2012 unter http:// www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Themen/ambulante_Versorgung/20060530_psychotherapeutische-versorgung-ki-ju.pdf
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2007). Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit zur Versorgungssituation mit psychotherapeutisch tätigen Leistungserbringern – Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer. Zugriff am 24.05.2011 unter http://www.bptk.de/ fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/Stellungennahmen_nach_Thema/B/Bedarfsplanung/Bedarfsplanungs-Richtlinie/20071108_stn_bptk_bericht_versorgungs situation.pdf
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2011). BPtK-Studie zu Wartezeiten in der ambu-lanten psychotherapeutischen Versorgung – Umfrage der Landespsychotherapeutenkammern und der BPtK. Zugriff am 24.11.2012 unter http://www.bptk.de/fileadmin/user_ upload/Publikationen/BPtK-Studien/belastung_moderne_arbeitswelt/Wartezeiten _in_der_Psychotherapie/20110622_BPtK-Studie_Langfassung_Wartezeiten-in-der-Psychotherapie.pdf
Burk, B. (1993). Training mit einem sozial unsicheren deprivierten Kind aus einer Tages-heimgruppe. Kindheit und Entwicklung, 2, 47-53.
Burk, B. & Wittchen, H.-U. (1991). Modifizierte Anwendung eines Trainings für sozial unsichere Kinder aus soziokulturell benachteiligten Schichten. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie, 39, 64-87.
Burt, S. A. (2009). Rethinking environmental contributions to child and adolescent psycho-pathology: A meta-analysis of shared environmental influences. Psychological Bulletin, 135, 608-637.
Carballo, J. J., Baca-Garcia, E., Blanco, C., Perez-Rodriguez, M. M., Jimenez Arriero, M. A. J., Artes-Rodriguez, A. et al. (2010). Stability of childhood anxiety disorder diagno-ses: A follow-up naturalistic study in psychiatric care. European Child and Adolescent Psychiatry, 19, 395-403.
9 Literatur 210
Cartwright-Hatton, S., Hodges, L. & Porter, J. (2003). Social anxiety in childhood: the rela-tion with self and observer rated social skills. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 737-742.
Cartwright-Hatton, S., McNicol, K. & Doubleday, E. (2006). Anxiety in a neglected popu-lation: Prevalence of anxiety disorders in pre-adolescent children. Clinical Psychology Review, 26, 817-833.
Cartwright-Hatton, S., Robert, C., Chitsabesan, P., Fothergill, C. & Harrington, R. (2004). Systematic review of the efficacy of cognitive behavioral therapies for childhood and adolescent anxiety disorders. British Journal of Clinical Psychology, 43, 421-436.
Cartwright-Hatton, S., Tschernitz, N. & Gomersall, H. (2005). Social anxiety in children: Social skills deficit or cognitive distortion? Behavior Research and Therapy, 43, 131-141.
Caspar, F. & Grosse Holtforth, M. (2009). Responsiveness – Eine entscheidende Prozess-variable in der Psychotherapie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 38, 61-69.
Chambless, D. L., Baker, M., Baumcom, D. H., Beutler, L. E., Calhoun, K. S., Crits-Christoph et al. (1998). Update on empirically validated therapies, II. The Clinical Psychologist, 51, 3-16.
Chambless, D. L. & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interven-tions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52, 129-143.
Chartier, M. J., Hazen, A. L. & Stein, M. B. (1998). Lifetime patterns of social phobia: A retrospective study of the course of social phobia in a nonclinical population. Depression and Anxiety, 7, 113-121.
Chartier, M. J., Walker, J. R. & Stein, M. B. (2003). Considering comorbidity in social phobia. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38, 728-734.
Chavira, D. A., Stein, M. B., Bailey, K. & Stein, M. T. (2004). Comorbidity of generalized social anxiety disorder and depression in a pediatric primary care sample. Journal of Affective Disorders, 80, 163-171.
Choudhury, M. S., Pimentel, S. S. & Kendall, P. C. (2003). Childhood anxiety disorders: Parent-child (dis)agreement using a structured interview for the DSM-IV. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 957-964.
Chronis-Tuscano, A., Degnan, K. A., Pine, D. S., Perez-Edgar, K., Henderson, H. A., Diaz, Y. et al. (2009). Stable early maternal report of behavioral inhibition predicts lifetime social anxiety disorder in adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48, 928-935.
9 Literatur 211
Chu, B. C., Colognori, D., Weissman, A. S. & Bannon, K. (2009). An initial description and pilot of group behavioral activation therapy for anxious and depressed youth. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 408-419.
Clark, D. M. & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope & F. R. Schneier (Eds.), Social phobia: Diagnosis, assess-ment und treatment (pp. 69-93). New York: The Guilford Press.
Cobham, V. E., Dadds, M. R. & Spence, S. H. (1998). The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 893-905.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NY: Erlbaum.
Cohen, P., Cohen, J. & Brook, J. (1993). An epidemiological study of disorders in late childhood and adolescence – II: Persistence of disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 869-877.
Cole, D. A., Peeke, L. G., Martin, J. M., Truglio, R. & Seroczynski, A. D. (1998). A longitu-dinal look at the relation between depression and anxiety in children and adoles-cents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 451-460.
Comer, J. S. & Kendall, P. C. (2004). A symptom-level examination of parent-child agree-ment in the diagnosis of anxious youths. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 878-886.
Compton, S. N., March, J. S., Brent, D., Albano, A. M., Weersing, V. R. & Curry, J. (2004). Cognitive-behavioral psychotherapy for anxiety and depressive disorders in children and adolescents: An evidence-based medicine review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 930-959.
Connolly, D. S. & Bernstein, G. A. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 267-283.
Cooper, P. J., Fearn, V., Willets, L., Seabrook, H. & Parkinson, M. (2006). Affective disorder in the parents of a clinic sample of children with anxiety disorders. Journal of Affective Disorders, 93, 205-212.
Copeland, W. E., Shanahan, L., Costello, A. J. & Angold, A. (2009). Childhood and adoles-cents psychiatric disorders as predictors of young adult disorders. Archives of General Psychiatry, 66, 764-772.
Costello, A. J., Edelbrock, C., Kalas, R., Dulcan, M. K. & Klaric, S. H. (1984). Development and testing of the NIMH diagnostic interview schedule for children (DISC) in a clinic population: Final report. Rockville, MD: Center for Epidemiological Studies, NIMH.
9 Literatur 212
Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G. & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of Gen-eral Psychiatry, 60, 837-844.
Crawford, A. M. & Manassis, K. (2001). Familial predictors of treatment outcome in child-hood anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1182-1189.
Crawley, S., Beidas, R., Benjamin, C., Martin, E. & Kendall, P. C. (2008). Treating socially phobic youth with CBT: Differential outcomes and treatment considerations. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 379-389.
Creswell, C. & Cartwright-Hatton, S. (2007). Family treatment of child anxiety: Outcomes, limitations and future directions. Clinical Child and Family Psychology, 10, 232-252.
Daleiden, E. L. (1998). Childhood anxiety and memory functioning: A comparison of sys-tematic and processing accounts. Journal of Experimental Child Psychology, 68, 216-235.
Davidson, J. R. T., Hughes, D. L., George, L. K. & Blazer, D. G. (1993). The epidemiology of social phobia: Findings from the Duke Epidemiological Catchment Area Study. Psychological Medicine, 23, 709-718.
Deegener, G. (2001). Anamnestischer Elternfragebogen. Göttingen: Hogrefe.
Degnan, K. A., Almas, A. N. & Fox, N. A. (2010). Temperament and the environment in the etiology of childhood anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 497-517.
Degnan, K. A. & Fox, N. A. (2007). Behavioral inhibition and anxiety disorders: Multiple levels of a resilience process. Development and Psychopathology, 19, 729-746.
De Los Reyes, A. & Kazdin, A. E. (2005). Informant discrepancies in the assessment of childhood psychopathology: A critical review, theoretical framework and recom-mendations for further study. Psychological Bulletin, 131, 483-509.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (1998). Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaft-licher Praxis: Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ - Denk-schrift. Weinheim: Wiley-VCH.
DiBartolo, P. M., Albano, A. M., Barlow, D. H. & Heimberg, R. G. (1998). Cross-informant agreement in the assessment of social phobia in youth. Journal of Abnor-mal Child Psychology, 26, 213-220.
Dodd, H. F., Hudson, J. L., Lyneham, H. J., Wuthrich, V. M., Morris, T. & Maunier, L. (2011). Biased self-perception of social skills in anxious children: The role of state anxiety. Journal of Experimental Psychopathology, 2, 571-585.
9 Literatur 213
Döpfner, M., Berner, W., Flechtner, H., Lehmkuhl, G. & Steinhausen, H. C. (1999). Psycho-pathologisches Befund-System für Kinder und Jugendliche (CASCAP-D) – Befundbogen, Glossar und Explorationsleitfaden. Göttingen: Hogrefe.
Döpfner, M., Görtz-Dorten, A., Lehmkuhl, G., Breuer, D. & Goletz, H. (2008). Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche – II (DISYPS-II). Bern: Huber.
Döpfner, M., Kinnen, C. & Petermann, F. (2010). Vor- und Nachteile von Therapie-manualen. Kindheit und Entwicklung, 19, 129-138.
Döpfner, M. & Lehmkuhl, G. (2000). Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV (DISYPS-KJ). Bern: Huber.
Döpfner, M. & Petermann, F. (2008). Leitfaden Kinder- und Jugendpsychiatrie, Band 2: Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. Göttingen: Hogrefe.
Döpfner, M., Schmeck, K., Berner, W., Lehmkuhl, G. & Poustka, F. (1994). Zur Reliabilität und faktoriellen Validität der Child Behavior Checklist – eine Analyse in einer klini-schen und einer Feldstichprobe. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 22, 189-205.
Döpfner, M., Schnabel, M., Goletz, H. & Ollendick, H. (2006). Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche (PHOKI). Göttingen: Hogrefe.
Edelbrock, C., Costello, A. J., Dulcan, M. K., Conover, N. C. & Kalas, R. (1986). Parent-child agreement on child psychiatric symptoms assessed via structured interview. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 27, 181-190.
Edelbrock, C., Costello, A. J., Dulcan, M. K., Kalas, R. & Conover, N. C. (1985). Age dif-ferences in the reliability of the psychiatric interview of the child. Child Development, 56, 265-275.
Edmunds, J. M., O’Neil, K. A. & Kendall, P. C. (2011). A review of cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders in children and adolescents: Current status and future directions. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 26-33.
Ehrenreich, J. T., Goldstein, C. R., Wright, L. R. & Barlow, D. H. (2009). Development of a unified protocol for the treatment of emotional disorders in youth. Child and Family Behavior Therapy, 31, 20-37.
Eifert, G. H., Schulte, D., Zvolensky, M. J., Lejuez, C. W. & Lau, A. W. (1997). Manualized behavior therapy: Merits and challenges. Behavior Therapy, 28, 499-509.
9 Literatur 214
Eley, T. C. & Stevenson, J. (2000). Specific life events and chronic experiences differentially associated with depression and anxiety in young twins. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 383-394.
Emmelkamp, P. M. G. & Wittchen, H.-U. (2009). Specific phobias (S. 77-101). In G. Andrews, D. S. Charney, P. J. Sirovatka & D. A. Regier (Eds.), Stress-induced and fear circuitry disorders - Refining the research agenda for DSM-IV. Arlington, VA: APA.
Epkins, C. C. (1996). Parent ratings of children’s depression, anxiety and aggression: A cross-sample analysis of agreement and differences with child and teacher ratings. Journal of Clinical Psychology, 52, 599-608.
ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators (2004). Prevalence of mental disorders in Eu-rope: Results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatrica Scandinavia, 109 (Suppl. 420), 21-27.
Essau, C. A., Conradt, J. & Ederer, E. M. (2004). Angstprävention bei Schulkindern. Versicherungsmedizin, 56, 123-130.
Essau, C. A., Conradt, J. & Petermann, F. (2000). Frequency, comorbidity and psychosocial impairment of anxiety disorders in German adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 14, 263-279.
Essau, C. A., Conradt, J. & Petermann, F. (2002). Course and outcome of anxiety disorders in adolescents. Anxiety Disorders, 16, 67-81.
Essau, C. A., Conradt, J., Sasagawa, S. & Ollendick, T. H. (2012). Prevention of anxiety symptoms in children: Results from a universal school-based trial. Behavior Therapy, 43, 450-464.
Essau, C. A., Karpinski, N. A., Petermann, F. & Conradt, J. (1998). Häufigkeit und Ko-morbidität von Angststörungen bei Jugendlichen: Ergebnisse der Bremer Jugend-studie. Verhaltenstherapie, 8, 180-187.
Essau, C. A., Muris, P. & Ederer, E. M. (2002). Reliability and validity of the Spence Chil-dren’s Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German children. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 1-18.
Esser, G., Blanz, B., Geisel, B. & Laucht, M. (1989). Mannheimer Elterninterview (MEI) – Strukturiertes Interview zur Erfassung von kinderpsychiatrischen Auffälligkeiten. Weinheim: Beltz.
Essex, M. J., Klein, M. H., Slattery, M. H., Hill Goldsmith, H. & Kalin, N. H. (2010). Early risk factors and developmental pathways to chronic high inhibition and social anxiety disorder in adolescence. American Journal of Psychiatry, 167, 40-46.
9 Literatur 215
Fallon, T. & Schwab-Stone, M. (1994). Determinants of reliability in psychiatric surveys of children aged 6 - 12. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1391-1408.
Farrell, L. J., Barrett, P. M. & Claassens, S. (2005). Community trial of an evidence-based anxiety intervention for children and adolescents (the FRIENDS program): A pilot study. Behavior Change, 22, 236-248.
Federer, M., Margraf, J. & Schneider, S. (2000). Leiden schon Achtjährige an Panik? Prävalenzuntersuchung mit Schwerpunkt Panikstörung und Agoraphobie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 28, 205-214.
Ferdinand, R. F., van der Ende, J. & Verhulst, F. C. (2004). Parent-adolescent disagreement regarding psychopathology in adolescents from the general population as a risk factor for adverse outcome. Journal for Abnormal Psychology, 113, 198-206.
Ferdinand, R. F., van der Ende, J. & Verhulst, F. C. (2007). Parent-teacher disagreement regarding behavioral and emotional problems in referred children is not a risk factor for poor outcome. European Child and Adolescent Psychiatry, 16, 121-127.
Fichtner, M. M. (1996). Versuchsplanung experimenteller Einzelfalluntersuchungen in der Psychotherapieforschung. In F. Petermann (Hrsg.), Einzelfallanalyse (S. 61-79). München: Oldenbourg.
Flannery-Schroeder, E., Choudhury, M. S. & Kendall, P. C. (2005). Group and individual cognitive-behavioral treatments for youth with anxiety disorders: 1-year follow-up. Cognitive Therapy and Research, 29, 253-259.
Flannery-Schroeder, E. & Kendall, P. C. (2000). Group and individual cognitive-behavioral treatments for youth with anxiety disorders: A randomized clinical trial. Cognitive Therapy and Research, 24, 251-278.
Foley, D. L., Pickles, A., Maes, H. M., Silberg, J. L. & Eaves, L. J. (2004). Course and short-term outcomes of separation anxiety disorder in a community sample of twins. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 1107-1114.
Ford, T., Goodman, R. & Meltzer, H. (2003). The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: The prevalence of DSM-IV disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 1203-1211.
Fydrich, T. & Bürgener, F. (2005). Ratingskala für soziale Kompetenz. In N. Vriends & J. Margraf (Hrsg.). Soziale Kompetenz, Soziale Unsicherheit, Soziale Phobie – Verstehen und verändern (S. 86-103). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Gar, N. S. & Hudson, J. (2008). An examination of the interactions between mothers and children with anxiety disorders. Behavior Research and Therapy, 46, 1266-1274.
9 Literatur 216
Garcia-Lopez, L. J., Olivares, J., Beidel, D. C., Albano, A. M., Turner, S. M. & Rosa, A. I. (2006). Efficacy of three treatment protocols for adolescents with social anxiety disorder: A five-year follow up assessment. Journal of Anxiety Disorders, 20, 175-191.
Garcia-Lopez, L. J., Olivares, J., Turner, S. M., Albano, A. M., Beidel, D. C. & Sanchez-Meca, J. (2002). Results at long-term among three psychological treatments for ado-lescents with generalized social phobia (II): Clinical significance and effect size. Psicologia Conductual, 10, 371-385.
Gehring, T. M. (1998). Familiensystemtest (FAST). Weinheim: Beltz.
Ginsburg, G. S. & Drake, K. L. (2002). School-based treatment for anxious African-American adolescents: A controlled pilot study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 768-775.
Ginzburg, S. G. A. (2009). Cross-informant agreement between parents and adolescents in 20 cultures. Dissertation Abstracts International, 70 (4-B), 2572. (UMI No. 3354838).
Görtz-Dorten, A. & Döpfner, M. (2008). Diagnose-Checklisten aus dem Diagnostik-System für Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (DISYPS-II) – Güte-kriterien und klinische Anwendung. Klinische Diagnostik und Evaluation, 1, 378-394.
Gra, A., Gerlach, A. L. & Melfsen, S. (2007). Fragebogen zur Erfassung sozial ängstlicher Kognitionen bei Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 35, 257-264.
Gregory, A. M., Caspi, A., Moffitt, T. E., Koenen, K., Eley, T. C. & Poulton, R. (2007). Juvenile mental health histories of adults with anxiety disorders. American Journal of Psychiatry, 164, 301-308.
Grietens, H., Onghena, P., Prinzie, P., Gadeyne, E., Van Assche, V., Ghesquière, P. et al. (2004). Comparison of mothers‘, fathers‘ and teachers‘ reports on problem behav-ior in 5- to 6-year-old children. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 137-146.
Grills, A. E. & Ollendick, T. H. (2003). Multiple informant agreement and the Anxiety Disorders Interview Schedule for Parents and Children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 30-40.
Hadwin, J. A., Garner, M. & Perez-Olivas, G. (2006). The development of information processing biases in childhood anxiety: A review and exploration of its origins in parenting. Clinical Psychology Review, 26, 876-894.
Harrington, R. C. (2001). Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Hogrefe.
9 Literatur 217
Heyne, D., King, N. J., Tonge, B. J., Rollings, S., Young, D., Pritchard, M. et al. (2002). Evaluation of child therapy and caregiver training in the treatment of school refusal. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 687-695.
Hibbs, E. D., Clarke, G., Hechtman, L., Abikoff, H. B., Greenhill, L. L. & Jensen, P. S. (1997). Manual development for the treatment of child and adolescent disorders. Psychopharmacology Bulletin, 33, 619-629.
Higa, C. K. & Daleiden, E. L. (2008). Social anxiety and cognitive biases in non-referred children: The interaction of self-focused attention and threat interpretation biases. Journal of Anxiety Disorders, 22, 441-452.
Hildebrand, D. K., Laing, J. B. & Rosenthal, H. (1977). Prediction analysis of cross classifications. New York: Wiley.
Himeno, Y. & Shimada, H. (2008). A study on the relationship between social skills acquisi-tion and social performance in children with social anxiety. Japanese Journal of Counseling Science, 41, 12-19.
Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2007). Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK): Grundlagen, Durchführung, Anwendungsbeispiele. Weinheim: Beltz/PVU.
Hirshfeld-Becker, D. R., Biederman, J., Henin, A., Faraone, S. V., Davis, S., Harrington, K. et al. (2007). Behavioral inhibition in preschool children at risk is a specific predic-tor of middle childhood social anxiety: A five-year follow-up. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 28, 225-233.
Hollis, S. & Campbell, F. (1999). What is meant by intention to treat analysis? Survey of published randomised controlled trials. British Medical Journal, 319, 670-674.
Hudson, J. L. (2005). Efficacy of cognitive-behavioural therapy for children and adoles-cents with anxiety disorders. Behavior Change, 22, 50-70.
Hudson, J. L. & Kendall, P. C. (2002). Showing you can do it: Homework in therapy for children and adolescents with anxiety disorders. Psychotherapy in Practice, 58, 525-534.
Hudson, J. L., Krain, A. L. & Kendall, P. C. (2001). Expanding horizons: Adapting manual-based treatments for anxious children with comorbid diagnoses. Cognitive and Behavioral Practice, 8, 338-346.
Hughes, A. A. & Kendall, P. C. (2007). Prediction of cognitive-behavior treatment out-come for children with anxiety disorders: Therapeutic relationship and homework compliance. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 35, 487-494.
9 Literatur 218
Hymel, S., Wagner, E. & Butler. L. J. (1990). Reputational bias: View from the peer group. In S. R. Asher & J. D. Coie (Eds.), Peer rejection in childhood (pp. 156-186). New York: Cambridge University Press.
Ihle, W., Frenzel, T. & Esser, G. (2006). Epidemiologie und Verlauf psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. In F. Mattejat (Hrsg.), Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und für die ärztliche Weiter-bildung, Band 4: Verhaltenstherapie mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien (S. 85-96). München: CIP-Medien.
In-Albon, T. (2011). Kinder und Jugendliche mit Angststörungen. Stuttgart: Kohlhammer.
In-Albon, T., Kossowsky, J. & Schneider, S. (2010). Vigilance and avoidance of threat in the eye movements of children with separation anxiety disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 225-235.
In-Albon, T. & Schneider, S. (2007). Psychotherapy of childhood anxiety disorders: A meta-analysis. Psychotherapy and Psychosomatics, 76, 15-24.
In-Albon, T. & Schneider, S. (2011). Trennungsangst Inventar – Kind/Elternversion (TAI-K/E). In C. Barkmann, M. Schulte-Markwort & E. Brähler (Hrsg.), Klinisch-psychia-trische Ratingskalen für das Kindes- und Jugendalter (S. 458-461). Göttingen: Hogrefe.
Ishikawa, S., Okajima, I., Matsuoka, H. & Sakano, Y. (2007). Cognitive behavioral therapy for anxiety disorders in children and adolescents: A meta-analysis. Child and Adoles-cent Mental Health, 12, 164-172.
Jacobson, N. & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19.
Javo, C., Ronning, J. A., Handegard, B. H. & Rudmin, F. W. (2009). Cross-informant correlations on social competence and behavioral problems in Sami and Norwegian preadolescents. European Child and Adolescent Psychiatry, 18, 154-163.
Joormann, J. & Unnewehr, S. (2002a). Behandlung der Sozialen Phobie bei Kindern und Jugend-lichen: Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Gruppenprogramm. Göttingen: Hogrefe.
Joormann, J. & Unnewehr, S. (2002b). Eine kontrollierte Studie zur Wirksamkeit einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Sozialer Phobie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 31, 284-290.
Kagan, J. (1994). Galen’s prophecy: Temperament in human nature. New York: Basic Books.
Kagan, J., Reznick, J. S., Clarke, C., Snidman, N. & Garcia-Coll, C. (1984). Behavioral inhibition to the unfamiliar. Child Development, 55, 2212-2225.
9 Literatur 219
Kaluza, G. & Schulze, H.-H. (2000). Evaluation von Gesundheitsförderungsprogrammen – Methodische Stolpersteine und pragmatische Empfehlungen. Zeitschrift für Gesund-heitspsychologie, 8, 18-24.
Kazantzis, N., Deane, F. P. & Ronan, K. R. (2000). Homework assignments in cognitive and behavioral therapy: A meta-analysis. Clinical Psychology: Science and Practice, 7, 189-202.
Kazantzis, N., Whittington, C. & Dattilio, F. (2010). Meta-analysis of homework effects in cognitive and behavioral therapy: A replication and extension. Clinical Psychology: Science and Practice, 17, 144-156.
Keller, M. B. (2003). The lifelong course of social anxiety disorder: A clinical perspective. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, 85-94.
Keller, M. B., Lavori, P. W., Wunder, J., Beardslee, W. R., Schartz, C. E. & Roth, J. (1992). Chronic course of anxiety disorders in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 595-599.
Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: Results of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 100-110.
Kendall, P. C. & Barmish, A. J. (2007). Show-That-I-Can (Homework) in cognitive-behavioral therapy for anxious youth: Individualizing homework for Robert. Cognitive and Behavioral Practice, 4, 289-296.
Kendall, P. C., Brady, E. U. & Verduin, T. L. (2001). Comorbidity in childhood anxiety disorders and treatment outcome. Journal of the American Academy of Child and Adoles-cent Psychiatry, 40, 787-794.
Kendall, P. C. & Chu, B. C. (2000). Retrospective self-reports of therapist flexibility in a manual-based treatment for youths with anxiety disorders. Journal of Clinical Child Psychology, 29, 209-220.
Kendall, P. C., Chu, B. C., Gifford, A., Hayes, C. & Nauta, M. (1998). Breathing life into a manual: Flexibility and creativity with manual-based treatments. Cognitive and Behav-ioral Practice, 5, 177-198.
Kendall, P. C. & Flannery-Schroeder, E. (1998). Methodological issues in treatment research for anxiety disorders in youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 27-38.
Kendall, P. C., Flannery-Schroeder, E., Panichelli-Mindel, S. M., Southam-Gerow, M., Henin, A. & Warman, M. (1997). Therapy for youths with anxiety disorders: A second randomized clinical trial. Journal of Clinical Child Psychology, 65, 366-380.
9 Literatur 220
Kendall, P. C. & Hedtke, K. A. (2006). Cognitive-Behavioral Therapy for Anxious Children: Therapist Manual (3rd Edition). Ardmore, PA: Workbook Publishing.
Kendall, P. C., Holmbeck, G. & Verduin, T. (2004). Methodology, design, and evaluation in psychotherapy research. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behavior change (pp. 16-43) New York: Wiley.
Kendall, P. C., Hudson, J. L., Gosch, E., Flannery-Schroeder, E. & Suveg, C. (2008). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disordered youth: A randomized clinical trial evaluating child and family modalities. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 282-297.
Kendall, P. C. & Ronan, K. (1990). Assessment of children’s anxieties, fears and phobias: Cognitive-behavioral models and methods. In C. R. Reynolds & R. W. Kamphaus (Eds.), Handbook of psychological and educational assessment of children, Vol. 2: Personality, behavior and context (pp. 223-244). New York: Guilford Press.
Kendall, P. C., Safford, S., Flannery-Schroeder, E. & Webb, A. (2004). Child anxiety treat-ment: Outcomes in adolescence and impact on substance use and depression at 7.4-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 276-287.
Kendall, P. C. & Southam-Gerow, M. A. (1996). Long-term follow-up of a cognitive-behavioral therapy for anxiety-disordered youth. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 724-730.
Kendler, K. S., Walters, E. E., Neale, M. C., Kessler, R. C., Heath, A. C. et al. (1995). The structure of the genetic and environmental risk factors for six major psychiatric disorders in women: Phobia, generalized anxiety disorder, panic disorder, bulimia, major depression, and alcoholism. Archives of General Psychiatry, 52, 374-383.
Kessler, R. C., Amminger, G. P., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Lee, S. & Üstün, T. B. (2007). Age of onset of mental disorders: A review of recent literature. Current Opinion in Psychiatry, 20, 359-364.
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, O. & Walter, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593-602.
Kim-Cohen, J., Caspi, A., Moffitt, T. E., Harrington, H., Milne, B. J. & Poulton, R. (2003). Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorders: Developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Archives of General Psychiatry, 60, 709-717.
King, N. J. & Ollendick, T. H. (1998). Empirically validated treatments in clinical psycho-logy. Australian Psychologist, 33, 89-95.
9 Literatur 221
King, N. J., Tonge, B. J., Heyne, D., Pritchard, M., Rollings, S., Young, D. et al. (1998). Cognitive-behavioral treatment of school-refusing children: A controlled evalua-tion. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 395-403.
Klein-Heßling, J. & Lohaus, A. (2003). Bleib locker – Entspannungs-CD. Göttingen: Hogrefe.
Kley, H. (2011). Aufrechterhaltende Faktoren, Therapieerfolg und Prädiktoren von Therapieerfolg bei Kindern und Jugendlichen mit sozialen Ängsten. Unveröffentlichte Dissertation, Universi-tät Bielefeld.
Kley, H., Heinrichs, N., Bender, C. & Tuschen-Caffier, B. (2012). Predictors of outcome in a cognitive-behavioral group program for children and adolescents with social anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorder, 26, 79-87.
Könning, J. (2007). Die Versorgungssituation im Bereich Kinder- und Jugendlichen-psychotherapie in der Bundesrepublik. Forum Psychotherapeutische Praxis, 7, 62-66.
Kraemer, H. C., Measelle, J. R., Ablow, J. C., Essex, M. J., Boyce, W. T. & Kupfer, D. J. (2003). A new approach to integrating data from multiple informants in psychiatric assessment and research: Mixing and matching contexts and perspectives. American Journal of Psychiatry, 160, 1566-1577.
Krain, A. L. & Kendall, P. C. (2000). The role of parental emotional distress in parent report of child anxiety. Journal of Clinical Psychology, 29, 328-335.
Krampen, G. (2002). Stundenbogen für die Allgemeine und Differentielle Einzelpsychotherapie (STEP). Göttingen: Hogrefe.
Kristensen, H. & Torgersen, S. (2006). Social anxiety disorder in 11-12-year-old children. European Child and Adolescent Psychiatry, 15, 163-171.
Krohne, H. W. & Pulsack, A. (1995). Erziehungsstil-Inventar (ESI). Weinheim: Beltz.
Kühl, S. (2005). Indizierte Prävention von sozialen Ängsten – Entwicklung und Evaluation eines Gruppenprogramms für Kinder und Jugendliche Elektronische Version . Veröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld. Zugriff am 08.10.2012, http://pub.uni-bielefeld.de/publication/2306283.
LaGreca, A. M. & Stone, W. L. (1993). The Social Anxiety Scale for Children – Revised: Factor structure and concurrent validity. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 17-27.
Last, C. G., Hersen, M., Kazdin, A., Francis, G. & Grubb, H. J. (1987). Psychiatric illness in the mothers of anxious children. American Journal of Psychiatry, 144, 1580-1583.
Last, C. G., Hersen, M., Kazdin, A., Orvashel, H. & Perrin, S. (1991). Anxiety disorders in children and their families. Archives of General Psychiatry, 48, 928-935.
9 Literatur 222
Last, C. G., Perrin, S., Hersen, M. & Kazdin, A. (1996). A prospective study of childhood anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1502-1510.
Legerstee, J. S., Garnefski, N., Jellesma, F. C., Verhulst, F. C. & Utens, E. M. W. J. (2010). Cognitive coping and childhood anxiety disorders. European Child and Adolescent Psychiatry, 19, 143-150.
Liber, J. M., McLeod, B. D., van Widenfelt, B. M., Goedhart, A. W., van der Leeden, A. J. M., Utens, E. M. W. J. et al. (2010). Examining the relation between the therapeutic alliance, treatment adherence and outcome of cognitive-behavioral therapy for children with anxiety disorders. Behavior Therapy, 41, 172-186.
Liber, J. M., van Widenfelt, B. M., van der Leeden, A. J. M., Goedhart, A. W., Utens, E. M. W. J. & Treffers, P. D. A. (2010). The relation of severity and comorbidity to treatment outcome with cognitive behavioral therapy for childhood anxiety disorders. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 683-694.
Lieb, R., Wittchen, H.-U., Höfler, M., Fuetsch, M., Stein, M. B. & Merikangas, K. R. (2000). Parental psychopathology, parenting styles and the risk of social phobia in offspring: A prospective-longitudinal community study. Archives of General Psychiatry, 57, 859-866.
Lundh, A. & Gøtzsche, P. C. (2008). Recommendations by Cochrane Review Groups for assessment of the risk of biases in studies. BMC Medical Research Methodology. doi: 10.1186/1471-2288-8-22.
Lyneham, H. J., Abbott, M. J., Wignall, A. & Rapee, R. M. (2003). The Cool Kids Family Program – Therapist Manual. MUARU: Macquarie University, Sidney.
Lyneham, H. J. & Rapee, R. M. (2004). Generalisierte Angststörung. In S. Schneider (Hrsg.), Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen (S. 197-236). Berlin: Springer.
Mack, B. W. (2007). Der Bereichsspezifische Angstfragebogen für Kinder (BAK). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 36, 189-197.
Mackowiak, K. & Lengning, A. (2010). Bochumer Angstverfahren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (BAV 3-11). Bern: Huber.
Manassis, K., Avery, D., Butalia, S. & Mendlowitz, S. (2004). Cognitive-behavioral therapy with childhood anxiety disorders: Functioning in adolescence. Depression and Anxiety, 19, 209-216.
Manassis, K. & Bradley, S. (1994). The development of childhood anxiety disorders: Toward an integrated model. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 345-366.
9 Literatur 223
Manassis, K., Bradley, S., Goldberg, S., Hood, J. & Swinson, R. P. (1994). Attachment in mothers with anxiety disorders and their children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 1106-1113.
Manassis, K., Bradley, S., Goldberg, S., Hood, J. & Swinson, R. P. (1995). Behavioral inhibition, attachment and anxiety in children of mothers with anxiety disorders. The Canadian Journal of Psychiatry, 40, 87-92.
Manassis, K., Mendlowitz, S. L., Scapillato, D., Avery, D., Fiksenbaum, L., Freire, M. et al. (2002). Group and individual cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders: A randomized trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1423-1430.
Margraf, J. & Ehlers, A. (2007). Beck-Angst-Inventar (BAI). Frankfurt: Harcourt.
Marmorstein, N. R. (2006). Generalized versus performance-focused social phobia: Patterns of comorbidity among youth. Journal of Anxiety Disorders, 20, 776-793.
Martin, M., Horder, P. & Jones, G. V. (1992). Integral bias in naming of phobia-related words. Cognition and Emotion, 6, 479-486.
Mattejat, F. & Remschmidt, H. (1999). Fragebogen zur Beurteilung der Behandlung (FBB). Göttingen: Hogrefe.
McLeod, B. D., Wood, J. J. & Weisz, J. R. (2007). Examining the association between par-enting and childhood anxiety: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27, 155-172.
Melfsen, S. (1998). Die deutsche Fassung der Social Anxiety Scale for Children - Revised (SASC-R-D): Psychometrische Eigenschaften und Normierung. Diagnostica, 44, 153-163.
Melfsen, S. (1999). Sozial ängstliche Kinder: Untersuchungen zum mimischen Ausdrucksverhalten und zur Emotionserkennung. Marburg: Tectum.
Melfsen, S. & Florin, I. (1997). Ein Fragebogen zur Erfassung sozialer Angst bei Kindern (SASC-R-D). Kindheit und Entwicklung, 6, 224-229.
Melfsen, S., Florin, I. & Warnke, A. (2001). Sozialphobie und -angstinventar für Kinder (SPAIK). Göttingen: Hogrefe.
Melfsen, S., Kühnemund, M., Schwieger, J., Warnke, A., Stadler, C., Poustka, F. et al. (2011). Cognitive behavioral therapy of socially phobic children focusing on cogni-tion: A randomized wait-list control study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5. Zugriff am 01.08.2012 unter http://www.capmh.com/content/5/1/5.
9 Literatur 224
Melfsen, S., Osterlow, J., Beyer, J. & Florin, I. (2003). Evaluation eines kognitiv-behavioralen Trainings für sozial ängstliche Kinder. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 32, 191-199.
Melfsen, S. & Walitza, S. (2012). Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „Sei kein Frosch”-Programm. Göttingen: Hogrefe.
Melfsen, S. & Warnke, A. (2004). Soziale Phobie. In S. Schneider (Hrsg.), Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen: Grundlagen und Behandlung (S. 165-195). Berlin: Springer.
Mendlowitz, S. L., Manassis, K., Bradley, S., Scapillato, D., Miezitis, S. & Shaw, B. F. (1999). Cognitive-behavioral group treatments in childhood anxiety disorders: The role of parental involvement. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1223-1229.
Merikangas, K. R., Avenevoli, S., Acharyya, S., Zhang, H. & Angst, J. (2002). The spectrum of social phobia in the Zurich cohort study of young adults. Biological Psychiatry, 51, 81-91.
Merikangas, K. R., Dierker, L. C. & Szatmari, P. (1998). Psychopathology among offspring of parents with substance abuse and/or anxiety disorders: A high-risk study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 711-720.
Merikangas, K. R., He, J., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L. et al. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in U.S. adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication – Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49, 980-989.
Merikangas, K. R., Lieb, R., Wittchen, H.-U. & Avenevoli, S. (2003). Family and high risk studies of social anxiety disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108 (Suppl. 417), 28-37.
Micco, J. A., Henin, A., Mick, E., Kim, S., Hopkins, C. A., Biederman, J. et al. (2009). Anxiety and depressive disorders in offspring at high risk for anxiety: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 23, 1158-1164.
Möller, C. & Petermann, U. (2011). Kurz- und langfristige Effekte des Trainings mit sozial unsicheren Kindern. Verhaltenstherapie, 21, 15-22.
Moreno, J. (2007). Family and group cognitive behavior therapy: Evaluation of treatment outcome and treatment specificity. Dissertation Abstracts International, 68 (6-B), 4138. (UMI No. AAI3268658).
Motoca, L. M., Williams, S. & Silverman, W. K. (2012). Social skills as a mediator between anxiety symptoms and peer interactions among children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 41, 329-336.
9 Literatur 225
Müller, N. (2002). Die soziale Angststörung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Erscheinungsformen, Verlauf und Konsequenzen. Münster: Waxmann.
Muris, P., Mayer, B., Bartelds, E., Tierney, S. & Bogie, N. (2001). The revised version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-R): Treat-ment sensitivity in an early intervention trial for childhood anxiety disorders. British Journal of Clinical Psychology, 40, 323-336.
Muris, P. & Meesters, C. (2002). Attachment, behavioral inhibition and anxiety disorders symptoms in normal adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24, 97-106.
Muris, P., Meesters, C. & van Melick, M. (2002). Treatment of childhood anxiety disorder: A preliminary comparison between cognitive-behavioral group therapy and a psy-chological placebo intervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 143-158.
Muris, P., Merckelbach, H. & Damsma, E. (2000). Threat perception bias in non-referred, socially anxious children. Journal of Clinical Child Psychology, 29, 348-359.
Muris, P., van Brakel, A. M. L., Arntz, A. & Schouten, E. (2011). Behavioral inhibition as a risk factor for the development of childhood anxiety disorders: A longitudinal study. Journal of Child and Family Studies, 20, 157-170.
Mychailyszyn, M. P., Mendez, J. L. & Kendall, P. C. (2010). School functioning in youth with and without anxiety disorders: Comparisons by diagnosis and comorbidity. School Psychology Review, 39, 106-121.
Nauta, M., Scholing, A., Emmelkamp, P. M. G. & Minderaa, G. (2003). Cognitive-behavioral therapy for children with anxiety disorders: No additional effect of parent training. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 1270-1278.
Newman, D. L., Moffitt, T. E., Caspi, A., Magdol, L., Silva, P. A. & Stanton, W. R. (1996). Psychiatric disorder in a birth cohort of young adults: Prevalence, comorbidity, clinical significance and new case incidence from ages 11 to 21. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 552-562.
Nübling, R., Reisch, M. & Raymann, T. (2006). Zur psychotherapeutischen und psycho-sozialen Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg. Psychotherapeutenjournal, 3, 247-257.
Ollendick, T. H., Jarrett, M. A., Grills-Taquechel, A. E., Hovey, L. D. & Wolff, J. C. (2008). Comorbidity as a predictor and moderator of treatment outcome in youth with anx-iety, affective, attention deficit/hyperactivity disorder, and oppositional/conduct disorders. Clinical Psychology Review, 28, 1447-1471.
9 Literatur 226
Ollendick, T. H. & King, N. J. (1998). Empirically supported treatments for children with phobic and anxiety disorders: Current status. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 156-167.
O’Neil, K. A. & Kendall, P. C. (2012). Role of comorbid depression and co-occurring depressive symptoms in outcomes for anxiety-disordered youth treated with cogni-tive-behavioral therapy. Child and Family Behavior Therapy, 34, 197-209.
Ortbandt, C. & Petermann, U. (2009). Effekte des Trainings mit sozial unsicheren Kindern. Kindheit und Entwicklung, 18, 21-29.
Petermann, F. (2007). Praxisforschung in der Kinderverhaltenstherapie. Kindheit und Entwicklung, 16, 139-142.
Petermann, F. & Petermann, U. (2011). Wechsler Intelligence Scale for Children – 4th Edition (WISC-IV). Frankfurt: Pearson.
Petermann, F. & Sauerborn, C. (1989). Training zum Aufbau sozial kompetenter Verhal-tensweisen im Kindergartenalter. Acta Paedopsychiatrica, 52, 176-187.
Petermann, F. & Senftleben, S. (1990). Training sozialer Kompetenzen mit sehbehinderten Grundschulkindern. Heilpädagogische Forschung, 16, 53-60.
Petermann, F. & Walter, H.-J. (1989). Wirkungsanalyse eines Verhaltenstrainings mit sozial unsicheren, mehrfach beeinträchtigten Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 38, 118-125.
Petermann, U. (1983). Training mit sozial unsicheren Kindern (1. Auflage). München: Urban & Schwarzenberg.
Petermann, U. (1984). Einzelfallanalytische Effektüberprüfung bei einem Training mit sozial unsicheren Kindern. Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie, 3, 357-374.
Petermann, U. (2007). Die Kapitän-Nemo-Geschichten – Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche Audio-CD . Essen: Elvikom.
Petermann, U. (2013). Die Kapitän-Nemo-Geschichten – Geschichten gegen Angst und Stress (18. Auflage). Freiburg: Herder.
Petermann, U. & Petermann, F. (2006a). Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL). Göttingen: Hogrefe.
Petermann, U. & Petermann, F. (2006b). Training mit sozial unsicheren Kindern (9. Auflage). Weinheim: Beltz/PVU.
9 Literatur 227
Petermann, U. & Petermann, F. (2010). Training mit sozial unsicheren Kindern (10. Auflage). Weinheim: Beltz/PVU.
Petermann, U. & Röttgen, B. (1986). Sozial unsichere Kinder – Konzeption und Evalua-tion eines Behandlungspaketes. Heilpädagogische Forschung, 31, 51-58.
Piacentini, J. C., Cohen, P. & Cohen, J. (1992). Combining discrepant diagnostic infor-mation from multiple sources: Are complex algorithms better than simple ones? Journal of Abnormal Child Psychology, 20, 51-63.
Pine, D. S., Cohen, P., Gurley, D. Brook, J. & Ma, Y. (1998). The risk for early-adulthood anxiety and depressive disorders in adolescents with anxiety and depressive disor-ders. Archives of General Psychiatry, 55, 56-64.
Plück, J., Döpfner, M., Berner, W., Englert, E., Fegert, J., Huss, M. et al. (1997). Die Bedeutung unterschiedlicher Informationsquellen bei der Beurteilung psychischer Störungen im Jugendalter – ein Vergleich von Elternurteil und Selbsteinschätzung Jugendlicher. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 46, 566-582.
Plück, J., Döpfner, M. & Lehmkuhl, G. (2000). Internalisierende Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse der PAK-KID-Studie. Kindheit und Entwicklung, 9, 133-142.
Potter, K. I. (1999). Implicit and explicit memory bias in adolescents who report symptoms of anxiety. Dissertation Abstracts International, 60(4-B), 1882 (UMI No. AEH9924352).
Psychotherapeutenkammer Hessen (PtK Hessen) (2006). Mitgliederbefragung zur psychothera-peutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Hessen. Zugriff am 26.02.2013 unter http://www.ptk-hessen.de/neptun/neptun.php/oktopus/download/427
Rapee, R. M. (1997). Potential role of childrearing practices in the development of anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 17, 47-67.
Rapee, R. M. (2001). The development of generalized anxiety. In M. W. Vasey & M. R. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of anxiety (pp. 481-504). New York: Oxford University Press.
Rapee, R. M. (2003). The influence of comorbidity on treatment outcome for children and adolescents with anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 41, 105-112.
Rapee, R. M. & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behavior Research and Therapy, 35, 741-756.
Rapee, R. M. & Szollos, A. A. (2002). Developmental antecedents of clinical anxiety in childhood. Behavior Change, 19, 146-157.
9 Literatur 228
Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Erhart, M., Bettge, S., Wittchen, H.-U., Rothenberger, A. et al. (2008). Prevalence of mental health problems among children and adolescents in Germany: Results from the Bella study within the National Health Interview and Examination Survey. European Child and Adolescent Psychiatry, 17 (Suppl. 1), 22-33.
Revenstorf, D. & Keeser, W. (1996). Zeitreihenanalyse von Therapieverläufen – ein Über-blick. In F. Petermann (Hrsg.), Einzelfallanalyse (S. 167-212). München: Oldenbourg.
Rice, C. L. (2009). Reducing anxiety in middle school and high school students: A compari-son of cognitive-behavioral therapy and relaxation training approaches. Dissertation Abstracts International, 69(7-A), 2607. (UMI No. AAI3315629).
Rief, W., Exner, C. & Martin, A. (2006). Psychotherapie – Ein Lehrbuch. Stuttgart: Kohlhammer.
Rossmann, P. (2005). Depressionstest für Kinder (DTK). Göttingen: Hogrefe.
Runge, A. J., Beesdo, K., Lieb, R. & Wittchen, H.-U. (2008). Wie häufig nehmen Jugend-liche und junge Erwachsene mit Angststörungen eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch? Verhaltenstherapie, 18, 26-34.
Saavedra, L. M., Silverman, W. K., Morgan-Lopez, A. A. & Kurtines, W. M. (2010). Cogni-tive-behavioral treatment for childhood anxiety disorders: Long-term effects on anxiety and secondary disorders in young adulthood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 924-934.
Saile, H. & Kison, K. (2002). Erfassung sozialer Unsicherheit bei Kindern: Situative Aspekte und Verarbeitungsebenen. Diagnostica, 48, 6-11.
Salbach-Andrae, H., Klinkowski, N., Lenz, K. & Lehmkuhl, U. (2009). Agreement between youth-reported and parent-reported psychopathology in a referred sample. European Child and Adolescent Psychiatry, 18, 136-143.
Salbach-Andrae, H., Lenz, K. & Lehmkuhl, U. (2009). Patterns of agreement among par-ent, teacher and youth ratings in a referred sample. European Psychiatry, 24, 345-351.
Santacruz, I., Orgiles, M., Rosa, A. I., Sanchez-Meca, J., Mendez, X. & Olivares, J. (2002). Generalized anxiety, separation anxiety and school phobia: The predominance of cognitive-behavioral therapy [Spanish]. Psicologia Conductual Revista Internacional de Psicologia Clinica de la Salud, 10, 503-521.
Schmeck, K., Poustka, F., Döpfner, M., Plück, J., Berner, W., Lehmkuhl, G. et al. (2001). Discriminant validity of the child behaviour checklist CBCL/4-18 in German samples. European Child and Adolescent Psychiatry, 10, 240-247.
9 Literatur 229
Schneider, S. (2004a). Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen: Grundlagen und Behandlung. Berlin: Springer.
Schneider, S. (2004b). Trennungsangstprogramm für Familien (TAFF). Unveröffentlichtes Manual, Universität Basel.
Schneider, S. (in Druck). Basler Bilder-Angst-Test (B-BAT). Frankfurt: Pearson.
Schneider, S. & Blatter, J. (2006). Angststörungen. In F. Mattejat (Hrsg.), Lehrbuch der Psychotherapie für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und für die ärztliche Weiterbildung, Band 4: Verhaltenstherapie mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien (S. 531-538). München: CIP-Medien.
Schneider, S., Blatter-Meunier, J., Herren, C., Adornetto, C., In-Albon, T. & Lavallee, K. (2011). Disorder-specific cognitive-behavioral therapy for separation anxiety disor-der in young children: A randomized waiting-list-controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 80, 206-215.
Schneider, S. & Borer, S. (2007). Nur keine Panik: Was Kids über Angst wissen sollten. Basel: Karger.
Schneider, S. & Döpfner, M. (2004). Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von Angst- und Phobischen Störungen im Kindes- und Jugendalter: Ein evidenz-basierter Diskussionsvorschlag. Kindheit und Entwicklung, 13, 80-96.
Schneider, S. & In-Albon, T. (2006). Die psychotherapeutische Behandlung von Angst-störungen im Kindes- und Jugendalter – Was ist evidenzbasiert? Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 34, 191-202.
Schneider, S. & In-Albon, T. (2010). Angststörungen und Phobien im Kindes- und Jugend-alter – Evidenzbasierte Diagnostik und Behandlung. Psychotherapeut, 55, 525-540.
Schneider, S., In-Albon, T., Nündel, B. & Margraf, J. (2013). Parental panic treatment reduces children’s long-term psychopathology: A prospective longitudinal study. Psychotherapy and Psychosomatics, 82, 346-348.
Schneider, S. & Silverman, W. K. (in Vorbereitung). Kinder-Angstsensitivitätsindex (KASI). Göttingen: Hogrefe.
Schreier, S.-S. & Heinrichs, N. (2008). Die Elternversion der deutschen Fassung der Social Anxiety Scale for Children Revised (SASC-R-D): Notwendig, hinreichend oder überflüssig? Klinische Diagnostik und Evaluation, 1, 430-446.
Sedlmeier, P. & Renkewitz, F. (2008). Forschungsmethoden und Statistik in der Psychologie. München: Pearson Studium.
9 Literatur 230
Seligman, M. E. P. (1995). The effectiveness of psychotherapy: The Consumer Reports study. American Psychologist, 50, 965-974.
Seligman, M. E. P. (2010). Erlernte Hilflosigkeit (4., unveränderte Auflage). Weinheim: Beltz.
Shamir-Essakow, G., Ungerer, J. A. & Rapee, R. M. (2005). Attachment, behavioral inhibi-tion and anxiety in preschool children. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 131-143.
Shortt, A. L., Barrett, P. M., Dadds, M. R. & Fox, T. L. (2001). Evaluating the FRIENDS program: A cognitive-behavioral group treatment for anxious children and their parents. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 525-535.
Silverman, W. K. & Albano, A. M. (1996). The Anxiety Disorders Interview Schedule for Children and Parents (ADIS-C/P). San Antonio, XT: Psychological Corporation.
Silverman, W. K. & Eisen, A. R. (1992). Age differences in the reliability of parent and child reports of child anxious symptomatology using a structured interview. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 117-124.
Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Ginsburg, G. S., Weems, C. F., Lumpkin, P. W. & Carmichael, D. H. (1999a). Treating anxiety disorders in children with group cogni-tive-behavioral therapy: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 995-1003.
Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Ginsburg, G. S., Weems, C. F., Rabian, B. & Serafini, L. T. (1999b). Contingency management, self-control, and education support in the treatment of childhood phobic disorders: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 675-687.
Silverman, W. K., Pina, A. A. & Viswesvaran, C. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 105-130.
Silverman, W. K., Saavedra, L. M. & Pina, A. A. (2001). Test-retest reliability of anxiety symptoms and diagnoses with the Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: Child and Parent Versions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 937-944.
Siqueland, L., Rynn, M. & Diamond, G. S. (2005). Cognitive behavioral and attachment based family therapy for anxious adolescents: Phase I und II studies. Anxiety Disor-ders, 19, 361-381.
Southam-Gerow, M. A., Kendall, P. C. & Weersing, V. R. (2001). Examining outcome vari-ability: Correlates of treatment response in a child and adolescent anxiety clinic. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 422-436.
9 Literatur 231
Specht, M. K. I. (2000). Angststörungen im Kindesalter – Implementierung eines kognitiv-behavioralen Trainings im Rahmen der stationären Jugendhilfe. Aachen: Shaker Verlag.
Speck, V. (2005a). Progressive Muskelentspannung für Kinder Audio-CD . Göttingen: Hogrefe.
Speck, V. (2005b). Training progressiver Muskelentspannung für Kinder. Göttingen: Hogrefe.
Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behavior Research and Therapy, 36, 545-566.
Spence, S. H., Donovan, C. & Brechman-Toussaint, M. (1999). Social skills, social out-comes and cognitive features of childhood social phobia. Journal of Abnormal Psycho-logy, 108, 211-221.
Spence, S. H., Donovan, C. & Brechman-Toussaint, M. (2000). The treatment of childhood social phobia: The effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioral intervention, with and without parental involvement. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 713-726.
Steinhausen, H.-C., Metzke, C., Meier, M. & Kannenberg, R. (1998). Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders: The Zürich epidemiological study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98, 261-271.
Stenzel, N., Krumm, S. & Tuschen-Caffier, B. (2009). Entwicklung und Validierung eines Lehrerfragebogens zu sozialen Ängsten im Kindes- und Jugendalter (L-ESAK). Klinische Diagnostik und Evaluation, 2, 33-53.
Stiensmeier-Pelster, J., Schürmann, M. & Duda, K. (2000). Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ). Göttingen: Hogrefe.
Streiner, D. L. (2006). Sample size in clinical research: When is enough enough? Journal of Personality Assessment, 87, 259-260.
Sturzbecher, D. & Freytag, R. (2000). Familien- und Kindergarten-Interaktionstest (FIT-KIT). Göttingen: Hogrefe.
Suhr-Dachs, L. & Döpfner, M. (2005). Leistungsängste – Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ), Band 1. Göttingen: Hogrefe.
Suveg, C., Hudson, J. L., Brewer, G., Flannery-Schroeder, E., Gosch, E. & Kendall, P.C. (2009). Cognitive-behavioral therapy for anxiety-disordered youth: Secondary outcomes from a randomized clinical trial evaluating child and family modalities. Journal of Anxiety Disorders, 23, 341-349.
Target, M. & Fonagy, P. (1994). Efficacy of psychoanalysis for children with emotional disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 361-371.
9 Literatur 232
Thurner, F. & Tewes, U. (1969). Kinder-Angst-Test (KAT). Ein Fragebogen zur Erfassung des Ängstlichkeitsgrades von Kindern ab 9 Jahren. Göttingen: Hogrefe.
Thurner, F. & Tewes, U. (2000). Kinder-Angst-Test II (KAT-II). Göttingen: Hogrefe.
Treadwell, K. R. H., Flannery-Schroeder, E. C. & Kendall, P. C. (1995). Ethnicity and gender in relation to adaptive functioning, diagnostic status, and treatment outcome in children from an anxiety clinic. Journal of Anxiety Disorders, 9, 373-384.
Treutler, C. M. & Epkins, C. C. (2003). Are discrepancies among child, mother and father reports on children’s behavior related to parents’ psychological symptoms and aspects of parent-child relationships? Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 13-27.
Tuschen-Caffier, B., Krämer, M., Seefeldt, W. L., Breuninger, C. & Heinrichs, N. (in preparation). Evaluation of a cognitive-behavioral group treatment for childhood SAD in a randomized clinical sample.
Tuschen-Caffier, B., Kühl, S. & Bender, C. (2009). Soziale Ängste und Soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter – Ein Therapiemanual. Göttingen: Hogrefe.
Unnewehr, S., Schneider, S. & Margraf, J. (1995). Diagnostisches Interview bei psychischen Störun-gen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS) (1. Auflage). Berlin: Springer.
Unnewehr, S., Schneider, S. & Margraf, J. (2009). Diagnostisches Interview bei psychischen Störun-gen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS) (2. Auflage). Berlin: Springer.
van der Bruggen, C. O., Stams, G. J. J. M. & Bögels, S. M. (2008). Research review: The relation between child and parent anxiety and parental control: A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 1257-1269.
van Gemmeren, B., Bender, C., Pook, M. & Tuschen-Caffier, B. (2008). Elternfragebogen zu sozialen Ängsten im Kindes- und Jugendalter (ESAK) – Entwicklung, psycho-metrische Qualität und Normierung. Klinische Diagnostik und Evaluation, 1, 412-429.
Vasey, M. W., Daleiden, E. L., Williams, L. L. & Brown, L. M. (1995). Biased attention in childhood anxiety disorders: A preliminary study. Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 267-279.
Vasey, M. W. & McLeod, C. (2001). Information-processing factors in childhood anxiety: A review and developmental perspective. In M. W. Vasey & M. R. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of anxiety (pp. 253-277). London: Oxford University Press.
Verduin, T. L. & Kendall, P. C. (2003). Differential occurrence of comorbidity within childhood anxiety disorders. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 290-295.
9 Literatur 233
Warren, S. L., Huston, L., Egeland, B. & Sroufe, A. (1997). Child and adolescent anxiety disorders and early attachment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 637-644.
Watts, S. E. & Weems, C. F. (2006). Associations among selective attention, memory bias, cognitive errors and symptoms of anxiety in youth. Journal of Abnormal Child Psycho-logy, 34, 841-852.
Weems, C. F. (2008). Developmental trajectories of childhood anxiety: Identifying continu-ity and change in anxious emotion. Developmental Review, 28, 488-502.
Weersing, V. R., Gonzalez, A., Campo, J. V. & Lucas, A. N. (2008). Brief behavioral thera-py for pediatric anxiety and depression: Piloting an integrated treatment approach. Cognitive and Behavioral Practice, 15, 126-139.
Weinbrenner, B. (2005). Fremddiagnostik bei Ängsten im Kindes- und Jugendalter Elektronische Version . Veröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld. Zugriff am 03.05.2012 unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:361-8026
Weisz, J. R., Weiss, B., Alicke, M. D. & Klotz, M. L. (1987). Effectiveness of psycho-therapy with children and adolescents: A meta-analysis for clinicians. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 542-549.
Weisz, J. R., Weiss, B., Han, S. S., Granger, D. A. & Morton, T. (1995). Effects of psycho-therapy with children and adolescents revisited: A meta-analysis of treatment out-come studies. Psychological Bulletin, 3, 450-468.
Weiß, R. H. (2006). Grundintelligenztest Skala 2 – Revision (CFT 20-R). Göttingen: Hogrefe.
Weiß, R. H. & Osterland, J. (1997). Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1). Göttingen: Hogrefe.
Wekenmann, S. B. (2009). Entwicklung und Evaluation eines des Tübinger Trainings sozialer Kompe-tenzen (TTsK) für sechs- bis zwölfjährige Kinder Elektronische Version . Veröffentlichte Dissertation, Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zugriff am 22.01.2011 unter http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2009/3897/pdf/Endversion_Diss_ SW _komplettue.pdf
Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. & Rauer, W. (1974). Angstfragebogen für Schüler (AFS) (1. Auflage). Braunschweig: Westermann.
Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B. & Rauer, W. (1981). Angstfragebogen für Schüler (AFS) (6. Auflage). Göttingen: Westermann.
Wirtz, M. (2006). Methoden zur Bestimmung der Beurteilerübereinstimmung. In F. Peter-mann & M. Eid (Hrsg.), Handbuch der Psychologischen Diagnostik (S. 369-380). Göttin-gen: Hogrefe.
9 Literatur 234
Wittchen, H.-U. & Jacobi, F. (2001). Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland – Eine klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundes-Gesundheitssurveys 1998. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheits-schutz, 44, 993-1000.
Wittchen, H.-U., Lieb, R., Pfister, H. & Schuster, P. (2000). The waxing and waning of mental disorders: Evaluating the stability of syndromes of mental disorders in the population. Comprehensive Psychiatry, 41, 122-132.
Wittchen, H.-U., Nelson, C. B. & Lachner, G. (1998). Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. Psychological Medicine, 28, 109-126.
Wittchen, H.-U., Stein, M. B. & Kessler, R. C. (1999). Social fears and social phobia in a community sample of adolescents and young adults: Prevalence, risk factors and co-morbidity. Psychological Medicine, 29, 309-323.
Woitecki, K. & Döpfner, M. (2011). Die Wirksamkeit der Reaktionsumkehr-Behandlung bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen Tic-Störungen – Eine Pilotstudie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 39, 387-397.
Wood, J. J., McLeod, B. D., Sigman, M., Hwang, W.-C. & Chu, B. C. (2003). Parenting and childhood anxiety: Theory, empirical findings and future directions. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 134-151.
Wood, J. J., Piacentini, J. C., Southam-Gerow, M., Chu, B. C. & Sigman, M. (2006). Family cognitive behavioral therapy for child anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 314-321.
World Health Organization (WHO) / Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2010). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F) – Klinisch-diagnostische Leitlinien (7., überarbeitete Auflage). Bern: Huber.
World Health Organization (WHO) / Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. & Schulte-Markwort, E. (Hrsg.). (2011). Internationale Klassifikation Psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F) – Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis (5., überarbeitete Auflage). Bern: Huber.
10 Anhang 235
10 Anhang
Anhang 1: Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem Training
Anhang 2: Korrelationen (Pearson’s r) zwischen den Einschätzungen für Schweregrad und Problemstärke im Eltern- und Lehrerurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES)
Anhang 3: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik und der Depressiven Symptomatik im Elternurteil sowie Ergebnisse der Mann-Whitney-U-Tests auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES)
Anhang 4: Beurteilung der klinischen Auffälligkeit in der Interventionsgruppe und in der Wartekontrollgruppe anhand des Elternurteils auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Anhang 5: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil sowie Ergebnisse der Mann-Whitney-U-Tests auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Anhang 6: Beurteilung der Auffälligkeit des Sozialverhaltens in der Interventionsgruppe und in der Wartekontrollgruppe anhand des Lehrerurteils auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Anhang 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinder-urteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 8: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik und der Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 10: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik und zur Depressiven Symp-tomatik im Elternurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremd-
10 Anhang 236
beurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 11: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zur Angstsymptomatik und zur Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremd-beurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventionsgruppe
Anhang 12: Beurteilung der klinischen Auffälligkeit in der Interventionsgruppe anhand des Elternurteils auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Anhang 13: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrer-urteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angst-störungen (FBB-ANG) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 14: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 15: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lern-verhalten (LSL) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 16: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zum schulbezogenen Sozialverhalten im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Wartekontrollgruppe
Anhang 17: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
Anhang 18: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zum schulbezogenen Sozialverhalten im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lern-verhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
Anhang 19: Beurteilung der Auffälligkeit des schulbezogenen Sozialverhaltens in der Interventionsgruppe anhand des Lehrerurteils auf den Skalen der Lehrerein-schätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Anhang 20: Einfluss verschiedener Merkmale auf die Reduktion der Angstsymptomatik aus Sicht der Eltern gemessen mit den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) - Mittelwerte und
10 Anhang 237
Standardabweichungen zum zweiten Messzeitpunkt sowie Ergebnisse der Kruskal-Wallis-H-Tests
Anhang 21: Retrospektive Beurteilung des Trainings durch die Eltern der Wartekontroll-gruppe – Häufigkeitsangaben (Prozentangaben in Klammern)
10 Anhang 238
Anhang 1: Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem Training
Mit diesem Fragebogen möchten wir in Erfahrung bringen, wie zufrieden Sie mit der Teil-
nahme am „Training mit sozial unsicheren Kindern“ (Petermann & Petermann, 2006) sind.
Wir bitten Sie, die Fragen sorgfältig und gewissenhaft zu beantworten. Auf diese Weise
können Sie uns dabei unterstützen, das Training ständig weiter zu verbessern. Bei vielen
Fragen brauchen Sie nur die zutreffende Antwort anzukreuzen. Bei einigen Fragen haben
Sie zusätzlich die Möglichkeit, die vorgegebenen Linien für Bemerkungen zu nutzen.
Name des Kindes: Vorname des Kindes:
Geburtsdatum: Alter:
Beurteiler/in: Trainer/in:
Datum: Standort der Einrichtung:
3. MZP (Interventionsgruppe) 4. MZP (Wartekontrollgruppe)
Nr. Fragen zur Zufriedenheit mit dem Training
1 Konnten Sie die in der Elternberatung besprochenen Inhalte umsetzen?
nie selten manchmal oft immer
Bitte benennen Sie die Inhalte, die Sie umsetzen konnten:
Bitte benennen Sie die Inhalte, die Sie nicht umsetzen konnten:
2 Hat Ihnen die Elternberatung geholfen, Ihr Kind besser zu verstehen?
nie selten manchmal oft immer
Bemerkungen:
3 Hat Ihnen die Elternberatung geholfen, den Zusammenhang zwischen Ihrem Verhalten und dem Verhalten Ihres Kindes besser zu verstehen?
nie selten manchmal oft immer
Bemerkungen:
4 Hat Ihnen die Elternberatung geholfen, Ihr Erziehungsverhalten zu verbessern?
nie selten manchmal oft immer
Bemerkungen:
5 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf bekanntes Problem-verhalten Ihres Kindes anzuwenden?
nie selten manchmal oft immer
10 Anhang 239
Nr. Fragen zur Zufriedenheit mit dem Training
6 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf unbekanntes Problemverhalten Ihres Kindes anzuwenden?
nie selten manchmal oft immer
7 Hat sich das Verhalten Ihres Kindes verbessert?
gar nicht kaum etwas deutlich stark
Bemerkungen:
8 Sind Sie mit den Fortschritten, die Ihr Kind gemacht hat, zufrieden?
gar nicht kaum etwas deutlich sehr
Bemerkungen:
9 Hat sich das Zusammenleben in der Familie verbessert?
gar nicht kaum etwas deutlich stark
Bemerkungen:
10 Haben Sie sich von den Trainerinnen bzw. Trainern verstanden gefühlt?
nie selten manchmal oft immer
Bemerkungen:
11 Haben Sie die Teilnahme am Training als hilfreich empfunden?
nie selten manchmal oft immer
Bemerkungen:
12 Würden Sie das Training weiterempfehlen?
ja nein
13 Was hat Ihnen am Training am besten gefallen?
14 Was hat Ihnen am Training gar nicht gefallen?
15 Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Beobachtungen, Kritik:
Vielen Dank für Ihre Mühe!
10 Anhang 240
Anhang 2: Korrelationen (Pearson’s r) zwischen den Einschätzungen für Schweregrad und Problemstärke im Eltern- und Lehrerurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremd-beurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES)
1. MZP 2. MZP 3. MZP
Eltern IG KG GS IG KG GS IG KG GS
FBB-ANG (n = 14) (n = 11) (n = 25) (n = 14) (n = 11) (n = 25) (n = 14) (n = 11) (n = 25)
TREN 0.99 0.87 0.97 0.99 0.96 0.97 0.92 0.68 0.87
GEN 0.92 0.92 0.92 0.98 0.86 0.95 0.88 0.94 0.90
SOZ 0.97 0.86 0.93 0.97 0.87 0.93 0.85 0.88 0.85
SPEZ 0.95 0.75 0.91 0.97 0.94 0.93 0.88 0.86 0.88
ANG 0.94 0.82 0.92 0.97 0.91 0.96 0.89 0.84 0.88
FBB-DES (n = 14) (n = 11) (n = 25) (n = 14) (n = 11) (n = 25) (n = 14) (n = 11) (n = 25)
DEP 0.90 0.85 0.89 0.97 0.67 0.92 0.96 0.99 0.96
SOM 0.91 0.91 0.91 0.97 0.81 0.92 0.95 0.98 0.95
DYS 0.95 0.93 0.94 0.99 0.75 0.95 0.96 0.96 0.96
DYST 0.93 0.83 0.90 0.99 0.62 0.93 0.97 0.97 0.96
DES 0.93 0.95 0.93 0.98 0.71 0.93 0.96 0.99 0.96
1. MZP 2. MZP 3. MZP
Lehrer IG KG GS IG KG GS IG KG GS
FBB-ANG (n = 13) (n = 9) (n = 22) (n = 13) (n = 9) (n = 22) (n = 13) (n = 9) (n = 22)
GEN 0.89 0.68 0.83 0.96 0.99 0.97 0.76 0.96 0.77
SOZ 0.79 0.90 0.83 0.79 0.93 0.86 0.80 0.98 0.86
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; DEP = Depressive Symptome; SOM = Soma-tisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen; IG = Interventionsgruppe; KG = Wartekontrollgruppe; GS = Gesamtstichprobe.
10
Anh
ang
241
Anh
ang
3: M
ittel
wer
te u
nd S
tand
arda
bweic
hung
en d
er A
ngst
sym
ptom
atik
und
der
Dep
ress
iven
Sym
ptom
atik
im E
ltern
urte
il so
wie
Erg
ebni
sse
der
Man
n-W
hitn
ey-U
-Tes
ts a
uf d
en S
kale
n de
r D
ISY
PS-K
J-Fre
mdb
eurte
ilung
sbog
en A
ngst
stör
unge
n (F
BB-A
NG
) und
Dep
ress
ive
Stör
unge
n (F
BB-D
ES)
1.
MZ
P
2. M
ZP
In
terv
enti
onsg
rup
pe
War
teko
ntr
ollg
rup
pe
Inte
rven
tion
sgru
pp
e W
arte
kon
trol
lgru
pp
e P
rüf-
größ
e K
orri
gier
te
Eff
ekts
tärk
e
Elt
ern
M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) z
a d t2
-t1 b
DIS
YP
S-K
J: F
BB
-AN
G
(n =
14)
(n
= 1
1)
(n =
14)
(n
= 1
1)
Tren
nung
sang
st
0.69
(0
.66)
0.
63
(0.3
2)
0.34
(0
.60)
0.
55
(0.4
1)
-2.0
5 *
0.49
Gen
erali
sierte
Ang
st
1.27
(0
.75)
1.
17
(0.5
7)
0.84
(0
.81)
1.
08
(0.5
5)
-1.5
9 +
0.49
Sozi
ale A
ngst
1.
96
(0.8
2)
1.66
(0
.62)
1.
21
(0.9
3)
1.61
(0
.64)
-2
.11
* 0.
90
Spez
ifisc
he P
hobi
e 0.
81
(0.7
4)
0.61
(0
.46)
0.
53
(0.6
1)
0.70
(0
.63)
-1
.95
* 0.
59
Ang
stst
örun
gen
1.13
(0
.49)
0.
98
(0.2
7)
0.69
(0
.59)
0.
94
(0.3
6)
-2.4
6 **
0.
87
DIS
YP
S-K
J: F
BB
-DE
S (n
= 1
4)
(n =
11)
(n
= 1
4)
(n =
11)
Dep
ress
ive
Sym
ptom
e 0.
74
(0.4
5)
0.83
(0
.29)
0.
46
(0.5
2)
0.62
(0
.27)
-0
.38
0.22
Som
atisc
hes S
yndr
om
0.64
(0
.52)
0.
48
(0.2
8)
0.40
(0
.48)
0.
40
(0.2
8)
-0.8
2 0.
36
Dys
thym
ia (I
CD-1
0)
0.85
(0
.61)
0.
94
(0.3
9)
0.59
(0
.73)
0.
75
(0.3
7)
-0.3
3 0.
10
Dys
thym
e St
örun
g (D
SM-I
V)
0.90
(0
.59)
0.
98
(0.3
6)
0.55
(0
.62)
0.
72
(0.2
9)
-0.4
4 0.
20
Dep
ress
ive
Stör
unge
n 0.
74
(0.4
7)
0.84
(0
.35)
0.
49
(0.5
6)
0.64
(0
.30)
-0
.38
0.08
Anm
erkun
gen: a
Man
n-W
hitn
ey-U
-Tes
t (au
f der
Bas
is st
anda
rdisi
erte
r Res
idue
n), e
inse
itige
Tes
tung
; + p
< .1
0; *
p <
.05;
**
p <
.01;
b E
ffek
tstä
rke
d be
rech
net n
ach
Bortz
und
D
örin
g (2
006)
, ein
gete
ilt n
ach
Cohe
n (1
988)
: d >
0.2
0 (k
lein
er E
ffek
t), d
> 0
.50
(mitt
lere
r Eff
ekt),
d >
0.8
0 (g
roße
r Eff
ekt);
die
Eff
ekts
tärk
en w
urde
n ko
rrig
iert,
inde
m d
ie fü
r de
n Pr
ätes
t erm
ittel
ten
Effe
ktst
ärke
n (d
t1) v
on d
en fü
r den
Pos
ttest
erm
ittel
ten
Eff
ekts
tärk
en (d
t2) s
ubtra
hier
t wur
den
(dt2
-t1 =
dt2
- d t1
).
10 Anhang 242
Anhang 4: Beurteilung der klinischen Auffälligkeit in der Interventionsgruppe und in der Wartekontrollgruppe anhand des Elternurteils auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremd-beurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
1. MZP 2. MZP 1. MZP 2. MZP
Eltern Beurteilung n (%) n (%) n (%) n (%)
FBB-ANG (n = 14) (n = 14) (n = 11) (n = 11)
TREN unauffällig 8 (57.1) 10 (71.4) 5 (45.5) 7 (63.6)
auffällig 2 (14.3) 2 (14.3) 3 (27.3) 2 (18.2)
sehr auffällig 4 (28.6) 2 (14.3) 3 (27.3) 2 (18.2)
GEN unauffällig 5 (35.7) 8 (57.1) 3 (27.3) 4 (36.4)
auffällig 2 (14.3) 3 (21.4) 4 (36.4) 5 (45.5)
sehr auffällig 7 (50.0) 3 (21.4) 4 (36.4) 2 (18.2)
SOZ unauffällig 2 (14.3) 6 (42.9) 2 (18.2) 1 (9.1)
auffällig 2 (14.3) 3 (21.4) 1 (9.1) 4 (36.4)
sehr auffällig 10 (71.4) 5 (35.7) 8 (72.7) 6 (54.5)
SPEZ unauffällig 6 (42.9) 7 (50.0) 6 (54.5) 6 (54.5)
auffällig 2 (14.3) 2 (14.3) 3 (27.3) 2 (18.2)
sehr auffällig 6 (42.9) 5 (35.7) 2 (18.2) 3 (27.3)
ANG unauffällig 2 (14.3) 9 (64.3) 1 (9.1) 3 (27.3)
auffällig 3 (21.4) 1 (7.1) 4 (36.4) 3 (27.3)
sehr auffällig 9 (64.3) 4 (28.6) 6 (54.5) 5 (45.5)
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; Die Angstsymptomatik wird als unauffällig (PR = 0-89), klinisch auffällig (PR = 90-96) oder klinisch sehr auffällig (PR = 97-100) beurteilt.
10
Anh
ang
243
Anh
ang
5: M
ittel
wer
te u
nd S
tand
arda
bweic
hung
en d
es sc
hulb
ezog
enen
Soz
ialve
rhalt
ens i
m L
ehre
rurte
il so
wie
Erg
ebni
sse
der M
ann-
Whi
tney
-U-
Test
s auf
den
Ska
len
der L
ehre
rein
schä
tzlis
te fü
r Soz
ial- u
nd L
ernv
erha
lten
(LSL
)
1.
MZ
P
2. M
ZP
In
terv
enti
onsg
rup
pe
War
teko
ntr
ollg
rup
pe
Inte
rven
tion
sgru
pp
e W
arte
kon
trol
lgru
pp
e P
rüf-
größ
e K
orri
gier
te
Eff
ekts
tärk
e
Leh
rer
M
(SD
) M
(S
D)
M
(SD
) M
(S
D)
z a
d t2-t1
b
LSL
: Soz
ialv
erh
alte
n
(n =
13)
(n
= 9
) (n
= 1
3)
(n =
9)
Koo
pera
tion
10.5
4 (2
.99)
9.
44
(4.2
2)
11.0
0 (3
.06)
11
.67
(2.6
9)
-1.1
4 0.
54
Selb
stw
ahrn
ehm
ung
9.1
5 (2
.51)
8.
89
(3.3
3)
9.9
2 (2
.66)
10
.56
(3.5
8)
-0.7
4 0.
31
Selb
stko
ntro
lle
10.5
4 (2
.33)
9.
56
(4.4
2)
9.5
4 (3
.46)
10
.67
(4.5
8)
-1.9
7 *
0.58
Hilf
sber
eits
chaf
t 7
.38
(3.6
9)
9.78
(3
.90)
8
.77
(3.1
9)
10.5
6 (3
.84)
-0
.30
-0.1
2
Selb
stbe
haup
tung
9
.15
(3.2
4)
9.33
(4
.53)
10
.77
(3.8
3)
10.5
6 (3
.50)
0.
00
-0.1
0
Sozi
alkon
takt
7
.85
(2.8
5)
8.33
(3
.64)
9
.31
(2.3
2)
9.5
6 (3
.94)
-0
.37
-0.0
7
Anm
erkun
gen: a
Man
n-W
hitn
ey-U
-Tes
t (au
f der
Bas
is st
anda
rdisi
erte
r Res
idue
n), e
inse
itige
Tes
tung
; * p
< .0
5; *
* p
< .0
1; b
Eff
ekts
tärk
e d
bere
chne
t nac
h Bo
rtz u
nd D
örin
g (2
006)
, ein
gete
ilt n
ach
Cohe
n (1
988)
: d >
0.2
0 (k
lein
er E
ffek
t), d
> 0
.50
(mitt
lere
r Eff
ekt),
d >
0.8
0 (g
roße
r Eff
ekt);
die
Eff
ekts
tärk
en w
urde
n ko
rrig
iert,
inde
m d
ie fü
r den
Pr
ätes
t erm
ittel
ten
Effe
ktst
ärke
n (d
t1) v
on d
en fü
r den
Pos
ttest
erm
ittel
ten
Effe
ktst
ärke
n (d
t2) s
ubtra
hier
t wur
den
(dt2
-t1 =
dt2
- d t1
).
10 Anhang 244
Anhang 6: Beurteilung der Auffälligkeit des schulbezogenen Sozialverhaltens in der Inter-ventionsgruppe und in der Wartekontrollgruppe anhand des Lehrerurteils auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe
1. MZP 2. MZP 1. MZP 2. MZP
Lehrer Beurteilung n (%) n (%) n (%) n (%)
LSL (n = 13) (n = 13) (n = 9) (n = 9)
KOOP unauffällig 11 (84.6) 11 (84.6) 5 (55.6) 7 (77.8)
leicht auffällig 0 (0.0) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (11.1)
sehr auffällig 2 (15.4) 2 (15.4) 4 (44.4) 1 (11.1)
WAHR unauffällig 10 (76.9) 11 (84.6) 5 (55.6) 6 (66.7)
leicht auffällig 2 (15.4) 0 (0.0) 3 (33.3) 3 (33.3)
sehr auffällig 1 (7.7) 2 (15.4) 1 (11.1) 0 (0.0)
KONT unauffällig 13 (100.0) 10 (76.9) 6 (66.7) 8 (88.9)
leicht auffällig 0 (0.0) 2 (15.4) 2 (22.2) 0 (0.0)
sehr auffällig 0 (0.0) 1 (7.7) 1 (11.1) 1 (11.1)
HILF unauffällig 7 (53.8) 8 (61.5) 4 (44.4) 6 (66.7)
leicht auffällig 4 (30.8) 2 (15.4) 3 (33.3) 2 (22.2)
sehr auffällig 2 (15.4) 3 (23.1) 2 (22.2) 1 (11.1)
BEHA unauffällig 8 (61.5) 11 (84.6) 6 (66.7) 6 (66.7)
leicht auffällig 3 (23.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1)
sehr auffällig 2 (15.4) 2 (15.4) 3 (33.3) 2 (22.2)
SOZI unauffällig 4 (30.8) 7 (53.8) 2 (22.2) 6 (66.7)
leicht auffällig 5 (38.5) 4 (30.8) 2 (22.2) 1 (11.1)
sehr auffällig 4 (30.8) 2 (15.4) 5 (55.6) 2 (22.2)
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; Das schulbezogene Sozialverhalten wird als sehr auffällig (PR = 0-10), leicht auffällig (PR = 11-20) oder unauffällig (PR = 21-100) beurteilt.
10 Anhang 245
Anhang 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Wartekontrollgruppe
2. MZP 3. MZP 4. MZP
Kinder M (SD) M (SD) M (SD)
SASC-R-D (n = 11) (n = 11) (n = 11)
FNE 19.18 (4.36) 18.18 (3.84) 16.64 (4.15)
SAD 19.36 (5.61) 16.91 (6.98) 16.00 (5.53)
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen.
10 Anhang 246
Anhang 8: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließenden Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Kinderurteil auf den Skalen der Social Anxiety Scale for Children – Revised – Deutsche Version (SASC-R-D) in der Wartekontrollgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t2 t3 t2
Kinder F df p 2p p a p b p a
SASC-R-D (n = 11) (n = 11) (n = 11) (n = 11)
FNE 2.09 2, 20 .15 .17 .50 .16 .26
SAD 2.75 2, 20 .09 .22 .13 1.00 .06
Anmerkungen: FNE = Furcht vor negativer Bewertung; SAD = Vermeidung von und Belastung durch soziale Situationen; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2
p = .01 (kleiner Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (großer Effekt).
10 Anhang 247
Anhang 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik und der De-pressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremd-beurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Wartekontrollgruppe
2. MZP 3. MZP 4. MZP
Eltern M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 11) (n = 11) (n = 11)
TREN 0.55 (0.41) 0.29 (0.28) 0.09 (0.11)
GEN 1.08 (0.55) 0.60 (0.47) 0.39 (0.38)
SOZ 1.61 (0.64) 0.86 (0.50) 0.53 (0.43)
SPEZ 0.70 (0.63) 0.30 (0.35) 0.19 (0.33)
ANG 0.94 (0.36) 0.49 (0.30) 0.28 (0.18)
FBB-DES (n = 11) (n = 11) (n = 11)
DEP 0.62 (0.27) 0.39 (0.38) 0.30 (0.32)
SOM 0.40 (0.28) 0.23 (0.27) 0.10 (0.13)
DYS 0.75 (0.37) 0.42 (0.42) 0.24 (0.33)
DYST 0.72 (0.29) 0.44 (0.38) 0.31 (0.36)
DES 0.64 (0.30) 0.40 (0.41) 0.26 (0.31)
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen.
10 Anhang 248
Anhang 10: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik und zur Depressiven Symptomatik im Eltern-urteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Wartekontrollgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t2 t3 t2
Eltern F df p 2p p a p b p a
FBB-ANG (n = 11) (n = 11) (n = 11) (n = 11)
TREN 11.59 2, 20 .00 *** .54 .00 ** .14 .01 **
GEN 11.29 2, 20 .00 ** .53 .04 * .14 .00 **
SOZ 24.90 2, 20 .00 *** .71 .00 ** .04 * .00 ***
SPEZ 10.40 2, 20 .01 ** .51 .03 * .31 .01 **
ANG 30.79 2, 20 .00 *** .76 .00 ** .05 * .00 ***
FBB-DES (n = 11) (n = 11) (n = 11) (n = 11)
DEP 15.24 2, 20 .00 *** .60 .01 ** .17 .00 **
SOM 11.75 2, 20 .00 *** .54 .02 * .10 .00 **
DYS 17.99 2, 20 .00 *** .64 .01 ** .02 * .00 ***
DYST 18.67 2, 20 .00 *** .65 .01 ** .04 * .00 ***
DES 20.49 2, 20 .00 *** .67 .01 ** .03 * .00 ***
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001;
Effektstärke 2p eingeteilt nach Cohen (1988): 2
p = .01 (kleiner Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (großer Effekt).
10 Anhang 249
Anhang 11: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zur Angstsymptomatik und zur Depressiven Symptomatik im Elternurteil auf den Skalen der DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogen Angststörungen (FBB-ANG) und Depressive Störungen (FBB-DES) in der Interventions-gruppe
1. MZP 2. MZP 2. MZP 3. MZP 1. MZP 3. MZP
Eltern z a d' z b d' z a d'
FBB-ANG (n = 14) (n = 14) (n = 14)
TREN -2.56 ** 0.71 -0.14 0.09 -2.95 ** 0.88
GEN -2.80 ** 0.90 -0.56 0.17 -3.19 *** 1.62
SOZ -2.79 ** 1.06 -2.19 * 0.57 -3.30 *** 1.86
SPEZ -1.61 * 0.46 -0.09 0.10 -2.01 * 0.49
ANG -2.87 ** 1.00 -1.47 0.34 -3.30 *** 2.12
FBB-DES (n = 14) (n = 14) (n = 14)
DEP -2.65 ** 0.85 -0.12 0.04 -3.19 *** 1.24
SOM -1.93 * 0.55 -0.82 0.27 -2.43 ** 0.71
DYS -1.93 * 0.55 -1.38 0.42 -3.02 ** 1.03
DYST -2.91 ** 0.83 -0.40 0.08 -3.19 *** 1.28
DES -2.49 ** 0.73 -0.75 0.22 -3.18 *** 1.15
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; DEP = Depressive Symptome; SOM = Somatisches Syndrom; DYS = Dysthymia (ICD-10); DYST = Dysthyme Störung (DSM-IV); DES = Gesamtskala Depressive Störungen; a einseitige Testung, b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; d' = Effektstärke d‘ berechnet nach Bortz und Döring (2006), eingeteilt nach Cohen (1988): d > 0.20 (kleiner Effekt), d > 0.50 (mittlerer Effekt), d > 0.80 (großer Effekt), ein positives Vorzeichen gibt eine Abnahme (z. B. t2 > t3), ein negatives Vorzeichen eine Zunahme (z. B. t2 < t3) an.
10 Anhang 250
Anhang 12: Beurteilung der klinischen Auffälligkeit anhand des Elternurteils auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interven-tionsgruppe
Interventionsgruppe
1. MZP 2. MZP 3. MZP
Eltern Beurteilung n (%) n (%) n (%)
FBB-ANG
TREN unauffällig 8 (57.1) 10 (71.4) 10 (71.4)
auffällig 2 (14.3) 2 (14.3) 2 (14.3)
sehr auffällig 4 (28.6) 2 (14.3) 2 (14.3)
GEN unauffällig 5 (35.7) 8 (57.1) 9 (64.3)
auffällig 2 (14.3) 3 (21.4) 3 (21.4)
sehr auffällig 7 (50.0) 3 (21.4) 2 (14.3)
SOZ unauffällig 2 (14.3) 6 (42.9) 7 (50.0)
auffällig 2 (14.3) 3 (21.4) 1 (7.1)
sehr auffällig 10 (71.4) 5 (35.7) 6 (42.9)
SPEZ unauffällig 6 (42.9) 7 (50.0) 9 (64.3)
auffällig 2 (14.3) 2 (14.3) 1 (7.1)
sehr auffällig 6 (42.9) 5 (35.7) 4 (28.6)
ANG unauffällig 2 (14.3) 9 (64.3) 8 (57.1)
auffällig 3 (21.4) 1 (7.1) 3 (21.4)
sehr auffällig 9 (64.3) 4 (28.6) 3 (21.4)
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; Die Angstsymptomatik wird als unauffällig (PR = 0-89), klinisch auffällig (PR = 90-96) oder klinisch sehr auffällig (PR = 97-100) beurteilt.
10 Anhang 251
Anhang 13: Mittelwerte und Standardabweichungen der Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Wartekontrollgruppe
2. MZP 3. MZP 4. MZP
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD)
FBB-ANG (n = 8) (n = 8) (n = 8)
GEN 0.63 (0.51) 0.35 (0.19) 0.56 (0.70)
SOZ 0.73 (0.50) 0.46 (0.35) 0.66 (0.55)
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie.
10 Anhang 252
Anhang 14: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Wartekontrollgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t2 t3 t2
Lehrer F df p 2p p a p b p a
FBB-ANG (n = 8) (n = 8) (n = 8) (n = 8)
GEN 1.01 2, 14 .39 .13 .17 1.00 .50
SOZ 0.61 2, 14 .49 .08 .42 .79 .50
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p = .01 (kleiner Effekt); 2
p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (großer Effekt).
10 Anhang 253
Anhang 15: Mittelwerte und Standardabweichungen des schulbezogenen Sozialverhaltens im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Wartekontrollgruppe
2. MZP 3. MZP 4. MZP
Lehrer M (SD) M (SD) M (SD)
LSL (n = 8) (n = 8) (n = 8)
KOOP 11.38 (2.33) 10.88 (3.31) 11.37 (3.50)
WAHR 8.88 (3.44) 10.13 (3.76) 10.50 (3.78)
KONT 9.50 (5.43) 10.38 (5.21) 10.88 (4.39)
HILF 9.75 (2.77) 11.13 (3.23) 10.50 (4.47)
BEHA 9.50 (3.25) 10.25 (4.59) 10.75 (4.46)
SOZI 9.13 (3.27) 9.50 (4.38) 10.38 (4.21) Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt.
10 Anhang 254
Anhang 16: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung und der anschließen-den Einzelvergleiche zum schulbezogenen Sozialverhalten im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Wartekontrollgruppe
Varianzanalysen mit Messwiederholung Einzelvergleiche
Haupteffekt „Zeit“ t2 t3 t3 t2
Lehrer F df p 2p p a p b p a
LSL (n = 8) (n = 8) (n = 8) (n = 8)
KOOP 0.17 2, 14 .85 .02 .50 1.00 .50
WAHR 1.88 2, 14 .19 .21 .40 1.00 .05 *
KONT 0.68 2, 14 .52 .09 .32 1.00 .50
HILF 0.95 2, 14 .41 .12 .11 1.00 .50
BEHA 0.56 2, 14 .59 .07 .50 1.00 .50
SOZI 1.28 2, 14 .31 .15 .50 1.00 .28
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; Effektstärke 2
p eingeteilt nach Cohen (1988): 2p =
.01 (kleiner Effekt); 2p = .06 (mittlerer Effekt); 2
p = .14 (großer Effekt).
10 Anhang 255
Anhang 17: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zur Angstsymptomatik im Lehrerurteil auf den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) in der Interventionsgruppe
1. MZP 2. MZP 2. MZP 3. MZP 1. MZP 3. MZP
Lehrer z a d' z b d' z a d'
FBB-ANG (n = 13) (n = 13) (n = 13)
GEN -2.16 * 0.68 -1.62 0.42 -2.85 ** 1.09
SOZ -1.02 0.41 -1.16 0.36 -2.28 * 0.76
Anmerkungen: GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; d' = Effektstärke d‘ berechnet nach Bortz und Döring (2006), eingeteilt nach Cohen (1988): d > 0.20 (kleiner Effekt), d > 0.50 (mittlerer Effekt), d > 0.80 (großer Effekt), ein positives Vor-zeichen gibt eine Abnahme (z. B. t2 > t3), ein negatives Vorzeichen eine Zunahme (z. B. t2 < t3) an.
10 Anhang 256
Anhang 18: Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zum schulbezogenen Sozialverhalten im Lehrerurteil auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
1. MZP 2. MZP 2. MZP 3. MZP 1. MZP 3. MZP
Lehrer z a d' z b d' z a d'
LSL (n = 13) (n = 13) (n = 13)
KOOP -1.08 -0.13 -2.38 * -0.71 -2.32 ** -0.69
WAHR -1.17 -0.38 -1.79 -0.44 -2.15 * -0.61
KONT -1.44 0.38 -2.82 ** -1.01 -1.51 -0.44
HILF -1.79 * -0.40 -1.98 * -0.64 -1.93 * -0.67
BEHA -1.46 -0.44 -0.41 -0.13 -2.33 ** -0.79
SOZI -1.43 -0.40 -0.85 -0.25 -2.11 * -0.68
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; a einseitige Testung; b zweiseitige Testung; * p < .05; ** p < .01; d' = Effektstärke d‘ berechnet nach Bortz und Döring (2006), eingeteilt nach Cohen (1988): d > 0.20 (kleiner Effekt), d > 0.50 (mittlerer Effekt), d > 0.80 (großer Effekt), ein positives Vorzeichen gibt eine Abnahme (z. B. t2 > t3), ein negatives Vorzeichen eine Zunahme (z. B. t2 < t3) an.
10 Anhang 257
Anhang 19: Beurteilung der Auffälligkeit des schulbezogenen Sozialverhaltens anhand des Lehrerurteils auf den Skalen der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) in der Interventionsgruppe
Interventionsgruppe
1. MZP 2. MZP 3. MZP
Lehrer Beurteilung n (%) n (%) n (%)
LSL (n = 13) (n = 13) (n = 13)
KOOP unauffällig 11 (84.6) 11 (84.6) 13 (100.0)
leicht auffällig 0 (0.0) 0 (0.00) 0 (0.0)
sehr auffällig 2 (15.4) 2 (15.4) 0 (0.0)
WAHR unauffällig 10 (76.9) 11 (84.6) 12 (92.3)
leicht auffällig 2 (15.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
sehr auffällig 1 (7.7) 2 (15.4) 1 (7.7)
KONT unauffällig 13 (100.0) 10 (76.9) 13 (100.0)
leicht auffällig 0 (0.0) 2 (15.4) 0 (0.0)
sehr auffällig 0 (0.0) 1 (7.7) 0 (0.0)
HILF unauffällig 7 (53.8) 8 (61.5) 10 (76.9)
leicht auffällig 4 (30.8) 2 (15.4) 0 (0.0)
sehr auffällig 2 (15.4) 3 (23.1) 3 (23.1)
BEHA unauffällig 8 (61.5) 11 (84.6) 11 (84.6)
leicht auffällig 3 (23.1) 0 (0.0) 1 (7.7)
sehr auffällig 2 (15.4) 2 (15.4) 1 (7.7)
SOZI unauffällig 4 (30.8) 7 (53.8) 10 (76.9)
leicht auffällig 5 (38.5) 4 (30.8) 1 (7.7)
sehr auffällig 4 (30.8) 2 (15.4) 2 (15.4)
Anmerkungen: KOOP = Kooperation; WAHR = Selbstwahrnehmung; KONT = Selbstkontrolle; HILF = Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft; BEHA = Angemessene Selbstbehauptung; SOZI = Sozialkontakt; Das schulbezogene Sozialverhalten wird als sehr auffällig (PR = 0-10), leicht auffällig (PR = 11-20) oder unauffällig (PR = 21-100) beurteilt.
10 Anhang 258
Anhang 20: Einfluss verschiedener Merkmale auf die Reduktion der Angstsymptomatik aus Sicht der Eltern gemessen mit den Skalen des DISYPS-KJ-Fremdbeurteilungsbogens Angststörungen (FBB-ANG) - Mittelwerte und Standardabweichungen zum zweiten Mess-zeitpunkt sowie Ergebnisse der Kruskal-Wallis-H-Tests
Interventionsgruppe Wartekontrollgruppe Prüfgröße
FBB-ANG M (SD) M (SD) M (SD) 2 (df = 2)
a
Geschlecht
Mädchen (n = 7)
Jungen (n = 7)
(n = 11)
TREN 0.56 (0.80) 0.13 (0.17) 0.55 (0.41) 2.78
GEN 1.02 (0.97) 0.65 (0.64) 1.08 (0.55) 2.88
SOZ 1.53 (0.89) 0.90 (0.92) 1.61 (0.64) 5.50
SPEZ 0.71 (0.67) 0.35 (0.52) 0.70 (0.63) 3.59
ANG 0.92 (0.71) 0.47 (0.37) 0.94 (0.36) 5.67
Alter
Jung b (n = 7)
Alt b (n = 7)
(n = 11)
TREN 0.20 (0.21) 0.49 (0.83) 0.55 (0.41) 2.09
GEN 0.57 (0.69) 1.10 (0.89) 1.08 (0.55) 2.75
SOZ 0.82 (0.92) 1.61 (0.81) 1.61 (0.64) 5.57
SPEZ 0.31 (0.54) 0.76 (0.63) 0.70 (0.63) 3.32
ANG 0.45 (0.37) 0.94 (0.68) 0.94 (0.36) 5.76
Intellektuelle Leistungsfähigkeit
Niedrig b (n = 6)
Hoch b (n = 8)
(n = 11)
TREN 0.67 (0.83) 0.10 (0.12) 0.55 (0.41) 2.24
GEN 1.45 (0.90) 0.38 (0.30) 1.08 (0.55) 3.33
SOZ 1.71 (1.01) 0.84 (0.71) 1.61 (0.64) 5.48
SPEZ 0.81 (0.68) 0.32 (0.49) 0.70 (0.63) 3.35
ANG 1.11 (0.89) 0.38 (0.19) 0.94 (0.36) 6.40 *
Depressive Symptomatik
Schwach (n = 9)
Stark (n = 5)
(n = 11)
TREN 0.14 (0.15) 0.70 (0.93) 0.55 (0.41) 2.34
GEN 0.52 (0.44) 1.40 (1.07) 1.08 (0.55) 2.81
SOZ 0.92 (0.73) 1.74 (1.09) 1.61 (0.64) 5.73 +
SPEZ 0.30 (0.49) 0.94 (0.62) 0.70 (0.63) 3.40
ANG 0.44 (0.25) 1.15 (0.77) 0.94 (0.36) 6.38 *
Anmerkungen: TREN = Trennungsangst; GEN = Generalisierte Angst; SOZ = Soziale Phobie; SPEZ = Spezifische Phobie; ANG = Gesamtskala Angststörungen; a Kruskal-Wallis-H-Test (auf der Basis standardi-sierter Residuen), zweiseitige Testung; + p < .10; * p < .05; ** p < .01; b Gruppenaufteilung mit Hilfe einer Mediandichotomisierung (zum 1. Messzeitpunkt).
10 Anhang 259
Anhang 21: Retrospektive Beurteilung des Trainings durch die Eltern der Wartekontroll-gruppe – Häufigkeitsangaben (Prozentangaben in Klammern)
Antwortformat Fragen
nie / gar nicht
selten / kaum
manchmal / etwas
oft / deutlich
immer / stark
1 Konnten Sie die in der Elternberatung besprochenen Inhalte umsetzen? 0 (0) 1 (9) 2 (18) 7 (64) 1 (9)
2 Hat Ihnen die Elternberatung gehol-fen, Ihr Kind besser zu verstehen? 0 (0) 4 (36) 3 (28) 4 (36) 0 (0)
3 Hat Ihnen die Elternberatung gehol-fen, den Zusammenhang zwischen Ihrem Verhalten und dem Verhalten Ihres Kindes besser zu verstehen?
0 (0) 2 (18) 4 (36) 5 (46) 0 (0)
4 Hat Ihnen die Elternberatung geholfen, Ihr Erziehungsverhalten zu verbessern?
0 (0) 3 (28) 4 (36) 4 (36) 0 (0)
5 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf bekanntes Problemverhalten Ihres Kindes anzuwenden?
0 (0) 1 (9) 2 (18) 8 (73) 0 (0)
6 Waren Sie in der Lage, die Inhalte der Elternberatung nach Trainingsende auf unbekanntes Problemverhalten Ihres Kindes anzuwenden?
1 (9) 3 (27) 6 (55) 1 (9) 0 (0)
7 Hat sich das Verhalten Ihres Kindes verbessert? 0 (0) 0 (0) 4 (36) 5 (46) 2 (18)
8 Sind Sie mit den Fortschritten, die Ihr Kind gemacht hat, zufrieden? 0 (0) 0 (0) 3 (27) 3 (27) 5 (46)
9 Hat sich das Zusammenleben in der Familie verbessert? 1 (9) 1 (9) 3 (27) 4 (37) 2 (18)
10 Haben Sie sich von den Trainerinnen bzw. Trainern verstanden gefühlt? 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (18) 9 (82)
11 Haben Sie die Teilnahme am Training als hilfreich empfunden? 0 (0) 0 (0) 3 (27) 1 (9) 7 (64)
.
Eidesstattliche Erklärung 260
Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Soweit aus den im
Literaturverzeichnis angegebenen Werken Stellen im Wortlaut oder Sinn entnommen wur-
den, wurden sie als solche einzeln kenntlich gemacht.
Diese Arbeit wurde bisher nicht anderweitig zu Prüfungszwecken vorgelegt.
Bremen, 01.03.2013 Dipl.-Psych. Christine Möller