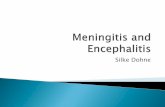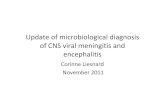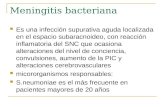Über die elektrische Leitfähigkeit von Körperflüssigkeiten...
Transcript of Über die elektrische Leitfähigkeit von Körperflüssigkeiten...
This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the Advancement of Science under a Creative Commons Attribution4.0 International License.
Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschungin Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.
Über die elektrische Leitfähigkeit
von Körperflüssigkeiten und Bakterienkulturen
V o n F . K L U T K E u n d H . W O R A T Z
Aus dem Hygiene-Institut der Stadt Lübeck (Leitung: Prof. S c h ü t z , jetzt Direktor des Hygiene-Instituts in Göttingen) und der Chem. Abt. des Drägerwerks in Lübeck
(Z. Naturforschg. 5 b, 441—442 [1950]; eingegangen am 4. Dezember 1950)
Das Prinzip der „elektrodenlosen" Leitfähigkeitsmessung (Dephimeter) wird beschrieben. Die Methode ermöglicht die Bestimmung der Leitfähigkeit auch in leicht veränderlichen Lösungen. Als Beispiele sind Versuche mit Liquor, Serum und Bakterienkulturen angefügt.
Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit bio-logischer Objekte, wie z. B. von Liquor cerebro-
spinalis, von Serum und von Bakterienkulturen ist bis-her nur in seltenen Fällen 1 ausgeführt worden. Die dazu erforderlichen platinierten Platinelektroden bil-den wegen ihrer adsorbierenden und katalytischen Eigenschaften eine Fehlerquelle von schwer abschätz-barer Bedeutung. Die Aussichten, zu reproduzier-
7O
2o
Abb. 1. Prinzip der „elektrodenlosen" Leitfähigkeitsmes-sung. Meßgefäß und Ersatzschaltung bei kapazitiver Übertragung des Meßstromes und räumlicher Trennung
von Leitungs- und Verschiebungsstrom.
baren Resultaten zu kommen, sind nun durch die Ent-wicklung eines technischen Gerätes (Dephimeter) zur Messung der Leitfähigkeit ohne Elektroden2 so weit verbessert worden, daß wir orientierende Versuche auf diesem Neuland unternehmen konnten, deren Besultate wir in folgendem vorlegen.
Die Meßmethode verwendet Wechselströme so hoher Frequenz, daß eine kapazitive Übertragung des Stromes durch die aus Isoliermantel (Glas, Keramik, Kunststoff) bestehenden Gefäßwände hindurch mög-lich wird, so daß keinerlei metallische Elektroden mit dem Meßobjekt in Berührung kommen. Das gefüllte
1 H. S c h w a n , Sedimentationsbestimmung durch elektr. Widerstandsmessung. Kolloid-Z. 111, 53 [1948],
Meßgerät ist dann einem Kondensator äquivalent, dessen Verluste allein von der Leitfähigkeit der zu messenden Flüssigkeit abhängen, wenn die Anord-nung der „Belege" so getroffen wird, daß der Ver-schiebungsstrom im wesentlichen durch das Glas, der
Abb. 2. Meßpipette.
Leitungsstrom aber durch die Flüssigkeit fließt (Abb. 1). Die Messung erfolgt nach einer zuerst von D e u b n e r angegebenen Methode, bei der die Amplitude eines Hochfrequenzgenerators mit schwa-cher Bückkopplung ein unmittelbares Maß für die Leitfähigkeit bildet. Das Meßgefäß wurde als Pipette ausgebildet, in die man die zu untersuchende Flüssig-keit hineinsaugt (Abb. 2). Der große Temperatur-koeffizient der elektrolytischen Leitfähigkeit wurde dadurch weitgehend unschädlich gemacht, daß der Ausschlag für physiologische Kochsalzlösung immer
2 F. K l u t k e , Die Messung der elektrischen Leit-fähigkeit von Flüssigkeiten ohne Elektroden. Arch. techn. Mess. V 3514 [Sept. 1950],
Unbeimpfte Bouillon
Kultur nach 4 Stdn.
Kultur nach 8 Stdn.
Kultur nach 12 Stdn.
Kultur nach 24 Stdn.
Bact. coli Stamm I Bact. coli Stamm II Bact. coli Stamm III Bact. Paratyphus B
| 0,66 0,76 0,78 0,74 0,72
0,74 0,72 0,74 0,68
0,73 0,72 0,76 0,68
0,72 0,66 0,72 0,66
Tab. 1. Leitfähigkeitsänderungen von 3 Stämmen Bact. coli und einem Stamm Paratyphus B. Leitfähigkeitswerte in % Kochsalz in Aqua dest. Zahlenangaben sind der Durchschnittswert von mindestens 3 Messungen.
auf denselben Punkt der Skala eingestellt wurde, was eine Parallelverschiebung der ganzen Eichkurve be-deutet. Mit Rücksicht darauf geben wir die Resultate auch nicht in Ohm X cm bzw. O h m - 1 c m - 1 , sondern als Konzentrationen der Kochsalzlösungen an, die dieselbe Leitfähigkeit haben wie das Untersuchungs-objekt (gleiche Temperatur vorausgesetzt). Unsere Untersuchungen beziehen sich auf Bakterienkulturen auf flüssigem Nährboden (0,5-proz. Traubenzucker-Bouillon), Serum und Liquor cerebrospinalis einer Anzahl gesunder und kranker Personen.
Tab. 1 zeigt die Leitfähigkeitsänderungen in Flüs-sigkeitskulturen dreier verschiedener Stämme Bact. coli und eines Stammes Paratyphus B.
Die Paratyphus-B-Kultur hat nach 8 Stdn. den Leitfähigkeitswert der unbeimpften Bouillon erreicht. Eine Bact.-coli-Ku\tur zeigt bei einer Messung nach 24 Stdn. ebenfalls den Ausgangswert. Die beiden anderen Bact.-coli-Stämme haben nach 24 Stdn. eine höhere Leitfähigkeit als die unbeimpfte Bouillon.
Zur Technik: Die Kulturen wurden in Kölbchen zu 50 ccm Bouillon mit 0 ,5% Traubenzuckerzusatz an-gelegt. Impfmenge 0,5 ccm einer 24-Stdn.-Bouillon-kultur.
29 Liquorproben von Patienten, die nicht an einer Erkrankung der Hirnhäute litten, ergaben einen Durchschnittswert der Leitfähigkeit, wie 0 ,83% Koch-salz in Aqua bidest., bei 22° C. Dabei betrug der höchste Wert 0,84% NaCl der niedrigste 0 ,81% NaCl.
Zahl der Fälle Diagnose
Leitfähigkeit in °/o NaCl
in H 20
1 Meningitis purulenta . . 0,73 1 Meningitis serosa . . . 0,73 1 Meningitis bei Sepsis . . 0,73 1 Meningitis und Enzephalitis 0,72 9 Meningitis tuberculosa . . 0,72—0,80 1 Meningismus bei Weilscher
Krankheit 0,80
Tab. 2. Veränderungen des Liquors bei Hirnhaut-entzündungen.
Bei Hirnhautentzündungen fanden sich Verände-rungen der Leitfähigkeit (Tab. 2).
Liquorproben von 4 Patienten mit erfolgreich be-handelter Meningitis tuberculosa hatten eine Leit-fähigkeit wie 0,82% Kochsalz. Bei 4 Wassermann-positiven Liquorproben von Paralytikern fanden sich Werte von 0,83—0,84% NaCl.
Der Durchschnittswert von 21 Seren Gesunder lag bei 0 ,65% NaCl. Mit einer Schwankungsbreite von 0,63 bis 0 ,67% NaCl. Bei einzelnen Fällen schwerer fieber-hafter Erkrankungen fanden sich Abnahmen der Leit-fähigkeit, ebenfalls bei einigen Fällen mit fort-geschrittenen bösartigen Tumoren bis zu 0,55% NaCl. Bei einem Patienten mit Lungenödem stieg die Leit-fähigkeit auf 0,74% NaCl.
Die Untersuchungen werden fortgesetzt.