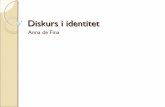SONDERDRUCK NAS-DOSSIER project 57 · project 57 Journal für Business Computing und Technologie...
Transcript of SONDERDRUCK NAS-DOSSIER project 57 · project 57 Journal für Business Computing und Technologie...
-
project 57Journal für Business Computing
und Technologie
[aus dem inhalt]
[retro] produkte & events 6
EMC auf Einkaufstour 6
[diskurs] Hammer 5.8 Beta trifft Nagel 3.1 a 17
10 Thesen zum Outsourcing 27
[infrastrukturen] SAP, Microsoft und die anderen 75
kolumne jenseits von 1984 82
[tempo] Physik und IT beim CERN 88
kolumne achim killers anderes it-lexikon 93
[exit] MS Office: XML für die Massen 94
Anmerkungen zur digitalen Spaltung 96
[dossier] NAS-Systeme: Zwischenhoch in Sicht
Die Blütezeiten des E-Business sind vorbei. Damals wurdeSpeicher in rauhen Mengen eingekauft. Jetzt konsolidiertsich der Markt für preisgünstigere NAS-Systeme – unterder Führung von Microsoft. Mit 25 OEM-Partnern will dieGates-Company ihre Servervorherrschaft auf den Speicher-markt ausdehnen. Neue Mittelstandsprogramme sollen esbringen. project 57 fasst die wichtigsten Aspekte zusam-men und weist auf die Fallstricke für Anwender hin.
Das komplette [dossier] ab Seite 37
heft 01/03november/dezember 2003€ 20,– (D, A), sfr 34,– (CH)ISSN 1612-8885
SONDERDRUCK NAS-DOSSIER
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [intro / inhalt] 3
[impressum]
project 57 – Journal für Business Computing und Technologie / sonderdruck 01/03© ZAZAmedia, München 2003. Postfach 14 06 43, 80456 München.Herausgeber und Chefredakteur: Hartmut Wiehr [hw]
(verantwortlich i. S. des Pressegesetzes)Redaktion: Rainer Graefen (Leitg.) [rg], Andreas Beuthner [ab], Achim Killer [ak],
Bernd Schöne [bs], Nicole Winkler [nw]Design und Titelbild: Hartmut WiehrLayout und Satz: Schmidt Media Design, MünchenDruck und Bindung: Isarpost Druck- und Verlagsgesellschaft, Altheim bei LandshutBezugspreise von project 57: Einzelheft € 20,– (D, A), sfr 34,– (CH).
Abonnement (6 Ausgaben pro Jahr + 6 PDF-specials) € 100,– (D, A), sfr 155,– (CH)Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste 2/2003
[Kontakt: Elisabeth Gassner, Tel. 0172/6 07 11 45]Printed in GermanyAuflage: 10.000www.zazamedia.de
Die Welt der IT-Hersteller, der Hardware- und Softwareproduzen-ten, der Serviceanbieter und Systemhäuser, ist nur scheinbar inOrdnung. Das Geschäft ist nicht komplett zusammengebrochen,doch bröckelt und bröselt es da und dort – mitunter so heftig,dass selbst die üblichen Verschlankungsprozesse nicht mehr hel-fen. Eine Besserung der Marktsituation, sprich der Aufträge undUmsätze, des Gewinns und des Wachstums, ist in Sicht. Gesehenwird sie jedoch nur von den berufsmässigen Optimisten in Stan-desorganisationen wie dem Bitkom und anderen. Indessen gehtes munter weiter mit Pleiten, Pannen, Übernahmen. Ein Mergerkann jeden erwischen, denn schiere Größe soll es in den Augenmancher Manager bringen. Das gilt nicht nur für Carly Fiorina vonHewlett-Packard so, auch bei ihrem Opfer Compaq war es nichtanders:Tandem und Digital sollten den Texanern einst helfen, denRuf eines bloßen Boxenschiebers abzulegen. Anstatt sich auf dieKernkompetenzen zu besinnen, möchten die Mergerprotagonis-ten immer noch etwas mehr. Andere befassen sich mit Outsour-cing, geben jenseits ihres engeren Geschäftsumfelds alles infremde Hände, weil die es besser können. Oder billiger. Das zügeltnicht unbedingt den Appetit der Häppchenjäger und Aufkäufer,deren Ideal neben dem Börsenkurs ein gesunder Mischkonzern àla IBM, Samsung oder Hitachi ist. Deren Vorteil besteht nicht nurin Größe, die sich in Angebotswucht und Marktdominanz um-setzt, wie es vielleicht Fiorinas Traum ist, sondern in der nicht zuunterschätzenden Fähigkeit, Verluste an der einen Verkaufsfrontmal eben durch eine ganz andere Sparte auszubügeln. Siemensmacht es hierzulande immer wieder vor. Vom Anwenderstand-punkt her müsste es deshalb nicht immer die reine Lehre von denKernkompetenzen sein. Investitionssicherheit gibt es vielleichteher im Gemischtwarenladen nach Samsungart. Unsere Rubrik[business dynamics] widmet sich dem wirtschaftlichen Hinter-grund der IT-Branche insgesamt und versucht etwas Licht in dasDunkel der Märkte, Anbieter oder Übernahmeschlachten zu brin-gen. Das trägt dann auch dazu bei, Schlagworte wie RoI (Returnon Investment), TCO (Total Cost of Ownership), Added Value oderTrusted Adviser einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Esgibt viel zu tun.
www.zazamedia.dewww.project57.de
[intro]
[auszug heft 01/03] EMC übernimmt die Kontrolle – Legato, Documentum und die Folgen 5
[dossier] Zwischenhoch in Sicht für Network Attached Storage 7
Dateispeicherung kennt viele Namen 7
Preiswerte Datenspeicherung – im Interesse der Hersteller? 11
Microsoft will mehr speichern 15
Rohstoff Festplatte 18
Speicherstrategie mit Windows Powered NAS 20
Netzwerkprotokolle und dieWartungsfolgen 24
Brauchen Datenbanken Blöcke? 26
Kleiner Eingriff – große Wirkung? 27
Hardware macht iSCSI teuer 31
NAS im Selbstbau 34
Überholungsbedürftige Backup-Konzepte 36
interview 38
[auszug heft 01/03] web jungle 41
[inhalt] Sonderdruck NAS-Dossier
-
4 [inhalt] sonderdruck 01/03 / project 57
[inhalt] project 57 heft 01/03, november/dezember 2003
[retro]
EMC übernimmt die Kontrolle – Legato, Documentum und die Folgen 6
Peoplesoft/J.D. Edwards/Oracle 9
Systems 2003: Alles beim Alten? 10
Novell: Back to Earth? 12
Toll Collect – die endlose Affäre 14
kolumne I basta! 16
[diskurs]
it-technologie Hammer 5.8 Beta trifft Nagel 3.1 a 17
[business dynamics]
interview I Wie man die IT nach Business-Grundsätzen führt 21
10 Thesen zum Outsourcing 27
[dossier]
Zwischenhoch in Sicht für Network Attached Storage 37
Dateispeicherung kennt viele Namen 37
Preiswerte Datenspeicherung – im Interesse der Hersteller? 40
Microsoft will mehr speichern 44
Rohstoff Festplatte 47
Speicherstrategie mit Windows Powered NAS 50
Netzwerkprotokolle und dieWartungsfolgen 55
Brauchen Datenbanken Blöcke? 57
Kleiner Eingriff – große Wirkung? 58
Hardware macht iSCSI teuer 60
NAS im Selbstbau 66
Überholungsbedürftige Backup-Konzepte 68
[infrastrukturen]
interview II Die Server von IBM:Steiler Weg nach oben? 70
erp-software SAP, Microsoft und die anderen 75
interview III „Größe allein reicht nicht“ 79
kolumne II jenseits von 1984 82
[tempo] feedback/quergelesen 84
wissenschaft Physik und IT beim CERN 88
Mikro- und Nanotechnik 90
web jungle 92
kolumne III achim killers anderes it-lexikon 93
[exit]
Microsoft Office System:XML für die Massen 94
Anmerkungen zur digitalen Spaltung 96
Veritas: Harte Arbeit statt Visionen 97
HP will den Unternehmen mit Darwin helfen 98
Sun kooperiert bei Prozessoren 98
agenda 98
Bestellung von Einzelheften und Jahresabonnement:siehe Anzeige Seite 42 und Antwortkarte auf der hinteren Umschlagklappe.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [retro] aus heft 01/03 5
[p57] – Einst war EMC eines der Lieblingskin-der der Börsen, mit einem konstanten Ak-tienkurs von 100 und mehr Dollar (immerwieder durch Aktiensplits anlegerfreundlichauf die Hälfte reduziert), einem sicheren Ab-satzmarkt im Highend-Storage und viel Bar-geld auf der Bank. Der Speicherspezialistgalt lange Jahre als schier unangreifbar. Dasist lange her. Schon vor dem Ende der NewEconomy, als der Absatz der überteuertenSymmetrix-Datenschränke fast über Nachtzusammenbrach, hatte diese Alleinherr-schaft über das Data Center den Futterneidauf Seiten von Hitachi Data Systems (HDS)und IBM angestachelt und damit einenTechnologie- und Preiskrieg entfesselt. DieManagementetage von EMC hatte aller-dings durchaus ein Gespür für die veränder-ten Marktbedingungen: Mit dem Einkaufvon Data General und deren Midrange-Spei-chersystem „Clariion“ hatte man sich recht-zeitig einen Zugang zu neuen Märkten er-worben. Kurz danach erfolgte eine breit an-gelegte Kooperation mit Dell – vor allem beiVertrieb und Produktion der Clariionsyste-me. Und: EMC kündigte immer wieder an,Marktführer bei Storage-Software werdenzu wollen, nachdem mit den großen Hard-warekisten nicht mehr so viel zu verdienenwar. Die entsprechenden Marktzahlen konn-te man zunächst nur durch einige Tricks vor-legen: Sämtliche Betriebssysteme, Firmware,Tools oder Management-Software, die größ-tenteils schon immer zusammen mit demHauptprodukt Storage-Hardware verkauftworden waren, wurden nun herausgerech-net und ihre Verkaufszahlen als Beweis derneuen Strategie präsentiert.Inzwischen hat sich EMC fleißig Marktantei-le hinzugekauft und zweimal sogar größereAkquisitionen vorgenommen – mit Legatowurde nach längerem Branchengeflüsterund monatelangem Hin und Her ein Anbie-ter von Backup- und E-Mail-Archivierungs-software übernommen, der zwar seine bes-ten Zeiten hinter sich hat, aber den EMC-Umsatz bereichern soll. Die meisten Szene-beobachter waren sich zumindest einig,dass das „irgendwie zusammenpasse“. Mitdem Erwerb von Documentum, einem derMarktführer in der in den vergangenen Jah-ren eher vor sich hin schlafenden undmanchmal schon totgesagten Nische vonDokumenten- und Knowledge-Manage-ment, sahen die öffentlichen Reaktionenschon anders aus:Während die einen nichts
als eine Konsolidierung auf dem DMS-Markterkennen mochten und dabei elegant dieFrage unbeantwortet ließen, was ein Storage-anbieter wie EMC dort eigentlich verlorenhabe, waren andere Auguren schlicht mitSprachlosigkeit geschlagen oder ergingensich in Rätseln.Einige meinten, EMC wolle seinen Kunden„ergänzend“ zur Storage-Hardware nunauch Software und Dienstleistungen egalwelcher Couleur anbieten, andere dachtenmehr an Bundles aus Hard- und Software.Und wieder andere spekulierten darüber,warum sich EMC gerade Documentum undnicht dessen ärgsten Konkurrenten Filenetausgesucht habe. Einen konkreten Bezugzwischen gekauftem Portfolio und neuemHerrn vermochte jedenfalls kaum jemand zuentdecken.
Die wahre Strategie hinter der Documentum-ÜbernahmeGanz anders die Realität: Hinter den Kulissen– und hier haben einige der Konkurrentenund der berufsmäßigen Beobachterzunftden Marktführer aus Hopkinson/Massachu-setts wohl doch ein bisschen unterschätzt –bereitete man sich offenbar minutiös undzielgerichtet auf die veränderte Strategievor. Mit der Vorstellung des CAS-Speicher-systems Centera wurde die Grundlage ge-legt. Und mit der Übernahme von Legatound Documentum liegt die neue Ausrich-tung nun fest: Content Adressed Storage(CAS) auf der Basis permanent wucherndergesetzlicher Bestimmungen zum strategi-schen Geschäftsfeld ausbauen.Um diese Strategie nachvollziehen zu kön-nen, ist ein kurzer Blick zurück sinnvoll. DerUntergang so großer US-Konzerne wie En-ron,Worldcom, Freddie Mac und einiger an-derer, der tiefe Einschnitte nicht nur für dieamerikanische Konjunktur produzierte, sorgtimmer noch für Nachbeben. Während dieRegierung in Washington inzwischen demMotto „Kontrolle der Wirtschaft ist besser alsVertrauen“ Geltung verschaffen will undeine Reihe entsprechender Gesetzesmaß-nahmen von der Verschärfung der Aufbe-wahrungspflichten für Geschäftsdokumenteeinschließlich des E-Mail-Verkehrs bis hinzur stärkeren Überwachung des Aktienhan-dels in Gang setzte, hält man sich in Europanoch mehr zurück und diskutiert erst einmalden Aspekt der staatlichen Überwachungdes Einzelnen. Egal wie die Debatte ausgeht
– die Großen der IT-Industrie ziehen schonjetzt weltweit ihre Konsequenzen, kaufensich in das aufstrebende Geschäftsfeld derlängerfristigen Datenaufbewahrung einoder schwören ihre Kunden zunächst auf„Information Lifecycle Management“ (ILM)ein. Die Präsentationen der Hersteller in Sa-chen Storage, Software oder Archivierungfallen entsprechend eintönig aus – zunächstgeht es allen erst einmal darum, Sensibilitätfür eine Problemlage zu schaffen, die man-chen Anwendern hierzulande so noch garnicht bewusst sein dürfte. Der Verkauf derhauseigenen Produkte – da scheinen sichalle Anbieter einig zu sein – läuft dann in ei-nem zweiten Schritt praktisch von alleine. Sozumindest die marketinggetriebene Theorie.Die Aktivitäten von EMC und anderen zeu-gen von dem Ernst, mit dem künftiger Um-satz auf diesem Geschäftsfeld generiertwerden soll. Es geht um viel: So berichtet die„Süddeutsche Zeitung“ vom 24. Oktober2003 unter der Überschrift „Kuckucksei ausWashington“: „Während die Handelsstreitig-keiten beiderseits des Atlantiks für Schlag-zeilen sorgen, ist ein anderer, doch mindes-tens ebenso folgenreicher Zwist nur wenigbeachtet worden: Seit Monaten liegen sichAmerikaner und Europäer in der Frage derBeaufsichtigung der Wirtschaftsprüfer inden Haaren.“ Kontrolle wird jenseits des At-lantiks groß geschrieben und zwar so weit,dass der US-Kongress Einsicht in interne Fir-menunterlagen nehmen darf. Grundlage istdas Sarbanes-Oxley-Gesetz, das Haftstrafenvon 20 Jahren für „Gauner in Chefetagen“
EMC übernimmt die Kontrolle – Legato, Documentum und die Folgen
+
+
=
= ?+ ???
-
6 aus heft 01/03 [retro] sonderdruck 01/03 / project 57
vorsieht. Der US-Staat hat als Oberaufseherdes wirtschaftlichen Treibens Konsequenzendaraus gezogen, dass Enron und andere bei-nahe die gesamte Volkswirtschaft zum Ein-sturz gebracht hätten. [project 57 wird sichin einer der nächsten Ausgaben intensivermit der US-Ökonomie beschäftigen; dasDossier in heft 02/04, das Mitte Januar 2004erscheint, widmet sich zudem dem ThemaInformation Lifecycle Management in allenseinen Facetten.]Die neuen Aufbewahrungspflichten ver-schärfen die Anforderungen an die IT-Infra-struktur: Microsofts Exchange-Server unddie E-Mail-Archivierung generell warenschon seit einer Weile als Schwachstelle inder Kommunikation entdeckt worden, undfindige Anbieter wie KVS waren sehr schnellin dieser Nische gewachsen. Zunächst wares darum gegangen, Attachments auszula-gern, um den Server zu entlasten. Dann be-merkte man, dass mit E-Mails unterneh-menskritische Daten unter der Obhut vonAnwendern mit teilweise eigenen Interes-sen abgelegt wurden oder im Cyberspaceverschwanden. Und ein wenig später woll-ten zumindest die Aufsichtsbehörden inAmerika in Streitfällen die gesamte Ge-schäftskorrespondenz inclusive aller E-Mailseinsehen. Mit drakonischen Strafzahlungenwerden seitdem nicht nur Börsenbroker undFinanzinstitute belegt, die diese Nachweis-pflicht nicht erfüllen können.EMC hat einen weiteren Grund, sich mit Do-cumentum eine Firma zuzulegen, mit der esauf den ersten Blick nur wenige Berührungs-punkte gibt. Joe Tucci, President und CEOvon EMC, in einem offenen Brief:„Unstruktu-rierte Daten – sämtliche Daten vom elektro-nischen Dokument wie Webseiten oder Ta-bellen bis zum medizinischen Datensatzoder Audio/Video-Content – bilden heutzu-tage den immensen Hauptanteil von Unter-nehmensdaten. Der Inhalt wird ständig um-fangreicher und dichter, und der Bedarf anneuen Funktionen für Speicher- und Infor-mationsmanagement wächst permanent.“Allein der Markt für das Speichern und dielangfristige Archivierung von elektronischenDokumenten im Gesundheitssektor ver-spricht mit den Auswirkungen des HIPAA(Health Insurance Portability and Account-ability Act) einen kontinuierlichen Absatzvon automatisierten Speicherlösungen. Da-bei kommen EMC und anderen Anbieterndie komplexen Vorschriften zur Ablage me-dizinischer Dokumente zu Hilfe. [Details in: J.Bogen, Accelerating HIPAA Compliance withEMC Healthcare Solutions; Quelle siehe [in-fos] Nr. [3].]
Neues El Dorado für alte KämpenKein Wunder eigentlich, dass Kapitalanlegerund größere Anbieter schon seit einiger Zeitund mehr klammheimlich ihre Fühler in die-se neue Sphäre von Archivierung ausge-streckt haben. Der Mailarchivierungsspezia-list XVault wurde bereits im April 2000 vonOTG übernommen, OTG 2002 dann von Le-gato und Legato in diesem Sommer schließ-lich von EMC. Die EMailXtender-Software(Ex-XVault, Ex-OTG, Ex-Legato) ist in Amerikain Börsenkreisen ein Renner und passt zumFestplattenspeicher Centera von EMC, dersehr große Datenmengen objektorientiertablegt, im Onlinezugriff hält und die Anwen-der von der Konvertierung archivierter Datenbefreit. Das ist nicht ganz billig für den An-wender, die Kombination von Soft- undHardware beflügelt aber schon jetzt die Um-sätze von EMC.EMC könnte zum Player Nummer eins beiILM und E-Mail-Archivierung werden. Dennmit KVS besitzt man bereits einen Partner,der auf die E-Mail-Archivierung unter Micro-softs Exchange-Server fokussiert ist. Undauch mit Hummingbird wird eng kooperiert:Hier hat man sich darauf spezialisiert, überdie revisionssichere Archivierung von Datenein Dokumentenmanagement zu legen, dasphysische und digitale Informationen in Re-cords aufzeichnet. EMC konzentriert sichalso unter Einsatz einiger Ressourcen auf ei-nen Markt, den andere schon vorher ent-deckt hatten. Konkurrent Storagetek ver-sucht derzeit in einer Art Abwehrkampf, dieBezeichnung Information Lifecycle Manage-ment (ILM) urheberrechtlich schützen zu las-sen, da man sich selbst als Erfinder von ILMsieht. Mehr als ein Marketingschachzugdürfte nicht daraus werden: Hier geht esschließlich um reale Marktanteile, und dawerden Claims nicht nur symbolisch abge-steckt. Storagetek und auch IBM-VerfolgerHewlett-Packard, der dringend neue Ge-schäftsfelder braucht, haben ein sehr prakti-sches Problem: Beide Firmen vertreiben Le-gatos EMailXtender-Software in Kombina-tion mit eigenen Hardwareprodukten undbeide suchen nach passenden Übernahme-kandidaten, weil sie damit rechnen müssen,dass EMC irgendwann den Hahn zudreht.HP hat inzwischen angekündigt, mit Preciseeinen Archivierungsspezialisten einzukau-fen. Die Kunden sind schon jetzt verunsi-chert. Noch bietet sich KVS als eigener Über-nahmekandidat an, und die Telefone bei derbritischen Firma dürften bereits heiß laufen.Schnell zuschlagen lautet allgemein dieDevise. Vorgemacht hat es der kanadischeAnbieter für Dokumenten- und Knowledge-Management Open Text, der sich mit Gauss
Interprise und mit Ixos zwei Content- undArchivierungsspezialisten einverleibte. Auchin diesem Fall geht es um mehr als um eineweitere Konsolidierung auf dem Markt fürDokumentenmanagement, der nach einerBlütezeit vor ein paar Jahren durch Absatz-probleme, Firmenzusammenbrüche undMerger ohne Ende gekennzeichnet ist. Wiebereits ein Blick auf die Webseite von OpenText zeigt, ist man sich der Auswirkungendes Sarbanes-Oxley-Gesetzes sehr bewusst.Und auch die Presseinformation zur Über-nahme von Ixos gibt entsprechende Hin-weise:„Die Kombination unserer ergänzen-den Technologien erlaubt uns, Kunden um-fassende Enterprise-Content-Management-Lösungen aus einer Hand anzubieten, dieden kompletten Lebenszyklus von Informa-tionen abdecken – von der Entstehung biszur Archivierung.“ Eine Kontrolle der Unter-nehmensprozesse, die auch vor Gericht Be-stand hat, werde besonders für börsenorien-tierte Unternehmen immer wichtiger, da Ge-setze und andere Regulatorien eine lücken-lose Rückverfolgung verlangten.Nichts wäre also schöner, wenn sich im ame-rikanisch-europäischen Streit über Stan-dards bei der Kontrolle von Wirtschaftsprü-fern ein Ende der vergleichsweise lahmenÜberprüfungspraxis auf dem alten Konti-nent abzeichnen würde. Sonst ist es ja ei-gentlich immer üblich, dass Unternehmenden Abbau von Vorschriften, Gesetzen undso weiter fordern. Im konkreten Fall des neu-en Marktes für ILM- und E-Mail-Archivie-rungsprodukte verhält es sich umgekehrt: jemehr Vorschriften, desto besser. Für das Ge-schäft der Speicherspezialisten.
[infos][1] EMC baut die Softwareposition aus; in:project 57 special no. 02/2003, 23. Juli 2003,Seite 28.[2] R. Graefen/H. Wiehr, State of Storage,Kapitel 3: E-Mail-Archivierung: die offeneFlanke im Unternehmen; Download mög-lich auf der Website www.zazamedia.de.[3] EMC veröffentlicht auf seiner Webseiteeine Reihe von White Papers und Research-Ergebnissen renommierter Analystengrup-pen, die sich intensiv mit der Firmenstrate-gie, dem ILM-Markt usw. beschäftigen:http://germany.emc.com/news/white_papers/index.jsp.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / kleine historie der netzwerkspeicherung 7
Novell und 3Com machten sie populär, dieFile- and Printservices – auf gut Deutschdie Datei- und Druckdienste. Auf den er-sten Blick schien es umständlich, ein Netzwerkmit einem kostspieligen zentralen Server auf In-tel-Basis aufzubauen, um dann dort Dateien ab-zulegen und bei Bedarf auch auszudrucken.Wozu der Aufwand, werden sich viele zu Beginngedacht haben, das kann man doch einfacherauch mit seinem Arbeitsplatz-PC erledigen.
Der Fortschritt eines lokalen Netzwerks(LAN) leuchtete jedoch vielen Geschäftsfüh-rern in kleineren und mittelständischen Unter-nehmen ein, die sich keinen zentralen Mainfra-me oder Unix-Server leisten konnten und end-lich eine Möglichkeit an die Hand bekamen,den lästigen Austausch von Disketten einstel-len zu können. Keine unlesbaren oder defektenDisketten mehr und auch keine Frage mehrdanach, ob man denn nun die letzte Version inder Hand hielte. Die neue Form des Ressour-
cen-Sharings löste viele Probleme in denUnternehmen: Von nun an konnte jeder mitden aktuellsten Daten arbeiten, wichtige Ge-schäftsinformationen ließen sich durch Pass-worte schützen, ein zentrales Bandlaufwerksorgte für die tägliche Datensicherung undauch die Geschäftspost schaute durch den ge-meinschaftlich genutzten Laserdrucker besserund vor allem einheitlicher aus. Dass inzwi-schen mehr als zwanzig Jahre vergangen sind,mag man kaum glauben, angesichts dessen,dass immer noch über dieselben Probleme ge-redet wird – selbstverständlich auf höheremNiveau.
Dateisysteme auf Netzwerkproto-kolle umsetzen
Der gemeinsamen Dateibenutzung bezie-hungsweise dem Filesharing ist vorausge-setzt, dass jedes Serverbetriebssystem auf dem
Zwischenhoch in Sicht für Network Attached Storage
Die Speicherhersteller erinnern sich nur zu gerne an die Blütezeit des E-Business. Das Daten-wachstum überschlug sich, und Speicher wurde in rauen Mengen eingekauft. Der Abkühlung desMarktes folgt nun die scheinbare Normalität – allerdings unter neuer Führung: der von Micro-soft. Durch den Windows Storage Server 2003 wird Microsoft, das schwarze Schaf der IT-Indus-trie, zum populären Bindeglied, das Anwender- und Herstellerinteressen vereint. Kein Speicher-hersteller, der sich der aufkeimenden Hoffnung entziehen möchte, wieder an alte Verkaufsrekor-de anzuknüpfen. Das passt ideal zu den Mittelstandsprogrammen der Hersteller. In diesem Dos-sier haben wir die wichtigsten Aspekte zusammengefasst, wie es mit der „Speicherei“ in dennächsten Jahren weitergeht und in welche Fallstricke Unternehmen sich besser nicht verheddern.
Von Rainer Graefen
[kleine historie der netzwerkspeicherung]
Dateispeicherung kennt viele NamenDer Weg war lang vom ersten Netzwerkprotokoll bis zum NAS-Gateway. Doch jetzt ist der Ent-wicklungspfad für die unternehmenseigene Datenspeicherung vorgezeichnet. Wer viele Da-teien speichern muss und eine große Datenbank betreibt, kommt an der NAS/SAN-Fusion nichtvorbei. Im Folgenden eine kleine Historie der Datenspeicherung.
-
lokalen Speichersubsystem sein eigenes Datei-system anlegt. Der Client-Rechner weiß alsonicht, ob auf dem Server FAT, FAT32, NTFS, UFS,VFS, ReiserFS oder irgendein anderes Dateisy-stem installiert ist. Netzwerkprotokolle müs-sen deshalb unabhängig von Hardware, Be-triebssystem, Netzwerk und Transportproto-koll arbeiten können.
Novell bewältigte die Aufgabe, Datei- undDruckdaten über Netzwerke zu schicken, vieleJahre lang mit dem IPX/SPX-Protokoll. Bei Sunentwickelten einige Programmierer im Hinter-stübchen das NFS-Protokoll (Network File Sha-ring) und stellten es 1984 der Öffentlichkeit vor.Ebenfalls in jenem Jahr publizierte IBM dieGründzüge von SMB, dem Server MessageBlock, jenem Protokoll, das später in OS/2 undallen Microsoft-Betriebssystemen eingesetztwurde. SMB heißt, seitdem es zum ersten Malin Windows for Workgroups eingesetzt wurde,CIFS (Common Internet File Sharing).
Jeder Windows- und Unix-Rechner ist auf-grund dieser Historie fähig, als Server und alsClient zu arbeiten, also Daten bei anderenRechnern abzurufen und auch entsprechendeAnfragen zu beantworten. Während NFS mitzwei Eingaben auf der Kommandozeile akti-viert wird, also einen erfahrenen Anwender be-nötigt, kann CIFS per Kontextmenü Ordneroder gleich die gesamte Festplatte freigeben.Eine Hand unter dem entsprechenden Objektsignalisiert, dass CIFS aktiv ist. NFS und CIFSsind fähig, aus den lokalen Dateisystemen allerRechner ein verteiltes Dateisystem zu machen.
IPX/SPX hat nur noch in der Novell-Welteine Bedeutung. Wer über Netzwerkprotokolleredet, meint fast immer NFS und CIFS. DamitUnix- und Windows-Rechner fähig sind, gegen-seitig Dateien auszutauschen, müssen beideSeiten das Protokoll der anderen Seite verste-hen. Unix benutzt hierzu Samba, eine nichtvollständige Variante von CIFS, und Windows2003 bietet Services for NFS an. Beide Imple-mentierungen sind weniger leistungsfähig alsdas Original. Grundsätzlich betrachtet hapertees in früheren Netzzeiten erheblich mit der Lei-stungsfähigkeit der Netzwerkprotokolle. Dasist verständlich, da vor dem Dateizugriff Be-nutzer zu identifizieren oder Zugriffsrechte ab-zuklären sind und auch jedes Mal zu überprü-fen ist, ob die angeforderte Datei nicht von je-mand anderem benutzt wird. Zudem warendie Netzwerkprotokolle damals noch als An-wendungsprogramme geschrieben. Der Zu-griff über ein langsames Zehn-Megabit-Netz-werk, die Kommunikation zwischen Netzwerk-
protokoll und Betriebssystem mussten infol-gedessen wesentlich langsamer sein als ein lo-kaler Festplattenzugriff über einen schnellenFestplattencontroller.
Hardware hilft
Die geringe Performance des bis dato unver-zichtbaren Netzwerk-Dateisystem führte1987 zur Gründung der Firma Auspex. Dort hat-te man erkannt, dass die Leistungsschwächetypischer NFS-Implementierungen auf der Ab-arbeitung aller Anfragen durch die Host-CPUberuhte. Auspex präsentierte als erstes Unter-nehmen eine spezialisierte Box, die die Bereit-stellung des Dateidienstes auf mehrere Pro-zessorschultern verteilte. Damit waren die er-sten Systeme für Network Attached Storage(NAS) geboren. Die Host-CPU war nur noch fürdas Betriebssystem zuständig, ein Netzwerk-und ein Speicherprozessor arbeiteten sichgegenseitig zu und beschleunigten die Datei-zugriffe rasant.
1992 betrat Network Appliance (Netapp)den Markt. Wichtige Geschäftsgrundlage wardie Entscheidung, auf standardisierte Hard-ware zu setzen und das Unix-Betriebssystemund -Dateisystem so weit als möglich abzu-specken. Ondat und WAFL (Write AnywhereFile Language) waren das Ergebnis dieser An-strengungen, das zwar im Laufe der Jahre andie veränderten Bedingungen angepasst wur-de, aber immer noch die Grundlage aller Net-app-Filer bildet. Die Netzwerkprotokolle arbei-teten nicht länger als Anwendungen, sondernwurden in den Ondat-Kernel integriert. Als er-stes Unternehmen bewies Netapp, dass manmit Netzwerkprotokollen schneller auf Da-teien zugreifen kann als wenn sie von der lokalinstallierten Festplatte gelesen werden. Wäh-rend Auspex mit seinem Konzept gescheitertist (Liquidation im Jahr 2003), brachte es Ne-tapp zur fast kontinuierlichen Marktführer-schaft, in der sich die Firma nur ab und zu mitEMC abwechseln musste.
Der Erfolg von Netapp hat viele Nachahmergefunden. Eine Zeitlang war es Mode, um einenkompakten Linuxkernel herum einen Dateiser-ver mit kostengünstigen ATA-Festplatten aus-zustatten. Linux unterstützt von Haus aus NFSund kann mittels Samba CIFS-ähnliche Diensteanbieten. Die NAS-Appliance war geboren, eininzwischen eher abwertend gemeinter Begrifffür preiswerte, leistungsschwache Dateiservermit geringer Verfügbarkeit. Das lässt sich ver-bessern, indem man Server und Speicher wie-
8 nas / kleine historie der netzwerkspeicherung [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
NAS-ApplianceMit NAS-Appliance werdenkompakte Boxen bezeichnet,die Server-Hardware, NAS-Be-triebssystem und Speicherkapa-zität bis zu zwei Terabyte ent-halten. Die Systeme sind weit-gehend vorkonfiguriert und fürden schnellen Einsatz vorberei-tet.
-
Nichts leichter als eine NAS-Speicherlösung für File & PrintSie sind auf der Suche nach einer Speicher-lösung, die den gesamten Firmenbereichabdecken soll, von Arbeitsgruppen bis zuZweigstellen? Sie soll verschiedene Dateiproto-kolle unterstützen und eine einfache Admini-stration ermöglichen? Und unter Budgetbe-schränkungen müssen Sie Kosteneffizienzwährend des gesamten Lebenszyklus erreichen,angefangen von den Beschaffungs- bis hin zuden Betriebskosten?
In den folgenden Situationen bietet sich eineNAS-Installation als optimale Lösung an:
• Schnelle und problemlose Bereitstellung von gemeinsam genutztem Speicher und Printserver.
• Eine einfachere Verwaltung und SicherungIhrer Daten.
• Konsolidierung von wenig genutzem, direktangeschlossenem Speicher aus verschiede-nen Standorten.
• Eine universelle Speicherlösung fürverschiedenste Betriebssysteme in ihrer IT-Umgebung.
• Wenn Sie eine plattenbasierte Daten-sicherung als vorläufige oder alternativeLösung zur Bandsicherung einsetzenmöchten.
HP StorageWorks NAS 2000s
Hoch-performantes NAS-System auf ProLiant DL380 G3Basis mit integrierter „Remote Management“ Karte, diedas Management des NAS-Systems unabhängig vomZustand (Power: ON/OFF) erlaubt.
Das vorinstallierte Microsoft® Windows® Storage Server2003 bietet Ihnen hervorragende Performance, ein-fache Speicherverwaltung und unterstützt Print Services.
Skalierbar von 587 GB bis 27 TB mit HP SCSI-Festplat-ten zur einfachen Datenmigration.
Weitere Informationen überdie Vorteile einer Migrationauf NAS-Speicher finden Sie auf der Webseite HP Easy As Nas www.hp.com/eur/easyasnas.
HP NAS 2000s gibt es schon ab
7.314,– € excl. MwSt. (8.484,– € incl. MwSt.).
-
10 nas / kleine historie der netzwerkspeicherung [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
der trennt. Dann kann der Server zu einemhochverfügbaren Cluster erweitert werdenund die Dateien auf dem Speichersubsystemkönnen mittels Hardware-Raid-Funktionenund Contoller-basierender Spiegelung ge-schützt werden. Diese häufig NAS-Server ge-nannten Systeme arbeiten mit mehreren Pro-zessoren und sind damit in der Lage, Hunder-ten von Anwendern über das Netzwerk ein Da-teisystem zur Verfügung zu stellen.
Erst mit Windows 2000 und dem Server Ap-pliance Kit mischte sich Microsoft direkt in dasGeschäft der NAS-Hersteller ein. Man verfügteja schließlich über ein Allzweck-Betriebssy-stem und über CIFS, so dass der Aufbau einesDateiservers ohne größere Umstände möglichwar.Verglichen mit einem NAS-Server musstenAnwender allerdings viel Aufwand betreiben,um den Dateiserver zu optimieren. Mit demWindows Storage Server 2003 bekommenNAS-Hersteller jetzt ein Produkt an die Hand,das zum einen auf höhere Geschwindigkeitenbei den Netzwerkprotokollen getrimmt wurdeund das jeder Hersteller durch eine geeigneteTreiberauswahl und Vorkonfiguration auf seineHardware zuschneidern kann. Kurz, es hat sicheiniges getan auf Windows-Seite.
Nicht das Produkt, die Produkt-palette wird zum Erfolgsfaktor
Die Entwicklung eigener Speichernetze mitFibre-Channel-Switch-Technik hat einigeHersteller von NAS-Appliances in eine Sinnkri-se, der Wettbewerb untereinander sogar in eine
Existenzkrise getrieben. Obwohl Quantumnach eigenen Aussagen Marktführer (gemes-sen an den verkauften Stückzahlen) war, wurdedas NAS-Geschäft in eine eigene Firma ausge-lagert, die heute kaum mehr wahrnehmbar ist.Festplattenhersteller Maxtor und ganz kurzeZeit auch Seagate versuchten ihr Glück undmussten einsehen, dass NAS mehr ist als nureine Ansammlung von Festplatten. Diese NAS-Komponente sorgt zwar für einen erheblichenUmsatzanteil, der Nutzwert liegt allerdings al-lein in dem effizienten Betriebssystem, demNAS-Header, und der richtigen Integration indas Unternehmensnetz. NAS-Hersteller, die kei-ne umfassende Produktpalette, Support- undIntegrationsdienste anbieten können (siehedas Kapitel zum Windows Storage Server), ha-ben deshalb auf Dauer schlechte Karten.
Der Wert einer umfangreichen NAS-Pro-duktpalette wird vor allem bei größeren Unter-nehmen deutlich. Aus der Sicht einer Enterpri-se-IT macht es keinen Sinn, NAS-Appliancesanzuwenden und damit die Speicherkapazitätim Unternehmen zu verteilen. Teilweise ist de-ren Erweiterung entweder gar nicht vorgese-hen oder wenn doch, handelt man sich alleProbleme ein, wie man sie auch bei einem nor-malen Allzweckserver hat. Ist erst einmal dieSkalierfähigkeit des Systems bei der Perfor-mance oder bei der Speicherkapazität am An-schlag, müssen komplette Komponenten odergleich das ganze System ausgewechselt wer-den. Ein weiterer Aspekt ist, dass viele Daten-bankhersteller zwar einen Betrieb über NFSunterstützen, Microsoft aber explizit für MSSQL und den Exchange-Server keinen CIFS-Sup-port gewährt. Das heißt, der Datenbankserverbraucht entweder eine lokale Festplatte oderein Speichernetz. Gerne wird auch vergessen,dass moderne NAS-Systeme mit einigen Hun-dert Gigabyte Speicherkapazität ausgestattetsind. Diese Datenmengen lassen sich nichtüber das Netzwerk sichern (das war mit einGrund für die Erfindung des SpeichernetzesSAN/Storage Area Network) und erzwingendeshalb ein lokales Backup. Aufgrund der Ad-ministrationskosten sollte man von diesemBackup-Konzept jedoch die Finger lassen.
Die Auftrennung der leistungsstärkerenNAS-Systeme in Server und Speicher zeigt ei-nen Ausweg aus dem Dilemma von unzurei-chender Skalierbarkeit des Speichers und de-zentralem Speichermanagement. Stattet manden Server mit einem FC-Controller aus, kann erdirekt oder über einen Fabric-Switch an ein FC-Speichersystem angeschlossen werden und die
0
20
40
60
80
100
Mar
ktan
teile
(%)
2000
90%
8%
2001
80%
18%
2002
59%
38%
2003 Jahr
56%
42%
Netapp, EMC, LinuxMicrosoft WPN (Windows Powered NAS)
Quelle: Gartner Group
Microsoft als Hersteller eines proprietären Dateiservers ist auf dem besten Weg, zum Industrie-standard zu werden. Das Jahr 2004 wird zeigen, ob der Hersteller seinen Höhenflug fortsetzt.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / kleine marktanalyse 11
dort vorhandene und leicht erweiterbare Spei-cherkapazität nutzen. Das gesamte Storage-Management erfolgt zentral im Speichernetz.
Die Konvergenz von NAS und SAN oder dieNAS/SAN-Fusion ist für große Datenmengenunumgänglich. Vom Standpunkt des Anwen-ders aus ist es sicherlich zu bedauern, dassAuspex mit seinem Konzept gescheitert ist.Die letzte Großtat des Unternehmens war es,mit dem Produkt NSc3000 einen Storage Con-troller, häufig auch als NAS-Gateway tituliert,in die Welt zu setzen, der für alle wichtigen En-terprise-Speichersysteme von EMC, Hitachi
Data Systems (HDS), Hewlett-Packard und LSILogic zertifiziert war. Aber das ist Geschichte.Aktuell ist es leider so, dass alle Hersteller, dieNAS-Gateways mit einem vorkonfiguriertenWindows Storage Server 2003 anbieten, nurdie Treiber für die eigene Hardware mitbrin-gen. Ein Anschluss von Fremdsystemen wärewahrscheinlich möglich, aber die Hersteller ge-währen derzeit nur Support für die eigeneHardware. Und da es für alle gilt, einen lukrati-ven Markt zu erobern, wird das auf absehbareZeit auch so bleiben. Interoperabilität scheintauch in diesem Fall ein Fremdwort zu bleiben.
Beim NAS-Gateway oder demNAS-Server kauft der Anwendernur die NAS-Funktion, die häu-fig auch als NAS-Header be-zeichnet wird. Die Speicherkap-zität „leiht“ sich das System voneinem externen Raid-Systemmit Fibre-Channel-Schnittstelle.
[kleine marktanalyse]
Preiswerte Datenspeicherung – im Interesse der Hersteller?Die Festplattenpreise verfallen immer mehr, die Kosten für das Speichermanagement dagegensteigen exorbitant. Das jedenfalls behaupten alle Marktanalysten fast in den gleichen Worten.Sie rechnen vor, dass 80 Prozent der Speicherinvestitionen in das Management der immer wei-ter wachsenden Datenbestände fließen, die restlichen 20 Prozent in Hardware-Erweiterungen.Soviel Einigkeit unter den Fachleuten muss stutzig machen. Ob das ermittelte Verhältnis zwi-schen Investitionen in reines Eisen und Verwaltungssoftware so stimmt, wird von einer Exper-tenminderheit angezweifelt. Dass Storage-Management allerdings immer wichtiger und auf-wändiger wird, lässt sich wohl kaum bestreiten. Das haben auch die Hersteller von NAS-Equip-ment bemerkt und konkurrieren nun nicht mehr länger allein darum, Speicher preiswert undschnell ins Netzwerk zu bringen, sondern ebenso darum, den Kunden ihre mehr oder wenigerproprietären Verwaltungsfunktionen schmackhaft zu machen. Mit dem Windows Storage Ser-ver 2003 von Microsoft erreicht der Konkurrenzkampf indes eine neue Dimension: Schon mitder Vorversion hat sich die Gates-Company fast die Marktdominanz erstritten.
Network Attached Storage, auch kurz NASgenannt, heißt die Produktgruppe, mitder ein Teil der Storage-Industrie die An-wenderunternehmen von der kosten- und ver-waltungstechnischen Last lokaler Speichersys-teme befreien will. Gelungen ist das bislangnicht, auch wenn NAS-Systeme heute 50 Tera-byte große Datensammlungen speichern kön-nen, sich leicht in gewachsene Netzwerkstruk-turen integrieren lassen und für Unix- und Win-dows-Umgebungen gleichermaßen brauchbarsind. Bei den Anwendern herrscht dennochvorerst Skepsis, nicht allein auf Grund der In-vestitionsengpässe. Viele bezweifeln, dass dieim lokalen Netzwerk verteilten Speicher à la
NAS die richtige Lösung ihrer Speicherproble-me sind. Schließlich wurde ihnen jahrelangvon smarten Produktmanagern erzählt, dassnur die Zentralisierung in einem Speichernetz(SAN) auf Fibre-Channel-Basis ihr Manage-mentproblem lösen könnte. Daran ändertauch die berechnende Umbenennung desLANs in IP-SAN nichts.
Und ob LAN oder IP-SAN, ohne die Aufrü-stung auf Breitband-Netzwerke mit Ein- oderZehn-Gigabit-Geschwindigkeiten bleibt auchweiterhin das Problem der Überlastung desproduktiven Netzwerks durch die Datensiche-rungsprozesse bestehen. Das löst sich nichteinfach durch die Anhäufung von immer mehr
-
12 nas / kleine marktanalyse [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
Speicherkapazität auf, wie manche Herstellerden Anwendern glaubhaft machen wollen. In-zwischen haben die NAS-Hersteller die ange-sprochene Problematik mitbekommen, auchwenn ihre Marketingabteilungen es nicht las-sen können, unverdrossen mit relativ billigemSpeicherplatz zu werben. Nicht zu übersehenist auf der anderen Seite, dass vor allem diegrößeren Hersteller systematisch ihre Profes-sional Services für NAS ausbauen – etwasmehr darf es schon sein. Zugleich wird derFunktionsumfang von NAS erweitert, zum Bei-spiel durch relativ preisgünstige passende Zu-satzsoftware, die eine bessere Verfügbarkeitder NAS-Daten sicherstellen soll.
Besseres Storage-Managementerreicht NAS-Systeme
Höhere Verfügbarkeit war bei den preiswer-ten NAS-Systemen bislang keine großesThema. Im Enterprise ging es zu Beginn auchnicht darum. Wichtig war zunächst die schnel-lere Datenspeicherung über das Netzwerkmittels Netzwerkprotokollen wie NFS undCIFS. Diese Aufgabe hat Network Appliance(Netapp) am Besten bewältigt, gleichzeitig ge-lang es dem Anbieter, seine Filer innovativ aufden neuesten Stand der Anwenderanforderun-gen zu bringen. So können heute nicht nur Da-teien gespeichert, sondern auch Datenbankenauf den Netapp-Filern betrieben werden. Zu-sätzlich hat Netapp Lösungen für die Backup-Problematik mit- und weiterentwickelt. DasNDMP-Protokoll (Network Data ManagementProtocol) hat zwar seine Eigenheiten, kopiertallerdings große Datenmengen auf Blocklevelsehr schnell auf Bandlaufwerke. Und mit insBetriebssystem integrierter Snapshot- undMirror-Technik kann der Hersteller Abbilder desDateisystems „einfrieren“ und diese bei Bedarfwiederherstellen. Das hat zu interessanten Va-rianten für das Disaster Recovery geführt:Selbst wenn der Filer inclusive des primärenSpeichersystems ausfallen würde, wäre esmachbar, dass über eine iSCSI-Verbindung (sie-he auch das Kapitel „iSCSI: weltumspannendesSpeichernetzwerk“) auf dem sekundären Spei-cher weiter gearbeitet werden könnte. Wersich heute größere NAS-Systeme installiert,sollte genau auf solche Backup- und Restore-Funktionen achten. Mit einer einfachen Back-up-Lösung ist es jedenfalls nicht möglich, Spei-cherkapazitäten von 320 Gigabyte geschweigedenn 50 Terabyte in vernünftigen Zeiträumenabzuspeichern.
Erfolg und Misserfolg am NAS-Markt
Mit ähnlichem Vorgehen ist auch EMC er-folgreich gewesen. Wer allerdings als An-wender auf die Preise schaut, die Netapp undEMC für ihre Produkte und Services verlangen,wird für alternative Angebote empfänglich sein.An Herstellerversuchen, NAS billiger auf denMarkt zu bringen, mangelte es nicht.Viel gehol-fen hat es kaum für die massenweise Durchset-zung dieser Technologie. Ein NAS-System mit320 Gigabyte Speicherkapazität kostet zwar in-zwischen nur noch 3.000 Euro, aber Festplattenmit derselben Kapazität sind bereits für einSechstel dieser Summe zu haben. Einige NAS-Anbieter sind daran gescheitert, dass sie aus-schließlich auf den Preis schielten und dabei dieIntegration der propagierten Lösung in dasNetzwerk unbeachtet ließen. Der HerstellerQuantum zum Beispiel schaffte es von denStückzahlen her mit seinen Snap-Servern sogarzum Marktführer. Gewinn in Form von schwar-zen Zahlen wollte sich dennoch nicht einstellen,da die Systeme teilweise zu einfach konstruiertwaren und jedes Mehr an Sicherheit die gerin-gen Margen aufzufressen drohte – und folge-richtig unterblieb. Die Snap-Division wurdeschließlich ausgelagert und ist heute als eigen-ständiges Unternehmen Snap Appliance nurnoch ein kleines Licht auf dem Markt.
Einen anderen Versuch startete Software-anbieter Veritas. Techniker und Managerglaubten daran, der Kern einer NAS-Appliancesei der NAS-Header, also die spezialisierte Soft-ware, die Speichersystem und Datenanfragensteuert. Man scheiterte etwas kläglich mitServpoint NAS, einem Softwareprodukt, das je-des Sun-Speichersystem in eine NAS-Applian-ce verwandeln sollte. Servpoint NAS konnte inpuncto einfacher Integration mit den anderenProdukten nicht mithalten und leidet zudeman unzureichender Performance, weil es alsAnwendungssoftware auf ein Server-Betriebs-system mit seinen hausgemachten Einschrän-kungen angewiesen ist.
Das Rennen um die Gunst der Anwender-unternehmen ist also nicht erst auf der dies-jährigen Systems ausgebrochen, aber dort istes im Oktober 2003 in eine neue Runde gegan-gen. Microsoft stellte den Windows StorageServer 2003 (WSS 2003) vor, dem Vertreter vonDell, Fujitsu Siemens Computer, Hewlett-Pack-ard, Iomega und EMC erhebliche Fortschrittegegenüber der Vorgängerversion WindowsPowered NAS auf der Basis des Windows 2000
-
ICP vortex Computersysteme GmbHKonrad-Zuse-Str. 9, D-74172 Neckarsulm, GermanyTelefon: +49-7132-9620-364, Telefax: [email protected], http://www.icp-vortex.com
K o m p e t e n z i n C o n t r o l l e r
Frischen Sie Ihren Server auf mit den neuen SCSI RAIDControllern von ICP: GDT8x24RZ hat eindeutig zweiUltra320 SCSI Kanäle mit zwei internen und zwei externenAnschlüssen. GDT8x24RZ+BBU ist zusätzlich mitBatterie-Funktion ausgestattet.
Wann bringen Sie Ihren Server in Fahrt?
Frischer Wind für Ihren Server
-
14 nas / kleine marktanalyse [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
Servers bescheinigten. Und die InternationalData Corporation (IDC) trat durch Markterhe-bungen den Nachweis an, dass schon 41 Pro-zent aller NAS-Anwender die Produkte von Mi-crosoft verwenden. So kann es gehen, wennman eine Unmenge von Windows-NT-Servern,die ebenfalls Daten speichern, in die Statistikmit einbezieht. Die IDC-Zahlen sind aber auchnicht zu unterschätzen, belegen sie doch ein-drucksvoll den Vormarsch eines Herstellers, derbisher nicht so recht am Speichermarkt wahr-genommen wurde. Der aber nun überdeutlichpräsent ist. Und darüber freut sich die großeGilde der Partner nicht unbedingt, auch wennsie gute Miene zum Spiel macht und lieber mitvon der Microsoft-Partie ist als außerhalb ohn-mächtig zuzuschauen.
Hat der Markt genug Platz für 25 OEM-Partner?
Mit Microsoft hat ein Softwaregigant dieArena betreten, der – so vermuten vieleBeobachter – nur einen weiteren Marktplatzfür seine Serverprodukte sucht. Die Anstren-gungen von Microsoft sind allerdings weitrei-chender (siehe Artikel „Microsoft will mehrspeichern“). Denn in Redmond hat man zumeinen den Ersatzbedarf für NT- und Windows-2000-Installationen im Auge, verpasste WSS2003 zum anderen allerdings auch sehr weit-reichende Neuerungen, um Preis und Verfüg-barkeit des hauseigenen NAS-Betriebssystemsattraktiver zu machen. Vom Preis her unterbie-ten Microsoft und seine 25 OEM-Partner dieProdukte von Netapp ohne große Mühen. Und
auch bei der Verfügbarkeit will man in die En-terprise-Klasse vordringen. So stellte ZaneAdam, Director Product Management andMarketing, auf der Systems 2003 klar, dass derWindows Storage Server zu einer Speicher-plattform ausgebaut werden soll und mansich nicht als Softwarezulieferer für NAS-Appli-ances beschränken will.
Technische Schützenhilfe erwartet sich Mi-crosoft nicht sofort, aber in naher Zukunft vondem neuen Ethernet-Transportstandard iSCSI,der Speicherpakete über Ethernet-Netzwerkeverschicken kann und mit dem sich ein zum Fi-bre-Channel alternatives Speichernetz schein-bar kostengünstig aufbauen ließe. Doch vor-erst ist das noch Zukunftsmusik und der Win-dows Storage Server nicht viel mehr als einüberarbeiteter und gut optimierter Datei- undDruckserver. Doch einige Verbesserungen zei-gen, dass der Fehdehandschuh im Ring liegt.So laufen die NAS-Protokolle zwar noch nichtim Betriebssystemkern, sondern nur kernel-nah, aber auf jeden Fall nicht mehr im Anwen-dermodus. Bei der CIFS-Performance siehtman sich vor Netapp, und auch NFS soll schonim nächsten Frühjahr ähnlich schnell wie beiNetapp laufen. Aufholen müssen die Micro-soft-Entwickler noch bei den wichtigen Snap-shot-Diensten. Der Plan, in einer eigenen Road-map für den WSS 2003 schnelle Updates her-auszubringen, zeigt jedoch, dass Microsoft sichnicht auf den ersten Erfolgen ausruhen will.Wen solche technische Feinheiten nicht über-zeugen, der wird mit dem Geldbeutel gelockt:Microsoft bietet für den WSS 2003 eine Unli-mited Client License. Wie Netapp.
NAS IS KING FOR BACKUPWozu brauchen Unternehmen NAS-Server? fragte die Gartner Groupmittelständische Unternehmen, die nach Zahl der Mitarbeiter in vierGruppen aufgeschlüsselt waren. Bei nur 58 Teilnehmern und Mehrfach-nennungen ist das zwar keine repräsentative Umfrage, aber das Ergeb-nis überrascht dennoch etwas. Mit 62 Prozent bekam nicht die Daten-speicherung – wie man hätte erwarten können –, sondern der BereichDisk-to-Disk-Backup, also Datensicherung, die meisten Antworten. 53Prozent der Befragten setzen NAS für die temporäre Speicherung vonInformationen ein, was im Prinzip nur eine Variante des Disk-to-Disk-Backups darstellt. Erst danach folgen Speichererweiterung (50 Prozent),Dokumentenspeicherung (40 Prozent) und Ersatz von Dateiservern (38 Prozent).Bei diesem Ergebnis verwundert es nicht, dass die Anbieter von Backup-Software sinkende Umsätze beklagen. Anwender, die keine zentrale Da-tensicherung benutzen, ziehen anscheinend ihre Schlüsse aus dem ewi-gen Ärgernis der Datensicherung. Ob sich das wieder ändern wird,nachdem inzwischen alle Speicher-Hersteller Produkte für Disk-to-Disk-to-Tape anbieten? Die nächste Gartner-Umfrage wird es zeigen.
0 2 4 6 8Anzahl der Antworten
Wer braucht NAS wozu?
10 12 14 16
Disk-to-Disk-Backupoder Archivierung
Zwischen-speicherung
Erweiterungsspeicher
Dokumenten-speicherung
Ersatz vonDateiservern
Anderes
1–19 Beschäftigte20–99 Beschäftigte100–499 Beschäftigte500–999 Beschäftigte
Qu
elle
: Gar
tner
Gro
up
-
Die Erweiterung durch das Server Appli-ance Kit (SAK) machte aus Windows2000 bereits den Windows PoweredNAS-Server. Das Urteil aus der Sicht vieler An-wender: Es gibt bessere Dateiserver. Auf der Sy-stems 2003 stellte Microsoft nun den Win-dows Storage Server 2003 (WSS 2003) vor, mitdem Redmond den Speichermarkt aufmischenwill. Zane Adam, Director Product Manage-ment und Marketing bei Microsoft, versprachsogar, Windows zu der besten aller Speicher-plattformen auszubauen. In der Tat wurden inWSS 2003 viele neue Speicherfunktionen im-plementiert. Da die Treiberarchitektur massivverbessert wurde, sollen harte Abstürze mitdem vielzitierten BSOD (Blue Screen of Death)nun der Vergangenheit angehören. Man kanndas als Sprücheklopferei abtun, sollte aber be-rücksichtigen, dass Microsofts Enterprise Sto-rage Group gegenwärtig mit 300 Mitarbeiternantritt. „Das sind fast ausschließlich Software-Entwickler, die mehr können als nur grafischeOberflächen gestalten“, heißt es mit angriffs-willigem Understatement bei Microsoft.
Nur an die OEM-Partner wird der WSS 2003ausgeliefert und kann dann, sofern der Partnerdazu in der Lage ist, mit herstellerspezifischenFunktionen erweitert werden. Hewlett-Pack-ard will beispielsweise einen Raid-Controller-basierenden Snapshot, NSI Software synchro-ne und asynchrone Replikationslösungen ent-wickeln. Und Quest bietet Migrations- undKonsolidierungsdienste für den Umstieg vonWindows NT 4 auf den WSS 2003 an. SolcheDienste dürften allerdings zum Programm je-des OEM-Partners gehören, da ein WindowsStorage Server leistungsfähig genug ist, umlaut Robert Gorbahn, Storage Technology Spe-cialist ESG bei Microcosft, 30 bis 50 NT-4-Datei-server zu ersetzen. Die Kostenersparnisse bei
Strom, Platz und Management könnten sichfür Anwender rechnen und so für die Anbieterein lukratives Ersatzgeschäft zur Folge haben.
Dabei sind allerdings nicht die Zusatzfunk-tionen das Besondere: Microsoft gibt denOEM-Partnern zwar ein wenig Spielraum, umsich voneinander zu differenzieren, doch mussjeder die Windows-internen Funktionsplattfor-men benutzen. Dadurch behält das Betriebssy-stem die Kontrolle über alle Speicherfunktio-nen.
Storage auf Microsoft-Art
Vier Hauptfunktionen sind es, die den WSS2003 tatsächlich zu einer Speicherplatt-form machen können: Volume Shadow CopyService (VSS), Virtual Disk Service (VSD), QuotaManagement und Multipathing.
Der Volume Shadow Copy Service ist dieSchnittstelle für diverse Einsatzgebiete vonSnapshots oder Schattenkopien, wie es in Mi-crosofts TV-Werbung heißt. Damit lässt sichder Zustand des Dateisystems festhalten, sodass zugriffsberechtigte Anwender eine ge-löschte Datei ohne großen Aufwand wieder-herstellen können. 64 Snapshots pro Volumesind möglich, erst danach wird die allerersteKopie wieder überschrieben. VSS reserviertstandardmäßig zehn Prozent des Speicherplat-zes für diesen Dienst, der aber bei Platzproble-men dynamisch erweiterbar ist. Auch dasinterne NT-Backup ist durch VSS in der Lage,Snapshots anzustoßen. Backup-Hersteller wer-den sich in Zukunft somit schwer tun, ihre op-tionalen Open-File-Programmerweiterungennoch als etwas Besonderes zu verkaufen.
Stehen die Snapshots auch im Speichernetzzur Verfügung, eignen sie sich hervorragendzum Testen neuer Programmversionen mit
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / windows storage server 15
[windows storage server]
Microsoft will mehr speichernDie ersten Berichte über den Windows Storage Server 2003 fallen gar nicht schlecht aus: schnel-ler als der Vorgänger, einfacher ins Netz zu bringen und mit einer grafischen Benutzeroberflä-che ausgestattet, die alle wichtigen Dateiserverfunktionen und noch mehr bereithält. Linux-Freunden und eingefleischten Windows-Gegnern schaudert es allerdings bei dem Gedanken,dass Microsoft sich verstärkt in die Datenspeicherung einmischen will. Und besorgte Anwenderfragen sich: Reicht es nicht aus, dass Windows gerne abstürzt, soll nun auch noch so ein wichti-ges Thema wie die Datensicherung in Microsofts Verantwortung liegen? Die Fronten sind – wieimmer, wenn es um Microsoft-Produkte geht – verhärtet.
Business-CopyBei der Business-Copy wird auf
einem Speichersystem einedreifach gespiegelte logischeFestplatte erzeugt. Die ersten
beiden Spiegel sollen die Hoch-verfügbarkeit der Anwendunggarantieren, der dritte Spiegel
kann für die Datensicherungabgehängt werden. Um einenkonsistenten Zustand der Da-
tenbank herzustellen, wird die-se in den Backupmodus ge-
bracht. Dadurch werden alle of-fenen Transaktionen beendet.
Zweck der Business-Copy ist es,die produktive Datenbank nicht
durch das Backup zu belasten.Nach erfolgter Datensicherung
wird der dritte Spiegel wiederangekoppelt und synchroni-
siert.
-
produktiven Daten und sind nicht zuletztwichtig für das zentrale Enterprise-Backup.Hewlett-Packard will auf VSS Raid-Controller-funktionen anbieten, mit denen sich dannauch ein Split-Mirror erzeugen ließe. Das Ver-fahren ist besser bekannt als Business-Copyund vereinfacht die Sicherung bei Datenban-ken.
Mit den Virtual Disk Services, der Datenträ-gerverwaltung, lassen sich Soft- und Hard-ware-Raid-Konfigurationen auf lokalen Plattenerzeugen. Die großen OEM-Partner wiederumkönnen VDS erweitern und so die spezifischenFunktionen ihrer Raid-Controller verfügbarmachen. Von HP ist bekannt, dass einige Ver-sionen der Virtual-Array-Familie dazu schon inder Lage sind. Die vielbeschworene NAS/SAN-Fusion zeigt hier praktische Konsequenzen.Für den Systemadministrator vereinfacht sichdurch diesen Durchgriff auf das Enterprise-Speichersystem die Verwaltung seines Spei-cherpools. Bislang ist es jedoch noch so, dassder Speicheradministrator logische Festplat-ten bereitstellen muss, die erst danach in ei-nem weiteren Arbeitsschritt vom Systemadmi-nistrator für ein Dateisystem im Netzwerknutzbar sind.
Eine bei Mitarbeitern sehr unbeliebte Spei-cherfunktion ist das Quota-Management, dahiermit ihr individueller Speicherplatz be-schnitten und nur bei Nachweis drängenderPlatzprobleme erweitert wird. Zusätzlich lässtsich das Abspeichern bestimmter Dateitypenwie AVI- oder MP3-Dateien im Firmennetz jetzt
komplett verbieten. Die grundlegenden Funk-tionen stammen von Precise, einem inzwi-schen von Veritas übernommenen Hersteller.
In kleineren Firmen dürfte der Verwaltungs-aufwand für das Quota-Management in kei-nem Verhältnis zum Nutzen stehen. In größe-ren Unternehmen ist Quota-Management da-gegen Ausgangspunkt für eine kostenstellen-bezogene Abrechnung. Soweit ist Microsoftmit WSS 2003 jedoch noch nicht, da Quotasvorerst nach Anwendern, Ordnern und Ver-zeichnissen zugeteilt werden. Die Umsetzungauf Kostenstellen dürfte selbst mit dem inte-grierten Reporting-Werkzeug zu aufwändigsein.
Interessant wird das Quota-Managementjedoch für das Storage Resource Management(SRM). Mittels Reporting kann der Speicherad-ministrator herausfinden, wo alte unbenutzteDateien liegen, wie der NAS-Server ausgelastetist, welcher Anwender beziehungsweise wel-che Anwendung den meisten Speicher bele-gen und ähnliches mehr. Für die Konsolidie-rung von NAS-Servern ein brauchbares Werk-zeug. Microsoft stellt es den OEM-Partnernallerdings frei, ob sie das Quota-Managementin ihre NAS-Systeme integrieren.
Multipathing I/O (MPIO) war lange Zeit einThema, das nur die großen Speicherherstellerbeherrschten: Um Speichersysteme hochver-fügbar mit NAS-Servern zu verbinden, ist esnotwendig, eine ausfallsichere Verbindung be-reitzustellen, also mindestens zwei Pfade zurVerfügung zu haben. Dazu erforderlich sindnicht nur zwei Hostbus-Adapter (HBA), son-dern Mechanismen, die erkennen, ob ein Pfadausgefallen ist, um im Fehlerfall die Datenüber den zweiten zu schicken. Dieser so ge-nannte Failover würde jedoch nur einen Pfadausnutzen. Microsoft hat für einen wirtschaft-lichen Betrieb auch gleich Funktionen zur Last-verteilung (Loadbalancing) integriert. Damitdas funktioniert, müssen noch die HBA-Her-steller mitspielen. Das ist jedoch nur eine Frageder Zeit. So ist LSI Logic gegenwärtig dabei, ei-nen betriebssystemnahen Treiber zu entwick-eln, der auf allen LSI-HBAs Fibre Channel, SCSIund iSCSI unterstützt. Emulex und Qlogic wer-den mit Sicherheit nicht lange abseits stehenbleiben.
Auch MPIO ist wie VSS und VSD nur eineProgrammierschnittstelle, auf die Softwarewie Secure Path von HP oder Power Path vonEMC aufsetzen muss, damit die gesamteStrecke vom NAS-Server zum externen Spei-chersystem ausfallsicher wird. Aber durch die
16 nas / windows storage server [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
1200
1000
800
600
400
200
0
Du
rch
satz
(Meg
abit
pro
Sek
un
de)
1 2 4 8
↑ 64%
↑ 59%
↑ 102%
↑ 148%
NetBench File Server PerformanceHP DL760 mit 900 MHz Pentium-4-Prozessoren und 4 GB RAM
Windows NT 4.0Enterprise Edition
NAS 2.0/Windows 2000
Storage Server 2003/Windows Server 2003
Quelle: Hewlett-PackardProzessorzahl
Mit Windows NT 4.0 glückte Microsoft der Durchbruch zum anerkannten Hersteller von Serverbe-triebssystemen. Jetzt heißt es Abschied nehmen von einem vielfach installierten Datei- undDruckserver. Der Nachweis der Performancegewinne von Windows 2003 ist die indirekte Aufforde-rung, Serverfarmen zu konsolidieren.
NAS Data CopyDer Windows Storage Server2003 kann gegenwärtig nurSnapshots auf dem ausführen-den NAS-Server ablegen, nichtjedoch den Snapshot auf einanderes Speichersystem über-tragen. NSI Software hat mitDouble-Take eine Software ent-wickelt, die über IP-Verbindun-gen einen Spiegel auf einen an-deren NAS-Server mit Win-dows-Betriebssystem ermög-licht. Eine Reihe von OEM-Part-nern setzt dieses Produkt untereigenem Namen ein. Hewlett-Packard vermarktet es unterdem Namen NAS Data Copyoder als Open View StorageMirroring und ist im letzterenFall fähig, eine Kopie auf belie-bigen Windows-Versionen zuerzeugen. Im Fehlerfall kannder Systemadministrator einenFailover auf die Kopie durchfüh-ren. Da die Supportfrage nochoffen ist, können Anwenderderzeit keine Spiegelung zwi-schen NAS-Servern unterschied-licher Hersteller vornehmen.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / windows storage server 17
Microsoft-Kontrolle bekommt sie eine durch-schlagende Einigungswirkung.
Was noch alles kommt
Die Funktionsplattformen, Andockstellenoder allgemeiner Programmierschnittstel-len (API) sind für die Zukunft von Windows alsSpeicherplattform überaus wichtig, da so dieAnwendungsprogramme über das Betriebssy-stem erfahren können, was auf dem Speicher-system alles getrieben wird. Das gehört auchbei Unix nicht zu den Standardfunktionen. Vorallem bei der Datensicherung von Datenban-ken ist es aus Zeitgründen inzwischen üblich,nicht über anwendungsspezifische Online-Schnittstellen zu gehen, sondern gleich dieSpeicherblöcke wegzusichern und den Pro-grammen ein gelungenes Backup vorzugau-keln. Das funktioniert soweit zufrieden stel-lend, lässt sich aber gewiss kooperativer undfür alle Beteiligten sicherer lösen.
Der Windows Storage Server 2003 wird sichwie andere Speicherplattformen auch ent-wickeln müssen. Microsoft verspricht eine bis-lang ungewohnte Stabilität, aber Speichermuss rebootlos erweiterbar sein. Diese Her-ausforderung ist nicht zu unterschätzen, wieman am Speichernetz sehen kann. Durch dasPlattformkonzept steckt in der Architektur desWSS 2003 das Versprechen auf Interoperabi-lität heterogener Infrastrukturen – ein An-spruch, der sich bislang fast ausschließlich nurauf der Marketingebene aller Speicheranbieterbewegte.
Beabsichtigt ist zudem, den WSS 2003 inkürzeren Zeitabständen als den Windows Ser-ver aufzufrischen. Eine öffentliche Roadmapdazu gibt es noch nicht von Microsoft. Das Ein-
spielen neuer Releases wird Anwender zwarnicht freuen, aber die Zusammenarbeit einerVielzahl von OEM-, Hard- und Softwarepart-nern lässt diese Strategie sinnvoll erscheinen,um schnellstmöglich die Anpassung auf ver-besserte Speicherfunktionen vorzunehmen.Microsoft hat die Basis gelegt, um alle wichti-gen Funktionen zu implementieren, die bishernur große Anbieter wie EMC, Hewlett-Packard,Hitachi und IBM beherrschen. Der späte Ein-tritt in den Speichermarkt könnte sich als vor-teilhaft erweisen.
Pro
toco
ls
Ant
i-Viru
s
Bac
kup
Rep
licat
ion
Clu
ster
ing
VD
S a
nd S
ecur
ePat
h(M
PIO
)
Management Inferfaces (Web GUI and more)
Quota Management
Virtual Shadow Copy Services (Snapshot)
Windows Storage Server 2003 – file and print services
Quelle: Hewlett-Packard
Hersteller, OEM-Partner und Third-Party-Anwendungen sind in dieser Grafik glücklich vereint. Indem massiven Fundament, den tragenden Säulen und der Deckplatte spiegelt sich eine temporäreinige Industrie wieder, die Windows 2003 zur Speicherplattform der Zukunft machen will.
-
Vielleicht hilft eine Analogie aus dem täg-lichen Leben, das Problem von Block undDatei verständlicher zu machen. Wer In-formationen ablegen will, schreibt sie ge-wöhnlich auf Papier nieder. Auf die Dauer wer-den so ganze Hefte und Bücher gefüllt. Aller-dings weiß nur der Autor, wo und wann er wel-che Informationen hingeschrieben hat. Erselbst findet diese meist ohne große Problemewieder. Für jeden Anderen ist es allerdings hilf-reich, wenn er bei der Informationssuchedurch ein Inhaltsverzeichnis und einen Indexunterstützt wird.
Auf Festplatten übertragen heißt das, diemit Magnetpartikeln beschichtete Drehschei-be muss eine grundsätzliche Struktur erhalten,ähnlich wie die Seiten eines Heftes. Das machtman, indem die Magnetbeschichtung in Blöckevon meistens 512 Byte Größe zerlegt wird. Unddiese Blöcke lassen sich gut und vor allemschnell zwischen Prozessor und Festplatte undauch über ein Netzwerk hin- und herschicken.
Moderne Festplatten mit 100 GigabyteSpeicherkapazität verfügen über etwa 200Millionen Blöcke. Wie beim Buch gibt es einenAnfang und ein Ende, in diesem Fall einenStart- und einen Endblock, der eine gewisseAnzahl der durchnummerierten Blöcke um-schließt. Dieser Bereich, auch logisches Volumegenannt, kann entweder einen Teil oder dieSpeicherkapazität der gesamten Festplatteumfassen, er kann sich aber auch über vieleFestplatten ausdehnen. Die logische Festplatteentspricht dem, was ein Anwender üblicher-weise als Festplatte wahrnimmt. Und nur die-ser strukturierte Bereich lässt sich grundsätz-lich von einem Betriebssystem oder einem An-wendungsprogramm benutzen.
Selbstverwaltung oder Dienstleister
Stellt sich die Frage, wie diese MillionenBlöcke beaufsichtigt werden. Soll jedes Pro-gramm selbst diese Funktion übernehmenoder bringt man eine spezialisierte Softwarefür diese Dienstleistung zum Einsatz? Es ver-hält sich also im Grund ähnlich wie beimNiederschreiben von Informationen auf Papier:Man braucht beides, die Daten plus eine zu-sätzliche Informationsmatrix. Betriebssyste-me, als spezialisierte Programme, legen dazuein Dateisystem über die Blöcke und verwaltendie Dokumente der Anwender in einem In-haltsverzeichnis. Jede Datei ist hier mit ihremNamen, ihrer Größe und anderen Attributeneingetragen, ebenso wie der Speicherort im In-haltsverzeichnis vermerkt wird. Weiterhinstellt das Betriebssystem standardisierte Dien-ste bereit, die für Anwendungsprogramme dasSpeichern, Öffnen und Löschen übernehmen.Das entlastet die Programmentwicklung vonApplikationen erheblich.
Wollen Anwendungen die Blockstruktur di-rekt benutzen, müssen sie ihre Blöcke selbstverwalten. Der Aufwand lohnt sich indes nurfür Unternehmens-Datenbanken wie Micro-soft Exchange, Oracle oder IBM DB/2. DieSelbstverwaltung bringt Geschwindigkeitsvor-teile, da nicht jeder Datensatz umständlichüber das Betriebssystem angefordert werdenmuss. Wichtiger ist jedoch, dass die Dateninte-grität und Datenverfügbarkeit nicht durch an-dere Programme, die auf denselben Bereich zu-greifen wollen, beeinträchtigt wird. Und nichtzuletzt weiß das Datenbankprogramm natür-lich selbst am besten Bescheid, welcher An-wender auf welchen Datensatz zugreift undkann so Zugriffskonflikte verhindern.
18 nas / festplatte, block und datei [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
[festplatte, block und datei]
Rohstoff FestplatteAuf Festplatten werden Daten gespeichert. Klar, das weiß man als Computerbesitzer. Werdendie Daten allerdings auf einem Dateiserver (NAS) gespeichert oder gar in einem Speichernetz(SAN), scheint es kompliziert zu werden. Dann reden die Fachleute auf einmal von datei- undblockorientierter Datenspeicherung. Preiswert soll es sein, Informationen in Form von Dateienzu speichern, als wesentlich schneller dagegen wird die Blockspeicherung ausgegeben. WarumAnwender mit solchen Details behelligt werden, bleibt im Dunklen – ihnen geht es schließlichnur um das Resultat gelungener Datenspeicherung. Wer es trotzdem wissen will: Im Folgendenein kleiner Versuch, den Unterschied zwischen datei- und blockorientiertem Speicherverfahrenzu erklären.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / festplatte, block und datei 19
Block- und dateiorientierte Datenspeiche-rung sind keine konkurrierenden Technologien,wie es im Vergleich von SAN und NAS immernahegelegt wird. Es ist eine Frage des Aufwan-des, den der Hersteller einer Anwendung be-treiben will. Es ist auch wichtig für den System-administrator, der das alles einrichten muss.Der Anwender braucht davon nichts zu wissen.Für ihn werden die Speicherfunktionen imHintergrund vom Betriebssystem oder der Da-tenbank bereitgestellt.
Block- oder Pakettransport
Ärgerlich ist es, dass die Trennung von Dateiund Block ins Netzwerk verlängert wirdund auch hier als konkurrierende IT-Infrastruk-tur dargestellt wird. Da steht das FC-SAN danngegen das IP-SAN oder dieses gegen das iSCSI-SAN. Dabei besteht technisch betrachtet derGegensatz allein darin, dass das zur jeweiligenInfrastruktur dazugehörige Protokoll entwederBlöcke transportiert oder nur fähig ist, mit ei-nem Betriebssystem zu kommunizieren. FC-und iSCSI-Protokoll können Blöcke transportie-ren und deshalb direkt auf eine Festplatte oderalternativ auf ein logisches Volume zugreifen.Das IP-Protokoll dagegen spricht über dieNetzwerkkarte mit dem Betriebssystem undbenutzt dessen Speicherfunktionen. Andersausgedrückt: Im FC- und iSCSI-SAN wird eine„rohe“ Festplatte bereitgestellt, das NAS, inzwi-schen zum IP-SAN hochstilisiert, stellt dagegenein Dateisystem im Netzwerk zur Verfügung.Mal wird das eine, mal das andere gebraucht.
Block- und dateiorientierte Verfahren sindnoch nicht die letzten Worte in Sachen Daten-
speicherung. Das zeigen die Bestrebungen vonAdic, IBM, Veritas und anderen, die gleich imSAN ein Dateisystem bereitstellen wollen. Die-ses bedient Betriebssysteme jeder Couleur undarbeitet zudem auf der schnellen FC-Infra-struktur. Die großen Vorteile dieser nicht ganzbilligen Lösung: fast unbegrenzte Skalierfähig-keit der Speicherkapazität und ein umfassen-des zentrales Speichermanagement im Re-chenzentrum.
Nicht vergessen werden soll bei diesen Be-trachtungen die objektorientierte Speicherungvon Daten, wie sie EMCs Centera offeriert. JedeDatei erhält bei diesem Verfahren Attribute,die festlegen, ob sich das Objekt selbsttätigspiegelt, repliziert oder auf ein Band schreibt.Diese übergeordnete Dateistruktur könnteauch Archivierungsprobleme lösen helfen.
Es ist also so und bleibt auch erst einmal so,dass Unternehmen die datei- und blockorien-tierte Datenspeicherung gleichermaßen benö-tigen. Den blockorientierten Zugriff für die Ex-change-Datenbank, den dateiorientierten Zu-griff für die Home-Verzeichnisse der User.Mittelständische und große Anwenderunter-nehmen werden diesen Bedarf mittelsNAS/SAN-Fusion befriedigen. Der NAS-Serverhat dann keinen eigenen Speicher mehr undbekommt diesen von einem FC-Speichersy-stem zugeordnet, während die Datenbank di-rekt darauf zugreift. Kleinere Unternehmen lö-sen das scheinbare Dilemma wie gehabt mitlokal installierten Festplatten für die Daten-bank und einem Allzweckserver, der unter an-derem Dateien abspeichert.
-
Das Angebot an NAS-Produkten ist groß,und ein weiteres Wachstum ist amMarkt absehbar. Zum einen hat Micro-soft mit dem Windows Storage Server 2003 einProdukt herausgebracht, das sich zur Ablösungüberkommener Speicherkonzepte eignet. Zumanderen stehen dem Software-Unternehmenwie erwähnt 25 große OEM-Partner von EMC,Dell, Fujitsu Siemens Computer, Hewlett-Pack-ard bis Iomega zur Seite, die nicht nur NAS-Ap-pliances und NAS-Server assemblieren, son-dern auch einiges Speicher-Knowhow in dieWindows-Plattform einfließen lassen. Kurz:Der Speichermarkt befindet sich im Umbruch,und das nicht zum Nachteil der Anwender.
Microsoft hat es durch sein Engagementgeschafft, die großen Serverhersteller bei ih-rem Eigeninteresse zu packen. Denn die Server-hersteller sind auch deshalb um die Produktka-tegorie NAS bemüht, weil man schon langenach einem Weg suchte, sich durch das Ange-bot vorkonfigurierter Server im Handel beliebtzu machen. Das Servergeschäft ist kein Mas-sengeschäft, und der Fachhandel leidet seitlangem an den knappen Gewinnspannen, diedurch die meist kundenspezifische Konfigura-tion aufgezehrt werden. Die Produktkateg-orien der NAS-Server lassen sich dagegen gutin standardisierte Leistungsklassen aufteilenund bieten zudem die Möglichkeit endlich ein-mal die herstellerspezifischen Leistungsmerk-male unter Beweis zu stellen. In Amerika istdas Benchmark-Rennen um die beste CIFS-und NFS-Performance schon in vollem Gange.
Die Microsoft-Initiative bringt überdies jeneNAS-Hersteller in eine gewisse Zwangslage,die Linux als preiswertes NAS-Betriebssystemvermarkten wollten. Solange Linux mit Samba,einem SMB-ähnlichen Netzwerkprotokoll,
nicht vergleichbare CIFS-Leistungen bringtund durch integrierte Snapshot-Techniken fürein einfacheres Backup und Recovery sorgt, ha-ben die Microsoft-Partner einige gute Argu-mente auf ihrer Seite. Umgekehrt: Es zeigt sichwieder einmal, dass es mit der so hochgeprie-senen Enterprise-Fähigkeit von Linux nochnicht so weit her ist.
Anders sieht es für Microsoft im Enterprise-NAS-Markt aus. Allein EMC ist hier bislang inder Lage, dem Marktführer Network Appliance(Netapp) Paroli zu bieten. Microsofts Unlimited-License-Politik für NAS-Server wird aber garan-tiert bei Netapp für Aufregung sorgen, da dieKonkurrenten nun durch Konzepte zur NAS/SAN-Fusion einen sehr preiswerten Migrations-pfad in Enterprise-Speicherkonzepte eröffnen.Sehr schön ist dies an der Produktpalette vonHewlett-Packard (HP) nachvollziehbar, die hierstellvertretend für ähnliche Produktgruppie-rungen der Mitbewerber begutachtet wird.
HP NAS 1200s
Ganz typisch für den unteren Leistungsbe-reich sind NAS-Appliances im 19-Zoll-Ein-schub mit nur einer Höheneinheit (HE) Platz-bedarf. Diese Gerätekategorie ist für den Be-reich Abteilungs-Dateiserver gedacht und wirdhäufiger, so auch bei HP, von Fremdherstellerngefertigt und bietet schon deshalb keine Al-leinstellungsmerkmale. Konkurriert wird überden Preis und den Support. Ebenfalls typischist die komfortable Installation. Nach dem Ein-schalten erfragt ein Wizard den Servernamen,die IP-Adresse sowie zwei, drei weitere anwen-derspezifische Details. Anschließend stellt dasInstallationsprogramm Speicher im Netzwerkzur Verfügung.
20 nas / speicherstrategie mit nas-produkten [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
[speicherstrategie mit nas-produkten]
Speicherstrategie mitWindows Powered NASDer Bedarf nach Speicherkapazität wird auch in den nächsten Jahren zunehmen. Die ultimati-ve Lösung, die alle Aspekte bezüglich Performance, Flexibilität, Verfügbarkeit, Datenintegritätund zentralem Speichermanagement bedienen könnte, ist sicherlich das Speichernetz (SAN)mit Fibre-Channel-Architektur. Das SAN belastet aber nicht nur beschränkte IT-Etats, es giltauch als extrem komplex und kompliziert zu verwalten. Anwender fragen sich deshalb immerhäufiger, ob mit der als preiswert und einfach zu installierenden NAS-Technik nicht ähnliche Er-gebnisse zu erreichen sind.
-
HPs Einstiegsprodukt, das NAS 1200s,kommt mit dem Windows Storage Server 2003in drei unveränderlichen Modellvarianten mit320, 640 und 1.000 Gigabyte Speicherkapa-zität auf den Markt. Einige Konkurrenten sindflexibler und bieten bei Festplatten, Netzteilund Lüfter Hot-Swap-Technik. Das sollte nichtdarüber hinwegtäuschen, dass diese Produkt-kategorie prinzipbedingt keine höhere Verfüg-barkeit bietet.
Im Gehäuse des NAS 1200s liegen flachnebeneinander vier Parallel-ATA-Festplattenmit je 80, 160 oder 250 Gigabyte Kapazität, dieper Software-Raid verwaltet werden. In derStandardkonfiguration ist das Betriebssystemgespiegelt (Raid-1) und der Datenbereich alsRaid-5 angelegt, um das bestmögliche Preis/-Leistungsverhältnis zu bieten. Die Konfigura-tion des Datenbereichs lässt sich über die gra-fische Benutzeroberfläche des WSS 2003 leichtändern. Zu beachten ist allerdings, dass beiRaid-1 weniger als die Hälfte, bei Raid-5 etwasweniger als 75 Prozent der Bruttospeicherka-pazität zur freien Verfügung stehen.
Der Netzwerkanschluss erfolgt über Giga-bit-Ethernet; Bandlaufwerke lassen sich aneine SCSI-Schnittstelle mit 160 Megabyte proSekunde anschließen. Der Support wird dasganze Gerät betreffen, es lassen sich nur weni-ge Komponenten austauschen. Für den An-wender heißt das, dass er von vornherein einAugenmerk auf die Datensicherung habenmuss, da sonst im schlimmsten Fall ein Tera-byte Daten verloren gehen. Eine halbherzigeBackup-Strategie ist angesichts der Daten-menge nicht angebracht. Man sollte sich alsoso schnell als möglich mit der Snapshot-Tech-nik des Windows Storage Server vertraut ma-chen und sich über optionale Replikations- undSpiegelungssoftware des jeweiligen Herstel-lers informieren, um eine möglichst hohe Da-tenverfügbarkeit herzustellen.
HP NAS 2000s
Anwendern, die sich nicht mit der mäßigenLeistungsfähigkeit eines Speichersystemsmit nur vier 7.200 Umdrehungen pro Minuteschnellen ATA-Festplatten zufrieden gebenwollen, wird der Einstieg in die nächst höhereProduktkategorie empfohlen. Das NAS 2000smisst zwei Höheneinheiten und enthält einenProliant DL380 G3 Server mit einem 3 Giga-hertz schnellen Xeon-Prozessor. Optional istein zweiter Prozessor nachrüstbar. Als Einsatz-gebiete sieht HP Unternehmen, die in der Ver-
gangenheit eine größere Zahl von Datei- undDruckservern installiert haben und diese aufeiner leistungsfähigeren Plattform konsolidie-ren wollen. Durch die integrierte Lights-Out-Hardware (ILO), die selbst bei Ausfall des Ge-samtsystems eine Remote-Diagnose erlaubt,eignet sich das Gerät für den Einsatz in Zweig-stellen. Das NAS 2000s ist ein Hybridgerät undzeigt die Strategie von HP, die NAS-Appliancesdurch die Trennung in NAS-Head und Speicher-subsystem flexibler und skalierbarer zu ma-chen und damit auch die Verfügbarkeit zu ver-bessern. Theoretisch verwaltet das NAS 2000sbis zu 27 Terabyte Speicher. Sinn macht dasallerdings nicht, da der Anwender bei Speicher-bedarf immer wieder neue Speichereinschübenachkaufen muss.
In der Basiskonfiguration sind fünf interneSCSI-Festplatten enthalten, ein sechster Lauf-werksslot ist frei. Installierbar sind SCSI-Fest-platten mit maximal 146 Gigabyte Kapazitätund 10.000 beziehungsweise 73 Gigabyte und15.000 Umdrehungen pro Minute. Die gegen-über ATA-Festplatten wesentlich höherenDrehzahlen und die um den Faktor zwei bisdrei schnelleren Zugriffszeiten haben deutlichbessere Antwortzeiten zur Folge – anders aus-gedrückt, das System eignet sich auch für einegrößere Anzahl von Nutzern. Durch den An-schluss externer Festplattenerweiterungen er-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / speicherstrategie mit nas-produkten 21
I/O-ZugriffDie durchschnittliche Zugriffs-
zeit von ATA-Festplatten liegtbei etwa zehn, bei schnellen
SCSI-Festplatten ist mit etwadrei Millisekunden zu kalkulie-
ren. Grob gerechnet wäre dieATA-Festplatte demnach in der
Lage, 100 Zugriffe in einer Se-kunde abzuarbeiten, die SCSI-Festplatte käme auf eine I/O-Rate von etwa 300 Zugriffen.
Benutzerschnittstelle und Verwaltung
Protokollunterstützung
Replikation
Clustering
Virenschutz
Datensicherung
Snapshot-Technologie
Windows-basiertes Betriebssystem
Standardmäßige HP NAS-Software
Optionale HP NAS-Software
Optionale Drittanbietersoftware
NAS-Komplettlösung
Quelle: Hewlett-Packard
Auch eine preiswerte NAS-Komplettlösung hat heute mehr zu bieten als nur die schnelle Integra-tion großer Daten-Sammellager. Die aufeinander gestapelten Blöcke zeigen, dass die Hersteller in-zwischen auch NAS als unternehmenskritische Komponente betrachten und neue Geschäftsfelderfür Datensicherung, Clustering und Replikation wittern. Je nach Hersteller hat der Windows Stora-ge Server 2003 mehr Standardfunktionen und Optionen zu bieten.
-
höht sich der Datendurchsatz weiter, da sichdie I/O-Raten von bis zu 14 Festplatten zu-sammenfassen lassen. Das NAS 2000s bietetzudem eine Besonderheit: Der SCSI-Bus kannin zwei Hälften zu je sieben Festplatten geteiltwerden. Das ermöglicht den Aufbau mehrerernicht ganz so großer logischer Volumes, diedurch den „Splitbus“ selbst bei Höchstlast denSCSI-Bus nicht überlasten.
Das NAS 2000s spiegelt das Betriebssystemauf zwei eigenen Festplatten. Auf dem Raid-1-Set ist ebenfalls, wie bei den anderen Produk-ten auch, die Emergency-Recovery-Partitionuntergebracht inclusive aller Softwarepakete,die für eine Reparatur oder Neuinstallation derStandardkonfiguration notwendig sind. BeimStartvorgang kann zu diesem Reparaturkit ge-wechselt werden, alternativ lässt sich das Sys-tem direkt von der beiliegenden Emergency-Recovery-DVD booten und ist dann nach Aus-sagen von Guido Klenner, Business ManagerOnline Storage bei HP, innerhalb von zehn Mi-nuten wieder funktionsfähig. Änderungen ander Grundkonfiguration müssen allerdingswieder per Restore nachgepflegt werden. Wei-ter liegen auf den Betriebssystemfestplattender NTFS-Dateisystem- und der Betriebssys-temcache. Da genügend Platz vorhanden ist,sind diese Bereiche anders als bei einem Win-dows-Dateiserver sehr großzügig ausgelegt.Daten sollten hier allerdings nicht abgelegtwerden. Diese werden bei einem eventuell not-wendigen Recovery oder einer Neuinstallation
überschrieben. Zudem bringt die SeparierungPerformancevorteile, da die I/O-Zugriffe derAnwender nicht mit Betriebssystemoperatio-nen in Konflikt geraten. Für den Datenbereichstehen, sofern Raid-5 verwendet wird, internmaximal 440 Gigabyte zur Verfügung.
An das NAS 2000s ist ohne Erweiterung einexternes Speichersubsystem mit 14 Festplat-ten anschließbar. Intern sind allerdings nochdrei PCI-Slots für die Installation weiterer Raid-Controller vorhanden. Eine interessante Funk-tion, die alle größeren HP-Systeme mitbringen,sind die Koppelungsmöglichkeiten für dieNetzwerkkarte: Beide Gigabit-Ethernet-Portswerden dabei unter einer IP-Adresse zu-sammengefasst. So lassen sich auch auf derNetzwerkseite Loadbalancing und Failover rea-lisieren. Diese Standardfunktion sollten andereHersteller ebenfalls integriert haben.
HP NAS 4000s
Den Einstieg in eine Enterprise-Lösung stelltdas NAS 4000s dar. Ähnlich wie beim NAS2000s sind das Betriebssystem und die Not-fallkomponenten auf einem gespiegeltenRaid-1-Set untergebracht. Durch die Integra-tion eines Fibre-Channel-Controllers werdenallerdings Optionen eröffnet, die weit über derEinstiegslösung NAS 1200s und der Zweigstel-lenlösung NAS 2000s liegen.
Mit dem NAS 4000s fällt der Anwender einerelativ preiswerte, aber grundsätzliche Ent-scheidung, dass die Unternehmens-IT auf ei-nem SAN beruhen sollte. Etwa 24.000 Euro ko-stet dieser Einstieg. Dafür erhält man einenDual-Prozessor NAS-Server und das extern an-schließbare Modular SAN Array MSA 1000 mit560 Gigabyte Speicherkapazität, das sich bisauf sechs Terabyte ausbauen lässt und eineBrocade-Fabric mit acht Ports integriert. ImMSA 1000 selbst arbeiten SCSI-Festplatten.
Dieses System verdeutlicht, wie sich HP dieUnternehmens-IT vorstellt. Während Netappbeispielsweise Datenbanken wie Oracle oderMS Exchange über das Netzwerkprotokoll NFSbetreibt, will sich HP strikt an die Vorgaben vonMicrosoft halten und den Exchange-Serverausschließlich blockorientiert betreiben. NAS-und Exchange-Server oder auch Lotus Notesbedienen sich direkt aus dem blockorientier-ten SAN-Speicher.
Durch die FC-Schnittstelle ist auch der An-schluss an die größeren HP-SpeichersystemeEVA oder XP möglich. Wichtiger als diese Op-tion auf höhere Skalierbarkeit ist jedoch der
22 nas / speicherstrategie mit nas-produkten [dossier] sonderdruck 01/03 / project 57
CIFSNFS etc.
Fibre Channel (FC)NAS-Server
externesFibre-Channel-
System
Arbeitsplatzrechner
Ethernet-Netzwerk
Netzwerk-Protokolle Oracle-
DatenbankE-Mail-Server
Quelle: Hewlett-Packard
Die NAS/SAN-Fusion ist eine wichtige Klarstellung: NAS und SAN sind und waren noch nie einGegensatz. Network Attached Storage findet seine Heimat im Speichernetzwerk. Und das kannschon aus einem Fibre-Channel-Speichersystem mit integriertem FC-Switch bestehen. Datenbank-server sind direkt an den FC-Speicher angeschlossen, da sie die Daten selbst verwalten. Das Netz-werk-Dateisystem dagegen benötigt zur Bereitstellung der Home-Verzeichnisse einen zusätz-lichen NAS-Server.
SMB – Server MessageBlockMicrosofts NetzwerkprotokollSMB (Server Message Block)diente in den frühen Windows-Versionen dazu, Peer-to-Peer-Netze aufzubauen und Ordneroder ganze Festplatten über dasNetzwerk zur gemeinschaft-lichen Nutzung freizugeben.SMB ist heute Bestandteil vonCIFS, dem Common Internet FileSystem.
-
project 57 / sonderdruck 01/03 [dossier] nas / speicherstrategie mit nas-produkten 23
mögliche Ausbau auf höchste Verfügbarkeit.Alle Komponenten wie der NAS-Server selbstund auch die Schnittstellen zum Speicher las-sen sich clustern oder redundant auslegen.HPs Software Secure Path sorgt auf der Spei-cherseite dafür, dass die logischen Volumes –obwohl zwei Pfade existieren – nur einmal ge-sehen werden und Loadbalancing- und Fail-over-Fähigkeiten erhalten.
Weiterhin wichtig ist, dass diese alsNAS/SAN-Fusion bezeichnete Lösung ein zen-trales Backup- und Speichermanagement er-öffnet. Eine Konsolidierung von NAS-Servenwird beim NAS 4000s um die Möglichkeit er-weitert, auch den Speicher zu konsolidieren.HP ist sich da sehr sicher, dass dieselbe IT-Mannschaft auf absehbare Zeit drei- bis vier-fach größere Datenmengen verwalten muss.Das ist im Prinzip nur mit einem SAN möglich.
HP NAS 9000s
Wer sich den NAS 9000s kauft, hat schonein SAN von HP installiert. Das System be-ruht auf einem Proliant DL 580 mit maximalvier Prozessoren und ist fähig, selbst größerenUnternehmen mit mehreren tausend Mitar-beitern den schnellen Dateizugriff zu gewähr-leisten. Werden nur Dokumente gespeichertoder abgerufen, ist das NAS 9000s fähig, bis zu
1.000 Mitarbeiter pro Prozessor mit Dateidien-sten zu versorgen. Diese Faustregel unterstelltallerdings auch, dass das Speichersystem ei-nen I/O-Zugriff pro Anwender ermöglicht. Bei1.000 Anwendern müssen also mindestenszehn Festplatten installiert sein.
Wie am Anfang erwähnt, steht HP mit sei-ner Produktstrategie nur stellvertretend füreine Entwicklung, die Dateiservices per NAS-Server oder besser NAS-Gateways bereitstellt.Der in Konkurs gegangene Anbieter Auspexwar mit seinem Produkt NSc3000 im Nachhin-ein betrachtet etwas zu früh auf dem Markt.Der Storage Controller war für prinzipiell allewichtigen Speichersysteme zertifiziert. Ge-nützt hat es dem Hersteller nichts. Denn einersolchen anwenderfreundlichen Strategie ste-hen ausgeprägte Eigeninteressen fast allerHersteller gegenüber: Nicht nur HP hat seineNAS-Produkte so ausgestattet, dass sie vorbild-lich mit HP-Speichersystemen kommunizieren,für alles andere aber kein Support gewährtwird. Interoperabilität führt man zwar gerneim Munde, sie zu praktizieren ist aber eineganz andere Sache. Festzuhalten bleibt den-noch, dass sich mit den neuen NAS-Gerätege-nerationen für Anwender schon heute größereChancen eröffnen, das Speichermanagementpreiswerter handzuhaben.
Logisches VolumeUm Teile der Speicherkapazität
einer oder mehrerer Festplattenüber ein Netzwerk nutzbar zu
machen, ist es erforderlich, eineBlockstruktur zu erstellen, die
dem Serverbetriebssystem wieeine lokale Festplatte erscheint.Diese als logisches Volume oder
Logical Disk bezeichnete Spei-cherkapazität kann anschlie-ßend mit einem Dateisystem
versehen werden.
-
Eigentlich wäre alles ganz einfach, wenn je-der auf alle Dateien zugreifen könnte, dieauf NAS-Systemen gespeichert sind. Dochda sind Domänencontroller (PDC), Access Con-trol List (ACL), Network Information Server (NIS)und Directory Services vor. Leider hat jeder Her-steller seine eigenen Vorstellungen, wie Au-thentifizierung und individuelle Zugriffsrechtezu lösen sind. Novell machte das zu früherenZeiten mit der Bindery und führte dann ab Ver-sion 4.0 die Netware Directory Services (NDS)ein, Windows schützt Dateien seit Windows2000 mit dem Active Directory (AD) und Unixverwaltet den Zugriff mit den Yellow Pages be-ziehungsweise dem NIS-Server. Solange alle un-ter sich bleiben, gibt es keine Probleme. Schwie-rig wird es dann, wenn mal wieder eine Spei-cherkonsolidierung geplant ist oder Anwenderüber Betriebssystemgrenzen hinweg Datenaustauschen wollen. Dann stellen IT-Admini-stratoren schnell fest, dass die Zugriffsverwal-tung sich nicht nur beim Namen unterscheidet.Dabei geht es vor allem darum, Windows undUnix unter einen Hut zu bekommen. Novell hatin der Vergangenheit zwar viele Anstrengungenunternommen, als die bessere Zugriffsverwal-tung für Windows wahrgenommen zu werden,aber wer holt sich schon Netware ins Rechen-zentrum, wenn er eine reine Windows-Welt zuverwalten hat. Umgekehrt beschränkt sich Mi-crosoft darauf, Netware nur soweit unter dieFittiche zu bekommen, wie Anwender die veral-tete Bindery-Struktur benutzen.
Um Sicherheit muss sich jeder selbstkümmern
Witzigerweise argumentiert man bei Mi-crosoft sehr ähnlich in Bezug auf Unix,
hat aber im Gegensatz zu Novell ein gewichti-geres Argument vorzuweisen: eine dominanteStellung in den Betrieben. Laut Guido Klenner,Business Manager Online Storage bei Hewlett-Packard, laufen „mehr als 80 Prozent aller NAS-Installationen unter Windows“. Daneben gibtes aber auch praktische Argumente, die bei ei-nem gemischten Einsatz von Windows undUnix für die Kontrolle der Zugriffe durch Win-dows sprechen. Unter Unix kennt man nur diedrei Benutzer „Besitzer“, „Gruppe“ und „Ande-re“, denen Zugriffsrechte wie Lesen, Schreibenund Ausführen zugeordnet werden. Je nach-dem, ob diese Rechte für die Datei selbst oderfür das Verzeichnis erteilt wurden, wirken siesich anders aus.
Unter Windows sind diese Einstellungensehr umfassend definierbar. Zusätzlich zu Be-nutzern, Gruppen und deren Rechten werdenZusätze in den Erstellungsdaten, Remote Zu-griffserlaubnis, Abhängigkeiten nach AD- undDomänenrichtlinien und vieles andere mehr ineiner ACL-Liste auf der Festplatte abgelegt. Dasist eine kleine Wissenschaft für sich, oder mitden Worten eines Experten ausgedrückt:„Wenn Sie Windows-Dateien und ACL-Datenauf einem Unix-Dateisystem ablegen wollen,dann haben Sie Arbeit vor sich.“ Aber selbstmit viel Arbeit ist keine exakte Abbildung(Mapping) möglich, dafür entsteht eine aufge-blähte Rechte-Datenbank, die Unix bei jedemZugriff durchforsten müsste, um den Dateienwieder die Rechte „anzukleben“.
Umgekehrt scheint es wesentlich unauf-wändiger zu sein, die einfache Rechte-Strukturbei