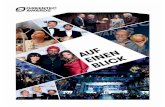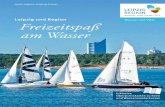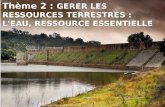Ressource Wasser
Transcript of Ressource Wasser

Ressource WasserWasserforschung für eine nachhaltige Zukunft

Impressum
HerausgeberBundesministerium für Bildung und ForschungReferat 724Ressourcen und Nachhaltigkeit53170 Bonn
DownloadEine barrierefreie Version der Broschüre finden Sie unter derAdresse http://ressourcewasser.fona.de
Redaktion und Gestaltungakzente kommunkation und beratung gmbh
Bonn, BerlinMai 2012
BildnachweisTitel: Helmut Löwe, Bundesministerium für Bildung und For schung (BMBF); S. 16: Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover; S. 36: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG); S. 39: www.oekolandbau.de; S. 44: Water related InformationSystem for the Sustainable Development of the Mekong Delta(WISDOM), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt(DLR), Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD); S. 52: Daniel Karthe, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-schung (UFZ); S. 53: Daniel Krätz, Center for EnvironmentalSystems Research, Universität Kassel; Lena Horlemann, Helm-holtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ); S. 58: GIZ Interna-tional Services; S. 63, S. 126, S. 144: André Künzelmann, Helm-holtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ); S. 66: ThomasEgli, Departement Umweltwissenschaft, ETH Zürich; Dagmar Haase, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ); S. 67: Günther Rank; S. 73: www.benno-gym.de; S. 80: Passa-vant-Roediger GmbH; S. 82: Fraunhofer-Institut für Grenz-flächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB); S. 112: DeutscherVerein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Technologie-zentrum Wasser (TZW); S 15: www.strategy4.china.com; S. 134: RusHydro; S. 140: visibleearth.nasa.gov; S. 148, S. 149:DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasserund Abfall e.V.
Die in der Broschüre enthaltenen Projektbeschreibungen basieren auf dem Infor-
mationsstand April 2012. Für die Korrektheit der gemachten Angaben sind die
jeweiligen Projektkoordinatoren verantwortlich.
Verwendete Sammelbezeichnungen wie Wissenschaftler, Forscher, Experten,
Studenten etc. sind als geschlechtsneutral anzusehen.

Ressource WasserWasserforschung für eine nachhaltige Zukunft

GRUSSWORT Ressource Wasser – Wasserforschung für eine nachhaltige Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
EINLEITUNG Wasserforschung für Mensch, Natur und Wirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. ÖKOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 EINSATZ IM UNTERGRUND – EFFIZIENTE IN-SITU-METHODEN ZUR GRUNDWASSERSANIERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . 101.1.01 Altlastensanierung an Ort und Stelle – Biologische Reinigungsprozesse sinnvoll nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.1.02 Gefahrstoffe im Visier – Natürliche Abbau- und Rückhalteprozesse erfassen und bewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.1.03 Durchströmte Reinigungswände – Sanierungserfolg durch unterirdische Bauwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.1.04 Zuverlässige Langzeitwirkung – In-situ-Reinigungswand am Standort Rheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.1.05 Funnel-and-Gate – Mit einem neuartigen Reaktorkonzept erfolgreich gegen Schadstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.1.06 Anwendung von Reinigungswänden – Im Einsatz gegen hohe TCE-Konzentrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.1.07 Verbundprojekt SAFIRA – Sanierungsforschung am Modellstandort Bitterfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.1 08 Sauerstoff-Direktgasinjektion – Messung und Modellierung von dynamischen Gasspeichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.1.09 Versuchseinrichtung VEGAS – Ökologisch sanieren ohne Aushub und Abtransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.1.10 Sanierung mit Alkohol – Methoden der Erdölindustrie als Vorbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.1.11 Wärme als Beschleuniger – Heizlanzen machen Bodenschadstoffen Dampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.2 LEBENSADERN ERHALTEN – GANZHEITLICHES UND NACHHALTIGES FLUSSGEBIETSMANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . 341.2.01 Das Elbegebiet – Ein Forschungsmodell für die Flussbewirtschaftung der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.2.02 Untersuchung an Rhein und Ems – Managementsysteme für die Wasserqualität in Flusseinzugsgebieten . . . . . . 381.2.03 Verbundprojekt SEDYMO – Einflüsse der Sedimentdynamik auf die Qualität von Fließgewässern . . . . . . . . . . . . . . . 401.2.04 Der Stör kehrt zurück – Wiedereinbürgerung eines alten Flussbewohners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.3 DURCH INTERNATIONALE KOOPERATIONEN SYNERGIEN SCHAFFEN – INTEGRIERTES WASSERRESSOURCEN-MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.3.01 Wassermangel im Jordantal – Grenzüberschreitende Lösungen finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461.3.02 Deutsch-vietnamesische Kooperation – Forschung für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3.03 Abwasserentsorgung in vietnamesischen Industriezonen – Ein Fall für ganzheitliche Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . 501.3.04 Modellregion Mongolei – Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wassermanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521.3.05 Modellregion Gunung Kidul – Integriertes Wasserressourcen-Management in Karstgebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541.3.06 Beispielregion Shandong – Konzepte gegen vermeidbare Wasserknappheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.3.07 Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen – Bausteine für ein zukunftsfähiges Wassermanagement . . . . 581.3.08 Verbundprojekt WISDOM – Ein Wasser-Informationssystem für das Mekongdelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601.3.09 Integriertes Wasserressourcen-Management – Wissenstransfer durch weltweite Vernetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.4 GEMEINSAM GEGEN DAS HOCHWASSER – ZIELGERICHTETE ANSÄTZE ZUR RISIKOABWEHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641.4.01 Folgen einer Jahrhundertflut – Schadstoffbelastung nach dem Elbehochwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.4.02 Projekt 3ZM-GRIMEX – Gekoppelte Modelle simulieren Hochwasserszenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681.4.03 Hochwasserereignisse – Das vergessene Grundwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701.4.04 Unterschätzte Gefahr Grundhochwasser – Schadensbewertung und -vorsorge nach der Jahrhundertflut . . . . . . . 721.4.05 Deichbrüche vermeiden – Beobachtungsmethoden und Sicherungskonzepte für Flussdeiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741.4.06 Integriertes Warnsystem – Überwachung und Stabilisierung von Deichen mit sensorbasierten Geotextilien . . . 761.4.07 Gebäudesicherung für jedermann – Selbstdichtende Wassersperren für Fenster und Türen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Inhalt
RESSOURCE WASSER2

INHALT 3
2. TECHNOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
2.1 GLOBALE NACHHALTIGKEIT DURCH LOKAL MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN – WIEDERVERWENDUNG UND RESSOURCENEFFIZIENZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1.01 Semizentrale Ver- und Entsorgungskonzepte – Dynamische Lösungen für Chinas wachsende Großstädte . . . . . . 842.1.02 Abwasser als Wertstoff – Das erfolgversprechende Demonstrationsprojekt SANIRESCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.1.03 Haushaltsabwasser im Kreislauf – Das „KOMPLETT“-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882.1.04 Wasserrecycling in Hotels – Umbauten im laufenden Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902.1.05 Phosphorrecycling – Abwasser und Klärschlamm als Quelle eines wertvollen Stoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922.1.06 Vietnam – Sauberes Wasser für das Mekong-Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942.1.07 Sauber und effektiv – Dezentrale Entsorgungssysteme für Hotelanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.1.08 Semi-dezentrales Konzept für ein Neubaugebiet – Das Wasserhaus Knittlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.2 BEWÄHRTE METHODEN UND HIGHTECH-ANALYTIK – MANAGEMENTKONZEPTE FÜR MEHR HYGIENE UND GESUNDHEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.2.01 Trinkwasserquelle Talsperren – Die Vorteile des Membranverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022.2.02 Analysesystem AquaSENS – Schneller und mobiler Nachweis von Wasserverunreinigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1042.2.03 Krankheitserreger in Wasserarmaturen – Ein unterschätztes Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062.2.04 Schwimmbäder – Gesundheitliche Risiken der Beckendesinfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.3 KMU-INNOVATIV – VORFAHRT FÜR SPITZENFORSCHUNG IM MITTELSTAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.4 BEWÄHRTE TECHNOLOGIEN IM AUSLANDSEINSATZ – FORTSCHRITT DURCH WELTWEITEN WISSENSTRANSFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.4.01 Natürlicher Wasserfilter – Die Uferfiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142.4.02 Angepasste Langsamfiltration – Vielseitig und kostengünstig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162.4.03 Exportorientierte Forschung & Entwicklung – Übertragung in andere Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182.4.04 Angepasste Abwassertechnologien – Wissenslücken geschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202.4.05 Wassermanagement in Megastädten – Die Rolle der Datenbasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222.4.06 Übertragbare Lösungen für spezielle Abwasserprobleme – Papierherstellung am Gelben Fluss . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.5 GEMEINSAM FÜR SAUBERE WASSERRESSOURCEN – INTERNATIONALE KOOPERATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.5.01 Angepasste Technologie – Ein unterirdisches Wasserwerk auf Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282.5.02 Olympiade 2008 in Peking – Ein Konzept für die Wassernutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302.5.03 Nitratbelastung im Iran – Wissensexport verbessert die Trinkwasserqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322.5.04 Wassermanagement an der Wolga – Eine Zukunft für Europas längsten Fluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342.5.05 Zum Schutz des Weltnaturerbes Ha Long Bucht – Deutsches Know How für die Bergbausanierung . . . . . . . . . . . . 1362.5.06 Überwachung der Wasserqualität – Neue Messverfahren entwickelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382.5.07 Regenmacher in Israel – Geimpfte Wolken erhöhen die Niederschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402.5.08 Vier Wege, ein Ziel – Desinfektion von Abwasser in China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3. ÖKONOMIE UND BILDUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.1 KOMMUNALE WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT – MIT NACHHALTIGEN KONZEPTEN AUS DER KOSTENFALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.1.01 Von den Besten lernen – Benchmarking in der Abwasserbeseitigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483.1.02 Mit Kennzahlen an die Spitze – Professionell Managen in der Wasserwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.1.03 Abfallentsorgung und Stadtreinigung – Kommunalunternehmen weiter optimieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.2 INTERNATIONALE UMWELTBILDUNG – ZUKUNFT SCHAFFEN DURCH WISSEN UND KOOPERATION . . . . . . . . . . . . 1543.2.01 Lernen aus der Erfahrung Anderer – Fortschritt durch weltweiten Wissensaustausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563.2.02 Neue Perspektiven eröffnen – Nachhaltigkeit in Usbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583.2.03 Internationales Stipendienprogramm – Wissenstransfer und Kontaktaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
GLOSSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Die Ressource Wasser zählt zu den zentralen Faktoren einer globalen nachhaltigen Entwicklung.Sie zu schützen ist eine der wichtigsten Aufgabendes 21. Jahrhunderts. Gemeinsam mit verschiedens-ten Akteuren aus Politik und Wirtschaft erarbeitetdie Wasserforschung zukunftsorientierte Lösungenund trägt gleichzeitig dazu bei, den Wohlstand heutiger und künftiger Generationen zu sichern.
RESSOURCE WASSER4

GRUSSWORT 5
Der weltweite Wasserverbrauch hat sich seit Mitte des 20.Jahrhunderts verdreifacht. Angesichts der wachsendenWeltbevölkerung wird sich diese Tendenz fortsetzen.Betroffen sind nicht nur Schwellen- und Entwicklungslän-der, sondern auch Industrieländer, deren Verbrauch teil-weise die natürlichen Vorräte übersteigt. Um die für denMenschen wichtigste Ressource zu schützen, arbeitenWasserforschung, Politik und Wirtschaft gemeinsam an Lösungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung derWasservorräte.
Ziel ist, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgungsicherzustellen und die Nutzungseffizienz zu steigern.Hierfür brauchen wir technische und strukturelle Innova-tionen sowie einen systematischen nationalen und inter-nationalen Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnis-sen und praktischer Anwendung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) unterstützt im Rahmen der Hightech-Strategie derBundesregierung die Umsetzung grundlegender Innova-tionen in relevanten Anwendungsfeldern. Für das Rah-menprogramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklun-gen“ (FONA) wird das BMBF bis zum Jahr 2015 mehr alszwei Milliarden Euro Fördermittel bereitstellen. Wichti-ger Teil von FONA ist die Wasserforschung, die im neuenBMBF-Förderschwerpunkt „Nachhaltiges Wassermanage-ment“ (NaWaM) umgesetzt werden wird. Damit fördertdas BMBF Verbundforschungsvorhaben mit Partnern ausWissenschaft und Wirtschaft.
Neben dem Austausch von Wissen sollen insbesondereSchwellen- und Entwicklungsländer dabei unterstütztwerden, fachkundiges Personal auszubilden, um somitlangfristig ihre ökologischen Probleme selbst lösen zukönnen. Darüber hinaus haben deutsche Unternehmendie Möglichkeit, mit Innovationen in den Bereichen Was-ser und Umweltschutz noch stärker am Weltmarkt zu par-tizipieren. Auf diese Weise sichern wir die Lebensqualitätder Menschen und fördern zugleich den Wirtschafts-standort Deutschland.
Das vorliegende eBook stellt eine Auswahl abgeschlosse-ner und laufender Forschungsvorhaben des BMBF vor.Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, dass Deutsch-land seine Spitzenposition als Entwicklungspartner undExporteur von Umwelttechnologien ausbauen kann.
Prof. Dr. Johanna WankaBundesministerin für Bildung und Forschung
Eine barrierefreie Version des Artikels finden Sie unter der Adresse http://ressourcewasser.fona.de/reports/bmbf/annual/2010/nb/German/10/gruszwort.html

Wasser ist die Voraussetzung für jedes Leben. Ob inder Landwirtschaft, in der Industrie oder im Haus-halt: Die Ressource spielt im Alltag der Menschenund in der Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Derbewusste Umgang mit Wasser stellt deshalb einezentrale Säule der nachhaltigen Entwicklung dar –und ist gerade durch Klimawandel, Bevölkerungs-wachstum und Trinkwassermangel eine der größtenHerausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Die Förderung von Wasserforschung und -technologienhat entscheidend dazu beigetragen, dass die deutscheWasserwirtschaft und die deutschen Forschungsinstitu-tionen bei der Entwicklung zukunftsorientierter Lösun-gen, die weltweit zum Erhalt und Schutz der Wasserres-sourcen beitragen, international bekannt und anerkanntsind.
Forschung für nachhaltige Entwicklungenund Hightech-Strategie bilden den Programmrahmen
Mit dem BMBF Rahmenprogramm „Forschung für nach-haltige Entwicklungen“ (FONA) und der Hightech-Strate-gie der Bundesregierung trägt das Bundesministerium fürBil dung und Forschung (BMBF) insbesondere im Wasser-be reich den heimischen und weltweiten Herausforderun-gen Rechnung. Die Forschung für ein nachhaltiges Was-ser management steht dabei im Fokus. Die Themen felderdes entsprechenden Förderschwerpunkts „Nach haltigesWassermanagement“ (NaWaM) reichen von innovativenTechnologieansätzen zum Trinkwas serschutz sowie zurVer- und Entsorgung und Methoden des Flussgebiets- undHochwassermanage ments über Konzepte des kostenbe-wussten Wirtschaftens bis hin zu Maßnahmen für deninternationalen Wissenstransfer. Die Wasserforschungerlebt – wie die gesamte Umwelttechnik – seit einigen Jah-ren einen Paradigmenwechsel. Während in der Vergan-genheit die Reaktion auf Probleme und die Entwicklungnachgeschalteter („End-of-Pipe“) Technolo gien im Mittel-punkt stand, liegt der Schwerpunkt von Forschung undTechnologie nun auf vorausschauenden Maßnahmen undder Erarbeitung integrierter Problemlösungsstrategien.
Wasserforschung für Mensch, Natur und Wirtschaft
Auf dem Weg zu einem europäischen Forschungsraum
Um die Forschungsförderung im europäischen Raum zuintensivieren, werden multilaterale Initiativen auf Euro-päischer Ebene unterstützt. Ziel ist es, einen internationalwettbewerbsfähigen europäischen Forschungs- und Tech-nologieraum zu schaffen. So sind beispielsweise in denBereichen Integriertes Flussgebietsmanagement sowieHochwasserschutz und -vorsorge das BMBF und seine Pro-jektträger in die von der EU geförderten ERA-NETs (Euro-pean Research Area-Networks) eingebunden. Durch dieseNetzwerke gelingt es, die Forschungsförderung zu koordi-nieren und abgestimmte Konzepte für die zukünftigeZusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Tech-nologie zu erarbeiten.
Grenzen der Fachdisziplinen überschreiten
Wasserforschung berührt die unterschiedlichsten Wis-sensgebiete und vereint vielfältige Ansätze und Ziele.Lösungen lassen sich in diesem breiten Forschungsfelddeshalb nur finden, wenn die Grenzen von Fachdiszipli-nen und Sektoren überschritten werden, sowie der Dialogintensiviert wird. Wasseringenieure müssen mit Ökolo-gen, Wirt schafts- und Gesellschaftswissenschaftlernzusammenar beiten und zugleich die Anforderungen vonPolitik, Ver waltung und Nutzern im Auge haben.
RESSOURCE WASSER6
Eine barrierefreie Version des Artikels finden Sie unter der Adresse http://ressourcewasser.fona.de/reports/bmbf/annual/2010/nb/German/20/einleitung.html

EINLEITUNG 7
Wasserwirtschaftliche Kompetenz durch Vernetzung
Zu den zentralen Zielen des Rahmenprogramms „For-schung für Nachhaltige Entwicklungen“ unter Federfüh-rung des BMBF gehört es, den Dialog aller wichtigenAkteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesell-schaft zu stärken und im Bereich Wasserwirtschaftgemeinsam neue Wege zu gehen. Deutschland soll so sei-ne Position als Technologieführer in den Bereichen Klima-schutz und Anpassung an den Klimawandel, nachhaltigesRessourcenmanagement sowie innovative Umwelt- undEnergietechnologien erhalten und weiter ausbauen.Gleichzeitig stellt der Umweltsektor einen wichtigenBeschäftigungsfaktor dar. Durch die Ausbil dung desNachwuchses im wissenschaftlichen Bereich und imManagement internationaler Projekte trägt die For-schungsförderung an Universitäten, Forschungsinsti tu-ten, Großforschungszentren und der Industrie wesent lichdazu bei, die wasserwirtschaftliche Kompetenz zu erhal-ten sowie zu verstärken und damit Arbeitsplätze zusichern.
Technik- und Wissenstransfer
Ein besonderes Anliegen des Bundesforschungsministeri-ums ist der Transfer von Wissen aus der Forschung undEntwicklung in die unternehmerische Praxis. BesondereBedeutung kommt hierbei der Erschließung neuer Märktezu. Gerade in der Zusammenarbeit mit Schwellen- undEntwicklungsländern kann ein erfolgreiches Manage-ment der Ressource Wasser neben kurzfristigen Lösungenfür akute Herausforderungen auch langfristige wirkendeEntwicklungen wie Fachkräftemangel und extreme kli-matische Bedingungen berücksichtigen. Der Förder-schwerpunkt Integriertes Wasserressourcen-Manage -ment (IWRM) im Rahmenprogramm Forschung für dieNachhaltigkeit zielt auf die Entwicklung von effizientenMaßnahmen zur Sicherung und Bewirtschaftung derWasserressourcen in zahlreichen Partnerländern, insbe-sondere in Asien, im Nahen Osten sowie in Afrika ab. Umdie Zukunftsfähigkeit von Projekten und Prozessen zuunter stützen, spielen Maßnahmen der Umweltbildungund des Capacity Buildings vor Ort eine wichtige Rolle.
International umsetzen
Viele Technologien haben sich hierzulande bereits in derPraxis bewährt. Nun gilt es, sie in andere Regionen zuübertragen und an die dortigen Gegebenheiten anzupas-sen. Dezentrale Ver- und Entsorgungskonzepte sowie Ver-fahren der Wassergewinnung und -aufbereitung könntenauch in Schwellen- und Entwicklungsländern immermehr Menschen den Zugang zu sauberem Trink wasserermöglichen. Für die Erschließung von Wasservor rätensind Planungsinstrumente notwendig, die bei einerbedarfsgerechten Steuerung des Verbrauchs helfen. Daextreme Wetterereignisse zunehmen, wird auch einvorausschauendes Hochwassermanagement weltweitimmer wichtiger. Weiterhin müssen die jeweiligen Bedin-gungen vor Ort, wie z.B. die Zusammensetzung des Roh-wassers, die Infrastruktur und die kulturellen Unterschie-de, berücksichtigt werden.
Ein Überblick
Die vorliegende Broschüre stellt lau fende und abgeschlos-sene Beispiele der BMBF-Förderung in der Wasserfor-schung dar. Mit den Schwerpunk ten „Ökologie“, „Techno-logie“ sowie „Ökonomie und Bildung“ gibt sie einen Über-blick über Ideen und Ergebnisse, die deutscheHochschulen und Institute zusammen mit der Wirtschaftund internationalen Part nern hervorgebracht und umge-setzt haben.

Ökologie
8 RESSOURCE WASSER | 1.0
Eine barrierefreie Version des Artikels finden Sie unter der Adresse http://ressourcewasser.fona.de/reports/bmbf/annual/2010/nb/German/30/1_-oekologie.html

9
Wasser ist Ursprung und Grundlage allen Lebens – ein kostbares Gut, welches in vielen Regionen dieserErde durch menschliche Einflussnahme zunehmend gefährdet ist. Umso wichtiger sind ein nachhaltigerUmgang und Schutz der Wasserressour cen. Mit zahlreichen Forschungsprojekten, von der Renaturierungheimischer Flussgebiete über biologische Sanierungsverfahren von Boden und Grundwasser bis hin zumHochwasser-Management arbeitet das BMBF auf dieses Ziel hin. Im Rahmen des integrierten Wasserres-sourcen-Managements werden dabei soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte in Ein klanggebracht.
ÖKOLOGIE

10 RESSOURCE WASSER | 1.1.0
Einsatz im Untergrund – Effiziente In-situ-Methoden zur Grundwassersanierung

Giftige Substanzen, die unter aufgelassenen, nichtabgedichteten Mülldeponien austreten, umfang-reiche Verunreinigungen auf dem Gelände und imBoden längst geschlossener Industriebetriebe, groß-flächige Kontaminationen durch Sprengstoffe undWaffeneinwirkungen: Beispiele für gefährliche Alt-lasten im Boden, die auch eine Bedrohung für dieQualität des Grundwassers darstellen, gibt es zuhauf.Oft weiß niemand, wo genau die Altlasten sich ver-bergen, weil Gefahrstoffe unzureichend entsorgtwurden oder es keine Zeitzeugen mehr gibt. Trotzdieser schwierigen Ausgangslage gelingt es Wissen-schaftlern zunehmend, Altlasten aufzuspüren, zubewerten und mit neuen Methoden – noch imUntergrund („in situ“) – unschädlich zu machen,bevor diese das Grundwasser erreichen. Dies ist einnotwendiger Schritt, denn rund 70 Prozent desTrinkwassers in Deutschland wird aus Grundwassergewonnen.
Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Län-der der Erde. Dies und die unkontrollierte Ablagerung vonSchadstoffen in der Vergangenheit sowie die intensiveNutzung der Grundwasser- und Bodenressourcen führtenzu einer hohen Zahl von Altlasten und Altlastenverdachts-flächen. Angesichts der 2009 erfassten rund 296.500 alt-lastenverdächtigen Flächen in Deutschland wird dieDimension des Handlungsbedarfs bei der Altlastensanie-rung deutlich. An vielen ehemaligen und noch genutztenIndustriestandorten finden sich Altlasten im Untergrund.Sie zu detektieren und effizient zu sanieren stellt eineanspruchsvolle Aufgabe dar.
Im Rahmen des Programms „Forschung für NachhaltigeEntwicklungen“ hatte das Bundesministerium für Bildungund Forschung (BMBF) dieses Thema erneut aufgegriffen.Es unterstützte ausgewählte Forschungs- und Entwick-lungsvorhaben zur Lösung des Altlastenproblems. Ein Ziel bestand darin, modellhafte und übertragbare Beispiellösungen zu entwickeln.
Reinigung direkt im Grundwasser
Erfolg verspricht der Ansatz, Grundwasser und Boden „insitu“ zu behandeln, also Schadstoffe direkt im Untergrundunschädlich zu machen. Ob Nährstoffzugabe, Gasinjekti-on (Projekt 1.1.08) oder Einbringen von Mikroorganismen– die Palette der In-situ-Verfahren, die Forscher und Inge-nieure in Deutschland (weiter-)entwickeln und erproben,ist technologisch anspruchsvoll und vielfältig. Von Vorteil
sind die in der Regel niedrigeren Kosten der Vor-Ort-Ver-fahren. Gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweisemuss das kontaminierte Grundwasser oder Bodenmateri-al nämlich nicht gehoben und in oberirdischen Anlagenbehandelt werden.
Grundwassersanierung als prioritäre Aufgabe
Die Entwicklung effizienter Sanierungsverfahren hat inDeutschland einen hohen Stellenwert. Die Optimierungdieser Technologien im Hinblick auf Praxistauglichkeitund Übertragbarkeit wird in zahlreichen Vorhaben voran-getrieben. Beispiele hierfür sind folgende vom BMBFgeförderte Verbundprojekte:
Ob und wie sich die Altlastensanierung durch natür-liche Reinigungsprozesse verbessern lässt, wurde imRahmen des Förderschwerpunkts KORA („Kontrollier-ter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffenbei der Sanierung kontaminierter Grundwässer undBöden“) geprüft (Projekte 1.1.01 und 1.1.02).Speziell für die Entwicklung von In-situ-Reinigungs-wänden hat das BMBF im Mai 2000 den Forschungs-verbund RUBIN („Anwendung von durchströmten Rei-nigungswänden für die Sanierung von Altlasten/Reini-gungswände und -barrieren im Netzwerkverbund“)ins Leben gerufen (Projekte 1.1.03, 1.1.05 und 1.1.06).SAFIRA („Sanierungsforschung in regional kontami-nierten Grundwasseraquiferen“). Die gleichnamigeGroßversuchseinrichtung ging 1999 in Bitterfeld inBetrieb, um neue Technologien und Methoden zur In-situ-Sanierung von Grundwasser zu erforschen, das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist(Projekt 1.1.07). Zur Entwicklung innovativer Sanierungsmethodenwurde auch die vom BMBF und dem Land Baden-Württemberg geförderte „Versuchseinrichtung zurGrundwasser- und Altlastensanierung“ (VEGAS)errichtet, die Experimente unter naturnahen Bedin-gungen ermöglicht (Projekte 1.1.09, 1.1.10, 1.1.11).
ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER 11

Die Praxis hat gezeigt, dass herkömmliche Sanie-rungsverfahren oft an technische oder finanzielleGrenzen stoßen, sodass Verunreinigungen vonBöden und Gewässern nicht vollständig behobenwerden können. Unterstützung versprechen hiernatürliche Schadstoffminderungsprozesse. Ob undwie sie in der Altlastensanierung genutzt werdenkönnen, wurde im Rahmen des BMBF-Förderschwer-punktes „Kontrollierter natürlicher Rückhalt undAbbau von Schadstoffen bei der Sanierung kontami-nierter Grundwässer und Böden“ (KORA) von 2002bis 2008 untersucht.
In der Vergangenheit wurden immer mehr Standortebekannt, die aufgrund früherer Produktions- und Lagertä-tigkeiten mit gesundheits- und umweltschädlichen Stof-fen verunreinigt sind. Bislang wurden derartige Altlastendadurch saniert, dass das verunreinigte Erdreich ausgeho-ben und entsorgt beziehungsweise das belastete Grund-wasser abgepumpt und anschließend aufbereitet wurde.Alternativ kann durch Sicherungsmaßnahmen eine weitere Ausbreitung der Schadstoffe verhindert werdenoder eine Behandlung (Dekontamination) mithilfe chemi-scher oder biologischer Mittel erfolgen. Diesen herkömm-lichen Sanierungsverfahren sind aber beispielsweisedurch tiefe Grundwasserleiter , heterogene Untergrund-verhältnisse oder überbaute Flächen sowie durch die Artder Schadstoffe und deren oft ungleichmäßige Verteilungtechnisch wie ökonomisch Grenzen gesetzt.
Auf die natürlichen Prozesse bauen
An zahlreichen Standorten wurde festgestellt, dass natür-lich ablaufende Prozesse, wie biologischer Abbau, chemi-sche Fällung , Zersetzung, Sorption , Verdünnung undVerflüchtigung die Schadstoffe in Grundwässern undBöden unter günstigen Bedingungen unschädlichmachen oder zurückhalten können. So dehnen sichSchadstofffahnen im Grundwasser nur begrenzt aus undschrumpfen mit dem Versiegen der Schadstoffquelle. Füreinen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen hatdie Erforschung, Bewertung und letztlich die gezielte Nutzung dieser Prozesse eine hohe Bedeutung.
Altlastensanierung an Ort und Stelle – Biologische Reinigungsprozesse sinnvoll nutzen
Systematische Untersuchungen an 24 Referenzstandorten
Der natürliche Rückhalt und Abbau von Schadstoffenhängt von der Art der Kontamination sowie von denBedingungen in Boden und Grundwasser ab. Um bewer-ten zu können, ob natürliche Schadstoffminderungspro-zesse (sogenannte Natural-Attenuation-(NA)-Prozesse) aneinem Standort genutzt oder stimuliert werden können,sind einige wichtige Fragen zu beantworten:
Werden die Schadstoffe unter den vorherrschendenBedingungen im Untergrund durch natürliche Prozes-se effektiv zerstört oder zurückgehalten?Reichern sich bei einem biologischen Abbau eventuell(unerwünschte) Zwischenprodukte an? Lässt sich der Abbau durch die gezielte Veränderungder Milieubedingungen stimulieren?
Die vielfältigen Fragestellungen im Zusammenhang mitNA-Prozessen waren für das BMBF Anlass, im Zeitraum von2002 bis 2008 den Förderschwerpunkt „Kontrollierternatürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen beider Sanierung kontaminierter Grundwässer undBöden“ (KORA) mit etwa 20 Millionen Euro zu unterstützen.An 24 branchentypisch verunreinigten Standorten, diestellvertretend für eine Vielzahl vergleichbarer Schadens-fälle in Deutschland stehen, wurde in insgesamt 74 Projek-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0112
Übersicht über die Themenverbünde (TV) und Arbeitshilfen des Förderschwerpunktes KORA
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
Bezeichnung des Themenverbundes(Branchenspezifische Schadstoffe)
Raffinerien, Tanklager, Kraftstoffe/Mineralöl(MKW, BTEX, MTBE)
Gaswerke, Kokereien, Teerverarbeitung(PAK, Teeröle, Heterozyklen)
Chemische Industrie(LCKW, BTEX)
Deponien, Altablagerungen(Deponiebürtige Schadstoffe)
Rüstungsaltlasten(Sprengstofftypische Verbindungen)
Bergbau, Sedimente(Spurenmetalle, Acidität/Sulfat, Pestizide)
Modellierung und Prognose
Ableitung von MNA-Konzepten, Rechtlicheund ökonomische Aspekte, öffentliche undbehördliche Akzeptanz
Untersuchte Standorte
5
4
6
4 (+ 2)+
3
2 (+ 1)+
–
–
Kurzname der Arbeitshilfe
Leitfaden TV 1(ISBN 978-3-89746-093-9)
Leitfaden TV 2(ISBN 978-3-934253-50-6)
Leitfaden TV 3(ISBN 978-3-00-026094-0)
Leitfaden TV 4(ISSN 1611-5627, 04/2008)
Leitfaden TV 5(ISBN 978-3-00-025181-8)
Leitfaden TV 6(ISBN 978-3-89746-098-X)
Synopse des TV 7(ISSN 1611-5627, 05/2008)
Handlungsempfehlungenmit Methodensammlung(ISBN 978-3-89746-092-0)
+ Weitere Standorte wurden im Rahmen assoziierter Projekte untersucht

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | ALTLASTENSANIERUNG AN ORT UND STELLE 13
ten geprüft, ob und unter welchen Randbedingungennatürliche Abbau- und Rückhalteprozesse berücksichtigtbeziehungsweise effektiv genutzt werden können – undzwar bei der
Bewertung von Gefahren, die von schadstoffbelaste-ten Grundwässern und Böden ausgehen können, Bemessung und Durchführung von Gefahrenabwehr-maßnahmen (konkrete Sanierung),Bemessung und Durchführung von Nachsorgemaß-nahmen.
Um zu beurteilen, ob die natürliche Schadstoffminderunggenutzt werden kann, beziehungsweise um die Wirksam-keit zu überwachen, müssen regelmäßig Boden- undGrundwasserproben untersucht werden (Monitored Natu-ral Attenuation, MNA). Die Nutzung von NA-Prozessen istdemzufolge keine „Option zum Nichtstun“. Im Gegenteil:Nur wenn durch eine solide Datenerhebung (Monitoring)und -beurteilung (Prognose) eindeutig belegt ist, dass dieerwarteten Prozesse effektiv ablaufen, ist die natürlicheSchadstoffminderung eine Alternative oder Ergänzung zuherkömmlichen Sanierungsverfahren.
Schadstoffbezogene Forschung
Die Forschungsarbeiten von KORA hatten zum Ziel,Grundlagen zur Berücksichtigung natürlicher Schadstoff-minderungsprozesse zu schaffen und die ökologisch, öko-nomisch sowie verwaltungsrechtlich sinnvollen Einsatz-möglichkeiten und -grenzen zu ermitteln. Dazu musstennicht nur die entsprechenden Methoden zum Nachweisder NA-Prozesse entwickelt, sondern auch die Werkzeugezu ihrer Bewertung validiert werden. Universitäten, Inge-nieurbüros und Behörden haben gemeinsam jeweils amEinzelfall orientierte MNA-Konzepte für die 24 untersuch-ten Standorte erarbeitet, die in vielen Fällen auch zur Anwendung gekommen sind. Damit schufen sie Referenz-standorte, an deren Beispiel gezeigt werden kann, wie NA-Prozesse in einem abgestuften Verfahren erfasst, bewertet und berücksichtigt werden können. Weiter entwickelten die Experten innovative In-situ-Sanierungs-verfahren, die auf einer Stimulierung der natürlichenSchadstoffminderungsprozesse basieren. Außerdemuntersuchten sie diverse Maßnahmen, welche die Akzep-tanz von NA-Prozessen in der Altlastensanierung durch(Risiko-)Kommunikation fördern sollen.
Branchenleitfäden und Handlungsempfehlungen für die Praxis
Die Ergebnisse des Förderschwerpunkts sind in den KORA-Handlungsempfehlungen (mit integrierter Methoden-sammlung), in sechs Branchenleitfäden und in der KORA-Synopse „Systemanalyse, Modellierung und Prognose derWirkungen natürlicher Schadstoffminderungsprozesse“dokumentiert worden (siehe Tabelle). Damit stehen für dieBehördenvertreter, die Planer in den Ingenieurbüros unddie Sanierungspflichtigen verschiedene, sich ergänzendeArbeitshilfen zur Verfügung. Mit ihnen können sie dieEinsatzmöglichkeiten von NA-Prozessen und MNA-Kon-zepten in der Altlastenbearbeitung prüfen. Die Arbeitshil-fen geben Empfehlungen und Hilfestellungen zum Ein-satz von überwachten oder stimulierten natürlichenSchadstoffminderungsprozessen bei der Altlastenbearbei-tung in Deutschland und widmen sich den NA-Prozessenim bereits verunreinigten Grundwasser. Vorliegende undrelevante (inter-)nationale Arbeitshilfen, Konzepte undLeitfäden wurden bei der Erstellung der Handlungsemp-fehlungen und Branchenleitfäden berücksichtigt. DieArbeitshilfen können über die Internetseite des Förder-schwerpunkts (www.natural-attenuation.de/ bestellung)bezogen werden oder stehen als pdf-Dateien zumDownload zur Verfügung.
Projekt-Website www.natural-attenuation.de
DECHEMA e. V.Dr. Jochen Michels, Christopher FreyTheodor-Heuss-Allee 2560486 FrankfurtTel.: 0 69/75 64-157, -440Fax: 0 69/75 64-117E-Mail: [email protected], [email protected]örderkennzeichen: 02WN0335
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau, VEGASDr.-Ing. Hans-Peter KoschitzkyPfaffenwaldring 6170650 StuttgartTel.: 07 11/6 85-647 17Fax: 07 11/6 85-670 20E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WN0336

Das ehemalige Gelände einer chemischen Reinigungfür Lederberufskleidung im niedersächsischen Land-kreis Harburg wurde jahrzehntelang mit Perchlor-ethylen kontaminiert. Da sich das Grundwasser ingroßer Tiefe befindet und der verunreinigte Unter-grund nur sehr schwer zugänglich ist, sind herkömm-liche Erkundungs- und Sanierungsverfahren für dieseAltlast nicht geeignet. Ein Projekt aus dem Förder-schwerpunkt KORA („Kontrollierter natürlicher Rück-halt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierungkontaminierter Grundwässer und Böden“) hatte deshalb das Ziel, mittels geeigneter Monitoring- und Prognoseverfahren abzuschätzen, inwieweit die natürlichen Abbau- und Rückhalteprozesse imUntergrund ausreichen, um Gefahren für ein angren-zendes Wasserschutzgebiet auszuschließen.
Perchlorethylen (PCE) wurde und wird in Industrie undGewerbe zum Entfernen von Farbe, als Lösungsmittel undzur Entfettung von Materialien eingesetzt – auch in einemehemaligen Spezialbetrieb zur chemischen Reinigungvon Lederberufskleidung in Rosengarten-Ehestorf, Land-kreis Harburg. Nach Gebrauch wurde die Chemikalie überJahrzehnte mit dem unvollständig gereinigten Abwasserin den Untergrund des rund 3.000 Quadratmeter großenFirmengeländes verrieselt.
Grundwasserleiter unzugänglich
Die Oberfläche des betroffenen Grundwasserleiters liegtmit rund 30 bis 40 Metern unter der Erdoberfläche unge-wöhnlich tief. Mit einer Erstreckung bis in 230 Metern Tiefeist er außerdem äußerst mächtig. Diese Faktoren machen –in Kombination mit der engen Wohnbebauung – eine Sa-nierung mit herkömmlichen Methoden (Pump-and-Treat-Verfahren ) schwierig und kostspielig. Die Behörden desLandkreises Harburg suchten deshalb nach Alternativenund entschieden sich für die Teilnahme am BMBF-Förder-schwerpunkt KORA. Im Zuge des von 2003 bis 2006 durch-geführten Projekts „Feldmaßstäbliche Quantifizierungdes NA-Potenzials in mächtigen Grundwasserleiternmit hohem Flurabstand – Beispiel: CKW-Schaden, Che-mische Reinigung in Rosengarten-Ehestorf“ ermitteltendie Projektpartner den Umfang der im Boden ablaufen-den natürlichen Schadstoffminderungsprozesse (NaturalAttenuation, NA) seit Schadenseintritt und schätzten denweiteren Verlauf ab. Zu den Projektpartnern gehörten derLandkreis Harburg, das Institut für Gewässerschutz und
Gefahrstoffe im Visier – Natürliche Abbau- und Rückhalteprozesse erfassen und bewerten
Umgebungsüberwachung in Kiel, das Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie in Hannover sowie dasTübinger Grundwasser-Forschungsinstitut.
Um das Verhalten der Schadstofffahne und die natürli-chen Abbau- und Rückhalteprozesse im Untergrund zuquantifizieren, musste zunächst der PCE-Eintrag und des-sen Ausbreitung erfasst werden. Zur genauen Eingren-zung des Schadensherdes und des davon ausgehendenAustrags wurden zusätzliche Messstellen eingerichtet unddie bestehenden umgerüstet.
Innovative Systeme zur Entnahme von Bodenluft- und Grundwasserproben
Die Beprobung des Grundwassers mittels konventionellerBrunnen ist unter den gegebenen Standortverhältnissenäußerst kostspielig, weshalb nur fünf dieser Brunnengebaut wurden. Weitere Probenahmen, vor allem aberdie Standorterkundungen, führten die Experten mithilfe
RESSOURCE WASSER | 1.1.0214
Ein Direct-Push-Sondiergerät im Einsatz

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | GEFAHRSTOFFE IM VISIER 15
des sogenannten Direct-Push-Verfahrens durch. Dieseneuartige Bohrmethode ist eine schnellere, flexiblere undwesentlich kostengünstigere Alternative zu den her-kömmlichen Verfahren. Um auch die notwendigen größe-ren Tiefen im Untergrund zu erreichen, wurde das Direct-Push-Verfahren im Projekt weiterentwickelt. Außerdembauten die Wissenschaftler die Brunnen zu sogenanntenMultilevel-Messstellen aus, um dauerhaft Bodenluft- undGrundwasserproben aus verschiedenen Tiefen entneh-men zu können. Mit diesem neuartigen Verfahren gelanges, die vertikale Verteilung der Schadstoffe genau zu ana-lysieren. Als schwierig erwies sich dagegen, die horizontaleSchadstoffausbreitung mittels Pumpversuch an den Brun-nen zu ermitteln. Der undurchlässige Boden ließ keineRückschlüsse auf die gesamte Breite der Schadstofffahne zu.
Kontinuierlicher PCE-Eintrag
Wichtige Ergebnisse der Erkundung: In einer Bodentiefevon fünf bis zehn Metern unter der Erdoberfläche maßendie Wissenschaftler die höchsten PCE-Konzentrationen.Sie stellten fest, dass der Boden laufend PCE ins Grundwas-ser abgibt. Allerdings nimmt die Menge im Laufe der Zeitkontinuierlich ab, bis der Austrag schließlich vollständigzum Erliegen kommt. Weil der Schadstoff überwiegendmit dem Sickerwasser ins Grundwasser gelangt, wird dieaktuelle und künftige Menge der ausgetragenen Schad-stoffe und damit auch die Lebensdauer des Schadensherdeserheblich von der Niederschlagsmenge beeinflusst. ImSchnitt beträgt der Gesamtaustrag über die nicht versiegelteOberfläche des Firmengeländes bis zu neun Gramm proTag, wovon über sieben Gramm ins Grundwasser gelan-gen können. Der Rest verflüchtigt sich in die Atmosphäreund wird dort zu unproblematischen Stoffen abgebaut.
Modellierung des Schadstofftransports
Um den künftigen Eintrag von Schadstoffen in das Grund-wasser quantitativ abzuschätzen, bediente sich das Pro-jektteam sogenannter Transportmodelle. Mit deren Hilfespielte es verschiedene Varianten der Schadstoffausbrei-tung seit dem angenommenen Schadenseintritt vor rund40 Jahren durch. Nach den wahrscheinlichsten Szenarien,die durch den Abgleich mit den Messergebnissen imGelände ermittelt wurden, ist die PCE-Verschmutzungs-fahne im Grundwasserleiter seit etwa 20 bis 25 Jahren stabil und nahezu unverändert. Ihre Länge beträgt lautBerechnungen zwischen 400 und 500 Meter. Die zum Teil
sehr heterogenen Messergebnisse an den vorhandenenMessstellen lassen überdies darauf schließen, dass es sichnicht nur um eine einzelne, sondern um eine in zwei odermehr Zweige geteilte Schadstofffahne handeln könnte.
In rund 40 Jahren Schadensherd „sauber“
Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Schadstoff-quelle – also das PCE, das sich über dem Grundwasserleiternoch im Boden befindet – in rund 40 Jahren vollständigverschwunden sein wird. Die PCE-Fahne im Grundwasserwird sich aufgrund der dort ablaufenden natürlichenAbbauprozesse zeitversetzt vollständig abbauen.
Diese Aussagen sind für eine rechtliche Bewertung derNutzung von Natural Attenuation unabdingbar. Sieermöglichen es den Behörden, ohne Risiko auf die sehrteuren und häufig nur wenig effizienten aktiven Sanie-rungsmaßnahmen zu verzichten. Das am Standort Rosen-garten entwickelte Vorgehen zur Erkundung und Beurtei-lung der Schadenssituation hat insgesamt gezeigt, dassEntscheidungen, ob und in welchem Umfang eine natürli-che Schadstoffminderung stattfindet, auch für tiefeGrundwasserleiter mit einer ausreichenden Sicherheitgetroffen werden können.
Landkreis Harburg (Abteilungsleiter Boden/Luft/Wasser)Gunnar PeterPostfach 144021414 Winsen/LuheTel.: 0 41 71/6 93-4 02Fax.: 0 41 71/6 93-1 75E-Mail: [email protected]: www.landkreis-harburg.deFörderkennzeichen: 02WN0437

Grundwasser ist eine besonders wichtige und gleich-zeitig sensible Ressource für die Trinkwasserversor-gung. Häufig genügen schon geringste Schadstoff-mengen, um Tausende Liter Wasser für den Men-schen ungenießbar zu machen. Um belastetesGrundwasser zur Reinigung nicht mehr an die Ober-fläche pumpen zu müssen, konzentrieren sich For-scher auch in Deutschland seit einigen Jahren ver-stärkt auf sogenannte In-situ-Verfahren, das heißtTechnologien, die direkt im Grundwasserleiterangewandt werden. Als Impuls für die Neu- und Wei-terentwicklung sogenannter durchströmter Reini-gungswände in Deutschland unterstützt das BMBFseit 2000/2001 den Forschungsverbund RUBIN.
Die Reinigung von schadstoffbelastetem Grundwasser istsehr aufwendig. Die meisten Sanierungen werden als akti-ve Verfahren nach der Pump-and-Treat-Methode durch-geführt. „Aktiv“ heißt: Das Wasser wird an die Oberflächegefördert und dort in nachgeschalteten Anlagen behan-delt. Dies verursacht hohe Kosten. Da das Wasser danachhäufig in die Kanalisation geleitet wird, entstehen durchdie Einleitgebühren weitere Kosten.
Sanierung im Grundwasserleiter
In den vergangenen Jahren wurde daher intensiv an derEntwicklung und Erprobung passiver In-situ-Sanierungs-technologien mittels durchströmter Reinigungswändegearbeitet. Diese werden in den Grundwasserabstrom vonSchadensherden eingebaut, um Schadstoffe direkt imGrundwasserleiter zu eliminieren. Dadurch spart mandank eines einzigen neuen Verfahrens sowohl Kosten fürdas Pumpen des Grundwassers als auch Einleitgebühren.In der Praxis kamen bisher vor allem zwei Technologie-varianten zum Einsatz: die vollflächig durchströmte Reinigungswand und das sogenannte Funnel-and-Gate-System, bei dem das Grundwasser über Leitwände (Funnel)einem durchströmbaren Reaktionsbereich (Gate) zugelei-tet wird.
Bei der vollflächig durchströmten Wand wird ein Graben,der bis in die grundwasserführenden Schichten reicht, mitreaktivem Material verfüllt. Dafür wird meist elementaresEisen bzw. Aktivkohle verwendet. Das belastete Grund-wasser durchströmt die durchlässige Barriere, wobei dieSchadstoffe am reaktiven Material, das wie ein Filter wirkt,zurückgehalten beziehungsweise abgebaut werden.
Durchströmte Reinigungswände – Sanierungserfolg durch unterirdische Bauwerke
Die Technologie der durchströmten Reinigungswändewurde bisher vor allem in Nordamerika vorangebracht. In Deutschland gab es wenig praktische Erfahrungen mitReinigungswänden.
RUBIN – Das Projekt
In dem vom BMBF geförderten Forschungsverbund„Anwendung von durchströmten Reinigungswändenfür die Sanierung von Altlasten/Reinigungswände und-barrieren im Netzwerkverbund” (RUBIN) arbeitetenUnternehmen der gewerblichen Wirtschaft und For-schungseinrichtungen bundesweit an verschiedenenStandorten eng und interdisziplinär zusammen. DieHauptaufgabe bestand darin, die Potenziale und Anwen-dungsgrenzen sowie die Umweltverträglichkeit und Wirt-schaftlichkeit durchströmter Reinigungswände an einergrößeren Zahl von Standorten in Deutschland in koordi-nierter Form detailliert und übergreifend zu untersuchen.Ein wichtiges Ziel des Forschungsverbundes war es dabei,verallgemeinerungsfähige Kriterien für die Anwendungdurchströmter Reinigungswände zu erarbeiten, wie
Auslegung, Konstruktion, Bau und Betrieb;Leistungsfähigkeit und Langzeitverhalten (Schadstoff-abbau, auch bei Mischkontaminationen/Reaktorsyste-me und reaktive Reaktor-Füllmaterialien);Einsatzrandbedingungen und -grenzen sowieÖkonomie (Verfahrenskosten) und Ökologie (Umwelt-verträglichkeit).
RESSOURCE WASSER | 1.1.0316
Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-gungswand (Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | DURCHSTRÖMTE REINIGUNGSWÄNDE 17
Ergebnisse für die Praxis
In sechs standortbezogenen Vorhaben wurden Langzeit-verhalten, Abbauleistung sowie Materialveränderungen,Stoffumsatzprozesse, Reinigungswandsysteme, Reaktor-füllmaterialien und das Monitoring untersucht.
In einem weiteren Arbeitsschwerpunkt wurden von Mitar-beitern der Universität Kiel im Rahmen des Verbundpro-jekts RUBIN Qualitätsmanagementregeln aufgestellt underprobt, die künftig eine zuverlässige Planung, Errichtungund Überwachung von Reinigungswänden in standardi-sierter Form ermöglichen. Ferner verglichen Experten derUniversität Tübingen die Wirtschaftlichkeit der Methodemit konventionellen Sanierungsverfahren. Diese Studiengestatten es, den Anwendern dieser neuen Technologiekünftig einen vertieften Kostenvergleich vorzunehmen.
Die Qualitätsmanagementregeln und Wirtschaftlichkeits-betrachtungen sind ebenso wie die Gesamtergebnisse des Verbundes integrale Bestandteile des Handbuchs„Anwendung von durchströmten Reinigungswänden zurSanierung von Altlasten“, das die wichtigsten Ergebnisseund gewonnenen Erkenntnisse des Projekts dem interes-sierten Leser zur Verfügung stellt. Es wurde von der Ostfa-lia Hochschule, der Koordinierungsstelle des RUBIN-Ver-bundes, federführend erstellt und soll vor allem Anwen-dern – zum Beispiel Behörden, Sanierungspflichtigen,Planern und Umwelttechnologieanbietern – als allge-meingültige Orientierungshilfe dienen.
In weitergehenden Untersuchungen überprüften die Wis-senschaftler die Ergebnisse und Erkenntnisse an techni-schen Versuchspilotanlagen; Planung, Bau und Versuchs-betrieb wurden dabei umfassend begleitet. Resultierenddaraus konnte die Technologie in die Marktreife überführtund in der Grundwassersanierungspraxis in Deutschlandeingeführt werden. Die Förderung des BMBF ermöglichtees somit, eine neue, wirtschaftlichere und umweltscho-nendere Methode zur Schadstoffbeseitigung direkt imGrundwasser – eine der wichtigsten Trinkwasserressour-cen hierzulande – bis zur Praxisreife zu entwickeln unddamit den Umwelttechnologiestandort Deutschland zustärken.
Projekt-Website www.rubin-online.de
Ostfalia – Hochschule für angewandte WissenschaftenFakultät Bau-Wasser-BodenProf. Dipl.-Ing. Harald BurmeierProf. Dr. Volker BirkeHerbert-Meyer-Straße 729556 Suderburg Tel.: 0 58 26/9 88-6 11 40, -6 15 60E-Mail: [email protected]@ostfalia.deFörderkennzeichen: FZK 0271241 und 02WR0828
Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-gungswand (Quelle: Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)

Reinigungswände (Reaktive Wände) sind ein vielver-sprechender Ansatz, um kontaminierte Grundwas-serleiter zu sanieren oder zu sichern. Im nordrhein-westfälischen Rheine wurde 1998 im Pilotmaßstabdie erste vollflächig durchströmte Reaktionswand inDeutschland in einem mit chlorierten Kohlenwasser-stoffen belasteten quartären Grundwasserleiterinstalliert (DBU-Projekt). In einem anschließend vomBMBF geförderten, weitergehenden Forschungs-und Entwicklungsprojekt untersuchten Partner ausWissenschaft und Wirtschaft gemeinsam das Lang-zeitverhalten der Reinigungswand und inwieweitsich Eisen dort als reaktives Material nutzen lässt.
Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hanno-ver, errichtete im Juni 1998 mit Förderung durch die Deut-sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine Grundwasserrei-nigungswand im Feldmaßstab, um mit leichtflüchtigenhalogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) wie Tetra-chlorethen (PCE) oder Trichlorethen (TCE) belastetesGrundwasser zu reinigen. Dabei diente ein neues porösesnullwertiges Eisen (Fe0), „Eisenschwamm“ genannt, alsreaktives Material.
Schadstoffe aus einer Wäscherei
Die Reaktionswand wurde nach etwa 700 Metern imAbstrom einer massiven Kontamination des Untergrundsmit PCE errichtet. Verursacher der Verunreinigung isteine ehemalige Wäscherei. Bei der Reinigungswand han-delt es sich um ein etwa sechs Meter tiefes, 22,5 Meter lan-ges, 88 Zentimeter dickes, vollflächig von kontaminier-tem Grundwasser durchströmtes Wandbauwerk. Es ist biszu einer Höhe von rund 3,5 Metern, also oberhalb desmaximal zu erwartenden Grundwasserstands, mit zweireaktiven Materialien gefüllt. Dabei handelt es sich umeinen Eisenschwamm der MITTAL Steel Hamburg GmbH(früher ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH) sowie einGemisch aus 70 Prozent Perlkies und 30 Prozent Grauguss-eisengranulat der Firma Gotthart Meier AG aus Rheinfel-den. Die Aufteilung in zwei Segmente dient dazu, das Ver-halten der Materialien zu vergleichen. Auf diese Weisewird seit 1998 der Schadstoff PCE in einer Konzentrationvon mehreren 1.000 Mikrogramm pro Liter zu über 99 Pro-zent zuverlässig abgebaut.
Zuverlässige Langzeitwirkung – In-situ-Reinigungswand am Standort Rheine
Studien zur Langzeitwirkung
Neben dieser Aktivität wird die Anlage für verschiedeneLangzeituntersuchungen genutzt. Die Projekte „Vorunter-suchungs-, Monitoring- und Qualitätsmanagementfür Reaktionswände“ (Christian-Albrechts-UniversitätKiel), „Auswertung zum Langzeitverhalten einer Eisen-reaktiven Wand am Beispiel des Standortes Rheine“(Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH) und „Bio-logische Prozesse in einer reaktiven Eisenwand“ (TUBerlin) wurden durch das BMBF gefördert. Ziel der For-schungsaktivitäten war es, das Langzeitverhalten der Reinigungswand zu beobachten und ein Monitoring-programm zu entwickeln, um die geochemischen, hydro-geologischen und biologischen Prozesse in und im Umfeldder Fe0-Reinigungswand zu untersuchen.
Zuverlässig seit vielen Jahren
Seit nunmehr über zehn Jahren gewährleistet die Reak-tionswand Rheine eine stete Reinigung des Grundwassers,wobei die beiden unterschiedlichen Materialien verschie-dene Reinigungsleistungen erzielen. Die Grundwasserun-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0418
Vertikalaufbau der Reinigungswand am Standort Rheine

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | IN-SITU-REINIGUNGSWAND RHEINE 19
tersuchungen zeigten, dass der Eisenschwamm in den ers-ten sechs bis zwölf Monaten nach der Installation eine Rei-nigungsleistung von rund 70 bis 80 Prozent erbrachte.Danach stieg sie auf mehr als 99 Prozent. Seit mehrerenJahren liegen die im Abstrom bestimmten LHKW-Konzen-trationen nun unterhalb von zehn Mikrogramm pro Liter.
Die LHKW-Konzentrationen im Abstrom des mit derMischung aus Graugusseisengranulat und Perlkies ver-füllten Abschnitts der Reinigungswand entwickelten sichanders. Hier wurden anfänglich sehr gute Reinigungsleis-tungen von über 99 Prozent erzielt. Nachdem die Reakti-onswand etwa acht bis zwölf Monate in Betrieb war, wur-den nur noch rund 80 Prozent der einströmenden LHKW-Gehalte abgebaut. Diese Reinigungsleistung blieb bisheute nahezu konstant. Übereinstimmend mit den Ergeb-nissen aus Kernbohrungen konnten die Wissenschaftlereine teilweise Entmischung von Kies und Eisen als Ursachefür die verminderte Abbauleistung in diesem Abschnittder Reinigungswand erkennen.
Sowohl Strömungsmodellierungen als auch Pump- undTracer-Versuche zeigten deutlich, dass die Durchströ-mung der Reinigungswand gewährleistet ist und sie nichtum- oder überströmt wird. Außerdem konnten die Exper-ten belegen, dass sich in der Betriebszeit hydraulische Ver-änderungen durch Präzipitate oder Gasbildung in derReinigungswand eingestellt haben.
Biologische Aspekte
Die Wissenschaftler der TU Berlin wiesen im Rahmen desProjekts weiterhin nach, dass in den beiden verwendetenEisenmaterialien nach einigen Jahren Bakterien auftre-ten. Durch die Beschreibung der biologischen Aktivitäten
aller relevanten physiologischen Bakteriengruppen konn-ten grundlegende Erkenntnisse zur mikrobiellen Besied-lung gewonnen werden. Wie sich herausstellte, sind ineinem absehbaren Zeitrahmen keine negativen Auswir-kungen auf die Langzeitstabilität der Dechlorierungsleis-tung von Eisenreinigungswänden durch die vorhandenenMikroorganismen zu erwarten.
Verwertung der Ergebnisse
Die Zusammenschau aller Forschungsarbeiten machtdeutlich: Die Pilot- und Demonstrations-ReinigungswandRheine ist eine erfolgreiche Anwendung im langjährigenEinsatz. Zu den Resultaten des Projekts gehört auch dieAnmeldung eines Markennamens für den Eisenschwammdurch die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH. Erwird unter dem Namen „ReSponge“ vertrieben und ist beiden Patent- und Markenämtern in Europa (07/2005) undden USA (12/2005) eingetragen. Darüber hinaus hat dasUnternehmen im Jahr 2003 mit der MITTAL Steel GmbH inHamburg eine vertragliche Vereinbarung zur Vermark-tung von Eisenschwamm zu Sanierungszwecken getroffen.
Projekt-Website www.rubin-online.de
Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbHDr. Martin WegnerJoachimstraße 130159 HannoverTel.: 05 11/12 35 59-59Fax: 05 11/12 35 59-55E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 0281238
Christian-Albrechts-Universität KielInstitut für GeowissenschaftenProf. Dr. Andreas DahmkeDr. habil. Markus EbertLudwig-Meyn-Straße 1024118 KielTel.: 04 31/8 80-28 58, -46 09Fax: 04 31/8 80-76 06E-Mail: [email protected]@gpi.uni-kiel.deFörderkennzeichen: 02WR0208
Technische Universität BerlinInstitut für Technischen Umweltschutz (ITU)Arbeitsgruppe UmwelthygieneDr. Martin SteiofAmrumer Straße 3213353 BerlinTel.: 0 30/31 42 75-32Fax: 0 30/31 42 75-75E-Mail [email protected]örderkennzeichen: 0271262
Verringerung der Schadstoffkonzentration beim Durchströmen derReinigungswand

Von 1915 bis 1929 wurde in der Teerfabrik Lang in Offenbach Teer aufbereitet und weiterverarbeitet.Nach dem Abriss der meisten Gebäude im Jahre 1930und verschiedenen Zwischennutzungen liegt dasGelände heute überwiegend brach. Boden und Grund-wasser sind jedoch nach wie vor stark mit Teerölenund teerölverwandten Stoffen belastet. Gefragt istalso ein einfaches, wirtschaftlich tragbares undsicheres Sanierungsverfahren, das gleichzeitig dieumliegenden Bürostandorte möglichst wenig beein-trächtigt. Mit einem neuartigen „Funnel-and-Gate-System“ mit drei eingebauten Bioreaktoren entwi-ckelten Wissenschaftler des ForschungsverbundsRUBIN ein Verfahren, das diesen Anforderungengerecht wird.
Noch heute sind die Folgen von 14 Jahren Teerproduktionam Standort Offenbach deutlich messbar: Die Kontamina-tion mit Teeröl und teerölverwandten Stoffen reicht bis andie Basis des quartären, sandig-kiesigen Grundwasserlei-ters . Darunter stehen tertiäre Tone (Rupelton) an, diestauend wirken und ein tieferes Eindringen der Schadstof-fe verhindern. An mehreren Messstellen zeigt sich dieseVerunreinigung als 20 bis 80 Zentimeter mächtige Teeröl-phase an der Basis des quartären Grundwasserleiters.Polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sinddabei die dominierenden Schadstoffe; Analysen ergabenGehalte von über 150 Milligramm pro Kilogramm Boden,stellenweise sogar bis hin zu mehreren Gramm. Im Grund-wasser stellten die Forscher im Schadenszentrum BTEX -Gehalte von bis zu 30 Milligramm pro Liter fest.
Geringer Wartungs- und Steuerungsaufwand
Nach einer eingehenden Untersuchung des Standortesschätzten Experten die Kosten für eine konventionelleSanierung mit Bodenaushub auf etwa 18 Millionen Euro.Damit lag es nahe, nach günstigeren Alternativen zusuchen. In einer Variantenstudie erwogen die Wissen-schaftler, Teilbereiche zu sanieren oder aber das kontami-nierte Erdreich mit einer Dichtwand und einer Oberflä-chenabdichtung zu umschließen. Als weitere Variantewurde ein Funnel-and-Gate-System mit Bioreaktor disku-tiert. Sie sollte einfach und mit einem geringen Wartungs-und Steuerungsaufwand zu realisieren sein und die Nut-zung des Grundstücks möglichst wenig beeinträchtigen.Die geschätzten Kosten waren mit 1,5 Millionen Euro ver-hältnismäßig gering. Das Problem: Ein solcher Reaktorwar noch nie zuvor gebaut worden; die Machbarkeit die-ses Vorschlags musste erst noch bewiesen werden.
Funnel-and-Gate – Mit einem neuartigen Reaktorkonzept erfolgreich gegen Schadstoffe
Den Weg von der ersten Idee bis hin zum inzwischengeführten Nachweis der Funktionsfähigkeit und Wirk-samkeit ebnete eine Förderung des BMBF. Im Rahmen desForschungsverbundes RUBIN (siehe Projekt 1.1.03) führteein Team von Wissenschaftlern die erforderlichen Versu-che (Labor und on-site), Modellierungen sowie den Bauund Probebetrieb des Reaktors im Pilotmaßstab durch.Die Zustimmung des Regierungspräsidiums Darmstadt,Abteilung Umwelt in Frankfurt, und die vom Land Hessenbereitgestellten Mittel waren weitere wesentliche Voraus-setzungen für den Projekterfolg.
Planung, Bau und Betrieb
Das im Pilotmaßstab umgesetzte Konzept sieht einen starkgegliederten Reaktor vor: Er besteht aus einem Schrägklä-rer, um Eisen und andere Feststoffe aus dem Wasser zuentfernen, sowie drei in Reihe geschalteten Bioreaktorenund einer Aktivkohlestufe. Im Anstrom des Schrägklärerssowie vor allen drei Bioreaktoren wurde jeweils eine offeneWasserzone (Freiwasserzone) angeordnet, die der Vertei-lung des Grundwassers auf den gesamten Fließquerschnittder Bioreaktoren dient. Darüber hinaus werden demGrundwasser in den Freiwasserzonen an mehreren StellenSauerstoff (als H2O2) und Nährstoffe zugegeben, um denbiologischen Schadstoffabbau zu stimulieren. Das Reaktor-konzept folgt damit der allgemeinen Entwicklung weg vonpassiven, schlecht kontrollierbaren Systemen hin zu sol-chen Systemen, die Eingriffe und eine Steuerung erlauben.
Der Bau des Funnel-and-Gate-Systems im Pilotmaßstaberfolgte von Oktober 2006 bis März 2007. Die jeweils 30Meter langen Leitwände (Funnel) schließen sich westlichund östlich an den durchströmbaren Reaktionsbereich(Gate) an. Sie wurden als 550 Millimeter starke Wände imMixed-in-Place-Verfahren (MIP) ausgeführt und bindenmindestens einen Meter in den Rupelton ein. Die eigentli-chen Reaktionsräume zwischen den Freiwasserzonenwurden mit einem Kies der Körnung zwei bis acht Milli-meter aufgefüllt, der als Aufwuchskörper (Trägermaterial)für die Schadstoff-abbauenden Mikroorganismen dient.
Der Reaktor wird im Pilotbetrieb mit einer Durchflussratevon 230 bis 500 Litern pro Stunde betrieben, die allerdingsnicht allein über das natürliche Grundwassergefälleerreicht werden kann. Für den nötigen Zustrom sorgtdaher eine Pumpe. Diese aktive Betriebsweise gewährleis-tet neben einem konstanten Durchfluss weitestgehendkonstante Dosiermengen und Abbaubedingungen, wasgegenüber einem passiven Betrieb einen deutlich redu-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0520

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | FUNNEL-AND-GATE 21
zierten Betriebs- und Überwachungsaufwand nach sichzieht. Außerdem ermöglicht die Steuerung der Durch-flussrate jederzeit eine Anpassung an veränderte hydrau-lische Randbedingungen (z. B. Grundwasserentnahmenim Umfeld).
Um den aeroben und aerob-denitrifizierenden Abbauder Schadstoffe zu stimulieren, werden dem Wasser Sauer-stoff und Nitrat zugegeben. O-Phosphat sorgt außerdemdafür, dass genügend Phosphor im Wasser vorhanden ist.Stickstoff als weiterer essenzieller Nährstoff steht denMikroorganismen in Form des natürlich im Grundwasservorkommenden Ammoniums zur Verfügung. Als Betriebs-chemikalien werden Wasserstoffperoxid-(H2O2)-Lösungen,Natriumnitrat und ein Gemisch aus Monokaliumphos-phat (KH2PO4) und der Pufferlösung Na2HPO4 beigesetzt.
Die mikrobielle Besiedelung der vier Gate-Module wurdeüber die Dosierung der Zusatzstoffe gesteuert und über800 Tage im gesamten Bioreaktor-System mit einemmikrobiologischen Monitoring-Programm verfolgt.
Wirksamkeit belegt
Im Schrägklärer wandelt sich durch H2O2-Zugabe dasEisen um und lagert sich als Schlamm durch Sedimenta-tion ab. Außerdem wird ein Großteil der Schadstoffebereits durch die aerobe Stimulierung im Schrägklärerabgebaut. Hier findet insbesondere eine Reduktion derPAK und BTEX-Aromaten (Benzol, Toluol, Ethylbenzol,Xylole) zu etwa 70 Prozent statt. Die anderen auf Teerölzurückgehenden Schadstoffe (teerölbürtige Schadstoffe)wie NSO-HET (NSO-Heterozyklen) und die übrigen Aro-matischen Kohlenwasserstoffe (AKW) werden um etwadie Hälfte reduziert.
Im Bioreaktor 1 bauen sich durch die aerob-denitrifizie-rende Prozesse die übrigen AKW und die PAK 2-16 (Polyzy-klische Aromatische Kohlenwasserstoffe) zu je etwa 40 Prozent ab; die BTEX-Aromate und NSO-HET zu mehrals 20 Prozent. In Bioreaktor 2 und 3 bauen sich die ver-bliebenen Schadstoffe ab.
Im September 2009 waren im Ablauf des Bioreaktors erst-malig keine teerölbürtigen Schadstoffe mehr nachweisbar.Das erprobte Funnel-and-Gate-System beseitigt die Schad-stoffe aus dem Grundwasser ausschließlich durch einenaerob-denitrifizierenden Abbau. Andere mögliche Elimi-nationsprozesse wie Retardation oder Verflüchtigungspielen keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Erweiterung des Systems
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Probereak-tor prüfen die Wissenschaftler nun, inwieweit das Systemfür die Behandlung des gesamten kontaminiertenAbstroms geeignet ist. Dazu vergleichen sie zurzeit ver-schiedene Varianten mit einem oder zwei Gates sowie mitpassiven und aktiven Komponenten.
HIM GmbH Bereich AltlastensanierungDipl.-Ing. Christian Weingran64584 BiebesheimWaldstraße 11Tel.: 0 64 28/92 35 11Fax: 0 64 28/92 35 35E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WR0293
CDM Consult GmbHDipl.-Ing. Jörn Müller64665 AlsbachNeue Bergstraße 13Tel.: 0 62 57/50 43 15Fax: 0 62 57/50 43 60E-Mail: [email protected]
I.M.E.S. GmbHDr. Hermann Schad88279 AmtzellMartinstraße 1Tel.: 0 75 20/92 36 00Fax: 0 75 20/92 36 04E-Mail: [email protected]
DVGW Technologiezentrum Wasser (TZW)Dr. Andreas Tiehm76139 KarlsruheKarlsruher Straße 84Tel.: 07 21/9 67 81 37Fax: 07 21/9 67 81 01E-Mail: [email protected]
Längsschnitt des neuartigen Funnel-and-Gate-Systems

Reaktionswände aus Eisengranulat haben ihre hoheReinigungswirkung bereits in mehreren Feldstudienbewiesen. Unklar war noch, wie sich veränderte pH-Werte auf die Langzeitstabilität des reaktivenMaterials auswirken. Auf dem Gelände einer ehema-ligen sowjetischen Kaserne bei Berlin testeten Wis-senschaftler des „Reinigungswände und -barrierenNetzwerkverbundes“ (RUBIN) eine entsprechendePilotanlage an dem hochgradig mit Trichlorethen(TCE) kontaminierten Grundwasser. Mit überzeu-gendem Ergebnis: Das Eisengranulat arbeitete auchlangfristig hocheffizient und ökonomisch. Das TCEkonnte vollständig beseitigt werden.
In Deutschland sind über 11.000 Altlasten bekannt, die eineerhebliche Gefahr für das Grundwasser darstellen. SchnelleSanierungen, beispielsweise durch Ausbaggern oderAbpumpen des verunreinigten Grundwassers, haben sichin vielen Fällen als technisch undurchführbar oder unver-hältnismäßig teuer erwiesen. Dies gilt vor allem dann,wenn es sich bei den Schadstoffen um organische Substan-zen, wie etwa leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser-stoffe (LHKW) oder Teeröle handelt und wenn diese alsseparate Flüssigphase im Untergrund vorliegen. Zuneh-mend setzen sich deshalb Technologien durch, die daraufabzielen, die aus den Schadensherden emittierendenSchadstofffahnen zu sichern. Dazu zählen unter ande-rem durchströmte Reinigungswände. Die Entwicklungdieser Technologie begann in Nordamerika und wurde inDeutschland über das Forschungs- und Entwicklungsvor-haben RUBIN vom BMBF gefördert (siehe Projekt 1.1.03).
Langzeitstabilität testen
2001 wurde am Standort einer ehemaligen Kaserne dersowjetischen Streitkräfte in Bernau (etwa 30 km nordöst-lich von Berlin) eine modular aufgebaute Pilotanlageerrichtet, mit der hochgradig mit Trichlorethen (TCE) kon-taminiertes Grundwasser behandelt wird. WichtigstesZiel des Vorhabens war, die Langlebigkeit und Abbauleis-tung einer Reinigungswand aus Eisengranulat unter qua-si In-situ-Bedingungen zu testen. Das Verfahren nutzt dasReduktionspotenzial von metallischem Eisen in Kontaktmit Wasser und halogenierten Kohlenwasserstoffen.Durch die Korrosionsreaktion des Eisens werden die teil-weise krebserzeugenden Schadstoffe dehalogeniert . DerRedoxprozess erhöht jedoch den pH-Wert, was eine Reihevon Nebenreaktionen auslöst. Diese bringen Einschrän-kungen hinsichtlich der Langzeitstabilität des reaktivenMaterials mit sich.
Anwendung von Reinigungswänden – Im Einsatz gegen hohe TCE-Konzentrationen
Ziele des Vorhabens erreicht
Die Wissenschaftler errichteten am Standort zunächsteine trichterförmige Dichtwand um das Schadenszen-trum. Diese grenzt an den Reaktor, der unterhalb desnatürlichen Grundwasserspiegels liegt und damit passivhorizontal durchströmt werden kann. Er besteht aus 18zylindrischen Einzelmodulen mit einem Durchmesser von2,8 Metern und einer Höhe von etwa 2,2 Metern; jedes ein-zelne Modul kann als eigenständiger Reaktor betrachtetwerden. Durch Kopplung mehrerer Module, parallel oderin Reihe geschaltet, können Fließlänge und damit auchdie Verweilzeit des Wassers im Reaktor je nach Erfordernisgesteuert werden. Im Forschungsvorhaben wurden dieModule in Reihe durchströmt.
Die wichtigsten Ziele des Vorhabens wurden in vollemUmfang erreicht:
Eine langfristig stabile und effiziente Beseitigung derhohen TCE-Konzentrationen.Kontrollierbare Volumenströme sowie Schadstoffkon-zentration und -menge über eine lange Fließstreckeim Eisenreaktor.Einen Zugang zum reaktiven Material zu schaffen, derbei unvorhersehbaren negativen Einflüssen Gegen-maßnahmen ermöglicht.
Das als Reaktionsmaterial eingesetzte Graugussgranulaterreichte eine Reinigungsleistung von mehr als 99,5 Pro-zent. Bei Schadstoffkonzentrationen von mindestens 25Milligramm pro Liter, wie sie am Standort Bernau anzu-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0622
TCE-Abbau im Labor mit Eisengranulat

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | REINIGUNGSWÄNDE GEGEN TCE 23
treffen sind, ist es für eine Anwendung im Feldmaßstabhocheffizient und ökonomisch vorteilhaft. Die Nachreini-gung des gering belasteten Reaktorablaufes mit Wasser-aktivkohle hat sich im dreieinhalbjährigen Reaktorbe-trieb gut bewährt und stellt für den Sanierungsbetrieb diewirtschaftlichste Maßnahme dar. Insgesamt wurden imVerlauf des mehrjährigen Forschungsvorhabens etwa 450Kilogramm TCE aus 15.000 Kubikmeter Wasser beseitigtund das behandelte Grundwasser bis zur TCE-Nachweis-grenze gereinigt.
Reif für die Praxis
Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens werden seit Feb-ruar 2007 bei der Standortsanierung umgesetzt. Die soge-nannte „LCKW-Fahne-Ost“ wird mithilfe der Reinigungs-wand aus Eisengranulat saniert. Voraussetzungen dafürwaren:
Eine Auf- bzw. Umrüstung der Anlage. Das Eisengra-nulat aus zehn Reaktormodulen musste ausgebaut,mechanisch aufbereitet und wieder eingebaut wer-den.Der Einbau von neuen Rohrleitungssystemen inklusiveMess- und Regeltechnik als Fördersystem zu und vonden Reaktormodulen.Die Errichtung von sechs Förderbrunnen inklusive dernotwendigen Fördertechnik.
Weil die Reinigungsleistung der Reaktionswand für dasAbbauprodukt cDCE nicht ausreicht, ist außerdem eineNachreinigung mit Nassaktivkohle erforderlich.
Das kontaminierte Grundwasser wird mit einer Geschwin-digkeit von 2,4 Kubikmetern pro Stunde aus sechs Brun-nen gefördert. Die Reinigung des mit leichtflüchtigenchlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW, vor allem TCE)kontaminierten Wassers erfolgt über zehn Module, die
parallel durchströmt werden. Im Anschluss durchläuft dasbehandelte Wasser die Nachreinigungsanlage und versi-ckert dann wieder im Boden. Der Anlagenbetrieb wirdzentral gesteuert und überwacht.
Im Laufe des bisherigen Sanierungsbetriebes haben dieWissenschaftler die Anlage bereits mehrmals modifiziert,um ihre Leistung zu optimieren. So durchströmt das Was-ser die Module des A-Stranges nunmehr von unten nachoben. In die Module des B-Stranges wurde im Zustrombe-reich eine Mischung aus Eisen und Filtersand eingebautund ein Gasdrainagesystem aus perforierten Polyethylen-rohren installiert.
In den letzten dreieinhalb Jahren entfernte die Reini-gungsanlage am Standort Bernau bei einem Behand-lungsvolumen von rund 55.000 Kubikmetern Grundwas-ser etwa 3.200 Kilogramm LCKW aus dem Untergrund.Dadurch baut sie an diesem Standort praktisch das gesam-te TCE ab. Ein Teil des Trichlorethens wird dabei nicht voll-ständig dechloriert, sondern zu cDCE umgewandelt.
Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbHMartina Freygang Waldstadt Hauptallee 116/6 15806 ZossenTel.: 0 33 77/3 88-157Fax: 0 33 77/3 [email protected] Förderkennzeichen: 0251231
IMES Gesellschaft für innovative Mess-, Erkundungs- und Sanierungstechnologien mbHDr. Hermann SchadMartinstraße 188279 AmtzellTel.: 0 75 20/92-36 00Fax: 0 75 20/92-36 [email protected] www.imes-gmbh.net
ISTEV GmbHPeter HeinBismarckstraße 114109 BerlinTel. 0 30/80 94-15 76Fax 0 30/80 94-15 [email protected]
Aufsicht auf die Reaktorgrube mit teilweise befüllten Modulen (links)und Seitenansicht eines befüllten Moduls

Kohlebergbau und chemische Industrie habenBoden und Grundwasser im Raum Bitterfeld starkgeschädigt. Die Erfahrungen der vergangenen 20Jahre zeigen: Die hydraulische Boden- und Grund-wassersanierung ist oft nicht effektiv – gerade beigroßen Altlastenflächen, wenn der Schadensherdnicht genau lokalisiert oder nur schwer entferntwerden kann. Der Projektverbund „Sanierungs-Forschung in regional kontaminierten Aquiferen “(SAFIRA) entwickelt daher am Beispiel des Modell-standorts Bitterfeld-Wolfen neue Technologien undMethoden zur In-Situ-Sanierung von Grundwasser,das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist.
Noch heute leidet der Raum Bitterfeld-Wolfen unter Alt-lasten. Der Untergrund an den ehemaligen Industrie- undDeponiestandorten ist verseucht, das Grundwasser aufeiner Fläche von rund 25 Quadratkilometern zum Teil hoch-gradig mit organischen Verbindungen, v.a. Chlorkohlen-wasserstoffen (CKW ), kontaminiert. In Bitterfeld reichtdiese Kontamination bis in Tiefen von 30 bis 40 Meter undbetrifft schätzungsweise 250 Millionen Kubikmeter Grund-wasser. Klassische Sanierungsverfahren erfordern meistlangwierige und teure Pump- und Aufbereitungsmaßnah-men. Für derart großflächige Kontaminationen und kom-plexe Schadstoffgemische ist dagegen die In-situ-Reini-gung eine interessante Methode, weil das Erdreich nichtausgehoben und abtransportiert werden muss.
Aktive und passive Methoden
Bei den In-situ-Sanierungsmethoden unterscheidet manzwischen aktiven Technologien (z. B. Bodenluftabsau-gung) und passiven Methoden, bei denen während derSanierung nur wenig oder keine Energiezufuhr benötigtwird. Die am weitesten entwickelte passive Variante sindReaktionswände. Während diese für einfache Schadstoff-gemische bereits erfolgreich im Einsatz sind, besteht fürkomplexe Gemische noch Entwicklungsbedarf.
Der Projektverbund SAFIRA erkundete die hydrogeologi-schen und geochemischen Randbedingungen für kosten-günstige In-situ-Verfahren und testete diese am Modell-standort Bitterfeld. Die Forscher des UFZ-Umweltfor-schungszentrums Leipzig-Halle und der UniversitätenDresden, Halle, Kiel, Leipzig und Tübingen konnten aufden Arealen der ehemaligen Bitterfelder Chemieindustriein einem realen Szenario Technologien für passive Dekon-taminationsverfahren entwickeln und testen, inwieweitsie sich für den praktischen Einsatz eignen.
Verbundprojekt SAFIRA – Sanierungsforschung am Modellstandort Bitterfeld
Die Hauptziele des Projekts waren: Entwicklung und stufenweise Umsetzung effizienterpassiver Wasseraufbereitungstechnologien für orga-nische Schadstoffgemische vom Labormaßstab bis zurPilotanlage.Technisch-ökonomische Optimierung der neuen Tech-nologien einschließlich ihrer Kombination.Demonstration ihrer Langzeitstabilität unter Feldbe-dingungen.Zusätzlich sollten die tatsächlichen Betriebskostensowie die umweltrechtlichen und -planerischenAspekte von In-situ-Reaktionszonen bewertet werden.
Pilotanlage für unterschiedliche Verfahren
Herzstück des Projekts ist eine im Bitterfelder Grundwas-ser, 23 Meter unter der Geländeoberfläche errichtete Pilot-anlage. Dort untersuchten die Wissenschaftler sieben Ver-fahren, die zuvor im Labormaßstab und im kleinskaligenFeldversuch mit einer mobilen Testeinheit erfolgreicherprobt worden waren:
Adsorption und mikrobieller Abbau von Schadstof-fen auf AktivkohleZeolith-gestützte Palladium (PD) KatalysatorenOxidative VollmetallkatalysatorenRedox-KombinationsreaktorenMembran-gestützte Palladium (PD) KatalysatorenAdsorption an Aktivkohle Anaerober mikrobieller Abbau
RESSOURCE WASSER | 1.1.0724
In der Pilotanlage realisierte Verfahrensschritte

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | VERBUNDPROJEKT SAFIRA 25
Diese Verfahren auf den größeren Maßstab der Pilotanla-ge zu übertragen, erwies sich in einigen Fällen als proble-matisch. So sind die am Standort vorhandenen Mikroorga-nismen zwar in der Lage, unter anaeroben BedingungenChlorbenzene abzubauen. Die Abbaugeschwindigkei-ten waren jedoch für eine Anwendung in der Praxis zugering, so dass auch Verfahren zur Sauerstoffdosierungentwickelt werden mussten. Die Wissenschaftler stelltenaußerdem fest, dass sich Palladium-Katalysatoren zwar fürdie schnelle reduktive Dechlorierung eignen, jedoch insulfathaltigen Grundwässern vor den Produkten dermikrobiologischen Sulfatreduktion wie Schwefelwasser-stoff besser geschützt werden müssen. Klassische Adsor-benzien (z. B. Aktivkohle) helfen dabei, Schadstoffe zu ent-fernen. Die Standzeiten von Reinigungswänden könnendurch mikrobiologische Besiedelung deutlich verlängertwerden. Im Rahmen des Projekts zeigte sich ferner, dassoxidativ-katalytische Verfahren auch zur Behandlungkomplexer Schadstoffgemische eingesetzt werden kön-nen. Optimierungsbedarf bestand bei Methoden zur Reak-tivierung der Katalysatoroberflächen.
Umsetzung in konkrete Sanierungskonzepte
In weitergehenden Untersuchungen passten die Projekt-partner ihre Forschungsarbeiten an die je nach Standortsehr unterschiedliche Schadstoffzusammensetzung an,insbesondere an die vielen verschiedenen Substanzen unddie hohen Konzentrationen von Einzelstoffen in Bitter-feld. Die neuen Vorhaben konzentrierten sich auf dreiThemenbereiche, die den größten Nutzen für zukünftigeSanierungskonzepte im Raum Bitterfeld-Wolfen verspra-chen:
Innovative Sanierungstechnologien (Katalyse ) Gekoppelte Systeme (Hydrochemie/Mikrobiologie) Raumwirkung (digitales Raummodell, Visualisierung,Modellierung)
Im Bereich innovative Sanierungstechnologien entwickel-te das Projektteam eine neue Methode, die mittels Vaku-umstrippen durch eine Hohlfasermembran Schadstoffeaus der wässrigen Phase in die Gasphase überführt, wosie hocheffizient katalytisch zerstört werden. Die Techno-logie bewältigt ein breites Spektrum an Schadstoffen inhohen Konzentrationen. Nach dem erfolgreichen Betriebeiner entsprechenden Pilotanlage an verschiedenenStandorten wurde das Verfahren weiterentwickelt. Dabeistand das Entfernen und Zerstören von verfahrenstech-nisch besonders kritischen Substanzen im Vordergrund.Eine neue Technologie soll nun die Behandlung eines spe-
ziell kontaminierten Grundwassers in der Region Bitter-feld-Wolfen deutlich vereinfachen. Getestet wird es mit-tels einer Pilotanlage, die neben einer Verfahrensstufe zurStrippung von Schadstoffen mit Hohlfasermembran-modulen auch Apparaturen zur Realisierung neuartiger Verfahrensschritte zur Entschwefelung der Strippgase(UFZ-Patent) enthält. Die Anlage soll bei komplexenGrundwasserkontaminationen, für die bisher kein ökono-misch sinnvolles Reinigungskonzept vorliegt, Alternati-ven demonstrieren. Dabei wird der Ansatz des „TreatmentTrain“ verfolgt, also der intelligenten Verknüpfung modu-larer Standard- und/oder innovativer Einzelverfahren, umeine ausreichende Gesamtreinigungsleistung zu erreichen.
Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Kombination ver-schiedener mikrobiologischer Abbauwege in entspre-chend konditionierten Aerob- /Anaerob-Zonen, die densukzessiven Abbau bestimmter Schadstoffe oder Schad-stoffgruppen erlauben. Im Rahmen des dritten Themen-felds wird eine digitale Datenbasis für Bitterfeld erarbei-tet, die unter anderem ein geologisches Strukturmodell,die Beschreibung regionaler Grundwasserqualitäten inverschiedenen Zeitabschnitten und landnutzungsorien-tierte Sanierungsszenarien umfasst.
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZProf. Dr. Holger WeißProf. Dr. Frank-Dieter KopinkePermoserstraße 1504318 LeipzigTel.: 03 41/2 35-12 53Fax: 03 41/2 35-18 37E-Mail: [email protected]@[email protected]: www.ufz.deFörderkennzeichen: 02WT9911/9

Viele organische Schadstoffe im Grundwasser sindunter aeroben , sprich sauerstoffhaltigen Bedin-gungen biologisch abbaubar. Durch die Zugabe von Sauerstoff können die Abbauprozesse beschleunigtwerden. Eine relativ kostengünstige Möglichkeit,zusätzlichen Sauerstoff im Untergrund bereitzu-stellen, ist die Direktgasinjektion. Ein Projektteamuntersuchte die Prozesse, die die Effizienz solcherDirektgasinjektionen in poröse Medien (Grundwas-serleiter ) bestimmen, und entwickelte Prognose-modelle für den Einsatz des Verfahrens in der Sanie-rungspraxis. Auf Basis der Forschungsergebnissewurden bereits mehrere Demonstrationsprojekteerfolgreich durchgeführt.
Eine Möglichkeit, den Abbau von Schadstoffen im Unter-grund zu beschleunigen, sind sogenannte Direktgasinjek-tionen – ein Verfahren der In-situ-Sanierung. Mittels hori-zontal und vertikal beweglicher Injektionslanzen wirdSauerstoff gezielt im Abstrom des kontaminierten Grund-wassers eingebracht. Dort setzt er sich in Form fein verteil-ter Bläschen im Grundwasserleiter fest. Gering durchlässi-ge Sedimentschichten hindern das Gas daran, nach obenzu entweichen. Stattdessen bilden sich sauerstoffdurch-strömte Kapillarnetzwerke , die sich seitlich ausdehnen.Die immobile Gasphase wirkt hydraulisch und biolo-gisch wie eine reaktive Sauerstoffwand, die das durchströ-mende Grundwasser reinigt. Das heißt, die Bläschen lösensich langsam auf und reichern das vorbeifließende Grund-wasser mit Sauerstoff an, was den Abbauprozess der ent-haltenen Schadstoffe unterstützt, während von obenimmer wieder neuer Sauerstoff zugeführt wird.
Raumwirkung des Gasspeichers steuern
Das BMBF finanzierte von 2000 bis 2010 die Demonstrati-onsprojekte SAFIRA, PROINNO 1 und 2 sowie ZIM, die die-ses Verfahren erforschen. Untersuchungsstandorte sindbeispielsweise das Gelände einer ehemaligen Chemiefa-brik in Leuna und das Leipziger NaherholungsgebietAuensee, das von einer PCE-TCE- Grundwasserkontami-nation bedroht ist. Konventionelle Technologien zurDirektgasinjektion gehen von einer homogenen Gasver-teilung um die Injektionslanze aus. Die tatsächliche Ver-teilung wird nicht gemessen, das heißt, diese Technolo-gien arbeiten „blind“. Grundsätzlich verhält sich die Gas-verteilung an Injektionslanzen wie ein dynamischerGasspeicher, der aus baumartig-verästelten und zusam-menhängenden (kohärenten) Gaskanälen und nicht-zusammenhängenden (inkohärenten) Gasclustern besteht.
Sauerstoff-Direktgasinjektion – Messung und Modellierung von dynamischen Gasspeichern
Diese dehnen sich durch die Injektions- beziehungsweiseAuflösungsprozesse aus oder ziehen sich zusammen.
Innovativer Kern und wissenschaftliche Herausforderungder Projekte war die kleinskalige messtechnische Erfas-sung der Gasausbreitungs- und Speicherprozesse im hete-rogenen Untergrund sowie deren Interpretation und kon-trollierte Steuerung mithilfe von Computermodellen. Zielwar es, die Raumwirkung des Gasspeichers zu steuern.Neben der konventionellen Niedrigdruck-Injektion (NDI)untersuchten die Wissenschaftler erstmals auch die Hoch-druck-Injektion (HDI).
Besseres Monitoring
Die Firma Sensatec aus Kiel entwickelte zusammen mitdem UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle eineneue Anlagentechnik zur gekoppelten NDI-HDI-Direkt-gasinjektion. Parallel dazu entstand ein zuverlässiges In-situ-Gasmesssystem und ein dynamisches Gasausbrei-tungsmodell, auf dessen Grundlage das neue Injektions-verfahren gesteuert und optimiert werden kann. DasMesssystem ist dank eines neuartigen Sets von Sensoren(Sensorarray) in der Lage, in schneller Abfolge großeDatenmengen zu messen und speichern. Damit ist esgeeignet, die sich verändernden Gastransport- und Gas-speicherprozesse im heterogenen Untergrund zu erfas-sen. Da diese wesentlich schneller als typische Grundwas-sertransportprozesse ablaufen, sind Standardsystemeungeeignet für dieses Monitoring. Zu den Messdatenerrechneten die Wissenschaftler mittels geeigneter geo-statistischer Verfahren Zwischenwerte (Interpolation)und visualisierten die gesamten Daten in 3D. Diese 3D-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0826
3D-Darstellung einer Gasverteilung im Untergrund bei NDI- bzw. HDI-Direktgasinjektion
Niederdruckinjektion Hochdruckinjektion

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | SAUERSTOFF-DIREKTGASINJEKTION 27
Datenfelder bildeten die Grundlage für die Entwicklungdes Gasausbreitungsmodells.
Technologisch relevante Ergebnisse
Die Forschungsprojekte erbrachten folgende Ergebnisse:Für die modellgestützte Prognose von dynamischenGasspeichern im Untergrund ist die unabhängigeMessung von horizontaler und vertikaler hydrauli-scher Leitfähigkeit essenziell. Insbesondere dünneTonschichten können die vertikal nach oben streben-den Gasströmungen entscheidend in ihrer Dynamikbeeinflussen. In bestehenden Grundwassermodellenwird die vertikale Leitfähigkeit über einen empiri-schen Faktor (< 1) aus der horizontalen Leitfähigkeitberechnet. Diese einfache Näherung versagt jedoch,wenn das Ausbreitungsverhalten von dynamischenGasspeichern vorhergesagt werden soll.Für die optimale vertikale und horizontale Positionie-rung von Injektionslanzen und Sensoren ist eine fein-skalige Standorterkundung notwendig. Das Monito-ring muss mindestens Rammkernsondierungen undInjection-Logs zur Bestimmung der hydraulischenLeitfähigkeit sowie geoelektrische Profilaufnahmenumfassen.Die Gasmessung muss in einem, den lokalen Erforder-nissen angepassten, dichten In-situ-Sensornetz (ca. 60Messstellen pro Injektionslanze; 1 Sensor pro m3) erfol-gen, was in heterogenen Sedimenten von zentralerBedeutung für eine erfolgreiche Prognose der Gasaus-breitung ist.Aus den Laborexperimenten leiteten die Experten dieArbeitshypothese ab, dass Niedrigdruckinjektionen zuinkohärentem und Hochdruckinjektionen zu kohä-rentem Gastransport führen. Diese Erkenntnis ist fürdie richtige Dimensionierung der Gaswände wichtig.Ein Sensorsystem muss in der Lage sein, in kurzer Zeitviele Daten zu messen und speichern, um zwischenkohärentem und inkohärentem Gastransport zuunterscheiden.
NDI-Szenarien und kombinierte NDI/HDI-Szenarienmit einer extrem geringen Injektionsrate von 0,18Kubikmeter pro Stunde führen zu einem inkohären-ten Gasspeicher. NDI-Szenarien mit zehnfach höhererInjektionsrate und gepulste HDI-Szenarien führendagegen zu einem kohärenten Gasspeicher. Diesbedeutet, dass offenbar die Injektionsrate und nichtder Injektionsdruck ausschlaggebend für die unter-schiedlichen Gasströmungsmuster ist. Der einzige sig-nifikante Unterschied zwischen den beiden Injektions-methoden ist, dass bei der Hochdruckinjektion imunteren Bereich eine höhere Gassättigung erzieltwird.Ein 3D-Gasausbreitungsmodell zur Optimierung desgekoppelten NDI/HDI-Gaseintragsverfahrens muss:a) ein Mehrphasenmodell sein,b) heterogene horizontale und vertikale Permeabili-
täts- und Kapillardruckfelder berücksichtigen, c) an Messdaten konditionierte Parameterfelder ver-
wenden.Die Untersuchungen der Gasausbreitungsprozesse imLabor- sowie im Feldmaßstab sind auch für die CCS-Technologie, also die unterirdische Speicherung vonTreibhausgasen, von großem Interesse.
Projekt-Website http://safira.ufz.de
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZDepartment HydrogeologieProf. Dr. Helmut GeistlingerTheodor-Lieser-Straße 406120 HalleTel.: 03 45/5 58-52 20Fax: 03 45/5 58-55 59E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WT9947/8
Beispiel für die 3D-Computersimulation der Gasverteilung bei einer NDI- bzw. HDI-Direktgasinjektion

Weltweit belasten Schadstoffe Böden und Grund-wasser. Derart kontaminierte Grundstücke sindschlecht nutzbar und schwer verkäuflich, weil dieSanierung von Boden und Grundwasser sehr aufwen-dig und teuer ist. Daher bleiben sie oft ungenutzt.Gleichzeitig wird allein in Deutschland täglich eineFläche von etwa 90 Hektar „auf der grünen Wiese“neu erschlossen. In der Versuchseinrichtung zurGrundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) entwi-ckeln Spezialisten deshalb Technologien, die eserlauben, kontaminierte Grundstücke effizient zuerkunden und zu sanieren, um sie dann wieder demMarkt zuzuführen.
Durch unsachgemäße Entsorgungsmethoden, Unfälle,Kriegseinwirkungen oder Unachtsamkeit im Umgang mitumweltgefährdenden Stoffen ist der Boden und dasGrundwasser an zahlreichen ehemaligen Industriestand-orten, aber auch in urbanen Räumen mit Schadstoffenbelastet. Auch Verbraucher haben in der Vergangenheitzu einer Verschärfung des Problems beigetragen: Oft wur-den Haushaltschemikalien, Farben und andere giftigeStoffe, die heute als Sondermüll gelten, auf ungesichertenMülldeponien mit durchlässigem Untergrund entsorgt.So wurden zum Beispiel ausgebeutete Kiesgruben mitAbfällen aller Art verfüllt und später bepflanzt.
Konventionelle In-situ-Sanierungstechniken sind oft lang-wierig und teuer. Wegen ihrer physikalischen Eigenschaf-ten setzen sich die Schadstoffe in den Bodenporen fest undsind mit herkömmlichen Spülmethoden kaum abzulösen.Wer aber kontaminiertes Material ausgräbt und auf einerDeponie entsorgt, verschiebt das Problem letztendlich indie Zukunft. Bebaute Grundstücke oder tief liegende,nicht genau lokalisierbare Schadstoffquellen könnenohnehin nicht ausgehoben werden. Deshalb besteht eineder wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit darin, neueTechnologien zur ökonomischen und ökologischen Sanie-rung zu entwickeln, bevor die Altlasten zur Gefahr für denMenschen und die Schutzgüter der Umwelt werden.
Das VEGAS-Konzept
Mit Unterstützung des BMBF und des Umweltministeri-ums Baden-Württemberg wurde im September 1995 dieGroß-Versuchseinrichtung VEGAS der Universität Stutt-gart eingerichtet (Größe: 670 m2; Fläche des Großver-suchsstands 18 x 9 m, Höhe 4,5 m, teilbar in drei Komparti-mente). Dort entwickeln Ingenieure und WissenschaftlerErkundungs- sowie Sanierungstechnologien und betrei-
Versuchseinrichtung VEGAS – Ökologisch sanieren ohne Aushub und Abtransport
ben Feldanwendungen und Technologietransfer. An Großversuchsständen finden Experimente unter naturna-hen Bedingungen statt. Sie liegen in ihren Abmessungenzwischen dem klassischen Laborversuch und dem realenFeldfall. Für diesen Mittelweg gibt es gute Gründe: Klassi-sche Laborversuche lassen sich nicht unmittelbar auf dierealen Bedingungen „im Feld“ übertragen, und auch diezeit- und kostenintensiven Feldstudien an bereits beste-henden Schadensfällen sind nur beschränkt aussagefähig.Denn meist kennen die Sanierungsspezialisten weder dieGesamtmasse des Schadstoffs noch seine genaue räum-liche Verteilung. Die wenigen verteilten Messpunkte ergeben kein ausreichend detailliertes Bild. Darüberhinaus verbieten die geltenden Umweltschutzgesetze dieInjektion von Sanierungschemikalien in den Grundwas-serleiter , wenn sich deren Unbedenklichkeit nichtgarantieren lässt. Eine solche Garantie kann aber bei Ver-suchen mit neu zu entwickelnden Technologien in derRegel nicht gegeben werden.
Technologie-Innovationen
Altlasten im Boden können entweder saniert oder gesi-chert werden. Bei der Sanierung wird die Schadstoffquelleoder -fahne durch chemische, biologische oder hydrauli-sche Methoden entfernt. Im Falle einer Sicherung wird dieweitere Ausbreitung der Schadstoffe beispielsweise durchEinkapselung der Quelle unterbunden. VEGAS hat sich in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig auf dieQuellenerkundung und -sanierung konzentriert. Entspre-
RESSOURCE WASSER | 1.1.0928
VEGAS – Beitrag zu Forschung, Praxis und Lehre

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | VERSUCHSEINRICHTUNG VEGAS 29
chende Verfahren, die teilweise bereits gemeinsam mitUnternehmen in der Feldanwendung eingesetzt werden,sind zum Beispiel:
Thermische Sanierungstechnologien: ZugeführteEnergie – sowohl als Dampf oder Dampf-Luft-Gemischals auch mittels fester Wärmequellen – erhöht dieTemperatur der kontaminierten Boden- und Grund-wasserbereiche. Dadurch sinken Grenzflächenspan-nung , Viskosität und Dichte des Schadstoffs,gleichzeitig steigt sein Dampfdruck. So geht er ver-stärkt in die Gasform über und kann über die Boden-luft abgesaugt werden.In-situ-Reduzierung von Schadstoffen durch kleinsteEisenteile (nanoskaliges Eisen) in Reinigungswänden:Sie werden zur Sanierung von CKW-Fahnen eingesetzt. Derzeit prüfen die Experten, wie dieseTechnologie auch bei bebauten Flächen angewendetwerden kann. Dazu wird nanoskaliges Eisen mittelsSuspension direkt in den Schadensherd injiziiert. Zu klären sind noch Fragen zum Transport, zur Reakti-vität und Langzeitstabilität, aber auch zur Ökonomie.Im Rahmen verschiedener Forschungskonsortien sollen diese auch auf Pilotstandorten beantwortetwerden.
Andere Technologien, die Universitäten, Firmen, Kommu-nen und Institute in VEGAS (weiter-)entwickelt haben, setzen zum Beispiel auf die Injektion von Tensiden, Alko-holcocktails oder Mikroemulsionen. Weitere neue Mög-lichkeiten sind spezielle Sanierungsbrunnen, die In-situ-chemische-Oxidation (ISCO ) oder -Reduktion (ISCR ),die Immobilisierung von Schwermetallen und eine Ver-besserung der natürlichen Abbauprozesse im Grundwas-serleiter (Enhanced Natural Attenuation, ENA) durchZugabe von Nährstoffen.
Schwerpunkt Messtechnik
Der Bereich Messtechnik wurde in VEGAS konsequent aus-gebaut:1. Erkundung: Lage und Konzentration eines Schadens-
herdes müssen genau bekannt sein, um ihn sanierenzu können. In VEGAS haben die Forscher deshalb neueMethoden entwickelt, zum Beispiel basierend auf Sen-soren und Lichtleitern. Mit ihnen können sie einenSchadensherd schnell und kostengünstig eingrenzen.
2. Monitoring: Neue Instrumente der Vor-Ort-Messtech-nik ermöglichen einen zeitnahen Rücklauf von Infor-mationen über Schadstoffverteilung und -rückgangund senken damit die Kosten der Sanierung.
3. Langzeitüberwachung: Ist eine Sanierung beendet,müssen die Experten mittels automatisierter Langzeit-überwachung nachweisen, dass die Schadstoffkonzen-tration nicht wieder ansteigt und somit die Gefahrwirklich gebannt ist.
4. Geothermie: Der Einfluss geothermischer Anlagen aufdas Grundwasser ist noch wenig erforscht. Die Über-wachung von Wassertemperatur und -qualität imNahbereich von Geothermiesonden soll langfristig zuderen sicherem Einsatz beitragen.
Technologie- und Wissenstransfer
Technologieentwicklung allein reicht nicht aus, um einennachhaltigen Boden- und Grundwasserschutz sicherzu-stellen. Deshalb finden in der Versuchseinrichtung regel-mäßig Weiterbildungsveranstaltungen für Fachleute aus Behörden und Ingenieurbüros statt. Die entwickeltenTechnologien werden in Pilotanwendungen an realenSchadensfällen einer breiten Fachöffentlichkeit vermittelt.
Projekt-Website www.vegasinfo.de
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau, VEGASPfaffenwaldring 6170550 StuttgartTel.: 07 11/6 85-6 47 17Fax: 07 11/6 85-670 20Förderkennzeichen: 02606861
Wissenschaftlicher Leiter VEGASDr. Jürgen BraunTel.: 07 11/6 85-6 70 18E-Mail: [email protected]
Technischer Leiter VEGASDr.-Ing. Hans-Peter KoschitzkyTel.: 07 11/6 85-6 47 16E-Mail: [email protected]

Methoden der Erdölindustrie als Vorbild für denUmweltschutz? Dass dies durchaus möglich ist, hatein Forscherteam in der Versuchseinrichtung zurGrundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) derUniversität Stuttgart gezeigt. Experten des dortigenInstituts für Wasserbau (IWS) und des Instituts fürHydromechanik der Universität Karlsruhe (IfH) ent-wickelten eine Sanierungstechnologie auf Alkohol-basis für kontaminierte Grundwasserleiter . Dabeikonzentrierten sie sich hauptsächlich auf Kontami-nationen mit mittel- bis schwerlöslichen Kohlenwas-serstoffen unterschiedlicher Dichte (LNAPL/DNAPL ).Ergebnis ist ein Verfahren, mit dem sich derart ver-unreinigte Grundwasserleiter „in situ“ – also an Ortund Stelle – reinigen lassen.
Mit traditionellen Fördermethoden schaffte es die Erdöl-industrie zunächst gerade einmal, rund 40 Prozent desgespeicherten Erdöls aus den entdeckten Vorkommen zugewinnen. Ursächlich für die geringe Ausbeute waren vorallem die Grenzflächenspannung und die unterschiedli-chen Viskositäten und Dichten von Wasser und Öl. Dochdann injizierten die Spezialisten der Ölkonzerne testweiseAlkohole und Tenside als Lösungsvermittler in die Erdölla-gerstätten. Diese Stoffe verringerten die Grenzflächen-spannung und die Fördereffizienz stieg stark an.
Bestimmte Alkohole aber verhindern, dass sich CKW un-kontrolliert in Bewegung setzen. Somit rückten Alkohol-spülungen für die In-situ-Grundwassersanierung wiederins Blickfeld. Wirtschaftlich vertretbar ist diese Methodejedoch nur, wenn sich Alkohole finden, die einen schnellenund kontrollierten Schadstoffaustrag in gelöster Form oderals freie Phase ermöglichen und bei der Sanierung zurück-gewonnen sowie mehrmals eingesetzt werden können.
Großskalige Versuche
In dem vom BMBF geförderten Projekt „Entwicklungeiner weitergehenden Grundwassersanierungstech-nologie zur Abreinigung von anthropogenen chlorier-ten Kohlenwasserstoffen hoher Dichte (CKW) durchAlkoholinjektion“ testeten die Wissenschaftler von IfHund VEGAS, ob sich Alkoholspülungen für die Sanierungeignen und wie sie zu dimensionieren sind. Forschungs-schwerpunkte waren Effizienz, Stabilität des Cocktails(Entmischbarkeit), Herstellungskosten und vor allem diehydraulische Kontrollierbarkeit. Dies bedeutet einerseits,
Sanierung mit Alkohol – Methoden der Erdölindustrie als Vorbild
dass ein Alkoholcocktail mit seinen spezifischen physikali-schen Eigenschaften gezielt zum Schadensherd transpor-tiert werden muss, und andererseits, dass eine unkontrol-lierte Mobilisierung des Schadstoffs zu vermeiden ist. DasIfH untersuchte, was geschieht, wenn Alkoholcocktailsräumlich gezielt in einen kontaminierten Grundwasser-leiter injiziert werden, und ob die Auswirkungen kontrol-lierbar bleiben. Um diese Fragen zu klären, führten dieExperten beider Institute unter anderem zwei großskaligeVersuche unter realitätsnahen Bedingungen durch.
In einem 6 x 3 x 4 Meter großen Behälter brachten die For-scher ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen (BTEX ) mitgeringer Dichte (LNAPL) so aus, dass der Schadstoff in resi-dualer Sättigung – also durch Kapillarkräfte „gefangen“ –unter der Wasseroberfläche sowie als aufschwimmendePhase vorlag. Über einen Horizontalbrunnen injiziertensie nun eine Alkohol-Wasser-Mischung (Isopropanol undWasser im Verhältnis 60 : 40) gezielt in den künstlichenGrundwasserleiter. Der Alkohol durchströmte den konta-minierten Bereich und löste den Schadstoff, der dann überzwei Vertikalbrunnen abgepumpt werden konnte. DasErgebnis: Fast 90 Prozent ließen sich entfernen.
In weiteren Versuchen bauten die Wissenschaftler ineinem heterogenen künstlichen Grundwasserleiter imGroßbehälter (9 x 6 x 4,5 m) eine CKW-Schadstoffquelle(TCE) ein. Über einen Grundwasserzirkulationsbrunnen
RESSOURCE WASSER | 1.1.1030
Die Alkoholspülung bei LNAPL-kontaminierten Grundwasserleitern

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | SANIERUNG MIT ALKOHOL 31
injiziierten sie im unteren Aquiferbereich einen Alkohol-cocktail. Gleichzeitig wurde über denselben Brunnen imoberen Bereich die Alkohol-Wasser-Schadstoffmischungabgezogen. Auch hier schafften es die Wissenschaftler,über 90 Prozent des Schadstoffs zu entfernen – in gelöster,aber auch in mobilisierter Form. Hervorzuheben ist, dassdabei keine unkontrollierte vertikale Verlagerung desSchadstoffs nach unten stattfand.
Um Kosten und Abwassermenge zu reduzieren, werdendie verwendeten Alkohole recycelt. Dazu entwarf undbaute das Projektteam eine Abwasseraufbereitungsanlage.
Reinigungsstarke Alkoholcocktails
Aufgrund ihrer erfolgreichen Versuche können die For-scher nun genauere Aussagen dazu machen, welche Alko-holcocktails sich für welchen Sanierungsfall eignen. FürCKW-Schadensfälle beispielsweise empfiehlt sich einCocktail aus 2-Propanol (54 Volumenprozent), 1-Hexanolund Wasser (beide je 23 Volumenprozent). Mit dieser Mischung konnte das Bodenmaterial in allen Versuchensicher und effizient gereinigt werden. Die erforderlicheAnfangskonzentration des Gemischs hängt von den Strö-mungsverhältnissen und der Heterogenität des Bodensab. Beachtet werden muss: je höher der Alkoholanteil, des-to teurer die Sanierung. Je niedriger er ist, desto größer dieGefahr, dass sich der Cocktail entmischt.
Komplexe Einsatzszenarien
Basierend auf den Versuchsdaten stellten die Projektpart-ner schließlich mathematische Gleichungen für dieAbhängigkeit der Dichte, Viskosität und Grenzflächen-spannung von Temperatur und Mischungsverhältnis auf.Sie dienen derzeit dazu, das numerische Modell MUFTE-UG (Multiphase Flow, Transport and Energy Model –Unstructured Grid) am Lehrstuhl für Hydromechanik undHydrosystemmodellierung des IWS um ein Modul zuerweitern, das eine komplexe Mehrphasen-/Mehrkompo-nentenströmung simulieren kann.
Projekt-Website www.vegasinfo.de
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften Institut für HydromechanikProf. Gerhard H. JirkaKaiserstr.1276128 KarlsruheTel.: 0721/608-2200Fax.: 0721/608-2202Förderkennzeichen: 02WT0065
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau, VEGASPfaffenwaldring 6170550 StuttgartTel.: 07 11/6 85-6 47 17Fax: 07 11/6 85-6 70 20E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WT0064
Wissenschaftlicher Leiter VEGASDr. Jürgen BraunTel.: 07 11/6 85-6 70 18E-mail: [email protected]
Technischer Leiter VEGASDr.-Ing. Hans-Peter KoschitzkyTel.: 07 11/6 85-6 47 16E-Mail: [email protected]
Große VEGAS-Rinne (Alkoholspülung bei DNAPL-Schadensfall)

Hohe Temperaturen sind ein gutes Mittel, um belas-tete Böden von Schadstoffen zu befreien. Das habenForscher der Versuchseinrichtung zur Grundwasser-und Altlastensanierung (VEGAS) im Institut für Was-serbau an der Universität Stuttgart bewiesen. IhreTechnologie zur thermischen In-situ-Sanierung (THE-RIS), eines der thermischen Sanierungsverfahren, rei-nigt kontaminierten Untergrund durch starke Wär-mezufuhr schneller als konventionelle Verfahren der„kalten“ Bodenluftabsaugung. In der Versuchsein-richtung VEGAS (siehe Projekt 1.1.09) haben Expertenim Rahmen eines Forschungsprojekts beide Verfah-ren miteinander verglichen – mit eindeutigemErgebnis.
Mittel- bis schwerlösliche, flüssige Kohlenwasserstoffe(LNAPL/DNAPL ) vergiften den Boden und gefährden dasGrundwasser. Zur Sanierung setzen Grundstückseigentü-mer häufig die sogenannte Bodenluftabsaugung (BLA)ein. Dabei werden die Schadstoffe, die bei ausreichendhoher natürlicher Temperatur in Gasform übergehen,über Rohre (Bodenluftpegel) zusammen mit der Luft ausdem belasteten Untergrund abgesaugt. In einer Abluftbe-handlungsanlage wird der Schadstoff vor Ort aus der kon-taminierten Bodenluft herausgefiltert und entsorgt. Diegereinigte Luft gibt die Anlage an die Atmosphäre ab. Diese Methode stößt jedoch schnell an ihre Grenzen: Dieorganischen Schadstoffe gehen bei den üblicherweise imBoden herrschenden Temperaturen von etwa zehn GradCelsius nur in geringem Maß von der Flüssig- in die Gas-phase über, was den Reinigungsprozess stark verlang-samt und verteuert. Außerdem sind feinkörnige Böden, indenen die Schadstoffe meist angereichert vorliegen, nichtdurchlässig genug. Die Bodenluft lässt sich dann schlechtabsaugen. Bei vielen dieser Anlagen ist nach mehrerenJahren noch immer ungewiss, ob sie das Sanierungszielerreichen werden.
Wärmezufuhr fördert den Schadstoffaustrag
Überwinden lassen sich diese Probleme mittels Wärme -zufuhr, zum Beispiel über feste Wärmequellen, wie dieelektrisch betriebenen Heizlanzen, auf denen das THERIS-Verfahren basiert. Heizt sich der Boden auf, gehen Schad-stoffe schneller in die Gasphase über und werden auch ausgeringer durchlässigen Bodenbereichen ausgetragen.Über die BLA werden die mit der Bodenluft vermischtengasförmigen Schadstoffe direkt aus dem Untergrundabgesaugt. Die abgesaugte, kontaminierte Bodenluft wirdvor Ort (on-site) gereinigt. Einsatzgebiete für THERIS sind
Wärme als Beschleuniger – Heizlanzen machen Bodenschadstoffen Dampf
unterschiedliche Bodenarten, vor allem Lockergesteine(Sand, Schluff, Lehm) in der Bodenzone oberhalb des Grund-wassers, der sogenannten ungesättigten Bodenzone.
Im Gegensatz zum thermischen In-situ-Sanierungsver-fahren – der Dampf- oder Dampf-Luft-Injektion – wird beiTHERIS kein Wärmeträgermedium injiziert. Dadurch können mit THERIS auch mächtige, gering durchlässigeBodenschichten aufgeheizt und gereinigt werden. Ver-gleichende Untersuchungen im Großbehälter der VEGAS-Versuchseinrichtung und an einem Feldstandort solltennun klären, wie sehr sich BLA und THERIS in Sanierungs-zeit, Zielerreichungsgrad und Energieverbrauch unter-scheiden.
Experiment im VEGAS-Großbehälter
Die Forscher erproben das THERIS-Verfahren zunächst ineinem 150 Kubikmeter großen Behälter der VEGAS-Ver-suchseinrichtung, der mit einem geschichteten Bodenauf-bau gefüllt und mit Messinstrumenten bestückt war. Indie einen Meter mächtige, gering durchlässige Feinsand-schicht infiltrierten sie lokal begrenzt 30 Kilogramm desSchadstoffs Trimethylbenzol (TMB, Siedepunkt 169 °C).
Zuerst betrieben sie für zwei Monate eine kalte Bodenluft-absaugung. Anschließend gingen vier quadratisch ange-ordnete, feste Wärmequellen (THERIS) in der Feinschichtin Betrieb, die bis zu 500 °C heiß werden. Die BLA lief mitkonstanter Absaugrate weiter. Als nach nur 20 Tagen das
RESSOURCE WASSER | 1.1.1132
Boden-Luft (Gas)-Absaugung
ungesättigte
Zone
Zone
Kontamination
Oberfläche
z.B. Schluff- oder Lehmschicht
FesteWärmequellen
Grundwasser U. Hiester, H.-P. KoschitzkyT. Theurer, A. Winkler,
Prinzip des THERIS-Verfahrens

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | WÄRME ALS BESCHLEUNIGER 33
TMB vollständig entfernt war, lagen die Bodentemperatu-ren zwischen den Heizelementen nicht einmal bei 100 °C.
Sanierung im Feldversuch
Zusätzlich starteten die Forscher einen Feldversuch. Ineiner etwa 3,5 Meter mächtigen Lehm-Mergel-Schichtbefanden sich auf rund 80 Quadratmetern Fläche nachmehrjährigem Betrieb einer kalten BLA noch CKW inhohen Konzentrationen, vornehmlich Perchlorethen(PCE, Siedepunkt 121 °C). Zunächst wurde etwa eineWoche lang die BLA unverändert weiterbetrieben. Dannkamen die 22 Heizlanzen der mit modernster Mess-, Rege-lungs-, Datenerfassungs- und Übertragungstechnik aus-gestatteten THERIS-Anlage zum Einsatz. Sie erwärmtenden Boden gleichmäßig, und zwar relativ unbeeinflusstvon geologischen Strukturunterschieden. Schon nacheinem Monat waren etwa 80 °C, nach zwei Monaten groß-teils über 90 °C erreicht. Mit der BLA saugten die Forscherdie von THERIS mobilisierten gasförmigen Schadstoffe ab.
THERIS hat die Nase vorn
Die Auswertung der Versuche ergab: THERIS spart im Ver-gleich zur kalten BLA rund 90 Prozent der Sanierungszeitund zwei Drittel der Energie ein. Vorhandene Unterschie-de in den Absolutwerten zwischen Großbehälter und Feld-anwendung gehen auf Standortfaktoren wie Geologie,Schadstoffart und -verteilung sowie Anlagenspezifika (z. B. Brunnenanordnung) zurück.
THERIS reinigt selbst gering durchlässige Böden in weni-gen Wochen schnell, zuverlässig und nachhaltig. Eine sig-nifikante Leistungssteigerung bewirken vor allem
die höhere Gasdurchlässigkeit und effektivere Diffusi-on aufgrund des getrockneten Bodens sowie
der durch die höheren Temperaturen beschleunigteÜbergang der flüssigen Kohlenwasserstoffe in die Gas-phase.
Die Robustheit der THERIS-Anlagen erlaubt es, sie schnellzu installieren und sicher und wetterunabhängig zu betrei-ben. Die Installationskosten liegen – bedingt durch denEinbau von Heizelementen und Monitoringsystemen –höher als bei der kalten Bodenluftabsaugung. DiesenMehrkosten stehen durch die kürzere Sanierungszeit abergeringere Betriebs- (für Energie, Anlagenmiete etc.) undPersonalkosten gegenüber.
Projekt-Website www.vegasinfo.de
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau, VEGASPfaffenwaldring 6170550 StuttgartTel.: 07 11/6 85-6 47 17Fax: 07 11/6 85-6 70 20E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WT0266
Wissenschaftlicher Leiter VEGASDr. Jürgen BraunTel.: 07 11/6 85-6 70 18E-Mail: [email protected]
Technischer Leiter VEGASDr.-Ing. Hans-Peter KoschitzkyTel.: 07 11/6 85-6 47 16E-Mail: [email protected]
Anwendungsbereiche des THERIS-Verfahrens Heizlanzen und Bodenluftabsaugpegel beim Einbau in den Großbehälter

RESSOURCE WASSER | 1.2.034
Lebensadern erhalten – Ganzheitliches und nachhaltigesFlussgebietsmanagement

ÖKOLOGIE | FLUSSGEBIETE 35
Flüsse sind Lebensadern der Natur. Sie sam meln dasWasser der Kontinente und trans portieren es in dieMeere, sie gliedern die Landschaft und dienen vielenTierarten als Lebensraum. Zugleich erfüllen sie einewich tige wirtschaftliche Funktion als Verkehrs wege,Energielieferanten und Trinkwasserquellen. Dochbei Hochwasser werden Flüsse zur Gefahr für Lebenund Eigentum der Men schen. Noch nicht gelöst istin vielen Regio nen der Welt außerdem die Schad-stoffpro blematik. Diese Vielfalt von Aspekten undihre Wechselwirkungen werden nur durch ein nach-haltiges Flussgebietsmanagement beherrschbar.
Der Begriff des Flussgebietsmanagements, abgeleitet ausder englischen Bezeichnung „river basin management“,steht für eine an natürlichen Einzugsgebietsgrenzen (stattan Stadt-, Kreis- oder ähnlichen Verwaltungsgrenzen) aus-gerichtete Wasserwirtschaft. Es hat somit einen räumli-chen Handlungsrahmen, in dem die natürlichen Zusam-menhänge des Wasserkreislaufs erkennbar werden undunmittelbar wirksam sind.
Neues Verständnis von Gewässerbewirtschaftung
Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentsund des Rates, allgemein als Europäische Wasserrahmen-richtlinie (EG-WRRL) bekannt, ist am 22. Dezember 2000in Kraft getreten. Sie trägt in starkem Maße den Gedankendes Flussgebietsmanagements in sich und verfolgt alsKernziel den Schutz der aquatischen Ökosysteme im Hin-blick auf eine nachhaltige Entwicklung der Umwelt. ImGegensatz zur bisherigen Betrachtung der Gewässer, diebislang eher nutzungs- und maßnahmenbezogen sowiesektoral ausgerichtet war, steht mit der EG-WRRL nuneine übergreifende, integrale Betrachtung der SystemeGrundwasser und Oberflächengewässer (Fließgewässer,stehende Gewässer, Übergangsgewässer und Küstenge-wässer) im Mittelpunkt.
Die Wasserwirtschaft orientiert sich damit künftig nichtmehr an den administrativen Grenzen, sondern an denFlusseinzugsgebieten. Dies öffnet den Weg zu einer ganz-heitlichen Betrachtung der natürlichen Gewässersystemeund ihrer Nutzung von der Quelle bis zur Mündung. ÜberStaats- und Ländergrenzen hinweg sollen Gewässer durchein koordiniertes Vorgehen schonend genutzt undgeschützt werden.
Instrumente für ein nachhaltiges Flussgebietsmanagement
Diese Anforderungen machen das Management von Flusseinzugsgebieten zur komplexen Aufgabe für Wissen-schaft und Praxis. Um in diesem neuen Feld Handlungs-an leitungen zu entwickeln, unterstützt das Bundesminis-teri um für Bildung und Forschung (BMBF) Forschungspro-jek te rund um das Flussgebietsmanagement. Neben derErforschung der komplexen Wechselwirkungen zwischenFlüssen und ihren Einzugsgebieten stehen dabei auch Fragestellungen der Renaturierung und des Naturschut-zes im Fokus der Wissenschaft. Schwerpunkte der vergan-genen Jahre waren zum Beispiel die Elbe-Öko logie-Fors-chung (Projekt 1.2.01), das Flussgebietsmanage ment (Projekt 1.2.02), das Risikomanagement extremer Hoch-wasserereignisse oder das integrierte Wasserres sourcen-management. Die Sedimente der Fließgewässer wurdenim Rahmen des BMBF-Verbundprojektes „Feinsediment-dynamik und Schadstoff mobilität in Fließgewässern“(SEDYMO) (Projekt 1.2.03) betrachtet. Damit soll ein Bei-trag zu ökologischen Unterhaltungsbaggerungen an Bun-des wasserstraßen, zu einer nachhaltigen Bewirtschaftungkontaminierter Überflutungssedimente und zur Planungund Durchführung von Sedimentausräumungen zur Ver-besserung der Gewässerstruktur und -ökologie geleistetwerden. In einem gemeinsam vom BMBF und Bundesmi-nisterium für Umwelt, Natur schutz und Reaktorsicherheit(BMU) geförderten Verbundprojekt wurden die Vorausset-zungen für eine erfolgreiche Wiedereinbürge rung desStörs (Projekt 1.2.04) geschaffen.
Auch auf europäischer Ebene werden im Rahmen des For-schungsprogramms der europäischen Union FuE- undNetzwerkprojekte zum Flussgebietsmanagement bzw.integriertes Wasserressourcenmanagement, IWRM,gefördert. Ein Beispiel hierfür ist das EU-Projekt „IWRM-Net“, indem 21 Institutionen aus 14 Ländern vertretensind, unter ihnen auch das BMBF mit seinen beiden Pro-jektträgern Karlsruhe (PTKA) und Jülich (PTJ). Mit diesemProjekt wird die Ausbildung bzw. Stärkung eines europäi-schen Flussgebietsmanagements verfolgt. IWRM-Net bie-tet den beteiligten Ländern die Möglichkeit, ihre Stand-ortgegebenheiten als auch ihre Erfahrungen auf europäi-scher Ebene auszutauschen, gemeinsame Projekte zustarten und ggf. sogar zukünftige Konzepte für einegemeinsame Forschungs- und Entwicklungszusammenar-beit zu entwickeln.

Das Flussgebiet der Elbe bietet Wissenschaftlernökologischer Disziplinen ein äußerst spannendesForschungsfeld. Während die Wasserqualität derElbe bis vor einigen Jahren äußerst schlecht war,konnten die Auen des ehemaligen Grenzflusses dievielfältige Struktur behalten, die den meisten Flüs-sen vergleichbarer Größe durch Baumaßnahmen geraubt wurde. So haben der 1.091 Kilometer langeStrom und sein Einzugsgebiet das Potenzial, auchin Zukunft als naturnahe Flusslandschaft zu überle-ben. Das Elbe-Gebiet gilt daher als Modellregion, inder Experten Nutzungskonflikte erforschen undLösungskonzepte erarbeiten.
Wegen ihrer Struktur und Geschichte ist die Elbe Gegen-stand von vielerlei Forschungsaktivitäten unterschied-lichster wissenschaftlicher Disziplinen – ganz im Sinne derEU-Wasserrahmenrichtlinie . Denn diese verlangt einFlussgebietsmanagement , das sich an Nachhaltigkeits-aspekten orientiert. Entwicklungskonzepte für großeFlusslandschaften mit ihren vielfältigen Wechselwirkun-gen gab es zuvor – auch international – erst ansatzweise.Mittlerweile setzt sich die Erkenntnis durch, dass derErhalt von Flusslandschaften eine ganzheitliche Betrach-tung erfordert, die sich auf eine komplexe Bewertung derökologischen und wirtschaftlichen Situation im Flussein-zugsgebiet stützen muss.
In diesem Sinne hat das BMBF von 1996 bis 2005 im „For-schungsverbund Elbe-Ökologie“ mit rund 20 MillionenEuro 28 wissenschaftliche Projekte gefördert. In den Ein-zelprojekten untersuchten Experten ökologische und öko-nomische Zusammenhänge und entwickelten Lösungs-konzepte für verschiedene Nutzungsansprüche der Land-wirtschaft, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft undder Schifffahrt.
Naturräume statt Verwaltungseinheiten
Die Forscher sollten nicht nur wissenschaftliche Erkennt-nisse sammeln, sondern auch Instrumente und Hand-lungsempfehlungen für Politiker und Planer erarbeiten.Entsprechend den Anforderungen der EU-Wasserrah-menrichtlinie wurden der Strom, seine Auen und das Einzugsgebiet dabei als funktionale Einheit betrachtet.Gerade die Auswirkungen der Elbeflut 2002 und der extre-men Trockenheit 2003 haben auf drastische Weise deut-lich gemacht, dass ökologische Phänomene nicht inner-halb von Verwaltungsgrenzen, sondern von Naturräumenzu betrachten sind.
Das Elbegebiet – Ein Forschungsmodell für die Flussbewirtschaftung der Zukunft
Drei Forschungsschwerpunkte
Themenbereich „Ökologie der Fließgewässer“ Schlagworte wie „Schaffung von Retentionsräumendurch Verlegung von Deichen“ und „Garantie von Min-destfahrwassertiefen durch angepasste flussbaulicheUnterhaltungsmaßnahmen“ sind nach den Hochwassernin aller Munde. Aber solche Maßnahmen haben Einflussauf die Wasserstände, wirken auf die Hydrodynamiksowie Morphodynamik der Gewässer und beeinflussendie Lebensbedingungen von Fischen und Kleinstlebewe-sen. Besonders die kleinsten Organismen in der Elbe habenfür Stoffumsetzungen und damit für die Gewässergüteeine große Bedeutung. Die Forscher gingen diesen Zusam-menhängen nach, indem sie die morphologischen ,hydraulischen und biozönotischen Wirkungsgeflechteuntersuchten. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Pro-zesse die Zusammensetzung und die Dynamik der Lebens-gemeinschaften in der Elbe steuern. Antwort gaben dieErgebnisse eingehender Felduntersuchungen und dieerarbeiteten Modelle. So entstand ein zeitgemäßer, umfas-sender Überblick über die Erforschung der Wasserquali-tät, der auch Entscheidungshilfen für die Planung wasser-baulicher Maßnahmen beinhaltet.
Themenbereich „Ökologie der Auen“ Bauliche Eingriffe in Flüsse und Landnutzungsänderungenin Auen haben ökologische Folgen. In der öffentlichen Dis-kussion werden verstärkt die Ausweisung von Überschwem-mungsgebieten und die Renaturierung von Flussauen gefordert. Doch es stellt sich die Frage, wie eine umweltge-rechte Auenentwicklung im Elbegebiet aussehen kann. DieKonsequenzen für die betroffene Landwirtschaft, die Bevöl-kerung sowie die Tier- und Pflanzenwelt müssen berück-sichtigt werden. Die Projekte dieses Themenbereichs zei-gen Handlungsempfehlungen für den Naturschutz auf undformulieren Leitbilder für die ökologische Entwicklung der
RESSOURCE WASSER | 1.2.0136
Blick auf die Elbe und die Elbeauen (Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde)

ÖKOLOGIE | FLUSSGEBIETE | FLUSSBEWIRTSCHAFTUNG IM ELBEGEBIET 37
Auen, wobei auch wirtschaftliche Aspekte beachtet sind.Dazu mussten die aktuellen Forschungsergebnisse zuSteuerfaktoren, Bioindikation und Prognose der Lebens-gemeinschaften der Elbe und ihrer Auen zusammenge-fügt werden. Parallel bestand ein wesentlicher Teil der Arbeiten darin, Nutzen und Kosten von Eingriffen aufzu-zeigen, denn sie sind letztendlich entscheidend für politi-sche Entscheidungen. So haben die Forschungsergebnissebeispielsweise auch wesentliche Grundlagen für das Plan-feststellungsverfahren zur Deichrückverlegung bei Len-zen geliefert. Es ist bisher das bundesweit größte Vorha-ben dieser Art und mittlerweile umgesetzt.
Themenbereich „Landnutzung im Einzugsgebiet“ Diffuse Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sindheute einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für dieGewässerqualität der Elbe. Die Ursachen für diese Einträ-ge sind aufgrund der naturräumlichen Eigenschaften undder Nutzungsstrukturen im Elbe-Einzugsgebiet regionalsehr unterschiedlich. In den Projekten dieses Themenbe-reichs prüften die Wissenschaftler, wie die Gewässerquali-tät der Elbe und damit auch der Nordsee durch eine ver-änderte Landnutzung oder andere landwirtschaftlicheVerfahren verbessert werden kann. Mithilfe von Wasser-und Stoffhaushaltsmodellen zeigten sie, welche Maßnah-men ökologisch anzustreben und ökonomisch vertretbar
sind, um die Landnutzung und den Wasserhaushalt imElbegebiet zu steuern. Auf dieser Grundlage wurden Stra-tegien zur Minderung von Gewässerbelastungen entwi-ckelt und vorgeschlagen. Hervorzuheben ist hier beispiels-weise das Verfahren der konservierenden Bodenbearbei-tung. Dieses Bewirtschaftungssystem wirkt sich positiv aufbodenphysikalische, hydrologische und biologische Para-meter aus, senkt den Bodenabtrag und verringert damitgleichzeitig die Phosphateinträge in die Gewässer.
Darstellung der Ergebnisse in unterschiedlichen Medien
Die Ergebnisse des Forschungsverbunds Elbe-Ökologiewurden in drei Medien für unterschiedliche Bedürfnisseaufbereitet:
Das internetbasierte Elbe-Informations-System (ELISE) gibt Auskunft über die Elbe-Ökologie-Forschung und unterstützte die Koordination der Pro-jektarbeiten.Die fünf Bände der Publikationsreihe „Konzepte fürdie nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“fassen die Erkenntnisse projektübergreifend zusam-men und stellen Konzepte für die Praxis vor(http://www.weissensee-verlag.de/verlagspro-gramm/04_niw_flusslandschaft.htm).Das „Elbe-DSS “, ein Entscheidungs-Unterstützungs-System zum Flusseinzugsgebiets-Management, struk-turiert das für das Elbe-Einzugsgebiet erarbeiteteFachwissen sowie verwendete Computermodelle undDaten in einem Grundgerüst. Solche Systeme könnenBehörden künftig bei der Bewirtschaftungsplanunghelfen. Sie erlauben es, vorab die komplexe Wirkungeinzelner Maßnahmen im Hinblick auf die zu errei-chenden Ziele zu erkennen. Die Bundesanstalt fürGewässerkunde (BfG) stellt den entwickelten Prototy-pen des Elbe-DSS per Internet frei zur Verfügung(http://elise.bafg.de/?3283).
Der Forschungsverbund Elbe-Ökologie
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)Dr. Sebastian KofalkMainzer Tor 156068 KoblenzTel.: 02 61/13 06-53 30Fax: 02 61/13 06-53 33E-Mail: [email protected]: www.bafg.de, http://elise.bafg.deFörderkennzeichen: 0339542A

Flüsse sind zentraler Bestandteil des Wasserkreis-laufs. Um diese Funktion nachhaltig zu gewährleis-ten, müssen sie unter anderem vor Stoffeinträgengeschützt werden. Dieser Sicherungsaufgabe hatsich die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL )mit der Forderung nach einer entsprechendenUmweltgestaltung verschrieben. Im Projekt REG-FLUD hat ein interdisziplinäres Team diese Anforde-rungen aufgegriffen und sich wissenschaftlich mitdem systematischen Management regionaler Fluss -einzugsgebiete befasst. Am Beispiel der Flüsse Rheinund Ems untersuchten die Experten Maßnahmender Landwirtschaft zur Verbesserung der Wasser-qualität.
Deutsche Gewässer sind heute weniger mit Nährstoffenbelastet als früher; sie sind in den vergangenen Jahrzehn-ten erheblich sauberer geworden. Zu dieser positiven Ent-wicklung haben in erster Linie eine verbesserte Abwasser-reinigung und eine verringerte Verwendung von Phos-phaten in Waschmitteln beigetragen. Trotz dieser bishererreichten Erfolge im Gewässerschutz sind aber nach wievor große Teile der Gewässer mehr oder weniger stark mitNährstoffen belastet. Ein Großteil der Nährstoffe in Flüs-sen stammt aus diffusen – also nicht genau lokalisierbaren– Quellen, insbesondere aus der Landwirtschaft. Durch dielandwirtschaftliche Produktion werden Stickstoff undPhosphor eingetragen, die dann den ökologischen Zustandund die Nutzbarkeit des Wassers und der Meere beeinflus-sen. Um den Zustand der Gewässer weiter zu verbessern,verlangt die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr2000 Managementsysteme für alle Flusseinzugsgebieteeinzurichten.
Neue Anforderungen
Viele für Gewässernutzung und -schutz verantwortlichestaatliche Stellen betreten Neuland, wenn sie sich mit dif-fusen Nährstoffeinträgen befassen. Anders als bei punktu-ellen Einträgen lassen sich hier weder Verursacher nochWirkung eindeutig identifizieren. Das liegt vor allem anden unterschiedlichen naturräumlichen Verhältnissenwie Wasserhaushalt und Bodenbeschaffenheit, die Trans-port, Bindung und Abbau der Nährstoffe im Untergrundund im Grundwasser beeinflussen. In vielen Fällen fehlenden Behörden die Instrumente und Methoden, um übereffiziente Strategien oder Maßnahmen zur Reduzierungder diffusen Gewässerbelastung durch die Landwirtschaftzu entscheiden.
Untersuchung an Rhein und Ems – Managementsystemefür die Wasserqualität in Flusseinzugsgebieten
Unterschiedliche Untersuchungsregionen
Hier setzte das vom BMBF geförderte Verbundprojekt„Management regionaler Flusseinzugsgebiete inDeutschland (REGFLUD) – Rahmenbedingungen undPolitikoptionen bei diffusen Nährstoffeinträgen(Stickstoff und Phosphor) der Landwirtschaft“ an. Zielwar es, wissenschaftliche Methoden zu erarbeiten, mitderen Hilfe sich effiziente Maßnahmen zur Reduktion
RESSOURCE WASSER | 1.2.0238
Die Flussgebiete des REGFLUD-Projekts

ÖKOLOGIE | FLUSSGEBIETE | UNTERSUCHUNG AN RHEIN UND EMS 39
diffuser Nährstoffeinträge der Landwirtschaft in Flussein-zugsgebieten ermitteln lassen. Die Untersuchungen zwi-schen Juli 2001 und Oktober 2005 konzentrierten sichexemplarisch auf zwei Flusseinzugsgebiete: ein Teilein-zugsgebiet des Rheins zwischen den Nebenflüssen Sieg,Erft, Wupper und Ruhr und das gesamte Einzugsgebietder Ems. Die Untersuchungsregionen unterscheiden sichsowohl in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung alsauch durch die Standortbedingungen.
Kopplung von Systemen und Modellen
Den Schwerpunkt des REGFLUD-Projekts bildete die Kopp-lung des „Regionalisierten Agrar- und Umweltinformati-onssystems“ (RAUMIS) für Deutschland mit den hydrologi-schen Modellen GROWA98 und WEKU. Mit RAUMIS kön-nen regionale Auswirkungen unterschiedlicher agrar-und agrarumweltpolitischer Maßnahmen auf landwirt-schaftliche Landnutzung, Produktion und Einkommensowie diverse Agrar-Umweltbeziehungen, wie beispiels-weise die landwirtschaftlichen Nährstoffüberschüsse,analysiert werden. Die Modelle GROWA und WEKU bildenauf dieser Basis – unter Berücksichtigung vielfältigerStandortbedingungen wie Boden, Klima und Gelände-form – den Nährstoffeintrag in Gewässer flächendifferen-ziert ab. Die Ableitung effizienter Maßnahmen zur Reduk-tion von Stickstoffeinträgen aus der Landwirtschaft mit-hilfe des Modellverbunds wurde beispielhaft an einerStickstoffsteuer sowie einer Begrenzung der Viehbesatz-dichte getestet.
Maßgeschneiderte Maßnahmen notwendig
Die Modellergebnisse zeigen, dass durch die unterschied-lichen regionalen Standorteigenschaften sehr unter-schiedlich Anteile der Stickstoffbilanzüberschüsse aus derLandwirtschaft in Grund- und Oberflächengewässer ein-getragen werden. Die nachgewiesenen, räumlich starkvoneinander abweichenden Auswirkungen einer Stick-stoffsteuer und einer Limitierung der Viehbesatzdichteauf die Stickstoffausträge dokumentieren, dass nur auf diejeweilige Region zugeschnittene Maßnahmen zu einernachhaltigen Lösung des Nitratproblems beitragen kön-nen. Die integrierte Betrachtung der Standorteigenschaf-ten und der komplexen Wechselwirkungen durch denModellverbund ermöglicht es, effizientere Gewässer-schutzmaßnahmen zu entwickeln.
Schritt in die Praxis
Im Rahmen des von Bund und Anrainerländern getrage-nen Pilotprojekts AGRUM-Weser werden weitere regiona-le Lösungen mit dem REGFLUD-Ansatz entwickelt. Dazuwird der Verbund um das Modell MONERIS erweitert, dasalle relevanten Eintragspfade berücksichtigt. In Zusam-menarbeit mit den für die WRRL zuständigen Akteurenim Flusseinzugsgebiet der Weser werden zusätzlich län-derspezifische Vorgehensweisen berücksichtigt. Das Zielist, operationelle Maßnahmen zur Reduzierung diffuserNährstoffeinträge der Landwirtschaft hinsichtlich ihrerAuswirkungen zu analysieren und zu bewerten. Damit hatdas Forschungsvorhaben REGFLUD den entscheidendenSchritt in die Praxis getan.
ProjektkoordinationInstitut für ländliche Räume der Bundesforschungs-anstalt für Landwirtschaft (FAL)Dr. Heinrich BeckerBundesallee 5038116 BraunschweigTel.: 05 31/5 96-55 03Fax: 05 31/5 96-55 99E-Mail: [email protected]:www.vti.bund.de/de/startseite/institute/lr.htmlFörderkennzeichen: 0330037 bis 0330040
Düngerausbringung in der Landwirtschaft (Quelle: www.oekolandbau.de)

Gewässer sind die Endstation vieler vom Menschenin die Umwelt eingebrachter Schadstoffe. Hier sam-meln sich direkt eingeleitete Schadstoffe ebenso an,wie durch Niederschläge und Hochwasser abge-schwemmte Feststoffe und gelöste Verbindungen.Einige Schadstoffe werden bevorzugt an Partikelgebunden und mit den Sedimenten auf dem Gewäs-sergrund abgelagert. Von dort aus können sie wie-der ins Wasser gelangen, etwa wenn sie durch dasVertiefen der Fahrrinnen oder bei Hochwasser auf-gewirbelt werden oder infolge chemischer Vorgän-ge wieder in Lösung gehen. Ein Forschungsprojektnimmt sich dieser wichtigen Problematik an underarbeitet fehlendes Grundlagen- und Prozesswissen.
Obwohl immer weniger Schadstoffe in Deutschlands Flüs-se geleitet werden, sind ihre Sedimente vielerorts nochstark mit Umweltchemikalien belastet. Diese Stoffe gelan-gen nicht nur über Abwässer in die Gewässer. Ursachenfür die Schadstoffbelastung sind auch Einträge aus derLuft, aus Niederschlägen und durch Hochwasser, das belas-tete Feststoffe aus Deponien oder Abraumhalden mit sichführt. Besonders betroffen sind Flussmündungen, da sichdort die Schadstoffe des gesamten Flusslaufs sammeln.
Feinsedimente sind für die Schadstoffforschung an Gewäs-sern von besonderem Interesse. Sie beinhalten vergleichs-weise große Mengen an Schadstoffen und sind durch ihregroße Partikeloberfläche chemisch und physikalisch sehrreaktiv. Unter den Begriff Schadstoffe fallen nicht nur dieunmittelbar giftigen Umweltchemikalien wie Schwerme-talle oder bestimmte organische Verbindungen. Dazugehören Stoffe, die indirekt die Gewässergüte verschlech-tern können, etwa organische Substanzen oder die Nähr-stoffe Stickstoff und Phosphor. Durch Abbauprozesse undstarkes Algenwachstum vermindern sie den Sauerstoffge-halt der Gewässer.
Dynamik der Schadstofffreisetzungen
Von den Flüssen transportierte Feststoffe sowie Teile vongelösten Stoffen lagern sich je nach Fließgeschwindigkeitund in Abhängigkeit vom chemischen und biologischenZustand des Wassers in den Flussbetten und Überflu-tungsbereichen ab. Die Sedimente zeigen somit auch dieGewässerbelastung vergangener Tage an. Ihre Bestandtei-le können aber auch wieder freigesetzt werden. Handeltes sich um Feststoffe (mineralische oder organische Parti-kel), so sind daran natürliche oder künstliche Erosionspro-zesse beteiligt. Auslöser sind beispielsweise Hochwasser,
Verbundprojekt SEDYMO – Einflüsse der Sedimentdynamik auf die Qualität von Fließgewässern
Schiffsbewegungen oder sogenannte Unterhaltungsbag-gerungen, durch die Gewässer schiffbar bleiben. LöslicheSchadstoffe, die zwischenzeitlich an das Sediment gebun-den waren, können durch (mikro-)biologische und chemi-sche Prozesse freigesetzt werden.
Das Wissen um die Dynamik schadstoffbelasteter Sedi-mente gewinnt bei der Umsetzung der europäischen Was-serrahmenrichtlinie (WRRL) zunehmend an Bedeutung.Im Mittelpunkt der Richtlinie stehen flussgebietsübergrei-fende Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte.
Bis heute werden Aussagen über den Eintrag von Schad-stoffen in ein Gewässer vorrangig anhand bekannterQuellen außerhalb der Gewässer getroffen. Dazu gehörendiffuse Quellen wie die Landwirtschaft oder Punktquellenwie Deponien oder Industriebetriebe. Diese Herangehens-weise vernachlässigt aber einen ganz wesentlichen Faktor:die erneute Freisetzung von schadstoffhaltigen Teilchen,die sich in den Ablagerungen des Flussbetts befinden.
Um diesen Aspekt der Sedimentforschung voranzubrin-gen, wurde im Mai 2002 das BMBF-Verbundprojekt „Fein-sedimentdynamik und Schadstoffmobilität in Fließge-wässern“ (SEDYMO) gestartet. Es soll dazu beitragen,Unterhaltungsbaggerungen an Bundeswasserstraßenökologisch zu optimieren, kontaminierte Überflutungs-sedimente nachhaltig zu bewirtschaften und Sediment-ausräumungen zur Verbesserung der Gewässerstrukturund -ökologie zu planen und durchzuführen.
Interdisziplinäre Herangehensweise
Das vom Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaftder TU Hamburg-Harburg koordinierte Verbundprojektmit zwölf weiteren Partnern (siehe Projekt-Website der
RESSOURCE WASSER | 1.2.0340
Sedimentprobenahme am Rhein
Einsatz eines In-situ-Erosionstestgerätsan der Elbe

ÖKOLOGIE | FLUSSGEBIETE | VERBUNDPROJEKT SEDYMO 41
TUHH) verbindet zwei zentrale Fragestellungen: das dyna-mische Abtrags- beziehungsweise Ablagerungsverhaltender Feinsedimente sowie die Mobilität von Schad- undBelastungsstoffen in Sedimenten und Schwebstoffen. Dadie beiden Aspekte in der Praxis eng miteinander verknüpftsind, ist ein gemeinsamer Forschungsansatz technischerund naturwissenschaftlicher Fachdisziplinen nötig.
In der ersten Phase des Vorhabens untersuchte das Pro-jektteam die Erosion und den Transport feinkörniger Sedimente am Beispiel des Neckars und der Elbe. Als Mess-apparaturen verwendeten die Forscher den Strömungska-nal, den Mikrokosmos und die Turbulenzsäule. Physika-lisch-chemische und mikrobiologische Analysen begleite-ten die methodischen Arbeiten. Weitere Teilprojektebefassten sich mit vergleichenden Untersuchungen überden Transport feinkörniger Sedimente, die unter naturna-hen Bedingungen in Hafenbecken und deren Einfahrtenstattfanden. Ein weiteres Teilprojekt untersuchte die Ver-mischung feinkörniger Partikel in der Elbe. In der zweitenPhase untersuchten die Wissenschaftler schwerpunktmä-ßig den Transport von Nähr- und Schadstoffen. Die in derNatur auftretenden Wechselwirkungen zwischen Aggre-gaten, Schadstoffen, Wasser und Boden wurden quantifi-ziert, als Steuergrößen der biologischen, sedimentologi-schen und chemischen Prozesse eingeordnet und inModellen zusammengeführt. In weiteren sechs Teilprojek-ten gewannen die Wissenschaftler grundlegende Kennt-nisse über die physikalisch-chemischen und biologischenEigenschaften von Gewässerfeststoffen.
Breites Anwendungsspektrum
Die Untersuchungen zeigten, dass die Geschwindigkeit, in der organische Schadstoffe an das Sediment sorbiert(gebunden) und wieder desorbiert (freigesetzt) werden,stark von hydrodynamischen Bedingungen abhängt.Dagegen haben Veränderungen der hydrochemischenZusammensetzung des Fließgewässers, zum Beispiel infol-ge von Hochwasserereignissen, einen geringeren Einflussauf das Schadstoffbindungsverhalten als bisher angenom-men.
Die im Rahmen des Verbundprojekts entwickelten Geräteund Modelle zur Charakterisierung und Prognose der Ero-sionsstabilität von Sedimenten kamen bereits in der Praxiszum Einsatz. Beispielsweise wurden Überflutungsflächennach dem Extremhochwasser an der Elbe im August 2002untersucht. Außerdem beteiligten sich Wissenschaftlerdes Forschungsverbundes an der Risikobewertung im Fall„Staustufe Iffezheim“. Die Umlagerung von 300.000Kubikmetern stark belasteter Rheinsedimente hatte hiereine internationale Kontroverse ausgelöst.
Die Ergebnisse von SEDYMO gehen außerdem unmittel-bar ein in die Arbeit des Fachausschusses „Bewirtschaf-tung kontaminierter Sedimente“ der Deutschen Vereini-gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)und in die BMBF-Förderaktivität „Risikomanagementextremer Hochwasserereignisse“ (RIMAX). Sie werdenbesondere Aktualität erhalten, wenn gemäß WRRL weite-re Maßnahmen gegen Schadstoffquellen in die Wegegeleitet werden. Dabei wird die Verringerung der Schad-stoffemissionen aus den historisch kontaminierten Sedi-menten eine zentrale Aufgabe sein.
Die Buchpublikation „Sediment Dynamics and PollutantMobility in Rivers – An Interdisciplinary Approach“ ist dasReferenzwerk für ingenieurtechnische und naturwissen-schaftliche Wechselbeziehungen von kontaminiertenSedimenten in Fließgewässern und wurde im Rahmen desSEDYMO-Projekts aus den Beiträgen zum „InternationalSymposium on Sediment Dynamics and Pollutant Mobilityin River Basins“ zusammengestellt.
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft(IUE)Prof. (i. R.) Dr. Ulrich FörstnerEissendorfer Straße 4021071 HamburgE-Mail: [email protected]: Stöversweg 6 a21244 BuchholzTel.: 0 41 81/3 67 90Internet: www.tu-harburg.de/iue/sedymo
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau (IWS)Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard WestrichPfaffenwaldring 6170569 StuttgartTel.: 07 11/68 56 37 76E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WF0315 – 0318,
02WF0320 – 0322, 02WF0467 – 0470
Sedimentprobenahme an der Salzach

Mit dem Stör ist ein typischer Bewohner norddeut-scher Flüsse verschwunden. Seine Ausrottung ist einSymptom für den Zustand der Gewässer: In verbau-ten und verschmutzten Flüssen haben es vor allemwandernde Fischarten schwer, geeignete Bedingun-gen zu finden. Ein aktuelles Verbundprojekt desBMBF und des BMU schafft seit 1996 die Vorausset-zungen für eine erfolgreiche Wiedereinbürgerungdes Störs. Die Wissenschaftler haben bereits Eltern-tierbestände für den Nord- und Ostseestör aufge-baut und erste Jungtiere im Rahmen experimentel-ler Besatzmaßnahmen in Oder und Elbe freigesetzt.Die Keimzelle der Nachzucht bilden Fische aus fran-zösischen und kanadischen Flüssen.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Störe an der gesam-ten europäischen Küste verbreitet. Sie hatten Laichplätzein allen großen europäischen Flüssen. Heute ist dieseFischart weltweit vom Aussterben bedroht. Die Verbau-ung und Verschmutzung der Flüsse zerstörte ihre Lebens-grundlage, während gleichzeitig intensiver Fischfang diePopulationen dezimierte. Einzelfänge von Stören wurdenin deutschen Gewässern noch bis 1992 registriert. Danachgalt der Stör in Deutschland als ausgestorben.
Doch nicht nur der Stör, auch andere Wanderfische, wieLachs, Meerforelle, Schnäpel, Maifisch und Finte leidenunter der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Die Erfah-rungen mit der Wiedereinbürgerung des Störs und mögli-che Renaturierungsmaßnahmen kommen also auchanderen Fischpopulationen zugute.
Bewohner verschiedener Gewässer
Der Stör ist ein Wanderfisch, der zum Laichen aus denMeeresgebieten weit in die Flüsse aufsteigt. Hier legt er instark strömendem Wasser über eine Million Eier ab. Sinddie Larven geschlüpft und zwischen den Kieseln herange-wachsen, verdriftet die Brut mit der Strömung in futterrei-che Flussabschnitte. Die Jungfische wandern am Endeihres ersten Lebensjahres in das Brackwasser der Fluss-mündungen, von wo aus sie nach zwei bis vier Jahren insMeer übersiedeln. Nach zehn bis 20 Jahren kommen diegeschlechtsreifen Tiere wieder in ihre Geburtsflüssezurück um zu laichen.
Der Stör kehrt zurück – Wiedereinbürgerung eines alten Flussbewohners
Projektverbund zur Wiedereinbürgerung
In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Wasserqualitätder Flüsse wesentlich verbessert – eine Chance für dieWiedereinbürgerung der Störe, welche die Gesellschaftzur Rettung des Störs e. V. 1994 ergriffen hat. Seit 1996unterstützen das Bundesforschungs- und das Bundesum-weltministerium einen Projektverbund zur Wiederein-bürgerung des Störs in den Zuflüssen der Nord- und Ost-see mit mehr als 1,8 Millionen Euro. Beteiligt an dem Pro-jekt „Genetische Populationsstruktur, Zuchtplan undkünstliche Vermehrung einer süßwasseradaptiertenZuchtgruppe des Europäischen Störs (Acipenser sturio)als Voraussetzung einer erfolgreichen Wiedereinbür-gung“ sind das Bundesamt für Naturschutz (BfN), das Ber-liner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfi-scherei (IGB), die Landesforschungsanstalt für Landwirt-schaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern sowieweitere Forschungseinrichtungen.
Geeignete Störe werden gezüchtet
Entscheidend für die Wiederbesiedelung der Gewässer sindausreichend viele Fische, die den ehemals heimischenArten entsprechen. Ein wichtiges Teilprojekt ist daher derAufbau eines Elterntierbestandes für die Nachzucht vonBesatzfischen, die sich für den jeweiligen Lebensraum eig-nen. Für die Nordsee und die in sie mündenden Flüsse istder Europäische Atlantische Stör (Acipenser sturio) aus dersüdwestfranzösischen Gironde zur Nachzucht vorgesehen.Die sehr kleine Population ist genetisch praktisch iden-tisch mit den ehemals in der Nordsee heimischen Fischen.Das IGB hält durch eine Kooperation mit der französischenCemagref seit 1996 einige Exemplare, um Besatzfische fürElbe und Rhein zu züchten. Da Störe frühestens mit zehnbis zwölf Jahren geschlechtsreif werden, standen die erstenNachzuchten von Tieren aus dem Ex-situ-Bestand in
RESSOURCE WASSER | 1.2.0442
Versuchsbesatz im Elbeeinzugsgebiet, Jungstör (Acipenser sturio) mitMarkierung

Frankreich im Jahr 2007 zur Verfügung. Tiere aus dieserVermehrung wurden markiert, mit telemetrischen Sen-dern versehen und an der mittleren Elbe ausgesetzt, umihre Wanderung zu verfolgen.
Die ehemals in der Ostsee heimischen Störe unterscheidensich genetisch und im Aussehen von denen aus der Nordsee.Sie sind die Nachfahren des vor rund 1.000 Jahren einge-wanderten Amerikanischen Atlantischen Störs (Acipenseroxyrinchus). Ein dem Ostseestör genetisch sehr ähnlicherVerwandter lebt in den kanadischen Flüssen St. Lawrenceund St. John. Die Gesellschaft zur Rettung des Störs hat2005 und 2006 geschlechtsreife Tiere für Zuchtzweckenach Deutschland geholt, um damit einen ersten Eltern-tierbestand zu begründen. Nachkommen aus kontrollier-ter Vermehrung in Kanada werden bereits seit 2006 fürtelemetrische Untersuchungen und zur Bestimmung derHabitatnutzung im Odereinzugsgebiet ausgesetzt.
Für den Ausbau der Elterntierbestände werden Nachzuch-ten aus kontrollierter Vermehrung aufgezogen. Zur Opti-mierung der genetischen Vielfalt werden diese Tiere imRahmen von genetischen Screenings, insbesondere übervon der Universität Potsdam entwickelte Mikrosatelliten,charakterisiert und Zuchtpläne erstellt. 2010 gelang dieerste erfolgreiche Vermehrung aus dem Elterntierbestanddes A. oxyrinchus in Deutschland, sodass jetzt auch früheLebensstadien untersucht werden können.
ÖKOLOGIE | FLUSSGEBIETE | DER STÖR KEHRT ZURÜCK 43
Entwicklung alternativer Fischereitechniken
Damit die im Aufbau befindlichen Störpopulationen nichtder Fischerei zum Opfer fallen, wird im Projekt außerdemdie Weiterentwicklung von Stellnetzen für die Küstenfi-scherei vorangetrieben. Ziel ist es, den unbeabsichtigtenFang (Beifang) von Stören zu minimieren und gleichzeitigden Fang von Zander und Barsch im Stettiner Haff zu opti-mieren. Versuche mit neu entwickelten Netzen zeigten,dass der Beifang von Stören durch einfache Veränderun-gen fast vollständig unterbunden werden kann. Da aberauch etwas geringere Mengen an Zielarten ins Netz gin-gen, ist die Akzeptanz in der Fischerei bisher sehr gering.
Störe unter Beobachtung
Nach dem Aussetzen stehen die Störe unter intensiverBeobachtung. Mittels Markierungen und Sendern lassensich die Wanderbewegungen der Tiere erforschen. Ziel istes, geeignete Lebensräume zu identifizieren und zubeschreiben sowie Risiken für die Tiere zu ermitteln. DasMonitoring soll die Grundlage für weitere Freisetzungensowie mögliche Renaturierungsmaßnahmen an Flüssenliefern. Wird die Qualität der Lebensräume des Störs ver-bessert, profitieren davon auch andere Tierarten. Der Störkann somit auch zu einem Wegbereiter für die Wiederan-siedlung anderer Arten mit ähnlichen ökologischenAnsprüchen werden.
Ultraschallsonografie zur Geschlechtsdifferenzierung in Born/Darß
Fang eines amerikanischen Atlantischen Störs (Acipenser oxyrinchus)für die Vermehrung in Kanada
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und BinnenfischereiDr. Jörn GeßnerMüggelseedamm 31012587 BerlinTel.: 0 30/64 18 16 26E-Mail: [email protected]: www.igb-berlin.deFörderkennzeichen: 0330718
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Die Wissenschaftler des Berliner IGB widmen sichder ökosystemaren Forschung an limnischen Sys-temen (Binnengewässer). Die Erkenntnisse dienenals Basis für ökologisch fundierte Restaurierungs-,Sanierungs-, Bewirtschaftungs- und Schutzkon-zepte. Am IGB arbeiten Hydrologen, Chemiker,Mikrobiologen, Limnologen, Fischökologen undFischereibiologen unter einem Dach.
www.igb-berlin.de

Durch internationale Kooperationen Synergien schaffen –Integriertes Wasserressourcen-Management
RESSOURCE WASSER | 1.3.044

ÖKOLOGIE | IWRM 45
Das Integrierte Wasserressourcen-Management(IWRM) bezeichnet nach allgemeiner Definitioneinen Prozess zur koordinierten Entwicklung undBewirtschaftung von Wasser-, Land- und damit ver-bundenen natürlichen Ressourcen. Ein solcherIWRM-Prozess verfolgt das Ziel, ökonomisches undsoziales Wohlergehen in Einklang mit einem nach-haltigen Umgang mit Ökosystemen herbeizuführen.
In den zurückliegenden Jahren wurde das Prinzip desIntegrierten Wasserressourcen-Managements zum vor-herrschenden Konzept für die Wasserwirtschaft inDeutschland und Europa; nicht zuletzt durch die Umset-zung der im Jahr 2000 verabschiedeten EuropäischenWasserrahmenrichtlinie. Der IWRM-Prozess stellt dieWassereinzugsgebiete als Einheiten in den Mittelpunkt.Durch die integrative Betrachtung der miteinander inWechselwirkung stehenden oberirdischen Gewässer, derGrundwasserleiter und gegebenenfalls auch der Küsten-gewässer soll eine nachhaltige Bewirtschaftung erreichtwerden. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, das Ökosystem und unterschiedliche Nutzungsansprüchewerden gegeneinander und im Dialog mit allen Nutzer-und Interessengruppen abgewogen.
Die Bundesregierung hat im Jahr 2004 einen Förderschwer-punkt zum IWRM im Rahmenprogramm Forschung fürdie Nachhaltigkeit des Bundesministeriums für Bildungund Forschung (BMBF) aufgelegt. Die vorrangigen Zielebeim Einsatz von IWRM in Entwicklungs- und Schwellen-ländern sind:
Vor Ort den Zugang der Bevölkerung zu sauberemTrinkwasser und einer gesicherten sanitären Entsor-gung zu gewährleistenVerbesserung der Positionierung deutscher Unterneh-men auf den internationalen Märkten der Wasserwirt-schaft Unterstützung der bi- und multilateralen Zusammen-arbeit im WasserfachFörderung der inter-, transdisziplinären und interna-tionalen Kooperation zwischen Wissenschaft, Indus-trie, Verwaltung und Ver- und EntsorgungspraxisStärkung des Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungs-standorts Deutschland im internationalen Wettbe-werb.
Derzeit werden acht Forschungsverbünde gefördert. Diese sind in China (Projektbeispiel 1.3.06), Indonesien(Projektbeispiel 1.3.05), Iran, Israel-Jordanien-Palästina(Projektbeispiel 1.3.01), Mongolei (Projektbeispiel 1.3.04),
Namibia, Südafrika und Vietnam (Projektbeispiel 1.3.02).Hier arbeiten deutsche und ausländische Forscher sowieUnternehmen gemeinsam daran, die Voraus setzungenfür einen nachhaltigen Umgang mit den Was servorrätenzu schaffen, oftmals unterstützt durch deutsche Monitor-ing- und Anlagentechnik. Die Betreuung der Vorhabenerfolgt durch den Projektträger Karlsruhe Wassertechno -logie und Entsorgung (PTKA-WTE) und den ProjektträgerJülich (PTJ-UMW).
Themenverwandte Programme und Projekte
Im Rahmen verschiedener Förderprogramme unterstütztdas BMBF in Partnerländern Projekte mit Bezug zumIWRM, die jedoch nicht nur in Entwicklungs- und Schwel-lenländern liegen, sondern die Ihren Schwerpunkt bei-spielsweise auch im Bereich der Entwicklung und Anpas-sung von Wassertechnologie bzw. der nachhaltigen Land-nutzung haben. Beispiele sind hier die Inter nationaleWasserforschungsAllianz Sachsen (IWAS) oder Konzeptefür eine nachhaltige Entwicklung an der Wolga undderen Nebenflüssen. In dem transdisziplinären Projekt„Water related Infor mation System for the SustainableDevelopment of the Mekong Delta“ (WISDOM) soll denlokalen Behörden mit einem Informationssystem gehol-fen werden, die vorhan denen Ressourcen nachhaltig zunutzen (Projekt 1.3.08).
Um ganzheitliche Wassermanagementkonzepte für fünfhydrologisch sensitive Weltregionen zu entwickeln,haben sich rund 40 Wissenschaftler des Helmholtz-Zen -trums für Umweltforschung – UFZ und der TechnischenUniversität Dresden mit der Stadtentwässerung DresdenGmbH, dem Institut für Technische Hydrobiolgoie (itwh),der Dreberis GmbH und weiteren Partnern aus Wissen- schaft, Wirtschaft und Politik zur „Internationalen Was- serforschungsAllianz Sachsen“ (IWAS) zusammenge- schlossen (Projekt 1.3.07).
Der Förderschwerpunkt IWRM und erzielte Ergebnissewerden auf der IWRM-spezifischen Internetseite desBMBF (www.bmbf.wasserressourcen-management.de)dargestellt.

Noch vor fünfzig Jahren führte der Jordan reichlichWasser. Heute ist der Unterlauf des Flusses nur nochein unbedeutendes Rinnsal und der Wasserspiegeldes Toten Meers sinkt jährlich um einen Meter.Ableitungen für die israelische Küstenebene und dasHochland um die jordanische Hauptstadt Ammanhaben die Wasservorräte drastisch dezimiert. Einewirtschaftliche und soziale Entwicklung des Jordan-tals ist so kaum mehr möglich – zumal die Bevölke-rung gleichzeitig stark wächst. Ein grenzüberschrei-tendes Managementkonzept könnte helfen, die vor-handenen Ressourcen effizienter zu nutzen. Eininternationales Team von Wissenschaftlern erfasstnun auch bisher ungenutzte Wasservorräte. Es ent-wickelt Technologien zur Reinigung und Speiche-rung und sorgt für den Aufbau von Infrastrukturenund Know-how in den betroffenen Regionen.
Bezugnehmend auf die Millenniumsziele und die UN-Dekade „Water for Life“ unterstützt das BMBF das interna-tionale Forschungsprojekt „Sustainable Management ofAvailable Water Resources with Innovative Technolo-gies“ (SMART) im Einzugsgebiet des unteren Jordan. Eswird unter der wissenschaftlichen Leitung des KarlsruherInstituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit deutschen,israelischen, palästinensischen und jordanischen Part-nern durchgeführt.
Wasservorräte beurteilen und managen
Zentrales Anliegen des Projekts ist es, alle Wasservorkom-men im Untersuchungsraum – einschließlich Grundwas-ser, Abwasser, stark salzhaltige Wässer und Flutwässer –umfassend zu beurteilen und in ein grenzüberschreiten-des integriertes Managementsystem einzubeziehen.Dafür müssen die Wissenschaftler alle Ressourcen, die bis-her aus qualitativen Gründen oder aufgrund fehlenderSpeichermöglichkeiten für eine Nutzung nicht in Fragekamen, erkunden und bewerten. Abhängig von der weite-ren Verwendung und den lokalen Gegebenheiten sollengeeignete Aufbereitungstechniken ermittelt sowie Mög-lichkeiten zur Zwischenspeicherung entwickelt werden.Diese integrative Herangehensweise ist neu im Wasser-management; für die Umsetzung des Integrierten Wasser-ressourcen-Managements (IWRM) sind außer neuen Tech-nologien eine regionale Infrastruktur und institutionelleKapazitäten notwendig.
Wassermangel im Jordantal – Grenzüberschreitende Lösungen finden
Regionale Charakteristik des Untersuchungsraumes
Typisch für die Region sind starke Kontraste in den klima-tischen Bedingungen. Sie wechseln von mediterran(semiarid) an der Küste bis hin zu hocharid im Südosten.Im Einzugsgebiet des Jordan variieren die Niederschlägevon 800 Millimeter pro Jahr in den nördlichen Bergregio-nen (ca. 1000 Meter über dem Meeresspiegel) bis zu weni-ger als 100 Millimeter pro Jahr im unteren Jordantal (250bis 420 Meter unter dem Meeresspiegel). Letzteres liegt ineiner bedeutenden Geosutur vergleichbar einem tiefenGraben, an der die arabische Platte nach Norden verscho-ben wird. Die Grabenflanken bestehen aus Karbonatge-steinen und Sandsteinen, die Grabenfüllung aus fluviati-len und marinen Lockergesteinen. Durch die ständigwachsende Bevölkerung, vor allem in den in Höhenlagenangesiedelten Großstädten (Jerusalem, Ramallah und
RESSOURCE WASSER | 1.3.0146
Lageplan des SMART-Untersuchungsgebietes zwischen See Genezareth im Norden und dem Toten Meer im Süden

ÖKOLOGIE | IWRM | WASSERMANGEL IM JORDANTAL 47
Amman-Salt), fallen punktuell große Abwassermengen an, die in die Grundwasserleiter einsickern oder übertief eingeschnittene, meist trocken liegende Flussbetten –sogenannte Wadis – in Richtung Jordantal abströmen.Wirtschaftlich setzt das untere Jordantal auf die landwirt-schaftliche, touristische aber auch industrielle Entwick-lung. Man nutzt die hohen Temperaturen und die frucht-baren Böden für eine ganzjährige Landwirtschaft undgestaltet die Region als „natürliches Gewächshaus“.
Forschung mit Anwendungsbezug
In der ersten Projektphase (2006 bis 2009) richteten dieForscher umfangreiche Infrastrukturen, zum Beispiel die„SMART-Wastewater Treatment and Reuse Site“ in Fuheisoder auch Umweltmonitoringsysteme (Klima, Abfluss,Grundwassermenge und -qualität) in mehreren Teileinzugs-gebieten ein. Außerdem identifizierten sie für verschiede-ne Technologielinien weitere Standorte. Dort werden nunin Absprache mit den lokalen Ministerien, Organen derEntwicklungszusammenarbeit sowie den beteiligtenIndustriepartnern Pilotanlagen installiert.
In der aktuellen zweiten Förderphase sollen die erfolgrei-chen Aktivitäten der ersten Phase in Demonstrationspro-jekten umgesetzt werden. Dabei wird vor allem auf einenstarken Anwendungsbezug geachtet. Speziell in denBereichen Abwasseraufbereitung, Membranverfahren ,künstliche Grundwasseranreicherung und softwarege-stützte Entscheidungshilfe hat die German Water Partner-ship bereits Interesse angemeldet; mehrere Mitglieder desDachverbands der deutschen Wasserwirtschaft sind amSMART-Projekt beteiligt. Weiterhin fanden Gespräche mitder Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) statt, die großesPotenzial für die dezentrale Abwasseraufbereitung in derRegion sieht.
Zentrale Ergebnisse der Verbundforschung fanden Einzugin den nationalen Wasserplan Jordaniens („National Stra-tegic Water Plan 2008–2022“); damit sind wesentliche
Schritte zur Vorbereitung einer Systemlösung für einedezentrale Wasserwirtschaft bereits politisch realisiert.
Strukturen und Kompetenz aufbauen
In der zweiten Phase werden die Wissenschaftler die Cha-rakterisierung der verfügbaren Wasserressourcen undihrer Gefährdungspotenziale fortsetzen und auf weitereGebiete ausdehnen. Zentrale Frage ist, wie sich die Was-serqualität in einem geschlossenen Einzugsgebiet mittel-und langfristig entwickelt, wenn zunehmend Abwässerwiederverwendet werden. Das Forscherteam untersuchthier, wie hygienisch relevante Mikroorganismen beseitigtwerden können und wie sich organische Spurenstoffeunter ariden bis semi-ariden Bedingungen anreichernbeziehungsweise biologisch abbauen.
Alle Aktivitäten münden zunächst in IWRM-Szenarien fürdie Teileinzugsgebiete, in denen die unterschiedlichenAnpassungsvarianten an den demographischen, klimati-schen und ökonomischen Wandel dargestellt und in Ana-lysen verglichen werden. Abschließend werden gesicherteIWRM-Szenarien für das gesamte Projektgebiet unterBerücksichtigung der neuen Technologie- und Manage-mentkonzepte zur Verfügung stehen.
Insgesamt nimmt der Aufbau lokaler Kapazitäten einewichtige Rolle in SMART II ein. Sie sind entscheidend fürdie Realisierung eines Integrierten Wasserressourcen-Managements. Schon in der ersten Phase hatte sichgezeigt, dass an den speziell entwickelten Weiterbil-dungsprogrammen größtes Interesse besteht. Sie wurdeninsbesondere von den oberen Planungsbehörden (Palesti-nian Water Authority, Jordan Ministry of Water and Irri-gation) unterstützt und erweisen sich als gute Möglich-keit, die Bewusstseinsbildung für den IWRM-Prozess undden Einsatz nachhaltiger Technologielinien zu fördern.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Angewandte GeowissenschaftenProf. Dr. Heinz HötzlAdenauerring 20 b76131 KarlsruheTel.: 07 21/60 84 30 96Fax: 07 21/60 62 79E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: BMBF-PTKA 02WM1079
Blick über das Jordantal mit Bewässe-rungskulturen auf der östlichen jordani-schen Seite
Information von Kindernin Schulen über die Nut-zung von gereinigtenAbwässern für die Bewäs-serung in der Landwirt-schaft

Vietnam ist ein Land mit reichhaltigen Wasserres-sourcen. Ein durchschnittlicher Jahresniederschlagvon knapp 2.000 Millimeter und ein dichtes Gewäs-sernetz von 2.360 Flüssen mit einer Länge von überzehn Kilometern sorgen für ein großes Wasserdarge-bot. Trotz dieser günstigen Bedingungen ist dasWassermanagement in Vietnam eine Herausforde-rung: Fehlende Infrastruktur, mangelndes Know-howund ein wachsender Wasserverbrauch durch Land-wirtschaft und Industrie sind nur einige Aspekte desProblems. Deutsche und vietnamesische Forscherarbeiten in einem Verbundprojekt des BMBFgemeinsam daran, die Voraussetzungen für einennachhaltigen Umgang mit den Wasservorräten zuschaffen.
Die Verteilung der Niederschläge und Gewässer ist in Viet-nam regional sehr unterschiedlich. Ausgedehnte Trocken-zeiten verursachen in bestimmten Gebieten temporäreVersorgungsprobleme. Außerdem ist Vietnam großenteilsein „Unterstromland“, das heißt, die Flüsse haben bereitseinen weiten Weg hinter sich, bevor sie durch Vietnamfließen. So hängen beispielsweise Menge und Güte derWasserressourcen aus dem Mekong und dem Roten Flussstark von den Nutzungen an den Flussoberläufen in denNachbarländern ab. Hinzu kommt, dass die nötige Infra-struktur, beispielsweise für Wasserversorgung, Abwasser-behandlung oder den Hochwasserschutz nicht flächende-ckend ausgebaut ist. Gleichzeitig führt die wirtschaftlicheEntwicklung des Landes mit einer fortschreitenden Urba-nisierung, Industrialisierung und Intensivierung derLandwirtschaft zu einem steigenden Wasserverbrauchund folglich zu wachsenden Abwassermengen. Ange-sichts dieser Herausforderungen sind die Behörden der-zeit nicht ausreichend in der Lage, ein effektives Wasser-management umzusetzen.
Voraussetzung für die Lösung der wasserbezogenen Pro-bleme in Vietnam ist ein sorgfältiges Management derWasserressourcen. Technische, juristische und sozialeInstrumente müssen entwickelt und Maßnahmenkonzep-te für die jeweiligen Flusseinzugsgebiete implementiertwerden. Diese Aktivitäten sollen die teilweise wider-sprüchlichen Anforderungen an die Wasserversorgungharmonisieren und sie nachhaltig gestalten. Mehrere vomBMBF geförderte Projekte unter dem Sammeltitel „IWRM-Vietnam“ unterstützen diesen Prozess in drei repräsenta-tiven, vietnamesischen Beispielgebieten, die sich durchverschiedene naturräumliche, sozioökonomische undökologische Charakteristika auszeichnen:
Deutsch-vietnamesische Kooperation – Forschung für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser
Red-River-Delta, Provinz Nam Dinh: Neben der inten-siven Landwirtschaft stellen die Abwässer aus Textilin-dustrie, Metallverarbeitung und Aquakultur die wich-tigsten Herausforderungen für ein Integriertes Was-serressourcen-Management (IWRM) dar. Darüberhinaus wird das Süßwasser durch übermäßige Grund-wasserentnahme und Überflutungen zunehmend vonMeerwasser verdrängt (Salzwasserintrusion ).Dong-Nai-Einzugsgebiet, Provinz Lam Dong, Gemein-de Hoa Bac: Durch intensiven Kaffee- und Teeanbaugelangen große Mengen an Düngemitteln und Pestizi-den in jene Gewässer, die über 9.000 Menschen mitWasser für den täglichen Bedarf versorgen sollen.Mekong-Delta, Provinz Can Tho: Zentrale Problemesind hier die Mängel bei der Wasserversorgung, Pro-bleme durch Hochwasserereignisse und Einträge ausder Intensivtierhaltung.
Unter der Leitung des Lehrstuhls für Umwelttechnik undÖkologie im Bauwesen der Universität Bochum kooperie-ren in dem Verbundprojekt „IWRM Vietnam“ die Univer-sitäten Bonn und Greifswald mit einem Netzwerk ausdeutschen und vietnamesischen Partnern in Universitä-ten, Forschungsinstituten, Behörden und Firmen. Die Wis-senschaftler entwickeln Methoden zur Umsetzung einesIntegrierten Wasserressourcen-Managements für Flus-seinzugsgebiete in Vietnam. Folgende Ergebnisse habensie bisher auf zwei Planungsebenen erzielt:
RESSOURCE WASSER | 1.3.0248
Das Red-River-Delta in der vietnamesischen Provinz Nam Dinh

ÖKOLOGIE | IWRM | DEUTSCH-VIETNAMESISCHE KOOPERATION 49
Flusseinzugsgebietsebene: Instrumente fürPlanungs- und Entscheidungsunterstützung
Es wurden Instrumente entwickelt, die helfen sollen, einenachhaltige Wassermengenwirtschaft aufzubauen unddie Risiken für die Wasserqualität zu reduzieren oder ganzzu vermeiden. Eines der Ergebnisse ist ein Planungsatlasfür das Integrierte Wasserressourcen-Management.
In den oben genannten Beispielgebieten haben die Wissen-schaftler die Wasserressourcen sowie die aktuelle ökono-mische, soziale und ökologische Situation für das jeweili-ge Einzugsgebiet untersucht. Das Ziel war, aktuelle undzukünftige Nutzungskonflikte und wasserwirtschaftlicheProblembereiche aufzudecken. Die Untersuchungsergeb-nisse sollen die Entscheidungsträger künftig dabei unter-stützen, Maßnahmen zur nachhaltigen Wassermengen-wirtschaft und zum Schutz der Wasserressourcen vor Ver-unreinigungen durchzusetzen. Die Instrumente wurden inenger Zusammenarbeit mit den vietnamesischen Behör-den entwickelt und in den drei Beispielgebieten getestet.
Lokale Ebene: Umwelttechnologie
Die Experten haben für die drei Projektregionen auchtechnische und konzeptionelle Lösungen für speziellewasserwirtschaftliche Probleme auf lokaler Ebene entwi-ckelt. Dabei wurden auch deutsche Umwelttechnologienan lokale Bedingungen angepasst und eingesetzt.
Für die Provinz Can Tho haben die Wissenschaftler einInstrument entwickelt, das die Nährstoffe in den Gewäs-sern des Mekong-Deltas reduzieren soll. Hierzu wurde einwebbasiertes Geoinformationssystem (GIS) zur Überwa-chung der Wasserqualität aufgebaut. Die Forscher entwi-ckelten außerdem Lösungen zur Aufbereitung landwirt-schaftlicher Abwässer.
In der Provinz Lam Dong konzipierten die Forscher einzentrales Wasserversorgungssystem. Hier ging es darum,konträre Interessen innerhalb einer ländlichen Gemeinde
auszugleichen. Eine besondere Rolle spielte dabei dieBeeinträchtigung der Wasserqualität durch die Landwirt-schaft. Die gewonnenen Erfahrungen fließen in die Ent-wicklung eines IWRM-Systems im Provinzmaßstab ein.
In der Provinz Nam Dinh haben die Wissenschaftler Kon-zepte für die Behandlung von Siedlungs- und Industrieab-wässern entwickelt. Sie sind exemplarisch für eine mögli-che Lösung der dortigen wasserwirtschaftlichen Probleme.
Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist das sogenannteCapacity-Development . Dazu gehören Schulungen fürdie vietnamesischen Partner aus Umweltverwaltung undForschung, Masterarbeiten, gemeinsame Forschungsakti-vitäten, Workshops und Konferenzen.
Weiterhin Kooperationsbedarf
Die vietnamesische Regierung hat die Bedeutung einesIntegrierten Wasserressourcen-Managements erkanntund arbeitet daran, die Rahmenbedingungen zu verbes-sern. Jene Institutionen, die das IWRM vor Ort umsetzenmüssen, werden gestärkt – zunächst in den Flusseinzugs-gebieten mit den größten wasserwirtschaftlichen Proble-men. Wegen der vielfältigen Herausforderungen benötigtdie vietnamesische Regierung weiterhin Unterstützung,beispielsweise bei der Entwicklung von Planungsinstru-menten, Monitoringstrategien oder Abwasserreinigungs-verfahren und auch bei der Stärkung der Umweltverwal-tung und der Ausbildung des Personals. Bezüglich IWRMbesteht daher weiterhin eine große Nachfrage nach einerwissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischenVietnam und Deutschland.
Universität BochumFakultät Bau- und UmweltingenieurwesenU+Ö Umwelttechnik und Ökologie im BauwesenProf. Dr. Harro StolpeUniversitätsstraße 15044801 BochumTel.: 02 34/3 22-79 95E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WM0815
· Teilprojekte Ruhr Universität Bochum, U+Ö (FKZ 02WM0815, FZKWM0816)
· Teilprojekt Universität Bonn, INRES (FKZ 02WM0760) · Teilprojekt Universität Greifswald, IGG
(FKZ 02WM0765) · Teilprojekt iaks GmbH (FKZ 02WM0766) · Teilprojekt Fraunhofer Institut (FKZ 02WM0767) · Teilprojekte Moskito GIS GmbH
(FKZ 02WM0762, 02WM0769)
Lage der drei Projektgebiete

Themenbereiche und Partner des AKIZ-Verbundvorhabens
Vietnam gehört zu den aufstrebenden ehemaligenEntwicklungsländern mit starkem Wirtschaftswachs-tum und rasant zunehmenden Umweltproblemen.Ein Großteil der etwa 300 Industriezonen des Landeskennt keine geregelte Abwasserentsorgung. Es fehltan moderner Technologie, dem nötigen Know-howund durchsetzungsfähigen Behörden. Klar ist, dassbei dieser komplexen Problemlage nur ein ganzheit-licher Ansatz dauerhaften Erfolg verspricht. Im Rah-men des BMBF-Forschungsvorhabens „IntegriertesAbwasserkonzept für Industriezonen“ (AKIZ) entwi-ckeln Forschungseinrichtungen zusammen mit deut-schen Unternehmen neue Lösungen – und schaffendamit gleichzeitig einen Zukunftsmarkt für Umwelt-technologie aus Deutschland.
Vietnam erwirtschaftet rund 20 Prozent seiner Exportleis-tung in staatlich verwalteten Industriezonen. Derzeit gibtes rund 250 registrierte nationale Industriezonen mitmehr als 60.000 Hektar Fläche und zusätzlich 15 Wirt-schaftszonen. Rechnet man die auf Bezirks- und Gemein-deebene registrierten Industriezonen hinzu, dürften essogar weit über 300 sein. 90 weitere sind bis 2015 geplant.
Im Vorfeld des Projekts stellten Experten fest, dass nurrund ein Viertel der untersuchten Industriezonen über-haupt zentrale Kläranlagen aufweist, wovon wiederumnur etwa ein Viertel nach westlichem Verständnis zufrie-denstellend arbeitet. Häufig waren vorhandene Anlagenwegen Unterfinanzierung oder mangelnder Wartungaußer Betrieb.
Integrierter Ansatz
Mögliche Auswege aus dieser prekären Situation soll einvom BMBF mit ca. acht Millionen Euro gefördertes For-schungsvorhaben aufzeigen. In dem „Leuchtturmprojekt“erarbeiten Wissenschaftler am Beispiel einer Industriezo-ne in der Provinz Can Tho im Mekong-Delta ein integrier-tes Abwas serkonzept. Es soll unter anderem die Vorgabenfür die Arbeit eines Zentralklärwerks liefern. In das AKIZ-Verbundvorhaben sind auf deutscher Seite vier Industrie-partner und insgesamt fünf deutsche Hoch schulen ein-gebunden, die mit vietnamesischen Universi täten undForschungsinstituten zusammenarbeiten. Die Gesamt-koordination liegt beim Institut für Umwelttech nik undManagement an der Universität Witten/Herdecke gGmbH(IEEM).
Abwasserentsorgung in vietnamesischen Industriezonen –Ein Fall für ganzheitliche Konzepte
Das BMBF-Vorhaben wird in Kooperation mit derdeutschen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt.
Angepasste Lösungen finden
Bevor bewährte Hightech-Lösungen aus den Industrielän-dern eingesetzt werden können, müssen sie an die speziel-len Arbeitsbedingungen und die tropischen Klimaverhält-nisse im Projektgebiet angepasst werden. Hierzu setzen
RESSOURCE WASSER | 1.3.0350
Arbeiter in einer vietnamesischen Pestizid-Fabrik
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Übergreifendes Management-Konzept/KoordinationInstitut für Umwelttechnik und Management an der Universität Witten/HerdeckegGmbH (02WA1060), Hanoi University of Science, National Economics University
AbwasserentgiftungHST Hydro-Systemtechnik GmbH (02WA1061), Universität Stuttgart (02WA1062), Hanoi University of Science
Energiegewinnung mittels AnaerobbehandlungPassavant-Roediger GmbH (02WA1063), Leibniz Universität Hannover (02WA1064),Southern Institute of Water Resources Research
Wertstoffrückgewinnung mit MembranfiltrationEnviroChemie GmbH (02WA1065), Technische Universität Darmstadt (02WA1066),Hanoi University of Civil Engineering, Vietnamese-German University
Monitoring mit Konzeptionierung und Betrieb eines ContainerlaborsLAR Process Analysers AG (02WA1067), Institut für Umwelttechnik und Management an derUniversität Witten/Herdecke gGmbH (02WA1068), Passavant-Roediger GmbH(02WA1063), Vietnam Institute of Industrial Chemistry, Can Tho University
Klärschlamm-KonzeptTechnische Universität Braunschweig (02WA1069), Vietnamese Academy of Science andTechnology, Institute for Environment and Resources at the Vietnam National University

ÖKOLOGIE | IWRM | ABWASSERENTSORGUNG IN VIETNAM 51
die Wissenschaftler Container-Versuchsanlagen deutscherIndustriepartner ein und entwickeln sie weiter. Anhandvon Beispielunternehmen in der Industriezone Tra Nocwerden dezentrale Lösungen zur Abwasservorbehand-lung mit quellnaher Entgiftung sowie Energie- und Wert-stoffrückgewinnung dargestellt.
In Vietnam – wie auch in vielen anderen Entwicklungs-und Schwellenländern – existieren bislang keine dauerhafttragfähigen Konzepte für die Beseitigung von Klärschläm-men. Für ihre Entsorgung und Verwertung müssen dieWissenschaftler erst geeignete Konzepte erarbeiten. Inden meisten Schwellenländern gibt es Einleitwerte, dieteilweise sogar mit westlichen Abwasserstandards ver-gleichbar sind. Oft enthalten sie jedoch keine Toxizitätspa-rameter oder werden aufgrund eines erheblichen Voll-zugsdefizits nicht umgesetzt. Die Durchsetzung geltenderUmweltstandards und Qualitätsanforderungen ist abereine Grundvoraussetzung für den Einsatz von Hochtech-nologien. Hier werden spezifische Schulungen (Capacity-Building ) im Rahmen des AKIZ-Vorhabens ansetzen. Einneuartiges Monitoring- und Überwachungssystem sollaußerdem wichtige Daten liefern, zum einen für dieErmittlung des technologischen Anpassungsbedarfs undzum anderen für die administrative und finanzielleDurchführung der Abwasserreinigung.
Konzepte mit Zukunft
Sämtliche vorgenannte Teilaspekte müssen in ein über-greifendes Managementkonzept einfließen, das den tech-nischen und wirtschaftlichen Betrieb des Abwassersystemsin der Industriezone abbildet. Es umfasst die dezentralenTechnologieansätze zur Vorbehandlung und das Zentral-klärwerk, beginnend beim Überwachungssystem (tropen-taugliche Laboreinheit) bis hin zu den Abrechnungs- undFinanzierungsmodellen für eine langfristig tragfähigeAbwasserreinigung. Die Übertragbarkeit der Projekter-gebnisse soll anhand weiterer Industriezonen verifiziertwerden.
Die Lösung der prekären Abwassersituation in vielenIndustriezonen von Entwicklungs- und Schwellenländernsetzt einen strikt ganzheitlichen Ansatz voraus. Er mussdas effiziente Funktionieren des Gesamtsystems mit allenKomponenten technisch, ökonomisch und ökologischnachhaltig sicherstellen. Das AKIZ-Vorhaben greift diegenannten Aspekte integrativ auf und entwickelt basierendauf deutschem Know-how angepasste Lösungsansätze. Vietnam als Schwellenland mit starkem Wirtschafts-wachstum und rasant zunehmenden Umweltproblemenwird damit zunehmend auch zu einem Markt für quali-tätsorientierte Umwelttechnologien aus Deutschland.
Institut für Umwelttechnik und Management ander Universität Witten/Herdecke GmbH (IEEM)Prof. Dr. Dr. Karl-Ulrich RudolphFrau Dipl.-Ing. Sandra KreuterAlfred-Herrhausen-Straße 4458455 WittenTel.: 0 23 02/9 14 01-0Fax: 0 23 02/9 14 01-11E-Mail: [email protected]@uni-wh-utm.deInternet: www.uni-wh-utm.de
ProjektkoordinationAKIZ Project OfficeDipl.-Ing. René HeinrichLot 12A, Tra Noc Waterplant, Industrial Zone Tra Noc IICan Tho City, VietnamTel.: +84/71 03/74 40-03Fax: +84/71 03/74 40-04E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WA1060 (TP Koordination)
Ein Abwasserkanal in der Industriezone Tra Noc in Can Tho

Die Mongolei steht vor großen wasserwirtschaftli-chen Herausforderungen. Globaler Wandel, Dürren,großflächige Verschmutzungen aus dem Bergbauund veraltete Infrastrukturen der Wasserver- und -entsorgung führten in den letzten Jahren zu einerdramatischen Verschlechterung der Lebensbedin-gungen. Die Probleme sind so eng miteinander verflochten, dass nur integrierte Systemlösungenweiterhelfen können. Ein Konsortium aus Wissen-schaftlern und Ingenieuren entwickelt nun einGesamtkonzept, bei dem Know-how und Technolo-gien aus Deutschland helfen sollen, die Wasservor-räte nachhaltig zu bewirtschaften.
In der Mongolei leben etwa drei Millionen Menschen, vondenen rund 60 Prozent keinen Zugang zu sauberem Trink-wasser und sicherer Abwasserentsorgung haben. In denweiten, trocken-kalten Steppengebieten und den borea-len Nadelwäldern Zentralasiens herrschen eine allge-meine Wasserknappheit und ein extrem variables Klima,das jährlich und saisonal starke Schwankungen in derWasserverfügbarkeit mit sich bringt. Eine schnell wach-sende Bevölkerung, die Aufgabe des traditionellen Noma-dismus sowie die Ausweitung von Landwirtschaft undBergbau (v. a. Gold und Kupfer) führen dazu, dass immermehr Wasser gebraucht wird. Eine Entspannung derSituation ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.
Im Verbundprojekt „Integriertes Wasserressourcen-Management in Zentralasien: Modellregion Mongo-lei“ (MoMo) entwickelt ein Team von Wissenschaftlerninnovative Lösungen, um die Menschen nachhaltig mitWasser zu versorgen. An dem vom Helmholtz-Zentrumfür Umweltforschung (UFZ) in Magdeburg koordinierteninter- und transdisziplinären Verbundprojekt sind zahlrei-che deutsche und mongolische Kooperationspartnerbeteiligt.
Verlässliche Datengrundlage notwendig
In den Jahren 2006 bis 2009 schufen die Forscher wesentli-che Grundlagen für ein integriertes Wassermanagementfür die Stadt Darkhan (ca. 100.000 Einwohner) und dasumliegende Flussgebiet des Kharaa im Nordosten derMongolei. Die neuen Konzepte entwickelten sie in engerZusammenarbeit mit den Partnern vor Ort. In dieser erstenPhase des Projekts wurden die wesentlichen Komponen-ten des Wassermanagements untersucht: Klimawandelund Hydrologie , Grundwasser, Landnutzung, Stoffkreis-läufe, Ökologie, Trinkwasserversorgung und Abwasserrei-
Modellregion Mongolei – Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wassermanagement
nigung. Mithilfe von Szenarientechniken leiteten die Wissenschaftler langfristige Strategien für die Bewirt-schaftung der Wasserressourcen ab, die zusammen mitden wichtigsten Akteuren vor Ort entwickelt, an die Situa-tion angepasst und justiert wurden. So konnten sie einsinnvolles Maßnahmenpaket vorschlagen. An der Umset-zung besteht in der Mongolei großes Interesse. Sehr guteinstitutionelle Rahmenbedingungen dafür wurden mitdem nationalen Wassergesetz von 2004 und der Einrich-tung einer nationalen Wasseragentur geschaffen.
Schritte zur Umsetzung
Seit Beginn der dreijährigen Umsetzungsphase (2010 bis2013) setzen die Wissenschaftler erste Elemente eines Inte-grierten Wasserressourcen-Managements (IWRM) um. Sowerden sie beispielsweise mehrere Pilotkläranlagen auf-bauen, um ausgewählte Technologien an die örtlichenVerhältnisse anzupassen. Wissenslücken über den quali-tativen und quantitativen Zustand der Wasserressourcensollen geschlossen und ein umfassendes Umweltüberwa-chungssystem etabliert werden, das Oberflächenwasser,Grundwasser, Boden, Trink-, Abwasser und Landbede-ckung einschließt. Das geplante Monitoring-Netzwerkwird zusammen mit den Umweltbehörden eingerichtetund an die örtlichen Erfordernisse angepasst.
In der Siedlungswasserwirtschaft setzen die Forscher einintegrales Konzept um, das die Einführung standortopti-mierter Technologien und Strategien für die relevantenSiedlungsräume umfasst. Dazu gehören der städtische
RESSOURCE WASSER | 1.3.0452
Lage des Modellgebietes in der Mongolei (Kartografie: Daniel Karthe)

ÖKOLOGIE | IWRM | MODELLREGION MONGOLEI 53
Sektor mit seinen maroden, zentralen Trinkwasser- undAbwasserbehandlungssystemen, die suburbanen Jurten-siedlungen, deren Bewohnern von den Behörden keinAnschluss an zentrale Ver- und Entsorgungssysteme inAussicht gestellt wird, sowie kleinere Ortschaften auf demLande, welche anstelle von Kläranlagen häufig nur überableitende Schwemmkanalisationssysteme verfügen.Außerdem werden in der zweiten Phase des Projekts dieMaßnahmen zum Wissensaufbau (Capacity Develop-ment) stark ausgeweitet, um so einen dauerhaften Beitragzur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu leisten unddie Eigenverantwortung vor Ort zu stärken.
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZDepartment Aquatische ÖkosystemanalyseProf. Dr. Dietrich BorchardtBrückstraße 3a39114 MagdeburgTel.: 03 91/8 10 97 57Fax: 03 91/8 10 91 11E-Mail: [email protected]: www.iwrm-momo.deFörderkennzeichen: 033L003
Das Einzugsgebiet des Kharaa im Norden der Mongolei (Quelle: Daniel Krätz)
In den suburbanen Jurtensiedlungen versorgen sich die Einwohner anzentralen Wasserkiosken mit Trinkwasser (Quelle: Lena Horlemann)
Partner des Verbundprojekts MoMo
Projektpartner in Deutschland:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Magdeburg
Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlin
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Systemtechnik, Ilmenau
Bauhaus-Universität Weimar, Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft, Weimar
Universität Kassel, Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung
Universität Heidelberg, Geographisches Institut, Heidelberg
p2mberlin GmbH, Berlin
Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, München
terrestris GmbH & Co. KG, Bonn
Bergmann Clean Abwassertechnik GmbH (BCAT), Penig
Seeconsult Deutschland GmbH, Osnabrück
Passavant-Roediger GmbH, Hanau
GEOFLUX GbR, Halle (Saale)
Projektpartner in der Mongolei:
Auf der nationalen Ebene:
Mongolisches Umweltministerium, Bildungsministerium, Bauministerium, Landwirt-schaftsministerium und Finanzministerium
Nationale Umweltüberwachungsbehörde
Nationale Wasseragentur
Auf der regionalen Ebene:
Provinzregierung des Darkhan Uul Aimag
Regionales Umweltamt, Darkhan Uul Aimag
Meteorologisches Institut von Darkhan
Trink- und Abwasserunternehmen USAG, Darkhan
Wissenschaftliche Institutionen in der Mongolei:
Nationaluniversität der Mongolei, Ulan Bator
Mongolische Universität für Wissenschaft und Technologie, Ulan Bator und Darkhan
Landwirtschaftliche Universität Darkhan
Mongolische Akademie der Wissenschaften
Deutsche Partner in der Mongolei:
Deutsche Botschaft, Ulan Bator
GIZ, Ulan Bator

Gunung Sewu an der Südküste der Insel Java ist geprägt vom tropischen Klima. In der Trockenzeitherrscht in dem Karstgebiet akuter Wassermangel.Er schwächt die auf Landwirtschaft angewiesene Region so stark, dass sie auch als „Armenhaus Javas“bezeichnet wird. Zusätzlich leidet das Gebiet untereinem desolaten Versorgungssystem und einer völligunzureichenden Abwasserentsorgung. Vom BMBFunterstützt, haben Wissenschaftler in den letztenJahren bereits einen unterirdischen Bewirtschaf-tungsspeicher errichtet und durch regenerativeWasserkraft Höhlenwasser gefördert. Im Folgepro-jekt erschließen sie nun weitere Wasservorräte undentwickeln ein Konzept zum Integrierten Wasserres-sourcen-Management. Die Lebensqualität derBewohner soll sich dadurch nachhaltig verbessern.
Der Distrikt Gunung Kidul nahe der Großstadt Yogyakartaist eines der ärmsten Gebiete Javas. Eine Ursache liegt imzerklüfteten Karstuntergrund, in dem das Oberflächen-wasser sofort versickert. Hinzu kommt, dass angepassteTechnologien zur Trinkwassergewinnung, -verteilungund Abwasserbehandlung fehlen. Hier setzt das BMBF-Projekt „Integriertes Wasserressourcen-Management(IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien“ an. Es solldie Trinkwasserversorgung der Region sichern. Dazu müs-sen die unterirdischen Wasserressourcen in den Höhlen-systemen der Gunung Sewu („1.000 Hügel“) und das Karst-grundwasser des Wonosari-Plateaus erschlossen und diebestehenden Wasserverteilungssysteme saniert werden.Neu zu entwickelnde Technologien sollen helfen, dieBevölkerung ganzjährig mit ausreichend sauberem Was-ser zu versorgen, ohne dadurch künftige Generationenoder angrenzende Regionen zusätzlich zu belasten.
Modellregion Gunung Kidul – Integriertes Wasserressourcen-Management in Karstgebieten
In dem Verbundprojekt arbeiten unter Federführung desInstituts für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) desKarlsruher Instituts für Technologie (KIT) deutsche undindonesische Partner aus Universitäten, Forschungsein-richtungen, Industrie und Behörden zusammen.
Erkundung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen
Grundlage eines IWRM-Projekts sind fundierte Kenntnis-se über sämtliche Bedingungen, die das Wasserangeboteiner Region beeinflussen. Die bereits im Vorgängerpro-jekt gewonnenen Daten für das Einzugsgebiet der HöhleGua Bribin sollen erweitert und mithilfe der neuenErkenntnisse Bewirtschaftungs- und Verteilungsanlagenoptimal dimensioniert sowie Strategien zum Schutz derkostbaren Wasserressource entwickelt werden.
Ein im Vorgängerprojekt gebautes Sperrwerk staut in derHöhle Gua Bribin das zuströmende Wasser auf. Damiterzeugt es genügend Druck, um Pumpen zur Wasserför-derung zu betreiben. Die Wissenschaftler planen nun eineweitere Förderanlage in der Höhle Gua Seropan. Die Ener-gie für den Antrieb soll hier über eine Holzdruckrohrlei-tung erzeugt werden. Die beiden Anlagen werden künftigwertvolle praktische Erfahrungen für den Einsatz regene-rativer Fördertechnologien in Karstgebieten liefern.
Verteilen, aufbereiten, Qualität sichern
In den ländlichen Gebieten der Gunung Sewu müssen vor-rangig die bestehenden Wasserverteilungssysteme ver-bessert werden. Neben einem kosteneffizienteren Netz-und Betriebskonzept sollen die Wissenschaftler auch einKonzept zur dezentralen Energierückgewinnung im Ver-
RESSOURCE WASSER | 1.3.0554
Lage des Karstgebietes Gunung Sewu auf der Insel Java, Indonesien
Grundkonzeption des Integrierten Wasserressourcen-Managements(IWRM)

ÖKOLOGIE | IWRM | MODELLREGION GUNUNG KIDUL, INDONESIEN 55
teilungsnetz erarbeiten und an ausgewählten Standortenexemplarisch umsetzen. Ein Managementtool soll die ört-lichen Behörden bei ihren Entscheidungen unterstützenund helfen, den Netzbetrieb zu optimieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung der Wasser-qualität. Dazu entwickeln die Forscher ein Monitoringsys-tem, das die Qualität des Rohwassers und des Wassers inden Verteilungssystemen permanent überwacht. ImKrankenhaus der Stadt Wonosari installieren sie eine Pilot-anlage zur Wasseraufbereitung, die bei Erfolg als Vorlagefür weitere dezentrale Anlagen in der Region dienen soll.
Abwasser- und Abfallbehandlung
Im Themenbereich Abwasser- und Abfallbehandlung sol-len angepasste Technologien zur Trennung, Aufberei-tung, Nutzung und Rückführung von Abwasser- undAbfallströmen entwickelt werden. Ziel ist eine geschlosse-ne Kreislaufführung der Nährstoffe und die Sicherung derknappen Wasserressourcen. Vorbereitend für ein nach-haltiges Entsorgungskonzept müssen die Wissenschaftlerein so genanntes Stoffstrommodell erarbeiten. Es bildetalle relevanten, wassergebundenen Nährstoffströme inder Region ab, visualisiert bestehende Probleme und hilftArbeitsschwerpunkte festzulegen. Die gravierendenUnterschiede zwischen dem ländlichen und dem städti-schen Raum in der Modellregion machen räumlich diffe-renzierte Lösungsansätze erforderlich.
Sozioökonomische Bewertung und Technologiefolgenabschätzung
Mit einer sozioökonomischen Analyse können die Lebens-bedingungen und Probleme im Hinblick auf Wasserver-sorgung und Abwasserentsorgung in der Untersuchungs-region räumlich differenziert ermittelt und Lösungsmög-lichkeiten erarbeitet werden. Mit der Systemanalyse undder Technikfolgenabschätzung – ergänzt durch die Metho-den der Ökobilanz (Life-Cycle-Assessment) und Lebens-zykluskostenrechnung (Life-Cycle-Costing) werden
zusätzlich ökonomische, ökologische, soziale, kulturelleund akzeptanzbezogene Aspekte bewertet. Die Ergebnisseerleichtern damit die Entscheidungen bezüglich Entwurfund der Realisierung wasserwirtschaftlicher Anlagen,erlauben eine Einschätzung der Wirkung dieses Systemsauf eine nachhaltige Entwicklung in der betrachtetenRegion und unterstützen das IWRM-Gesamtprojekt dabei,zu einer solchen beizutragen.
Wissen aufbauen
Technische Konzepte können nur dann nachhaltig sein,wenn die Zielgruppen das Konzept akzeptieren und inallen Projektphasen beteiligt werden. Entwurf und Reali-sierung der technischen Konzepte sind im beschriebenenProjekt deshalb von Workshops, Sensibilisierungskampa-gnen und einem intensiven Wissenstransfer begleitet. DieWissenschaftler arbeiten bei allen Aufgabenstellungenmit den indonesischen Partnerinstitutionen zusammenund beziehen teilweise NGOs und die lokale Bevölkerungein. Geplant ist außerdem ein umfangreiches Lehr- undAusbildungsprogramm für das Betriebs- und Wartungs-personal von wasserwirtschaftlichen Anlagen. Es soll auchdie Grundlage für die Übertragung des IWRM-Konzeptesauf weitere Standorte schaffen und eine möglichst breitgefächerte Multiplikation anstoßen.
Strategien gegen Wasserknappheit
Die Erschließung des unterirdischen Fließgewässersys-tems und das IWRM-Konzept für Gunung Kidul werdenwichtige Lösungsansätze zur Überwindung von Wasser-knappheit in Karstgebieten aber auch in Gegenden mitnicht verkarstetem Untergrund liefern. Nicht zuletzt istdas Projekt ein Beitrag zur interkulturellen Verständi-gung, die gerade vor dem Hintergrund der weltpoliti-schen Situation von existenzieller Bedeutung ist.
Projekt-Website www.iwrm-indonesien.de
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Wasser und GewässerentwicklungProf. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Franz NestmannDr.-Ing. Peter OberleDr.-Ing. Muhammad IkhwanKaiserstraße 1276131 KarlsruheTel.: 07 21/6 08-63 88Fax: 07 21/60 60 46E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WM0877
Die Karstregion Gunung Sewu während der Trockenzeit

In den nördlichen Provinzen Chinas sind Wasser-knappheit und -verschmutzung schwerwiegendeProbleme. Eine stockende sozioökonomische Ent-wicklung, sinkende Lebensqualität und Umweltschä-den sind die Folgen. Dabei gibt es dort keinengrundsätzlichen Mangel an Wasservorräten; viel-mehr führen schnelles Wachstum von Bevölkerung,Industrie und Landwirtschaft sowie nicht koordi-nierte wasserwirtschaftliche Maßnahmen oft zuWasserkonflikten. Ein Integriertes Wasserressour-cen-Management, das auch deutsche Monitoring-und Anlagentechnik einsetzt, soll die großen Proble-me der Provinz Shandong lösen und gleichzeitig alsnachhaltiges Konzept für andere Regionen der Weltdienen.
Das 1.034 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Flusses Huangshuihe liegt im Nordosten der chinesischenProvinz Shandong am Pazifischen Ozean (64 KilometerKüstenlinie). Die Landwirtschaft ist eine der Haupteinnah-mequellen der Region. Ihre Entwicklung wird durch dieWasserknappheit inzwischen stark behindert, gleichesgilt für die Industrie. Auch die Überlastung der Ressour-cen macht sich mittlerweile bemerkbar. So hat die über-mäßige Nutzung der Grundwasservorkommen mittler-weile zur Salzwasserintrusion geführt.
Im bilateralen Verbundprojekt „Nachhaltiges Wasser-ressourcenmanagement in der Küstenregion der Pro-vinz Shandong, V.R. China“ entwickelt ein internationa-les Team von Wissenschaftlern jetzt ein Integriertes Was-serressourcen-Management (IWRM), um die großenProbleme der Region zu lösen. Die Ziele des IWRM sind:
Integration von sozialen, ökonomischen und Umwelt-aspektenIntegrierte Betrachtung von Grundwasser und Ober-flächenwasser (Quantität und Qualität)Optimierung des Wasserhaushaltes für das gesamteEinzugsgebiet.
Deutsch-chinesisches Forschungsteam
Das Forschungsprojekt wird vom chinesischen Ministeri-um für Wissenschaft und Technologie (MOST) und vomBMBF gefördert. Es führt deutsches Expertenwissen, neue-re Entwicklungen in Zusammenhang mit der WRRL undForschungsanstrengungen der chinesischen Experten imKüstengebiet der Provinz Shandong zusammen. Am Bei-spiel des Projektgebiets Longkou entwickeln deutscheund chinesische Wissenschaftler gemeinsam mit Behör-
Beispielregion Shandong – Konzepte gegen vermeidbare Wasserknappheit
den und Forschungseinrichtungen vor Ort eine anwen-dungsorientierte Strategie zur Optimierung der Wasser-bewirtschaftung. Im Idealfall auf die gesamte ProvinzShandong angewandt, soll sie zur Entspannung der Was-serknappheit beitragen.
Das Verbundprojekt gliedert sich in vier Teilprojekte:1. Sozioökonomische Entscheidungskriterien für ein Ent-
scheidungshilfesystem (DSS)2. Entwicklung einer Methode zur Planung nachhaltiger
Maßnahmen im Rahmen eines IWRM3. Integriertes Konzept für Wassersparen, Wasserwie-
der- und -weiterverwendung in Haushalten, Industrieund Landwirtschaft
4. Entwicklung eines Wassermonitoring-Konzepts fürdas Einzugsgebiet des Huangshuihe
Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems
Im Rahmen des Projekts entwickeln die Wissenschaftlerein DSS. Es soll helfen, die Maßnahmen für ein nachhalti-ges Wassermanagement zu optimieren und ein Monito-ringkonzept zu erarbeiten. In das System fließen sozioöko-nomische Entscheidungskriterien ein. Um sie festzulegen,ermittelte das Institut für ökologische Wirtschaftsfor-schung (IÖW) in einem ersten Schritt die gegenwärtigeWassernutzung im Projektgebiet (Bericht: „Assessment ofcurrent water uses“). Die Analyse der sozioökonomischenund institutionellen Rahmenbedingungen im Wassersek-
RESSOURCE WASSER | 1.3.0656
Aufbauschema des geplanten Entscheidungshilfesystems (DSS)

ÖKOLOGIE | IWRM | WASSERKNAPPHEIT IN SHANDONG 57
tor war Teil einer Masterarbeit. Die darin entwickeltenSzenarien zur zukünftigen Wassernutzung wurden durchlineare Projektion aus den gegenwärtigen Nutzungenermittelt. Ein anderes Verfahren ist bisher noch nichtmöglich. Die größte Informationslücke besteht jedoch beiden Rahmenbedingungen bezüglich der sozioökonomi-schen Institutionen und institutionellen Werkzeuge. Trotzenger Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern istes nach wie vor schwierig, reale Daten und Zahlen fürLandwirtschaft, Haushalte und institutionelle Maßnah-men zu akquirieren.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war die Sammlung undquantitative Beschreibung der Maßnahmen, die als Grund-lage für das DSS dienen sollen. In enger Zusammenarbeitzwischen der DHI-WASY GmbH und der Ruhr-UniversitätBochum stellten die Experten mögliche Wassermanage-ment-Instrumente in einem umfassenden Katalog zusam-men. Zurzeit werden Fragen zur Auswahlmethodik disku-tiert. Mithilfe einer Vorauswahlstufe soll es beispielsweisemöglich sein, die große Zahl möglicher Maßnahmen(-kombinationen) schon im Vorfeld zu reduzieren. Eineneu entwickelte interaktive Wasserbilanz und ein eben-falls im Projekt erarbeitetes Grundwassermodell konntenbereits zeigen, dass die Wasserbilanz im Projektgebietüber das Jahr hinweg fast ausgeglichen ist. Es liegt also,wie bereits vermutet, kein prinzipieller Wassermangel,sondern ein reines Managementproblem vor.
Planungen für Pilotprojekte abgeschlossen
Mittlerweile haben die Wissenschaftler Konzepte und Ent-wurfsplanungen für eine Regenwassernutzung in der Wohn-siedlung Songfeng und eine effiziente Bewässerung desWeinbaubetriebes Weilong Wine Company fertiggestelltund den chinesischen Partnern übergeben. Reaktionenhierzu stehen noch aus. Die Planungen für Pilotprojektezur Grundwasseranreicherung mit aufbereitetem Abwas-ser in der Kläranlage Dongcheng und zur Wiederverwen-dung von Prozesswässern in der Papierfabrik Yulong sindnoch in Arbeit.
Monitoringsystem im Aufbau
Auch die Umsetzung des Monitoringkonzeptes konntendie Wissenschaftler wesentlich voranbringen. Eine demProjekt vorangegangene Grobanalyse des Projektgebieteshatte deutliche Schwachstellen im bestehenden Monito-ringsystem gezeigt. Sie betrafen vor allem die Erfassung vonGrundwasserständen und Wasserqualitätsparametern.Die chinesischen Partner bauten nun zwei neue Messstel-len, eine dritte ist geplant. Die erste Messstelle ist mit einersolarbetriebenen Multiparameter-Funksonde ausgestat-tet, die laufend fünf verschiedene Werte misst und täglichauf eine Website funkt. Eine Ausstattung mit weitererMess- und Probenahmetechnik sowie regelmäßige Probe-nahmen zur chemischen Analyse sind in Vorbereitung.
Auch bei der Erfassung von Abflussmengen gibt es Schwach-stellen. Besonders gravierend ist, dass die Abflussdaten fürden größten Nebenfluss des Projektgebiets, den Huang-chengji, fehlen. In Abstimmung mit den chinesischenPartnern haben die Wissenschaftler mittlerweile ein Mess-system konzipiert. Es soll kurz vor der Mündung desHuangchengji in den Hauptfluss installiert werden undDaten für die Grundwassermodellierung liefern.
Projekt-Website www.dhi-wasy.de
DHI-WASY GmbHProf. Dr. S. Kaden (Projektkoordinator)Waltersdorfer Straße 10512526 BerlinTel.: 0 30/67 99 98-0Fax: 0 30/67 99 98-99E-Mail: [email protected]: www.dhigroup.comFörderkennzeichen: 02WM0923-6
Testen von Probenahmetechnik an einer Grundwassermessstelle

Derzeit leben knapp eine Milliarde Menschen ohnesauberes Trinkwasser und über drei Milliarden ohneausreichende Sanitärversorgung – mit gravierendengesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Vordiesem Hintergrund haben die Vereinten Nationenim Jahr 2002 die sogenannten Millenniumszielebeschlossen. Darin verpflichtet sich die Staatenge-meinschaft, die Zahl der Menschen ohne Zugang zusauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen bis2015 zu halbieren. Forschungsvorhaben wie die „Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen“(IWAS) können hierfür konkrete Lösungsansätze liefern. In dem Verbundprojekt entwickeln Wissen-schaftler ganzheitliche Wassermanagementkonzep-te für fünf hydrologisch sensitive Weltregionen.
Die Weltbevölkerung wächst rasant und mit ihr der Bedarfan Nahrung und sauberem Wasser. Das große Problem:Bis zu 90 Prozent des erwarteten Anstiegs (bis 2050) wirdin Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden. Umdie benötigten Nahrungsmittel in diesen Regionen zuproduzieren, muss Bewässerungslandwirtschaft betrie-ben werden. Dadurch verschärft sich der dort bereits heu-te herrschende Wassermangel noch – mit rund 70 Prozentdes globalen Wasserverbrauchs ist die Landwirtschaft dermit Abstand größte Wassernutzer.
Angesichts dieser Herausforderungen haben sich rund 40Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-schung – UFZ und der Technischen Universität Dresdenmit der Stadtentwässerung Dresden GmbH, dem Institutfür Technische Hydrobiolgoie (itwh), der Dreberis GmbHund weiteren Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft undPolitik zur „Internationalen WasserforschungsAllianzSachsen“ (IWAS) zusammengeschlossen, um sich dendrängendsten Wasserproblemen in fünf besonders starkbetroffenen Weltregionen zu widmen.
Arbeiten in den Modellregionen
Im Projekt IWAS, das vom BMBF im Rahmen des Pro-gramms „Spitzenforschung und Innovation in den NeuenLändern“ gefördert wird, entwickeln Wissenschaftler Systemlösungen für die jeweiligen Wasserprobleme. DieLösungen dienen als elementare Bausteine für ein ganz-heitliches und nachhaltiges Integriertes Wasserressour-cen-Management (IWRM), dessen Etablierung in den betreffenden Ländern in den nächsten Jahren und Jahr-zehnten angestrebt wird. So unterschiedlich wie die Grün-
Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen – Bausteine für ein zukunftsfähiges Wassermanagement
de für die auftretenden Wasserprobleme sind auch diejeweiligen Profile der untersuchten Regionen:
Osteuropa/Ukraine: Hier steht die Verbesserung der Ober-flächenwasserqualität mit Blick auf die EU-Wasserrahmen-richtlinie (WRRL ) im Vordergrund. Modellregion ist dasEinzugsgebiet des Westlichen Bugs. Die bisherigen Unter-suchungen zeigten, dass das Flussgebiet extremen Belas-tungen ausgesetzt ist. Um hier europäische Standards zuerreichen, bedarf es umfangreicher technologischer Ver-besserungen und veränderter institutioneller Rahmen-bedingungen. Die Wissenschaftler analysierten die was-serwirtschaftlichen Strukturen in den Städten und imländlichen Raum, bildeten den Wasserkreislauf und dievorgefundenen Landnutzungsformen in Computermodel-len ab und erfassten die Klimadaten in einer Datenbank.Gleichzeitig wurden intensive Beziehungen zu Vertreternder Wissenschaft, der Behörden, der Wasserwirtschaftund der verantwortlichen Ministerien aufgebaut.
Zentralasien/Mongolei: In diesem Projektgebiet herrschtein extremes Klima vor und die Umweltbedingungen ver-ändern sich derzeit erheblich. Hier geht es vor allem darum,Anpassungsstrategien zu entwickeln. Eine wichtige Rollespielt die Sicherung der Gewässergüte durch neue Tech-nologien. Die Wissenschaftler haben bereits mit dem Baueines Messgerätes begonnen, das in kürzester Zeit bakterio-logische Verunreinigungen und Schadstoffe nachweisensoll. Außerdem haben sie in enger Abstimmung mit demIWRM-Projekt „MoMo“ (siehe Projekt 1.3.04) die vorhande-nen Verwaltungsstrukturen und Stakeholder analysiert.Hier sollen mögliche Verbesserungen der gesellschaftli-chen Rahmenbedingungen ansetzen und so die nachhal-tige Umsetzung des IWRM-Konzeptes ermöglichen.
RESSOURCE WASSER | 1.3.0758
Modellgebiet Saudi-Arabien: Wasser in der Wüste (Quelle: GIZ IS, Riyadh)

ÖKOLOGIE | IWRM | INTERNATIONALE WASSERFORSCHUNGSALLIANZ SACHSEN 59
Südostasien/Vietnam: Die Arbeiten in diesem Projektge-biet konzentrieren sich auf ein Stadtviertel von Hanoi(Long Bien). Ein extrem schnelles Wachstum in der Regionhat dazu geführt, dass die Abwässer nicht geregelt entsorgtwerden. Hier soll ein Konzept für ein nachhaltiges Entwäs-serungssystem und dessen Integration in den existierendenWasserkreislauf entwickelt werden. Um der Grundwasser-absenkung entgegenzuwirken, haben die Wissenschaftlerdie Möglichkeiten einer künstlichen Anreicherung mitgereinigtem Abwasser analysiert. Auf einem von derStadtverwaltung zur Verfügung gestellten Gelände solleine Demonstrationsanlage errichtet werden. Außerdemist der Aufbau eines Wasserkompetenzzentrums geplant.
Mittlerer Osten/Saudi-Arabien, Oman: In ariden Regionenwie der arabischen Halbinsel kommen Wasserressourcenvor allem in Form von Grundwasser vor. Bei Grundwasserist die Gefahr der Übernutzung besonders groß. Im Mittel-punkt des Regionalvorhabens steht daher eine komplexeModellierung der Grundwasserneubildung und derBeeinträchtigungen seiner Qualität, beispielsweise durchdas Eindringen von Salzwasser im Küstenbereich. Daranschließt sich die Frage nach einer nachhaltigen Bewirt-schaftung an. Im Vorhaben wird unter anderem unter-sucht, welchen Einfluss der Klimawandel und Klimaextre-me auf den Ertrag von Kulturpflanzen haben.
Lateinamerika/Brasilien: Für die Modellregion Brasíliastellt die rasante und ungeplante Urbanisierung ein gro-ßes Problem dar. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarfbald die Wasservorräte und die Systemkapazitäten erheb-lich übersteigen wird. Gemeinsam mit dem Wasserversor-ger und weiteren brasilianischen Partnern erarbeitetIWAS hier geeignete Strategien. Zusammen mit weiteren,ergänzenden BMBF-Projekten wird in diesem Zusammen-hang ein IWRM für die Region aufgebaut. Die regionalenWasserversorger planen für die nächsten Jahre Investitio-nen in Millionenhöhe für die Landnutzung und die Ent-
wicklung der technischen Infrastruktur. Die Projektergeb-nisse werden entscheidend dazu beitragen, dass hierfürnachhaltige Lösungen gefunden werden.
Querschnittsaktivitäten und Ausblick
Für die Entwicklung nachhaltiger Managementkonzeptesind Zukunftsszenarien und Modelle zur Vorhersage nötig.Sie werden für alle Regionalvorhaben in einer zentralen„IWAS-Tool-Box“ zusammengefasst, was eine Übertrag-barkeit auf andere Regionen ermöglichen soll. Weiterezentrale Bestandteile der IWAS-Projekte sind Wissens-transfer (Capacity-Development) und der Aufbau nach-haltiger wasserwirtschaftlicher Strukturen. Sie sollen hel-fen, die entwickelten Lösungen und Strategien in derjeweiligen Region dauerhaft zu implementieren.
Nach der zweieinhalbjährigen Pilotphase wurde einAnschlussvorhaben gestartet (2011 bis 2013). In dieser Phase sollen die Arbeiten fortgeführt, schwerpunktmäßigvertieft und die entwickelten Managementkonzepte mitden jeweiligen Partnern verwirklicht werden.
Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen –IWASHelmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZDepartment Aquatische Ökosystemanalyse und ManagementProf. Dr. Dietrich BorchardtBrückstraße 3a39114 MagdeburgTel.: 03 91/8 10 91 01E-Mail: [email protected]
Technische Universität DresdenInstitut für Siedlungs- und Industriewasserwirt-schaftProf. Dr. Peter Krebs01062 DresdenTel.: 03 51/46 33 52 57E-Mail: [email protected]
Förderkennzeichen: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ 02WM1027Technische Universität Dresden 02WM1028Stadtentwässerung Dresden 02WM1029Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie (itwh) 02WM1050DREBERIS GmbH 02WM1051
Forschungsansatz der Internationalen Wasserforschungs-AllianzSachsen (IWAS)

Der Klimawandel, eine rapide wirtschaftliche Ent-wicklung und das schnelle Bevölkerungswachstumhaben den Druck auf die Wasservorräte im Mekong-delta erhöht. Leben und Landwirtschaft in der ohne-hin von Naturereignissen wie Fluten und Dürrengeprägten Region sind damit noch schwierigergeworden. In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektentwickeln deutsche und vietnamesische Wissen-schaftler jetzt ein neuartiges Informationssystem. Es soll den Behörden vor Ort helfen, das Wasser-management an die veränderten Umweltbedingun-gen anzupassen und die vorhandenen Ressourcennachhaltig zu nutzen.
Der Mekong ist mit 4.500 Kilometern Länge und einemEinzugsgebiet von 800.000 Quadratkilometern einerder größten Flüsse der Erde. Er entspringt im Hochlandvon Tibet und bahnt sich von dort seinen Weg bis in denäußersten Süden Vietnams. Dort fließt er über neun grö-ßere Arme ins Südchinesische Meer und bildet das über70.000 Quadratkilometer große Mekongdelta aus. Lebenund Landwirtschaft in diesem gewaltigen Mündungsge-biet sind geprägt von Naturereignissen: Überflutungenwechseln sich mit Dürren ab, Meerwasser dringt durchEbbe und Flut, aber auch durch den fortschreitenden Kli-mawandel ein und versalzt die Böden. Das schnelle Bevöl-kerungswachstum und eine fortschreitende wirtschaftli-che Entwicklung haben den Druck auf die Ressourcenzusätzlich erhöht und regulatorische Maßnahmen derAnrainerstaaten am Oberlauf führten zu weitreichendenVeränderungen in der Region. Die Folgen sind veränderteÜberflutungsmuster, immer mehr Extremereignisse wieFluten und Dürren, eine zunehmend schlechte Qualitätund Verfügbarkeit von Trinkwasser, versauernde und ver-salzende Böden sowie ein Verlust an Artenvielfalt.
Diese Entwicklungen stellen das Landwirtschafts- undWassermanagement vor große Herausforderungen, dochumweltrelevante Informationen für den administrativenund den Planungssektor liegen in den Untersuchungsge-bieten nur vereinzelt vor und werden kaum ausgetauscht.Doppelzuständigkeiten und Zuständigkeitslückenerschweren eine nachhaltige Lenkung zusätzlich.
Deutsch-vietnamesische Kooperation
Das transdisziplinäre Projekt „Water related Informa-tion System for the Sustainable Development of theMekong Delta“ (WISDOM) ist ein Forschungsvorhaben
Verbundprojekt WISDOM – Ein Wasser-Informationssystem für das Mekongdelta
zum Integrierten Wasserressourcen-Management desMekong auf drei Skalen (Basin, Delta, drei ausgesuchteUntersuchungsgebiete im Delta). Es wird vom DeutschenFernerkundungsdatenzentrum (DFD) des Deutschen Zen-trums für Luft- und Raumfahrt koordiniert. Deutsche undvietnamesische Institutionen bauen im Rahmen des Pro-jekts ein übertragbares Informationssystem (IS) für dasMekongdelta auf. Es soll Planungen und Entscheidungenim Bereich des nachhaltigen Landmanagements und Inte-grierten Wasserressourcen-Managements (IWRM) unter-stützen und zur Klimawandeladaption beitragen. Das Vor-haben wird in enger Kooperation mit den zuständigenInstitutionen auf regionaler und nationaler Ebene durch-geführt.
Mehr Informationen für eine bessere Planung
Beim Design des WISDOM-Informationssystems wird derSchwerpunkt auf die stetige Integration vorhandener undneu generierter Ergebnisse und Daten gelegt. Damit sol-len nutzerorientierte Analysen für die Erarbeitung nach-haltiger Lösungen im Ressourcenmanagement ermöglichtwerden. Das System führt Daten aus unterschiedlichenDisziplinen wie Hydrologie (Wasserquantität, Sediment-fracht), Sozioökonomie (sozioökonomische statistischeDaten, Analysen der rechtlichen Rahmenbedingungen,institutionelle Datenbanken etc.), Geographie (Landnut-zung, Böden, Vegetation, Wasserressourcen und derenWandel), Modellierung (Salzintrusion , Schadstoffaus-breitung, Überflutungsszenarien), Informationstechnolo-gie (Daten aus In-situ-Messnetzen zu Salzgehalt, Wasser-level, pH-Wert , Nährstoffen) sowie Erdbeobachtung(Landnutzung, Bodenfeuchte, versiegelte Flächen etc.)
RESSOURCE WASSER | 1.3.0860
BMBF-Delegation besucht WISDOM-Workshop in Vietnam – WISDOM Projekt Koordination stellt Projektergebnisse vor

ÖKOLOGIE | IWRM | VERBUNDPROJEKT WISDOM 61
zusammen. Das Planungswerkzeug ermöglicht demBenutzer damit Analysen im Hinblick auf spezifische Fragestellungen.
Bedienerfreundliches Online-Werkzeug
Das WISDOM-IS verfügt über eine neuartige, komplexeDateninfrastruktur, die auf verschiedenen lizenzfreienSoftwarekomponenten basiert. Sie ist – bildlich gespro-chen – eine Art „Mini-Google-Earth“ für das Mekongdelta,das alle erzielten Projektergebnisse zur Verfügung stellt.Es erlaubt nicht nur die Visualisierung aller Daten undForschungsergebnisse sowie deren kombinierte Abfrageund Verschneidung, sondern auch den Abruf von Doku-menten, Gesetzestexten, Adressdatenbanken, Bildmaterialund Präsentationen. Da es sich um ein einfach zu bedie-nendes Online-Werkzeug handelt, benötigen die Ent-scheidungsträger im Land keine Erfahrung mit Geoinfor-mationssystemen (GIS) oder andere Geo-IT-relevantenKenntnisse, um das System zu bedienen. Indem es regel-mäßig Daten bereitstellt, kann das IS auch bestimmteMonitoringaufgaben innerhalb eines nachhaltigen Land-und Wasserressourcenmanagement unterstützen. Dasmomentan noch prototypische System soll zur Reifegeführt und gegen Projektende (2013) im Projektgebietimplementiert werden.
Verwertung und Übertragbarkeit
Die Beteiligung an der deutsch-vietnamesischen WISDOM-Initiative bietet exzellente Möglichkeiten, deutsche Tech-nologie und Know-how in Vietnam zu etablieren. Bei einemerfolgreichen Verlauf des Vorhabens bestehen besondersin den Bereichen Umweltmonitoring sowie Entscheidungs-unterstützung im Wasser- und Landmanagement und inder Landadministration gute wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Verwertungsmöglichkeiten. Großes Potenzialbesteht auch in den Bereichen Wissensaufbau (Capacity-Building ) und Training auf institutionellem Level –sowohl national (Ministerien, Forschungsverbünde) alsauch regional.
Das planungsrelevante Informationssystem erlaubt es,Daten jeglicher Art (Fernerkundungs-, GIS- oder Sensorda-ten, digitale Karten, Feldkartierungen, Berichte, Statisti-ken etc.) einzuspeisen und problemspezifisch abzufragen.Des Weiteren sind viele im Projekt entwickelte Methodenan die speziellen Bedingungen in Entwicklungsländernangepasst und übertragbar. Erste Ergebnisse des ProjektsWISDOM werden bereits auf das vom Auswärtigen Amtfinanzierte Projekt CAWA (Wasserverfügbarkeit in Zentral-asien) übertragen. In Zentralasien ebenso wie in Chinabesteht starkes Interesse am WISDOM-Ansatz.
Projekt-Website www.wisdom.caf.dlr.de/
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLRDeutsches Fernerkundungsdatenzentrum DFD desDLRDr. Claudia KünzerMünchner Straße 2082234 WesslingTel.: 0 81 53/28 32 80E-Mail: [email protected]öderkennzeichen: 0330777
Feldarbeiten im Mekong Delta
WISDOM Trainingsworkshop

Das nachhaltige Management der Wasserressourcengehört zu den größten Herausforderungen des 21.Jahrhunderts. In einem Förderschwerpunkt des Bun-desministeriums für Bildung und Forschung arbeitenWissenschaftler, Ingenieure und Praktiker an neuenKonzepten für ein „Integriertes Wasserressourcen-Management“ (IWRM). IWRM ist ein Prozess, der dasLeitbild der Nachhaltigkeit umsetzt und ökologi-sche, soziale und ökonomische Ziele miteinanderverknüpft. Ein wissenschaftliches Begleitprojektunterstützt die Vernetzung der Akteure.
Die globale und sich zuspitzende Wasserkrise ist allgegen-wärtig. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer leidenunter mangelhafter Trinkwasserver- und Abwasserentsor-gung. Etwa jeder sechste Mensch in Asien lebt derzeitohne zentrale Trinkwasserversorgung, jeder zweite ohnegeregelte Abwasserentsorgung. In Afrika sind es vier vonzehn Menschen, die ohne gesicherte Trinkwasserver- undAbwasserentsorgung auskommen müssen. Eine chroni-sche Wasserknappheit ist in vielen semi-ariden und ari-den Regionen der Erde ein begrenzender Faktor für diewirtschaftliche Entwicklung. Die rasche Zunahme derWeltbevölkerung und die Folgen des Klima- und Landnut-zungswandels werden diese Probleme in Zukunft in glo-balem Maßstab verschärfen. Insbesondere die Folgen desKlimawandels – Hochwasser, Dürren und Desertifikationetwa – stellen große Herausforderungen an das künftigeWassermanagement.
Grundlagen 1992 gelegt
Zur Lösung der globalen Wasserprobleme werden großeErwartungen an das Konzept des „Integrierten Wasserres-sourcen-Managements (IWRM)“ gestellt. Die Grundlagendafür wurden mit den „Dublin-Prinzipien“ und der „Agen-da 21“ bereits im Jahr 1992 international als Leitbild veran-kert, viele internationale Konferenzen haben das IWRMKonzept seitdem bestätigt. IWRM ist ein iterativer, adapti-ver und evolutionärer Prozess mit dem Ziel der Maximie-rung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens,ohne dabei die lebenswichtigen Ökosysteme zu beein-trächtigen. Es werden somit ökologische, ökonomischeund soziale Ziele miteinander verknüpft. Dabei ist füreinen guten Umgang mit Wasser die aktive Teilnahmeund Zusammenarbeit der verschiedenen gesellschaftli-chen und privaten Akteure bei den Planungs- und Ent-scheidungsprozessen erforderlich.
Integriertes Wasserressourcen-Management –Wissenstransfer durch weltweite Vernetzung
Den IWRM-Ansatz hat die Europäische Union (EU) in Formder Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 eingeführt, siebefindet sich in den EU-Mitgliedstaaten in der Umset-zung. Die Bewirtschaftungszyklen der EU-Wasserrahmen-richtlinie gelten international als vorbildlich. DieserRahmen bietet – angepasst an die jeweils örtlichen Gege-benheiten – sehr gute Chancen, auch außerhalb der EUdie bestehenden Wasserprobleme zu überwinden.
Förderschwerpunkt seit 2006
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)fördert seit 2006 Projekte zum Integrierten Wasserres-sourcen-Management, die in Modellregionen außerhalbder EU neue Verfahren und Techniken sowie Management-konzepte entwickeln und erproben. Das Ziel: In Siedlungs-räumen und Flusseinzugsgebieten sollen die Wasserver-sorgung sowie der Erhalt der Ökosysteme gesichert unddurch integrierte, auf vergleichbare Regionen übertrag-bare Konzepte nachhaltiges Wirtschaften möglich wer-den. Die daraus hervorgehenden Lösungen sollen zudemdeutschen Unternehmen im Wassersektor den Zugang zuneuen Märkten erleichtern. Daher sind Begleitmaßnah-men ein Teil des Förderschwerpunkts, um die Chancenvon Infrastrukturinvestitionen durch multilaterale Finan-zierungs- und Förderorganisationen zu verbessern.
RESSOURCE WASSER | 1.3.0962
Länder und Regionen, in denen das BMBF Projekte zum IWRM fördert

ÖKOLOGIE | IWRM | INTEGRIERTES WASSERRESSOURCEN-MANAGEMENT 63
Derzeit fördert das BMBF in seinem IWRM-Förderschwer-punkt Forschungsprojekte in China, Indonesien, Iran, Isra-el-Jordanien-Palästina, der Mongolei, Namibia, Südafrikaund Vietnam. Synergien ergeben sich aus den Ergebnis-sen der Förderschwerpunkte „Globaler Wandel des Was-serkreislaufes“ (GLOWA) und „Forschung für die nachhal-tige Entwicklung der Megastädte von morgen“.
Viele Forschungsprojekte und Initiativen arbeiten inzwi-schen an angepassten IWRM-Konzepten. Eine wichtigeFrage ist jedoch, ob sich aus den länderspezifischen Aktivi-täten allgemeingültige Grundlagen und Maßstäbe fürintegrierte Managementansätze ableiten lassen. Dazu istes erforderlich, dass die beteiligten Wissenschaftler undEntscheidungsträger aus Politik und Verwaltung einenintensiven Dialog über die in den Projekten gemachtenErfahrungen führen – und Schlüsse aus deren Ergebnissenziehen.
Koordinierungsstelle für die Vernetzung eingerichtet
Um die Vernetzung der Akteure zu unterstützen, hat dasBMBF im Jahr 2009 eine Koordinierungsstelle am Helm-holtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ eingerichtet.Die Vernetzungsaktivitäten umfassen viele Akteure ausder Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft.Nur durch eine Einbeziehung möglichst vieler Akteure
wird es möglich sein, nachhaltige Konzepte zu entwickelnund das Integrierte Wasserressourcen-Management alsein intelligentes Managementkonzept zu etablieren.
Ziel dieses Begleitprojekts ist es, den inhaltlichen Dialogzwischen den Akteuren zu verbessern; ferner soll es dieIWRM-Fördermaßnahmen – einschließlich des Technolo-gie- und Wissenstransfers – inhaltlich und organisatorischbegleiten, um Synergieeffekte aus den nationalen undinternationalen Forschungsaktivitäten zu ziehen.
Das Vernetzungsprojekt hat sich verschiedenen Quer-schnittsthemen angenommen, die in Workshops undArbeitsgruppen besprochen und bearbeitet werden. Zudiesen Themen, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzungvon IWRM spielen, gehören beispielsweise Capacity Deve-lopment, Informations- und Datenmanagement, WaterGovernance , Stakeholder Partizipation, Finanzierungs-strategien und Implementierungskonzepte. Für das Jahr2011 ist eine internationale Konferenz zum IWRM geplant,bei der Wissenschaftler, Ingenieure, Verwaltung undUnternehmen ihre Erfahrungen und Forschungsergebnis-se zum Thema vorstellen und diskutieren.
Projekt-Website www.bmbf.wasserressourcen-management.de
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZDepartment Aquatische ÖkosystemanalyseDr. Ralf IbischDipl.-Loek Christian StärzDipl.-Pol. Sabrina KirschkeProf. Dr. Dietrich BorchardtBrückstraße 3a39114 MagdeburgTel.: 03 91/8 10 97 57Fax: 03 91/8 10 91 11E-Mail: [email protected]: www.ufz.de
Ein Junge in Jordanien sucht Wasser (Quelle: André Künzelmann, UFZ)

RESSOURCE WASSER | 1.4.064
Gemeinsam gegen das Hochwasser – Zielgerichtete Ansätze zur Risikoabwehr

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER 65
Zerstörte Häuser, vernichtetes Vermögen, gefährde-te Existenzen: Die Bewohner hochwassergefährdeterGebiete müssen offenbar immer häufiger zusehen,wie das Wasser ihnen ihr Eigentum nimmt. Die Gefahrgeht nicht nur von angeschwollenen Flüssen aus, dieDämme überspülen oder zerstören. Da der Grund-wasserspiegel während eines Hochwassers ebensosteigt, sind auch Keller und die unterirdische Infra-struktur gefährdet. Es bedarf eines professionellenRisikomanagements, um die Gefahr für bewohnteund bewirtschaftete Gebiete zu vermindern.
Überschwemmungen gehören wie Niedrigwasser zurnatürlichen Dynamik aller Flusslandschaften. Als Folge desweltweiten Klimawandels zeichnet sich in Mitteleuropajedoch ein Trend zu meteorologischen Extremereignissenwie Dürren oder Starkregenereignissen ab. Somit ist auchmit einer Zunahme sogenannter „Jahrhundertfluten“ zurechnen. Schon jetzt sind Hochwasserereignisse in Europadie am weitesten verbreitete Naturgefahr. Durch einezunehmende Bodenversiegelung versickert immer weni-ger Niederschlagswasser. Der Verbau der Flussauen unddie Kanalisierung der Gewässer bewirken zudem den Ver-lust natürlicher Rückhalteflächen. Dadurch steigt dieFließgeschwindigkeit bei Hochwasser, die Flutwellen ver-laufen höher, und die Schadenswahrscheinlichkeit nimmtzu. Auch das hohe Alter einiger Deiche stellt eine Gefähr-dung dar, weil Deichbrüche auftreten können.
Fachübergreifende Forschungsaktivitäten
In Zukunft sollen daher die Möglichkeiten verbessert wer-den, bedrohliche Situationen frühzeitig zu erkennen undSchäden zu reduzieren. Dazu bedarf es eines umfassendenRisikomanagements, im planerischen wie im operationel-len Bereich. Die Forschung muss hierzu fachgebietsüber-greifende Untersuchungsansätze entwickeln, ihre Ergeb-nisse daraus vermitteln und deren Anwendbarkeit exem-plarisch belegen. Um den Ergebnistransfer in die Praxis zugewährleisten, bindet das Bundesministerium für Bildungund Forschung (BMBF) in seine Forschungsprojekte zumHochwasserschutz Akteure aus Wirtschaft und Verwal-tung ein. Neben Universitäten, Behörden von Bund, Län-dern und Kommunen sowie Privatunternehmen sindWasserverbände und Versicherungen an den Vorhabenbeteiligt.
Schon vor den Flutkatastrophen an Oder und Elbe, ver-stärkt aber unter deren Eindruck, hat das BMBF Projekteim Bereich der Hochwasserforschung gefördert. Beispiel-haft sind folgende vom BMBF geförderten Themenberei-che aufgeführt: Die akuten Schadstoffbelastungen durchdas Elbehochwasser im August 2002 waren ebenso Gegen-stand von Untersuchungen (Projekt 1.4.01) wie auch eineAufklärung der Folgen des noch lange nach der Elbeflutextrem hohen Grundwasserstands in Dresden anhand vonModellen (Projekte 1.4.02 und 1.4.04). Auch zur Überwa-chung und Stabilisierung von Deichen mit Dränelemen-ten (Projekt 1.4.05) sowie mit sensorbasierten Geotextilienim Inneren (Projekt 1.4.06) konnten wichtige Erkenntnisseerlangt werden. Um im Extremfall das Eindringen vonHochwasser durch Fenster und Türen zu verhindern,haben Wissenschaftler des Sächsischen Textilforschungs-zentrums Chemnitz selbstdichtende Wassersperren ent-wickelt, die auch in alte Gebäude mit unebenen Wändenmontiert und ebenso leicht wieder entfernt werden kön-nen (Projekt 1.4.07). Im Mittelpunkt des Projekts MULTI-SURE („Entwicklung multisequenzieller Vorsorgestrate-gien für grundhochwassergefährdete urbane Lebensräu-me“) stand die Frage, wie sich die Schadenspotenziale undGefahren infolge eines schnell steigenden Grundwassersin urbanen Gebieten abschätzen lassen (Projekt 1.4.03).
Nachhaltiger Schutz vor Hochwasserereignissen
Im Jahr 2004 hat das BMBF den Hochwasserschutz zueinem Schwerpunkt in der Forschungsförderung ausge-baut. Die Fördermaßnahme „Risikomanagement extre-mer Hochwasserereignisse“ (RIMAX, vgl. Projekt 1.4.06)hat seither Kompetenzen gebündelt und weiterentwickelt(www.rimax-hochwasser.de). In den Jahren 2005 bis 2010 wurden 38 Projekte mit insgesamt etwa 20 MillionenEuro gefördert. Ziel war es, drohende Hochwasserereig-nisse künftig früher zu erkennen und Schäden schnellerund effektiver vorzubeugen. Damit leistete RIMAX einenwichtigen Beitrag zur Umsetzung des Fünf-Punkte-Pro-gramms der Bundesregierung zum Hochwasserschutzund ist zugleich Teil ihrer High-Tech-Strategie. Mit der Fördermaßnahme RIMAX hat das BMBF außerdem schonfrühzeitig eine Grundlage für die nationale Umsetzungder EU-„Hochwasserrichtlinie“ vom 23. Oktober 2007gelegt („Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Parla-ments und Rates über die Bewertung und das Manage-ment von Hochwasserrisiken“). (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:de:PDF)

Kommt es bei extremen Hochwasserereignissen zurMobilisierung von Schadstoffen wie im Einzugsgebietder Elbe, werden große Mengen schadstoffhaltigerSchlämme und Abwässer in den Überflutungsgebie-ten verteilt – auch in Wohngebieten und auf land-wirtschaftlichen Nutzflächen. Ein Team von Wissen-schaftlern hat die Schadstoffbelastung untersuchtund die davon ausgehenden Gefahren bewertet.Ergebnis: Die Schadstoffgehalte der Böden warennach dem Hochwasser in der Regel nicht größer alszuvor. Dennoch empfehlen die Experten für dieZukunft ein umfassendes Wasser- und Risikomana-gement.
Starke Regenfälle hatten im August 2002 an der Elbe undihren Nebenflüssen zu Extremhochwasser und starkenVerunreinigungen im Überflutungsbereich geführt. DieFluten setzten Schadstoffe aus Altlasten frei, schwemmtenbelastete Flusssedimente auf und trugen verunreinigtenBoden sowie Abraum von Industrieflächen und Bergbau-halden mit sich. Aus Tanks von Privathaushalten lief Öl ausund kommunale sowie industrielle Abwässer aus über-schwemmten Kläranlagen verunreinigten die Flüsse. DasWasser überflutete Wohnanlagen, Gärten und landwirt-schaftliche Nutzflächen. Dort sanken die Feststoffe ab undbildeten eine Schlammschicht, die mit Schwermetallen,organischen Schadstoffen sowie krankheitserregendenKeimen belastet war. Daher galt es, die gesundheitlichenRisiken möglichst kurzfristig zu klären.
Zahlreiche Forschungsinstitutionen und Behörden unter-suchten zunächst unabhängig voneinander die Auswir-kungen der Flut auf die Schadstoffbelastung der Gewässerund überfluteten Bereiche. Um die Messungen miteinan-der zu verknüpfen und die Gesamtsituation zu bewerten,initiierte das BMBF das Verbundprojekt „Schadstoffun-tersuchungen nach dem Hochwasser 2002 – Ermitt-lung der Gefährdungspotenziale an Elbe und Mulde“.28 Partner untersuchten unter Federführung des Umwelt-forschungszentrums Leipzig-Halle die Flussgebiete derMulde sowie der Elbe von Tschechien bis Hamburg.
Chronische Belastung der Flusssedimente
Die Herkunft der zahlreichen Schadstoffe in der Elbe istvielfältig. Elemente wie Arsen oder Schwermetalle kom-men im gesamten Einzugsgebiet natürlich vor und wurdenschon immer aus den angrenzenden Mittelgebirgsregio-nen abgetragen. Sie werden entsprechend der Flussdyna-mik abgelagert oder weitertransportiert und verursachen
Folgen einer Jahrhundertflut – Schadstoffbelastung nach dem Elbehochwasser
die sogenannte geogene Hintergrundbelastung imGewässer. Hinzu kommen Schadstoffeinträge aus Bergbauund anderen industriellen Aktivitäten in der Region.
Kaum Veränderungen durch das Hochwasser
Die teils erhebliche Konzentration von Schwermetallenund organischen Schadstoffen, die die Flüsse während derFlut aufwiesen, ging den Untersuchungen zufolge mitAblaufen des Hochwassers zügig zurück. Von wenigenAusnahmen abgesehen, hat die Flut die Schadstoffgehaltein Auenböden und Sedimenten nicht wesentlich erhöht.Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieregelmäßig überfluteten Deichvorlandbereiche unter-halb der Einmündung von Mulde und Saale hoch belastetsind. Da die Richtwerte für eine Nutzung als Weidelandbezüglich Dioxin und Quecksilber in vielen Proben weitüberschritten waren, empfehlen Experten ein konsequen-tes Nutzungsmanagement. So sollten die besonders hoch
RESSOURCE WASSER | 1.4.0166
Durch die Elbeflut herausgerissener Öltank (Quelle: Thomas Egli)
Sedimentablagerungen nach dem Elbhochwasser 2002 (Quelle: Dagmar Haase)

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | FOLGEN EINER JAHRHUNDERTFLUT 67
belasteten Senken und Wasserlöcher nicht genutzt undmit der Beweidung erst nach reinigenden Niederschlägenbegonnen werden.
Von der Extremflut 2002 waren auch normalerweise vonDeichen geschützte Ortschaften betroffen. Für dieGesundheit der Bevölkerung bestand nach Meinung derForscher jedoch keine akute Gefahr. Nur vereinzelt erga-ben die Analysen erhöhte Schadstoffkonzentrationen.Allerdings zeigte sich bei den Messungen, dass die Grund-belastung des untersuchten Gebiets bereits vor demHochwasser recht hoch war. (siehe Abschlussbericht desUFZ: Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser2002 unter www.ufz.de/data/HWBroschuere2637.pdf).
Risikomanagement einführen
Hochwasser und die damit verbundenen Gefahren wer-den immer wieder auftreten. Allerdings lässt sich das Aus-maß der Ereignisse und der Schäden vermindern. Soregen die Forscher an, wesentlich konsequenter als bishervorsorgende Wasserbewirtschaftung und Landnutzungzu betreiben und zersplitterte Zuständigkeiten für Hoch-wasserfragen zusammenzuführen. Ziel sollte eine integra-tive und interdisziplinäre Wasserbewirtschaftung imFlussgebietsmaßstab sein, die auch ein Hochwasserrisiko-management umfasst. Ein integriertes Schadstoffmana-gement – insbesondere für Mulde und Saale – sehen dieForscher als mögliche Grundlage für eine langfristigeSanierung der Region Mitteldeutschland.
Ein erster Schritt in diese Richtung ist ein neu entwickeltesSchadstoffausbreitungsmodell. Durch die erstmaligeKopplung eines hydraulischen Modells mit einem Gelän-de- sowie einem Schadstoffausbreitungsmodell konntenSzenarien für mäßige bis extreme Hochwasserereignisseermittelt und in einem Entscheidungshilfesystemzusammengeführt werden. Der Landkreis Anhalt Bitter-feld nutzt das System bereits. Es wird außerdem für aktuel-le Hochwasserübungen und bei Neuansiedlungen zurAbschätzung des Risikos von Schadstoffeinträgen beiHochwasserereignissen eingesetzt.
Um bei zukünftigen Hochwassern die Gefahr durch Gift-stoffe und gesundheitsgefährdende Keime zu verringern,raten die Experten außerdem dazu, Handlungsanweisun-gen für den Umgang mit Flutsedimenten auszuarbeiten,Schadstoffquellen wie private Öltanks und Heizungenoder gewerbliche Chemikalienlager hochwassersicher zuinstallieren und Maßnahmen für einen besseren Schutzvon industriellen Anlagen, Kläranlagen und ähnlichenEinrichtungen zu erarbeiten. Die Wissenschaftler emp-fehlen weiterhin, Forschungsergebnisse über ein daten-bankgestütztes „Decision Support System“ (DSS) zusam-menzuführen, damit bei zukünftigen Entscheidungen diebenötigten Informationen bereitstehen.
Stärker als bisher sollten außerdem Überschwemmungs-gebiete vorsorglich von Bauten und ungeeigneter Nut-zung freigehalten werden (Flächenvorsorge). Der Erosionvon belasteten Böden in Flussauen kann durch Stilllegungvon Ackerflächen und Begrünung begegnet werden. Frei-gehaltene Flächen dienen zudem als natürliche Retenti-onsflächen ; Schäden an Gebäuden entstehen auf dieseWeise erst gar nicht.
In einem zweiten vom BMBF geförderten Projekt, „Minde-rung von Hochwasserrisiken durch nicht-strukturelleLandnutzungsmaßnahmen in Abflussbildungs- und Über-schwemmungsgebieten“ (MinHorLam), untersuchtenWissenschaftler den Einfluss von nicht-strukturellenLandnutzungsmaßnahmen auf Hochwasserrisiken. The-ma waren hier unter anderem die Risikopotenziale fürProduzenten und Verbraucher, wenn SchadstoffeinträgePflanzenbestände und Böden auf land- und forstwirt-schaftlich genutzten Flächen kontaminieren. Sie erarbei-teten schadensreduzierende Maßnahmen wie Landum-nutzungen, Anbau von speziellen Pflanzensorten, dieSchadstoffe nur in geringem Maße akkumulieren oderAusgleichszahlungen für Flächenstilllegungen. Diegewonnenen Erkenntnisse werden der Bevölkerung übereine Internetplattform zugänglich gemacht.
UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbHDepartement FließgewässerökologieDr. Wolf von Tümpling, Prof. Walter GellerBrückstraße 3a39114 MagdeburgTel.: 03 91/8 10-93 00Fax: 03 91/8 10-91 11E-Mail: [email protected],[email protected]: www.ufz.de/hochwasserFörderkennzeichen: 0330492
Hinterlassenschaften des jahrhundertelangen Bergbaus: Schlacken-halden in Muldenhütten bei Freiberg. Während des Hochwassers 2002wurden hier rund 9.000 Tonnen hochgradig blei- und arsenbelastetesMaterial erodiert (Quelle: Günther Rank)

Bei Hochwasser wird neben der oberirdischen Über-flutung oft auch das ansteigende Grundwasser zurGefahr. Es breitet sich unter der Erde aus und kanngroße Schäden verursachen. Bislang stellen diemeisten Simulationssysteme die Wasserflüsse fürdiese Prozesse separat oder auf zwei Komponentenbezogen dar. Oberflächenwasser, Kanalisation undGrundwasser gemeinsam abzubilden, war bislangunmöglich. Um die Interaktion dieser Komponentenbei Hochwasser besser abschätzen zu können, ver-knüpfte ein Forschungsverbund um das DresdnerGrundwasserforschungszentrum die computerge-stützten Modelle miteinander.
Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben gewaltigeSchäden verursacht. Mit rund einer Milliarde Euro sind imAugust 2002 rund zehn Prozent der deutschen Gesamt-schadensumme allein in Dresden angefallen. 16 Prozentder Schäden an den Liegenschaften des Freistaats Sachsengehen auf Grundwasser zurück. Dadurch ist den Men-schen bewusst geworden, dass Hochwasser in städtischgeprägten Räumen auch das Grundwasser beeinflussenkann. Dieses breitet sich unterirdisch im Wesentlichenüber zwei Pfade aus:
Oberflächenwasser gelangt ins Grundwasser und ver-teilt sich dort. Das Grundwasser, das aus dem Hinter-land dem Vorfluter zuströmt, staut sich auf.Das Oberflächenwasser verteilt sich über Infrastruk-turbauwerke wie Abwasserkanalisation (technogeneZone ) in Gebiete außerhalb des direkten Über-schwemmungsbereichs.
Unmittelbar nach dem Hochwasser begannen Forscherdes Dresdner Grundwasserforschungszentrums e. V. dieInteraktion zwischen Oberflächenwasser und Grundwas-ser im Hochwasserfall modellgestützt abzubilden. Zielwar es, die Hochwassernachsorge zu begleiten und dieVorsorge zu verbessern. Für Wechselwirkungen zwischenOberflächenwasser und Grundwasser sowie zwischenGrundwasser und Kanalisation existierten damals abernur einzelne modelltechnische Lösungen. Sie beruhtenauf Simulationsprogrammen, die ausschließlich auf eineKomponente – Oberflächenwasser, Kanalisation oderGrundwasser – ausgerichtet waren.
Gekoppelte Modellierung: Drei Zonen – ein System
Abhilfe schaffte hier das BMBF-Projekt „Entwicklungeines 3-Zonenmodells für das Grundwasser- und Infra-
Projekt 3ZM-GRIMEX – Gekoppelte Modelle simulieren Hochwasserszenarien
strukturmanagement nach extremen Hochwasser-ereignissen in urbanen Räumen“ (3ZM-GRIMEX). DieWissenschaftler des Projektteams entwickelten für dieLandeshauptstadt Dresden ein neuartiges Modellwerk-zeug, das die Wechselwirkungen zwischen den hydrauli-schen Komponenten Oberflächenwasserabfluss, Abflussin der technogenen Zone und Grundwasser bei extrememHochwasser auf der Basis bestehender Modelle abbildet.Mit diesem gekoppelten Modellsystem können Lösungs-strategien für die Gestaltung und Sicherung der unterir-dischen Infrastrukturnetze, für das Management vonGrundhochwasser und zur Unterstützung bauleitplaneri-scher Entscheidungen entwickelt werden.
Mithilfe einer Kopplungssoftware des Fraunhofer-Insti-tuts verknüpften die Experten Simulationsprogramme,die sich bei der Abbildung der bei einem Hochwassermaßgeblichen Wasserströme bewährt hatten. Dabeimussten sowohl die zeitlichen als auch die räumlichenUnterschiede zwischen den einzelnen Modellkomponen-ten berücksichtigt werden. Für eine erfolgreiche Kopp-lung müssen die grundlegenden Zusammenhänge desSystems, das aus Kanalnetz, Oberflächen- und Grundwas-ser besteht, sowie die zeitlichen und räumlichen Skalender Strömungsprozesse bekannt sein. Eine Skala legt fest,auf welche Weise ein bestimmtes Merkmal eines Prozes-ses erfasst und messbar gemacht wird.
Computergestützter Kopplungsprozess
Die computergestützte Kopplung beruht auf der Strategie,dass die Einzelmodule – Oberflächenwasser-, Kanalnetz-und Grundwassermodell – als eigenständige Instanzenihre jeweiligen Wasserstände und Durchflüsse berechnenund daraufhin miteinander austauschen. Jedes Modul stelltdann diese sogenannten Kopplungsgrößen dem jeweils
RESSOURCE WASSER | 1.4.0268
Hochwasser in Dresden: Wasseraustrittdurch die Kanalisation am Terrassenufer

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | PROJEKT 3ZM-GRIMEX 69
anderen Modul zur Verfügung. Die Kopplungssoftwarekombiniert schließlich die Informationen der Einzelmo-dule (Verschneidung) miteinander. Verschneidet man bei-spielsweise Kanalelemente, Grundwasserstände undÜberflutungsflächen, kann man herausfinden, welcheAnwohner von Unwettern betroffen sein werden und sierechtzeitig warnen.
Die verwendeten Programme stellten das Projektteam jenach Anwendungsbereich vor unterschiedliche Heraus-forderungen. Beispiel Kanalnetz: Für die hydrodynami-sche Kanalnetzberechnung war keine besonders hoheLeistungsfähigkeit der Rechner erforderlich. Außerdem
war die Datenlage dazu in den meisten Kommunen sehrgut. Die Wirkung der Kanalisation auf die Grundwasser-dynamik hingegen konnte nur über stark vereinfachendeAnsätze in ein Grundwassermodell einbezogen werden.
Praktischer Einsatz in Dresden
In der ersten Bearbeitungsphase standen die Einzelmodelleim Mittelpunkt. Hier kam es darauf an, deren Raumbezü-ge aufeinander abzustimmen und alle relevanten Wasser-flüsse, die im Überflutungsfall wirken und in dem Modell-system abgebildet werden sollten, zu erfassen. Hierzuerstellten die Forscher ein allgemeines Wasserflussschema,das Grundlage für die Kopplungsarbeiten war. Es gingdabei vor allem um die adäquate Abbildung temporärerKomponenten wie Hochwasserentlastungsbrunnen, Über-flutungsflächen oder überstaute Kanalabschnitte. DieseAlgorithmen wurden in einem synthetischen Testmodellgetestet. Damit erprobte das Expertenteam zunächst dieKopplungen zweier und anschließend aller drei Instanzen.
Das Gesamtsystem kommt inzwischen in der Landes-hauptstadt Dresden zum Einsatz. Durch die gekoppeltenModellierungen konnten für verschiedene Hochwasser-szenarien der Wasseraustausch zwischen Oberflächenab-fluss, Abfluss in der Kanalisation und Grundwasserberechnet werden. Außerdem identifizierten Expertenmithilfe des neuen Systems die Schwerpunkte latenterHochwassergefahren durch austretendes Kanalwasser.Die Übertritte von Grundwasser in das Kanalsystem konn-ten lokalisiert und quantifiziert werden. Der Einfluss vonaustretendem Kanalwasser auf das Grundwasser spielt beiHochwasserereignissen nur lokal eine Rolle, kann aber inden Schwerpunktbereichen je nach Intensität zu signifi-kanten Anstiegen des Grundwassers führen.
Projekt-Website www.gwz-dresden.de/dgfz-ev/forschungsbereich/3zm-grimex.html
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e. V.ProjektkoordinationDr. Thomas SommerMeraner Straße 1001217 DresdenTel.: 03 51/40 50-6 65Fax: 03 51/40 50-6 79E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WH0557
Schema der Modellkopplung im Projekt 3ZM-GRIMEX
Vorausberechnung der Überflutungsflächen durch realitätsnaheModellierung (Quelle Kartenhintergrund: Landeshauptstadt Dresden)

Welche Folgen hat der im Zuge eines Hochwassersansteigende Grundwasserpegel, insbesondere fürden städtischen Baubestand nahe Flüssen? Antwor-ten auf diese bislang vernachlässigte Frage hat dasProjekt MULTISURE gesucht. Die Wissenschaftlerentwickelten Modelle, mit denen sich künftig mög-liche Risiken und Schadenspotenziale genauer ein-grenzen lassen — am Beispiel der ElbmetropoleDresden.
Die Fachöffentlichkeit nimmt ein Hochwasser meist alsEreignis extremer Abflüsse an der Erdoberfläche wahr.Der durch die Überflutungen erzeugte Anstieg des Grund-wassers auch außerhalb der Überflutungsflächen lässtsich vor allem während länger andauernder Hochwasser-ereignisse in breiten Talauen beobachten. Von der Wis-senschaft bislang selten berücksichtigt wird die Gefähr-dung unterirdischer Bauwerke und Infrastrukturen durchschnell steigendes Grundwasser als Folge von Extrem-hochwassern.
Doch wie lassen sich die Schadenspotenziale und Gefahreninfolge eines schnell steigenden Grundwassers in urbanenGebieten abschätzen? Wie müssen Modelle aussehen, dieeine Prognose von unterirdischen Schäden bei einemExtremhochwasser ermöglichen? Diese Fragen standenim Mittelpunkt des Projekts „Entwicklung multisequen-zieller Vorsorgestrategien für grundhochwasserge-fährdete urbane Lebensräume“ (MULTISURE), an demmehrere Institute unter Leitung des Dresdner Grundwas-serforschungszentrums (DGFZ) gearbeitet haben (Lauf-zeit: 2006 bis 2009). Ziel des Vorhabens war es, Werkzeugezu entwickeln, die es ermöglichen, die Gefährdungen,Schadenspotenziale und Risiken, die sich aus den Wir-kungszusammenhängen von Hochwasser, Grundwasserund dem unterirdisch bebautem Raum ergeben, abzubil-den und zu bewerten. Untersuchungsgebiet war die StadtDresden mit dem Elbtalgrundwasserleiter und der beste-henden sowie geplanten Tiefbebauung.
Zwei Schadensmodelle entwickelt
Zunächst untersuchten die Projektpartner, wie sich dieAnsätze der Schadensabschätzung von Flussüberschwem-mungen auf das Grundhochwasser übertragen lassen, wiebeide Ereignisse zusammenwirken oder sich überlagern.Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) modifiziertdazu das für Flusshochwasser entwickelte meso-skaligeSchadensmodell FLEMOps (Top-down-Ansatz), um die
Hochwasserereignisse – Das vergessene Grundwasser
durch steigendes Grundwasser verursachten Schädenabzuschätzen. In diesem Rahmen wurden die Betroffenentelefonisch befragt — speziell zu Schäden, die außerhalbder Überflutungsfläche nur durch Grundwasser entstan-den sind. Daraus ließen sich sowohl Erkenntnisse zumindividuellen Umgang mit Grundhochwasser als auch zuden materiellen wie finanziellen Schäden gewinnen.
In einem Bottom-up-Ansatz wurden in dem Projekt — inAbhängigkeit von der Grundwasserdynamik — Schadens-bilder für baualtersbezogene Gebäude- und Infrastruktur-typen beschrieben. Damit lassen sich die zur Schadensbe-seitigung notwendigen Sanierungsmaßnahmen undderen Kosten bestimmen. Darauf aufbauend hat das Leib-niz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IöR) dasneue „Schadens-Simulations-Modell für grundwasserbe-dingte Gebäudeschäden“ (GRUWAD) entwickelt.
Mehrere Szenarien erstellt
Die grundwasserbezogene Risikobewertung und -darstel-lung nutzte beide Modellierungsansätze (Top-down undBottom-up). Mit Hilfe von FLEMOps und GRUWAD erfolgtedie GIS-basierte Bestimmung von grundwasserinduzier-ten Schäden in unterschiedlicher räumlicher Auflösung.Grundlage waren die vom Dresdner Grundwasserfor-schungszentrum erstellten Szenarien für höchste Grund-wasserstände unter verschiedenen Hochwasserständenim Elbtal Dresden und bei der Realisierung verschiedenerSchutzmaßnahmen (Datenbasis waren bisherige Hoch-wasserereignisse sowie die laufenden Planungen der Lan-deshauptstadt Dresden).
RESSOURCE WASSER | 1.4.0370
Gefahr von unten: Wirkungen auf die Gebäudesubstanz

ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | HOCHWASSER UND GRUNDWASSER 71
Interviews durchgeführt
Für ein effizientes Hochwasser-Risikomanagement ist eswichtig, dass alle Akteure intensiv kommunizieren undzusammenarbeiten: die städtischen und staatlichenBehörden, Verbände und Wissenschaft ebenso Anwohner.MULTISURE hat diese Prozesse analysiert und bewertet.
Aussagefähige Informationen sind Grundlage für einabgestimmtes behördliches Handeln bei der Hochwasser-vorsorge – und sie schärfen das Risikobewusstsein und dieEigenvorsorge der Bürger. Die im Verlauf des Projektsdurchgeführten Interviews mit Akteuren sowie die Analy-se bestehender Informations- und Kommunikationsmittellagen in den Händen des Instituts für Umweltkommuni-kation der Leuphana Universität Lüneburg. Daraus ent-stand ein Faltblatt, das sich vornehmlich an die allgemei-ne Öffentlichkeit wendet, und das insbesondere auf dieEigenverantwortung der Betroffenen eingeht und somitderen Risikovorsorge stärken soll.
Die Projektergebnisse wurden von der FH Görlitz/Zittau indas Informationssystem der Landeshauptstadt Dresdenaktuell übernommen. Ein behördeninterner Zugriff aufwesentliche Projektergebnisse ist damit möglich. So die-nen die Ergebnisse der Verbesserung der behördeninter-nen Analysen und Entscheidungen sowie der Informationder Öffentlichkeit über Risiken durch Grundhochwasser.
Gefahr von unten: oberirdisch austretendes Grundwasser
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.(DGFZ)Dr. Thomas SommerMeraner Straße 1001217 DresdenTel.: 03 51/4 05 06-65Fax: 03 51/4 05 06-79E-Mail: [email protected]: www.dgfz.deFörderkennzeichen: 0330755

Infolge des Hochwassers im August 2002 hatte Dres-den nicht nur mit den Schäden an Bauwerken undInfrastruktur zu kämpfen. Auch das Grundwasserwar teilweise um bis zu sechs Meter gestiegen undging nur langsam zurück. Deshalb machte sich einTeam aus Dresdner Forschern und Ingenieurendaran, die Folgen der Flut im Untergrund zu untersu-chen. Ziel war, künftige Gefahren für unterirdischeAnlagen sowie das Grundwasser frühzeitig zu erken-nen, um Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Zudiesem Zweck modellierten die Experten die Dyna-mik des Grundwasseranstiegs und analysierten dieBeschaffenheit des Grundwassers hinsichtlich derTrinkwasserversorgung sowie möglicher Gefahrendurch eingesickerte Schadstoffe.
Während des Hochwassers 2002 bildeten sich im Elbtal-untergrund Grundwasserstände, die alles in den letztenJahrzehnten Beobachtete weit übertrafen. Auslöser warendie starken Regenfälle vom 12. und 13. August, diedadurch entstandenen Überflutungen der Elbenebenflüs-se und das Elbehochwasser. Betroffen waren unter- undoberirdische Bauwerke – ihre Funktionsfähigkeit und Sta-bilität waren aufgrund des schnellen Grundwasseran-stiegs erheblich beeinträchtigt. Als die oberirdische Was-serflut zurückging, galt es, die Konsequenzen des unterir-dischen Hochwassers für den Grundwasserkörperunterhalb der Stadt Dresden abzuschätzen. Dieser spielteine große Rolle für die Trink- und Brauchwassergewin-nung, für die Stabilität der Bauwerke sowie den urbanenNaturhaushalt. Wissenschaftler und Ingenieure der TUDresden und des Dresdner Grundwasserforschungszen-trums e. V. sowie örtliche Ingenieurbüros widmeten sichim Forschungsprojekt „Hochwassernachsorge Grund-wasser Dresden“ dieser Aufgabe. Die Leitung des Projektslag beim städtischen Umweltamt. Die Experten gingenvon kurz- und mittelfristigen Folgen aus, die sie anhandfolgender Schwerpunkte untersuchten:
Weiterentwicklung des Grundwassermodells, um dieAuswirkungen der Grundwasserdynamik auf Bauwer-ke und mögliche Bauwerksschäden zu erfassen,Untersuchung von Veränderungen der Grundwasser-beschaffenheit infolge stark gestiegener Grundwas-serstände,Analyse und Bewertung möglicher Grundwasserschä-den, die – bedingt durch Hochwasser – durch schad-stoffbelastete Flächen (Altlasten), abgelagerte Schläm-me oder Abfall entstehen,Bewertung der Gefahren, die von undichten Abwas-serkanälen ausgehen (Schadstoffaustrag).
Unterschätzte Gefahr Grundhochwasser – Schadensbewertung und -vorsorge nach der Jahrhundertflut
Ziel war es, am Beispiel von Dresden erstmals hochwasser-bedingte Schäden an einem unter der Stadt liegendenGrundwasserkörper zu bewerten und daraus Handlungs-empfehlungen für Verwaltung, betroffene Unternehmenund Bürger abzuleiten.
Modell erfasst Grundwasserdynamik
Ausprägung und Verlauf des Grundhochwassers zeigtensich im Stadtgebiet auf unterschiedliche Weise. WeiteBereiche verzeichneten nach der Hochwasserwelle einenAnstieg und einen stark verzögerten Rückgang desGrundwasserstands. Diese Gebiete lagen meist mehr alseinen Kilometer vom Vorfluter entfernt. In anderenzeigte sich ein kurzzeitiger und hoher Anstieg mit schnel-lem Rückgang. Um diese unterschiedlichen Dynamikenzu erfassen, entwickelten die Experten ein Computer-Grundwassermodell, das auch die unterirdische Bausub-stanz – vor allem der historischen Innenstadt und derInfrastruktur – berücksichtigte. Damit konnte das Projekt-team auch die Wirkung differenzierter Hochwasser-schutzmaßnahmen auf das Grundwasser simulieren.
Die Untersuchungen der Grundwasserbeschaffenheiterfolgten auf drei Ebenen: Im Herbst 2002 sowie im Früh-jahr und Herbst 2003 nahm die Arbeitsgruppe flächen-deckende Beprobungen vor, um zu prüfen, wie sich dieQualität entwickelt hatte. Zudem fanden Untersuchun-gen zu punktuellen Schadstoffeinträgen an Altlasten-standorten statt. Die dritte Säule bildeten exemplarischestandortbezogene Untersuchungen im Labormaßstab amnatürlichen Sediment . Dieses Vorgehen sollte Aussagenzu Stoffaustrag und -umwandlung für den Fall ermögli-chen, dass schadstoffbelastetes Abwasser aus der Kanali-sation in das Grundwasser gelangt. Die Forscher simulier-ten Szenarien bei unterschiedlichen Wasserständen und -drücken in Kanal und Grundwasserleiter .
RESSOURCE WASSER | 1.4.0472
Hochwasser der Elbe bei Kaditz. Grundwassermessstellen sind von derFlut eingeschlossen.

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | UNTERSCHÄTZTE GEFAHR GRUNDHOCHWASSER 73
Trinkwasser nicht gefährdet
Sorgen im Hinblick auf die Beschaffenheit des Grund-wassers konnten die Experten ausräumen, indem sieMessergebnisse zu bestimmten Wassereigenschaften undSchadstoffen den vor der Flut ermittelten Werten gegen-überstellten. Demnach waren hochwasserbedingte Ver-änderungen nur etwa drei Monate lang erkennbar. Siestellten für die Trinkwassergewinnung keine Gefahr dar.
An den untersuchten Altlastenstandorten ergaben sich jenach Stoffinventar und Strömungsverhältnissen unter-schiedliche Ergebnisse. Erhöhte Grundwasserstände undeine höhere Fließgeschwindigkeit setzten Schadstoffe ausdem jeweiligen Quellbereich frei. Im oberen Grundwasser-bereich wiesen die Experten daher leicht erhöhte Schad-stoffkonzentrationen nach, für bestimmte Stoffgruppenzudem vertikale Stoffverlagerungen. Eine signifikantehochwasserbedingte seitliche Schadstoffausbreitung warnicht zu beobachten.
Um die von undichten Kanälen ausgehenden Gefahrenfür den Grundwasserleiter zu untersuchen, simulierte dasProjektteam das Verhalten einer lokal undichten Kanali-sation unter den hochwasserbedingten Druck- und Strö-mungsbedingungen. Es zeigte sich, dass sich die für städti-sche Abwässer typische Ammoniumbelastung aufgrundder Strömungsgeschwindigkeit und der begrenztenundichten Stellen nur wenig ausbreiten konnte.
Gefahren erkennen, Schutzmaßnahmen entwickeln
Ausgehend von den Abständen des Grundwasserspiegelszur Geländeoberkante (Grundwasserflurabstand) vonAugust 2002 bis Dezember 2003, entwickelten die Exper-ten eine Methodik, um Gefahren für den unterirdischenBauraum zu erkennen. Als Parameter verwendeten sie
unter anderem Intensität und Dauer des Grundhochwas-sers, die höchsten Wasserstände, die Anstiegsgeschwin-digkeit und die minimalen Grundwasserflurabstände.Damit konnten sie an 68 Messstellen im Stadtgebiet dasGefahrenpotenzial bestimmen.
Die Auswertung des Grundwasserverhaltens und der Strö-mungsmodellierung am Beispiel unterschiedlicher Hoch-wasserszenarien erlaubte Schlussfolgerungen für die Bau-leitplanung. Diese sollte nach den Erkenntnissen des Pro-jektteams immer die Gefährdung durch ansteigendesGrundwasser berücksichtigen. Außerdem bestätigten dieUntersuchungen die Wirksamkeit der geplanten Schutz-maßnahmen „Mobiler Verbau der Dresdner Innenstadt“und „Hochwasserentlastungsbrunnen“.
Die Forscher empfehlen im Ergebnis der Untersuchungen,die Prozesse des Grundwasseranstiegs bei der Vorberei-tung und Durchführung von Maßnahmen zur Hochwas-serbekämpfung dauerhaft zu berücksichtigen. Insbeson-dere der Bauvorsorge kommt hier eine Schlüsselstellungzu. Die Ausweisung von Gefahrenzonen, in denen erhöhteGrundwasserstände zu erwarten sind, bildet hierfür eineGrundlage. Dazu sind zeitnahe Messungen der Grundwas-serdynamik und die Identifizierung der höchsten Grund-wasserstände anhand eines aktuellen Grundwasserströ-mungsmodells erforderlich.
Projekt-Website www.hochwasser-dresden.de/HWGWDD
ProjektleitungLandeshauptstadt Dresden, UmweltamtDr. Kirsten UllrichGrunaer Straße 201069 DresdenTel.: 03 51/4 88 62 78E-Mail: [email protected]: www.dresden.de/HochwasserFörderkennzeichen: 0330493
ProjektkoordinationDresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.Dr. Thomas SommerMeraner Straße 1001217 DresdenTel.: 03 51/4 05 06 65E-Mail: [email protected]
Bauwerkssicherung gegen aufsteigendes Grundwasser in einemDresdner Gymnasium (Quelle: www.benno-gym.de)

Während der Hochwasserereignisse der letzten Jah-re kam es immer wieder zu Deichbrüchen, weil diezum Teil historisch gewachsenen Schutzdeiche denhydraulischen Belastungen nicht standhielten. Einegrundlegende Sanierung aller betroffenen Deich-strecken kann aus Kostengründen allenfalls langfris-tig erfolgen. Vor diesem Hintergrund entwickeltenWissenschaftler in zwei vom BMBF geförderten For-schungsprojekten einerseits ein Monitoringsystem,das kritische Deichzustände sicher anzeigen soll.Außerdem erarbeiteten sie ein Verfahren, das gefähr-dete Deiche mithilfe von Dränelementen stabilisiert.Modellversuche bestätigten seine Wirksamkeit.
Ein dem Stand der Technik entsprechender Drei-Zonen-Deich besteht aus einer wasserseitig angeordneten Ober-flächendichtung und einem Stützkörper in der Mitte desQuerschnitts. Ein landseitiger Dränkörper sorgt dafür,dass Sickerwasser im Deich gefasst und schadlos abgelei-tet wird. Entlang von Flüssen und Strömen in Deutschlandgibt es aber – wie in anderen Teilen Europas auch – hun-derte Kilometer alter Deiche, die nicht diesen heutigenSicherheitsstandards entsprechen. Sie wurden früher,meist nach Hochwasserereignissen, mit vor Ort zur Verfü-gung stehenden Materialien aufgeschüttet. MangelsDichtungsschicht dringt bei einem HochwasserereignisWasser in solche Deichkörper ein, und es kommt zu einerfortschreitenden Durchfeuchtung, die im schlimmstenFall zum Bruch des Deichs führen kann.
Deich-Monitoring mittels Time Domain Reflectometry
Die zeitliche Entwicklung der Durchfeuchtung spielt fürdie Stabilität beziehungsweise die Standsicherheit einezentrale Rolle, insbesondere bei den oben genannten Altdeichen. Um hierüber verlässliche Informationen zuerhalten, ist ein Monitoringsystem erforderlich, das ent-lang einer Deichstrecke Daten über die aktuelle hydrauli-sche Situation des Deichkörpers liefert. Die sogenannteTime Domain Reflectometry (TDR) hat sich in Verbindungmit Kabelsensoren als ein geeignetes Messverfahren hier-für erwiesen. Hierzu werden Flachbandkabel als Sensorenin den Deichkörper eingebracht. Anhand eines am Sensor-anfang eingespeisten und am Sensorende reflektiertenSpannungsimpulses lässt sich die Feuchteverteilung ent-lang der Kabelsensoren bestimmen. Auf diese Weise kanndie Sickerlinie (Grenze zwischen feuchtem und trockenemMaterial) und damit der durchfeuchtete Bereich hinrei-chend genau bestimmt werden. Der Vorteil des Verfah-
Deichbrüche vermeiden – Beobachtungsmethoden undSicherungskonzepte für Flussdeiche
rens ist, dass Eingriffe am Deichkörper nur an neuralgi-schen Punkten erforderlich sind.
Wissenschaftler der Materialforschungs- und -prüfanstalt(MFPA) der Bauhaus-Universität Weimar sowie des Insti-tuts für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) des Karls-ruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelten im Rah-men des Projekts „Bewertung und Prognose der Stand-sicherheit von Hochwasserschutzdeichen mittels TimeDomain Reflectometry“ ein auf der TDR-Methode basie-rendes Monitoringsystem speziell für Hochwasserschutz-deiche.
Kern des Monitoringsystems ist ein Prognosemodell, dasauf Basis der gemessenen Feuchteverteilungen innerhalbeines Deiches, des prognostizierten Hochwasserverlaufsund der vorhergesagten Niederschläge den weiteren Ver-lauf der Deichdurchfeuchtung vorhersagt. Sowohl für diegemessene Feuchteverteilung während eines Hochwas-sers als auch für die vorhergesagten Feuchtebedingungenwurde ein Bewertungsmodul entwickelt, das eine Standsi-cherheitsanalyse der luftseitigen Böschung des eingestau-ten Deiches erlaubt. Das entwickelte Monitoringsystem istin der Lage, autark mit eigenständiger StromversorgungMessungen durchzuführen und mittels Datenfernüber-tragung an einen zentralen Server zu senden. Die analy-sierten und vorhergesagten Feuchteverteilungen werdenzusammen mit der Standsicherheitsbewertung für einenOnline-Zugriff bereitgestellt. Den für das Hochwasser-management verantwortlichen Stellen könnte somit eineffektives Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, umbei Gefahr kurzfristig Sicherungsmaßnahmen oder Evaku-ierungen zu veranlassen. Eine Überführung des Monito-ringsystems in ein voll automatisiertes Beobachtungs-werkzeug war im Rahmen der Förderperiode dieses Pro-jekts nicht möglich.
Stabilisierung von Deichen mit Dränelementen
Bruchgefährdete Deichabschnitte müssen bei Hochwas-ser im unteren Bereich der landseitigen Böschung stabili-siert werden, was mit einem erheblichen Einsatz anArbeitskräften und Material (z. B. Sandsäcken) verbundenist. Die Böschungsoberfläche auf der Flussseite mit Folienoder anderen Materialien abzudichten, ist hingegen nurdann sinnvoll, wenn Schwachstellen zu einer konzentrier-ten Durchströmung führen. Ansonsten kann mit derleiMaßnahmen die Höhe der Sickerlinie nicht nennenswertabgesenkt werden. Wenn sich das Eindringen von Wasser
RESSOURCE WASSER | 1.4.0574

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | DEICHBRÜCHE VERMEIDEN 75
in die Deiche nicht verhindern lässt, kommt es somit ent-scheidend darauf an, das Sickerwasser im Deichkörper zufassen und schadlos abzuleiten. Andernfalls kann es ander landseitigen Böschung austreten; erhöhte Strömungs-kräfte führen dann möglicherweise zu einem Deichbruch.
Hiermit befasst sich das zweite BMBF-Projekt „Stabilisie-rung bruchgefährdeter Flussdeiche mit Dränelemen-ten zur Sickerwasserfassung und Bewehrung“, an demdas Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik desKarlsruher Instituts für Technologie, das Fachgebiet Geo-technik der Universität Kassel sowie das Sächsische Textil-forschungsinstitut (STFI) in Chemnitz beteiligt waren. Indem Forschungsvorhaben wurde ein Konzept zur Siche-rung von eingestauten Deichen im Falle eines Hochwas-sers entwickelt. Eine derartige Notsicherungsmaßnahmekann letztlich auch zur kurz- beziehungsweise mittelfristi-gen Ertüchtigung von Altdeichen verwendet werden kön-nen.
Wirksamkeit des Verfahrens belegt
Konkret sieht die Notsicherungsmaßnahme vor, in bruch-gefährdete durchweichte Deiche maschinell Dränelemen-te einzubringen, die den Sickerwasserandrang zum Deich-fuß abfangen. Der Einbau soll weitestgehend mit Stan-dardgeräten zum Beispiel aus der Bauwirtschaft möglichsein, die vielerorts schnell verfügbar sind. Die Praktikabili-tät des Verfahrens und die zum Einbau erforderlichenHilfsmittel wurden an Modelldeichen im natürlichenMaßstab mit einem marktüblichen Bohrgerät getestet.Die praxisnahen Versuche bestätigten die Leistungsfähig-keit des Stabilisierungsverfahrens. Für seine Akzeptanz inder Baupraxis wäre darüber hinaus eine Erprobung aneiner realen Deichstrecke von großer Bedeutung. Diesekonnte jedoch im Rahmen des Forschungsprojektes nichtmehr durchgeführt werden.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Bodenmechanik und FelsmechanikDr.-Ing. Andreas BiebersteinEngler-Bunte-Ring 1476131 KarlsruheTel.: 07 21/6 08-22 23Fax: 07 21/69 60 96E-Mail: [email protected]: www.ibf.uni-karlsruhe.deFörderkennzeichen: 02WH0479 bzw. 02WH0585
Mit marktüblicher Bohrtechnik sollen die linienförmigen Dränele-mente in den Modelldeich eingebracht werden (Durchführung:Morath GmbH, Albbruck)
Am Modelldeich im natürlichen Maßstab (Höhe: 3 m) wird die techni-sche Machbarkeit des Stabilisierungsverfahrens (Ansicht Landseite)nachgewiesen

Bis heute wird der Zustand von Deichen fast aus-schließlich visuell kontrolliert; wie es im Inneren desDeichs aussieht, bleibt den Inspektoren verborgen.Doch häufig sind Schäden erst im fortgeschrittenenStadium sichtbar. Für eine gezielte Unterstützungbruchgefährdeter Abschnitte ist es im Krisenfalldann oft zu spät. Eine automatisierte Überwachungim Inneren des Deichs könnte hier Abhilfe schaffen.Mit Förderung des BMBF hat das Sächsische Textil-forschungsinstitut (STFI) gemeinsam mit der Bundes-anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)sowie weiteren Partnern spezielle Geotextilien ent-wickelt, mit denen Deiche nicht nur befestigt, son-dern zugleich überwacht werden können. Aus denForschungsarbeiten sind mittlerweile das jungeSpin-off-Unternehmen fibrisTerre GmbH und dreivermarktungsfähige Patente hervorgegangen.
Mit der in Deutschland üblichen Inspektion der Oberflä-che können Schäden am Deich nicht immer schnell undzuverlässig genug erfasst werden. Gerade bei Hochwasserwäre hier eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung erforder-lich, die personell kaum zu bewältigen ist. Zwar existierenauf dem Markt bereits elektronische Messsysteme, dochdiese sind teuer und kommen deshalb nur selten zum Ein-satz. Im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungs-projekts „Entwicklung von multifunktionalen, sensor-basierten Geotextilien zur Deichertüchtigung, fürräumlich ausgedehntes Deich-Monitoring sowie fürdie Gefahrenerkennung im Hochwasserfall bei derDeichverteidigung“ entwickelten Wissenschaftler desSächsischen Textilforschungsinstituts in Chemnitz,zusammen mit der Bundesanstalt für Materialforschungund -prüfung in Berlin und weiteren Partnern einen neu-artigen Baustoff mit integrierter Sensortechnik.
Vielseitiger Baustoff: Geotextilien
Geotextilien sind speziell für den Außenbereich konstru-ierte, strapazierfähige Vliesstoffe, Gewebe oder Gewirkeaus natürlichen oder synthetischen Materialien. Sie wer-den in der Geo- und Bautechnik eingesetzt – in der Regel,um Erdbauwerke zu stabilisieren und die Bodenerosion zuverhindern, zum Beispiel im Straßen- und Gleisbau oderim Wasserwege- und Deichbau. Je nach Verwendungs-zweck sind Geotextilien entweder wasserdurchlässig,wenn damit etwa steile Hänge, Straßen- oder Eisenbahn-böschungen befestigt werden, oder wasserdicht wie beimEinsatz in Deponien.
Integriertes Warnsystem – Überwachung und Stabilisierungvon Deichen mit sensorbasierten Geotextilien
Automatisiertes Deich-Monitoring
Die Projektidee bestand darin, ein multifunktionales Geo-textil zu entwickeln, das über die Befestigung der Deich-böschungen hinaus auch dazu genutzt werden kann, dieStabilität des Deichs zu kontrollieren. Zu diesem Zweckwurden direkt im Herstellungsprozess sogenannte faser-optische Sensoren in Vliesstoffstrukturen eingearbeitet.Bei diesen Sensoren handelt es sich um gewöhnliche, preis-günstige Glasfasern aus der Telekommunikationstechnik.Über spezielle optische Messverfahren erfassen sie auchminimale Dehnungen der Textilstruktur sowie Tempera-turveränderungen. Deichverformungen während einesHochwassers können auf diese Weise registriert werden.Die festgestellten Veränderungen können dann an zentra-le Mess- und Überwachungsstationen weitergemeldetwerden. Von dort aus sind sie jederzeit abrufbar, sodass imSchadensfall frühzeitig Alarm ausgelöst werden kann.
Zur Gewinnung und Auswertung der Messwerte wurdeeine neue Messgerätebasis entwickelt. Die dazu notwen-digen Arbeiten übernahm vorrangig die BAM. Die im Rah-men des BMBF-Forschungsprojektes „Risikomanage-ment extremer Hochwasserereignisse“ (RIMAX) entwi-ckelte und patentierte neue Messtechnik auf Basis derBrillouin-Frequenzbereichsanalyse offenbarte so vielPotenzial, dass das EXIST-Forschungstransfer-Programmden Antrag von drei jungen Wissenschaftlern zur Neu-gründung einer eigenen Firma bewilligte. Seit ihrer Grün-dung im Januar 2010 ist die fibrisTerre GmbH das ersteSpin-off-Unternehmen der BAM.
RESSOURCE WASSER | 1.4.0676
Kontrollmessung an einer sensorbasierten Geotextilfläche beim Applikationsprozess im Feldversuch in Swienna Poremba (Polen)

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | SENSORBASIERTE GEOTEXTILIEN 77
Herstellung der Geotextilien
Wie müssen Textilien beschaffen sein, damit die optischenFasern ausreichend geschützt sind? Welche Materialieneignen sich am besten? Wie können die Glasfasern verar-beitet werden? Die Wissenschaftler des Sächsischen Tex-tilforschungsinstituts führten hierzu zahlreiche Versuchean einer sogenannten Vliesraschelmaschine durch. Dabeihandelt es sich um ein klassisches Herstellungsverfahrenfür Geotextilien, welches speziell für diesen Zweck modifi-ziert wurde. Zur Ermittlung des sensorischen und mecha-nischen Leistungsprofils der multifunktionalen Geotexti-lien, wurden neue Prüfmethoden entwickelt. Sowohl fürdas Herstellungsverfahren als auch für die Anwendungvon sensorintegrierten Geotextilien im Deich erhielt dasSTFI ein Patent.
Inzwischen wurde die Funktionsfähigkeit der Geotextilienin verschiedenen Feldtests nachgewiesen. VerschiedeneStudien an einem Versuchsdeich in Originalgröße aufdem Gelände des Franzius-Instituts für Wasserbau undKüsteningenieurwesen der Universität Hannover zeigten,was das neue Verfahren leisten kann. Es wurden verschie-dene Krisen- und Belastungssituationen simuliert und dieFunktionstüchtigkeit der sensorbasierten Geotextilienunter praxisrelevanten Belastungen nachgewiesen. Ander Vermarktung der sensorisch aktiven Geotextilienarbeiten momentan die Firmen BBG-Bauberatung Geo-kunststoffe GmbH und die Firma rg-research, gegründetvon Herrn Rainer Glötzl (http://rg-research.de).
Vorteile des Verfahrens
Das Deich-Monitoring mittels sensorbasierter Geotexti-lien ist eine vergleichsweise preisgünstige Alternative zuanderen Entwicklungsansätzen. Die Kosten pro Messstellewerden durch die Anwendung des optischen Verfahrenserheblich reduziert. Überdies lassen sich die Daten flä-chendeckend und nicht nur punktuell oder linear entlangeiner Kette von Sensoren erheben. Auf diese Weise wird esmöglich sein, auch sehr lange Deichstrecken mit gerin-gem Personalaufwand zu überwachen und eine exakteSchadenskartierung zu erstellen. Mit nur einem Monito-ringsystem können sowohl kurzfristige Veränderungenwie Risse und Ausspülungen als auch langfristige Verän-derungen wie das Setzungsverhalten von Deichen beob-achtet werden. Schließlich bringt das Verfahren auch öko-nomische Vorteile für den Deichbau, weil die Deichbefes-tigung und die Integration des Monitoringsystems ineinem Arbeitsschritt erfolgen können.
ProjektkoordinationSächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)Elke ThieleAnnaberger Straße 24009125 ChemnitzTel.: 03 71/52 74-0Fax: 03 71/52 74-1 53E-Mail: [email protected]: www.stfi.deFörderkennzeichen: 02WH570
Feldversuch im 1:1 Labordeich des Franzius-Instituts für Wasserbauund Küsteningenieurwesen in Hannover
Feldversuch in Solina (Polen)

Zahlreiche Städte und Gemeinden waren in den ver-gangenen Jahren von Hochwasser betroffen. Die Flu-ten gelangten in die Häuser und zerstörten häufigdas komplette Mobiliar. Um zu verhindern, dassüber die Ufer tretendes Wasser in Gebäude ein-dringt, müssen Fenster und Türen rechtzeitig abge-schottet werden. Zwar gibt es auf dem Marktbereits unterschiedliche Schutzsysteme, doch dieErfahrung hat gezeigt, dass sich insbesondere Alt-bauten damit nicht ausreichend abdichten lassen.Wissenschaftler des Sächsischen Textilforschungsin-stituts in Chemnitz entwickelten deshalb selbstdich-tende Wassersperren für Fenster und Türen, die fle-xibel und mit wenig Aufwand auch in alten Gebäu-den mit unebenen Wänden montiert und ebensoproblemlos wieder entfernt werden können.
Herkömmliche Hochwasserschutzsysteme für Fenster undTüren bestehen in der Regel aus Schutzplatten, die vordem Hochwasser mittels Dübel und Schrauben direkt amMauerwerk befestigt oder in bereits vorinstallierte Schie-nen eingesetzt werden. Entscheidend ist hierbei, dass derSpalt zwischen Platte und Mauer vollkommen dicht ist,damit das Wasser nicht durch kleine Öffnungen und Rit-zen nach innen drücken kann. Doch dies – so die Erfah-rung aus den Hochwasserereignissen der vergangenenJahre – lässt sich vor allem bei vielen Altbauten kaum ver-meiden, da aufgrund des unebenen Mauerwerks keineexakte und damit undurchlässige Dichtung angebrachtwerden kann. Selbst Gummi ist hierfür nicht elastischgenug, und Silikon lässt sich nach dem Abbau des Schott-systems nur sehr mühevoll von Putz, Fenstern und Türrah-men entfernen.
Mineralisches Dichtungsmaterial
Im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungspro-jekts „Selbstdichtende Wassersperren für Fenster undTüren“ suchten Wissenschaftler des Sächsischen Textilfor-schungsinstituts in Chemnitz deshalb nach effizientenund wirksamen Alternativen. Ihre Lösung: mineralischeDichtungsstoffe, die sich durch die Zugabe von Flüssigkeitformen und somit den Unebenheiten flexibel anpassenlassen. Lehm und Ton sind zum Beispiel mineralische Stof-fe, die im feuchten Zustand aufquellen und beliebig form-bar sind. In spezielle Textilschläuche gefüllt und vor demEinsatz angefeuchtet, passen sie sich dem Mauerwerkexakt an.
Gebäudesicherung für Jedermann – Selbstdichtende Wassersperren für Fenster und Türen
Die Untersuchungen ergaben, dass sich Bentonit als Dich-tungsstoff sehr gut eignet. Das Gestein ist eine Mischungaus verschiedenen Tonmineralien und besitzt eine starkeWasseraufnahme- und Quellfähigkeit. Das verwendeteTongranulat ist es sehr feinkörnig (Korngröße 0,1 bis 2 mm), lässt sich dadurch gut dosieren und neigt auchnicht dazu, den Trichter beim Befüllen der Textilschläuchezu verstopfen (Brückenbildung). Für die weiteren Versu-che wurde deshalb dieses Granulat verwendet.
Herstellung in einem Arbeitsgang
Die Textilschläuche sollen bei der Herstellung direkt mitdem Bentonit-Granulat befüllt werden, sodass das kom-plette Produkt in einem Arbeitsgang entsteht. Die Wissen-schaftler testeten gemeinsam mit Vertretern der Umwelt-und Maschinentechnik GmbH aus Pöhl hierfür geeigneteSpezialmaschinen, die in der Textilverarbeitung zum Ein-satz kommen. Dazu zählen beispielsweise eine Rundwirk-maschine, eine Rundstrickmaschine und eine sogenannteKemafil-Maschine. Letztere ermöglicht ein vom Sächsi-schen Textilforschungsinstitut entwickeltes und paten-tiertes Spezialverfahren, bei dem unterschiedlichste Mate-rialien mit einer dreidimensionalen Maschenstrukturummantelt werden können. Für das Dichtungssystemwurde ein Vliesstoff zu einem Schlauch geformt und mitMaschenfäden fixiert, während gleichzeitig die minerali-
RESSOURCE WASSER | 1.4.0778
Zentrale Spannspindel
Klemmspreizen
Schottblech
Spannstifte
Sicke für Dichelement
Schottsystem mit speziell entwickelten Klemmspreizen für höhere Stabilität.

ÖKOLOGIE | HOCHWASSER | GEBÄUDESICHERUNG FÜR JEDERMANN 79
schen Substanzen eingefüllt wurden. Die Versuche erga-ben, dass sich eine Rechts-Links-Kleinrundstrickmaschineam besten für die Herstellung der Dichtung für das Schott-system eignet.
Zusätzlicher Ausschwemmschutz
Fest steht, dass mit mineralischen Granulaten gefüllte Textilschläuche geeignet sind, kleine und größere Mauer-unebenheiten auszugleichen und exakt abzudichten. Siemüssen vor dem Einsetzen zwischen Mauer und Plattedurchfeuchtet werden. Ist eine größere Strömungsge-schwindigkeit vorhanden, sollte ein zusätzlicher Aus-schwemmschutz vor der Dichtung angebracht werden.Dafür eignet sich ein Schlauch aus weichem, textilemRecyclingmaterial. Er verhindert zwar nicht, dass Wassernach und nach bis zur Dichtung vordringt, setzt aber dieStrömungsgeschwindigkeit so herab, dass die minerali-schen Bestandteile nicht ausgewaschen werden.
Vorteile der selbstdichtenden Wassersperre
Die selbstdichtende Wassersperre ist ein Schnellbausys-tem, das sich ohne Vorinstallationen flexibel und mitgeringem Aufwand an allen Gebäudearten anbringenund ebenso problemlos wieder entfernen lässt. Zum Sys-tem gehören neben der mineralischen Dichtung und dem
Ausschwemmschutz auch metallische oder nichtmetalli-sche Frontplatten, die mithilfe einer Schnellspanneinrich-tung angebracht werden. Damit entfällt die Befestigungmittels Schrauben und Dübeln direkt am Mauerwerk.Dank exakt sitzender Dichtung erübrigt sich zudem dasmühevolle Nachdichten, wenn das Hochwasser bereitsgegen die Sperre drückt.
Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI) ander Technischen Universität ChemnitzAbt. Technische Textilien/Web- & MaschenwarenDipl.-Ing. Ulrich HerrmannAnnaberger Straße 24009125 ChemnitzTel.: 03 71/52 74-2 16Fax.: 03 71/52 74-1 53E-Mail: [email protected]:www.stfi.de/de/projekte/rimax_wassersperre.pdfFörderkennzeichen : 02WH0477
Modifizierte RL-KRSM mit Zuführ-, Dosier- und FülleinrichtungDichtschlauch aus einem Kleinrundgestrick mit integriertem BENTONIT-Granulat

Technologie
RESSOURCE WASSER | 2.080
Eine barrierefreie Version des Artikels finden Sie unter der Adresse http://ressourcewasser.fona.de/reports/bmbf/annual/2010/nb/German/40/2_-technologie.html

TECHNOLOGIE 81
Die sanitäre Grundversorgung der wachsenden Weltbevölkerung zu gewährleisten und für die Zukunft zu sichern, ist eine globale Herausforderung. Die Erforschung flexibler Konzepte sowie effizienter undfinanzierbarer Technologien ermöglicht es, den ständig steigenden Anforderungen an eine umwelt-gerechte Wasserver- und Abwasserentsorgung gerecht zu werden. Dezentrale und fachübergreifendeAnsätze spielen dabei eine zentrale Rolle.

Globale Nachhaltigkeit durch lokal maßgeschneiderteLösungen – Wiederverwendung und Ressourceneffizienz
RESSOURCE WASSER | 2.1.082

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL 83
Etwa eine Milliarde Menschen haben noch immerkeinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, etwa 2,5Milliarden Menschen leben auch heute noch ohnegeregelte Abwasserentsorgung. Im Jahr 2002 hat derUN-Gipfel in Johannesburg die enorme Bedeutungder Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-gung unterstrichen: Bis zum Jahr 2015 soll der Anteilder Menschen, die ohne sauberes Trinkwasser undohne sanitäre Grundversorgung leben müssen, hal-biert werden. Eine alleinige 1:1-Übertragung unsererMethoden in betroffene Gebiete kann dies nichtleisten, denn der demografische Wandel schreitetvoran. Angepasste und effiziente Technologien undKonzepte sind deshalb erforderlich.
Vor Jahrzehnten für einen deutlich höheren Wasserver-brauch konzipiert, sind konventionelle, zentrale Ver- wieEntsorgungssysteme auf einen hohen Wasserdurchflussin den Leitungen angewiesen. Der Wasserverbrauch derHaushalte in Deutschland sinkt jedoch seit Jahren; derdemografische Wandel in Deutschland dürfte diesenTrend dort in den nächsten Jahrzehnten noch verstärken.Um den Druck zu erzeugen, der nötig ist, um die Ablage-rung von Feststoffen in den Kanälen zu verhindern, mussin vielen Bereichen bereits heute zusätzliches Wasserzugeführt werden. Es sind deshalb künftig kleinere undsich an wandelnde Bedürfnisse anpassbare, sowie dezen-trale Konzepte vordringlich.
Auch in Wassermangelgebieten und in ökologisch sensi-blen Regionen bieten maßgeschneiderte, dezentrale Ver-fahren die Möglichkeit, die vor Ort vorhandenen Ressour-cen effizient zu nutzen. Dieser Ansatz erfordert allerdings,den gesamten lokalen Wasserkreislauf, von der Wasserge-winnung, -aufbereitung und -verteilung, Abwasserreini-gung bis zum Recycling, als Einheit zu begreifen. Durcheine übergreifende Betrachtung und Bewirtschaftung las-sen sich die Abwässer von Haushalten zu Brauchwasseraufbereiten, Feststoffe zu Dünger verarbeiten oder zu Bio-gas umwandeln und so energetisch nutzen. Wie sicherprobte Verfahren vor Ort zu Systemlösungen kombinie-ren lassen, haben mehrere vom Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekte unter-sucht.
Beispiel China. Als „semizentral“ wird eine Strukturbezeichnet, die über einzelne Bebauungseinheitenhinausgeht; sie unterscheidet sich damit von konventio-nellen zentralen Lösungen. Das Projekt „Semizentrale Ver-und Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas“ hat
grundlegend untersucht, welches Potenzial dieser Ansatzfür große und schnell wachsende Städte in China hat (Pro-jekt 2.1.01).
Beispiel Deutschland. Im Mittelpunkt des Projektes „Sani-tärrecycling Eschborn“ (SANIRESCH) steht die Frage, wiesich der Wasserverbrauch für Toiletten verringern unddas anfallende Gelbwasser umweltverträglich nutzenlässt (Projekt 2.1.02). Das Projekt „Entwicklung und Kombi-nation von innovativen Systemkomponenten aus Verfah-renstechnik, Informationstechnologie und Keramik zueiner nachhaltigen Schlüsseltechnologie für Wasser- undStoffkreisläufe – Projekt KOMPLETT“ (Laufzeit: 2005 bis2009) konnte zeigen, dass die Wiederverwertung aller imHaushalt anfallenden Abwasser sowie Feststoffe bei hoherNutzungsdichte z. B. in Hotelanlagen, wirtschaftlich ein-gesetzt werden kann (Projekt 2.1.03). Wie sich „Produkti-onsintegrierte Umweltschutzmaßnahmen im Hotel- undGaststättengewerbe unter besonderer Berücksichtigungvorhandener Bausubstanz“ umsetzen lassen, untersuchteein gleichnamiges Projekt (Projekt 2.1.04). Ob sich derknappe Rohstoff Phosphor aus Klärschlämmen effizientzurückgewin nen lässt, testet das vom BMBF geförderteProjekt „Phosphorrecycling – Ökologische und wirtschaft-liche Bewertung verschiedener Verfahren und Entwick-lung eines strategischen Verwertungskonzepts fürDeutsch land“ (PhoBe). Weiterhin ermitteln die Forscherdie Produktionskosten der eingesetzten Verfah ren. (Pro-jekt 2.1.05). Beim Anschluss von Neubaugebieten stelltsich für Kommunen die Frage der Erweiterung bereitsbestehender Kanalsysteme. In einem Neubaugebiet inKnittlingen bei Pforzheim wurde ein „Dezentrales Urba-nes Infrastruktursystem 21“ (DEUS 21) entworfen undumgesetzt (Projekt 2.1.08).
Beispiel Vietnam. Wie sich das Problem der Verschmut-zung durch Mineraldünger und menschliche Exkrementelösen lässt, untersucht das deutsch-vietnamesische Pro-jekt „Schließen von landwirtschaftlichen Nährstoffkreis-läufen über hygienisch unbedenkliche Substrate ausdezentralen Wasserwirtschaftssystemen im Mekong-Del-ta – SANSED“ (Projekt 2.1.06).
Beispiel Türkei. Eine umweltgerechte Abfall- und Abwas-serentsorgung oder Energieversorgung ist in vielen Tou-ristenanlagen eine Seltenheit. Eine Lösung könnten „Inte-grierte Module zur hocheffizienten Abwasserreinigung,Abfallbehandlung und regenerativen Energiegewinnungin Tourismus Resorts“ (kurz: MODULAARE) darstellen (Projekt 2.1.07).

Chinas Städte wachsen rasant: Auf der Suche nachArbeit ziehen viele Menschen in die Ballungszentren.Die Infrastruktur für die Ver- und Entsorgung istdarauf nicht ausgerichtet, erhebliche Umweltbelas-tungen sind die Folge. „Semizentrale“ Konzepte fürdie Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallbe-handlung in schnell wachsenden urbanen Räumensind eine Lösung: Sie lassen sich flexibel an denBevölkerungszuwachs in Städten anpassen.
Konventionelle zentrale und vor allem sektoral angelegteVer- und Entsorgungsstrategien stoßen in urbanen Räu-men mit Zuwachsraten von bis zu 1.000 Menschen täglichschnell an ihre Grenzen. Das zeigt sich auch in der Volksre-publik China: Die schnell wachsenden Städte sind mit derWasserversorgung und Abwasserbehandlung, der Abfall-behandlung und der räumlichen Planung überfordert,entsprechend groß sind die Umweltprobleme.
Hier setzte der Projektcluster „Semizentrale Ver- undEntsorgungssysteme für urbane Räume Chinas“ an(Laufzeit: 2004 bis 2010), geleitet vom Institut IWAR derTechnischen Universität Darmstadt. Die noch neue räum-liche Bezugsebene „Semizentral“ steht für eine Struktur,die über einzelne Bebauungseinheiten hinausgeht; sieunterscheidet sich damit von konventionellen zentralenLösungen. Das Ziel: Ver- und Entsorgungseinheiten flexibelan die dynamische Entwicklung von Großstädten anzu-passen, die in China durch ein schnelles Wachstum undsich schnell verändernde Strukturen gekennzeichnet sind.
Ein erstes Teilprojekt in den Jahren 2004/2005 galt denstrukturellen und rechtlichen Grundlagen; weitere Pro-jekte untersuchten technische Aspekte in Pilotanlagen inDeutschland und China, galten der Öffentlichkeitsarbeit(EXPO 2010 in Shanghai) sowie dem Kostenvergleich zwi-schen einer beispielhaften konventionellen und einerintegrierten semizentralen Ver- und Entsorgungseinheit.
Ziel der zweiten Projektphase (2005 bis 2008) war es, Ver-und Entsorgungssysteme zu entwickeln, die durch eineweitgehende Kreislaufführung von Wasser und Energieeinen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen verwirk-lichen. Dies lässt sich nur mit einer integrierten Planungder technischen Anlagen erreichen. Das Projektteam ent-wickelte ein modulares Baukastensystem für die Ver- undEntsorgung (Wasser, Abwasser, Abfall), das sich flexibel andie lokalen Bedingungen anpassen lässt und technischewie organisatorische Synergien nutzt. Gegenstand derabwasserseitigen Forschung waren Untersuchungen zur
Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme –Dynamische Lösungen für Chinas wachsende Großstädte
Grauwasseraufbereitung und innerstädtischen Wasser-wiederverwendung. Untersucht wurden verschiedeneVerfahren, beispielsweise hinsichtlich der erreichbarenAblaufqualitäten sowie des Flächen- und Energiebedarfs.
Integrierter Ansatz
Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme ermöglicheneine gleichbleibend hohe Qualität des Wasserzu- und -ablaufs, eine sichere Klärschlamm- und Abfallbehand-lung und erzeugen selbst ausreichend Energie, um dieSysteme autark betreiben zu können. Das Konzept inte-griert die verschiedenen technischen Infrastrukturele-mente für Wasser, Abwasser und Abfall sowohl unterei-nander als auch in der Raumplanung. Dabei sind spezifi-sche rechtliche, soziokulturelle, ökologische undökonomische Gegebenheiten sowie die administrativenund technischen Strukturen und Ressourcen vor Ort zuberücksichtigen. Um Synergien zu fördern, ist es wichtig,Schnittstellen zwischen der räumlichen und infrastruktu-rellen Planung einerseits und zwischen den einzelnentechnischen Modulen andererseits effizient zu nutzen,beispielsweise mittels der Energiegewinnung durch eineintegrierte Abfall- und Klärschlammbehandlung oder derinnerstädtischen Wasserwiederverwendung für die Toi-lettenspülung (integrierte Infrastrukturplanung).
RESSOURCE WASSER | 2.1.0184
Ausstellungsstand „Semizentral“ auf der EXPO 2010 in Shanghai

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | LÖSUNGEN FÜR CHINAS GROSSSTÄDTE 85
Praxiserprobte Technologien
Zentrale Ziele bei der Kombination verschiedener Modulezu einem technischen Gesamtsystem sind die Kreislauf-führung von Stoffströmen und die Weiterverwendungvon Nährstoffen und Energie aus Abwasser und Abfall. Fürdie Module werden praxiserprobte Technologien einge-setzt: aerobe und anaerobe Abwasserbehandlung , Ver-gärung sowie mechanisch-biologische Abfallbehand-lung , energetische und stoffliche Verwertung sowieWassergewinnung und -aufbereitung. Mithilfe von Ver-suchsanlagen im großtechnischen Maßstab wurden darü-ber hinaus neue technische Herausforderungen über-prüft wie die Membranreinigung mittels Ultraschall oderdie großtechnische Grauwasserbehandlung mittels unter-schiedlicher Behandlungsverfahren.
Der semizentrale Ansatz hat inzwischen weltweit großesInteresse gefunden; das zeigte auch der Auftritt auf derEXPO 2010 in Shanghai, wo er im Themenpavillon „UrbanPlanet“ als zukunftsweisende Infrastrukturlösung für dieStädte der Zukunft vorgestellt wurde.
Projekt-Website www.semizentral.de
Technische Universität DarmstadtInstitut IWARProf. Dr.-Ing. Peter CornelProf. Dr.-Ing. Martin WagnerDr.-Ing. Susanne BiekerPetersenstraße 1364287 DarmstadtTel.: 0 61 51/16 27 48Fax: 0 61 51/16 37 58E-Mail: [email protected]: www.iwar.bauing.tu-darmstadt.deFörderkennzeichen: 02WD0398, 02WD0607,
02WD0998

Der Kenntnisstand über neue Sanitärsysteme inDeutschland wächst. Doch bis zur Serienreife allerSystemkomponenten bedarf es noch weiterer Forschung und Entwicklung. Das Projekt „Sanitär-recycling Eschborn“ hilft hier mit: Im Mittelpunktsteht die Frage, wie sich der alternative Lösungs-ansatz umsetzen und sich das anfallende Abwasserumweltverträglich nutzen lassen. Demonstrations-objekt ist ein Bundesunternehmen, erste Projekt-ergebnisse liegen inzwischen vor.
Für die großflächige Umsetzung von neuartigen Sanitär-systemen (NASS) ist der aktuelle Wissensstand in Deutsch-land noch nicht ausreichend: Manche der eingesetztenTechnologien sind weiterzuentwickeln (z. B. Spültrenntoi-letten), die landwirtschaftliche Verwertung von gewon-nenen Produkten wie z. B. Urin und Struvit ist noch nichtzugelassen. Wie sich diese Situation ändern lassen könnte,untersucht das Forschungs- und Demonstrationsvorha-ben „Sanitärrecycling Eschborn“ (SANIRESCH) derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-beit (GIZ), wissenschaftlich begleitet durch die Projekt-partner RWTH Aachen, Universität Bonn, FH Gießen,Huber SE und Roediger Vacuum (Laufzeit: 2009 bis 2012).
Die GIZ hatte im Jahr 2006 bei der Modernisierung ihresHauptgebäudes in Eschborn bei Frankfurt ein Sanitärsys-tem zur getrennten Erfassung von Urin, Braun- und Grau-wasser eingebaut. Es umfasst Spültrenntoiletten, wasser-lose Urinale, separate Leitungen für Urin, Braun- und Grau-wasser sowie Urinspeichertanks. SANIRESCH kümmertsich um die Behandlung und Verwertung der Abwasser-ströme, Das Projekt will die Akzeptanz des neuen Sanitär-systems in der Belegschaft ebenso untersuchen wie dieEinsatzmöglichkeiten von Urin in der Landwirtschaft.Außerdem betrachtet es die Wirtschaftlichkeit und inter-nationale Übertragbarkeit.
Zahlreiche Projektbausteine
Das Projekt besteht aus verschiedenen Komponenten, diedie beteiligten Projektpartner allein oder gemeinsambearbeiten.
Sanitär- und Hausinstallationen: Im GIZ-Hauptgebäudesind für die Trennung des Abwassers 25 wasserlose Urinale(Firma Keramag) sowie 48 Trenntoiletten (Roediger Vacu-um) eingebaut – das Projekt untersucht letztere im Dauer-betrieb.
Abwasser als Wertstoff – Das erfolgversprechende Demonstrationsprojekt SANIRESCH
Anlagentechnik: Ein Fällungsreaktor behandelt dengesammelten Urin in einem chemisch-physikalischen Pro-zess; nach Zugabe von Magnesiumoxid entsteht Magnesi-um-Ammonium-Phosphat (MAP) in fester Form, ein wert-volles Düngemittel für die Landwirtschaft. Die Braunwas-serbehandlung erfolgt in einem Membranbioreaktor(MBR), nachdem zuvor Grobstoffe entfernt wurden. DerMBR hält mittels Ultrafiltration Feststoffe und Bakteriensowie nahezu alle Viren zuverlässig zurück. Das gewonne-ne Filtrat lässt sich hygienisch bedenkenlos für die Bewäs-serung nutzen. Auch Grauwasser (Küchenspül- und Hand-waschwasser) bereitet ein MBR auf, das erzeugte Betriebs-wasser bietet sich für die Toilettenspülung an.
Betrieb und Überwachung: Die Anlagen werden vor Ortbetreut und optimiert. Eine Fernwirktechnik dient dazu,die Anlagen zu steuern und zu überwachen sowie dieBasisparameter des Abwassers zu analysieren.
Qualität der Produkte/Urinlagerung: Bereits bei derLagerung von Urin kann es zum Abbau von Arzneimittel-wirkstoffen kommen; diesen Abbau gilt es zu quantifizie-ren. Außerdem werden in Labortests die Lagerungsbedin-gungen gezielt angepasst (z. B. durch Variation des pH-Werts ), um die Urinlagerung hinsichtlich der Schad-stoffentfrachtung verbessern zu können.
Landwirtschaftliche Produktion SANIRESCH führt Dün-geversuche mit gelagertem Urin und MAP im Freilanddurch. Erkenntnisse über die Folgen für nachwachsendeRohstoffe (Miscanthus) und Getreide stehen im Mittel-
RESSOURCE WASSER | 2.1.0286
Ausbringungsversuche mit Urin auf den Versuchsfeldern der Universi-tät Bonn: Düngung (März 2010)

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | DEMONSTRATIONSPROJEKT SANIRESCH 87
punkt des Interesses. Die rechtlichen Rahmenbedingun-gen für die Urinverwertung in Deutschland werdengeklärt und Empfehlungen für Behörden erarbeitet.
Akzeptanz: Studien sollen die Akzeptanz der Urindün-gung bei Nutzern und Reinigungskräften in der GIZ sowie bei Landwirten und Verbrauchern ermitteln.
Wirtschaftlichkeit: Ein Projektbaustein gilt der Ermitt-lung der Investitions-, Betriebs- und Re-Investitionskos-ten; auch der Amortisationszeitpunkt ist zu bestimmen.Flankierend will das Projekt den wirtschaftlichen Ver-gleich mit anderen technischen Lösungen vornehmen.
Internationale Übertragbarkeit: Ziel ist es, die für dasSanitärkonzept und die verwendeten Technologienbesonders geeigneten Regionen und Einsatzoptionenfestzustellen. Zusätzlich wird der Anpassungsbedarfermittelt, der erforderlich ist, um die Technologien auchin besonderen Fällen in Schwellen- und Entwicklungslän-dern erfolgreich einsetzen zu können.
Erste Projektergebnisse
Das Forschungsprojekt ist im Juli 2009 gestartet. Die fol-gend vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf das ersteProjektjahr.
Für die Mitarbeiter sind die Urinale und Toiletten die ein-zigen sichtbaren Komponenten des Systems, der Zustandder Sanitäranlagen ist ausschlaggebend für die Akzep-tanz. Es hat sich gezeigt, dass es erforderlich ist, die Roedi-ger Trenntoiletten zu modifizieren: Das Ventil, das für dieUrin-Abtrennung verantwortlich ist, wurde bereits ver-bessert, um den Einbau zu erleichtern und den Durchflusszu verbessern.
Die Urinlagerversuche haben gezeigt, dass der Urin phar-mazeutische Rückstände enthält, die auch am Ende derLagerzeit von sechs Monaten nicht vollständig eliminiert
waren. Die Schwermetallkon-zentrationen lagen in erstenMessungen unter den Grenz-werten der Trinkwasserver-ordnung (TrinkwV, 2001);somit ist davon auszugehen,dass eine Anwendung in derLandwirtschaft diesbezüglichunproblematisch wäre. Unter-suchungen des als MAP ausge-fällten Urins haben ergeben,dass keine pharmazeutischenWirkstoffe in das Fällprodukteingeschlossen waren. Nochzu analysieren ist, ob Wirk-stoffe an der Oberfläche derMAP-Kristalle haften undBestandteil einer organischenMatrix bilden.
Hinsichtlich der Düngewirkung zeigten die mit Gelbwas-ser gedüngten Weizen- und Ackerbohnen-Parzellen imlaufenden Feldversuch eine gute Wuchsleistung, die sichoptisch nicht von den Mineraldünger-Parzellen unter-scheiden. Obgleich detailliertere Ergebnisse noch ausste-hen, sind nur geringe Unterschiede zu Mineraldünger zuerwarten.
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden dieInvestitions- und Betriebskosten der im Gebäude einge-bauten Sanitärinstallationen (Toiletten, Urinale, Leitun-gen, Urintanks) im Vergleich zum konventionellen Systemanalysiert, das in den Flügeln desselben Gebäudes zeit-gleich installiert wurde. Die Kosten der Sanitärinstallationbetragen für die SANIRESCH-Variante 0,088 Euro je Nut-zung, bei der konventionellen Variante sind es 0,071 Euro.Diese Differenz erklärt sich durch die deutlich höherenInvestitionskosten.
Projekt-Website www.saniresch.de
Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbHNachhaltige Sanitärversorgung – ecosanDr.-Ing. Martina Winker (Projektfederführung)Postfach 518065726 EschbornTel.: 0 61 96/79 32 98Fax: 0 61 96/79 80 32 98E-Mail: [email protected]: www.giz.de/ecosanFörderkennzeichen: : 02WD0947 bis -52
Besichtigung des MAP-Reaktors durch Projektpartner MAP-Reaktor mit Innenan-sicht

Abwasser aus Haushalten getrennt aufzubereitenund nahezu vollständig wiederzuverwenden warZiel des Projekts „Komplett“. Gegenstand des Vorha-bens war auch die Entwicklung neuer WC-Sanitärke-ramiken, die leichter sind und somit Ressourcen inder Produktion sparen, den Wasserverbrauch sen-ken und antibakterielle Eigenschaften haben.
Noch immer haben rund 1,1 Milliarden Menschen keinenZugang zu sauberem Trinkwasser, etwa 2,5 MilliardenMenschen keinen zu sanitären Einrichtungen – ein erheb-licher Teil der Weltbevölkerung kann also humanitäreGrundbedürfnisse nicht oder nur sehr unzureichenderfüllen. Nach Prognosen der UNESCO werden bis Mittedes laufenden Jahrhunderts – je nach Szenario – zwischenzwei und sieben Milliarden Menschen weltweit unterWassermangel leiden. Davon sind insbesondere Regionenbetroffen, in denen neben der einheimischen Bevölke-rung auch Touristen zu versorgen sind (deren Wasserver-brauch mit etwa 400 Litern pro Kopf und Tag zudem sehrhoch ist). Die Bereitstellung von hygienisch einwandfrei-em Wasser ist auch für die Staaten Mittel- und Südeuropaseine der großen Zukunftsaufgaben. Die Wiederverwen-dung von aufbereitetem Abwasser aus den Haushaltenkann einen entscheidenden Beitrag leisten.
Ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) gefördertes Verbundvorhaben hat ein Konzept zurfast vollständigen Schließung von Wasserkreisläufen inder Praxis erprobt. Die Leitung für das Projekt unter demTitel „Entwicklung und Kombination von innovativenSystemkomponenten aus Verfahrenstechnik, Infor-mationstechnologie und Keramik zu einer nachhalti-gen Schlüsseltechnologie für Wasser- und Stoffkreis-läufe – Projekt Komplett“ (Laufzeit: 2005 bis 2009) hattedas Sanitärunternehmen Villeroy & Boch. Das Ziel war einSystem, bei dem das gesamte in Haushalten anfallendeAbwasser sowie alle Feststoffe wiederverwertet werden.
Das Projekt umfasste eine Vorversuchs-, Technikums- undPilotphase. In der ersten Phase wurden Versuche zur Cha-rakterisierung der beiden Abwasserfraktionen (Grau- undSchwarzwasser ) durchgeführt. Anschließende Laborver-suche dienten dazu, einzelne Anlagenkomponenten zubeurteilen und zu verbessern (insbesondere die biologi-sche Behandlung des Abwassers). Weiterhin wurden ersteVersuche zur Kompostierung der anfallenden Feststoffedurchgeführt sowie neue Sanitärprodukte entwickelt. ImRahmen des Vorhabens konnten neue Sanitärkeramikensowie leichtere Sanitärartikel entwickelt werden.
Haushaltsabwasser im Kreislauf – Das „KOMPLETT“-System
Versuchsanlage in Kaiserslautern
In der Technikumsphase wurde eine Versuchsanlage imhalbtechnischen Maßstab zur Aufbereitung der beidenTeilströme Grauwasser (aus Duschen, Handwaschbecken,Waschmaschinen) und Schwarzwasser (aus Toiletten)eines Wohnblocks in Kaiserslautern zehn Monate langbetrieben. Neben biologischen Behandlungsstufen wur-den Verfahrensstufen zur weitergehenden chemisch-phy-sikalischen Wasseraufbereitung sowie zur Desinfektionund Elimination von Spurenstoffen erprobt. Parallel fan-den Funktionstests der Sanitärprodukte, der Messtechnikim System und der Software zur Messwertdarstellungstatt. Ferner führte das Projektteam Versuche zur Vermi-kompostierung (die mit speziellen Würmern arbeitet)der anfallenden Reststoffe durch.
Pilotanlage in Oberhausen
In der abschließenden Untersuchungsphase erfolgte derBetrieb der Aufbereitungsanlagen im Pilotmaßstab aufdem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicher-heits- und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen – mitdem Abwasser eines Institutsgebäudes sowie des nahege-legenen Freizeit- und Einkaufszentrums „CentrO“. Hierwurden die Systeme der Sanitär- und Aufbereitungstech-
RESSOURCE WASSER | 2.1.0388
Vorstellung des Projektes KOMPLETT auf der Umweltmesse IFAT inMünchen im Jahr 2008. Die Vorstellung erfolgte unter der Schirm-herrschaft von German Water Partnership.

nik mit denen der Verwertung und Visualisierung gekop-pelt sowie der Schwarzwasserkreislauf vollständig (aufbe-reitetes Wasser für die Toiletten- und Urinalspülung) undder Grauwasserkreislauf weitgehend geschlossen (aufbe-reitetes Grauwasser für Duschen und Waschmaschinen).Somit ließ sich die Anreicherung von nicht abgebautenSubstanzen in beiden Kreisläufen untersuchen. ZurAbschätzung des Recyclingpotenzials untersuchten dieProjektpartner die Akzeptanz der Sanitärprodukte unddes Wasserrecyclings. Abschließend erfolgte eine Kosten-analyse des Komplett-Systems sowie ein Vergleich mit denKosten herkömmlicher Wasserver- und Entsorgungstech-nik. Es zeigte sich, dass das System in Bereichen fehlenderInfrastruktur zur Ver- und Entsorgung und hoher Nut-zungsdichte, z. B. in Hotelanlagen, wirtschaftlich einge-setzt werden kann. Die Projektziele wurden damit erreicht.
Eine Spülung mit nur 3,5 Litern
Die spüloptimierten Toiletten und Urinale mit photokata-lytischen Oberflächen wurden im Pilotobjekt in Ober-hausen getestet. Im Verlauf des Projekts wurde eine neue,um 20 Prozent leichtere Sanitärkeramik entwickelt, diesomit deutlich Ressourcen in der Produktion spart undaußerdem über eine antibakterielle Oberfläche verfügt.Mit dem neuen 3,5-Liter-WC lassen sich Fäkalien und Papier
TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | DAS „KOMPLETT“-SYSTEM 89
problemlos ausspülen, bei verminderter Spülwassermen-ge von zwei Litern. Gegenüber einem sechs-Liter-WC lassen sich so pro Jahr in einem Vier-Personen-Haushalt17.000 Liter Trinkwasser einsparen. Bei Einsatz in der Komplett-Anlage fällt jedoch ein höherer Feststoffanteilim Schwarzwasseranteil an, der den Aufwand für dieSchwarzwasserbehandlung zwar vermindert, jedoch beider Hausinstallation angepasste Rohrleitungen erfordert.
Projekt-Website www.komplett-projekt.de
Villeroy & Boch AGEnvironment/Safety/Research –Corporate CoordinationDanuta KrystkiewiczPostfach 11 2066688 MettlachTel.: 06 86/4 81 13 32Fax: 06 86/4 81 14 16E-Mail: [email protected]: www.villeroy-boch.com
EnviroChemie GmbHDr.-Ing. Markus EngelhartIn den Leppsteinswiesen 964380 RossdorfTel.: 0 61 54/69 98 57Fax: 0 61 54/69 98 11E-Mail: [email protected]: www.envirochemie.deFörderkennzeichen: 02 WD 0685
Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt KOMPLETT unter Berücksichtigung der entwickel-ten Ferndiagnostik und spezieller Keramiken.

Der Wasserverbrauch in Hotels und Pensionen ist jePerson deutlich höher als in Privathaushalten:Durchschnittlich verbraucht ein Gast in deutschenHotels rund 300 Liter Wasser täglich, das ist mehrals doppelt soviel wie in den eigenen vier Wänden.Sind auch noch Golfplätze und Schwimmbäder zuversorgen, kann der Verbrauch bis zu 1.000 Liter proÜbernachtungsgast und Tag betragen. Deutlichgeringer könnte der Frischwasserbezug sein, wenndas in den Betrieben anfallende Grauwasser vor Ortaufbereitet wird. Ein Projekt zeigt, dass die entspre-chenden Umbauten selbst im laufenden Betriebmöglich sind.
Wie sich „Produktionsintegrierte Umweltschutzmaß-nahmen im Hotel- und Gaststättengewerbe unterbesonderer Berücksichtigung vorhandener Bausub-stanz“ umsetzen lassen, untersuchte das gleichnamigeVerbundprojekt unter der Leitung des Instituts für Sied-lungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen (Laufzeit:Juni 2006 bis Mai 2009). Im Mittelpunkt stand der Nach-weis, dass sich auch mit marktüblichen Anlagen zurBetriebswasseraufbereitung der Verbrauch von Trinkwas-ser in Hotels deutlich reduzieren lässt und die Umbau-maßnahmen im laufenden Hotelbetrieb machbar sind.
Als Projektpartner gewann das ISA das 1981 gegründeteVier-Sterne „Hotel Am Kurpark“ in Bad Windsheim (Mit-telfranken); es verfügt über 50 Gästezimmer mit 90 Bet-ten, ein Restaurant mit rund 100 Plätzen sowie Tagungs-räume und eine Sauna. Das Gros der Räumlichkeitenbefindet sich im Haupthaus, 20 Gästezimmer und dieSeminarräume sind in einem separaten Gebäude unterge-bracht (1992 errichtet, 1998 erweitert). Der Wasserver-brauch des Hotels ist in den Jahren 2001 bis 2007 deutlichgestiegen (siehe Abbildung).
Aufbereitungsanlage für Grauwasser
Die Aufbereitungsanlage für das Grauwasser installiertedie Firma Hans Huber AG (Berching) im November 2008.Aufgrund der Bausubstanz erwies sich der Einbau derneuen Wasserleitungen als unerwartet schwierig, da siein die bestehenden Leitungsschächte zu integrierenwaren. Weil der Hotelbetrieb nicht unterbrochen werdensollte, wurden die Stemm- und Fliesenarbeiten auf dasNotwendigste beschränkt. Während die Anbindung desSeminargebäudes innerhalb der zehn Tage dauerndenBauphase erfolgte, wurden die Arbeiten im Keller desHaupthauses und im Verbindungsschacht zwischen
Wasserrecycling in Hotels – Umbauten im laufenden Betrieb
Haupt- und Seminargebäude außerhalb dieser Bauzeitdurchgeführt. Insgesamt waren Leitungen für Grau- undBetriebswasser mit einer Länge von 460 Metern zu legen.
Weitere Quellen eingebunden
Aufgrund des geringen spezifischen Grauwasseraufkom-mens der Gästezimmer (Dusche, Bad, Handwaschbecken)war es notwendig, weitere Grauwasserquellen aus Grün-den der Wirtschaftlichkeit an das Aufbereitungssystemanzuschließen. Darauf aufbauend teilte das ISA den Anla-genbetrieb zur Auswertung in drei Betriebsphasen ein.
Innerhalb der ersten Betriebsphase wurde ein Grauwas-seraufkommen von 35 bis 130 Litern je Gast und Tag ermit-telt, der Durchschnitt lag bei 52 Litern. Durch den Einbe-zug der Waschmaschine als Quelle ließ sich das mittleregastspezifische Grauwasseraufkommen in der zweiten
RESSOURCE WASSER | 2.1.0490
Entwicklung des Wasserverbrauchs 2001 bis 2007 im Hotel „Am Kurpark“
Schema der Aufbereitungsanlage für Grauwasser im Hotel „Am Kurpark“

Betriebsphase auf 72 Liter je Gast und Tag steigern. In derdritten Betriebsphase konnte durch den Anschluss derTheke und der Gläser-Geschirrspülmaschine das spezifi-sche Aufkommen schließlich auf durchschnittlich 82 Litererhöht werden. Die Berücksichtigung weiterer Grauwas-serquellen im Aufbereitungskonzept machte (bedingtdurch den Anschluss der Theke und der Gläser-Geschirr-spülmaschine) einen automatisierten Überschluss-schlammabzug erforderlich.
Die Folgen des Anschlusses weiterer Grauwasserteilströ-me spiegeln sich in erhöhten Ablaufkonzentrationen: Tra-ten innerhalb der Betriebsphase I im Weißwasser nur dreimikrobiologische Grenzwertüberschreitungen auf, führteder Anschluss weiterer Grauwasserquellen zu einerschlechteren mikrobiologischen Qualität des Weißwas-sers. Für einige mikrobiologische Parameter, bei denendie Ultrafiltrationsmembran (Ultrafiltration ) eine siche-re Barriere ist (insbesondere für den Parameter E. coli ),lassen sich die erhöhten Konzentrationen nur auf Wieder-verkeimungseffekte innerhalb der Permeatleitungzurückführen. Durch Anpassung der Rezirkulationsrate
TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | WASSERRECYCLING IN HOTELS 91
ließ sich die geforderte hygienische Qualität des Weißwas-sers auch am Ende der Untersuchungen der BetriebsphaseIII einhalten (eine zusammenfassende Darstellung derGrauwasser- und Betriebswasserbeschaffenheit aller dreiBetriebsphasen zeigt nebenstehende Abbildung).
Aus Grauwasser wird Betriebswasser
Das Abwasser aus den Duschen und Badewannen wird zuhochwertigem Betriebswasser aufbereitet, das hygienischunbedenklich ist und den Anforderungen der deutschenTrinkwasserverordnung entspricht. Das gewonneneBetriebswasser lässt sich für die WC-Spülung, die Vor-waschgänge der Geschirrspülmaschine sowie für Bewäs-serung und Reinigung nutzen.
Das Projekt hat gezeigt, dass sich Konzepte für das Wasser-recycling auch im laufenden Hotelbetrieb umsetzen las-sen. Die erforderlichen baulichen Mehraufwendungensind mitunter jedoch beträchtlich und erhöhen die Kos-ten. Wirtschaftlicher ist die Situation bei Neubauten oderim Zuge von allgemeinen Sanierungsmaßnahmen.
RWTH AachenInstitut für SiedlungswasserwirtschaftProf. Johannes PinnekampMies-van-der-Rohe Straße 1D-52074 AachenTel.: 02 41/8 02 52 07Fax: 02 41/8 02 22 85 E-Mail: [email protected]: www.isa.rwth-aachen.de
Vergleich der chemisch-physikalischen und der mikrobiologischenBeschaffenheit von Grau- und Betriebswasser für die drei Betriebspha-sen (Mittelwerte)

Phosphor ist für alle Lebewesen essentiell. Mithohem Energieaufwand wird aus abgebautemPhosphaterz mineralischer Phosphordünger herge-stellt. Doch die Erze sind endlich: Die bekannten,wirtschaftlich abbaubaren Reserven sind nach jetzi-gem Kenntnisstand in etwa 100 Jahren erschöpft.Deshalb arbeiten Wissenschaftler seit Jahren an Ver-fahren, mit denen sich Phosphor aus dem Abwasserbeziehungsweise Klärschlamm effizient zurückge-winnen lässt.
Eines dieser Forschungsvorhaben ist das vom Bundesmi-nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderteProjekt „Phosphorrecycling – Ökologische und wirt-schaftliche Bewertung verschiedener Verfahren undEntwicklung eines strategischen Verwertungskon-zepts für Deutschland“ (PhoBe); an ihm sind fünf Institu-te unterschiedlicher Fachrichtungen beteiligt, geleitetvom Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) derRWTH Aachen. Beim Projekt PhoBe (Laufzeit bis Ende 2011)handelt es sich um ein übergreifendes Vorhaben, das dieErgebnisse der geförderten Projekte der BMBF-Förderini-tiative „Kreis laufwirtschaft für Pflanzennährstoffe – ins-besondere Phosphor“ resümiert und übergreifend bew-ertet. Die Förderinitiative wurde im Jahr 2004 zusammenmit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicherheit (BMU) gestartet.
Da die Preise von mineralischem Roh-Phosphat als ent-scheidende Referenzgröße für die Bewertung der Wirt-schaftlichkeit von Recyclingverfahren dienen, erfolgtinnerhalb eines der acht Arbeitspakete eine mittel- bislangfristige (2030) Abschätzung der globalen Preisent-wicklung. Ferner werden die relevanten phosphatreichenStoffströme in Deutschland identifiziert und qualitativerfasst. Die bei den in der Förderinitiative entwickeltenRückgewinnungsverfahren gewonnenen Phosphatproduk-te werden auf Verunreinigungen analysiert und anhandihrer Düngewirkung im Vergleich zu herkömmlichenPhosphatdüngern (z. B. Tripelsuperphosphat) bewertet.
In einem weiteren Schritt werden die spezifischen Produk-tionskosten der entwickelten Verfahren anhand einerKostenabschätzung ermittelt und die Verfahren unterökologischen Aspekten bilanziert. Auf Grundlage der bis-herigen Ergebnisse wird ein Rückgewinnungskonzept fürDeutschland entwickelt, das aufzeigt, welcher Stoffstromsich sinnvoll für das Recycling eignet. Ein weiterer Arbeits-schwerpunkt ist die Technologievorausschau anhand einerExpertenbefragung sowie die Identifizierung von Zu -kunfts chancen für das Phosphorrecycling in Deutschland.
Phosphorrecycling – Abwasser- und Klärschlamm als Quellen eines wertvollen Stoffs
Preisentwicklung prognostiziert
Für die mittel- und langfristige Preisentwicklung vonPhosphat dient als methodische Vorgehensweise derAnsatz, die Ermittlung der Fundamentaldaten – somit dieEntwicklung von Angebot und Nachfrage – zunächstgetrennt zu analysieren und dann zur späteren Preisent-wicklung wieder zusammenzuführen. Dabei wurden zweiSzenarien untersucht, in denen von einem Anstieg desPhosphatverbrauchs ausgegangen wurde (ein bzw. zweiProzent p. a.). Der langsame Anstieg spiegelt die Entwick-lung in der näheren Vergangenheit (Business as Usual,BAU); der schnellere (Biofuels) käme beim vermehrtenAnbau von Pflanzen für die Biotreibstoffproduktion zumTragen.
Da Phosphorsäure als Ausgangssubstanz für die Produktionphosphathaltiger Düngemittel dient, wurde zusätzlich zuder Preisentwicklung des Rohphosphats auch die Preis-entwicklung der Phosphorsäure geschätzt: Im ersten Sze-nario steigt der Phosphorsäurepreis bis zum Jahr 2030 auf660 US-Dollar, im zweiten auf 760 US-Dollar je Tonne (sie-he Grafik Preisentwicklung von Phosphorsäure).
Die Analyse der in der Förderinitiative gewonnenenSekundärphosphate hat gezeigt, dass alle hergestelltenMagnesiumammoniumphosphate (MAP) die Grenzwerte(bzw. fast alle Produkte die Kennzeichnungspflicht) derDüngemittelverordnung aus dem Jahr 2008 unterschrei-ten. Die Düngewirksamkeit wurde mit Maispflanzen aufSand- und Lehmboden in Erst- und Zweitfrucht im Ver-
RESSOURCE WASSER | 2.1.0592
Preisentwicklung von Phosphorsäure

ÖKOLOGIE | WASSER UND RESSOURCEN | PHOSPHORRECYCLING AUS KLÄRSCHLAMM 93
gleich zu Tripelsuperphosphat und Rohphosphat sowieeiner Null-Kontrolle untersucht. Bisherige Ergebnissedeuten darauf hin, dass die gewonnenen Sekundärphos -phate keine signifikante Abweichung zum Tripelsuper-phosphat aufweisen und somit von ihrer Düngewirksam-keit vergleichbar sind mit herkömmlichen Düngemitteln.
Sekundärphosphat noch nicht konkurrenzfähig
Die Kostenabschätzung der in der Förderinitiative entwi-ckelten Verfahren ergab, dass die spezifischen Produkti-onskosten für ein Kilogramm Sekundärphosphat – abhän-gig vom technischen Aufwand und dem Rückgewinnungs-potenzial des Verfahrens – zwischen zwei und dreizehnEuro je Kilogramm Phosphor liegen und somit noch nichtkonkurrenzfähig zu den marktüblichen Phosphatdün-gern (rund 1,50 €/kg) sind. Doch schon heute kann sich das Phosphatrecycling lohnen: In den Fällen, in denen eseinen zusätzlichen Nutzen gibt – etwa vermiedene Rohr-verblockungen durch Ablagerung von ausgefallenemMAP oder eine Verbesserung der Entwässerung des Klär-schlamms.
Die für Deutschland erstellte Stoffstrombilanz gibt dietheoretisch für das Phosphorrecycling zur Verfügung ste-hende Phosphormenge aus dem Abwasser beziehungs-weise Klärschlamm mit rund 70.000 Tonnen im Jahr an.Besonders bedeutend ist hier der Klärschlamm, der gegen-wärtig zu etwa einem Viertel in Monoklärschlammver-brennungsanlagen entsorgt wird. Die Verbrennung zer-stört weitgehend Keime, geruchsverursachende Stoffeund organische Schadstoffe, der Phosphor bleibt jedochvollständig als Rückstand in der Asche. Untersuchungenzeigten, dass der Phosphoranteil in den Klärschlamma-
schen bei etwa sechs Prozent liegt und somit im Vergleichzu den übrigen Quellen (Kläranlagenablauf, Schlamm-wasser, Klärschlamm) die höchste Phosphorkonzentrationaufweist.
Potenzial von bis zu 45.000 Tonnen
Die Monoverbrennungskapazitäten betragen in Deutsch-land rund 520.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr und sindmomentan zu etwas mehr als 90 Prozent ausgelastet. Soll-ten alle Klärschlammaschen aus der Monoverbrennungeiner Phosphorrückgewinnung zugeführt werden, ließensich jährlich etwa 13.000 Tonnen Phosphor rückgewinnen.Durch den Einbezug von Klärschlämmen, die keinerMonoverbrennung oder landwirtschaftlichen Verwer-tung zugeführt werden, ließen sich in den großen Kläran-lagen (>100.000 Einwohner) weitere 5.000 Tonnen gewin-nen. Ausgehend davon, dass die landwirtschaftliche Klär-schlammverwertung in Zukunft weiter eingeschränktwird und somit die thermische Verwertung zunimmt,wurde ein Szenario berechnet, bei dem der gesamte Klär-schlamm in Monoverbrennungsanlagen verbrannt undeiner Rückgewinnung angedient wird: In diesem Fall lie-ßen sich etwa 45.000 Tonnen Phosphor jährlich zurückge-winnen, was einer Substitution der Phosphordüngemittelvon rund 60 Prozent entspräche.
Fachleute sind der Ansicht, das Phosphatrecycling könnebis 2030 in den Industrieländern umgesetzt und wirt-schaftlich tragfähig sein – dies ist das Ergebnis einerdurchgeführten Umfrage, die unter dem Titel „Dringlich-keit der Phosphorrückgewinnung, Erfolgspotenzial derPhosphorrückgewinnung aus Abwasserbehandlung undKlärschlamm, Potenziale der Rückgewinnung aus Klär-schlammasche und Phosphatrückgewinnung im Kontexteines Systemwandels in der Wasser- und Abfallwirtschaft“stand.
Projekt-Website www.phosphorrecycling.eu
RWTH AachenInstitut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA)Univ.-Prof. Dr.-Ing. Johannes PinnekampMies-van-der-Rohe Straße 152074 AachenTel.: 02 41/80-2 52 07Fax: 02 41/80-2 22 85E-Mail: [email protected]: www.isa.rwth-aachen.deFörderkennzeichen: 02WA0805 – 02WA0808
Magnesiumammoniumphosphate (MAP) und Klärschlammasche (kleines Bild)

Obwohl es in Vietnam ausgiebig regnet, mangelt esin vielen Regionen an sauberem Trinkwasser ebensowie an Nutzwasser für die Landwirtschaft. Eine dieser Regionen ist das Mekong-Delta: Ein deutsch-vietnamesisches Projekt entwickelt für die dortigenVerhältnisse Lösungen für die Wasserver- und -ent-sorgung. Dabei gilt es, nicht nur Trinkwasser für dieMenschen zu gewinnen, sondern aus der Abwasser-behandlung auch verwertbare Produkte für dieLandwirtschaft zu gewinnen, beispielsweise Kom-post und Biogas.
Mit rund 17 Millionen Menschen lebt rund ein Fünftel derVietnamesen im Mekong-Delta, das im Süden des Landesliegt – die meisten arbeiten in Landwirtschaft und Fisch-zucht. In den Städten hat etwa die Hälfte der EinwohnerZugang zu einer geregelten Wasserver- und Abwasserent-sorgung, auf dem Land sind es etwa nur zehn Prozent.Weil es nur wenige Kläranlagen gibt, gelangt ein großerTeil der Abwässer unbehandelt in die Flüsse, in ländlichenRegionen oft auch in Fischteiche.
Aufgrund des steigenden Wasserverbrauchs sinkt derGrundwasserspiegel im Mekong-Delta. In den küstenna-hen Regionen dringt häufig Meerwasser ins Grundwasserein, steigende Salzkonzentrationen sind die Folge. Dergrößte Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft: Rund90 Prozent des Wassers verwenden die Bauern für denReisanbau; trotz der ausgiebigen Niederschläge sind dieReisfelder zusätzlich intensiv zu bewässern.
Organischer Dünger aus Schmutzwasser
Um den Ertrag ihrer Reisfelder zu steigern, setzen die Bau-ern große Mengen teuren Mineraldüngers ein. Dabei gäbees günstigere und umweltverträglichere Möglichkeiten,den Böden Nährstoffe zuzuführen: menschliche Exkre-mente, die bisher das Wasser verschmutzen. Wie sich diesbewerkstelligen lässt, untersuchte das deutsch-vietname-sische Projekt „Schließen von landwirtschaftlichenNährstoffkreisläufen über hygienisch unbedenklicheSubstrate aus dezentralen Wasserwirtschaftssystemenim Mekong-Delta“ (SANSED). Beteiligt waren die Univer-sitäten Bonn und Bochum, die vietnamesische UniversitätCan Tho sowie mehrere deutsche Unternehmen.
Dezentrale Anlagen sollen möglichst kostengünstig Trink-wasser aufbereiten und zugleich Abwasser so behandeln,dass Landwirte vor Ort die Schlämme und den Kompost
Vietnam – Sauberes Wasser für das Mekong-Delta
nutzen können. Die rund 120.000 Tonnen Nitrat und19.000 Tonnen Phosphor, die im Mekong-Delta jährlichanfallen, könnten im Idealfall so wieder umweltverträg-lich in die Stoffkreisläufe gelangen.
Sieben Teilaspekte
Vor allem dezentrale Abwasserentsorgungs- und Wasser-versorgungssysteme sind sinnvoll, die an die Strukturenvor Ort angepasst sind und auch das geringe Einkommender Bevölkerung berücksichtigen. In der zweiten Phasewurden Demonstrationsanlagen errichtet und gemein-sam mit den vietnamesischen Partnern betrieben: SAN-SED will zeigen, dass sich die Kosten für den Bau undBetrieb der Anlagen durch den Verkauf der erzeugten Pro-dukte (Biogas, Dünger, Kompost) refinanzieren lassen.SANSED hatte sieben Teilprojekte.
Biogas: Landesübliche Biogas-Anlagen, in denen Bakte-rien Abfälle zersetzen, produzieren zu wenig Gas oder las-sen Überschüsse ungenutzt entweichen. In dem von SAN-SED verfolgten Ansatz zerlegen Pilze schwer abbaubarePolymere in Zucker, der die Bakterien zu stärkerer Aktivi-tät anregt und so die Gasausbeute erhöht. ÜberschüssigesGas kann in Strom umgewandelt oder in Flaschen abge-füllt werden.
Abwasserteilstrombehandlung: Als Modelle für dieAbwasserreinigung installierte das Projektteam in zweiStudentenwohnheimen Toiletten, die das Abwasser vonden Fäkalien trennen. Aus dem Urin und den Feststoffenließ sich Dünger für die Landwirtschaft oder Biogasgewinnen. Krankheitserreger und organische Schmutz-stoffe aus dem Gelbwasser wurden durch Trocknung ander Sonne beseitigt oder zumindest deutlich reduziert.Den Feststoffen zugefügte Regenwürmer wandelten dasSubstrat in Kompost um (Kaltrotte).
RESSOURCE WASSER | 2.1.0694
Biogasanlage in der Landwirtschaft

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | VORREITER VIETNAM 95
Abwassersiebung/Bodenfiltration: Aus den Abwässerneines der Studentenwohnheime filterten Feinsiebe Fest-stoffe heraus. Das Wasser wurde anschließend überBodenfilter weiter gereinigt, die Feststoffe kompostiert.
Trinkwasser aus Oberflächenwasser: Eine Anlage berei-tete mit organischen Stoffen und Mikroorganismen belas-tetes Oberflächenwasser – unter anderem mittels Lang-samsandfiltern und Sonnenlicht (UV-Desinfektion) – zurWasserversorgung eines Studentenwohnheims auf.
Trinkwasser aus Grundwasser: Für rund 100 Haushalteoptimierten die Wissenschaftler die Trinkwasserversor-gung: Schnellsandfilter bereiten das stark eisenhaltigeGrundwasser auf.
Weiterbildung: Zahlreiche Bezirke der Stadt Can Tho werden zentral mit Trinkwasser versorgt, das sich allen-falls als Brauchwasser bezeichnen lässt. Zudem existierteine Anlage, die Trinkwasser in Gebinde abfüllt. Für dieBeschäftigten der Can Tho Water Supply and SewerageCompany erarbeitete das Projektteam ein spezielles Infor-mations- und Trainingsprogramm.
Handlungsempfehlungen: Für einen Stadtteil von CanTho, der bislang keine geregelte Wasserver- und -entsor-gung hat, erstellte das Team zusammen mit dem örtlichenVersorgungsunternehmen eine exemplarische Machbar-keitsstudie: Sie zeigt, wo der Einsatz (de)zentraler Anlagensinnvoll ist.
Prüfung der Übertragbarkeit
Auf Grundlage des Projekts SANSED sollte auch für andereinfrastrukturschwache Regionen der Einsatz von dezen-tralen Abwasser- und Wasserversorgungssystemengeprüft werden.
Der SANSED-Abschlussbericht ist als Band 31 in der Reihe„Bonner Agrikulturchemische Reihe“ erschienen (kosten-pflichtige Bestellungen unter www.ipe.uni-bonn.de/publikationen).
Weitere Informationen sind auf der Projekt-Websiteabrufbar. Projekt-Website www.sansed.uni-bonn.de
Universität BonnINRES-PflanzerernährungDr. Ute ArnoldKarlrobert Kreiten Straße 1353115 BonnTel 02 28/73 36 39Fax 02 28/73 24 89Internet: www.ipe.uni-bonn.deFörderkennzeichen: 02WD0620
Natürliche Düngung in der Landwirtschaft
Anlage zur Trinkwasserversorgung

In vielen Tourismusgebieten in südlichen Ländern gibtes keine umweltgerechte Abfall- und Abwasserent-sorgung oder Energieversorgung. Das Forschungs-und Demonstrationsprojekt MODULAARE testete ineiner türkischen Hotelanlage eine zukunftsfähigeLösung für diese Probleme: Das entwickelte Verfah-ren verbindet die Vergärung organischer Abfälle mitder Membrantechnik zur Abwasserreinigung. Dabeientstehen Brauchwasser, Dünger und Biogas.
Ohne eine intakte Umwelt ist eine stabile wirtschaftlicheEntwicklung von Tourismusgebieten nicht möglich. Vorallem in stark frequentierten Regionen, schnell wachsen-den neuen Standorten sowie in ökologisch sensiblenGebieten gilt es, den Tourismus am Leitgedanken derNachhaltigkeit auszurichten – und die Energie- und Was-serversorgung sowie die Abfall- und Abwasserentsorgungumweltverträglich zu gestalten.
Stichproben in internationalen Ferienhotels haben einentäglichen Wasserverbrauch von bis zu 1.200 Litern je Gastermittelt (einschließlich des anteiligen Verbrauchs fürGrünanlagen und Schwimmbäder). Zum Vergleich: DieHaushalte in Deutschland verbrauchen heute mit durch-schnittlich 123 Litern pro Einwohner und Tag ein Zehnteldieser Menge. Abwässer fließen häufig schlecht gereinigtin Flüsse oder direkt ins Meer, weil Kläranlagen in denHotelanlagen fehlen oder schlecht gewartet sind; derAnschluss an die zentrale Abwasserentsorgung bezie-hungsweise Kläranlagen ist oft nicht möglich, da sich dieTourismusgebiete häufig außerhalb von Ortschaftenbefinden. Ebenso problematisch ist die Müllentsorgung:In großen Hotels entstehen bis zu 2,5 Kilogramm Abfall jeGast und Tag, der oft auf wilden Müllhalden entsorgt wird.
Integriertes Konzept für Tourismusregionen
Eine Antwort auf diese Probleme besonders in ökologischsensiblen Regionen sind „Integrierte Module zur hoch-effizienten Abwasserreinigung, Abfallbehandlungund regenerativen Energiegewinnung in TourismusResorts“ (MODULAARE) so der Titel des Projekts, indem esdie Membrantechnik in der Abwasserbehandlung unddie anaerobe Vergärung bei der Behandlung von Bioab-fällen verbindet, ermöglicht es ein gezieltes Stoffstrom-management für Abwasser und organische Abfälle. Soentsteht ein nahezu geschlossener Stoffkreislauf in einemfast abwasserfreien Hotel – in dem ferner hochwertigeNebenprodukte wie Brauchwasser, Dünger und Energieanfallen.
Sauber und effektiv –Dezentrale Entsorgungssysteme für Hotelanlagen
Um das Verfahren in der Praxis zu testen, errichtete dasinternationale Projektteam im Jahr 2005 eine Versuchsan-lage im „Hotel Sarigerme Park“, das an der türkischenÄgäisküste liegt. Die Projektleitung des 2008 abgeschlos-senen Projekts hatte der Verband zur Förderung ange-passter, sozial- und umweltverträglicher Technologiene.V. (AT-Verband, Stuttgart); die wissenschaftliche Leitunglag beim Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte-und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart, MEMOSMembranes Modules Systems (Pfullingen) realisierte dieMembrantechnik, die Bio-System Selecta GmbH (Kon-stanz) die Anaerobanlage. Die Verwaltung der Bodensee-Insel Mainau lieferte Basisdaten und unterstützte das Pro-jekt in der Öffentlichkeitsarbeit.
Membranen reinigen das Abwasser
Das angewandte Verfahren gewinnt Biomasse aus demAbwasser mittels Membranen – nicht wie üblich durcheine Nachklärung (Sedimentation). Membranen haltennicht nur Feststoffe vollständig, sondern auch Keime undViren in hohem Maße zurück. Der Membranbelebung vor-geschaltet ist eine mechanische Reinigung, die Grobstoffeentfernt. Die Membranfiltration erlaubt höhere Biomasse-konzentrationen (Experten sprechen von einer höherenRaum-Zeit-Ausbeute): Biomembranreaktoren arbeitenmit Biomassegehalten von 10 bis 15 Gramm je Liter. DieserWert liegt etwa dreimal so hoch wie in konventionellenBelebtschlammreaktoren (circa 4 g/l), weil die Biomasse-konzentration in der Belebung nicht mehr vom Sedimen-tationsverhalten im Nachklärbecken abhängt. Im MODU-LAARE-Verfahren wird Überschussschlamm zusammenmit Küchen- und Gartenabfällen im Vergärungsmodulweiterbehandelt.
RESSOURCE WASSER | 2.1.0796
Die Hotelanlage „Sarigerme Park“ in der Türkei

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | ENTSORGUNGSSYSTEME FÜR HOTELANLAGEN 97
Die Membrananlage bietet verschiedene verfahrenstech-nische Möglichkeiten, Nährstoffe zu eliminieren. Darüberhinaus lassen sich Kohlenstoff, Stickstoff und/oder Phos-phor teilweise wiederverwerten – je nachdem, wofür dasgereinigte Abwasser zu verwenden ist. Bei der Gartenbe-wässerung etwa dient Phosphor als Dünger, besonders inGebieten mit negativer Humusbilanz wie dem Mittel-meerraum kann das Verfahren gleichzeitig dem Boden-schutz dienen. An saisonal schwankende Gästezahlenlässt sich die Anlage aufgrund ihrer Modulbauweise leichtanpassen, sei es durch einen anderen Feststoffgehalt oderdurch zu- beziehungsweise abgeschaltete Membranmo-dule.
Biogas deckt den Energiebedarf
Hotelabfälle können zu mehr als 70 Prozent aus organi-schen Materialien bestehen. Bedingt durch die Eigen-schaften der Abfälle ließe sich nur etwa ein Drittel davonohne größeren verfahrenstechnischen Aufwand aerobbehandeln (Kompost). Denn aufgrund des hohen Wasser-gehalts und der Struktur des Materials können anaerobeBereiche in einer Menge entstehen, die zu erheblichenGeruchsbelästigungen führt; zudem kann Kompost inmediterranen und ariden Gebieten aufgrund der hohenLufttemperaturen leicht austrocknen. Die Vergärungkann hingegen bis zu 90 Prozent der organischen Abfällebehandeln, Gärrückstände lassen sich in der Landwirt-schaft nutzen.
Das MODULAARE-Projekt hat ein praxistaugliches Kon-zept erarbeitet, wie sich das Biogas optimal nutzen lässt:entweder für die Wärmeversorgung oder – in Stromumgewandelt – zur Deckung des hohen Energiebedarfs
der Membranbelebung. Eventuell anfallendes Abwasser(z. B. bei der Entwässerung) lässt sich wiederum der Mem-branbelebung direkt zuführen.
Projekt-Website www.modulaare.de
Verband zur Förderung angepasster, sozial- undumweltverträglicher Technologien e.V. (AT-Ver-band)Dr. Udo Theilen (Koordinator)Dieter Steinbach, Andrea Schultheis (MODULAAREGesamtkonzept)Waldburgstraße 9670563 StuttgartTel.: 07 11/7 35 52 79Fax: 07 11/7 35 52 80E-Mail: [email protected]: www.at-verband.deFörderkennzeichen: 02WD0440
Universität StuttgartInstitut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- undAbfallwirtschaftAbteilungen Abwassertechnik und SiedlungsabfallProf. Dr.-Ing. Martin Kranert (Wissenschaftliche Leitung)Bandtäle 270569 StuttgartTel.: 07 11/68 56 55 00Fax: 07 11/68 56 54 60E-Mail: [email protected]: www.iswa.uni-stuttgart.deFörderkennzeichen: 02WD0441
MODULAARE Membran-ModulEin MODULAARE Biogas-Modul

Beim Anschluss von Neubaugebieten an die Wasser-ver- und -entsorgung stehen Kommunen vor derWahl: Sollen sie das bereits bestehende Kanalsystemerweitern oder eine dezentrale Lösung umsetzen?In einem Modellprojekt in Knittlingen bei Pforzheimzeigt das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- undBioverfahrenstechnik, welche Vorteile ein semi-dezentrales Konzept bietet: Weil es Regenwassernutzt, senkt es den Frischwasserverbrauch. Außer-dem erzeugt es Dünger für Landwirte und ist ener-gieautark zu betreiben.
Industriestaaten setzen bei der Abwasserentsorgung inder Regel auf das Prinzip der Schwemmkanalisation:Regenwasser verdünnt das Abwasser, bevor es zur zentra-len Kläranlage gelangt. Dieses Verfahren ist kontrapro-duktiv, denn die Kläranlage muss die Inhaltsstoffe demWasser mit hohem Aufwand entziehen. Eine wirtschaft-lich und ökologisch sinnvolle Alternative können kreis-lauforientierte semi-dezentrale Systeme für die Wasser-ver- und Abwasserentsorgung sein – auch in Schwellen-und Entwicklungsländern.
In dem Projekt „Dezentrales Urbanes Infrastruktursys-tem 21“ (DEUS 21) hat das Fraunhofer-Institut für Grenz-flächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) ein solches Kon-zept für ein 2005 erschlossenes Neubaugebiet mit 100Grundstücken in Knittlingen bei Pforzheim umgesetzt.Projektbegleitend vergleicht das Fraunhofer Institut fürSystem- und Innovationsforschung (ISI) die ökologischenund ökonomischen Aspekte der Anlage mit herkömmli-chen Verfahren.
Aufbereitetes Regenwasser
Herzstück der Anlage ist das „Wasserhaus“ am Rande desDEUS 21-Wohngebiets. Es ist sowohl technisches Betriebs-gebäude als auch Informationszentrum für Anwohnerund Besucher. Das von den Dächern und Straßen abflie-ßende Regenwasser wird in unterirdischen Zisternengespeichert und im Wasserhaus aufbereitet. Ziel ist es, dasRegenwasser so aufzubereiten, dass es Trinkwasserquali-tät erreicht, um es in einem separaten Netz in die Wohn-häuser leiten zu können: für die Toilettenspülung undGartenbewässerung, Wasch- und Spülmaschinen sowiezum Waschen und Duschen. Zunächst wird das aufberei-tete Regenwasser noch über einen längeren Zeitraumuntersucht; in dieser Testphase erhalten die Anwohnerüber eine zweite Leitung Trinkwasser der Stadt Knittlingen.
Semi-dezentrales Konzept für ein Neubaugebiet –Das Wasserhaus Knittlingen
Ein Vakuumkanalsystem saugt das Abwasser der Haushal-te aus Übergabeschächten vor den Häusern ab, im Wasser-haus wird es in einem anaeroben Reinigungsreaktor mitintegrierter Membrantechnik aufbereitet. Den nötigenUnterdruck erzeugt die eingebaute, 2005 in Betriebgenommene zentrale Vakuumstation. Die Bauherren kön-nen auch eine Vakuumleitung in ihr Haus verlegen lassenund somit eine wassersparende Vakuumtoilette undeinen Shredder für Küchenabfälle installieren.
Abgetrennte Feststoffe
Vorversuche hatten gezeigt, dass die Abwasserreinigungbesser funktioniert, wenn die Feststoffe vorher abgetrenntwerden. Die abgesetzten Feststoffe werden deshalb sepa-rat bei 37 Grad Celsius nach dem am Fraunhofer IGB ent-wickelten Verfahren der Hochlastfaulung mit integrier-ter Mikrofiltration behandelt. Täglich entstehen aus derVergärung der Feststoffe bis zu 5.000 Liter Biogas. Diehydraulische Verweilzeit im Reaktor beträgt etwa zehnTage, die Verweilzeit der Feststoffe ist in gewissemUmfang frei einstellbar, liegt jedoch deutlich höher. Einunbeheizter, voll durchmischter Bioreaktor mit einemVolumen von zehn Kubikmetern behandelt den Überlaufdes Absetzbehälters (circa 99 Prozent des Zulaufs); derAblauf erfolgt über vier parallele Rotationsscheibenfilter(Porendurchmesser: 0,2 m).
Selbst bei niedrigen Temperaturen funktioniert die anero-be Kläranlage zuverlässig: Die Ablaufwerte lagen selbstbei Temperaturen im Reaktor bis 13° C unter 150 Milli-gramm des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB ) je Liter(Grenzwert für Kläranlagen für weniger als 1.000 Einwoh-
RESSOURCE WASSER | 2.1.0898
Das Wasserhaus in Knittlingen

TECHNOLOGIE | DEZENTRAL | WASSERHAUS KNITTLINGEN 99
ner). Die Zulaufkonzentrationen liegen zwischen 400 und1.100 Milligramm CSB je Liter, der durchschnittlicheAbbaugrad lag bei 85 Prozent. Im Reaktor zur Reinigungdes Überlaufs der Vorklärung betrug die maximale Bio-gasproduktion zusätzlich rund 3.000 Liter täglich. DerZuwachs der Biomasse ergibt etwa zehn Prozent der beimBelebtschlammverfahren zu erwartenden Menge vonÜberschussschlamm . Die Membranfiltration ist seitInbetriebnahme im März 2009 durch automatisches Rück-spülen mit Filtrat gereinigt worden, eine erste chemischeReinigung fand im April 2010 statt.
Nutzen für die Landwirtschaft
Der Wasserablauf der Anlage ließe sich für die Bewässe-rung und Düngung landwirtschaftlicher Flächen nutzen.Der Bioreaktor baut die Nährstoffe Ammonium und Phos-phat kaum ab, die sich in relativ hohen Konzentrationenim Abwasser befinden. Durch die Membranfiltration istdas Wasser keimarm, somit gefahrlos als Dünger geeig-net. Bei stichprobenartigen Untersuchungen wurden imAblauf der für die Membranfiltration eingesetzten Rotati-onsscheibenfilter keine Escherichia coli Bakterien nach-gewiesen, obwohl sie im Reaktorschlamm in Größenord-nungen von einer Million pro Milliliter vorkommen.
Ist der Einsatz als Dünger nicht möglich, sind Verfahrenzur Rückgewinnung des Ammoniums und Phosphats eineAlternative: Ein elektrochemischer Prozess fällt die Nähr-stoffe als Struvit aus (MAP, Magnesiumammoniumphos-phat). Überschüssiges Ammonium wird durch einenIonenaustauschprozess an Zeolith gebunden und durchLuftstrippung als Ammoniumsulfat zurückgewonnen.
Energieautarker Betrieb
Die rein anaerobe Verfahrenstechnik kann die organischenInhaltsstoffe des Abwassers zum größten Teil zu Biogasumsetzen: Täglich sind es 40 bis 60 Liter je Einwohner –eine herkömmliche Abwasserreinigung durch Schlamm-faulung erzielt hingegen lediglich 25 Liter. Der Energiege-halt des durch anaerobe Abwasserreinigung produziertenBiogases beträgt mehr als 100 Kilowattstunden je Einwoh-ner im Jahr. Große Kläranlagen verbrauchen jährlich etwa30 Kilowattstunden elektrische Energie pro Einwohner(zudem etwa 30 kWh thermisch): Im Vergleich dazu isteine mindestens energieautarke Abwasserreinigungunter anaeroben Bedingungen möglich.
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB)Prof. Dr. Walter TröschDipl.-Ing. Marius MohrNobelstraße 1270569 StuttgartTel.: 07 11/9 70-42 20Fax: 07 11/9 70-42 00E-Mail: [email protected]@igb.fraunhofer.deInternet: www.igb.fraunhofer.deFörderkennzeichen: 02WD0457
Eine Vakuumstation (links) und Bioreaktoren im Wasserhaus

Bewährte Methoden und Hightech-Analytik – Managementkonzepte für mehr Hygiene und Gesundheit
RESSOURCE WASSER | 2.2.0100

TECHNOLOGIE | HYGIENE UND GESUNDHEIT 101
Weltweit sterben rund zwei Millionen Menschendurch verunreinigtes oder fehlendes Trinkwasser.Wasser, insbesondere sauberes Wasser, ist ein kost-bares, in den meisten Regionen der Welt jedochknappes Gut. Um Wege zu finden, möglichst vielenMenschen im Alltag sauberes Wasser bereitzustel-len, werden dringend neue und effiziente Verfahrenund Managementkonzepte benötigt. Ziel ist es,einen hohen Wirkungsgrad während des gesamtenNutzungszyklus zu erreichen – von der Wasserge-winnung bis zur Abwasserreinigung.
Die Frage der Gesundheit der Weltbevölkerung ist unmit-telbar mit der Qualität und Quantität des nutzbaren Süß-wassers verbunden. Nach Angaben der Weltgesundheits-organisation WHO kommt der Vermeidung übertragba-rer Krankheitserreger (Bakterien, Viren und Parasiten)durch kontaminiertes Trinkwasser weltweit betrachtet die größte Bedeutung für die Gesundheit zu. Mangelhaftehygienische Verhältnisse, fehlende Sanitäreinrichtungenund schlechte Trinkwasserqualität sind vorwiegend inEntwicklungs- und Schwellenländern dafür verantwort-lich, dass alle drei Sekunden ein Kind unter fünf Jahrenstirbt.
Neben der massiven Verschmutzung verschärft sich invielen Entwicklungsländern die Situation zusätzlichdurch eine drastisch zunehmende Wasserknappheit. ImVergleich zu den Entwicklungs- und Schwellenländernbesteht in Deutschland und den anderen Industrienatio-nen vorwiegend eine Gefährdung durch eine Vielzahlneuer chemischer Stoffe aber auch Krankheitserreger, die sich besonders über die Gewässersysteme verbreiten.
Deutschlands größte Ultrafiltrationsanlage
Eine der weltweit größten Ultrafiltrationsmembrananla-gen hat 2005 in der Eifel ihren Betrieb aufgenommen.7.000 Kubikmeter Wasser pro Stunde fließen aus der Tal-sperre durch die Anlage und können anschließend alsTrinkwasser eingesetzt werden. Gelöste Stoffe, Partikelund Mikroorganismen werden von den extrem feinenMembranporen der Anlage zurückgehalten. Im Rahmendes „Verbundprojekts Hochleistungs-Membrantechnolo -gie“ förderte das BMBF umfangreiche Pilotversuche bevordie Anlage in Betrieb genommen wurde. Die in der Eifelerprobten Hochleistungsmembranen haben die Erwar-tungen voll erfüllt. Selbst bei extremen Belastungen, etwanach Starkregen, lag die Eliminationsleistung für Parasi-ten und Viren bei fast 100 Prozent. Die Kosten für Betriebs-
mittel und Kapitaldienst inklusive neuer Gebäude betra-gen weniger als zehn Cent pro Kubikmeter Trinkwasser(Projekt 2.2.01).
AQUASens – Schneller und mobiler Nachweisvon Wasserverunreinigungen
Verfahren zum Nachweis mikrobieller Belastung vonWasserproben sind auch heute noch sehr aufwändig –und dauern oft länger als eine Woche. In einem interdis-ziplinären BMBF – Verbundprojekt unter Beteiligung wis-senschaftlicher Institutionen und Unternehmen wurdeein halbautomatisches Analysegerät entwickelt, dassowohl kleine Moleküle wie Hormone, Antibiotika oderPestizide, ebenso viel größere Bakterien nachweisen kann:anhand eines immunologischen Tests in einer winzigenWasserprobe und innerhalb von Stunden. Die Verantwort-lichen bekommen so schnell verlässliche Informationenüber das Ausmaß und potentielle Gefahren von Wasser-verunreini gungen (Projekt 2.2.02).
Krankheitserreger in Wasserarmaturen
Selbst das qualitativ beste Trinkwasser kann noch auf denletzten Metern verunreinigt werden, bevor es aus derArmatur sprudelt: Dichtungen oder Schläuche vonschlechter Qualität sind ein Paradies für Bakterien. Übereinen Zeitraum von vier Jahren wurde im Rahmen desBMBF Verbundprojektes, „Biofilme in der Hausinstalla ti-on“ in 20.000 Messungen die hygienische Belastung vonWarmwassersystemen untersucht. Die Ergebnisse zeigen,dass in über 13 Prozent dieser Warmwassersysteme Legio-nellen vorkommen (Projekt 2.2.03).
Aktuelle Aspekte der Schwimmbeckenwasserhygiene
Die Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser erfordertden Einsatz von Chlor als Desinfektionsmittel (siehe auchDIN 19643). Die Reaktionen von Chlor mit Stoffen, die überdas Beckenwasser oder die Badegäste in die Schwimmbe-cken eingebracht werden, erzeugen jedoch unerwünsch-te Desinfektionsnebenprodukte (DNP). Diese DNP stehenim Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Ziel des Pro-jekts „Gesundheitsbezogene Optimierung der Aufberei-tung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ ist es, dieAuswirkungen der DNP insbesondere auf Menschen mitAtemwegs- und anderen chronischen Erkrankungen zuuntersuchen (Projekt 2.2.04).

Druckgetriebene Membranverfahren gewinnen bei der Wasseraufbereitung an Bedeutung. Nachmehrjährigen Pilotversuchen nahm im Jahr 2005 inder Nordeifel eine der weltweit größten Ultrafiltra-tionsmembrananlagen ihren Betrieb auf, die Talsper-renwasser zu Trinkwasser aufbereitet. Die in dieseAnlage gesetzten Erwartungen wurden in vollemUmfang erfüllt. Das Bundesministerium für Bildungund Forschung finanzierte die im Vorfeld durchge-führten Untersuchungen.
Die hygienischen Anforderungen an die Trinkwasserauf-bereitung aus Oberflächenwasser haben in den letztenJahren deutlich zugenommen. Um sie zu erfüllen, sindMembranverfahren eine Lösung mit einem sehr großenEntwicklungspotenzial: Sie können gelöste Stoffe zurück-halten und dienen zugleich als Barriere für Partikel undMikroorganismen. Die universellen Einsatzmöglichkeitenbei der Meerwasserentsalzung, Abwasserbehandlungsowie Prozess- und Trinkwasserproduktion begründen dasWachstumspotenzial der druckgetriebenen Membranver-fahren Mikro- , Ultra- und Nanofiltration sowieUmkehrosmose .
Die potenziellen Anwendungsfelder der Membranfiltrati-onsverfahren hängen von den aus dem Rohwasser zuentfernenden Störstoffen ab. So gehört die Umkehrosmo-se zur Entsalzung seit langem zum Stand der Technik beider Aufbereitung von Brack- und Meerwasser zu Trinkwas-ser. Für die Rohwasseraufbereitung im Binnenland wer-den vornehmlich die beiden Niederdruckmembranver-fahren Ultra- und Mikrofiltration sowie die Nanofiltrati-on eingesetzt. In jüngster Zeit ist die sehr weitgehendeEntfernung von Parasiten und Viren in den Mittelpunktdes Interesses gerückt. Um diese weitgehend partikulärenWasserinhaltsstoffe zu eliminieren, lässt sich sowohl dieMikro- als auch die Ultrafiltration nutzen (wobei dieMikrofiltration die Parasiten praktisch vollständig ent-fernt, die Ultrafiltration Viren aber eventuell nur unvoll-ständig beseitigt). Für die Entfernung anorganischer Was-serinhaltsstoffe müssen Verfahren mit dichteren Membra-nen wie die Nanofiltration oder die Umkehrosmoseeingesetzt werden.
Gute Kombinationsmöglichkeiten
Für den Erfolg der Membranverfahren mit verantwortlichsind ihre guten Kombinationsmöglichkeiten mit her-kömmlichen Verfahren und Techniken der Wasseraufbe-reitung (z. B. Flockung ). Von Vorteil sind auch die stark
Trinkwasserquelle Talsperren –Die Vorteile des Membranverfahrens
gesunkenen Membranpreise sowie der durch Nieder-druckmembranen und intelligente Energierückgewin-nung wesentlich gesunkene Energiebedarf.
Die Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaftNordeifel (WAG) betreibt in dem Ort Roetgen seit Ende2005 eine Membrananlage, die das aus Talsperren gewon-nene Wasser für die Trinkwasserversorgung aufbereitet.Die Anlage versorgt rund 500.000 Einwohner der RegionAachen mit Trinkwasser. Mit einer Kapazität von bis zu7.000 Kubikmetern pro Stunde ist die Anlage eine derweltweit leistungsfähigsten Ultrafiltrationsmembranan-lagen zur Trinkwasserproduktion aus Talsperrenwasser.Selbst bei extremen Belastungen des Talsperrenwassers(etwa nach starkem Regenfall) erreicht die Anlage eineEliminationsleistung für Parasiten und Viren von prak-tisch 100 Prozent.
Langjährige Vorversuche
Im Vorfeld der Inbetriebnahme hatten die WAG und dasIWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserfor-schung zusammen mit dem Lehrstuhl für Wassertechnikan der Universität Duisburg-Essen vier Jahre lang Untersu-chungen durchgeführt: in mehreren Versuchsanlagenmit Kapazitäten von rund zehn Kubikmetern stündlichsowie in einer Pilotanlage mit einer deutlich höheren Auf-bereitungsleistung (ca. 150 m3/h). Parallel erfolgten Pilot-
RESSOURCE WASSER | 2.2.01102
Aufbereitungsschema des Wasserwerks Roetgen und Integration derPilotanlagen

versuche mit einer getauchten Saugmembran zur Trink-wasserproduktion und zur Aufbereitung des Spülwassersder Membrananlage. Das BMBF förderte diese Versucheim Rahmen des Verbundprojekts „Hochleistungs-Mem-brantechnologie“. Auf Grundlage der Versuchsergebnis-se erfolgte durch die Wetzel + Partner Ingenieurgesell-schaft mbH (Moers) die Planung der großtechnischenAnlage in Roetgen, wissenschaftlich begleitet vom IWW.
Die Anlage in Roetgen kombiniert Flockung und direkteUltrafiltration. Durch diese Kombination verringern sichAblagerungen auf der Filtermembran und damit verbun-dene irreversible Leistungseinbußen. Die Flocken lagernsich auf der Membranoberfläche ab und stabilisieren denFiltrationsbetrieb. Mit einer optimierten Rückspülung derMembranen lassen sich die Störstoffe dann zusammen mitden Flocken von der Membranoberfläche entfernen. Eineweitere Besonderheit der Anlage ist, dass das schlammhal-tige Rückspülwasser aus der Membrananlage mit einerzweiten Membranstufe aufbereitet wird. Das dabei erzeug-te Permeat – das durch Filtration von Partikeln gereinigteWasser – wird dem Rohwasser der ersten Stufe wiederzugemischt. So erhöht sich die Ausbeute des Gesamtpro-zesses auf über 99 Prozent. Die zweite Stufe ist mit einerAufbereitungskapazität von 630 Kubikmetern in der Stun-de ebenfalls eine der weltweit größten Anlagen ihrer Art.
Erwartungen voll erfüllt
Das stabile Betriebsverhalten und die ausgezeichnete Qua-lität des produzierten Wassers erfüllen die Erwartungenin vollem Umfang. Die Kosten für den Betriebsmittelein-satz sowie den Kapitaldienst (inklusive der neuen Gebäude)betragen weniger als 0,10 Euro je Kubikmeter Trinkwasser.
ÖKOLOGIE | WASSER UND RESSOURCEN | TRINKWASSERQUELLE TALSPERREN 103
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGmbHProf. Dr.-Ing. Rolf GimbelMoritzstraße 2645476 Mülheim an der RuhrTel.: 02 08/4 03 03-3 00Fax: 02 08/4 03 03-83E-Mail: [email protected]: www.iww-online.deFörderkennzeichen: 02WT0658
WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesell-schaft Nordeifel mbHDipl.-Ing. W. DautzenbergFilterwerk52159 RoetgenTel.: 0 24 71/1 30-0Fax: 0 24 71/1 30-12 05E-Mail: [email protected]: www.enwor-vorort.deFörderkennzeichen: 02WT0660
Ultrafiltrationsblöcke zur Trinkwasseraufbereitung (1. Stufe) Ultrafiltrationsblock zur Spülwasseraufbereitung (2. Stufe)

Mikrobiologische Tests von Wasserproben sind bis-lang zeitraubend und aufwändig. Ein neues Analyse-system, dessen Entwicklung das Bundesministeriumfür Bildung und Forschung gefördert hat, könnteAbhilfe schaffen: Es ist schnell, mobil und genau –preiswert zudem. Denkbar sind vielfältige Einsatz-möglichkeiten in Kommunen und der Industrie.
Mit dem Aufspüren von Wasserverunreinigungen durchMikroorganismen sind bislang vornehmlich spezialisierteLabors beauftragt, als Methode dient die Vermehrung vonKeimen auf einem Nährboden. Während coliforme (fäka-le) Keime sich innerhalb eines Tages nachweisen lassen,da bewährte Verfahren existieren, sind Tests für die meis-ten anderen Bakterien auch heute noch sehr aufwändig -sie dauern schon mal länger als eine Woche. Ist das Was-ser möglicherweise mikrobiell belastet, müssen die Ver-antwortlichen jedoch schnell verlässliche Informationenüber das Ausmaß und potentielle Gefahren bekommen.
Kompetenzen gebündelt
Hier hat das Projekt „AquaSENS – Detektion von Mikroor-ganismen in Wasser mit CMOS-basierten Sensoren“ ange-setzt, das Bundesministerium für Bildung und Forschunghat es gefördert. Unternehmen und wissenschaftlicheInstitute bündelten ihre Kompetenzen, um ein mobil ein-setzbares Analysesystem zu entwickeln, das Mikroorganis-men und Keime im Wasser schnell nachweisen kann –ohne zeitraubende und teure Kultivierungen im Labor.Beteiligt waren die Siemens AG, inge watertechnologiesAG und Friz Biochem Gesellschaft für Bioanalytik mbHsowie das Institut für Wasserchemie und chemische Bal-neologie (IWC) der TU München, das IWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung und das Tech-nologiezentrum Wasser Karlsruhe (TZW). Die Aufgabendes Projekts:
Aufbau einer kompakten, vollautomatisierten Mem-branfiltrationsanlage zur Aufkonzentration der Keime(aus 10 Litern Wasser in einem Eluatvolumen von 50Milliliter).Entwicklung von zwei Probenvorbereitungsverfahrenauf Grundlage immunomagnetischer Separation undAffinitätschromatographie zur weiteren Aufkonzen-tration und Überführung der Keime in 1 MilliliterMesspuffer.Entwicklung digital auslesbarer Biochips mit inte-grierter Detektions- und Auswerteelektronik.
Analysesystem AquaSENS – Schneller und mobilerNachweis von Wasserverunreinigungen
Entwicklung und Herstellung des kompakten undbenutzerfreundlichen Auslesegeräts für die Biochips.Identifikation biochemischer Erkennungsmoleküle(Antikörper) und DNA-Abschnitte, die für die gesuch-ten Mikroorganismen spezifisch sind, sowie die Ent-wicklung von Nachweisverfahren (Assays) zur Über-tragung auf die Biochips.
Das Projekt AquaSENS konnte die gestellten Aufgabenerfolgreich erfüllen: Das entworfene, halbautomatischeGerät weist sowohl kleine Moleküle wie Hormone, Anti-biotika oder Pestizide, ebenso viel größere Bakterien nach:anhand eines immunologischen Tests in einer winzigenWasserprobe. In Anlehnung an das Immunsystem beruhtder Nachweis auf der Fähigkeit von Antikörpern, fremdeStoffe an charakteristischen Bestandteilen, den Antige-nen, zu erkennen.
Biochips entwickelt
Zum Einsatz kommt ein Biochip mit einer vollintegriertenHalbleiterschaltung (CMOS - Complementary Metal OxideSemiconductor). Der kleine biochemische Sensor und diemit ihm verbundene Ausleseelektronik eignen sich idealin transportablen, kompakten und preiswerten Analyse-systemen. Ihre Vorteile spielen sie insbesondere aus, wennviele unterschiedliche Keime in einem Messvorganggleichzeitig über Antikörper-Antigen-Bindungen oder dieDetektion spezifischer DNA-Abschnitte gewünscht sind.Für beide Nachweisprinzipien hat das Projekt Biochipsund biochemische Nachweisverfahren entwickelt.
RESSOURCE WASSER | 2.2.02104
Kleiner Biochip, große Leistung: Ein Sensor weist schnell Mikroorganis-men im Trinkwasser nach.

TECHNOLOGIE | HYGIENE UND GESUNDHEIT | NACHWEIS VON WASSERVERUNREINIGUNGEN 105
Weil gefährliche Keime - Legionellen, Salmonellen oderKolibakterien - im Wasser meist nur in geringen Konzen-trationen vorhanden sind, andererseits Biochips mitkleinsten Probenmengen um 100 Mikroliter arbeiten, isteine Voranreicherung der gesuchten Keime erforderlich.Das hierfür notwendige System erreichten die Projekt-partner, indem sie eine Membranfiltrationsanlage miteiner sogenannten immunomagnetischen Separations-säule koppelten.
Ergebnis: Der Nachweis von Kolibakterien war innerhalbvon nur 90 Minuten erbracht. Die Nachweisgrenze desBiochips für E.coli-Bakterien wurde mit 2.000 Keimen proMilliliter Probenkonzentrat bestimmt, wobei die Messzeit30 Minuten betrug. Das Analysesystem kann Bakterienalso binnen zwei Stunden nachweisen.
Vielfältiger Einsatz möglich
Neben dem Einsatz in der Qualitätssicherung der Trink-wasserversorgung könnte das Analysesystem auch beiProben von Prozess-, Reinst-, Grund- und Oberflächenwas-ser wichtige Dienste leisten; ob und wie das möglich ist,wird noch untersucht.
AQUASens könnte in öffentlichen Gebäuden und Kran-kenhäusern das Prozesswasser der Klimaanlage oder dasWarmwassersystem auf gefährliche Inhaltsstoffe untersu-chen. Auch für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie,die Reinstwasser für ihre Produktion benötigen, wäre dasneue Analysesystem eine wertvolle Hilfe.
Selbst der Einsatz bei Messungen von Klärschlämmenoder der Prozessüberwachung in biotechnologischen Fer-mentern ist denkbar. Hierzu wären zunächst die jeweilsrelevanten Mikroorganismen zu bestimmen, anschlie-ßend die entsprechenden Assays zu entwickeln. Entschei-dend ist hier, zunächst geeignete Antikörper zu identifi-zieren und herzustellen, denn sie sind heute noch nichtfür alle Anwendungsfälle verfügbar.
Siemens AGCorporate TechnologyDr. Daniel SickertOtto-Hahn-Ring 681739 München Tel.: 0 89/63 64 50 89Fax: 0 89/63 64 85 55E-Mail: [email protected]: www.siemens.comFörderkennzeichen: 02WU0862 – 0867
Der mobile Reader ermöglicht das Auslesen der Ergebnisse zu Wasser-verunreinigungen

Selbst das qualitativ beste Trinkwasser kann nochauf den letzten Metern verunreinigt werden, bevores aus der Armatur sprudelt: Dichtungen oderSchläuche von schlechter Qualität sind ein Paradiesfür Bakterien – für Menschen mit einem geschwäch-ten Immunsystem kann dies unter Umständen ernst-hafte Konsequenzen haben. Ein neues Forschungs-projekt untersucht nun, wie sich die hygienischeSicherheit von Trinkwasserinstallationen verbessernlässt.
Wie kommt das Trinkwasser zum Verbraucher? Es hateinen langen Weg hinter sich, aus dem Wasserwerk durchdie Leitungen ins Haus, streng überwacht und in besterQualität – bis zur Wasseruhr. „Dann aber beginnt eineGrauzone: die Hausinstallation. Hier kann eine unüber-sehbare und wenig kontrollierte Vielfalt von Materialieneingesetzt werden, von denen einige ein Paradies fürMikroorganismen bieten“, so Professor Hans-Curt Flem-ming von der Universität Duisburg-Essen. Trinkwasser istnämlich nicht steril und muss es auch nicht sein – es ent-hält immer noch Bakterien, die auch bei Nährstoffmangelüberleben und vollkommen ungefährlich sind. DasErfolgsrezept der Wasserwerke besteht darin, den Bakte-rien die Nährstoffgrundlage zu entziehen. Das ergibtsogenanntes stabiles Trinkwasser. „Wenn diese ausgehun-gerten Keime nun auf Materialien treffen, die ihnen Nähr-stoffe bieten, dann eröffnet sich dieses Paradies. Viel brau-chen sie nicht zum Gedeihen – kleine Mengen ausge-schwitzter Weichmacher, Farbstoffe, Antioxidantien undandere Zusätze zu Kunststoffen reichen völlig aus. Dortsetzen sie sich fest und bilden dicke Biofilme . Darin kön-nen sich auch Krankheitserreger einnisten, wachsen, aus-geschwemmt werden und das Wasser kontaminieren“,fährt Flemming fort.
Und dann verliert auch das beste Wasser seine Qualität,ausgerechnet auf den letzten Metern auf dem Weg zumWasserhahn. Unter welchen Umständen passiert das?Gibt es Epidemien? Wie gut ist die Überwachung? WelcheMaterialien sind zugelassen? Wie lassen sich Problemevermeiden?
Warmwassersysteme untersucht
Diese Fragen war Gegenstand der vom BMBF geförderten,groß angelegten Studie „Biofilme in der Hausinstalla-tion“ mit der Laufzeit von Oktober 2006 bis März 2010.Fünf Forschungseinrichtungen und 17 Industriepartnerhaben sich vier Jahre lang unter Koordination von Profes-
Krankheitserreger in Wasserarmaturen –Ein unterschätztes Problem
sor Hans-Curt Flemming (Universität Duisburg-Essen undIWW Mülheim) den Fragen gewidmet. Die Ergebnisse las-sen aufhorchen: „Die statistische Auswertung von mehrals 20.000 Messungen durch die Gesundheitsämter zeigte,dass in über 13 Prozent der Warmwassersysteme Legionel-len vorkommen“, so Professor Thomas Kistemann vomHygieneinstitut der Universität Bonn, einer der beteiligtenForscher. Ein besonders unangenehmer Krankheitserre-ger ist Pseudomonas aeruginosa, der Lungenentzündung,Harnwegsinfekte oder auch besonders hartnäckige Infek-tionen bei Brandwunden verursacht. Er wurde in drei Pro-zent der Untersuchungen nachgewiesen. Kistemann fährtfort: „Dabei ist seit Einführung der Überwachungspflichtvor vier Jahren erst die Hälfte der zu überwachendenöffentlichen Gebäude und Hotels untersucht worden. Dasliegt nicht daran, dass die Ämter inaktiv sind, sondern siesind einfach überfordert und unterbesetzt. Und wer ist inMehrfamilienhäusern zuständig für die Wasserqualität?Jeder, der diese Aufgabe wahrnimmt, macht sich erfah-rungsgemäß rasch unbeliebt.“
Duschschläuche sind ein Paradies – für Bakterien
In praxisnahen Modellsystemen konnten die Wissen-schaftler nachweisen, dass Duschschläuche oder auchrelativ kleine Dichtungen zum Bakterienparadies werden,wenn sie aus Werkstoffen bestehen, die das Keimwachs-tum unterstützen. Bei einigen von ihnen ließen sich Biofil-me nach ein bis zwei Wochen sogar mit dem bloßen Augeerkennen. Übliche Verdächtige für solche Fälle sind Kunst-stoffe, die keine Prüfung auf Zulassung im Trinkwasserhaben. Gerade preiswerte Armaturen enthalten oft biolo-
RESSOURCE WASSER | 2.2.03106
Nachweis des Krankheitserregers Pseudomonas aeruginosa mittelsKultivierung (linke Säulen, blau). vs. Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-rung (FISH) (rechte Säulen, violett)

TECHNOLOGIE | HYGIENE UND GESUNDHEIT | KRANKHEITSERREGER IN WASSERARMATUREN 107
gisch verwertbare Zusatzstoffe wie Weichmacher, Restevon Trennmitteln oder wurden bei der Herstellung undMontage mit Substanzen verunreinigt. Eine ungünstigeKombination aus schlechter Werkstoffqualität (beispiels-weise bei preiswerten Armaturen) und Wasserbeschaffen-heit fördert eine starke Biofilmentwicklung – und bietetdamit auch Lebensräume für Krankheitserreger. „Das heißtnicht, dass gleich Epidemien ausbrechen, aber es kann zuErkrankungen kommen, die zum Ausfall von Arbeitszeitund zu vorübergehendem Verlust an Lebensqualität füh-ren“, so Professor Kistemann. „Wenn das Immunsystemgeschwächt ist, beispielsweise nach einer Operation, kön-nen dann allerdings kritische Situationen entstehen“, soProfessor Martin Exner von der Universität Bonn.
Was tun? Zunächst einmal wurde im Rahmen des For-schungsprojekts gezeigt, dass die derzeitigen Überwa-chungsmethoden in Problemfällen ergänzungsbedürftigsind. Es hat sich erwiesen, dass sich gerade die gesuchtenKrankheitserreger in eine Art Dämmerzustand versetzenkönnen. Dann verschwinden sie vom Radar der Standard-methoden, aber sobald ihre Lebensbedingungen wiederbesser werden, wachen sie wieder auf und können genauso infektiös sein wie vorher. Anhand praktischer Problem-fälle konnte der Nutzen neuer molekularbiologischerMethoden demonstriert werden, um die Ursachen hartnä-ckiger Verkeimungen aufzuklären und zu beseitigen.
Mehr Aufmerksamkeit für die Hausinstallation
Ein Fazit des erfolgreichen Forschungsprojekts ist es, derHausinstallation vermehrte Aufmerksamkeit zu schen-ken, denn hier kann das beste Wasser seine Qualität ver-
lieren. „Wir haben wichtige Hinweise auf Möglichkeitenerarbeitet, dies zu verhindern“, zieht Hans-Curt FlemmingBilanz. Es zeigte sich aber auch, dass hier noch ein großerForschungs- und Regulierungsbedarf besteht – nicht nurbei den Materialien, sondern auch bei den Untersuchungs-verfahren. Die letzten Meter bis zum Wasserhahn sindentscheidend, und dennoch erstaunlich unterbelichtet.
Als Konsequenz der Erkenntnisse aus diesem Vorhabenhat das Projektkonsortium einen Forschungsantraggestellt, der sich eingehend mit den Problemen befasst.Speziell geht es um das vorübergehende Verschwindenpathogener Keime vom Überwachungsradar und um ihrplötzliches Wiederauftauchen; die Bedingungen, unterdenen dies geschieht und wie man die hygienische Sicher-heit der Trinkwasserinstallation sicherstellen kann. DerAntrag war erfolgreich und wird ab September 2010 bisAugust 2013 mit insgesamt mehr als zwei Millionen Eurogefördert.
Universität Duisburg-EssenCampus Essen – Biofilm CentreProf. Dr. Hans-Curt Flemming Universitätsstrasse 547141 Essen Tel.: 02 01/83-66 01 1Fax: 02 01/183-66 03 E-Mail: [email protected]: www.uni-due.de/biofilm-centre/Förderkennzeichen: 02WT1153-1157
Computergesteuerte, halbtechnische Hausinstallation für Langzeitversuche mit praxisnahen Verbrauchsprofilen

„Schwimmen ist gesund“, das ist ein Allgemeinsatzder Gesundheitsvorsorge. Doch trifft dies auchuneingeschränkt auf das Schwimmen in dem mitChlor desinfizierten Wasser von Schwimmbädernzu? Nach einer Desinfektion mit Chlor können sichim Wasser sogenannte Desinfektionsnebenproduktebilden – die Risiken für die menschliche Gesundheitbedeuten können. Noch sind viele Fragen wissen-schaftlich nicht ausreichend geklärt, etwa die Risi-ken für chronisch Kranke oder Kinder. Ein neues For-schungsprojekt sucht Antworten auf diese Fragen.
Die Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser erfordertden Einsatz von Chlor als Desinfektionsmittel (siehe auchDIN 19643). Die Reaktionen von Chlor mit Stoffen, die überdas Beckenwasser oder die Badegäste in die Schwimmbe-cken eingebracht werden, erzeugen jedoch unerwünsch-te Desinfektionsnebenprodukte (DNP). Diese DNP stehenim Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Die für diemenschliche Gesundheit schädlichen DNP sind zwar keinneues Problem, die Folgen für die Hygiene von Schwimm-und Badebeckenwasser stehen aber in jüngster Zeit imFokus des wissenschaftlichen Interesses.
Die Ergebnisse der bisher vorliegenden Studien bringenAtemwegs- und andere chronische Erkrankungen inZusammenhang mit dem Schwimmen in gechlortemBadebeckenwasser. Insbesondere unter dem Aspekt derbreiten Akzeptanz des Schwimmens bereits vom Kindes-alter an („Schwimmen ist gesund“) ist das Thema brisantfür die Gesundheitspolitik. Zumal in der Öffentlichkeit derEindruck entstehen kann, die Risiken des Schwimmens ingechlortem Badebeckenwasser seien größer als diegesundheitlichen Vorteile. Dies ist eine Aufgabe dergesundheitsbezogenen Umweltforschung: Sie muss ver-lässliche Daten bereit stellen, die eine wissenschaftlicheRisikobewertung im Sinne der Prävention ermöglichen.
Internationale Impulse gesetzt
Deutschland hat in der Schwimm- und Badebeckenwasser-hygiene international eine führende Rolle. Die Forschungs-arbeiten sind ein Beitrag zur nachhaltigen Gesundheits-vorsorge und sie beeinflussen die internationalen Stan-dards. Zu nennen sind die Projekte „Sicherheit vonSchwimm- und Badebeckenwasser aus gesundheit-licher und aufbereitungstechnischer Sicht“ (Förder-kennzeichen: 02WT0004) und „Integrierte Risikoab-schätzung für die neue Generation der Desinfektions-nebenprodukte“ (Förderkennzeichen: 02WU0649). Die
Schwimmbäder –Gesundheitliche Risiken der Beckendesinfektion
Studie mit Leistungsschwimmern (Projekt FKZ: 02WT0004)war weltweit die erste Populationsstudie, die das gesund-heitsbezogene Risiko des Schwimmens in Badebeckenabgeschätzt hat. Sie gab internationale Impulse für ähn-liche Studien.
Symposium veranstaltet
Im März 2009 fand in Dessau das Symposium „AktuelleAspekte der Schwimmbeckenwasserhygiene – Pool WaterChemistry and Health“ statt. Hier trafen sich weltweit füh-rende Wissenschaftler auf diesem Gebiet, führten eineBestandsaufnahme durch und benannten offene Fragen.Nach übereinstimmender Einschätzung der Wissen-schaftler hat die deutsche Forschung auf dem Gebiet derSchwimm- und Badewasserhygiene einen erheblichenVorteil: Schon frühzeitig wurden alle wesentlichen Aspek-te des Risikomanagements in ihren Wechselwirkungenuntersucht – ob es sich um die Aufbereitung von Badebe-ckenwasser oder die Gefährdungsabschätzung und Risi-kobewertung von Desinfektionsnebenprodukten handelt.
Die beiden genannten Forschungsprojekte haben gezeigt,dass gesundheitliche Gefährdungspotenziale des Schwim-mens in gechlortem Badebeckenwasser nachweisbar sind.Ziel des laufenden Projekts „Gesundheitsbezogene Opti-mierung der Aufbereitung von Schwimm- und Bade-beckenwasser“ ist es, noch offene Fragen mit hohergesundheitspolitischer Brisanz zu bearbeiten, vor allem
RESSOURCE WASSER | 2.2.04108
Vorort-Messung zur Bestimmung des Gefährdungspotenzials von DNPin der Hallenbadluft

TECHNOLOGIE | HYGIENE UND GESUNDHEIT | BECKENDESINFEKTION SCHWIMMBÄDER 109
Atemwegserkrankungen unter besonderer Berücksichti-gung von Kindern. Das vorrangige Ziel: In einem breitenKonsens von Wissenschaft, Behörden und Politik, Betrei-bern von Badeanstalten sowie der Öffentlichkeit die Para-meter zu definieren, die eine gesundheitliche Gefährdungausschließen.
Drei Fragen sind für das Projekt von besonderem Interesse:Sind die diskutierten Expositionspfade und die damitverbundenen chronischen Erkrankungen (inhala-tiv/Asthma, dermal/Blasenkrebs) relevante Gefähr-dungspotenziale?Wenn ja, welche Expositionsszenarien sind dafür ver-antwortlich (chemische Stoffe/Aufbereitung)?Welche Möglichkeiten (Aufbereitungstechniken/Maß-nahmenkatalog) sind verfügbar, um diese Gefähr-dungspotenziale zu verringern beziehungsweise aus-zuschließen?
Zentrales Element der wissenschaftlichen Arbeiten ist derAufbau eines Schwimmbadmodells, in dem sich die Unter-suchungen kontrolliert durchführen lassen. Die verschie-denen Aufbereitungsvarianten werden begleitet durchumfangreiche chemische und toxikologische Analysen.Hierzu werden die modernsten Verfahren eingesetzt(etwa Expositionsmodelle für inhalative und dermaleSchadstoffe ).
Mitteilung „Babyschwimmen und Desinfektionsnebenprodukte in Schwimmbädern“ erschienen
Auf Grundlage der Ergebnisse sind eine Risikobewertungvon Desinfektionsnebenprodukten sowie technische undrechtliche Maßnahmen geplant, die die DNP-Bildung ver-ringern sollen. Ein wesentliches Ziel ist es, die gesund-heitsbezogene Umweltforschung voranzutreiben. Es ist zuerwarten, dass die Forschungen auf dem Gebiet derSchwimm- und Badebeckenwasserhygiene in rechtlicheVorschriften münden. Erstes Ergebnis ist die Mitteilung„Babyschwimmen und Desinfektionsnebenprodukte inSchwimmbädern“ der Schwimm- und Badebeckenwasser-kommission (BWK) des Bundesministeriums für Gesund-heit, die im Bundesgesundheitsblatt 2011 (54: 142–144) ver-öffentlicht wurde. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird aufein mögliches Risiko hingewiesen. Das geschieht auchunter dem Aspekt, dass mit dem technischen Regelwerkzur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwassersowie zur Hallenbadbelüftung das Instrumentarium zurMinimierung der TCA-Konzentration in der Hallenluft zurVerfügung steht. Die aktuellen Entwicklungen zeigen,dass Badbetreiber und Badegäste infolge der UBA-Aktivi-täten ein deutliches Problembewusstsein zum Baby-schwimmen und Asthma ausgebildet haben. Auch wenndie wissenschaftliche Bewertung der toxikologischenDaten von der BWK und der Ad-hoc-Arbeitsgruppe„Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kom-mission“ nach wie vor kontrovers ist, steht nun dennochmit dem festgelegten technisch erreichbaren Richtwertvon 0,2 mg/m3 Trichloramin in der Hallenbadluft eingeeigneter Überwachungsparameter zur Minimierungdes Gesundheitsrisikos zur Verfügung.
Umweltbundesamt (UBA)Forschungsstelle Bad ElsterDr. Tamara GrummtHeinrich-Heine-Straße 1208645 Bad ElsterTel.: 03 74 37/7 63 54Fax: 03 74 37/7 62 19E-Mail: [email protected]: www.uba.deFörderkennzeichen: 02WT1092

KMU-innovativ –Vorfahrt für Spitzenforschung im Mittelstand
RESSOURCE WASSER | 2.3.0110
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind oftdiejenigen, die besonders effiziente Technologiennutzen und vorantreiben. Dadurch werden sie in vie-len Bereichen Vorreiter technologischen Fort-schritts. Die Ressourceneffizienz wird durch eigeneInnovationen oder durch frühes Aufgreifen beson-ders innovativer Methoden verbessert. Die BMBF-Förderinitiative „KMU-innovativ“ unterstützt kleineund mittlere Unternehmen bei der Entwicklunginnovativer Technologien und Dienstleistungen füreine verbesserte Ressourcen- und Energieeffizienz.
Innovationen für die Ressourcen- und Energieeffizienz
KMU-innovativ ist im Bereich der Ressourcen- und Ener-gieeffizienz themenoffen gestaltet. Es richtet sich bran-chenübergreifend an alle innovativen KMU. Das BMBFeröffnet kleinen und mittleren Unternehmen mit „KMU-innovativ“ seit 2007 neue Chancen durch einen erleichter-ten Zugang zur Forschungsförderung in wichtigenZukunftsbereichen, weil mit Spitzenforschung verbunde-ne Risiken häufig schwer zu kalkulieren sind. Dazu hat dasBMBF die Beratungsleistungen für KMU ausgebaut sowiedas Antrags- und Bewilligungsverfahren vereinfacht undbeschleunigt.
Technologiefeld: „Nachhaltiges Wassermanagement“
Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist es, dieVersorgung der Weltbevölkerung mit sauberem Wassersicherzustellen. Bevölkerungswachstum, Wasserver-schmutzung und ein steigender Pro-Kopf-Wasserver-brauch belasten die Wasserqualität. Darüber hinausbeeinflussen großräumige Klima- und Landnutzungsän-derungen die globalen und regionalen Wasserkreisläufeund stellen damit auch die mittel- und langfristige Was-serverfügbarkeit in Frage. Um hierfür Lösungen zu entwi-ckeln, unterstützt das BMBF Forschungs- und Entwick-lungsvorhaben in den folgenden Bereichen:innovative Verfahren zur Trinkwassergewinnung
Strategien und Technologien zur Wassereinsparung(auch Recyclingtechnologien)effiziente Bewässerungstechnologienenergieeffiziente Abwasserbehandlungsverfahrenund Energiegewinnung aus Abwasser
neuartige Konzepte und Technologien zur Kopplungvon Stoffströmen (z. B. Wasser/ Energie/Abfall) undggf. Rückgewinnung von (Nähr-)Stoffenressourcen- und energieeffiziente Anpassungsmaß-nahmen zur Steigerung der Exportfähigkeit im Was-sersektor
Im Folgenden werden beispielhaft drei Projekte aus derFörderinitiative vorgestellt.
1. Intelligenter Bodenfeuchtesensor zur effi-zienten Bewässerung
Durch Temperaturerhöhung mit niederschlagsärmerenSommern und feuchter werdenden Wintern wird die all-gemeine Wasserverfügbarkeit deutlich sinken. Der vieler-orts heute schon existierende Wassermangel bei derBewässerung wird dadurch verstärkt und die RessourceWasser wird generell an Konfliktpotenzial gewinnen.
Das Ziel des Projekts ist deshalb die Entwicklung einesintelligenten Bodenfeuchtesensors zur Effizienzsteige-rung von Bewässerungssystemen. Der Sensor wird miteinem Mikrokontroller ausgestattet, der ein selbstständi-ges Erfassen der bodenhydraulischen Eigenschaften (Was-serspannungskurve) ermöglicht. Dadurch wird der Sensorin der Lage sein, den optimalen Bewässerungszeitpunktund die optimale Bewässerungshöhe zu bestimmen.Durch intelligente Algorithmen werden zeitliche Verän-derungen der bodenhydraulischen Eigenschaften erfasstund die Bewässerungslogik entsprechend angepasst.Ansprechpartner: Parga Park- & Gartentechnik GmbH &Co. KG, Markus Blind, E-Mail: [email protected]
Effiziente Wasseraufbereitung ist ein zentrales Feld der Förderungdurch KMU-innovativ

TECHNOLOGIE | KMU-INNOVATIV 111
2. Entwicklung neuer Lösungen für wasser-und energieeffiziente Bewässerungstechnik
Zur Verbesserung der Bewässerungseffizienz der ägypti-schen Landwirtschaft wird in der Region von Kalabsha, inder Nähe des Assuan Staudammes, vom ägyptischenMinisterium für Landwirtschaft (MALR) mit substanziellerUnterstützung des World Food Programms (WFP) nachneuen Lösungen gesucht. Ein Problem am Nil ist der stei-gende Wasserverbrauch für die Landwirtschaft bei wach-sender Bevölkerung. Dazu kommen Umweltschäden, z.B.durch Versalzung von bewässerten landwirtschaftlichenNutzflächen, und der wachsende Energieverbrauch fürPumpen. Das PREFARM-Projekt, das ein Baustein für dieLösung dieser Probleme der Bewässerungseffizienz seinsoll, wird im Rahmen des KMU-innovativ Programms desBMBF gefördert. Die Unternehmen drip irrigation pro-ducts (dip GmbH), Alternativ Elektrobau Renger (AER) undEnergiebau Solarstromsysteme GmbH setzen gemeinsammit dem Institut für Technologie und Ressourcenmanage-ment in den Tropen und Subtropen (lTT) der FH Köln dievom ITT begonnene erfolgreiche Kooperation mit Ägyp-ten im Kalabsha- Projekt zur Einführung von innovativenTropfbewässerungssystemen fort.
Die Ziele des Projektes sind: Entwicklung innovativer Tropfbewässerungssysteme(dip GmH drip irrigation products, Ellefeld) Innovative optische Verfahren zur Erfassung der Was-serversorgung und Bioaktivität (AER Alternativ Elek-trobau Renger Elektromeisterfachbetrieb, Ellefeld) Erfassung der Messdaten für Klima, Wasserverbrauchund Bodeneigenschaften sowie Sicherstellung einerautarken Energie- und Wasserversorgung unter Nut-zung der Solarenergie (Energiebau SolarstromsystemeGmbH, Köln) Koordination der Feldarbeiten und sozioökonomi-schen Analyse von innovativen Wasser- und energieef-fizienten Bewässerungstechniken im Gesamtprojekt(FH Köln - Institut für Technologie und Ressourcen ma-nagement in den Tropen und Subtropen (lTT), Köln;Ansprechpartner: Prof. Dr. Sabine Schlüter. Institutefor Technology and Resources Management, In theTropics and Subtropics ITI, Cologne University ofApplied Sciences)
3. Innovative Probenahme- und Messtechnikfür den Schutz der Ressource Grundwasser
Die Rohwasserressourcen der öffentlichen Trinkwasser-versorgung stehen aufgrund des Klimawandels in einemzunehmenden Spannungsfeld. Der nationale und interna-tionale Wasserbedarf erfordert Verfahren zur kosten-güns tigen Planung, Durchführung und Kontrolle der Nut-zung von Rohwasserressourcen für die Trinkwassergewin-nung.
Die klimatisch bedingten Änderungen des Wasserdarge-bots werden in dem BMBF-Verbundprojekt „Prozessbasier-tes Management-Tool Wasser“ der TrinkwasserversorgungMagdeburg GmbH (TWM) und des Grundwasserfor-schungsinstituts GmbH Dresden (GFI) am Beispiel desWasserwerkes Colbitz in Sachsen-Anhalt untersucht.
Zur Überwachung der schutzwürdigen Ressource Grund-wasser wurde am Grundwasser-Zentrum Dresden innova-tive Probenahme- und Messtechnik entwickelt:
„Verfälschungsfreies Grundwasser-Probenahmesys -tem“ – Schutz des Aquifers vor dem zumeist che-misch veränderten Standwasser und tiefenorientierte,isobare Probenahme „Milieu-Fluid-Sampler“ – druckhaltende Tiefenwasser-probenahme bis zu 500 m und geophysikalische Mul-tiparametersonde
Ansprechpartner: GFI Grundwasserforschungsinstitut GmbH, Dr. Susann Berthold, E-Mail: [email protected]
Projektträger KarlsruheKarlsruher Institut für Technologie (KIT)Wassertechnologie und Entsorgung (PTKA-WTE)Dr. Verena Höckele Postfach 36 4076021 KarlsruheTel.: 07 21/60 82 49 32 E-Mail: [email protected] Internet: www.kmu-innovativ.de
www.ptka.kit.edu

Bewährte Technologien im Auslandseinsatz – Fortschritt durch weltweiten Wissenstransfer
RESSOURCE WASSER | 2.4.0112

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER 113
Die Umsetzung einer umweltgerechten, höchstentechnischen und hygienischen Anforderungen ent-sprechende Aufbereitung von Trinkwasser und Reini-gung von Abwasser ist vor allem in Entwicklungs-und Schwellenländer mit zusätzlichen Herausforde-rungen verbunden. Das beginnt mit der Frage, wel-che Verfahren und Techniken für die variablenBedingungen geeignet sind und erstreckt sich bisauf den zuverlässigen Betrieb und die Unterhaltungvon Anlagen.
Ein wesentliches Anliegen des Bundes ist es, Fachwissen inden Entwicklungs- und Schwellenländern aufzubauen.Hier gilt es, in Deutschland etablierte Verfahren der Was-seraufbereitung und Abwasserreinigung an die jeweili-gen standortbedingten Verhältnisse anzupassen. DasBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)hat in den vergangenen Jahren mehrere Projekte geför-dert, die gezeigt haben, wie sich in Deutschland bewährteVerfahren und Techniken fortentwickeln und an lokaleBedingungen anpassen lassen.
Beispiel Trinkwasserversorgung
Ein vom BMBF gefördertes Verbundprojekt hat Ergebnisseder Wasserforschung in Deutschland doku mentiert unddiese für andere Randbedingungen weiter entwickelt.Dazu wurden Eckwerte für die Größe und den Betrieb vonWasserbehandlungs- und -verteilungsanla gen unterBerücksichtigung extremer Rohwasserbeschaf fenheitensowie klimatisch und sozial abweichender Bedingungenermittelt. In Deutschland bewährte Aufbe reitungsverfah-ren wurden dahingehend bewertet, inwie weit sie auchunter veränderten Bedingungen anwendbar sind, bezie-hungsweise wann verbesserte Leistungen zu erwarten sind(Projekt 2.4.03). Das Projekt „Abwasserbehandlung bei derPapierherstellung mit Stroh als Rohstoff zur Zellstoffher-stellung am Beispiel der Shandong Provinz (VolksrepublikChina)“ untersucht in diesem Zusammenhang ein lang-fristiges Wasserressourcenmanagement. Ein Ziel des For-schungsprojektes ist es, behandeltes Abwasser als Brauch-wasser wieder in die Papierprodukti on zurückzuführen,um den Wasserverbrauch zu verrin gern (Projekt 2.4.06).
Beispiel Uferfiltration
Die Uferfiltration ist in Deutschland ein etabliertes Ver-fahren zur Trinkwasseraufbereitung: Wasserwerke nut-zen die natürliche Reinigungskraft des Bodens, um ohne
Einsatz von Energie und Chemikalien die Qualität des Roh-wassers zu verbessern. Die notwendigen Voraussetzungenuntersuchten Wissenschaftler im Projekt „Ermittlung derpotenziellen Reinigungsleistung der Uferfiltration/Unter-grundpassage hinsichtlich der Eliminierung organischerSchadstoffe unter standortspezifischen Randbedingun-gen“ (Projekt 2.4.01).
Beispiel Langsamfiltration
Die Langsamfiltration hat sich als Verfahren zur biologi-schen Trinkwasseraufbereitung etabliert. In der Regelbestehen die Anlagen aus einem Infiltrationsbecken, dasmit verschiedenen Filter- und Stützschichten befüllt ist.Gleichförmiger und gut gereinigter Filtersand ist jedochnicht überall verfügbar. Wie sich die Anpassung an lokaleGegebenheiten erreichen lässt, untersuchten mehrereInstitute im Verbundvorhaben „Langsamsandfiltration“.Exemplarisch wurde dabei u. a. die Reinigungsleistungvon Recycling-Glasgranulat und Kokosfasern analysiert(Projekt 2.4.02).
Beispiel Abwassertechnologien
In der Wassertechnologie hält Deutschland weltweit eineSpitzenstellung. Dennoch bestehen in einzelnen Punktennach wie vor Wissenslücken. Ziel des Verbundprojekts„Exportorientierte Forschung und Entwicklung auf demGebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil II – Abwasser-technologien in anderen Ländern“ war es deshalb, inDeutschland bewährte Technologien der kommunalenAbwasserreinigung an andere Klimazonen anzupassen.Dazu wurden im Rahmen des Projekts Erhebungen zurSituation der kommunalen Abwasserbehandlung in zwölfStaaten durchgeführt (Projekt 2.4.04).
Beispiel Datenbasis für Wassermanagementsysteme
Verlässliche Informationen sind eine Grundvorausset-zung für ein erfolgreiches Wassermanagement. Für dieWasserbehörde der Megalopolis Peking gilt es angesichtsdes jahreszeitlich extrem schwankenden Wasserangebotsbeispielsweise, Angebot und Verbrauch genau abschät-zen zu können. Ein mit deutscher Hilfe entwickeltes Com-puterprogramm macht genau das jetzt möglich – trotzeiner sehr schwierigen Datenbasis. Die Ergebnisse des Pro-jekts sind auch für andere Megastädte Asiens von Bedeu-tung und können dort Anwendung finden (Projekt 2.4.05).

Die Uferfiltration ist in Deutschland ein etabliertes,kostengünstiges Verfahren zur Trinkwasseraufberei-tung: Wasserwerke nutzen die natürliche Reini-gungskraft des Bodens, um ohne Einsatz von Energieund Chemikalien die Qualität des Rohwassers zu ver-bessern. Mit dem Ziel, Planungs- und Betriebsleitfä-den für den weltweiten Einsatz dieses Verfahrens zuerstellen, untersuchte ein Forschungsprojekt dieFähigkeit der Uferfiltration, unter wechselndenStandortbedingungen organische Schadstoffe zubeseitigen oder zumindest zu reduzieren.
Bedingt durch die Abwassereinleitungen aus Industrie,Haushalten und Landwirtschaft weisen Oberflächenge-wässer in industrialisierten und urbanen Gebieten oft viele organische Spurenstoffe beziehungsweise derenAbbauprodukte auf: Pflanzenschutzmittel, Mineralöleund Chemikalien mit hormoneller Wirkung oder phar-mazeutische Wirkstoffe sind im Wasser nachweisbar. Diese Stoffe sind wirksam zu beseitigen, wenn das Ober-flächenwasser eine Trinkwasserquelle ist.
Bei der Uferfiltration werden in unmittelbarer Nähe desfür die Trinkwasserversorgung benötigten Flusses Brun-nen errichtet, der Grundwasserspiegel wird künstlichgesenkt. Dadurch entsteht ein hydraulisches Gefälle zwi-schen Flussbett und Brunnen, das Oberflächenwassersickert über die Sohle oder das Ufer in den Untergrund:Schmutz- und Schadstoffe werden durch natürliche physi-kalische, chemische und biologische Prozesse herausgefil-tert und abgebaut. Abhängig von den geologischen Ver-hältnissen, dem Abstand zwischen Brunnen und Ufersowie dem Pegelstand des Flusses kann dies nur wenigeTage oder auch ein halbes Jahr dauern.
Wechselnde Standortbedingungen
Doch inwieweit ist diese Uferfiltration geeignet, organi-sche Verbindungen zu beseitigen, wenn diese höchstunterschiedliche chemisch physikalische Eigenschaftenhaben? Diese Frage untersuchten Wissenschaftler im Pro-jekt „Ermittlung der potenziellen Reinigungsleistungder Uferfiltration/Untergrundpassage hinsichtlich derEliminierung organischer Schadstoffe unter standort-spezifischen Randbedingungen“ (Laufzeit: 2001 bis2005). Ferner wollten sie herausfinden, welche Vorausset-zungen ein Standort erfüllen muss, damit die Uferfiltrati-on erfolgreich ist. Denn neben dem Schadstoffspektrumund der jeweiligen Konzentration im Wasser spielen diehydrogeologischen Bedingungen eine große Rolle – vor
Natürlicher Wasserfilter – Die Uferfiltration
allem die Zusammensetzung, Durchlässigkeit und Sorpti-onsfähigkeit des Bodens, ferner klimatische Faktorenwie die Wassertemperatur. Weitere Aspekte der Uferfiltra-tion untersuchten das Institut für Wasserforschung, Dort-mund (Gesamtkoordination der Vorhaben „Uferfiltrati-on“), das Forschungszentrum Karlsruhe sowie die TU Ber-lin, TU Dresden und TU Hamburg-Harburg (Leitfaden:Kühn, W.; Müller, U. (Editor) (2006): Exportorientierte F&Eauf dem Gebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil I:Trinkwasser. Band 2. Leitfaden. Technologiezentrum Was-ser, Karlsruhe, ISBN 3-00-015478-7).
Um Planungs- und Betriebsleitfäden für den Einsatz derUferfiltration in anderen Klimazonen zu erstellen, trugendie Projektpartner vorliegende Forschungsergebnisseund Erfahrungswerte aus Deutschland und anderen Län-dern zusammen und werteten sie aus. Informationslü-cken – zum Beispiel in Bezug auf extremere klimatischeVerhältnisse – füllten sie mit den Ergebnissen praxisnaherFeld- und Laboruntersuchungen.
Deutlich verbesserte Wasserqualität
Die im Projekt durchgeführten Untersuchungen ergaben,dass die Uferfiltration die meisten (rund 80 Prozent) derim Oberflächenwasser festgestellten organischen Spuren-stoffe beseitigen kann; bei den übrigen Stoffen ließ sich inder Regel zumindest eine Konzentrationsminderungbeobachten. Dennoch ist das Verhalten neuartiger Sub-stanzen bei der Uferfiltration nicht hundertprozentig vor-hersehbar, da chemisch ähnliche Stoffe zuweilen sehr
RESSOURCE WASSER | 2.4.01114
Funktionsweise einer Uferfiltratanlage

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | DIE UFERFILTRATION 115
unterschiedlich reagieren. Das Projekt bestätigte, dass dieBeseitigung organischer Verbindungen auf Sorptionspro-zesse sowie biologische und chemische Abbauvorgängeim Untergrund zurückzuführen ist. Dabei erfolgt dergrößte Teil der Schadstoffreduktion bereits in der soge-nannten Infiltrationszone, unmittelbar nach dem Eintrittdes Wassers in den Boden. Daraus lässt sich schließen, dassdie Entfernung der Brunnen vom Gewässer (20 bis 400Meter) für die Reinigungsleistung nicht maßgebend ist.Trotzdem ist die weitere Fließstrecke beziehungsweise dieAufenthaltszeit des Wassers im Untergrund wichtig, wennes gilt, die Leistung optimal auszuschöpfen. So beobachte-te das Projektteam für viele Substanzen bei längerer Auf-enthaltszeit im Untergrund eine deutlich höhere Elimina-tion.
Sauerstoffversorgung entscheidend
Welche Spurenstoffe in welchem Umfang abgebaut wer-den, hängt entscheidend von dem im Boden herrschen-den Redoxmilieu ab, oder anders gesagt, von der Sauer-stoffversorgung der Mikroorganismen. Beispielsweisewerden bestimmte Spurenstoffe besser im aeroben ,andere nur im anaeroben Milieu beseitigt. Als Uferfil-tratsstrecken sind deshalb solche Standorte vorteilhaft,bei denen das Wasser sowohl in aeroben als auch anaer-oben Bodenzonen ausreichend lange verweilen kann.
Unabhängig von den Redoxverhältnissen ist die Uferfiltra-tion geeignet, organische Spurenstoffe wie polyzyklischearomatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Bipheny-le (PCB) und viele Insektizide zu entfernen. Aber auchGeruchs und Geschmacksstoffe sowie hormonell wirksa-me Substanzen werden größtenteils abgebaut. Wichtigfür die Uferfiltration in wärmeren Klimazonen: SteigendeTemperaturen führen zu einer erhöhten Stoffwechselin-tensität und somit meist zu einer höheren Umsatzrate.
DVGW – Technologiezentrum Wasser Karlsruhe(TZW)Dr. Frank Thomas LangeKarlsruher Straße 8476139 KarlsruheTel.: 07 21/96 78 15 7Fax: 07 21/96 78 10 4E-Mail: [email protected]: www.tzw.deFörderkennzeichen: 02WT0279
Ein Brunnen der Vertikalbrunnengalerie in Düsseldorf

Die Langsamfiltration ist ein naturnahes, einfachesund kostengünstiges Verfahren, um Trinkwasser auf-zubereiten; in Deutschland wird sie meist mit ande-ren Verfahren kombiniert. Sie lässt sich auch mitalternativen, lokal verfügbaren Filtermaterialienbetreiben. Mehrere Forschungsprojekte habenuntersucht, ob und wie sich die Langsamfiltrationtechnisch noch verbessern und an Standortbedin-gungen außerhalb Mitteleuropas anpassen lässt.
Die Langsamfiltration hat sich als Verfahren zur biologi-schen Trinkwasseraufbereitung etabliert. In der Regelbestehen die Anlagen aus einem Infiltrationsbecken ,das mit verschiedenen Filter- und Stützschichten befülltist. Auf eine Drainage- und Stützschicht aus Steinen, Kiesund grobem Sand folgt eine etwa einen Meter hohe Filter-schicht. Als Filtermaterial wird in Mitteleuropa vor allemSand verwendet (Langsamsandfiltration); je länger dasWasser im Sandfilter verbleibt, desto besser ist in derRegel dessen Reinigung.
Gleichförmiger und gut gereinigter Filtersand ist jedochnicht überall verfügbar. Für eine weitere Verbreitung desVerfahrens (insbesondere in Entwicklungs- und Schwel-lenländern) ist deshalb die Anpassung an lokale Gegeben-heiten entscheidend – etwa durch den Einsatz am Ort ver-fügbarer und kostengünstiger Filtermaterialien. Wie sichdies erreichen lässt, untersuchten das Rheinisch-Westfäli-sche Institut für Wasserforschung (IWW), Mülheim an derRuhr (Gesamtkoordination der Vorhaben „Langsamsand-filtration“) und das Institut für Wasserforschung (IfW) inSchwerte (Laufzeit: 2002 bis 2005).
Alternativen zu Sand untersucht
Exemplarisch analysierten die Wissenschaftler die Reini-gungsleistung von Recycling-Glasgranulat und Kokosfa-sern im Vergleich zu Sand – bei wechselnden Temperatu-ren, Filtergeschwindigkeiten und Betriebsweisen. Ein wei-teres Teilprojekt war der Frage gewidmet, ob sich dieWirksamkeit der Langsamfiltration verbessert, wenn dieSandfilterschicht durch zusätzliche Auflagen aus Kies,Bims oder Kokosfasern ergänzt wird.
Extreme Schadstoffkonzentrationen simuliert
Die Untersuchungen fanden im Labor und in halbtechni-schen Versuchsanlagen statt. Um die Wirksamkeit beiextremen Schadstoffkonzentrationen im Ausgangswasserzu ergründen, verwendeten die Forscher für ihre Tests zum
Angepasste Langsamfiltration –Vielseitig und kostengünstig
einen künstlich verunreinigtes Oberflächenwasser miterhöhtem DOC- und Ammoniumgehalt . Zum anderensetzten sie den Ablauf einer Kläranlage als Rohwasserin den Versuchsanlagen ein, um zu erfahren, ob sich dieLangsamfiltration auch zur Aufbereitung von Wasser ausFlüssen eignet, die zwar stark durch Abwassereinleitun-gen beeinflusst sind, aber noch über eine gewisse Selbst-reinigungskraft verfügen.
Forschungsgegenstand war darüber hinaus die Charakte-risierung der mikrobiellen Besiedlung in Langsamsandfil-tern. Das Technologiezentrum Wasser (TZW) der Deut-schen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) ent-wickelte ein Modul zur praxisnahen mathematischenSimulation der Langsamsandfiltration unter Berücksichti-gung unterschiedlicher Umgebungsbedingungen, umdas Betriebsverhalten optimieren zu können.
Schließlich ging es in den Projekten „Grenzen der Lang-samsandfiltration, Möglichkeiten der technischenModifikation und Anpassung an lokale Gegebenhei-ten“ und „Optimierung des Einsatzes von Langsam-sandfiltern durch spezielle Auflageschichten undBetriebsweisen“ darum, bereits vorhandene Daten überdie Langsamfiltration mit den aktuellen Ergebnissen ineinem Leitfaden für die Planung und den Betrieb vonLangsamfiltrationsanlagen zusammenzuführen (Kühn,W.; Müller, U. (Hrsg.): Exportorientierte F&E auf demGebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil I: Trinkwasser.Band 2; Karlsruhe; unter www.tzw.de).
Altglasgranulat und Kokosfasern sind Alternativen
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dasssich sowohl Recycling-Glasgranulat als auch Kokosfasernals Alternative zu Sand in der Langsamfiltration anbieten.
RESSOURCE WASSER | 2.4.02116
Säulenversuchsanlage in einer Klimakammer Recycling-Glasgranulat

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | ANGEPASSTE LANGSAMFILTRATION 117
Deren alleinige Reinigungsleistung reichte allerdingsunter den Versuchsbedingungen nicht bei allen Betriebs-varianten aus, um direkt Trinkwasser zu gewinnen. So tra-ten in den Versuchen spezifische Stärken und Schwächender jeweiligen Filtermaterialien auf, die in der Praxis zuberücksichtigen und gegebenenfalls durch technischeModifikationen auszugleichen sind (z. B. Vorabscheidungoder Belüftung).
Für die Aufbereitungsleistung der Langsamfiltrationspielt die Temperatur eine wichtige Rolle: Temperaturenunter zehn Grad Celsius verlangsamen erheblich die bio-logische Abbauvorgänge, teilweise kommen sie fast zumErliegen. Bei hohen Temperaturen und einer hohen Kon-zentration biologisch abbaubarer Stoffe erfolgt durch bio-logische Abbauprozesse eine starke Sauerstoffzehrung.Säulenversuche in einem klimatisierten Raum zeigten,dass sich unter den gewählten Betriebsbedingungen (Fil-terschichtmächtigkeit, Betriebsweise, Filtergeschwindig-keit etc.) bei fünf bis zehn Grad Celsius das eingesetzteRohwasser (hoher DOC- und Ammoniumgehalt) durchkein Filtermaterial so aufbereiten ließ, dass es bei denuntersuchten chemischen Parametern den Trinkwasser-vorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO)entsprach. Bei 20 Grad Celsius überschritt nur das mitRecycling-Glasgranulat aufbereitete Filtrat die Grenzwer-te, während bei 30 Grad alle Filtrate die WHO-Richtwerteerfüllten. Das mit Sand filtrierte Wasser erreichte bei die-sen Versuchen sogar die Vorgaben der strengeren deut-schen Trinkwasserverordnung.
Schützende Auflageschicht
Die Versuche haben gezeigt, dass eine 20 Zentimeterdicke Auflageschicht aus Kies, Bimsstein oder Kokosfaserndie Filterlaufzeit deutlich erhöht. Ferner wurde ein Groß-teil der im Wasser enthaltenen Partikel bereits in dieser
Schicht zurückgehalten, das schützt die unter ihr liegendeSandfilterschicht, deren Oberfläche weniger „verklebt“.Handelt es sich bei den herausgefilterten Partikeln umorganische statt mineralische Stoffe, werden sie bereits inder Auflageschicht biologisch abgebaut. Der Nachteil: Derverbrauchte Sauerstoff fehlt weiter unten, was sich – ohnezusätzliche Belüftung – negativ auf weitere aerobe Abbau-vorgänge , zum Beispiel die Ammoniumoxidation, aus-wirkt.
Wie wirksam Langsamsandfilter schwer abbaubare orga-nische Spurenstoffe zurückhalten, testeten die Wissen-schaftler in einer eigenen Versuchsanlage, die mit einerAktivkohleschicht unterhalb der Sandschicht ausgestattetwar. Das Ergebnis: Mit dem lageweisen Einbau von sorpti-ven Materialien wie Aktivkohle lassen sich organischeSpurenstoffe aus Pflanzenschutz- und Arzneimitteln effek-tiv zurückhalten. Weil diese „Sandwich“-Bauweise hoheBau- und Wartungskosten verursacht, bietet sich eine groß-technische Anwendung aber bislang nicht an. Erreicht dieLangsamfiltration allein nicht die gewünschte Wasser-qualität, ist es deshalb sinnvoller, das Verfahren in eindem Standort angepasstes System aus geeigneten Vor-und Nachbereitungstechniken zu integrieren.
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser-forschung gGmbHDr.-Ing. Hans-Joachim MälzerMoritzstraße 2645476 Mülheim an der RuhrTel.: 02 08/4 03 03-3 20Fax: 02 08/4 03 03-80E-Mail: [email protected]: www.iww-online.deFörderkennzeichen: 02WT0282
Institut für Wasserforschung GmbH Dortmund(IfW)Frank RemmlerZum Kellerbach 4658239 SchwerteTel.: 0 23 04/95 75-3 53Fax: 0 23 04/95 75-2 20E-Mail: [email protected]: www.ifw-dortmund.deFörderkennzeichen: 02WT0279
Schematischer Aufbau der Langsamsandfiltration (Schnitt) nach DIN19605 aus dem DVGW-Arbeitsblatt W213-4

Ein vom Bundesministerium für Bildung und For-schung (BMBF) gefördertes Verbundforschungspro-jekt hat Ergebnisse der Wasserforschung in Deutsch-land dokumentiert und diese für andere Randbedin-gungen weiterentwickelt. Dazu wurden Eckwertefür die Größe und den Betrieb von Wasserbehand-lungs- und -verteilungsanlagen unter Berücksichti-gung extremer Rohwasserbeschaffenheiten sowieanderer klimatischer und sozialer Bedingungenermittelt. An dem Projektverbund waren zehn Insti-tute und Universitäten beteiligt.
Nachstehend werden in Deutschland bewährte Aufberei-tungsverfahren dahingehend bewertet, wie sie auchunter speziellen Randbedingungen anwendbar sind,beziehungsweise wann verbesserte Leistungen zu erwar-ten sind.
Langsamfilter mit geschlossenem Boden sowie Infiltra-tionsbecken mit nachgeschalteter Bodenpassage könnenin Entwicklungs- und Schwellenländern für Kleinanlagenin ländlichen Gebieten wie auch in Städten eine Alternati-ve sein. Hinzuweisen ist darauf, dass durch Langsamfiltra-tion ohne Vorbehandlung lediglich trübstoffarmes undmikrobiologisch nur gering belastetes Wasser behandeltwerden sollte.
Großer Erfahrungsschatz: Uferfiltration
Seit weit über 100 Jahren wird die Uferfiltration inDeutschland eingesetzt, somit besteht hier ein sehr großerErfahrungsschatz. Dieses Wissen erlaubt einen zielgerich-teten Einsatz im Ausland – trotz anderer klimatischer undhydrogeologischer Bedingungen. Um den Know-how-Transfer zu unterstützen, hat der Projektverbund diverseingenieurtechnische Hilfsmittel entwickelt und detailliertin einem Leitfaden für Anwender aufgeführt (siehe Quel-lenangabe am Ende des Beitrages).
Die Verfahrenskombination Flockung , Sedimentationund Filtration ist das Standardverfahren in vielen Ländernbei der Aufbereitung von Oberflächenwasser. WichtigeZiele bei der Projektierung sind eine optimale hydrauli-sche und dosierungstechnische Konzeption der Hilfsmit-telzugabe zur Flockenbildung, ein minimierter Spülwas-serbedarf, eine optimierte Schlammwasserentsorgungsowie eine an lokale Standards angepasste Mess-, Steue-rungs- und Regelungstechnik (MRS-Technik).
Exportorientierte Forschung & Entwicklung –Übertragung in andere Länder
Mikro- und Ultrafiltration – eine Alternativezur konventionellen Wasseraufbereitung
Neben der konventionellen Wasseraufbereitung durchFlockung und Filtration kann die Mikro- oder Ultrafiltra-tion zur Trübstoffentfernung eine Alternative sein. Ein-setzen lassen sie sich einerseits zur Aufbereitung geringtrübstoffhaltiger Rohwässer ohne Vorbehandlung oderstark trübstoffhaltiger Rohwässer nach konventionellerVorbehandlung. Die Mikro- und Ultrafiltration kann aucheutrophe Rohwässer aufbereiten. Voraussetzung füreine nachhaltige Nutzung dieser Techniken ist die ent-sprechende Infrastruktur für Wartung und Betrieb.
Die Schwermetallentfernung mit Ionenaustauschern istbesonders für nur gering trübstoffhaltiges Wasser geeig-net; die Kapazität der Ionenaustauscher wird kaum ver-mindert. Bei schwermetallhaltigem Wasser kann derIonenaustausch eine Alternative etwa zur Aufbereitungvia Flockung sein.
Insbesondere bei Einsatz in Wässern mit unbekannterZusammensetzung an Wasserinhaltsstoffen sind die mitOxidationsverfahren verbundene Nebenproduktbildungsowie die Entfernung von Restgehalten zu berücksichti-gen. Die Kombination von Wasserstoffperoxid und UV-Strahlung hat sich als energieintensives Verfahren erwie-sen; eine Voroxidation mit Kaliumpermanganat , umden Wirkungsgrad der Flockung zur Trübstoffentfernungzu verbessern, ist nicht zielführend. Wichtige Planungs-
RESSOURCE WASSER | 2.4.03118
Transportabler Versuchsstand zur Bewertung des Einflusses der Wasserbeschaffenheit auf die Korrosion vor Ort

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | WISSENSEXPORT AUS DEUTSCHLAND 119
kriterien sind die Betriebssicherheit des Prozesses sowiedie notwendige Qualifikation des verantwortlichen Perso-nals. Die Schwächen der biologischen Ammoniumoxidati-on in kaltem Wasser lassen sich durch verschiedene Maß-nahmen mindern. Bei Wassertemperaturen unter fünfGrad Celsius sind jedoch sehr lange Einarbeitungszeiten(Wochen bis Monate) erforderlich, um eine erhöhteAmmoniumbelastung zu eliminieren. Dies kann die Nütz-lichkeit des Verfahrens in Frage stellen.
Aktivkohlen sollten prinzipiell nur mit gering trübstoff-haltigen Wässern beaufschlagt werden (z. B. <0,2 NTU,Nephelometrischer Trübungswert). Der Einfluss der Was-sertemperatur auf die Adsorption von natürlichen orga-nischen Wasserinhaltsstoffen ist eher von geringem Aus-maß. Hohe DOC-Konzentrationen im aufzubereitendenWasser können die Adsorptionskapazität der Aktivkohlefür Spurenstoffe einschränken, sie sollten daher vor derAdsorption durch andere Verfahren soweit wie möglichvermindert werden. Obwohl sich granuliertes Eisenhydro-xid sehr wirkungsvoll zur Entfernung von Arsen eignet, istder Wirkungsgrad bei der Entfernung gelöster organi-scher Stoffe nur gering.
Die Desinfektion des Trinkwassers ist in allen Ländern daswichtigste und am häufigsten angewandte Verfahren zurAufbereitung. In der Regel werden im Ausland eine Desin-fektion und die Einspeisung des Wassers mit freiem Desin-fektionsmittel in das Verteilungssystem gefordert; dies istin Anbetracht von oft nicht optimalen Zuständen im Ver-teilungsnetz auch erforderlich. Da ein Restchlorgehalt amWasserhahn gefordert wird, sind entsprechende Desinfek-tionsmittel mit Depotwirkung auch nach Optimierungder Aufbereitung als finale Sicherheitsstufe erforderlich.Vorsicht ist allerdings vor einer Überdosierung aufgrundder Desinfektionsnebenproduktbildung sowie negativenReaktionen seitens der Verbraucher geboten.
Wasserbeschaffenheit und Korrosion imRohrnetz
Im Ausland ist für eine Bewertung des Einflusses der Was-serbeschaffenheit auf die Korrosion nicht nur die in derPraxis übliche Ermittlung der Korrosionswahrscheinlich-keit aus Ionenverhältnissen ausreichend. Versuche unterden konkret vorliegenden Bedingungen mit einem spe-ziellen Versuchsstand (Foto) liefern weitergehende Aussa-gen.
Bei der Beurteilung der grundsätzlichen Anwendbarkeitder Verfahren aus technischer Sicht sind die landesspezifi-schen Bedingungen hinsichtlich Infrastruktur, Verfügbar-keit et cetera zu berücksichtigen (siehe auch Tabelle). DieÜbertragbarkeit der Verfahren in andere Industrieländerist, abgesehen von der Berücksichtigung eventueller kli-matischer Unterschiede, kein grundsätzliches Problem, davon einem nahezu gleichwertigen technologischen Stan-dard auszugehen ist. Für Schwellen- und Entwicklungs-länder gilt dies nicht oder nur eingeschränkt.
Ein Leitfaden fasst die Ergebnisse des Projektverbundszusammen, eine beiliegende CD dokumentiert dieAbschlussberichte der Teilprojekte: „ExportorientierteF&E auf dem Gebiet der Wasserver- und –entsorgung.Teil I: Trinkwasser, Band 2: Leitfaden, Eigenverlag DVGW-Technologiezentrum Wasser Karlsruhe (2006), ISBN: 3-00-015478-7“ (vergriffen)
DVGW - Technologiezentrum Wasser (TZW)Dr. Uwe MüllerKarlsruher Straße 84D-76139 KarlsruheTel.: 07 21/96 78-2 57Fax: 07 21/96 78-1 09E-Mail: [email protected]: www.tzw.deFörderkennzeichen: 02WT0273 – 0282, 02WT0323
Eignung von Aufbereitungsverfahren in Industrie- (IL), Schwellen- (SL)und Entwicklungsländern (EL)+++ Weniger Aufwand bzw. Stand der Technik++ Mäßiger Aufwand bzw. noch nicht häufig eingesetzt+ Höherer Aufwand bzw. Verfügbarkeit nur in Einzelfällen
Kostenfaktoren in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern(Gieb, 2005)
Verfahren
Uferfiltration
Langsamfiltration
Flockung, Sedimentation
Filtration
Ionenaustausch
Oxidation
Adsorption
Desinfektion
Teilverfahren
Langsamfilter Infiltration
Schnellfiltration
Biofiltration
Mikro-/Ultrafiltration
Luftsauerstoff
Ozon
H2O2/Fe
Kornkohle
Pulverkohle
mit Restkonzentration
ohne Restkonzentration
IL
++
+
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+
+++
++
+
++
SL
++
++
+++
+++
++
++
+
+++
+
+
++
++
+++
EL
+++
+++
+++
+++
+++
+
+
+++
+
+
+
+++
+++
Bauteil
Bauwerke
Maschinenbauliche Ausrüstung,
Elektrotechnik/MSR-Technik
Kostenart
Ausführung häufigdurch regionale Unternehmen
Lokale/regionaleProduktion
Importierte Ausrüstung
IL
1,0
1,0
SL
0,6
0,8
1,5-1,7
EL
0,4
0,6
1,5-1,7
i.d.R. keine Anwendung
Faktor für Entwicklungsstandard

Deutschland hat weltweit eine Spitzenstellung inder Wassertechnologie. In einzelnen Punkten beste-hen dennoch auch heute noch Wissenslücken. Dasbetrifft zum Beispiel die Anpassung von Abwasser-technologien an veränderte Randbedingungen wiedas Klima in anderen Ländern. Ein Verbundprojekthat solche Lücken geschlossen.
Zu diesen veränderten Randbedingungen gehören extre-me Abwassertemperaturen, geringe Konzentrationen anleicht abbaubaren Verbindungen, erhöhte Salzgehalte oderein intensives Algenwachstum in Abwasserteichen alsFolge einer hohen Sonneneinstrahlung. Ziel des Verbund-projekts „Exportorientierte Forschung und Entwick-lung auf dem Gebiet der Wasserver- und -entsorgungTeil II – Abwassertechnologien in anderen Ländern“war es, die in Deutschland bewährten Technologien derkommunalen Abwasserreinigung an andere Klimazonenund Randbedingungen anzupassen. Zudem galt es, imVergleich zu Deutschland stärker die Themen Recyclingund Planungsmethoden zu betonen. Damit leistete dasVerbundprojekt einen Beitrag zu einer verbesserten undwirtschaftlicheren Abwasserbehandlung und zu einemverbesserten, nachhaltigeren Umgang mit der RessourceWasser.
In der ersten Projektphase wurden Erhebungen zu denbesonderen Bedingungen der kommunalen Abwasserbe-handlung in zwölf Staaten durchgeführt, die repräsentativfür verschiedene Weltregionen und Entwicklungsstufenstehen: Ägypten, Brasilien, China, Indonesien, Iran, Jorda-nien, Marokko, Russland, Südafrika, Thailand, die USAsowie Vietnam. An diese Bestandsaufnahme schlossensich 24 einzelne Forschungs- und Entwicklungsprojektean, durchgeführt von elf Hochschulen sowie mehrerenUnternehmen, eingeteilt in drei Kernbereiche.
Kernbereich A: Abwasserbehandlung
Kernbereich A befasste sich überwiegend mit Verfahren,die weltweit und auch in Deutschland Standard sind: Bele-bungsverfahren , Tropfkörper , Scheibentauchkörper ,getauchte Festbetten und Abwasserteiche. Die deutscheWassertechnologie kann hier ihren großen Erfahrungs-schatz einbringen; er ist an andere Ausgangsbedingun-gen anzupassen. Im Mittelpunkt stehen hier die stofflicheBeschaffenheit des Abwassers, die Temperatur des Abwas-sers und der Umgebungsluft sowie die Anforderungen anden Klärwerksablauf beziehungsweise die Reinigungsstu-fen (mechanisch, biologisch, Nährstoffelimination).
Angepasste Abwassertechnologien –Wissenslücken geschlossen
Kernbereich B: Desinfektion und Wasserwiederverwendung
Die Teilprojekte des zweiten Kernbereichs konzentriertensich auf die Möglichkeiten des Wasserrecyclings sowie dieAnalyse, Demonstration und Verbesserung ausgewählterAbwasserbehandlungsverfahren. Einen Themenkomplexbildeten beispielsweise die unterschiedlichen Anforde-rungen an Abwasseranlagen – je nach Jahreszeit (Sommer,Winter) oder Nutzer – zur Erzeugung von Bewässerungs-wasser. Auch interessierten sich die Wissenschaftler fürdie Frage, wie sich Anaerobverfahren zur Abwasserbe-handlung anpassen lassen. Ferner standen Untersuchun-gen zur Klärschlammbehandlung und -verwertung aufder Projektagenda.
Kernbereich C: Simulation und Konzepte der Abwasserbehandlung
Den Kernbereich C bildeten die Projekte, die auf andereLänder abgestimmte Hilfen für die Planung von Abwasser-behandlungsanlagen erarbeitet haben. Angesprochen sindhier angepasste ökonomische Methoden zur Variantenbe-wertung, Modelle zur Klärwerkssimulation, Stufenaus-baukonzepte zur Anpassung an steigende Reinigungsan-forderungen oder steigende Belastungen sowie Arbeits-hilfen (“Expo-Tool“, erhältlich bei ifak e.V., Magdeburg) für
RESSOURCE WASSER | 2.4.04120
Projektstruktur

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | ANGEPASSTE ABWASSERTECHNOLOGIEN 121
die Projektbewertung, die verschiedene Klärwerksalter-nativen quantitativ bewerten und visuell darstellen. Mitdiesen Hilfen lassen sich Klärwerksalternativen aussage-kräftig und anschaulich erläutern, zum Beispiel gegen-über den Auftraggebern.
Umfangreiche Dokumentationen
Die Projektdokumentationen des Forschungsverbundsbieten eine Fülle von Informationen und Hilfen, um Klär-werkstechnologien an die Verhältnisse in anderen Län-dern anzupassen. Zu verschiedenen qualitativ durchaus
bekannten Phänomenen werden erstmals quantitativeEmpfehlungen vorgelegt. An erster Stelle steht hier derEinfluss der Abwassertemperatur: Sie ist in allen mit Fra-gen der Bemessung befassten Projekten die wichtigsteGröße zur Anpassung der Abwasserreinigungs- und Klär-schlammbehandlungsverfahren an andere klimatischeVerhältnisse. Eine wichtige Aussage ist, dass höhereAbwassertemperaturen zwar eine deutliche Leistungsstei-gerung ermöglichen, ohne entsprechende Gegenmaß-nahmen aber auch zu Betriebsproblemen führen können(z. B. Verschlammung, unzureichende Sauerstoffversor-gung).
Neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Vor-trägen sind die Ergebnisse des Verbundprojekts in dendrei Berichten „Anforderungen an die Abwassertechnik inanderen Ländern“, „Projektübergreifender Abschlussbe-richt“ und „Leitfaden zur Abwassertechnologie in ande-ren Ländern“ zusammengefasst. Die Berichte sind überdie angegebene Kontaktadresse der Ruhr-UniversitätBochum erhältlich.
Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft undUmwelttechnikProf. Dr.-Ing. Hermann OrthGeb. IA 01/147Universitätsstraße 15044801 BochumTel.: 02 34/32-2 30 49Fax: 02 34/32-1 45 03E-Mail: [email protected]: www.ruhr-uni-bochum.de/siwawi/Förderkennzeichen: 02WA0539Nachklärung und Faulturm der Kläranlage Fujairah, Vereinte
Arabische Emirate (zur Verfügung gestellt durch die Passavant-Roediger GmbH)
Demonstrationsanlage auf der Yamuna Vihar Kläranlage in Neu Delhi,Indien

Verlässliche Informationen sind das A und O, umrichtige Entscheidungen treffen zu können. Für dieWasserbehörde der Megalopolis Peking gilt diesbesonders: Weil das Wasserangebot in der Regionklimatisch bedingt extrem schwankt, benötigt siegenaue Daten, um jeweils Angebot und Verbrauchabschätzen zu können. Ein mit deutscher Hilfe ent-wickeltes Computerprogramm ermöglicht jetztgenau dies – und das trotz einer sehr schwierigenDatenbasis. Die Ergebnisse des Projekts könntenauch für andere Megastädte Asiens hilfreich sein.
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen ineinem Wassermangelgebiet ist eine komplexe Aufgabe.Ab einer bestimmten Größe (Versorgungsgebiet, Einwoh-nerzahl) sind in der Regel mehrere Ressourcen zeitlichund räumlich optimal zu bewirtschaften, wobei in Man-gelgebieten auch das Abwasser als Ressource zu betrach-ten ist. Megastädte wie Peking mit ihren 16 bis 17 MillionenEinwohnern stehen somit in ihrem Wassermanagementvor großen Herausforderungen.
Extreme Situationen
Die geographische Lage Pekings am Nordrand der nord-chinesischen großen Ebene bedingt ein semi-arides, zeit-weise semi-feuchtes Klima. Fast der gesamte Jahresnieder-schlag fällt in nur zwei Monaten (einschließlich von Hoch-wasserereignissen), zehn Monate im Jahr ist es hingegenweitgehend trocken. Die Wasserbehörde von Peking mussalso zwei völlig konträre Extremsituationen managen.
Am meisten Wasser benötigt die Landwirtschaft imUmland der Metropole, den Bedarf decken weitgehenddie 40.000 bis 50.000 lokalen Grundwasserbrunnen. DasTrinkwasser wird derzeit aus Oberflächenwasser (vorallem Stauseen) und aus dem Grundwasser gewonnen –beide Quellen sind übernutzt. Die beiden großen Flüsse inder Region (Yongding und Chaobai) führen seit Jahren nurnoch zeitlich oder räumlich eingeschränkt Wasser. Undder Grundwasserpegel fällt jährlich um ein bis zwei Meter.
Um auch in Zukunft bei weiter steigendem Verbraucheine gesicherte Wasserversorgung zu gewährleisten, sollteursprünglich ab 2007 Wasser aus dem Süd-Nord-Wasser-transfer in die Region Peking geleitet werden. Der Anschlusshat sich jedoch verzögert, derzeit ist er für 2012/2013 vor-gesehen. Dieser Transfer soll jährlich einmal bis zu 1,4 Mil-liarden Kubikmeter Wasser in die Metropole leiten, bis-lang fehlt es jedoch an geeigneten Zwischenspeichern.
Wassermanagement in Megastädten –Die Rolle der Datenbasis
Diese vielschichtigen Aufgaben können nur mit Hilfeeines auf die Informationsbedürfnisse zugeschnittenenComputerprogramms gelingen. Ein solches Informations-system für den Großraum Peking zu erstellen, war Aufga-be eines deutsch-chinesischen Vorhabens, das im Novem-ber 2009 mit der Übergabe des Softwaresystems an dieWasserbehörde Pekings (Beijing Water Authority, BWA)abgeschlossen wurde. Die Leitung des vom Bundesminis-terium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertenProjekts hatte das Fraunhofer-Institut für Optronik, Sys-temtechnik und Bildauswertung (IOSB).
RESSOURCE WASSER | 2.4.05122
Beispiel für ein trockenes Flussbett im Betrachtungsgebiet
Struktur und Funktionen des für Peking erstellten Informationssystems

TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | WASSERMANAGEMENT IN MEGASTÄDTEN 123
Vielschichtiges Programm
Das im Projekt entwickelte „Beijing Water Decision Sup-port System“ (DSS ) führt Daten und Informationenunterschiedlicher Qualität, Quantität und Beeinflussbar-keit zusammen (siehe auch Grafik). Die Informationen rei-chen von gut messbaren Daten (z. B. Wasserentnahme auseiner bestimmten Quelle) bis zu unsicheren Schätzungen(z. B. Verbraucherverhalten, Neubildungsrate des Grund-wassers). Das System bildet alle Ressourcen – basierend aufBilanzgleichungen – in mathematischen Modellen ab: Sieermöglichen es, unterschiedliche Szenarien zu simulie-ren, die die Wasserbehörde bei ihren Entscheidungenunterstützen.
Erwartungsgemäß tauchten erhebliche Probleme bei denArbeiten an einer umfassenden Informationsbasis sowiebei der Ableitung repräsentativer Modellstrukturen miträumlich und zeitlich verteilten Parametern auf. Datenliegen in der Regel bei verschiedenen Institutionen undBehörden, sie sind deshalb bezüglich der Anforderungeneiner detaillierten Modellierung lückenhaft, ungenau,inkonsistent und manchmal sogar widersprüchlich.Erschwerend kam hinzu, dass viele Modellparameter(bzw. Modelleingangsgrößen) als Funktionen des Ortesund der Zeit – also in Form von Karten – zu ermittelnwaren, jedoch viel zu wenige Messdaten vorlagen.
System für Wasserbilanzen geschaffen
Die Projektpartner lösten diese Probleme, indem sie einzusammenhängendes, vielschichtiges System für Wasser-bilanzen geschaffen haben: Bilanzieren lässt sich bei-spielsweise das Wasserangebot verschiedener Quellen,die Grundwasserneubildung und Rohwasserentnahme,der Wasserverbrauch oder die Aufbereitung und Entsor-gung des Abwassers. Mit Hilfe dieser Bilanzen lassen sichunplausible Daten erkennen und korrigieren sowieLücken schließen. Ferner ist eine automatisierte multikri-terielle Optimierung möglich, mit der über Simulationenfür vorgegebene Parametervariationen das Szenarioermittelt wird, das unter den gegebenen Randbedingun-gen die günstigste Lösung für die Wasserversorgung ist.Angesichts der hohen Komplexität überprüft das Systemdie Benutzereingaben auf ihre Konsistenz, Plausibilitätund Vollständigkeit.
Die Arbeiten am Beijing Water Decision Support Systemergaben neue methodische Ansätze für eine hoch aufge-löste Modellierung von Wasserressourcen bei meso-skali-gen Betrachtungsgebieten von mehreren Tausend Qua-dratkilometern (und mehr) sowie für die Ermittlung vonParametern auf Basis unvollständiger, inkonsistenter oderwidersprüchlicher Ausgangsdaten (wie dies bei der Was-serversorgung der Megastädte Asiens oder Südamerikasdie Regel ist). Wie gut diese Ansätze insgesamt waren,zeigte die gute Übereinstimmung von errechneten undgemessenen Ergebnissen im Rahmen der Verifikation derDaten aus den Jahren 1995 bis 2000.
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnikund Bildauswertung (IOSB)Prof. Dr. Michael BirkleFraunhoferstraße 176131 KarlsruheTel.: 07 21/60 91-3 80Fax. 07 21/60 91-5 56E-Mail: [email protected]: www.iosb.fraunhofer.deFörderkennzeichen: 02WA0565, 02WA0849,
02WA1035
Trocken gefallene Uferzone des Kunming See am Sommerpalast in Beijing

Papierfabriken sind in der chinesischen ProvinzShandong ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor.Bislang ist das Abwasseraufkommen der Fabrikenaußerordentlich hoch. Ein neues vom BMBF geför-dertes Forschungsprojekt hat Wege für eineumweltverträglichere Papierproduktion in Chinauntersucht.
Die Provinz Shandong im Osten der Volksrepublik Chinaweist das zweitgrößte Bruttoinlandsprodukt aller chinesi-schen Provinzen auf – erwirtschaftet vor allem von denhier angesiedelten Industriebetrieben. Dazu gehören vor-rangig die Branchen Papierherstellung, Brennerei, Färbe-mittelindustrie und Mononatriumglutamatproduktion. Im Bereich der Trinkwasserversorgung gibt es in der Pro-vinz Shandong seit langer Zeit Probleme. Im Jahr 2003waren über zwei Millionen Menschen nicht ausreichendmit Trinkwasser versorgt. Entsprechend dem Jahresbe-richt des Ministeriums für Wasserressourcen der Shan-dong Provinz konnte für mehr als sechs Millionen Men-schen kurzzeitig kein Trinkwasser zur Verfügung gestelltwerden, obwohl im Jahr 2003 relativ viel Niederschlag fiel.Dies bedeutet, dass sich die Probleme bei der Trinkwasser-versorgung in anderen Jahren noch verschärfen dürften.
Der zweitgrößte Fluss Chinas – der Gelbe Fluss – durchfließtdie Shandong Provinz. Aus dem Gelben Fluss wird Wasserentnommen und im „Kanal von Süd nach Nord“ geleitetum insbesondere die Region Peking mit Rohwasser zurTrinkwassergewinnung zu versorgen. Ein nachhaltigesWasserressourcenmanagement im Einzugsgebiet desGelben Flusses und des Kanals ist in diesem Zusammen-hang eine sehr wichtige Thematik. Dementsprechendwird eine Vielzahl von Projekten zur seiner Umsetzunggefördert. Diesbezügliche Schwerpunkte sind die Reini-gung von industriellen Abwässern aus z. B. Brennereien,Textilienfärbereien und insbesondere Papierfabriken.
In Shandong wurden 2005 insgesamt 38 Papierfabrikenmit Stroh als Rohstoff betrieben. Das von ihnen verursach-te Abwasser – im Jahr 2000 alleine 416 Millionen Kubikme-ter – stellt eine extreme Belastung für die Gewässer dar.Bei einer Jahresproduktion von rund drei Millionen Ton-nen Papier im Jahr 2000 ergab sich ein Wert von 138 Liternje erzeugtem Kilogramm Papier – deutsche Papierfabri-ken verursachten lediglich ein Zehntel.
Um die Konflikte zwischen dem Wirtschaftwachstum unddem Umweltschutz zu entschärfen und schrittweise alleUmweltschutzziele zu erreichen, wurden sowohl von der
Übertragbare Lösungen für spezielle Abwasserprobleme –Papierherstellung am Gelben Fluß
Zentralregierung in Peking als auch von der Regierungder Shandong Provinz eine Vielzahl von verschärftenRichtlinien im Bereich der industriellen Abwasserbeseiti-gung erlassen. Demnach muss ab dem 1. Januar 2011 direktin die Vorflut eingeleitetes Abwasser einen Grenzwert von100 Milligramm CSB /Liter unterschreiten („IntegratedWastewater Discharge Standard in Shandong PeninsulaBasin“). Dieser Einleitgrenzwert ist schärfer als seine euro-päischen Pendants. Umso mehr konnten die Abwasserbe-handlungsanlagen in den Papierfabriken der ShandongProvinz in der Vergangenheit diese Regelungen sowohlhinsichtlich der Schmutzfracht als auch bezüglich derSchmutzkonzentration nicht einhalten. Vor diesem Hin-tergrund war es also notwendig, Verfahren zu entwickeln,die betriebsicher und kostengünstig die gefordertenAblauffrachten und -konzentrationen einhalten konnten.
RESSOURCE WASSER | 2.4.06124
Vorbehandlungsstufe – Mikroelektrolyse-Verfahren (MEV)
Aerobe – aerobe Behandlungsstufe
Anaerobe – aerobe biologische Behandlungsstufe

ÖKOLOGIE | WASSER UND RESSOURCEN | PAPIERHERSTELLUNG AM GELBEN FLUSS 125
Das Gesamtziel des beantragten Forschungsvorhabenswar es, Lösungsmöglichkeiten zur Abwasserbehandlungfür die speziellen Papierabwässer der Shandong Provinzaufzuzeigen und zunächst die Abwasserbehandlung zuverbessern. Langfristig gesehen sollte auch die Brauch-wasserrückführung optimiert werden, um insgesamt denWasserverbrauch in der Produktion zu reduzieren. Außer-dem sollte die Übertragbarkeit der untersuchten Verfahrenzur Abwasserbehandlung auf andere Papierfabriken derShandong Provinz bzw. in ganz China überprüft werden.
Das gesamte Vorhaben lässt sich in zwei wesentlicheArbeitsschritte aufteilen: Im ersten Projektteil (ProjektteilA) wurde das Mikroelektrolyse-Verfahren (MEV) im Labor-maßstab an der TU Darmstadt untersucht, um die biologi-sche Abbaubarkeit des Abwassers aus der Papierproduk-tion zu optimieren. Damit sollte ein weitgehender BSB5 -und CSB-Abbau realisiert und gleichzeitig die biologischeAbbaubarkeit in den nachfolgenden Stufen verbessertwerden. Dieser Schritt diente der späteren Untersuchungin der halbtechnischen Versuchsanlage (Projektteil B), die unter der deutsch-chinesischen Kooperation in derPapierfabrik Qufu in der Shandong Provinz aufgebautworden war.
In der halbtechnischen Versuchsanlage wurden zurBehandlung der anfallenden Papierabwässer eine Vorbe-handlungsstufe nach dem Mikroelektrolyse-Verfahrenund eine zweistufige biologische Reinigung (anaerob /aerob bzw. aerob/aerob) eingesetzt. Die Mikroelektroly-se diente der Vorbehandlung und sollte insbesondere dieschwer abbaubaren Ligninverbindungen eliminieren. Ineiner Straße wurde das Abwasser mit einem hochbelaste-ten Belebtschlammverfahren und einer anschließenden
Biofilterstufe behandelt. In der zweiten Straße wurde dasAbwasser mit einem UASB-Reaktor anaerob vorbehan-delt und anschließend mit einem Biofilter aerob nachge-reinigt. Zusätzlich zur halbtechnischen Anlage wurden imProjektteil B ergänzende Laborversuche mit einer abge-wandelten Behandlungsstufe durchgeführt, in der dieBehandlungsschritte in der Reihenfolge MEV, UASB, Bele-bungsbecken und Biofilter hintereinander geschaltet wurden.
Bei den Untersuchungen mit der halbtechnischen Ver-suchsanlage konnten die ab dem 1. Januar 2010 geforder-ten 120 Milligramm CSB/Liter erreicht werden; jedoch nichtdie Werte der verschärften Emissionsnorm, die ab 2011gelten soll. Bei den zusätzlichen Laborversuchen dagegenkonnten diese zukünftigen Anforderungen (weniger als100 Milligramm CSB/Liter) eingehalten werden.
Mit den bisherigen Untersuchungen wurde gezeigt, dassdie Abwasserreinigung der Papierindustrie in China mitdurchaus bezahlbaren Verfahren optimiert werden kann;die Einhaltung der Grenzwerte bedarf aber einer Anpas-sung der Verfahren an die speziellen Abwasserströme undSchmutzfrachten. Für die Übertragung der Ergebnisse aufandere Fabriken wird zurzeit noch eine Wasserbilanz deroben genannten Papierfabrik erarbeitet. Doch es wirdgenerell davon ausgegangen, dass eine Übertragung aufFabriken mit Stroh als Rohstoff möglich ist. Um weiterge-hende Aussagen zu Papierabwasserbehandlungen vonFabriken mit anderen Rohstoffen zu erhalten, sind die spezifischen Randbedingungen und Abwasserzusammen-setzungen zu berücksichtigen und ggf. weiter zu unter-suchen.
Technische Universität DarmstadtInstitut IWARFachgebiet AbwassertechnikProf. Dr.-Ing. Peter Cornel. Petersenstraße 1364287 DarmstadtTel.: 0 61 51/16-21 48Fax: 0 61 51/16-37 58E-Mail: [email protected] Internet: www.iwar.bauing.tu-darmstadt.deFörderkennzeichen: 02WA0953
Eisenbett (Vordergrund), Zwischenklärung und Nachklärung (Hinter-grund)

Gemeinsam für saubere Wasserressourcen – Internationale Kooperationen
RESSOURCE WASSER | 2.5.0126

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES 127
Als Beitrag zur Verbesserung der globalen Wasser-versorgung fördert das Bundesministerium für Bil-dung und Forschung (BMBF) im Rahmen von For-schungs- & Entwicklungsprojekten Technologienund Managementkonzepte für eine nachhaltigeBewirtschaftung von Wasserressourcen. Zielgebieteder zurückliegenden Förderperiode waren vor allemAsien, der Nahe Osten, Osteuropa und Afrika.
In Deutschland bewährte Techniken und Verfahren müs-sen in der Regel an die regionalen, wirtschaftlichen undsozialen Verhältnisse angepasst werden. Besonders wich-tig ist hier die Ausbildung einheimischer Fachkräfte.Know-how an die Verantwortlichen vor Ort zu vermittelnund sie so in die Lage zu versetzen, Projekte selbst umzu-setzen oder fortzuführen, ist ein zentrales Anliegen derinternationalen Wasserforschungsprojekte. DeutscheUnternehmen bringen wertvolles technisches Wissen indiese Forschungs- und Entwicklungsprojekte ein. Die vomBMBF geförderten Vorhaben tragen somit auch dazu bei,der deutschen Wasserbranche neue Exportmärkte zuerschließen – auf einem Feld, das in den nächsten Jahr-zehnten deutliche Zuwachsraten verzeichnen dürfte.
Beispiel Indonesien. Die Südküste der Insel Java ist eineder ärmsten Regionen Indonesiens. Den Menschen fehltes an Wasser, obwohl es im Untergrund große Vorrätegibt. Über ein verzweigtes unterirdisches Gewässersystemmit weit mehr als 1.000 Höhlen floss das Wasser bisherjedoch ungenutzt ins Meer. In dem Projekt „Erschließungund Bewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer in Mitteljava, Indonesien“ haben Wissenschaftler ausDeutschland und Indonesien ein kleines unterirdischesWasserkraftwerk gebaut, mit dessen Hilfe Wasser füretwa 80.000 Menschen an die Oberfläche befördert wer-den kann (Projekt 2.5.01).
Beispiel China. Das deutsch-chinesische Forschungspro-jekt „Entwicklung eines nachhaltigen Wasserkonzepts fürden Olympischen Park in Beijing, 2008“ hatte im Vorfeldder Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ein Was-serkonzept für den rund 550 Hektar großen OlympischenPark erarbeitet. Es soll geprüft werden, ob die Ergebnisseauch auf weitere Regionen des Landes sowie andere Staa-ten übertragen werden können (Projekt 2.5.02). Die vielenhygienisch relevanten Mikroorganismen (Viren, Bakte-rien, Protozoen, Wurmeier), die im Abwasser – selbst nacheiner biologischen Reinigung – vorhanden sind, erforderneine adäquate Behandlung des Abwassers vor dessen Wie-derverwendung. Bei der Chlorung ist aber mit der Bildung
von unerwünschten Desinfektionsnebenprodukten zurechnen. Ein Vergleich von Abläufen hat gezeigt, dass esAlternativen zur üblichen Abwasserbehandlung gibt. DasInstitut IWAR der Technischen Universität Darmstadt hatvier dieser Alternativverfahren in China getestet (Projekt2.5.08).
Beispiel Iran. Mashhad ist die zweitgrößte Stadt des Iranund liegt in einer ariden Zone. Um die Bevölkerung mitnitratarmen Trinkwasser versorgen zu können, hat dasBMBF in Kooperation mit dem iranischen Energieministe-rium das Projekt „Demonstration verschiedener inDeutschland entwickelter Hochleistungsverfahren zurEntfernung von Nitrat aus Trinkwasser und ihre Anpas-sung an die Aufbereitung von hoch mit Natriumnitratund anderen Salzen belasteten Grundwässern am Beispielder Trinkwasseraufbereitung der Stadt Mashhad, Iran“durchgeführt (Projekt 2.5.03).
Beispiel Russland. Mit 3.500 Kilometern ist die Wolga derlängste Fluss Europas. Massive Eingriffe haben den Stromwie kaum einen anderen verändert – mit komplexen Fol-gen für Mensch und Umwelt. Ein deutsch-russisches Pro-jekt hat nachhaltige Lösungen für die ökonomische undumweltschonende Bewirtschaftung der Wolga und ihrerZuflüsse entwickelt (Projekt 2.5.04).
Beispiel Vietnam. Für Vietnam ist Steinkohle ein wichti-ger Energieträger, ihr Abbau führt jedoch zu erheblichenUmweltschäden. Ziel des deutsch-vietnamesischen Pro-jekts „RAME (Research Association Mining and Environ-ment)“ in der Provinz Quang Ningh ist es, Sanierungstech-nologien des deutschen Kohlenbergbaus für Vietnamnutzbar zu machen (Projekt 2.5.05).
Beispiel Israel. Wissenschaftler aus Deutschland und Isra-el haben gemeinsam neue Messverfahren entwickelt, dieals Grundlage kontinuierlicher Überwachung des Schad-stoffgehalts in Trinkwasserquellen in Israel dienen kön-nen (Projekt 2.5.06). In einem weiteren in dieser Broschürevorgestellten Projekt versuchen deutsche und israelischeWissenschaftler durch „Wolkenimpfung“ der Austrock-nung des Landes entgegenzuwirken (Projekt 2.5.07).

Die Südküste der Insel Java ist eine der ärmstenRegionen Indonesiens. Den Menschen fehlt Wasser,obwohl es unter der Erde große Vorräte gibt – inweit mehr als 1.000 Höhlen; über ein verzweigtesunterirdisches Gewässersystem fließt das Wasserjedoch in das Meer ab. Wissenschaftler aus Deutsch-land und Indonesien haben für eine Region auf Javaeine einfache Lösung gefunden: ein unterirdischesKleinkraftwerk, das genug Wasser an die Oberflächebefördert, um etwa 80.000 Menschen versorgen zukönnen.
Die rund 1.400 Quadratkilometer große Karstlandschaftin der Region Gunung Sewu auf Java ist von Hundertenmiteinander verbundenen Höhlen und unterirdischenFlüssen durchzogen. Obwohl unter der Erde ausreichendWasser vorhanden ist, leiden die Bewohner der Region inder Trockenzeit unter Wassermangel, weil geeignete Spei-cher fehlen – die wenigen Niederschläge versickernschnell im karstigen Boden. In der Regel befördern mitDieselgeneratoren betriebene Pumpen das Wasser ausden Höhlen an die Oberfläche. Einmal abgesehen vomEnergieverbrauch und den hohen Betriebs- und War-tungskosten: Die Fördermenge reicht nicht aus, um denWasserbedarf von privaten Haushalten, Gewerbe undLandwirtschaft zu decken.
Wasser aus Höhlen
Eine im Auftrag des BMBF durchgeführte Machbarkeits-studie kam zu dem Ergebnis, dass es technisch möglichwäre, das Höhlenwasser mittels Wasserkraft zu fördern.Dies war der Ausgangspunkt für das 2002 gestartetedeutsch-indonesische Pilotprojekt „Erschließung undBewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer inMitteljava, Indonesien“ zum Bau einer Demonstrations-wasserkraftanlage in Gunung Sewu. Unter Leitung desInstituts für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) desKarlsruher Instituts für Technologie (KIT) waren siebenInstitute unterschiedlicher Fachdisziplinen sowie indus-trielle Partner beteiligt (Tunnelvortriebs-, Pumpen- undRegelungstechnik).
Nach intensiven Erkundungen vor Ort fiel die Wahl aufdie Höhle (Gua) Bribin. Sie hat ein Speichervolumen vonetwa 300.000 Kubikmetern, der Wasserdurchfluss beträgtselbst in der Trockenzeit über 1.000 Liter pro Sekunde. DieProjektteilnehmer entschieden sich für den Bau einesSperrwerks in der Höhle, um das kontinuierlich zuströ-mende Wasser aufzustauen, einen Teil davon mittels
Angepasste Technologie –Ein unterirdisches Wasserkraftwerk auf Java
Kleinwasserkraftwerk über eine 100 Meter lange Steiglei-tung zu fördern und so rund 80.000 Menschen in denumliegenden Hüttensiedlungen zu versorgen. Bewusstkonzentrierten sich die Forschungs- und Entwicklungsar-beiten auf einfach handhabbare Techniken, die an dieBedürfnisse von Mensch und Natur vor Ort angepasst sind.
Um die potenziellen Einstauhöhen und Speichervoluminazu bestimmen, wurden große Teile der Höhle mittelsmodernster Lasertechnik exakt vermessen, die Datenanschließend zu einem hochaufgelösten, dreidimensiona-len Modell zusammengeführt. Die Porosität und die mine-ralogische Zusammensetzung des Gesteins ermitteltendie Forscher durch makro- und mikroskopische Untersu-chungen von Proben. Sie schufen damit eine wichtigeVoraussetzung, eventuelle Wasserverluste und Korrosi-onserscheinungen prognostizieren und so die langfristigeStabilität des Systems beurteilen zu können. Anschließendinstallierten sie ein Messnetz, um die Gewässergüte sowiedie hydrologischen, hydraulischen und hydrogeologi-schen Zustände kontinuierlich zu erfassen.
Nach der Erschließung des Projektgebiets führte dasDepartment of Public Works, Yogyakarta, auf Grundlageder vom IWG erhobenen Vermessungsdaten eine ersteSondierungsbohrung (103 m) durch. Nach einer weiterenBohrung und einer detaillierten Analyse der Bohrprobenbegannen im Sommer 2004 die Arbeiten an einemZugangsschacht; die Firma Herrenknecht AG entwickelte
RESSOURCE WASSER | 2.5.01128
Bohrstelle im Karstgebiet

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | UNTERIRDISCHES WASSERWERK AUF JAVA 129
hierfür eine an die örtliche Situation angepasste Vertikal-vortriebsmaschine und grub einen rund 100 Meter tiefenSchacht mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. DerDurchbruch in die Höhle erfolgte im Dezember 2004.
Pumpen statt Turbinen
Für die Konstruktion der Staumauer mit integrierterKleinwasserkraftanlage wurden verschiedene Bau-, Mate-rial- und Ausführungsvarianten untersucht. Dabei ging esneben der optimalen Funktionsfähigkeit, Sicherheit undVerfügbarkeit auch darum, die Betriebstechnik der Klein-wasserkraftanlage hinsichtlich ihrer Steuerung, Wartungund Instandhaltung an die Fähigkeiten und den Ausbil-dungsstand des technischen Personals vor Ort anzupas-sen: Deshalb kommen zur Energiegewinnung inversbetriebene Pumpen statt Turbinen zum Einsatz, die inZusammenarbeit von IWG und der Firma KSB AG entwi-ckelt wurden. Sie sind kostengünstig, sehr robust und war-tungsfreundlich.
Erdbeben unterbrach die Arbeiten
Nach Abschluss der Planungen begann im April 2005 derBau des unterirdischen Sperrwerks. Ende 2005 musstendie Bauarbeiten aufgrund der frühen Regenzeit unterbro-chen werden; kurz nach Wiederaufnahme der Arbeitenim Mai 2006 ereignete sich ein schweres Erdbeben derStärke 6,3 auf der Richterskala, dessen Epizentrum nur 30Kilometer entfernt lag. Die Baustelle selbst blieb weitest-gehend unversehrt, jedoch stieg der Wasserstand nachdem Beben an der Baustelle um rund zwei Meter – weitereBauarbeiten waren nicht möglich. Deutsche Berufstau-cher stellten fest, dass der Anstieg des Wasserspiegelsdurch einen Versturz hinter dem flussabwärts folgendenSiphon verursacht wurde. Insgesamt blockierten über1.000 Kubikmeter Geröll an dieser schwer zugänglichenStelle den Fließquerschnitt. Ende 2006 sprengten deut-sche und indonesische Spezialisten eine Schneise in die-sen Versturz – ab Juni 2007 konnten die Arbeiten fortge-führt werden.
Im August 2008 erfolgte nach erfolgreicher Fertigstellungder Staumauer sowie der Installation des ersten Förder-moduls ein erster Probeeinstau unter großer Anteilnahmeder Öffentlichkeit. Aufgrund von Sättigungsprozessen imumgebenden Gebirge wurde die Einstaudauer auf ein biszwei Wochen geschätzt – tatsächlich war das Stauziel von16 Metern bereits nach weniger als zwei Tagen erreicht.Während des Probeeinstaus erfolgte auch ein Testbetriebdes ersten Fördermoduls, hier ließ sich eine Förderleis-tung von 20 Litern pro Sekunde am Ende des 100 Meterlangen, vertikalen Steigrohrs messen – das Ergebnis ent-sprach den Erwartungen. Noch vier weitere Fördermodu-le sowie ein elektrisches System zur Anlagensteuerungwurden installiert.
Somit konnten die Projektpartner die Anlage im März 2010an die zuständige indonesische Behörde übergeben, derenMitarbeiter durch Schulungen auf den selbständigenBetrieb der Anlage vorbereitet waren. Um das Verhaltender Anlage im Dauerbetrieb bewerten und bei eventuellauftretenden Problemen helfen zu können, begleitet dasKIT den Betrieb während der Laufzeit des Nachfolgepro-jekts „Integriertes Wasserressourcen Management (IWRM)in Gunung Kidul, Java, Indonesien“ (siehe Projekt 1.3.05).
Projekt-Website www.iwrm-indonesien.de
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG)Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Franz NestmannDr.-Ing. Peter OberleDr.-Ing. Muhammad IkhwanKaiserstraße 1276131 KarlsruheTel.: 07 21/6 08 63 88Fax: 07 21/60 60 46E-Mail: [email protected]örderkennzeichen: 02WT0424
Erkundungen des Höhlensystems Bauarbeiten in der Höhle

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2008 inPeking war die chinesische Regierung bestrebt, dieUmweltbelastungen in der Region um die Haupt-stadt deutlich zu verbessern. Ein deutsch-chinesi-sches Forschungsprojekt erarbeitete deshalb einbeispielhaftes Wasserkonzept für den rund 550 Hek-tar großen Olympischen Park, der im Norden derMetropole entstanden ist. Eine zentrale Rolle spiel-ten ein großer künstlicher See sowie ein künstlicherFluss innerhalb der Parkanlage.
Die Umweltsituation im Ballungsraum Peking (Beijing) istsehr angespannt. Nicht nur die Luftverschmutzung, auchdie Wasserversorgung bereitet Probleme: Der Wasserbe-darf der Millionenstadt steigt kontinuierlich, während derGrundwasserpegel jährlich um ein bis zwei Meter sinktund die Wasserqualität abnimmt. Für die Olympiade2008, die unter dem Motto „Grüne Olympische Spiele“stand, war ein funktionstüchtiges und störungsfreies Was-sermanagement für den Olympischen Park erforderlich,der rund 18.000 Athleten und Funktionäre beherbergte.Seit den Spielen ist der Park eine grüne Erholungszonezwischen Stadt und Umland für die Bewohner. Nebenumfangreichen Aufforstungsmaßnahmen ist im Nordendes Parks ein etwa 60 Hektar großer See entstanden. Darü-ber hinaus wurde ein kleinerer Fluss im zentralen Bereichdes Olympischen Parkes realisiert. Letzterer wurde mitWasser höchster Qualität (Umkehrosmose ), der See imnördlichen Bereich wurde mit aufbereitetem Kommunal-abwasser nach Mikrofiltration befüllt.
Öffentliche und private Partner
Das bilaterale Verbundprojekt „Entwicklung eines nach-haltigen Wasserkonzepts für den Olympischen Park inBeijing, 2008“ sollte zum nachhaltigen Umgang mit derknappen Ressource Wasser über das Jahr 2008 hinaus bei-tragen – mit der Perspektive, die hier gemachten Erfah-rungen auf weitere Regionen des Landes sowie andereStaaten zu übertragen. An dem vom Ministerium für Wis-senschaft und Technologie (MOST) der Volksrepublik Chi-na und dem BMBF geförderten Projekt waren neben derUniversität Duisburg-Essen und der Technischen Universi-tät Berlin auch mittelständische Unternehmen maßgeb-lich beteiligt: die WASY Gesellschaft für wasserwirtschaft-liche Planung und Systemforschung mbH aus Berlin (heute: DHI-Wasy GmbH), das Institut für angewandteGewässerökologie GmbH, die GeoTerra GmbH sowie dasBeratungsunternehmen Obermeyer aus München. Die Projektteilnehmer auf chinesischer Seite waren die
Olympiade 2008 in Peking –Ein Konzept für die Wassernutzung
Tsinghua Universität Beijing und die WasserbehördePekings (Beijing Water Authority). Neben der detailliertenBestandsaufnahme der Planungsgrundlagen beschäftigtesich das Projekt mit dem Einsatz wassersparender Haus-technologien im Olympischen Dorf, modernen Technikender Abwasser- und Regenwasserbehandlung oder mit derGewässergestaltung im Olympischen Park. Zu den Ergeb-nissen gehört ein für Entscheidungsträger erstelltes Hand-buch zum nachhaltigen Wassermanagement in Städten.
Einer der Schwerpunkte des Forschungsprojekts lag in derAuswahl geeigneter Technologien für die Aufbereitungund Wiederverwendung von Abwasser im OlympischenPark, insbesondere für die Seen. Das Recyclingkonzept sahdie Kontrolle von Hygiene-, Algen- und Geruchsproble-men durch regulierte Nährstoffkonzentrationen vor. DerHygienesicherheit diente ein Multi-Barrieren-System(zweifaches Niederdruckmembranverfahren , Bodenfil-tration); auf diese Weise ließ sich das aufbereitete Wasserals Brauchwasser für Toilettenspülungen, Springbrunnenoder zur Straßenreinigung nutzen.
Kombinierte Prozesstechniken
Auf dem Gelände der Kläranlage Beixiaohe im NordenPekings bauten Wasserspezialisten der Technischen Uni-versität Berlin gemeinsam mit Kollegen von der TsinghuaUniversität und der Beijing Drainage Group eine Pilotan-lage für alle geplanten Wasserrecyclingverfahren. ZumEinsatz kamen kombinierte, moderne Prozesstechniken:Membranbioreaktoren (MBR), Festbett, Phosphat-Adsorp-tionsmaterialien und Ultrafiltration mit naturnahenAufbereitungsprozessen wie der künstlichen Uferfiltration.Die MBR trennten Biomasse und Keime, wodurch ein
RESSOURCE WASSER | 2.5.02130
G I S - b a s e d I n f o r m a t i o n S y s t e m f o r d a t a m a n a g e m e n t a n d v i s u a l i z a t i o n
P l a n n i n g D S S M o n i t o r i n g M o d u l e M o n i t o r i n g M o d u l e
O p e r a t i o n D S S O p e r a t i o n D S S
P u b l i c W a t e r I n f o r m a t i o n S y s t e m
P u b l i c W a t e r I n f o r m a t i o n S y s t e m
O l y m p i c G a m e s P o s t O l y m p i c G a m e s Pre Olympic Games
G I S - b a s e d I n f o r m a t i o n S y s t e m f o r d a t a m a n a g e m e n t a n d v i s u a l i z a t i o n
P l a n n i n g D S S M o n i t o r i n g M o d u l e M o n i t o r i n g M o d u l e
O p e r a t i o n D S S O p e r a t i o n D S S
P u b l i c W a t e r I n f o r m a t i o n S y s t e m
P u b l i c W a t e r I n f o r m a t i o n S y s t e m
O l y m p i c G a m e s P o s t O l y m p i c G a m e s Pre Olympic Games
OWIS – Olympic Water Information System

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | WASSERNUTZUNG OLYMPIADE PEKING 131
partikelfreier Ablauf des Wassers gewährleistet war. WeilOrthophosphat im See als Dünger für Algen und Pflanzenwirkt und so das ökologische Gleichgewicht des Gewäs-sers gefährdet, wurde dem Wasser in einem adsorptivenSchritt Orthophosphat entzogen. Die Anlagen bewiesenim vorherigen Testbetrieb (2005) ihre Eignung bezüglichder erforderlichen Wasserqualitäten. Im Testsee der Klär-anlage wurden durchgängig mesotrophe Verhältnisseeingehalten, die Brauchwasserqualität war nach derkünstlichen Uferfiltration des Testsees und anschließen-der Ultrafiltrationsmembran sehr gut. Die Ergebnisse ausDemoanlage und Testsee wurden in der ersten Phase desProjekts (2004 – 2008) erarbeitet. Die Empfehlungen derProjektpartner BDG und TUB wurden allerdings nur zumTeil im Olympischen Park umgesetzt, da man für den zen-tralen Bereich nur aufbereitetes Umkehrosmosewassereinsetzten wollte. Die Partner hatten hier eine Kombina-tion von Biofiltration und Ultrafiltration vorgeschlagen.
Elektronisches Informations- und Kontrollsystem
Mitarbeiter der WASY GmbH entwickelten mit der Tsing-hua Universität das elektronische „Olympic Water Infor-mation System“ (OWIS) für die Planer, Veranstalter undBetreiber des Olympiaparks. In diese Datenbank flossensowohl neue, im Verlauf des Projekts ermittelte Faktenund Forschungsergebnisse als auch bereits vorhandeneDaten ein, die die chinesischen Projektpartner verfügbarmachten. OWIS ermöglicht es, das Wassersystem imOlympischen Park laufend zu überwachen, ein Alarmmo-dul ist in das System integriert. Ferner ist OWIS ein effekti-ves Instrument, um die Folgen möglicher Entscheidungenund Ereignisse für das Wassersystem vor Ort abschätzen
und verschiedene Handlungsoptionen vergleichen zukönnen – zum Beispiel, welche Maßnahmen erforderlichwären, wenn sich die Wasserqualität im Olympiasee plötz-lich dramatisch verschlechterte.
DHI-WASY GmbHProf. Dr. Stefan Kaden (Geschäftsführer)Waltersdorfer Straße 10512526 BerlinTel.: 0 30/67 99 98-0Fax: 0 30/67 99 98-99E-Mail: [email protected]: www.dhi-wasy.deFörderkennzeichen: 02WA0526
Teil der Pilotanlage im Klärwerk BeiXiaoHe
Übersichtskarte des Olympischen Parks (Quelle: www.strategy4.china.com)

Weltweit führen Einträge aus der Landwirtschaftoder ungereinigte Abwässer aus Haushalten zuhohen Nitratkonzentrationen im Grundwasser. Ohneentsprechende Aufbereitung kann daraus gewonne-nes Trinkwasser gesundheitsschädlich sein. Um die-se Gefahr für die Menschen der iranischen GroßstadtMashhad zu verringern, hat ein deutsch-iranischesProjekt vier verschiedene Verfahren getestet, Nitrataus dem Grundwasser zu entfernen. Die Ergebnissehelfen zu entscheiden, ob und mit welcher Technikim Iran künftig Anlagen zur Trinkwasseraufbereitunggebaut werden.
Die Stickstoffverbindung Nitrat ist natürlicherweise inden meisten Wasservorkommen in geringen Konzentra-tionen zu finden. Doch seit Jahren steigen in vielen Regio-nen der Welt die Nitratwerte, oft sind Stickstoffeinträgeaus der Landwirtschaft dafür verantwortlich. Auch unge-klärt im Boden versickernde häusliche Abwässer belastendas Grundwasser. Wird aus nitrathaltigem Grundwasser –ohne ausreichende Aufbereitung – Trinkwasser gewon-nen, so ist dieses ebenfalls mit Nitrat belastet. Eine zu hoheNitratkonzentration ist gesundheitsschädlich.
Stark erhöhte Nitratwerte
Mashhad ist mit über zwei Millionen Einwohnern diezweitgrößte Stadt des Iran und liegt in einer ariden Zoneim Nordosten des Landes. Die Wasserversorgung der Stadtberuht zu etwa 85 Prozent auf nicht aufbereitetem Grund-wasser. Insbesondere in den Sommermonaten herrschteine ausgeprägte Wasserknappheit. In den vergangenenJahren sind die Nitratkonzentrationen zahlreicher Brun-nen in Mashhad deutlich gestiegen – auf Werte von 150Milligramm je Liter (vereinzelt sogar über 250 mg/l). ZumVergleich: Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisati-on (WHO) liegt bei 50 Milligramm Nitrat je Liter Trinkwas-ser. Vermutlich sind die hohen Werte darauf zurückzu-führen, dass unbehandelte häusliche Abwässer im Bodenversickern, was zu einem starken Eintrag von Stickstoff inden Aquifer führt. Obwohl sich die Abwassersituation inMashhad in den vergangenen Jahren deutlich verbesserthat, ist nicht abzusehen, dass sich die Nitratbelastung derWasserressourcen kurz- oder mittelfristig verringert.
Um die Bevölkerung in Zukunft mit nitratarmen Trink-wasser versorgen zu können, hatten das iranische Energie-ministerium und das BMBF im Jahr 2002 eine Kooperationvereinbart: das Projekt „Demonstration verschiedenerin Deutschland entwickelter Hochleistungsverfahren
Nitratbelastung im Iran –Wissensexport verbessert die Trinkwasserqualität
zur Entfernung von Nitrat aus Trinkwasser und ihreAnpassung an die Aufbereitung von hoch mitNatriumnitrat und anderen Salzen belasteten Grund-wässern am Beispiel der Trinkwasseraufbereitung derStadt Mashhad, Iran“. Beteiligt waren das IWW Rhei-nisch-Westfälische Institut für Wasserforschung, dasUnternehmen VA TECH Wabag Deutschland GmbH, dasForschungszentrum Karlsruhe, das WETECH – Institut fürWasser- und Umweltschutztechnologie sowie der lokaleWasserversorger Mashhad Water & Wastewater.
Kombinierte Verfahren
Ziel des Vorhabens war es, erstmals parallel vier verschie-dene Verfahren zur Entfernung von Nitrat aus dem Trink-wasser einzusetzen: den Ionenaustausch , die Umkehr-osmose , die Elektrodialyse sowie die biologische Denitrifikation . Da die in Deutschland entwickelten Verfahren und Anlagen bisher noch nicht bei derart belas-tetem Grundwasser zum Einsatz kamen, galt es, sie an diespezifischen Bedingungen im Iran anzupassen – auch umdas Nitrat bei einem gleichzeitig hohen Sulfatgehalt desWassers zuverlässig entfernen zu können. Die Versuchs-anlagen mit Durchsätzen von jeweils etwa drei Kubikme-tern pro Stunde wurden in Deutschland in Containerbau-weise konstruiert und im Oktober 2004 in Mashhad instal-liert. Ein deutsch-iranisches Team (IWW, Mashhad Water& Wastewater Co.) war für den Betrieb und die Optimie-rung der Anlagen zuständig und führte von 2004 bis 2007zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durch.
RESSOURCE WASSER | 2.5.03132
Aufstellung der Versuchsanlagen auf dem Gelände der Brunnen-pumpstation in Mashhad

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | TRINKWASSERQUALITÄT IM IRAN 133
Zum Ende des Projekts im Mai 2008 hat sich gezeigt, dassich die vier Verfahren in Mashhad erfolgreich anwendenlassen. Alle Versuchsanlagen liefen zuverlässig und redu-zierten die Nitratkonzentrationen im Trinkwasser aufWerte unterhalb des WHO-Richtwerts. Dennoch habendie Projektpartner signifikante Unterschiede zwischenden einzelnen Verfahren festgestellt, etwa bezüglich derspezifischen Abwassermenge, den benötigten Ressourcen(Energie, Chemikalien, Personal) sowie den ökologischenwie wirtschaftlichen Folgen. Diese Aspekte wurden füralle vier Verfahren erfasst und in einer Nutzwertanalysebewertet. Unter Berücksichtigung der Situation im Iran (u. a. extrem niedrige Energiepreise) zeigte sich: die biolo-gische Denitrifikation und die Umkehrosmose sind die ambesten geeigneten Verfahren, um die Wasserqualitätszie-le in Mashhad zu erreichen. Verändern sich die Randbe-dingungen jedoch (z. B. durch steigende Energiepreise),können die Ergebnisse anders lauten.
Übertragbare Ergebnisse
Die mit diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen sindauch für neue Wasserwerke in Mashhad und anderenStädten der Region wichtig: Sie sind eine gute Grundlage,wenn die Experten im Iran entscheiden müssen, ob und
mit welchem Verfahren künftig Anlagen zur Nitratentfer-nung im Land zu errichten sind. Ein ebenfalls wichtigesErgebnis dieses Forschungsprojekts sind die vielen neuenKontakte zwischen deutschen und iranischen Wasser-fachleuten.
Auf mehreren internationalen Konferenzen und Fach-messen sowie in internationalen Publikationen haben dieProjektpartner ihre Ergebnisse vorgestellt. Der Abschluss-bericht mit dem Titel „Demonstration in Deutschland ent-wickelter Hochleistungsverfahren zur Entfernung vonNitrat aus Trinkwasser im Iran“ ist online abrufbar überdie Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover(http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb09/590090909.pdf; 7,4 MB).
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für WasserforschungBereich WassertechnologieDr.-Ing. Stefan Panglisch Dipl.-Ing. Oliver DördelmannMoritzstraße 2645476 Mülheim an der RuhrTel.: 02 08/4 03 03-243, -321Fax: 02 08/4 03 03-82E-Mail: [email protected]@iww-online.deInternet: www.iww-online.deFörderkennzeichen: 02WT0393
Reaktor zur biologischen Nitratentfernung (Denitrifikation)

Mit 3.500 Kilometern ist sie der längste FlussEuropas: die Wolga. Die massiven Eingriffe habenden Strom wie kaum einen anderen verändert – mitkomplexen Folgen für Mensch und Umwelt im Ein-zugsgebiet. Ein deutsch-russisches Projekt hat nach-haltige Lösungen für die ökonomische und umwelt-schonende Bewirtschaftung der Wolga und ihrerZuflüsse entwickelt. Schwerpunkte waren Untersu-chungen der Wasserqualität, die Wasserbewirtschaf-tung sowie die Sicherheit der Bauwerke.
Das Einzugsgebiet der Wolga mit ihren rund 200 Zuflüs-sen ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Rus-sischen Föderation, etwa 40 Prozent der Einwohner lebenhier. Mit seinen Wasser- und damit Energieressourcen hatder Strom ein enormes wirtschaftliches Potenzial, dasRussland seit Jahrzehnten intensiv nutzt: Bereits Mitte der1930er Jahre entstanden an der Wolga und ihrem größtenNebenfluss Kama elf große Stauwerke (bekannt als „Wol-ga Kama-Kaskade“), die heute eine Gesamtleistung von elfGigawatt haben. Doch diese massiven Eingriffe in das Öko-system führen zu weitreichenden Risiken und Konflikten.
Die ökologischen Risiken zu reduzieren war Ziel des „Wolga-Rhein-Projekts: ein deutsch-russisches Koope-rationsprojekt zur Wassergüte- und Wassermengen-bewirtschaftung an Wolga und Rhein“ (Laufzeit: 2004bis 2006). Gefördert vom BMBF und dem russischen For-schungsministerium arbeiteten an dem Projekt das Insti-tut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG), das Eng-ler-Bunte-Institut (EBI), Bereich Wasserchemie und dasInstitut für Massivbau und Baustofftechnologie (IfMB)vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Institutfür Umwelt-Geochemie der Universität Heidelberg unddie Abteilung Bodenphysik des Helmholtz-Zentrums fürUmweltforschung (UFZ) sowie die Unternehmen VoithSiemens Hydro (Heidenheim), die MC-Bauchemie (Bott-rop) und RusHydro (vormals RAO EES), der größte Energie-versorger Russlands. Die Institute IWG und EBI des KITkoordinierten das Projekt.
Niederschläge und Abflüsse analysiert
Besonders bedeutsam sind die von den deutschen undrussischen Partnern durchgeführten statistischen Analy-sen und Simulationen des Niederschlag-Abfluss-Gesche-hens im Wolga-Einzugsgebiet. Wie oft, wie intensiv reg-net es hier? Wie wirken sich die Niederschläge auf dennatürlichen Abfluss der Wolga aus? Das Verhältnis vonNiederschlag und Abfluss hat eine zentrale Bedeutung für
Nachhaltiges Wassermanagement an der Wolga –Eine Zukunft für Europas längsten Fluss
das gesamte Flusssystem: Erst wenn es anhand genauerDaten modelliert ist, lassen sich Aussagen etwa zum Stoff-transport oder zur Hochwasserlage treffen.
Um bei Hochwasser die Überflutungsgebiete, Wassertie-fen und -abfluss analysieren zu können, entwickelten dieWissenschaftler digitale Geländemodelle von fünf wichti-gen Staustufen an der Wolga. Während die russischenPartner die verfügbaren Daten erfassten und aufbereite-ten, simulierten ihre deutschen Kollegen die hydrauli-schen Verhältnisse der Wolga mit sogenannten hydrody-namisch numerischen Modellen. Ferner entwickelten siedas Programm „EntscheidungsunterstützungssystemWolga“, mit dem sich verschiedene Abflussszenarien ana-lysieren lassen: Es ermöglicht, das Gesamtsystem Wolgaeinschließlich der bewirtschafteten Stauräume im Com-puter zu simulieren und die aus energiewirtschaftlicherund ökologischer Sicht jeweils effizienteste Bewirtschaf-tungsstrategie für jede Staustufe zu ermitteln. Um denverschiedenen Nutzungsansprüchen an eine Stauraum-bewirtschaftung zu entsprechen, wurden Grundlagen derSimulation von Staustufenketten unter Einbindung vonAutomatisierungsfunktionen zur Verbesserung derBewirtschaftung erarbeitet.
Bauwerke und Wasserqualität untersucht
Zu den Voraussetzungen für eine wirtschaftliche undumweltschonende Wasserbewirtschaftung der Wolgagehören die Funktionsfähigkeit und die Betriebssicher-heit der vorhandenen Wasserbauwerke. Am Wasserkraft-komplex Wolgograd untersuchten Wissenschaftler undIngenieure exemplarisch den Zustand des Bauwerks undder einzelnen Bauteile (Wehrüberläufe, Wehrpfeiler,Betonwände). Die Ergebnisse dieser Vor-Ort-Untersuchun-gen und Laboranalysen von Bauwerksproben mündetenin ein Instandsetzungskonzept, dessen Umsetzung dieProjektpartner fachlich begleitet haben.
RESSOURCE WASSER | 2.5.04134
Wasserkraftwerk Nishegorodskaya bei Nishny Novgorod (Quelle: RusHydro)

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | WASSERMANAGEMENT AN DER WOLGA 135
Zwar gab es in der ehemaligen Sowjetunion seit Mitte der1940er Jahre umfangreiche Programme zur Kontrolle derWasserqualität, deren Ergebnisse wurden jedoch nichtveröffentlicht. Nach der Auflösung der Sowjetunionkamen diese Programme mangels Material und Personalde facto zum Erliegen. Über den aktuellen Zustand derrussischen Gewässer ist somit nur wenig bekannt – obwohldie Wolga und andere Flüsse eine wichtige Trinkwasser-quelle sind. Gegenstand des Projekts waren deshalb auchAnalysen des Schadstoffgehalts von Wasser und Sedimen-ten der Wolga. Im Untersuchungsgebiet von Nishny Nov-gorod war die Gewässergüte überraschend gut, offen-sichtlich verdünnt die enorme Wasserführung des Flusseseingeleitete Schadstoffe stark und verringert sie durchSelbstreinigungsprozesse.
Eutrophierte Stauseen und ihre Folgen
Die vorhandenen Nährstoffe führen allerdings vor allemin den Stauseen zu einer kritischen Eutrophierung ,bedingt durch die eingeleiteten Phosphorverbindungenaus den Abwässern von Haushalten (z. B. Waschmitteln)beziehungsweise durch Nährstoffeinträge aus der Land-wirtschaft. In den Sommermonaten führt die Eutrophie-rung besonders in den vielen Stauseen zu einem massen-haften Algenwachstum; ein reduzierter Sauerstoffgehaltdes Wassers und freigesetzte Toxine sind die Folge. Derrelativ hohe Gehalt an organischen Stoffen natürlichenUrsprungs verstärkt diese Effekte. Die Folge: An vielenStellen entstehen anaerobe Zonen, es kommt zu Fäulnis-prozessen. Eines der Ziele des Forschungsprojekts war esdeshalb, die Untersuchungsergebnisse nutzbar zumachen, damit die Vorsorge zu verbessern und die Belas-tungsquellen zu beseitigen – etwa durch eine ökologischeLandwirtschaft im Wolga-Einzugsgebiet.
Bereich 1: WassermengenbewirtschaftungKarlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Wasser und GewässerentwicklungProf. Dr. Dr. h.c. mult. Franz NestmannProf. Dr. Rolf KrohmerKaiserstraße 1276128 KarlsruheTel.: 07 21/6 08 21 94Fax: 07 21/60 60 46E-Mail: [email protected]@kit.eduInternet: www.iwg.uni-karlsruhe.deFörderkennzeichen: 02WT0484
Bereich 2: GewässergüteKarlsruher Institut für Technologie (KIT)Engler-Bunte-Institut und DVGW-Forschungsstelle –Bereich WasserchemieProf. Dr. Fritz H. FrimmelDr. Gudrun Abbt-BraunEngler-Bunte-Ring 176128 KarlsruheTel.: 07 21/6 08 25 80Fax: 07 21/69 91 54E-Mail: [email protected]: www.wasserchemie.uni-karlsruhe.deFörderkennzeichen: 02WT0480
Längsschnitt der Wolga- und der Kama-Staustufenkette
Entnahme und Analyse von Proben im Untersuchungsgebiet

Für Vietnam ist Steinkohle ein wichtiger Energieträ-ger. Ihr Abbau führt jedoch zu erheblichen Umwelt-schäden. Ein Kooperationsprojekt macht Technolo-gien und Erfahrungen des deutschen Kohlenberg-baus für Vietnam nutzbar, um den Bergbau inVietnam umweltverträglicher gestalten zu können.Welche Techniken und Verfahren sich an die örtli-chen Verhältnisse anpassen lassen, klären Wissen-schaftler und Ingenieure beider Länder vor Ort.
Rund 95 Prozent (45 Mio. t/a) der SteinkohlenförderungVietnams stammen aus der Provinz Quang Ninh im Nord-osten des Landes. Doch die Provinz beherbergt nicht nurdas bedeutendste Kohlenrevier Vietnams, sondern aucheine einzigartige Naturlandschaft: die Ha Long-Bucht. Seit1994 steht die Bucht mit ihren zahllosen Kalksteinfelsenund kleinen Inseln auf der UNESCO-Liste des Weltnaturer-bes, bei Touristen ist sie ein beliebtes Ferienziel. Die Regie-rung Vietnams will die touristische Anziehungskraft vonHa Long nutzen und die Zahl der Besucher weiter erhö-hen. Auch seine Steinkohlenförderung hat Vietnam injüngster Zeit deutlich ausgeweitet – und damit die Um-weltschäden vor Ort. Die fehlende Vegetation auf Abraum-halden und Altbergbauflächen sowie der Kohlentransportin offenen Lastwagen zu Häfen und Kraftwerken führenzu einer erheblichen Staubbelastung – viele Ortschaftenund ganze Landstriche sind vom Staub grau eingefärbt.
Gruben- und Sickerwasser gelangt in die Bucht
Das Gruben- und Sickerwasser aus den Abraumhaldenverunreinigt die Bäche und Flüsse im Abbaugebiet, fließtin die Ha Long-Bucht und gefährdet oder schädigt die ein-zigartige und sehr empfindliche Küsten- und Meeresfau-na und -flora. Die in der Regenzeit großflächige Erosionder unbewachsenen Bergbauflächen trägt dazu in hohemMaße bei, indem sie kohlehaltiges Feinmaterial in dieBucht schwemmt. Ein weiteres Problem ergibt sich auf-grund fehlender Flächen für Abraumhalden: Die Haldenwerden meist platzsparend sehr steil und oft in unmittel-barer Nähe zu Siedlungen aufgeschüttet, in der Folgekann es zu Rutschungen mit unmittelbarer Gefahr für dieAnwohner kommen.
Um die negativen Folgen beziehungsweise Risiken desKohlenbergbaus für Mensch und Natur zu vermeidenoder wenigstens zu verringern, sind dringend Sanierungs-maßnahmen notwendig. Doch wie lässt sich das deutscheKnow-how im Sanierungsbergbau an die Verhältnisse inVietnam anpassen? Antworten auf diese Frage erarbeitet
Zum Schutz des Weltnaturerbes Ha Long-Bucht –Deutsches Know-how für die Bergbausanierung
der vom BMBF geförderte deutsch-vietnamesische For-schungsverbund „RAME (Research Association Miningand Environment) in Vietnam, Provinz Quang Ninh“ unterLeitung des Lehrstuhls für Umwelttechnik und Ökologieder Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. Harro Stolpe), miteiner Laufzeit von 2007 bis 2012. Beteiligt sind ferner dieRWTH Aachen (Lehrstuhl für Bergbaukunde I), das Helm-holtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), die Gesell-schaft für Consulting, Business und Management (CBM)mbH (Aachen), Brenk Systemplanung GmbH (Aachen),LMBV International GmbH, eta AG engineering (Cottbus),das GFI Grundwasserforschungsinstitut GmbH (Dresden);die BioPlanta GmbH (Leipzig), sowie die DHI-WASI GmbH(Berlin). Das Projekt findet in enger Zusammenarbeit mitder Vietnam National Coal-Mineral Industries HoldingCooperation Limited (VINACOMIN) statt, sie stellt demForschungsverbund in ihrer Hauptverwaltung in Hanoiein Büro zur Verfügung. Die deutschen Partner entwi-ckeln die technischen Konzepte, die VINACOMIN an denBeispielstandorten in Pilotanlagen umsetzt.
In der ersten Projektphase (2005 bis 2007) ging es darum,Probleme zu identifizieren, einzugrenzen und zu beschrei-ben sowie geeignete Beispielstandorte für Untersuchun-gen zur Anpassung deutscher Technologie zu finden (The-ma: Bergbau und Umwelt in Vietnam, Problemanalyseund Lösungsstrategien). Seit 2007 entwickeln die Projekt-partner Konzepte für ausgesuchte Standorte: die HaldeChinh Bac Nui Beo (Stabilisierung und Rekultivierung),den Tiefbaustandort Vang Danh (Abwasserbehandlung),das Bergbaugebiet Dong Trieu (Behandlung von bergbau-
RESSOURCE WASSER | 2.5.05136
Die Ha Long-Bucht gehört zum Weltnaturerbe

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | BERGBAUSANIERUNG HA LONG BUCHT 137
beeinflussten Wässern in einem passiven Wasserreini-gungssystem) sowie das Bergbaugebiet Hon Gai (Umwelt-management).
Pilotanlage und Experimente
Nachdem das Projektteam im ersten Schritt die ökologi-schen Folgen des Bergbaus erfasst hatte, erstellte es –abgestimmt mit VINACOMIN – das Design einer angepass-ten Grubenwasserreinigungsanlage, die sowohl die feinenKohlenpartikel als auch die hohen Eisen- und Mangan-konzentrationen beseitigt. Auf der zu stabilisierendenHalde finden umfangreiche Feldexperimente etwa zurSchütttechnologie statt. Die Pflanzexperimente zur Rekul-tivierung wurden nach Auswahl geeigneter lokaler Artenebenfalls auf dieser Halde eingerichtet und werden nunregelmäßig untersucht. Auf Grundlage der für Hon Gaierhobenen Daten wird ein Umweltinformationssystemaufgebaut, das dem Umweltmanagement und der Umwelt-berichterstattung von VINACOMIN dient. Aufbauend aufden in den Pilotanlagen und Experimenten gewonnenenErkenntnissen soll zu Projektende ein Handbuch für dievietnamesischen Umweltingenieure vorliegen.
Vietnamesische Experten geschult
Eine wichtige Projektaufgabe besteht darin, Kontakte zuvietnamesischen Forschungsinstituten, Ministerien,Behörden und Unternehmen aufzubauen und zu pflegen.Sehr gute Kontakte bestehen inzwischen zu Wissenschaft-lern der vietnamesischen Akademie für Wissenschaft undTechnik (VAST) und der Universität für Bergbau und Geo-logie (UMG) in Hanoi. Diese wissenschaftliche Zusammen-arbeit bereitet auch den Weg für eine spätere wirtschaftli-che Kooperation deutscher und vietnamesischer Unter-nehmen.
Unter dem Aspekt Technologietransfer sind auch die Maß-nahmen zum Capacity Building des Verbundprojekts zusehen. In Vietnam fanden einige ein- bis dreiwöchigenKurse für Mitarbeiter von VINACOMIN statt, die Bergbau-experten aus Deutschland zu den Themen Staub, Halden-gestaltung und Grubenwasser durchführten. Ferner wur-den technische Exkursionen nach Deutschland organi-siert, um den Entscheidungsträgern von VINACOMINBergbaustandorte mit beispielhaften Maßnahmen zurRenaturierung und Rekultivierung zu zeigen.
Projekt-Website www.vinacomin.vn
Ruhr-Universität BochumUmwelttechnik und Ökologie im BauwesenProf. Dr. Harro StolpeUniversitätsstraße 15044780 BochumTel.: 02 34/32-2 79 95Fax: 02 34/32-1 47 01E-Mail: [email protected]: www.ruhr-uni-bochum.de/ecology/
Research Association Mining and Environment inVietnam (RAME)Vietnam National Coal & Mineral Industries Group(VINACOMIN)Dr.-Ing. Katrin Brömme (CEO)226 Le DuanHa Noi, Viet NamTel.: 00 84/4 35 18 83 07Fax: 00 84/4 35 18 83 41E-Mail: [email protected]: www.rame.vn
Förderkennzeichen: 02WB0689 (Vorprojekt),02WB0915, 02WB0916, 02WB0917, 02WB0919 (Ver-bundkoordination), 02WB0957, 02WB0958,02WB0964, 02WB0965, 02WB1017, 02WB1018,02WB1019, 02WB1250, 02WB1251
Eine Siedlung vor einer Bergbauhalde in Quang Ninh
Akazienpflanzungen von VINACOMIN

Trinkwasserquellen sind kontinuierlich auf ihrenSchadstoffgehalt zu prüfen, das ist zeit- und kosten-aufwendig. Ein Monitoring ist besonders in Krisenre-gionen wichtig, in denen die Gefahr terroristischerAnschläge besteht – etwa die Vergiftung von Was-serquellen. Wissenschaftler aus Deutschland undIsrael haben gemeinsam neue Messverfahren entwi-ckelt, die als Grundlage eines Frühwarnsystems die-nen können. Sie nutzen dazu das Infrarot-Absorpti-onsspektrum von Stoffen.
Um Verunreinigungen und Schadstoffe in Trinkwasser-quellen rechtzeitig entdecken zu können, ist eine ständi-ge Überwachung erforderlich. In politisch sensiblenRegionen wie Israel besteht zudem die Gefahr gezielterVergiftungen von Wasserquellen (Chemo-Terrorismus).Mithin besteht ein großer Bedarf an Messungen, die konti-nuierlich verlässliche Daten zur Qualität des Wassers liefern.
Deutsch-israelische Zusammenarbeit
Bisher erfolgten in Israel Grundwasseruntersuchungenvorwiegend durch Laboranalysen. Dazu mussten Probenan den Messstellen entnommen, ins Labor transportiertund dort aufbereitet werden – ein zeitaufwendiges, kost-spieliges und zudem fehleranfälliges Verfahren. Das vomBMBF innerhalb der deutsch-israelischen Wissenschafts-kooperation geförderte Projekt „A Compact Fiber-OpticInfrared System for Online Monitoring of Pesticidesand other Pollutants in Water“ (Kompaktes Infrarot-Messsystem zur Online-Detektion von Pestiziden und Ver-unreinigungen im Wasser) sollte daher ein Messsystementwickeln, mit dem sich die Wasserqualität in Echtzeitund über große Entfernungen zuverlässig und dauerhaftüberwachen lässt. Die Forschungsarbeiten führten dieSchool of Physics and Astronomy der Tel Aviv Universityund das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik(IPM) durch.
Analyse des Strahlungsspektrums
Die technischen Grundlagen hatte das IPM bereits im Vor-feld mit einem Breitbandspektrometer gelegt, dasursprünglich entwickelt wurde, um Deponie- und Sicker-wasser online überwachen und industrielle Prozesse kon-trollieren zu können. Das Analysegerät ist darauf ausge-legt, verschiedene organische Moleküle (z. B. Pestizide)nachzuweisen. Die Messmethode nutzt die Eigenschaftaller Stoffe, Infrarotstrahlen in einem spezifischen Spek-
Überwachung der Wasserqualität –Neue Messverfahren entwickelt
trum zu absorbieren. Mit der Infrarot-Spektroskopie ,einer technischen Analysemethode, lassen sich Stoffe überderen Infrarot-Absorptionsspektrum bestimmen. Die vonden Forschern verwendete Attenuated Total Reflection(ATR)-Spektroskopie baut auf einem optischen Systemauf. Das analysierte Strahlungsspektrum ermöglicht Aus-sagen über das Vorkommen und die Konzentration vonSchadstoffen. So lassen sich Wasserverschmutzungendurch die meisten schädlichen Chemikalien aufdeckenund die Daten ohne Zeitverzögerung über Funk an einezentrale Überwachungsstelle leiten.
Das Messsystem des eingesetzten Breitbandspektrometersbesteht aus drei Modulen: einer Lichtquelle, einem Sensor-element und einem Infrarot-Spektrometer. Das abge-
RESSOURCE WASSER | 2.5.06138
Schema der ATR-Technik

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | ÜBERWACHUNG DER WASSERQUALITÄT 139
strahlte Licht eines miniaturisierten Glühstrahlers wird in das ATR-Sensorelement geleitet, durchläuft die Mess-strecke und wird vom Spektrometer aufgenommen. Dieanschließende Spektrenanalyse ermittelt die einzelnen imWasser gelösten Stoffe und deren Konzentration.
Nachweis auch geringster Schadstoffkonzentrationen
Die ATR-Technik nutzt den Umstand, dass das Feld einer ineinem transparenten Material geführten Lichtwelle zumTeil in das sie umgebende Medium hineinragt. Diesessogenannte evaneszente Feld eignet sich für Absorptions-messungen. Als Sensor dient eine sensitive Faser: Wirddiese mit einem geeigneten Polymer beschichtet, reichertsich darin das gesuchte Molekül an und verstärkt dasMesssignal bis zum Tausendfachen. Zusätzlich schirmt daswasserabweisende Polymermaterial Wasser ab, das dieMessung stark stören würde. Ein bewegliches Gitterbewirkt, dass das Spektrometer Wellenlängen zwischen 8 und 12,5 Mikrometern messen kann. Andere Wellenlän-genbereiche lassen sich durch einen Austausch des Gitterseinstellen. Absorptionsmessungen im mittleren Infrarot-bereich ermöglichen es, organische Moleküle bis zu Kon-zentrationen unter 1 ppm aufzuspüren.
Zwei Messsysteme entwickelt
Im Verlauf des 2003 gestarteten, im Juni 2006 abgeschlos-senen Vorhabens entwickelte das deutsch-israelische Pro-jektteam zwei verschiedene Messsysteme auf Basis derATR-Technologie: ein größeres und empfindlicheres Gerät– welches allerdings teurer und nicht für den Feldeinsatzgeeignet ist, sowie ein handliches und preiswertes, das
eine geringere Nachweisempfindlichkeit hat. In einemAnschlussprojekt wurde der Fortschritt der Miniaturisie-rung kommerzieller Fourier-Transform-Infrarot (FTIR)-Spektrometer genutzt, um ein Messsystem mit nahezugleicher Nachweisempfindlichkeit wie die des teuren Pen-dants zu schaffen (siehe Foto). Die Projekte haben dieGrundlage für die Entwicklung von kompakten, verlässli-chen und leicht bedienbaren Messsystemen geschaffen.Die Systeme wurden in ersten Feldversuchen geprüft undhaben einen hohen Entwicklungsgrad. Weitere Feldein-sätze in der Bundesrepublik als auch in Israel sind geplant.
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik(IPM)Dr. Werner KonzHeidenhofstraße 879110 FreiburgTel.: 07 61/88 57-2 89Fax: 07 61/88 57-2 24E-Mail: [email protected]: www.ipm.fraunhofer.deFörderkennzeichen: 02WU0268
Tel Aviv UniversitySchool of Physics and AstronomyProf. Abraham KatzirRamat AvivPO Box 3904069978 Tel Aviv, IsraelTel.: 00 97 23/6 40 83 01Fax: 00 97 23/6 41 58 50E-Mail: [email protected]: www.tau.ac.ilFörderkennzeichen: FZK0201
Ein ATR- Messmodul zur Aufnahme der Infrarot-Absorptionsspektren(Die Sensorfaser befindet sich in der zylindrischen Messzelle, die vonder Wasserprobe, zugeführt über die beiden Wasseranschlüsse, durch-strömt wird.)

Bislang sind die Versuche, die Regenniederschläge inTrockengebieten durch menschliche Eingriffe gezieltzu erhöhen, nicht sehr erfolgreich – trotz langjähri-ger, weltweiter Forschungen. Wissenschaftlern ausDeutschland und Israel ist es in einem Projekt gelun-gen, sich diesem Ziel deutlich zu nähern: Ihre Simu-lationen zeigen, dass die Niederschläge zunehmen,wenn die Wolken mit geeigneten winzigen Teilchen„geimpft“ sind.
Israel ist einer der wasserärmsten Staaten der Welt. Den-noch ist Wasser der entscheidende Wirtschaftsfaktor desLandes: Israel hat eine hochproduktive Landwirtschaft, esist ein Obst- und Gemüse-Exportland. Rund 70 Prozent desverbrauchten Süßwassers dienen der Bewässerung in derLandwirtschaft, infolge des hohen Wasserbedarfs sinktkontinuierlich der Grundwasserspiegel. Der Jordan entwi-ckelt sich zu einem Rinnsal, weil 85 Prozent seines Was-sers für die Versorgung von Menschen und Landwirt-schaftsflächen genutzt werden. Dies hat Folgen für denWasserspiegel des Toten Meers (in das der Jordan mün-det): In den letzten 70 Jahren ist der Wasserspiegel bereitsum mehr als 20 Meter gesunken – Tendenz zunehmend.
Deutsch-israelische Wassertechnologie-Kooperation
Für Israel – wie den gesamten östlichen Mittelmeerraum –wäre es segensreich, ließe sich über dem Land die Nieder-schlagsmenge erhöhen. Und genau daran arbeiten Wis-senschaftler. Ein vom BMBF unterstütztes Forschungspro-jekt des Institute of Earth Sciences der Hebrew Universityin Jerusalem und des Instituts für Meteorologie und Kli-maforschung (IMK) des Karlsruher Instituts für Technolo-gie (KIT) hat den „Regenmachern“ deutlich geholfen: dasProjekt „Numerische Untersuchungen zum Einflussvon Aerosoleffekten auf die Niederschlagsdynamikvon Wolken in der israelischen Küstenregion“(Laufzeit: 2004 bis 2008), durchgeführt im Rahmen derdeutsch-israelischen Wassertechnologie-Kooperation.Computersimulierte Modellrechnungen zeigen, dass einekünstliche „Impfung“ der Wolken (englisch: Cloud See-ding) vor der israelischen Küste die Regengüsse soweitverzögert, dass bei Westwind vermehrt Niederschlag überdem Land fällt. Optimale Ergebnisse gibt es, wenn Koch-salz-(Meersalz-)Teilchen einer bestimmten Größe in dieWolken gestreut werden.
Regenmacher in Israel –Geimpfte Wolken erhöhen die Niederschläge
Im Mittelpunkt des Projekts standen Aerosolpartikel .Diese kleinen Schwebteilchen befinden sich überall in derLuft und sind die Voraussetzung dafür, dass sich Wolken-tropfen bilden und es zu Niederschlägen kommt: In mitWasserdampf übersättigter Luft wirken Aerosolpartikelals sogenannte Kondensationskerne, an die sich Wasser-dampf anlagert, wodurch Tropfen entstehen. Anzahl undGröße der Tropfen hängen von der Zusammensetzung derKondensationskerne ab. So enthält beispielsweise die Luftin Meeresnähe nur wenige, dafür große Salzpartikel – inden Wolken bilden sich wenige, aber große Tropfen. Luftüber dem Festland enthält hingegen viele Aerosolteil-chen, die Wolkentropfen sind relativ klein.
Das Projektteam hat festgestellt, dass auch vom Menschenfreigesetzte Aerosole die zeitliche Entwicklung, die räum-liche Verteilung und die Menge des Niederschlags starkbeeinflussen. Schon seit Jahren beobachten die Forschereinen Rückgang der Niederschläge im Bergland vonJudäa. Ihre Berechnungen legen nahe, dass dafür dieZunahme anthropogen erzeugter Schwebteilchen verant-wortlich ist (etwa Ruß, Staub).
RESSOURCE WASSER | 2.5.07140
Satellitenaufnahme der Region (Quelle: visibleearth.nasa.gov)

TECHNOLOGIE | INTERNATIONALES | REGENMACHER IN ISRAEL 141
Simulationsmodelle genutzt
Um die Wirkung der Aerosoleffekte auf die Niederschlags-bildung zu berechnen, nutzten die Wissenschaftler zweiverschiedene numerische Simulationsmodelle: das kom-plexe Computermodell „Spectral Bin Cloud MicrophysicalModule“ (SBM) der Hebrew University sowie das weiter-entwickelte Programm „Two-Moment Parameterization“(TMP) des Karlsruher IMK. Letzteres ist eine grobe (den-noch hinreichend genaue) Beschreibung, um den Rechen-aufwand zu reduzieren. Das deutsch-israelische Teamstellte die beiden Modelle zunächst mit der Vorhersagenatürlicher Wetterprozesse auf die Probe: Sie funktionier-ten gut, erbrachten zudem vergleichbare Ergebnisse.Anschließend berechneten sie Möglichkeiten, Nieder-schläge aktiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse zeigten, dasseine künstliche Impfung der Wolken, die sich vor der Küs-te bilden, die Niederschlagsbildung verzögert. Dadurchentwickelt sich der Regen langsamer und die mit demWestwind nach Osten verdrifteten Wolken regnen dannüber Land aus, meist in Küstennähe (mitunter um bis zu50 Kilometer landeinwärts).
Partikelgröße ist entscheidend
Entscheidend für die Niederschlagsentwicklung ist diePartikelgröße. Große hygroskopische Teilchen beschleu-nigen die Regenbildung, kleine verlangsamen sie und ver-mindern oft die Menge. Mittels Computersimulationenermittelten die Wissenschaftler die Teilchengröße, die beider Wolkenimpfung die Niederschlagsmenge am wir-kungsvollsten erhöht: Die optimale Größe liegt – abhän-
gig von Wolkenhöhe und anderen meteorologischenParametern – zwischen 1,8 und 2,5 Mikrometern. Bei Ver-wendung hygroskopischer Teilchen dieser Größe lässt sichdie Niederschlagsmenge, die über Land abregnet, um 20bis 25 Prozent erhöhen, während die Gesamtnieder-schlagsmenge leicht abnimmt.
Um die Modellrechungen mit den tatsächlichen Effektenin der Natur zu vergleichen, wurden in Israel einige Pra-xistests durchgeführt, bei denen von Flugzeugen aus Salz-teilchen mit der rechnerisch optimalen Größe in die Wol-ken gestreut wurden; die Beobachtungen bestätigten dietheoretischen Berechnungen größtenteils.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK)Prof. Dr. Klaus Dieter BehengKaiserstraße 1276128 KarlsruheTel.: 07 21/6 08-4 35 95Fax: 07 21/6 08-4 61 02E-Mail: [email protected]: www.imk-tro.kit.eduFörderkennzeichen: 02WT0536
Berechnete zeitliche Entwicklung der Regensumme „über Land“ beiImpfung mit hygroskopischen Partikeln. Durchgezogene Linie: Kon-trollrechnung ohne Impfung; gestrichelte Linie: Simulation mit Imp-fung durch Partikel mittlerer Größe
Berechnete zeitliche Entwicklung der Regensumme bei Impfung tieferKonvektionswolken mit hygroskopischen Partikeln optimaler Größe

Ein Vergleich von Desinfektionsverfahren in Abläu-fen von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagenin China hat gezeigt, dass es Alternativen zu derüblichen Chlorung gibt. Das Institut IWAR der Tech-nischen Universität Darmstadt hat in einem vomBMBF geförderten Kooperationsforschungsprojektgemeinsam mit der Tongji Universität, Shanghai(Laufzeit: August 2006 – März 2011) vier Verfahrengetestet.
Die Vielzahl hygienisch relevanter Mikroorganismen(Viren, Bakterien, Protozoen, Wurmeier), die im Abwasser– selbst nach einer biologischen Reinigung – vorhandensind, erfordert eine adäquate Behandlung des Abwassersvor dessen Einleitung in sensible Oberflächengewässer(insbesondere vor einer Wasserwiederverwendung). Inder Volksrepublik China ist die Desinfektion des Abwas-sers zwar gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch aus Kos-ten- und Betriebssicherheitsgründen häufig nicht durch-geführt (Xin, 2004).
Eine Alternative zu konventionellen Desinfektionsverfah-ren ist aus verschiedenen Gründen erforderlich. Bei dermeist verbreiteten Methode, der Chlorung, ist mit der Bil-dung von unerwünschten Desinfektionsnebenproduktenzu rechnen. Weitere Nachteile bei der Nutzung von Chlorund seinen Verbindungen bestehen aufgrund von Beden-ken hinsichtlich der Betriebssicherheit und der geringenWirksamkeit gegenüber chlorresistenten Organismen.Ziele des gemeinsamen Forschungsprojektes sind deshalbdie
Verbesserung der hygienischen Wasserqualität imAblauf kommunaler Kläranlagen zum Schutz vorKrankheiten, die durch Wasser übertragen werden;Erarbeitung eines wissenschaftlich abgesicherten Bei-trags zur Frage des kosteneffizienten Einsatzes vonwirksamen, innovativen Abwasserdesinfektionsver-fahren;Vermeidung neuer Risiken durch Minimierung vonDesinfektionsnebenprodukten.
Angewandte Methoden
Zu den Faktoren, die die Wahl der Desinfektionsmethodebeeinflussen, gehören Effektivität, Betriebssicherheit,Investitions- und Betriebskosten, Praktikabilität (Trans-port, Lagerung, Produktion etc.) sowie Entstehung uner-wünschter Nebenprodukte. Zu den, in einer dem Projektvorausgehenden Literaturstudie, ausgewählten und wäh-rend der Projektlaufzeit getesteten Verfahren gehören:
Vier Wege, ein Ziel –Desinfektion von Abwasser in China
UV-Strahlung: UV-Strahlen der Wellenlänge 245 – 265Nanometer verursachen Veränderungen der Nukleinsäu-ren im Zellkern, welche bei Überschreitung des Repara-turvermögens der Zelle zu einem irreversiblen Verlust derVermehrungsfähigkeit und damit zur Inaktivierung derZelle führen. Eine Zugabe von im Wasser verbleibendenDesinfizienzien entfällt bei dieser Desinfektionsmethode.Dadurch können negative Umwelt- und Gesundheitsein-wirkungen aber auch eine Depotwirkung im Ablaufwas-ser weitgehend ausgeschlossen werden. Das UV-Systembeinhaltet zwei austauschbare UV-Strahler von 80 und 120Watt. Über eine Steuerung lässt sich die gewünschteBestrahlungsdosis (von 80 – 800 J/m) einstellen.
Chlorelektrolyse: Die Chlorelektrolyseanlage stellt gasför-miges Chlor (Cl) und weitere elektrochemische Oxidan-tien aus Kochsalz, Wasser und elektrischem Strom vor Orther, sodass der Transport und die Lagerung von Chlor(gas)entfällt. Chlor bewirkt eine oxidative Zerstörung der Zell-wand der Mikroorganismen. Die maximale Dosiermengebeträgt 20 mg Cl2/l.
Chlordioxid: Die desinfizierende Wirkung von Chlordi-oxid beruht im Wesentlichen auf dessen extrem hohemOxidationspotential (etwa 2,5-mal höher als das von Chlor-gas). Bei der Abwasserdesinfektion mit Chlordioxid anstattmit Chlor(gas) ist die Gefahr der Entstehung umweltschäd-licher Verbindungen geringer, da keine Trihalogenmetha-ne (THM), Chlorphenole und Reaktionsprodukte mit Am-monium und Aminoverbindungen entstehen. Die Chlor-dioxiddosierung erfolgt in einem Bereich von 1-20 mg ClO2/l.Chlordioxid (ClO2) wird mittels des Chlorit-/Säure-Verfah-rens vor Ort aus Salzsäure und Natriumchlorit hergestellt.
RESSOURCE WASSER | 2.5.08142
Desinfektionspilotanlagen (rechts) mit verschiedenen Abwasservorbe-handlungsstufen (links); Zulauf = kommunales Rohabwasser

TECHNOLOGIE | HYGIENE UND GESUNDHEIT | DESINFEKTION VON ABWASSER IN CHINA 143
Ozon: Ozon (O3) ist eines der effektivsten Desinfektions-mittel. Das Ozon greift die Zellmembran direkt an oderpermeiert in das Zellinnere, wo es die DNA, RNA oderandere Zellbestandteile angreift und somit die Zelle inak-tiviert. Zusätzlich kann mit einer Abwasserozonung dieEntfernung von Arzneimittelrückständen, endokrin wirk-samen Stoffen sowie von Geruchs- und Farbstoffen erreichtwerden (Schuhmacher, 2006). Ozon wird vor Ort durcheinen Ozongenerator mittels elektrischer Entladungenaus industriell hergestelltem Sauerstoff erzeugt. Die über-tragene Ozondosis variiert von 2-20 mg O3/l.
Alle beschriebenen Verfahren (bis auf die Ozonung, dienur in Deutschland untersucht wurde) wurden mittelsidentischer halbtechnischer Versuchsanlagen auf einerkommunalen Kläranlage in Darmstadt-Eberstadt und inShanghai über den Zeitraum der Projektlaufzeit betriebenund untersucht.
Neben der Wahl des Desinfektionsverfahrens ist die Artder Vorbehandlung des Abwassers entscheidend – sowohlfür den Desinfektionserfolg als auch für das Potenzial derBildung von Nebenprodukten. Die Abschattung und derEinschluss von Mikroorganismen in Abwasserpartikelnbestimmen oft maßgeblich die Gesamtleistung eines Des-infektionssystems und die eventuell daraus entstehendenGesundheitsrisiken. Die Desinfektionsleistung wurde indiesem Projekt bewertet, indem Standardmethoden mikro-biologischer Kultivierungsverfahren zur Quantifizierungder Indikatororganismen E.coli, Gesamtcoliforme, Entero-kokken und somatische Coliphagen angewendet wurden.
Erzielte Ergebnisse
Sowohl durch die Mikrosiebung als auch Sandfiltrationlässt sich die CSB-Konzentration um rund 30 Prozent, dieUV-Absorption (bei 254 nm) um rund zehn, die Trübungum rund 80 Prozent reduzieren. Alle vier Desinfektions-verfahren waren während der Versuchsphasen I bis III(siehe Abbildung) in der Lage, die Indikatororganismenbis unter die Nachweisgrenze beziehungsweise um bis zuvier Zehnerpotenzen zu reduzieren (Bischoff, 2009). Eineerhöhte Toxizität des Abwassers, gemessen als hemmen-
der Effekt auf die Lumineszenz der Organismen Vibriofischeri, war hier nicht signifikant (Reihenfolge des Toxizi-tätsanstiegs: Cl2>O3>ClO2; UV-Strahlung: keine Erhöhung).
Neben der Dosierung der Desinfektionsmittel und denorganischen Abwasserinhaltsstoffen zeigte auch die Was-sertemperatur einen deutlichen Einfluss auf den Desinfek-tionserfolg. Phase IV wurde nach vier Wochen abgebro-chen, da nach zwei Wochen der zunehmende Biofilmbe-wuchs keinen stabilen Betrieb der Desinfektionsanlagenmehr zuließ. Eine Desinfektion von Abwasser, welches kei-nem biologischen Behandlungsprozess unterzogen wur-de, wird daher kritisch beurteilt. Die untersuchten Desin-fektionsverfahren mit vorhergehender biologischerAbwasserbehandlung erzeugten – je nach Dosierungder Desinfektionsmittel – ein Abwasser, das unbedenklichauch in sensible Oberflächengewässer eingeleitet werdenkann beziehungsweise für verschiedene Wiederverwen-dungszwecke sehr gut geeignet ist. Eine weiterführendedetaillierte Bewertung der Versuchsergebnisse ist demProjektabschlussbericht zu entnehmen.
Technische Universität DarmstadtInstitut IWARFachgebiet AbwassertechnikProf. Prof. Martin WagnerM.Sc. Astrid BischoffPetersenstraße 1364287 DarmstadtTel.: 0 61 51/16-37 59Fax: 0 61 51/16–37 58E-Mail: [email protected]@iwar.tu-darmstadt.deInternet: www.iwar.bauing.tu-darmstadt.deFörderkennzeichen: 02WA0764
Referenzen
Bischoff, A.; Cornel, P.; Wagner, M. (2010): Ozone,Chlorine Dioxide, UV-light and ElectrolyticallyProduced Chlorine Gas for Disinfection of TreatedWastewater – a Comparative Study with DifferentPreceding Treatment Techniques, Poster at: IWAWorld Water Congress and Exhibition, 19–24 Sep-tember 2010, Montréal, Canada.
Schuhmacher, J. (2006): Ozonung zur weitergehen-den Aufbereitung kommunaler Kläranlagenab-läufe; Dissertation; Technischen Universität Berlin
Xin, Z. (2004): Disinfection development the rise of UVin China. In: Water21; Oct. 2004.
Pilotanlage zur Abwasserdesinfektion (von links): UV-Strahlung, Chlor-elektrolyse, Chlordioxid, Ozon

144
Ökonomie und Bildung
RESSOURCE WASSER | 3.0
Eine barrierefreie Version des Artikels finden Sie unter der Adresse http://ressourcewasser.fona.de/reports/bmbf/annual/2010/nb/German/50/3_-oekonomie-und-bildung.html

145
Sauberes Trinkwasser und eine funktionierende Abwasserentsorgung sind hierzulande eine Selbst-verständlichkeit. Ein angepasstes und professionelles Management ermöglicht es, Kosten zu regulierenund gegebenenfalls zu reduzieren. Neben der Optimierung heimischer Konzepte fördert das BMBF inten-siv den Wissens- und Kompetenztransfer in Schwellen- und Entwicklungslänger: weltweit gilt es, Fach-kräfte auszubilden und den Menschen für den umweltverträglichen Umgang mit der Ressource Wasser zu sensibilisieren.
ÖKONOMIE UND BILDUNG

146 RESSOURCE WASSER | 3.1.0
Kommunale Wasser- und Abfallwirtschaft – Mit nachhaltigen Konzepten aus der Kostenfalle

147ÖKONOMIE UND BILDUNG | KOSTENSENKUNG
Die Kosten für Trinkwasser, Abwasser und die Müllabfuhr stellen mittlerweile einen Großteil derWohnnebenkosten. Verantwortungsbewusste Ver- und Entsorger suchen inzwischen Wege, ihreKunden zu entlasten und zudem bei Gewährleistunghöchster Qualität sparsamer zu wirtschaften. MitUnterstützung des Bundesministeriums für Bildungund Forschung (BMBF) haben einige von ihnen inPilotprojekten herausgefunden, dass mit Hilfe einesadaptiven Managements und der Nutzung optimierter Instrumente, wie z.B. Kennzahlen undBenchmarking, eine effiziente und nachhaltige Ver- und Entsorgung möglich ist. Schon kleine Maß-nahmen können hierbei viel bewirken.
Sauberes Trinkwasser und eine funktionierende Abwasser-und Abfallentsorgung sind in Deutschland eine Selbstver-ständlichkeit. Doch angesichts hoher Investitionen in denErhalt und Ausbau der Anlagen stehen viele Kommunenund ihre öffentlichen oder privaten Ver- und Entsorgungs-unternehmen unter ökonomischem Druck. Ein kostenbe-wusstes Management wird daher immer wichtiger.
Preis- und Gebührendiskussion nimmt zu
Um den Verbrauchern eine sichere Ver- und Entsorgungbieten zu können, hat die deutsche Wasser- und Abfall-wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten viel Geld in dieErweiterung und Modernisierung von Anlagen, Abwasser-kanälen und Wasserversorgungsnetzen gesteckt. DieseAusgaben müssen sich langfristig rechnen; gleichzeitig istdie Branche mit neuen Anforderungen konfrontiert: DiePreis- und Gebührendiskussion verschärft sich stetig,demografische und strukturelle Veränderungen erfor-dern in einigen Regionen einen kostspieligen Umbau desVer- und Entsorgungssystems. Und die Verbraucher ver-langen bezahlbare Preise und Gebühren – bei gleichblei-bend hoher Qualität.
Praxistaugliche Instrumente
Diesen Anforderungen kann die Abfall- und Wasserwirt-schaft nur gerecht werden, wenn sie nachhaltig plant undhandelt, also unter sozialen, ökologischen und ökonomi-schen Aspekten bestmöglich disponiert. Um hierfür praxistaugliche Konzepte zu entwickeln, müssen die ver-schiedenen Disziplinen der Forschung eng zusammen-arbeiten und weitere Experten einbeziehen. Transdiszipli-näres Arbeiten ist gefragt.
Es gilt, den Dialog zwischen Vertretern aus Politik, Wirt-schaft, Gesellschaft und Forschung zu intensivieren undgemeinsam Instrumentarien für die Praxis zu erarbeiten.Diese sollen es den Ver- und Entsorgern ermöglichen, dieFolgen ihres Handelns mit Blick auf die Nachhaltigkeitbesser zu beurteilen und geeignete Strategien zu entwi-ckeln. Maßnahmen, die sich in anderen Branchen bewährthaben, sind so anzupassen, dass sie auch in der Wasser-und Abfallwirtschaft zum Einsatz kommen können (Pro-jekte 3.1.01 und 3.1.02).
Professionelles Management schafft Kostenvorteile
Die vom BMBF geförderten transdisziplinären Projektehaben gezeigt: Ein professionelles Management trägt zueinem wirtschaftlicheren Arbeiten und damit auch zurfinanziellen Entlastung der Bürger bei. Den Verantwortli-chen in den Betrieben stehen dabei unterschiedlichsteMaßnahmen zur Verfügung: betriebswirtschaftlicheInstrumente wie Integrierte Managementsysteme (IMS),eine effektivere Steuerung von Prozessen mittels Kenn-zahlen, der systematische, unternehmensübergreifendeVergleich von Abläufen im Rahmen von Benchmarkingund der Einsatz ressourcenschonender Technologien undVerfahren.
Häufig führen schon kleine, einfache Veränderungen inbetrieblichen Abläufen wie beispielsweise flexiblereArbeitszeitmodelle zu erheblichen Einsparungen – unddies nicht nur in der Wasserwirtschaft: Auch Abfallentsor-ger können mit Instrumenten wie Benchmarking odereinem effektiven Controlling ihre Leistungsfähigkeit stär-ken (Projekt 3.1.03).

Mit seinem Beschluss „Nachhaltige Wasserwirt-schaft in Deutschland“ hat der Deutsche Bundestagim Jahr 2002 eine Modernisierungsstrategie für diedeutsche Wasserwirtschaft angeregt. Dazu gehörtauch die Entwicklung moderner Verfahren zum Leis-tungsvergleich zwischen Betrieben (Benchmarking).In seinem diesbezüglichen Projekt hat der Wasser-verband Emschergenossenschaft/Lippeverband(EG/LV) gemeinsam mit den Partnern Aggerverband,RINKE Unternehmensberatung und der Universitätder Bundeswehr München diese Methode auf dieAbwasserbehandlung übertragen und Strategien fürdie Anwendung in anderen Bereichen der Wasser-wirtschaft entworfen. Das Projekt ist damit zueinem Baustein der Modernisierungsstrategiegeworden und hat wesentliche Impulse für denerfolgreichen Ausbau des Instruments Benchmar-king gegeben.
Die Rahmenbedingungen für die Wasserwirtschaft habensich gewandelt: Die Anforderungen an ihre Wirtschaft-lichkeit sind gestiegen und Gebühren werden nur nochakzeptiert, wenn die zugrunde liegenden Kosten ausrei-chend dargelegt werden. Um ihre Aufgaben zuverlässigund wirtschaftlich wahrzunehmen, müssen Unterneh-men Methoden für die wirtschaftliche Abwasserbeseiti-gung erschließen, ohne die übrigen Anforderungen ausdem Blick zu verlieren. Das 1999 gestartete Projekt „Bench-marking in der Abwasserbeseitigung auf Basis tech-nisch-wirtschaftlicher Kennzahlensysteme“ des EG/LVzielte darauf ab, die betrieblichen Prozesse in Kläranlagenzu verbessern. Da Benchmarking in der Wasserwirtschaftzu dieser Zeit noch neu war, erforderte die Umsetzungeinige Entwicklungsarbeit. Eine besondere Herausforde-rung lag darin, technische Lösungen und ihre Kosten trotzunterschiedlicher Randbedingungen vergleichbar zumachen. Dazu mussten die Projektpartner normierteBeurteilungsmaßstäbe entwickeln. Sie verglichen mehr als100 Kläranlagen mit Einwohnerwerten (EW) von 420 bis2.400.000. Das Vorhaben bestand aus vier Arbeitsfeldern:
1. Die Methodik auf alle Anlagen übertragen Die Erkenntnisse aus einem Vorläuferprojekt zum Bench-marking für Kläranlagen mit 10.000 bis 100.000 EW wur-den auf alle Anlagen des EG/LV und des Aggerverbandsangewendet. Die Experten legten die zu ermittelndentechnischen und ökonomischen Kenngrößen fest, erho-ben die Daten, berechneten die Kennzahlen, analysiertendie Ursachen für Abweichungen vom Bestwert und identi-fizierten Verbesserungsmaßnahmen. Um den Prozess
Von den Besten lernen – Benchmarking in der Abwasserbeseitigung
„Abwasserreinigung“ zwischen mehreren Anlagen ver-gleichen zu können, wurden sechs Teilprozesse betrach-tet: mechanische, biologische und weitergehende Reini-gung, Schlammstabilisierung, Schlammverwertung und -entsorgung sowie Sonstiges (z. B. Außenanlagen, Laborund Werkstätten).
2. Strategien entwickeln, um andere Betreiber einzubeziehen
Den Experten gelang es, auch Betreiber weiterer Kläranla-gen mit anderer Datengrundlage in das Benchmarkingeinzubinden. Sie passten die Kenngrößen entsprechenddem Bedarf kleinerer und mittlerer Unternehmen an.
3. Technisch-ökonomische Beurteilungsansätze für Planungen generieren
Das Benchmarking bezieht sich nicht nur auf den Anla-genbetrieb, sondern auch auf die Planung. Dem EG/LV lie-gen für alle seine Bauwerke die Investitionskosten vor,aufgeteilt in die Kostenarten Bautechnik und Maschinen-/Elektrotechnik. Mithilfe der ermittelten Daten, könnendie Experten nun beurteilen, wie wirtschaftlich baulicheLösungen und verfahrenstechnische Kombinationen mitBlick auf Investitionskosten und Betriebsaufwand sind.
4. Die Methodik für andere Bereiche der Abwasserbeseitigung ausarbeiten
Die Projektpartner haben das Benchmarking auch aufandere Bereiche, wie die Abwasserableitung übertragen.Dazu entwickelten sie Erhebungsbögen, die sie ebenso
RESSOURCE WASSER | 3.1.01148
Arbeitsschritte des Benchmarkings
Arbeitsschritte Aktivitäten
I. Vorbereitung, Planung
II. Datenbeschaffung
• Festlegung des Teilnehmerkreises/ Benchmarking -Objekts
• Definition des Benchmarking-Objekts
• Datenerhebung • Datenaufbereitung • Plausibilitätsprüfung
• Kennzahlenvergleich • Bestimmung Benchmarks
• Ursachenanalyse • Potenzialermittlung • Maßnahmenplan
• Umsetzung
• Beschreibung des Benchmarking -Objekts
• Definition der Kennzahlen
III. Bestimmung Benchmarks
V. Integration
IV. Analyse
Arbeitsschritte des Benchmarkings

ÖKONOMIE UND BILDUNG | KOSTENSENKUNG | BENCHMARKING IN DER ABWASSERBESEITIGUNG 149
wie die Systematik mit weiteren Kommunen erprobten.Auch das Benchmarking von Regenüberlaufbecken undPumpwerken des Kanalnetzes wurde betrachtet.
Nutzen für die Praxis
Mit dem Vorhaben ist es gelungen, wesentliche Grundla-gen für ein Benchmarking in der Abwasserwirtschaft zuerarbeiten. Heute ist diese Methode weitverbreitet; mit ihrlassen sich die jährlichen Betriebskosten um drei bis zwölfProzent reduzieren. Und: Alle Größenklassen von Kläran-lagen können über ein technisch-wirtschaftliches Kenn-zahlenraster miteinander verglichen werden. Weil dasKennzahlensystem alle Teilprozesse der Abwasserbeseiti-gung einheitlich darstellt, lassen sich auch einzelne Ver-fahrensschritte vergleichen. So werden gezielte struktu-relle und auch punktuelle Verbesserungen möglich.
Die Experten haben die Systematik weiterentwickelt, umdie Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtliniewirtschaftlich umsetzen zu können. Die Ergebnisse desVorhabens wurden in die Benchmarking-Gesellschaftaquabench eingebracht. Gesellschafter sind neben derEmscher Wassertechnik GmbH und Aggerwasser GmbHdie Städte Hamburg, Bremen, Dresden, Zürich, Köln, Düs-seldorf, München und Berlin beziehungsweise ihre ent-sprechenden Unternehmen sowie die Beratungsgesell-schaft on.valco. Die aquabench bietet zahlreiche Bench-marking-Produkte online an, die sich auf verschiedeneProzesse beziehen oder einen Vergleich auf Unterneh-mensebene ermöglichen.
Die Ergebnisse des Förderprojekts ebenso wie die Erfah-rung aus den Folgeprojekten haben die Experten kontinu-ierlich in die Fachverbände eingebracht. Ein Merkblattund ein Leitfaden, herausgegeben von der Deutschen Ver-einigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall(DWA) und dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfa-ches (DVGW) sowie ein Beispielkennzahlensystem der
DWA unterstützen eine einheitliche, qualitätsgesicherteVorgehensweise. Außerdem informieren die Verbändeseit 2005 mit dem „Branchenbild der deutschen Wasser-wirtschaft“ Politik, Öffentlichkeit und Unternehmen überdie Leistungsfähigkeit der Branche. In fast allen Bundes-ländern werden inzwischen Benchmarking-Projektedurchgeführt und Berichte dazu veröffentlicht (z. B.www.abwasserbenchmarking-nrw.de).
Ziel ist, das Benchmarking weiter zu verbreiten und eineinternationale Kennzahlenbasis zu erarbeiten, welche dieErgebnisse verschiedener Projekte vergleichbar macht. ImSinne der Wasserrahmenrichtlinie muss außerdemgeprüft werden, wie der Betrachtungshorizont überUnternehmensgrenzen hinaus erweitert werden kann.Dieser Frage ist das Pilotprojekt „Benchmarking derBewirtschaftung von Fluss(teil)-einzugsgebieten “ vonEG/LV, aquabench, der Universität der Bundeswehr Mün-chen und der Universität Duisburg-Essen in einem erstenSchritt nachgegangen.
Projekt-Website www.aquabench.de
Emschergenossenschaft und LippeverbandProf. Dr.-Ing. Andreas SchulzKronprinzenstraße 2445128 EssenTel.: 02 01/10 4-27 23Fax: 02 01/10 4-27 86E-Mail: [email protected]: www.emschergenossenschaft.deFörderkennzeichen: 02WI9913/9
Methode und Kernelemente des Benchmarkings
Rahmendaten – Struktur und Technik
Wirtschaft-
lichkeitSicherheit Qualität
Kunden-
service
Nach-
haltigkeit
Merkmale zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines wasserwirt-schaftlichen Unternehmens

In der Wasserversorgung sind Qualität, Versorgungs-sicherheit, Kundenservice, Nachhaltigkeit und Wirt-schaftlichkeit wesentliche Zielgrößen. Um ihre Leis-tungsfähigkeit in diesen Bereichen zu steigern, setztdie Wasserwirtschaft verstärkt auf Kennzahlen – einbetriebswirtschaftliches Instrument, das die Indus-trie bereits erfolgreich nutzt. Das IWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung hat einKennzahlensystem erarbeitet, das sich mittlerweilezum Branchenstandard entwickelt hat. Es basiertauf einem Modell der International Water Associa-tion (IWA) und unterstützt die Prozessanalyse derWasserproduktion und die Betrachtung von Nach-haltigkeitsaspekten der Wasserversorgung.
Um alle Kostensenkungspotenziale auszuschöpfen undmögliche Optimierungspotenziale zu identifizieren,benötigen Unternehmen der Wasserwirtschaft einegeeignete Datenbasis. Immer mehr dieser Betriebe setzendeshalb auf Kennzahlensysteme, denn diese liefern belast-bare Informationen für unternehmerische Entscheidun-gen, lassen sich aber auch für Benchmarkings, also Ver-gleiche mit anderen Betrieben der Branche, nutzen. DerGeschäftsführung ist es damit möglich festzustellen, wiesich der Betrieb entwickelt hat, wo er mehr leistet alsWettbewerber und wo Verbesserungsbedarf besteht.
Ziel des vom IWW durchgeführten und vom BMBF geför-derten Projekts „Kennzahlen für die Wasserversor-gung: Feldtest des Kennzahlensystems der IWA“ wares, in Übereinstimmung mit den internationalen Stan-dards ein Kennzahlensystem für die deutsche Wasserwirt-schaft zu schaffen und erproben zu lassen. 14 Betriebeschlossen sich der Projektgruppe an und erklärten sichbereit, das System über drei Erhebungsperioden hinwegzu testen und weiterzuentwickeln.
Kennzahlensystem der IWA
Das Kennzahlensystem der IWA hat acht wesentlicheEigenschaften:
Alle Aufgaben eines Wasserversorgers sind enthalten,gegliedert nach den Bereichen Technik und Verwal-tung.Der hierarchische Aufbau des Systems erlaubt es, alleKennzahlen miteinander zu verknüpfen – von Haupt-über Teil- und Einzelaufgaben bis hin zu einzelnenProzessen, mit steigendem Detaillierungsgrad.
Mit Kennzahlen an die Spitze – Professionell Managen in der Wasserwirtschaft
Alle Begriffe, Ableitungen und Datenstrukturen (z. B.Finanzstruktur) sind eindeutig definiert.Im Datenmodell werden alle eingegebenen Informa-tionen daraufhin bewertet, wie zuverlässig und genausie sind.Je nach Nutzergruppe (z. B. Unternehmen, Behörden,Fachverbände, Banken) lassen sich das Kennzahlensys-tem und die Gewichtung der Kennzahlen flexibel anverschiedene Fragestellungen anpassen.Das System ist für die EDV-Bearbeitung konzipiert –eine zwingende Voraussetzung für den kontinuierli-chen Einsatz von Kennzahlen als Managementwerk-zeug. So tun sich Unternehmen leichter, wenn sieDatenvariablen erheben und Kennzahlenergebnisseberechnen und auswerten.Um die Verantwortlichen in den Betrieben beim Inter-pretieren der Kennzahlenergebnisse zu unterstützen,stellt das deutschsprachige IWA-Handbuch Kontextin-formationen zu Unternehmensstruktur (z. B. Größe,Rechtsform, Managementsysteme), Versorgungssys-tem (z. B. Schutzgebiete, Förderbrunnen, Wasserwer-ke, Rohrnetzdaten) und Versorgungsgebiet (z. B. Topo-grafie , Bodenbeschaffenheit) bereit.Den fünf Leistungsmerkmalen der Trinkwasserversor-gung – Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit derVersorgung, Kundenservice und Wirtschaftlichkeit –sind insgesamt 55 Kennzahlen und 19 Kontextinfor-mationen zugeordnet.
RESSOURCE WASSER | 3.1.02150
Von hochaggregierten Leistungskennzahlen zur Beurteilung desGesamtunternehmens bis hin zu detaillierten Prozesskennzahlen

ÖKONOMIE UND BILDUNG | KOSTENSENKUNG | PROFESSIONELL MANAGEN IN DER WASSERWIRTSCHAFT 151
Vielfältiger Nutzen
Kontinuierliche Kennzahlenanalysen und -vergleiche hel-fen nicht nur dabei, Schwachstellen im Unternehmen zuerkennen und zu beheben. Nach den Erfahrungen der amProjekt beteiligten Betriebe sind damit noch weitere Nut-zenaspekte verbunden:
Mit dem System gehen Aufbau und Pflege eines struk-turierten Datenmodells einher, das die Verhältnisseim Unternehmen widerspiegelt.Aufgaben, Arbeitsabläufe und Ergebnisse für alle Leis-tungsmerkmale werden transparent.Das System ermöglicht es, zielorientierte Vereinba-rungen mit den verantwortlichen Unternehmensbe-reichen zu treffen, was Kostenbewusstsein und Effi-zienz bei Erhaltung von Qualität und Sicherheit för-dert.Die Entscheidungsträger können besser beurteilen,wo Kooperationen mit externen Partnern (z. B. Versor-gungsunternehmen, Dienstleistern) sinnvoll sind, diebestimmte Leistungen gegebenenfalls effizienter undbesser erbringen können.Erbrachte Leistungen und behobene Defizite könnenfür die Öffentlichkeit transparent dargestellt werden.
Praxisnah und erfolgreich
Das praxisnahe und international kompatible IWW-Kenn-zahlensystem mit den spezifischen Erweiterungen erfährtmittlerweile eine hohe Akzeptanz in der Praxis und istBranchenstandard in der deutschen Wasserversorgung.In zahlreichen Benchmarking-Projekten im deutschspra-chigen Raum haben inzwischen mehr als 500 Wasserver-sorgungsunternehmen damit gearbeitet.
Auf Grundlage der verbreiteten Anwendung wurde dasIWA-System zum Schwerpunkt „Nachhaltigkeit der Was-serversorgung“ in einem gemeinsamen Folgevorhabendes IWW, des Instituts für sozial-ökologische Forschung(ISOE) und der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- undUmweltforschung (ARSU) erweitert. Im Rahmen einerdetaillierten Effizienz- und Leistungsuntersuchung derbetrieblichen Prozesse der Wasserproduktion war das Pro-jekt zudem Ausgangspunkt für „Entwicklung und Praxis-test von Prozesskennzahlen für die Wasserwirtschaft, -gewinnung und -aufbereitung“ durch das IWW und derTechnischen Universität Hamburg-Harburg.
Aus dem Projekt ist unter anderem folgende Veröffentli-chung hervorgegangen: „Kennzahlen für Benchmarkingin der Wasserversorgung. Handbuch zur erweitertendeutschen Fassung des IWA-Kennzahlensystems mit Defi-nitionen, Erklärungsfaktoren und Interpretationshilfen“(wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Was-ser mbH, Bonn 2005 – ISBN 3-89554-152-4)
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser-forschung gemeinnützige GmbHDr.-Ing. Wolf MerkelTechnischer GeschäftsführerMoritzstr. 2645476 Mülheim an der RuhrTel.: 02 08/4 03 03-0Fax: 02 08/4 03 03-80E-Mail: [email protected]: www.iww-online.deFörderkennzeichen: 02WT0224
Leitungen und Armaturen im Wasserwerk (Filterablauf und Spülwasserverteilung)
Brunnenstube und Turbine in einem Wasserwerk

Kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe sehen sichheute hohen Anforderungen und sich veränderndengesetzlichen Vorgaben und Richtlinien gegenüber.Neben den ökonomischen werden in den letztenJahren verstärkt auch ökologische Anforderungenan die Betriebe gestellt. Sie müssen strengeUmweltvorschriften einhalten und Abfälle sowieWertstoffe getrennt sammeln, verwerten und ent-sorgen. Die verantwortlichen Manager stehen nunvor der Aufgabe, ihre Betriebe so zu organisieren,dass sie trotz der teilweise komplexen Aufgabenfel-der produktiver und kostengünstiger arbeiten. Ineinem Forschungsprojekt haben Vertreter von 19Betrieben gemeinsam mit Experten Ansätze für eineeffizientere Abfallwirtschaft und Stadtreinigunganalysiert, auf Umsetzbarkeit geprüft und anschlie-ßend Empfehlungen erarbeitet.
Die Grundlage für das 1999 gestartete Projekt bildete einIdeenwettbewerb des BMBF zur Kostensenkung in derkommunalen Entsorgung. Ziel des Vorhabens „Kosten-senkung in der kommunalen Abfallentsorgung undStadtreinigung“ war es, allgemeine Empfehlungen abzu-leiten. Zum Projektteam zählten Vertreter von Entsorgungs-unternehmen aus Städten und Gemeinden unterschied-licher Größe in ganz Deutschland. Mit ihren verschiede-nen Betriebsformen – Regie-, Eigen- und gemischtwirt-schaftliche Betriebe sowie kommunale GmbHs – repräsen-tierten sie ein breites Spektrum. Fachlich unterstützt wurdedas Projekt von der INFA GmbH (Ahlen) als Gesamtkoordi-natorin, dem Institut für Umweltökonomie (IfU, Mainz),der uve GmbH (Berlin) und der intecus GmbH (Dresden).Fünf Arbeitsgruppen hatten die Aufgabe, jeweils für einender folgenden Bereiche Kostensenkungspotenziale zuermitteln: Entsorgungslogistik, Straßenreinigung, Betriebs-hof und Werkstatt, Kostenrechnung und Wirtschaftlich-keitssteuerung sowie Organisation und Verwaltung.
Der erste Schritt war eine Bestandsaufnahme in ausge-suchten Betrieben, bei der die Experten wichtige Leis-tungsdaten erhoben. In Absprache mit den Unternehmenuntersuchten sie neue Organisationsformen, Methodenund Techniken, von denen sie sich eine effizientereArbeitsweise versprachen. Auf Basis der dabei gemachtenErfahrungen erarbeitete das Projektteam eine Soll-Kon-zeption, stellte Soll-Ist-Vergleiche an und ermittelte Leis-tungskennziffern. Die Arbeitsgruppen identifizierten inden fünf Bereichen zum Teil erhebliche Einsparpotenziale,die sich in der Praxis auch auf andere Betriebe der Bran-che übertragen lassen.
Abfallentsorgung und Stadtreinigung – Kommunalunternehmen weiter optimieren
Entsorgungslogistik
Im Bereich der Entsorgungslogistik wurden verschiedeneMöglichkeiten im Hinblick auf Kostensenkungen undUmsetzbarkeit geprüft. Dazu zählten unter anderem dieeingesetzten Erfassungs- und Fahrzeugsysteme, Abfuhrin-tervalle, Art und Umfang der getrennten Sammlung, dieKonzeptionen der Tourenplanungen und die dafürgenutzten EDV-Programme, Personal- und Fahrzeugein-satzplanung, innerbetriebliche Arbeitsabläufe, betriebli-che Informationssysteme sowie neue Arbeitszeitmodelle.Das Projektteam identifizierte zahlreiche Einsparpoten-ziale. Dazu gehören je nach den örtlichen Voraussetzun-gen ein intelligent gesteuerter Fahrzeug- und Personal-einsatz per Tourenplanungssoftware, angepasste Abfuhr-intervalle, die Trennung von Abfallsammlung und-transport durch Wechselaufbautechnik, flexiblereArbeitszeitmodelle, ein verbessertes Dokumentations-und Managementinformationssystem als wirksames Con-trollinginstrument sowie eine intensivere Schulung desPersonals. Im Bereich der Entsorgungslogistik hatten viele
RESSOURCE WASSER | 3.1.03152
Geschäfts- und Kernprozesse
Unterstützungsprozesse
Personal- und Finanzprozesse
z.B. Personalentwick- lung und -betreuung
z.B. Betrieb der Kläranlage
z.B. Beschaffung von Material
z.B. Finanz- und Kostenrechnung
z.B. Instandhaltung der Kläranlage
z.B. Realisierung von übrigen Projekten
z.B. Informatik- betrieb
Führungsprozesse
z.B. Konzepte und Mehrjahresplanung
z.B. Kommunikation Unternehmen
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Abwasserableitung
Abwasserbehandlung
Abfallentsorgung
Gasversorgung
Stromversorgung
Straßenbau
Sichtweise
Prozessstruktur
sicherheit
Umwelt
Qualität
Risiko
Kosten Arbeits-
Prozessstrukturen im Unternehmen (aus: DWA-M 801, IntegriertesQualitäts- und Umweltmanagementsystem für Betreiber von Abwas-seranlagen, April 2005)

ÖKONOMIE UND BILDUNG | KOSTENSENKUNG | KOMMUNALUNTERNEHMEN WEITER OPTIMIEREN 153
Betriebe bereits vor dem Verbundvorhaben einen hohenEffizienzstandard erreicht, konnten jedoch auf Basis desProjekts nochmals Kostenreduzierungen von fünf bis 20Prozent realisieren.
Straßenreinigung
Auch bei der Straßenreinigung bestehen erhebliche Ein-sparpotenziale. Diese reichen von fünf bis 15 Prozent undwerden häufig dazu genutzt, die Qualität der Straßenrei-nigung zu erhöhen, da insbesondere die Stadtbildpflegemit dem Ziel einer sauberen Stadt in der Vergangenheiteinen größeren Stellenwert bekommen hat. Neben einembesseren struktur- und anforderungsbezogenen Einsatzder Fahrzeuge zählen dazu längere, effektivere Reini-gungszeiten sowie die enge Zusammenarbeit der manuel-len und maschinellen Reinigungssysteme. Auch die Einführung von Gruppensystemen, eine optimierte Rou-tenplanung und der unterstützende Einsatz von Kleinst-kehrmaschinen tragen dazu bei, Kosten zu senken.
Betriebshof und Werkstatt
Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe untersuchten insechs kommunalen Werkstätten, die Müll- und Straßen-reinigungsfahrzeuge betreuen, Werkstattaufbau, Auf-tragsannahme, betriebliche Arbeitsabläufe, Arbeitszeitre-gelungen, Kooperationen sowie die Bereiche Planung,Software und Controlling. Sie kamen unter anderem zudem Ergebnis, dass weniger Schnittstellen zwischen denComputerprogrammen für Zeiterfassung, Werkstattauf-tragsverwaltung, Rechnungsstellung und Lohnabrech-nung Einsparungen bei Zeit und Kosten ermöglichen. Alsbesonders wichtig für unternehmerische Entscheidungenerwies sich ein funktionierendes Controlling.
Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeit
Damit die Betriebe noch wirtschaftlicher arbeiten können,entwickelte diese Arbeitsgruppe ein Controlling-Systemmit Berichtswesen. Es ermöglicht den Mitarbeitern, Infor-mationen zu gewinnen, aufzubereiten und zu präsentie-ren, die dem Management Entscheidungen erleichtern.Dazu muss der Betrieb seine Leistungen kennen, erfassenund systematisieren. Aus diesem Grund haben die Teil-nehmerbetriebe in dem Projekt je einen Leistungskatalogerstellt. Dieser kann zusammen mit der beschriebenenKostengrundrechnung und der entwickelten Berichts-pyramide in ein integriertes Managementsystem eingehen.
Organisation und Verwaltung
Verwaltungsmitarbeiter sollten sich auf ihre Kerntätigkei-ten konzentrieren können. Deshalb empfehlen die Exper-ten der Arbeitsgruppe „Organisation und Verwaltung“ je
nach Betriebsgröße und örtlichen Voraussetzungen einServicecenter und ein Sekretariat einzurichten, einzelneLeistungsbereiche neu zu gliedern und die Beschaffungzu zentralisieren. Ein kommunaler Entsorger bekam Emp-fehlungen, wie er sein Callcenter verbessern kann. Einenanderen Betrieb unterstützte die Arbeitsgruppe dabei,eine passende Fuhrpark- und Werkstatt-Managementsoft-ware zu implementieren. Hinweise für eine effizientereAbfallwirtschaft gibt die 2006 veröffentlichte DStGB-Dokumentation Nr. 58 „Handlungsempfehlung zur Kos -tensenkung in der kommunalen Abfallentsorgung“ undfür eine effizientere Straßenreinigung die in 2007 veröf-fentlichte DStGB-Dokumentation Nr. 67 „Hand-lungsempfehlung zur Optimierung der kommunalenStraßenreinigung“. Die DStGB-Dokumentation Nr. 58 ist inder Verlagsbeilage des Deutschen Städte- und Gemein de-bunds „Stadt und Gemeinde INTERAKTIV“, Ausgabe4/2006 erschienen (http://www.dstgb.de/dstgb/DStGB-Dokumentationen/).
INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbHProf. Dr.-Ing. Klaus GellenbeckDr.-Ing. H.-J. Dornbusch Beckumer Straße 3659229 Ahlen/WestfalenTel.: 0 23 82/9 64-5 00Fax: 0 23 82/9 64-6 00E-Mail: [email protected]: www.infa.deFörderkennzeichen: 02WA0728
PDCA-Regelkreis (aus: DWA-M 801, April 2005)

RESSOURCE WASSER | 3.2.0154
Internationale Umweltbildung – Zukunft schaffen durch Wissen und Kooperation

ÖKONOMIE UND BILDUNG | INTERNATIONALE UMWELTBILDUNG 155
Viele der vom Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) geförderten Projekte zum Wasser-management haben einen starken Bezug zur Bil-dung. Es gilt, verschiedenen Zielgruppen Wissenüber neue oder bewährte Verfahren und Technikensowie wasserwirtschaftlich relevante Zusammen-hänge zu vermitteln, um sie dauerhaft für einenumweltverträglichen Umgang mit der RessourceWasser zu sensibilisieren. Die spezifische Weiterbil-dung der Kooperationspartner vor Ort ist ein weite-rer Aspekt: Sollen die im Ausland geförderten Pro-jekte nachhaltig wirken, müssen sie nach ihremAbschluss eigenständig fortgeführt werden.
Internationale Umweltbildung nur als Instrument desakuten Umweltschutzes zu verstehen, greift zu kurz: Sieist nämlich auch ein unverzichtbarer Beitrag zur Armuts-bekämpfung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Diegeförderten BMBF-Programme stehen somit im Kontextder Weltdekade der Vereinten Nationen „Bildung fürnachhaltige Entwicklung“ (2005 bis 2014).
Projekte mit einem starken Bildungsbezug schaffen zudemtragfähige Voraussetzungen für internationale Koopera-tionen in Regionen mit knappen Wasserressourcen, stär-ken mittelbar die Position der deutschen Wasserwirt-schaft und helfen so, neue Märkte zu erschließen. Nichtzuletzt verbessern sie das internationale Renommee desWissenschafts- und Technologiestandorts Deutschland.
Programme für einen weltweiten Erfahrungsaustausch
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung sind Diszipli-nen, die in hohem Maße auf eine permanente Weiterent-wicklung des theoretischen und praktischen Wissensangewiesen sind. Deutschland, das bereits auf viele JahreUmwelt- und Nachhaltigkeitsforschung zurückblickt,kann und muss sein umfangreiches technisches und planerisches Know-how weltweit vermitteln. So wurdebeispielsweise das Projekt „Einführung eines deutschenZusatzstudiengangs Umweltwissenschaften in China“ imJahr 2008 erfolgreich abgeschlossen. Ein weiteres Beispielist das im Rahmen der langjährigen Wassertech nologie-Kooperation zwischen dem BMBF und dem israe lischenWissenschafts- und Technologieministerium (MOST) 1999aufgelegte "Young Scientists Exchange Program" (YSEP),das junge Wissenschaftler zur Teilnahme an dieser Koop-eration motivieren soll. Das YSEP richtet sich vor allem anDiplomanden, Graduierte, Doktoranden und Post-Docs
und bietet Forschungsaufenthalte von bis zu 6 Monatenbei Partnerinstitutionen in Deutschland bzw. Israel an.Während der deutsch-israelischen Zusammenarbeit wur-den in den vergangenen Jahren zwischenzeitlich über 100For schungsprojekte durchgeführt. Das in Zusam menar-beit mit mehreren europäischen Hochschulen ent wick-elte Lehrmodul „Integrated Flood Risk Management“(FLOODmaster) spricht mit einer E-Learning-Komponenteauch Fachkräfte an, die ihr Wissen erweitern wollen (Pro-jekt 3.2.01).
Wissensvermittlung in Usbekistan
Wissensvermittlung spielt auch bei einem vom BMBFgeförderten Projekt in der zentralasiatischen RepublikUsbekistan eine tragende Rolle: Thema ist die „Ökonomi-sche und ökologische Umstrukturierung der Land- undWassernutzung in der Region Khorezm“. Khorezm ist amAralsee gelegen, der in den vergangenen Jahrzehnten bisheute nahezu vollständig verlandete, unter anderem inFolge intensiv betriebener Baumwollproduktion und desdamit verbundenen hohen Bewässerungsbedarf. InZusammenarbeit mit den usbekischen Partnern und Bau-ern vor Ort soll die umweltverträgliche Landwirtschaft inder Region gefördert und die Menschen in Khorezm dabeiunterstützt werden, Maßnahmen selbst umzusetzen. Umdies zu ermöglichen, werden regelmäßige Schulungen fürLandwirte und Techniker im Wasserbereich durchgeführtsowie geeignete Organisations- und Kommunikationsin-strumente entwickelt. Das Vorhaben unterstützt auch dieAusbildung usbekischer Studenten (Projekt 3.2.02).
Internationales Stipendienprogramm
Unter dem Titel „Internationale Aufbaustudiengänge imWasserfach“ – kurz IPSWaT (International PostgraduateStudies in Water Technologies) – hat das BMBF im Jahr2001 ein Programm für Stipendien aufgelegt. Mit Stipen-dien für Master-Studiengänge (M.Sc.) und Promotionen(Ph.D) unterstützt es junge, besonders qualifizierte Wis-senschaftler aus dem In- und Ausland bei Forschungsar-beiten zum integrierten, nachhaltigen Wassermanage-ment. Mit der Vergabe dieser Stipendien will das BMBFden internationalen Wissens- und Technologietransfer imWassermanagement verbessern und künftige Entschei-dungsträger in Entwicklungs- und Schwellenländernunterstützen. Gleichzeitig werden so auch die Grundla-gen gelegt, aus denen sich spätere wissenschaftliche wiewirtschaftliche Kooperationen ergeben (Projekt 3.2.03).

Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung sindDisziplinen, die in hohem Maße auf eine permanen-te Weiterentwicklung des theoretischen und prakti-schen Wissens angewiesen sind. Deutschland, dasbereits auf viele Jahre Umwelt- und Nachhaltigkeits-forschung zurückblickt, kann und muss sein umfang-reiches technisches und planerisches Know-howweltweit vermitteln. Denn der Erhalt der Lebens-grundlagen und der Schutz der Menschen vor Natur-gefahren dürfen an nationalen Grenzen nicht halt-machen. Drei Beispiele aus dem Bereich der Wasser-wirtschaft zeigen, welche Möglichkeiten es gibt,Wissen an junge Wissenschaftler aus aller Welt wei-terzugeben.
Deutsche Umweltexperten lehren in China
Die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschlandbei Bildung und Forschung hat in den vergangenen Jah-ren deutlich zugenommen. So wurde China zu einemwichtigen Partner der Bundesrepublik – sowohl gemessenan der Projektzahl als auch am Finanzvolumen. Dabei ste-hen vor allem zwei Ziele im Vordergrund: Zum einen gehtes darum, mit dem Know-how deutscher Experten die Ent-wicklung des Umweltschutzes in China voranzubringen.Zum anderen soll der Transfer von umweltbezogenemWissen deutsche Standards, Umwelttechnologien und -kenntnisse in China bekannt machen und deutschenUnternehmen den Weg speziell für den chinesischenMarkt ebnen.
Als eine wichtige Maßnahme des Wissenstransfers wurdeim Januar 2003 das Projekt „Einführung eines deutschenZusatzstudiengangs Umweltwissenschaften in China“gestartet. Künftige Entscheidungsträger und Fachleuteaus Wirtschaft, Industrie und Verwaltung, die einenBachelor-Abschluss vorweisen, sowie Master-Studentenerfahren darin eine auf deutsche Technologien und Nor-men zugeschnittene fachliche Vertiefung. Bausteine desZusatzstudiums Umweltwissenschaften des Instituts fürSiedlungswasserwirtschaft (ISA) der Rheinisch-Westfäli-schen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen wurdenin Master-Studiengänge zweier chinesischer Universitäteneingeführt. Deutsche Lehrende bieten dort Vorlesungsrei-hen zur Wasserwirtschaft und Abfallentsorgung an. Die15 jahrgangsbesten Studierenden aus China werden zumAbschluss der Vorlesungsreihen nach Deutschland einge-laden, um beispielhafte deutsche Wassertechnologienund unsere wasserwirtschaftlichen Strukturen kennenzu-lernen.
Lernen aus der Erfahrung Anderer –Fortschritt durch weltweiten Wissensaustausch
Austauschprogramm für deutsche und israelische Jungwissenschaftler
Seit 1974 besteht die Wassertechnologie-Kooperation zwi-schen dem BMBF und dem israelischen Wissenschafts-und Technologieministerium (MOST), in deren Rahmenbisher über 125 Forschungsprojekte durchgeführt wurden.Im Jahr 1999 wurde die Kooperation um das „Young Scien-tists Exchange Program“ (YSEP) ergänzt. Ziel ist es, jungeWissenschaftler zur Teilnahme an der deutsch-israelischenKooperation im Bereich Wassertechnologie zu motivieren.
Inzwischen ist das Jungwissenschaftler-Austauschpro-gramm YSEP eine der tragenden Säulen der deutsch-israelischen Wassertechnologie-Kooperation geworden.Es richtet sich vor allem an Diplomanden, Graduierte,Doktoranden und Post-Docs und umfasst Forschungsauf-enthalte von jeweils bis zu sechs Monaten bei Partnerinsti-tutionen in Deutschland und Israel. Insgesamt haben bis Ende 2011 70 Jungwissenschaftler (35 Israeli, 35 Deut-sche) am Programm teilgenommen. Erfreulich ist diehohe Frauenquote von 50 Prozent.
RESSOURCE WASSER | 3.2.01156
ISA-Mitarbeiter im Einsatz an der Pekinger Tsinghua-Universität
Probebohrung für einen Brunnen in der Judäischen Bergwüste nahedes Toten Meers im Rahmen eines Forschungsprojekts

ÖKONOMIE UND BILDUNG | INTERNATIONALE UMWELTBILDUNG | FORTSCHRITT DURCH WELTWEITEN WISSENSAUSTAUSCH 157
Internationales Lehrmodul Hochwassermanagement
Extreme Hochwasserereignisse machen immer wieder dieNotwendigkeit eines umfassenden Risikomanagements –in Deutschland und international – deutlich. Fachgebiets-übergreifende Analysen der komplexen Hochwasserrisi-ken und die Abschätzung von Steuerungsmöglichkeitenstellen Forschung und Praxis vor erhebliche Herausforde-rungen. Die Hochschulausbildung kann durch ein geeig-netes Lehrangebot zu einem ganzheitlicheren Problem-verständnis junger Wissenschaftler und Experten beitragen.Dazu gehören einerseits die Zusammenhänge zwischen denhydro-meteorologischen Ursachen von Hochwasser undder sozialen, ökonomischen und ökologischen Vulnerabi-lität . Andererseits geht es um die Wirksamkeit von Vor-sorgemaßnahmen und dem Katastrophenmanagement.
Dieses Ziel verfolgt das internationale Lehrmodul „Inte-grated Flood Risk Management“ (FLOODmaster), das ander Technischen Universität Dresden im Rahmen des Mas-ter-Programms Hydro Science and Engineering durchge-führt wird. Das internationale, englischsprachige Pro-gramm verknüpft natur- und ingenieurwissenschaftlicheGrundlagen mit wirtschafts-, sozial- und planungswissen-schaftlichen Erkenntnissen. Zielgruppen sind neben denMaster-Studenten auch Studierende höherer Fachsemes-ter sowie Graduierte. Eine spezielle E-Learning-Kompo-nente spricht zudem auch Experten an, die ihr Wissenerweitern wollen. Für das Direkt- und Fernstudium wer-den Lehrmaterialien im Internet bereitgestellt.
Das Studienkonzept besteht aus folgenden Komponenten: Zwei Ringvorlesungen zu den Themen „Prozesseextremer Hochwasserrisiken“ sowie „IntegriertesHochwasserrisikomanagement“. Drei Fokus-Workshops thematisieren die wichtigstenFluttypen; ein Akteurs-Workshop, bei dem Entschei-dungsträger aus der Praxis einbezogen werden,behandelt Konflikte bei der Entwicklung von Manage-mentstrategien. Eine mehrtägige Exkursion in ein hochwassergefähr-detes Gebiet in Europa behandelt unter anderemtransnationale Fragen. Eine Studienarbeit zu einem konkreten Untersu-chungsobjekt führt die theoretischen und methodi-schen Grundlagen aus den einzelnen Veranstaltungenzusammen.
Das Modul wurde in enger Zusammenarbeit mit mehre-ren europäischen Hochschulen sowie Wissenschaftlernnationaler und internationaler Forschungsvorhaben ent-wickelt und von einem wissenschaftlichen Beirat beglei-tet. Das Vorhaben ist aus der BMBF-Förderaktivität RIMAX(Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse) in
Kooperation mit dem EU-Forschungsprojekt FLOODsite(Integrated Flood Risk Analysis and Management Metho-dologies) entstanden. Heute ist diese universitäre Ausbil-dung als Doppelmodul Flood Risk Management Teil desinternationalen Masterkurses Hydro Science and Enginee-ring an der TU Dresden und damit ein Beispiel für dieerfolgreiche Überführung eines BMBF-geförderten Vorha-bens in die Praxis.
ChinaRheinisch-Westfälische Technische HochschuleAachenProf. Dr. Max DohmannTemplergraben 5552056 AachenTel.: 02 41/80-2 66 24 (Sekretariat)Fax: 02 41/87 09 24E-Mail: [email protected]: www.fiw.rwth-aachen.deFörderkennzeichen: 02WA0418
IsraelPTKA-WTE Forschungszentrum KarlsruheDr. Hans Joachim MetzgerPostfach 364076021 KarlsruheTel.: 0 721/60 82 23 55Fax: 0 721/60 89 22 35 5E-Mail: [email protected]: www.ptka.kit.edu/wteFörderkennzeichen: KII1101-YSEP
InternationalTU DresdenInstitut für Hydrologie und MeteorologieProf. Dr. Christian Bernhofer01062 DresdenTel.: 03 51/4 63-3 13 40Fax: 03 51/4 63-3 13 02E-Mail: [email protected]: www.floodmaster.deFörderkennzeichen: 0330680
Studenten beim Abschätzen des Hochwasserrisikos entlang der Elbeim Rahmen des River Flood Workshops in Dresden

Die ineffiziente und umweltschädigende Nutzungvon Böden und Gewässern stoppen, gleichzeitig dieArmut der Menschen lindern: Das sind Ziele einesdeutsch-usbekischen Projekts am Aralsee. Der Hand-lungsbedarf ist hier besonders groß, denn die jahr-zehntelang intensiv betriebene Agrarwirtschaft inder Region (Baumwollanbau) hat dazu geführt, dassder Aralsee zunehmend verlandet. Gleichzeitig giltes, den Landwirten das Wissen zu vermitteln, wie siemit ökologisch nachhaltigen Bewirtschaftungswei-sen ihre Einkommenssituation verbessern können.
Der bisher praktizierte Bewässerungslandbau in Zentral-asien verringert die Produktivität der Land- und Wasser-ressourcen, die Armut der Bevölkerung wächst – ursäch-lich dafür sind die Ineffizienz und fehlende Nachhaltig-keit der Ressourcennutzung. Dies gilt vor allem für diebewässerten Tiefländer des Aralseebeckens in Usbekistan(etwa 27 Mio. Einwohner): Hier hat die intensiv betriebeneBaumwollproduktion schwerwiegende ökologische Fol-gen für die Böden und Gewässer.
Damit sich diese Abwärtsspirale nicht weiter dreht, müss-ten die Usbeken stärker marktwirtschaftlich arbeiten dür-fen. Denn die Bauern – sie stellen über 70 Prozent der Ein-wohner – schützen ihre Ressourcen am ehesten dann,wenn sie so höhere Einkommen erzielen können. Doch siehaben ungenügende Erfahrung in der privaten Landwirt-schaft, weil sie erst seit kurzem selbständige Unternehmersind; ihre wirtschaftlichen Spielräume sind noch gering:Sie unterliegen weiterhin einer strengen Kontrolle durchdie Zentralregierung und sind an deren Pläne gebunden.Ihnen lediglich zu zeigen, wie nachhaltige Landnutzungfunktioniert, ist deshalb nicht ausreichend. Ebenso wich-tig ist es, die Entscheidungsstrukturen vor Ort zu verste-hen und die Interessen der verschiedenen Entscheidungs-träger zu berücksichtigen.
Konzepte für den Bewässerungslandbau
Um die Ressourcennutzung am Aralsee nachhaltig zu ver-bessern, führt das Zentrum für Entwicklungsforschung(ZEF), ein interdisziplinäres Forschungsinstitut an der Uni-versität Bonn, zusammen mit der UNESCO und der Regie-rung Usbekistans das Forschungsprojekt „Ökonomischeund ökologische Umstrukturierung der Land- undWassernutzung in der Region Khorezm“ durch (Lauf-zeit: 2002 bis 2012). Involviert sind ferner Institute ausDeutschland und Usbekistan sowie weiteren Ländern.
Neue Perspektiven eröffnen –Nachhaltigkeit in Usbekistan
Die Experten verschiedener Disziplinen (Landnutzung,Agrarwissenschaften, Wasserwirtschaft, Wirtschafts- undSozialwissenschaften) entwickeln Konzepte für die ökolo-gisch nachhaltige, ökonomisch effiziente Ressourcennut-zung im Aralseebecken. Als Modellregion für das vomBMBF finanzierte Projekt dient die Provinz Khorezm inUsbekistan, sie liegt südlich des Aralsees, am Unterlauf desAmu Darya. Wichtigster lokaler Partner ist die Staatsuni-versität Urgench; an ihr wurde für das Vorhaben einmodernes Laborgebäude aufgebaut und ausgestattet.
Ein wichtiger Baustein des Projekts ist, die Verantwortli-chen vor Ort dabei zu unterstützen, die Maßnahmenselbst umzusetzen. Die Wissenschaftler interessieren sichdeshalb sehr für die lokalen Entscheidungsprozesse,damit sie – unter Einbezug der Entscheidungsträger vorOrt – Vorschläge ausarbeiten können, wie sich Landbauund Wasserwirtschaft besser organisieren lassen.Betriebswirtschaftliche und makroökonomische Untersu-chungen im Agrarbereich, die sich über die gesamte Pro-duktionskette erstrecken, sollen Potenziale für eine effi-zientere Ressourcenbewirtschaftung und verbesserteWertschöpfung aufzeigen. Gleichzeitig werden neueTechniken der Landnutzung erprobt. Das Vorhaben unter-stützt die akademische Ausbildung usbekischer Studen-ten: So werden viele Studenten zu einem Master-Studien-gang in Taschkent entsandt, 22 Doktoranden haben bisheram ZEF in Bonn promoviert (viele von ihnen haben einePosition in Zentralasien gefunden oder übernehmen alsPost-Doktoranten im Projekt eine größere Verantwortungfür die Wissensvermittlung).
RESSOURCE WASSER | 3.2.02158
Ein Schiffsfriedhof auf bereits verlandetem Boden des Aralsees

ÖKONOMIE UND BILDUNG | INTERNATIONALE UMWELTBILDUNG | NACHHALTIGKEIT IN USBEKISTAN 159
Partizipativer Ansatz
Über den Erfolg technologischer Innovationen entschei-det auch die Partizipation: Bedürfnisse und Erwartungender Partner sind aufzugreifen, technische und institutio-nelle Veränderungen sind den lokalen Gegebenheitenanzupassen. Die enge Zusammenarbeit mit den usbeki-schen Partnern verbessert maßgeblich die Akzeptanz vorOrt. Ebenso wichtig sind regelmäßige Schulungen vonLandwirten und Technikern im Wasserbereich, ferner dieEntwicklung von geeigneten Organisations- und Kommu-nikationsinstrumenten. Hier kooperiert das Projekt mitdeutschen, usbekischen und internationalen Organisatio-nen für die technische Zusammenarbeit.
Eine wichtige Hilfe sind die im Projekt erstellten interdis-ziplinären Modelle für die Wasser- und Landnutzung, dieökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte aufgrei-fen. Sie helfen, das Zusammenspiel der verschiedenenFaktoren und Akteure zu untersuchen, um die Langzeit-wirkung von Maßnahmen vorherzusagen. Gleichzeitig sol-len Kosten-Nutzen-Rechnungen finanzielle Vorteile ein-zelner Technologien aufzeigen, die den lokalen Entschei-dungsträgern helfen, geeignete Maßnahmen zu treffen.
Vier Projektphasen
Das über zehn Jahre laufende Projekt verläuft in vier Pha-sen. Die erste Phase galt dem Aufbau der Infrastruktur vorOrt und dem Erstellen der erforderlichen Datenbasis (z. B.digitale Karten), aus bereits existierendem Material sowieeigenen Forschungen.
Aufbauend auf intensiven Felduntersuchungen undModellentwicklungen wurden in der zweiten PhaseOptionen für das künftige Ressourcenmanagement ent-wickelt. Hier handelt es sich um neue, bodenschonendeAnbauverfahren, optimierte Bewässerungsstrategien und-techniken sowie die Einführung alternativer Anbaupflan-zen und Baumarten, die sowohl ökologisch vorteilhaftersind als auch das Einkommen der Bauern erhöhen.
Diese Konzepte testeten die Projektteilnehmer in der drit-ten Phase in enger Zusammenarbeit mit Bauern, Vertre-tern der Wasserbehörden und den Partnerinstitutionen inder Region Khorezm. Phase 4 (2012) dient der Umsetzung,in der die Wissenschaftler gemeinsam mit usbekischenPartnern ihr Restrukturierungskonzept großflächig wei-ter ausweiten wollen. Ziel ist es, eine nachhaltige Lösungumzusetzen, die der Region eine ökologisch, ökonomischund sozial tragfähige Zukunft ermöglicht.
Universität BonnZentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)Prof. Dr. Paul L. G. VlekDr. John P. A. LamersWalter-Flex-Straße 353113 BonnTel.: 02 28/73-18 38Fax: 02 28/73-18 89E-Mail: [email protected]: www.zef.de/khorezm.O.htmlFörderkennzeichen: 0339970A, 0339970C
Aufforstung einer degradierten Fläche Ein Bewässerungskanal mit Verteilungsbauwerk

Das BMBF-Stipendienprogramm „Internationale Aufbaustudiengänge im Wasserfach“ – englischeBezeichnung „IPSWaT – International PostgraduateStudies in Water Technologies“ – setzt eine Hand-lungsempfehlung des „Aktionskonzepts: Nachhaltigeund wettbewerbsfähige deutsche Wasserwirt-schaft“ aus dem Jahr 2000 um. Ziel des Stipendien-programms ist es, besonders qualifizierte Nachwuchs-wissenschaftler zu fördern, den internationalen Wissenstransfer zu unterstützen und langfristigeKontakte in Wissenschaft, Wasserwirtschaft undEntwicklungszusammenarbeit anzubahnen.
Mit IPSWaT unterstützt das Bundesministerium für Bil-dung und Forschung seit 2001 hervorragend qualifiziertedeutsche und ausländische Studenten und Nachwuchs-wissenschaftler mit Stipendien für international ausge-richtete Master-Studiengänge in englischer Sprache undfür Promotionen an deutschen Hochschulen. Die Vergabevon Stipendien soll im Sinne des Capacity Building deninternationalen Wissens- und Technologietransfer imWassermanagement verbessern und künftige Entschei-dungsträger besonders in Entwicklungs- und Schwellen-ländern unterstützen. Nicht zuletzt soll damit auch eineGrundlage für spätere Kooperationen gelegt werden.
Stipendien sind möglich für Master-Studiengänge (M.Sc.)und Promotionen (Ph.D). Jährlich werden in zwei Aus-wahlrunden jeweils rund 35 M.Sc.- und Ph.D.-Stipendienvergeben. Die Kandidaten sollten sich vorzugsweise miteinem heimat- oder regionalbezogenen, problemlösungs-orientierten Thema sowie einem integrierten methodi-schen Ansatz bewerben. Dabei soll das Vorhaben einerelevante Fragestellung in einem bi- oder multilateralenForschungskontext bearbeiten. Besonders gefördert wer-den solche Stipendiaten, die Forschungsarbeiten unterdem Aspekt des integrierten, nachhaltigen Wassermana-gements unter Einbezug der wirtschaftlichen Wertschöp-fung anstreben. Kandidaten müssen je nach Vorhabeneinen erfolgreichen Bachelor- oder Masterabschluss vor-weisen. Mit dem Stipendium studieren die Master-Stipen-diaten zwei Jahre lang in einem der derzeit 20 akkreditier-ten deutschen Studiengänge. Ausgewählte Promotions-vorhaben werden für drei Jahre gefördert und können anjeder deutschen Hochschule durchgeführt werden.
Internationales Stipendienprogramm –Wissenstransfer und Kontaktaufbau
Gutachter bewerten Bewerbungen
Zweimal pro Jahr (April und November) findet eine Gut-achterrunde zur Beurteilung der eingegangenen Bewer-bungen statt. Nach Auswahl der Kandidaten durch diesesexterne, unabhängige Expertengremium werden dieHochschulen durch das Internationale Büro des BMBFvom Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Bei der Auswahl derKandidaten steht an erster Stelle die hervorragende, aka-demische Qualifikation der Bewerber. Weitere Aspektebei der Auswahl sind:
Potenzial zur Einbindung in bilaterale wissenschaftli-che, wirtschaftliche oder entwicklungspolitischeKooperationenAnwendungsbezug und Übertragbarkeit der geplan-ten ForschungsarbeitInstitutionelle Verknüpfung zu Herkunfts- und/oderPartnerländernRelevanz des Forschungsvorhabens für ein Integrier-tes Wasserressourcen-Management
Leistungsumfang
IPSWaT-Stipendiaten erhalten neben dem monatlichenGrundbetrag (und eventuell einem Familienzuschlag)Erstattungen für An- und Abreisekosten vom Heimatortzum Studienort in Deutschland, einen Deutschkurs zuBeginn des Stipendiums, eine Kranken-, Unfall- und Haft-pflichtversicherung während des Aufenthalts in Deutsch-land, Studiengebühren für das erste Semester, eventuelleAuslandsaufenthalte im Rahmen der Forschungsarbeit,
RESSOURCE WASSER | 3.2.03160
Zahlreiche Universitäten und Technische Hochschulen haben sich fürIPSWaT akkreditieren lassen (Quelle: IPSWaT-Broschüre)

ÖKONOMIE UND BILDUNG | INTERNATIONALE UMWELTBILDUNG | INTERNATIONALES STIPENDIENPROGRAMM 161
einmaliges Startgeld sowie eine monatliche Gratifikationals Forschungsbeihilfe. Während ihres Studiums bekom-men die Stipendiaten auch die Teilnahme an relevanten,internationalen Konferenzen, Fortbildungen und Messen,ihre Feldforschung im Ausland und gegebenenfalls bis zudreimonatige Praktika in einem deutschen Unternehmender Wassertechnologie oder einem Wasserversorgerbezahlt. Nicht übernommen werden: Versicherung undReisekosten für Familienangehörige sowie mehrfache An- und Rückreisen der Stipendiaten.
Netzwerke entstehen
Mehr als 350 Stipendiaten aus 60 Ländern hat das BMBFseit Start des Programms gefördert. Ein zentrales Elementvon IPSWaT ist der Aufbau von Netzwerken sowohl der Sti-pendiaten und Alumni untereinander als auch mit deut-schen Partnerorganisationen aus der Wasserwirtschaft,Forschung und Entwicklungszusammenarbeit (z. B. mitden BMBF-Programmen IWRM und IWAS oder den Insti-tutionen DAAD, DED, GIZ, InWEnt, KfW). Ein bewährtesinternes und externes Vernetzungsinstrument sind diejährlichen Stipendiatentreffen. Dort bekommen die Sti-pendiaten Gelegenheit, sowohl ihre Forschungsarbeitenuntereinander vorzustellen als auch mit relevanten Stake-holdern deutscher Wasserinstitutionen aus Wirtschaft,Wissenschaft und EZ Kontakt aufzunehmen.
Derzeitige Laufzeit des Programms ist bis Ende 2014.
Projekt-Website www.ipswat.de
Internationales Büro des BMBFDeutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V.(DLR)Internationale Aufbaustudien im Wasserfach (IPSWaT)
Cornelia ParisiusHeinrich-Konen-Straße 153227 BonnTel.: 02 28/38 21-4 22Fax: 02 28/38 21-4 44E-Mail: [email protected]
IPSWaT-Stipendiatentreffen (Kleingruppe), Leipzig, Juli 2010 Eine Postersession beim IPSWaT-Stipendiatentreffen in Stuttgart, Juli2009

Abbauprodukt cDCE: Die Formel steht für cis-1,2-Dichlor-ethen. Es entsteht beim Abbau von Tetrachlorethen (PCE)und Trichlorethen (TCE). Beide Stoffe zählen zu den leicht-flüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen ( LCKW).
Abwasserteiche: Kleine Teiche, in denen Pflanzen dasAbwasser biologisch reinigen.
Adsorption: Das Anreichern von Stoffen aus Gasen oderFlüssigkeiten an der Oberfläche eines Festkörpers.
Aerob: Zustand in Anwesenheit von Sauerstoff (O2). AuchBezeichnung der Lebensweise von Organismen, die zumLeben elementaren Sauerstoff benötigen, oder von chemi-schen Reaktionen, die nur unter Sauerstoffzufuhr möglichsind.
Aerobe Abbauvorgänge: Abbau von Mikroorganismenmit Hilfe von Sauerstoff.
Aerobe und anaerobe Abwasserbehandlung: Vgl. Bio-logische Abwasserbehandlung.
Aerosol: Stoffgemisch aus einem gasförmigen Stoff undflüssigen oder festen, fein verteilten Bestandteilen, dieman als „Schwebstoffe“ bezeichnet. Die Teilchen kommenüberall in der Luft vor und sind so klein, dass sie einzelnmit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Beispiele sind Salz-kristalle, Sandkörner, Pollen und Ruß sowie andere Teil-chen aus Industrieabgasen. Aerosolpartikel lagern Luft-feuchtigkeit an und wirken so als Wolkenkondensations-keime.
Ag-Ionen: Ag (Argentum) ist das chemische Symbol für Sil-ber. Silber ist ein sehr altes Antiseptikum, seine Verwen-dung zur Prophylaxe und Behandlung von Infektionenlässt sich bis circa 1000 v. Chr. zurückverfolgen. Heutekommt Silber unter anderem in der Trinkwasserdesinfek-tion zum Einsatz.
Aktivkohle: Sammelname für eine Gruppe von künstlichhergestelltem, porösem Kohlenstoff mit einer schwamm-artigen Struktur. Dieser hochporöse reine Kohlenstoffzeichnet sich durch eine große spezifische Oberfläche aus(bis zu 300 m2/g). Aktivkohle wird aus Torf, Holz, Braun-kohle, Steinkohle oder Nussschalen hergestellt. DieseMaterialien werden zunächst verkohlt. Dabei entstehensehr kleine Poren. Aktivkohle adsorbiert organische Sub-stanzen aus Wasser und Luft und kann daher Wasser oderkontaminierte Luft reinigen.
Glossar
AKW: Die Aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Tolu-ol, Ethylbenzol und Xylol ( BTEX-Aromaten) kommen inSteinkohleteer vor, werden aber meist aus Erdöl gewon-nen. Sie erhöhen im Benzin die Oktanzahl und dienenaußerdem als Löse- und Entfettungsmittel oder als Roh-stoff in der chemischen Industrie. Generell weisen AKWeine hohe Toxizität auf und sind, zumindest im Fall vonBenzol, krebserregend.
Anaerob: Abwesenheit von Sauerstoff (O2). Auch Bezeich-nung für die Lebensweise von Organismen, die zum Lebenkeinen freien Sauerstoff benötigen, und für chemischeReaktionen, die unter Ausschluss von Sauerstoff ablaufen.
Aquifer: (von lat. aqua „Wasser“, ferre „tragen“) ist in derHydrogeologie ein Leiter für Grundwasser. Der BegriffAquifer entspricht im Wesentlichen dem Begriff Grund-wasserleiter. Je nach vorliegender Gesteinsart (und damitPorosität des Gesteins) wird zwischen unterschiedlichenAquifertypen unterschieden.
ATR-Spektroskopie: „ATR“ steht für Attenuated TotalReflection (abgeschwächte Totalreflexion). AnalytischesVerfahren zur Messung in dünnen Oberflächenschichten.Durch Wechselwirkungen eines Messstrahls an der Grenz-fläche eines durchlässigen Materials und der Oberflächeeines zu untersuchenden Materials wird ein charakteristi-scher Teil des Infrarot-Messstrahls absorbiert (vgl. Infra-rot-Spektroskopie).
Aride Regionen: Regionen mit trockenem Klima
Aufsalzung: Die Erhöhung der Salzfracht eines Gewässersdurch z. B. bei der Abwasserreinigung nicht entfernbareSalze oder durch Einleitung oder Rückführung von Salzenaus einer Meerwasserentsalzungsanlage in ein Gewässer.
Batch-Test: Eine Versuchsanordnung, bei der getestetwird, in welcher Geschwindigkeit bzw. über welchen Zeit-raum ein Substrat (hier die Inhaltsstoffe des Abwassers)unter bestimmten Bedingungen durch biologische Pro-zesse abgebaut wird.
Belebtschlamm: Die bei der aeroben biologischenAbwasserreinigung durch den Abbau der Abwasserin-haltsstoffe im Belebungsbecken gebildete Biomasse.Mikroskopische Untersuchungen belegen, dass Belebt-schlammflocken aus Bakterien und Protozoen bestehen.
Belebtschlammreaktor: vgl. Belebtschlammverfahren
RESSOURCE WASSER162

GLOSSAR 163
Belebtschlammverfahren (auch: Belebungsverfahren):Bei diesem Verfahren wird das Abwasser mit Belebt-schlamm (auch Blähschlamm genannt) biologisch gerei-nigt. Die Kleinlebewesen im Schlamm (Bakterien, Pilze)bauen die organischen Substanzen ab; der für ihren Stoff-wechsel benötigte Sauerstoff wird in Belebungsbeckenzugeführt. Nach der Reinigung des Abwassers wird derbelebte Schlamm im Nachklärbecken vom Abwassergetrennt und in das Belebungsbecken zurückgeführt(oder als Überschussschlamm entsorgt).
Belebungsverfahren: Vgl. Belebtschlammverfahren.
Biofilm: Schicht von lebenden und abgestorbenen Mikro-organismen. Biofilme entstehen, wenn Mikroorganismen(z. B. Bakterien, Algen, Protozoen) sich an Grenzflächenzwischen Gas- und Flüssigphasen (z. B. bei freiem Wasser-spiegel), Flüssig- und Festphasen (z. B. Kies an der Gewäs-sersohle) oder an Flüssig-/Flüssigphasen (z. B. Öltröpfchenim Wasser) ansiedeln. Es bildet sich auf der Grenzflächeeine dünne, meist geschlossene Schleimschicht (Film), indie Mikroorganismen eingebettet sind.
Biogasreaktor: Anlage, die aus Biomasse Biogas erzeugt.Biogas besteht zu 50 – 70 Prozent aus Methan und kann alsEnergiequelle eingesetzt werden. Die künstliche Biogas-produktion erfolgt in mehreren Stufen in einem geheiz-ten Reaktor bei durchschnittlich 30 – 35 °C unter Luftab-schluss ( anaerob).
Bioindikation: Ermittlung natürlicher oder menschlicherUmwelteinflüsse mittels geeigneter Organismen (Bioindi-katoren).
Biologische Abwasserbehandlung: Die im Abwasser ent-haltenen organischen Verbindungen werden bei der bio-logischen Abwasserreinigung einem Abbauprozess unter-zogen. Der Abbau erfolgt im Wesentlichen durch Mikro-organismen in Verbindung mit gelöstem Sauerstoff bei
aeroben Prozessen bzw. unter Sauerstoffabschluss bei anaeroben Prozessen. Dabei entstehen durch Umwand-
lungsprozesse anorganische Verbindungen und Biomas-se. Das am häufigsten angewandte Verfahren der biologi-schen Abwasserreinigung ist das Belebtschlammver-fahren.
Biologische Nitratentfernung: Ein Verfahren, bei demdie natürliche Fähigkeit von Mikroorganismen (Bakterien)genutzt wird, um Nitrat (NO3) in elementaren, gasförmi-gen Stickstoff (N2) umzuwandeln. Der Prozess findet unteranoxischen Bedingungen, d. h. unter Luftabschluss, stattund benötigt ein Substrat (z. B. Essigsäure), damit die Bak-terien denitrifizieren können. Zur Trinkwasseraufberei-tung ist in der Regel im Anschluss an die Denitrifikati-onsstufe eine umfangreiche Nachbehandlung (Gasaus-tausch, Filtration, Desinfektion) erforderlich.
Biomembranreaktor: Kombination von Belebtschlamm-verfahren und Membranfiltration. Ziel ist die weitgehen-de Reinigung eines biologisch verunreinigten Abwassers,bis dieses wieder als Brauch- oder Prozesswasser verwen-det werden kann.
Bioreaktor: Ein Bioreaktor ist ein Behälter, in dem Mikro-organismen, Zellen oder kleine Pflanzen unter Optimalbe-dingungen kultiviert bzw. fermentiert werden. Auch derAbbau von chemischen Verbindungen mit Hilfe von Bak-terien etc. kann in Bioreaktoren stattfinden. In dieserEigenschaft spielen sie zum Beispiel in der biologischenReinigung von Abwässern eine Rolle.
Biozid/Biozide: Wirkstoffe (Chemikalien und Mikroorga-nismen), die zur Schädlingsbekämpfung im nicht-agrari-schen Bereich eingesetzt werden. Dazu zählen Desinfekti-onsmittel, Rattengift, Holzschutzmittel, etc. Vgl. auch:
Mikrobizid
Biozönotisch: Eine Biozönose ist eine Gemeinschaft vonPflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen in einemabgrenzbaren Lebensraum (Biotop).
Blockheizkraftwerk (BHKW): Anlage zur kombiniertenErzeugung von Strom und Wärme nach dem Prinzip derKraft-Wärme-Kopplung. Die Wärme, die bei der her-kömmlichen Stromerzeugung als Abwärme verlorengeht,wird in einem BHKW in Dampf umgewandelt und kannbeispielsweise zum Heizen (Fernwärme) genutzt werden.
Boreale Nadelwälder: Die am nördlichsten gelegenenWälder der Erde, die sich als riesiges Band durch den Nor-den Eurasiens und Nordamerikas ziehen.
Braunwasser: Sanitär-Abwasser ohne Urin bzw. Gelb-wasser.
Brillouin-Frequenzbereichsanalyse: Grundlage des Mess-systems auf Basis der Brillouin-Frequenzbereichsanalyseist der nichtlineare optische Effekt der stimulierten Bril-louinstreuung (SBS), der die Dehnung einer optischenGlasfaser in eine messbare Frequenzverschiebung desRückstreulichts eines optischen Signals überträgt.
BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf): Dieser Wert istdie Menge an Sauerstoff in mg/l, den Bakterien und alleanderen im Wasser vorhandene Mikroorganismen beieiner Temperatur von 20°C innerhalb von fünf Tagen ver-brauchen, woraus man auf die Menge der dabei abgebau-ten organischen Stoffe schließt.
BTEX: AKW, Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol,Toluol, Ethylbenzol, Xylol)

RESSOURCE WASSER164
Capacity-Building/Development: Im Rahmen internatio-naler Zusammenarbeit für Personal- und Organisations-entwicklung hat Capacity Development zum Ziel, denMenschen in Entwicklungsländern technische Unterstüt-zung und Beratung zu geben. Dies bedeutet die Kompe-tenz vor Ort nachhaltig zu stärken und somit die Kapazitä-ten eines Landes zu erhöhen, um soziale, politische undwirtschaftliche Probleme wirkungsvoll lösen zu können.
Chlorbenzen: Aromatische organische Verbindung, dieunter anderem als Verdünnung in der Farbindustrie, fürdie Entfettung in der Textil- und der Metallindustrie undals Extraktionsmittel eingesetzt wird.
CKW (Chlorkohlenwasserstoffe): Sammelbezeichnungfür organische Verbindungen, die mindestens ein direktan ein Kohlenstoffatom gebundenes Chloratom enthal-ten. CKW sind in vielen Produkten zu finden und werdenals Grundstoffe in der chemischen Industrie, als Lösungs-mittel sowie als Pestizide eingesetzt. Ihre weite Verbrei-tung und ihre hohe Stabilität führen dazu, dass sie heuteüberall in der Umwelt vorkommen.
Co-Vergärung: Zusatz von anaerob abbaubaren Stoffenin einen Faulturm oder eine Biogasanlage.
CSB: Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß fürdie Summe der im Wasser vorhandenen, unter bestimm-ten Bedingungen oxidierbaren Stoffe. Er gibt die Mengean Sauerstoff (in mg/l) an, die zu ihrer Oxidation benötigtwürde.
DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan): Insektizid mit Wir-kung als Kontakt- und Fraßgift, das seit Anfang der 1940erJahre eingesetzt wurde. DDT gehört zu den persistentenchlorierten Kohlenwasserstoffen. In den meisten Indus-trieländern ist seine Verwendung seit den 1970er Jahrenverboten. Seit 2004 darf es international nur noch zurBekämpfung der Malariaüberträger verwendet werden.Die Substanz ist äußerst stabil und wird in der Umwelt nursehr langsam abgebaut. Man findet sie daher heute in dergesamten Umwelt, selbst in Muttermilch. DDT ist muta-gen und steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen.
Dehalogieniert: Dehalogenierung ist die Entfernung vonHalogenen (insbesondere Chlor) aus organischen Verbin-dungen. Im engeren Sinne versteht man darunter die Entfernung von Halogenen aus Leichtflüchtigen Halo-genierten Kohlenwasserstoffen (LHKW). LeichtflüchtigeHalogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) mit bis zu dreiChloratomen können durch mikrobielle Aktivität dehalo-geniert werden.
Denitrifikation: Vorgang, bei dem Bakterien Nitratabbauen und dabei Stickstoff (N2) freisetzen, wie er in der
Luft vorkommt. Nebenprodukte der Denitrifikation sindLachgas (N2O) und Stickstoffoxid (NOX).
Desertifikation: Prozess der fortschreitenden Wüstenbil-dung in trockenen Gebieten.
Direct-Push-Verfahren: Ein Verfahren, das zur tiefenori-entierten Grundwasserprobenahme dient. Eine spezielleFiltersonde wird direkt bis zur gewünschten Tiefe in denGrundwasserleiter vorgetrieben, wodurch eine Grund-wasserprobenahme aus vorab definierten Tiefenberei-chen möglich ist.
DNAPL: Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch wer-den organische, in Wasser unlösliche Flüssigkeiten mitüber 1 g/cm3 liegenden Dichten (schwerer als Wasser) alsDense Non-Aqueous Phase Liquids (DNAPL) bezeichnet.Besonders wichtig ist die Gruppe der LeichtflüchtigenHalogenierten Kohlenwasserstoffe (LHKW). DNAPL tretenhäufig als Grundwasserverunreinigungen auf.
DOC-Gehalt: Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff(Dissolved Organic Carbon). Er bildet zusammen mit demungelösten organisch gebundenen Kohlenstoff (Particula-te Organic Carbon, POC) und dem flüchtigen organischgebundenen Kohlenstoff (Volatile Organic Carbon, VOC)den organisch gebundenen Gesamtkohlenstoff (TotalOrganic Carbon, TOC). Weist als organischer Summenpa-rameter auf die im Wasser gelöste organische Substanzhin.
Druckgetriebenes Membranverfahren: Membranen sindfeine Filter, die Flüssigkeiten passieren lassen, die darinenthaltenen Stoffe jedoch zurückhalten. Bei druckgetrie-benen Membranverfahren wird beim Transport durch dieMembran Druck auf die Flüssigkeit ausgeübt. Je nachTrenngrenze beziehungsweise Porengröße der Membra-nen wird zwischen Mikro-, Ultra-, Nanofiltration sowieUmkehrosmose unterschieden.
DSS (Decision Support System): ComputerbasiertesInstrument, das Entscheidungsträgern hilft, Informatio-nen zu bewerten und Auswirkungen von Handlungsmög-lichkeiten zu beurteilen (Entscheidungshilfssystem).
Einwohnerwert (EW): Maß für den Verschmutzungsgradgewerblich-industriellen Abwassers, angegeben alsAnzahl von Einwohnern, die eine entsprechende Belas-tung hervorrufen.
Einzugsgebiet: Teil der Erdoberfläche, von dem aus Was-ser einem bestimmten Gewässerabschnitt zufließt. Es wirdzwischen oberirdischem und unterirdischem Einzugsge-biet unterschieden. Die Wasserscheide markiert die Gren-ze des Einzugsgebiets.

GLOSSAR 165
Elbe-DSS: Entscheidungs-Unterstützungs-System (Decisi-on Support System) zum Flusseinzugsgebietsmanage-ment. Es strukturiert das für die Elbe erarbeitete Fachwis-sen, die verwendeten Computermodelle und Daten ineinem Grundgerüst.
Elektrodialyse (ED): Membranverfahren, bei dem im Was-ser befindliche Ionen durch das Anlegen einer elektri-schen Spannung eine Membran passieren. Durch dieabwechselnde Anordnung einer Vielzahl von kationen-und anionenselektiven Membranen kann dem Wasser dergrößte Teil der Ionen entzogen werden. Jenseits der Mem-branen sammeln sich die Kationen und Anionen zu einemKonzentratstrom, der abgeleitet wird. Im Gegensatz zurUmkehrosmose passiert das aufzubereitende Wasser beider Elektrodialyse die Membranen nicht, wodurch der ED-Prozess recht unempfindlich ist.
Energetische Verwertung: Einsatz von Abfall als Ersatz-brennstoff in Zementwerken, Kohlekraftwerken oderMüllverbrennungsanlagen.
Entscheidungshilfesystem: DSS.
Dränelemente: Sie dienen als Ersatz für natürliche, was-serdurchlässige Dränschichten z. B. aus Blähton, Lava, Kiesoder Blähschiefer. Dränelemente dienen zur mechani-schen Stabilisierung des Untergrundes und zur Vermei-dung von Wasserstaus und kommen deshalb u. a. auchvielfach im Deichbau zum Einsatz.
Escherichia coli (E. coli): Bakterien der Darmflora vonMenschen und Tieren; benannt nach deren Entdecker,dem Arzt Theodor Escherich (1857-1911). Der Nachweis vonE. coli im Trinkwasser ist ein Indikator für die Verunreini-gung mit Fäkalien.
EU-Wasserrahmenrichtlinie: Die Richtlinie 2000/60/EGdes europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-ber 2000 „zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“– Wasserrahmenrichtlinie ( WRRL) – bildet den Ord-nungsrahmen zum Schutz aller Gewässer. VorrangigesZiel ist die Herstellung eines „guten Zustands“ der Gewäs-ser. Die WRRL verfolgt einen flächenhaften, flussgebiets-weiten Ansatz, der alle signifikanten Belastungen im
Einzugsgebiet der Gewässer erfasst und ihre Auswirkun-gen auf die Gewässer bewertet.
eutroph: nährstoffreich (vgl. auch: mesotroph und oligotroph).
Eutrophierung: Übermäßiger Eintrag von Nährstoffen,besonders Phosphor- und Stickstoffverbindungen, in einstehendes oder langsam fließendes Gewässer, wodurcheine Massenentwicklung von Algen- und Wasserpflanzen
hervorgerufen wird. Durch die Zersetzung abgestorbenerPflanzen und Algen kommt es zu Sauerstoffverarmung imGewässer und zur Fäulnisbildung mit Bildung von Schwe-felwasserstoff und anderen schädlichen Stoffen („Umkip-pen des Gewässers“, Fischsterben, Geruchsbelästigungen).
Fällung: Durch chemische Reaktionen hervorgerufeneÜberführung gelöster Stoffe in unlösliche Stoffe, die sichdann zum Beispiel in Flockenform am Grund eines Behäl-ters oder Gewässers absetzen und sich so leichter aus demWasser entfernen lassen.
Faulturm: ein turmartig gebauter Behälter aus Beton,Spannbeton oder Stahl zur Abwasserbehandlung durchkontrollierte und gesteuerte Durchführung anaeroberAbbauprozesse. Er ist in der Regel wie andere Faulbehälterauch in Kläranlagen anzutreffen. Im Faulschlamm lösensich unter anderem Faulgase wie Methan (CH4), welcheswegen seines starken Treibhauspotenzials aufgefangenoder verbrannt werden muss. Das aufgefangene Gas lässtsich energetisch verwerten, insbesondere für die Erzeu-gung elektrischer Energie in einem Blockheizkraftwerk
Fermenter: Bioreaktor
Fernwirktechnik: Anlagenüberwachung aus der Ferne.
Flockung: ist ein Verfahren der Trinkwasseraufbereitungzur Reduzierung vorhandener Trübungen, bei dem unlös-liche Stoffe aus dem Wasser in Form voluminöser Teilchen(Flocken) mittels Zugabe von Flockungsmitteln bzw. -hilfs-mitteln, wie z. B. Aluminium- und Eisensalzen in Form vonChloriden und Sulfaten, ausgeschieden werden. DieAbtrennung der Flocken erfolgt dann z. B. durch Sedimen-tation.
Flotatschlamm: Während des Schlachtprozesses fallengroße Mengen Fett an, die in Flotationsanlagen von ihrerTrägersubstanz (Wasser) getrennt werden. Flotatschlammist eine Mischung aus Fetten, Blut und Wasser sowie eini-gen weiteren Verunreinigungen aus dem Schlachtpro-zess, etwa Federn.
Flussgebietsmanagement: Gesamtheit der Maßnahmen,die dabei helfen, Gewässer so zu bewirtschaften, dass siedem Allgemeinwohl dienen. Ziel ist es, dass vermeidbareBeeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen undder direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme undFeuchtgebiete bezüglich des Wasserhaushalts unterblei-ben, sodass insgesamt eine nachhaltige Entwicklunggewährleistet wird. Planungsräume sind Flussgebietsein-heiten, zu denen die Einzugsgebiete einschließlich desGrundwassers und der Küstengewässer gehören.

RESSOURCE WASSER166
Fluviatil: Durch Wasserbewegungen (Fluß/Strömung) aus-gearbeitet (erodiert), fortgetragen, abgelagert (Sedimen-tation) oder angereichert (Seifen). Benannt nach demlateinischen Wort fluvius: Fluss. Fluviatile Sedimente sindmeist gut gerundet und können fast alle Gesteine umfas-sen, die im Einzugsgebiet des jeweiligen Flusses oder Stro-mes vorkommen.
Freie Phase: Die einzelnen Teile eines Gemischs verschie-dener Stoffe (z. B. einer Flüssigkeit mit einem Feststoff)nennt man „Phasen“. Als „freie Phase“ bezeichnet manden Teil einer Flüssigkeit (oder eines Gases: flüssige resp.gasförmige Phase), der nicht über Bindungskräfte an diefesten Teile (feste Phase) des Gemischs gebunden (sorbiert)ist.
Funnel-and-Gate-System: Funnel-and-Gate-Systemebestehen aus trichterförmig angeordneten, unterirdi-schen Wänden (Funnel) in denen der kontaminierteGrundwasserstrom gefasst und einem ebenfalls unterirdi-schen Durchlaufbauwerk (Gate) zugeführt wird, an dessenEnde der Grundwasserstrom wieder abfließen kann. Wäh-rend der gesamten Passage wird das Wasser gereinigt. DasVerfahren benötigt bei richtiger Auslegung keine Pum-pen und funktioniert ohne Stromzufuhr.
Gelbwasser: Urin aus Separationstoiletten und Urinalen,mit oder ohne Spülwasser.
Geoelektrische Profilaufnahme: Bei geoelektrischen Pro-filaufnahmen werden Aufbau und Eigenschaften einesUntergrundes mithilfe von eingeleitetem Strom ermittelt.
Geogene Hintergrundbelastung: Natürliche Schadstoff-belastung in Boden, Wasser oder Luft, die von chemischenVerbindungen der Gesteine in der Erdkruste herrührt.
Getauchte Festbetten: Ein Festbettreaktor ist ein biotech-nisch häufig verwendeter Reaktortyp, bei dem die denStoffumsatz vermittelnden Elemente (Mikroorganismen,Enzyme) an feste Trägermaterialien (Festbett) fixiert sind.Am Festbett, das aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstof-fen bestehen kann, werden die übrigen Komponenten(Substrate, Gase u. a.) des Prozesses in einem Flüssigkeits-strom vorbeigeführt. Bei einem getauchten Festbett istdas Trägermaterial des Festbetts vollständig in das zu rei-nigende Abwasser eingetaucht. Die Sauerstoffversorgungerfolgt mittels Druckbelüftung (die Belüftung dient auchder Spülung).
GIS-basiert: Auf Geografischen Informationssystemen(GIS) aufbauende Kartierung, Messung oder Bestimmung.
Grauwasser: Haushaltsabwasser aus Küche, Bad, Dusche,Waschmaschine usw. (ohne Fäkalien und Urin) (vgl. Braun- und Gelbwasser).
Grenzflächenspannung: Eine Grenzfläche ist die Berüh-rungszone zwischen zwei Phasen, etwa zwischen Wasserund Luft oder zwischen Öl und Wasser. Die Grenzflächen-spannung führt dazu, dass sich die Oberfläche einer Flüs-sigkeit wie eine elastische Folie verhält.
Grundwasserleiter: Vgl. Aquifer
Habitat: Lebensraum für Organismen bzw. Lebensraum,den eine Art bewohnt.
Halbtechnischer Maßstab: Versuchs- oder Pilotanlagenwerden meist zunächst in halbtechnischem, d. h. praxis-nah, aber in kleinerem Maßstab getestet, bevor eine Groß-anlage gebaut wird.
Heterozyklen: Organische Verbindungen mit ringförmi-ger Struktur, in deren Ringgerüst ein oder mehrere Koh-lenstoffatome durch ein Heteroatom (z. B. Stickstoff, Sau-erstoff) ersetzt sind.
Hochlastfaulung: Dieses Verfahren wurde am Fraunho-fer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik(IGB) entwickelt. Kennzeichen des Verfahrens sind Effi-zienzgewinne durch einen kleineren Faulturm, kürzereVerweilzeiten des Klärschlamms im Turm und eine höhe-re Biogasausbeute. Bei der Hochlastfaulung fallendadurch geringere Mengen Restschlamm an, die zu ent-sorgen sind.
Hydraulik: Lehre vom Strömungsverhalten der Flüssigkei-ten.
Hydraulische Boden- und Grundwassersanierung: Sanie-rungsverfahren, das auf dem Strömungsverhalten vonFlüssigkeiten basiert.
Hydraulische Wirkung: Wirkung einer Maßnahme aufdie Eigenschaften eines Flusses, z. B. auf die Abflussvertei-lung, die Fließgeschwindigkeit oder die Wasserstände.
Hydraulischer Widerstand: Widerstand, den ein Mediumdem freien Fließen des Wassers entgegensetzt. Abhängigvon der Mächtigkeit und der hydraulischen Leitfähigkeiteines Stoffes/einer Bodenschicht.
Hydrodynamik: Ein Teilgebiet der Strömungslehre, dassich mit den dynamischen Prozessen, den Speicher- undTransportvorgängen in hydraulischen Systemen beschäf-tigt.
Hydrologie: Wissenschaft vom Wasser, seiner räumlichenund zeitlichen Verteilung und den damit zusammenhän-genden biologischen, chemischen und physikalischenEigenschaften.

GLOSSAR 167
Hygroskopische Teilchen: Stoffe, die Feuchtigkeit aus derUmgebung binden.
Immunomagnetische Separationssäule: Eine immuno-magnetische Separations- oder Trennsäule wird zur Rück-haltung von zuvor mit magnetischen Partikeln gekoppel-ten Mikroorganismen eingesetzt. Fließt die Flüssigkeit mitden magnetisch markierten Mikroorganismen durch diemagnetisierte Säule, bleiben diese an den Wänden haften.Anschließend entfernt man den Magneten und spült dieSäule mit dem Messpuffer, in welchem die Mikroorganis-men dann die Säule verlassen.
Infiltrationsbecken: Sammelbecken für Oberflächenwas-ser, das nach Filtrierung über Kiese und Sande demGrundwasser zugeführt wird.
Infrarot-Spektroskopie: Physikalisches Analyseverfahren,das mit Infrarotlicht arbeitet. Es wird zur quantitativenBestimmung und zur Strukturaufklärung von Substanzengenutzt.
Injection-Logs: Messsystem zur Ermittlung hydraulischerDurchlässigkeiten im Erdreich.
Inhalative und dermale Schadstoffe: Schadstoffe, dieüber die Atemwege (inhalativ) oder die Haut (dermal) auf-genommen werden.
In-situ-chemische-Oxidation (ISCO): Sanierungsverfah-ren, bei dem chemische Oxidationsmittel wie z. B. Kalium-permanganat in den Grundwasserleiter injiziert werden,um die Schadstoffe abzureinigen.
In-situ-chemische-Reduktion (ISCR): Hierbei werdenreduzierende Chemikalien, wie z. B. Melasse, in den Unter-grund eingebracht und reagieren hier mit den Schadstof-fen, wodurch diese chemisch zerstört werden.
In-situ-Messnetze: In-situ-Messungen werden an Ort undStelle, also unter natürlichen Bedingungen durchgeführt.Mehrere, oft über große Flächen verteilte Messstationen,sind zu sogenannten Messnetzen zusammengeschlossen.
Ionenaustauscher: Natürliche oder künstliche Stoffe, dieim Wasser gelöste Ionen (geladene Teilchen) durch ande-re Ionen ersetzen. Dabei werden die zu ersetzenden Ionenan das Ionenaustauscher-Material gebunden, das seiner-seits Ionen in die Lösung entlässt.
Kapillardruck: Als Kapillardruck bezeichnet man dieKraft, die Flüssigkeiten beim Kontakt mit engen Röhren,Spalten oder Hohlräumen nach oben steigen lässt. DieserEffekt wird durch die Oberflächenspannung von Flüssig-keiten und der Grenzflächenspannung von Flüssigkeitenmit der festen Oberfläche hervorgerufen.
Kapillarnetzwerke: Netzwerke aus haarfeinen Gefäßenund Verästelungen (Kapillaren).
Karst/Karstlandschaft: Landschaftsform, bei der löslichesGestein (Kalk-, Gips und Salzgestein) durch Wasser zer-stört (erodiert) wurde. Typische Merkmale sind zerklüfteteFelsen, Einsturztrichter und Höhlen.
Katalyse: Chemische Reaktion unter Beteiligung einergeeigneten Substanz als Katalysator (Beschleuniger), ofteingesetzt mit dem Ziel, die Reaktionsgeschwindigkeit zuerhöhen.
KbE: Koloniebildende Einheit
Klärschlammverordnung (AbfKlärV): Regelt das Aufbrin-gen von Klärschlamm aus Abwasserreinigungsanlagenauf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne-risch genutzte Flächen.
Lamellenseparator: In einem Lamellenseparator oder -abscheider werden Partikel aus verschmutztem Wassermittels Wabenlamellen abgetrennt.
Langsamfilter: Langsamfilter entstanden in Anlehnungan die natürliche Bodenfiltration und besitzen eine gerin-ge Durchströmgeschwindigkeit. Nachteilig ist der hoheFlächenbedarf. Wo aber Oberflächenwasser genutzt wer-den muss, sind sie von Vorteil.
Lebenszykluskostenrechnung: Diese Rechnung zeigt – z. B. bezogen auf ein Produkt – an welchen Punkten desLebenszyklus welche Kosten entstehen.
Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW):Organische Verbindungen, bei denen bis zu vier Wasser-stoff-Atome durch Chloratome ersetzt sind. Die alsLösungs- und Reinigungsmittel verwendeten LCKW ver-dunsteten bis weit in die 1980er Jahre überwiegend in dieAtmosphäre. Aufgrund ihrer langen Lebensdauer sindLCKW noch heute in der Atmosphäre allgegenwärtig undnachweisbar. Große Mengen gelangten in der Vergangen-heit durch Unachtsamkeit, unsachgemäßen Umgang,Ablagerung oder Unfälle in den Untergrund.
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe(LHKW): Organische Verbindungen, die außer Kohlenstoffund Wasserstoff auch Halogen-Atome (Fluor, Chlor, Brom,Jod) enthalten. LHKW fanden und finden unter anderemVerwendung als Reinigungs-, Extraktions- und Lösungs-mittel, als Kältemittel und Treibgase (FCKW, Freone) oderals Feuerlöschmittel (Halone). Ähnlich den drei BTEX-Aromaten reichern sie sich in der Bodenluft an, können aberim Gegensatz zu diesen bis zur Grundwassersohle vordrin-gen. Einige LHKW wirken nicht nur toxisch, sondern auchozonschädigend (FCKW, Halone) oder krebsfördernd.

RESSOURCE WASSER168
LNAPL: Die meisten Kohlenwasserstoffe (d. h. nicht chlo-rierte Verbindungen, vgl. DNAPL) sind leichter als Was-ser und bilden auf dem Wasser (z. B. Grundwasser) auf-schwimmende Phasen. Organische Flüssigkeiten mitunter 1 g/cm3 liegenden Dichten werden als Light NonAquous Phase Liquids (LNAPL) bezeichnet. Die bedeutend-sten LNAPL-Verbindungen sind Kraftstoffe (Vergaserkraft-stoffe, Kerosin, Diesel), auch Heizöl EL gehört dazu. Beson-ders wichtig sind die BTEX.
Mechanisch-biologische Abfallbehandlung: Verfahren,bei dem Abfall mechanisch zerkleinert und biologisch(etwa durch Kompostierung) zersetzt wird.
Membran-gestützte Pd-Katalysatoren: Pd ist das chemi-sche Symbol für Palladium, ein weißes, sogenanntes Über-gangsmetall, das zu den Platinmetallen und damit zu denEdelmetallen zählt. Palladium ist ein exzellenter Katalysa-tor zur Beschleunigung von chemischen Reaktionen. Feinverteilt auf Membranen aufgebracht, wird es unter ande-rem zur Wasseraufbereitung, z. B. Dechlorierung benutzt.
Membranverfahren/Membrantechnik: Einsatz eines aufeiner Stützschicht aufgebrachten Filters zur Entfernungvon feinsten Partikeln bis hin zu gelösten Stoffen ausAbwasser. Der Werkstoff der Filterfläche kann je nachAnwendungsfall aus Edelstahl, Kunststoff oder textilemGewebe bestehen.
Mesotroph: Mit ausgeglichenem, durchschnittlichemNährstoffgehalt. Zustand von Gewässern, der zwischennährstoffreich ( eutroph) und nährstoffarm ( oligo-troph) liegt.
Methyltertbutylether (MTBE): Farblose, leicht flüchtigeorganische Verbindung. MTBE-Dampf-Luft-Gemische sindleicht entzündlich und explosiv. Wird hauptsächlich inOttokraftstoffen als Klopfschutzmittel eingesetzt.
Mikrobizid: Chemische Substanzen, die Mikroben abtöten(Viruzide gegen Viren, Bakterizide gegen Bakterien, Fun-gizide gegen Pilze, etc). Sie gehören zu den (vgl. auch )Bioziden und sind in vielen Farben, Reinigungsmitteln,aber auch in Kosmetika vorhanden um u. a. lange Haltbar-keit zu gewährleisten.
Mikro-Biozönose: Lebensgemeinschaft von Mikroorga-nismen.
Mikrofiltration: Physikalisches (mechanisches) Mem-bran-(trenn)verfahren (Filtrationsverfahren). Alle Inhalts-stoffe einer Flüssigkeit, die größer als die Membranporensind, werden von der Membran zurückgehalten. Eine Fil-tration durch Membranen mit einer Porengröße > 0,1 mwird „Mikrofiltration“, bei Porengrößen < 0,1 m „Ultrafil-tration“ genannt.
Millenniumsziele: Acht Entwicklungsziele, auf die sich dieStaats- und Regierungschefs von 189 Staaten im Jahr 2000in der sogenannten Millenniumserklärung verständigthaben. Die Ziele, die vier Handlungsfeldern entstammen(1. Frieden, Sicherheit und Abrüstung, 2. Entwicklung undArmutsbekämpfung, 3. Schutz der gemeinsamen Umwelt,4. Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsfüh-rung) und deren oberstes Ziel die globale Zukunftssiche-rung ist, sollen bis zum Jahr 2015 umgesetzt werden.
Mineralisation: Umsetzung zu anorganischen Stoffen.
Mixed-In-Place-Verfahren (MIP): Mit dem Mixed-In-Place-Verfahren (MIP) werden vertikale Betonwände im Erd-reich hergestellt. Der Boden wird dabei mit Zementsus-pension vermischt und so ein Erdbetonkörper hergestellt.Der Vorteil ist, dass keine weiteren Baustoffe nötig sind.Das Verfahren wird zur Abschottung von Deponien undAltlasten verwendet.
Morphodynamik: Dynamische Entstehung von Formendurch Abtrag oder Ablagerung beispielsweise durch Wit-terungseinflüsse, aber auch durch hydrologische Prozesse.
Morphologisch: Die äußere Form betreffend.
Nachklärung: Teilprozess der biologischen Abwasserreini-gung zur Trennung gereinigten Abwassers von dem amReinigungsprozess beteiligten Klärschlamm. Die Nachklä-rung erfolgt i. d. R. im Nachklärbecken. Das Nachklärbe-cken einer Abwasserreinigungsanlage ist zumeist hintereiner biologischen Stufe (z. B. Belebungsbecken) angeord-net, bei dem durch Verlangsamung der Fließgeschwindig-keit eine Sedimentation der absetzbaren Stoffe erfolgt.Unter bestimmten Umständen können auch Membran-verfahren zur Nachklärung eingesetzt werden.
Nanofiltration: Druckgetriebenes Membranverfahren,das Partikel im Nanometer-Bereich zurückhält.
Niederdruckmembranverfahren: Vgl. Membranverfah-ren.
Nitrifikation: Bakterieller Abbau (Oxidation) von Ammo-niumverbindungen zu Nitrat (NO3).
Null-Kontrolle: Unbehandelte Kontrolle, die bei Experi-menten als Standard dient, gegen den Veränderungenoder Abweichungen der anderen, behandelten Probengemessen werden.
NSO-HET: Heterozyklische Kohlenwasserstoffe (vgl. Heterozyklen).

GLOSSAR 169
Ökobilanz (Life-Cycle-Assessment): Eine Ökobilanz analy-siert möglichst umfassend den gesamten Produktlebens-weg (Life-Cycle) und die zugehörigen ökologischen Aus-wirkungen und bewertet die während des Lebenswegsauftretenden Stoff- und Energieumsätze und die darausresultierenden Umweltbelastungen.
Ökomorphologie: Strukturelle Ausprägung eines Gewäs-sers einschließlich des Uferbereichs (vgl. morpholo-gisch).
Oligodynamischer Effekt: Schädigende Wirkung vonMetall-Kationen (positiv elektrisch geladene Metall-Ionen) auf lebende Zellen.
Oligotroph: Nährstoffarm (vgl. auch eutroph und mesotroph). ( Eutrophierung).
O-Phosphat: Sauerstoff-Phosphat-Verbindung (O ist dasSymbol für das chemische Element Sauerstoff).
Oxidative Vollmetallkatalysatoren: Katalysatoren (Reak-tionsbeschleuniger), die Wasser mithilfe von Sauerstoffreinigen.
Perchlorethylen (PCE): Vgl. Tetrachlorethen.
Permeabilität: Durchlässigkeit von Fels oder Böden fürGase oder Flüssigkeiten.
Phase: Eine Phase ist ein räumlicher Bereich, in dem diephysikalischen Parameter und die chemische Zusammen-setzung der Materie homogen sind.
Photokatalytische Oberflächen: Oberflächen, auf denendas (Sonnen-)Licht organische Materialien zersetzt.
pH-Wert: Maß für die H+-Ionenkonzentration, also dasMaß für die Konzentration an Säure (pH < 7) bzw. Base (pH> 7). Ein pH-Wert von 7 gilt als neutral.
Polychlorierte Biphenyle (PCB): Gruppe giftiger Substan-zen, die bis in die 1980er Jahre vor allem in Transformato-ren, elektrischen Kondensatoren, Hydraulikanlagensowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen undKunststoffen verwendet wurden. PCB zählen inzwischenzu den zwölf als „dirty dozen“ bekannten organischenGiftstoffen, die 2001 weltweit verboten wurden. Nebenchronischen toxischen Wirkungen (Chlor-Akne, Haaraus-fall und Hyperpigmentierungen) stehen PCB auch in Ver-dacht, krebserregend zu sein und hormonell zu wirken.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):Stoffgruppe von organischen Verbindungen. Sie sindnatürlicher Bestandteil von Kohle und Erdöl und entste-hen bei der Pyrolyse (unvollständige Verbrennung) von
organischem Material (z. B. Kohle, Heizöl, Kraftstoff, Holz,Tabak) und sind deswegen überall in der Umwelt nachzu-weisen. Wegen ihrer schlechten Abbaubarkeit, Giftigkeitund durchgängigen Verbreitung haben PAK eine großeBedeutung als Schadstoffe in der Umwelt.
ppm: parts per million (Teile pro 1 Million Teile). Maßein-heit, die das Mengenverhältnis eines Stoffes zu einemanderen Stoff angibt.
Präzipitat: Stoff, der aus einer Lösung ausfällt und sichabsetzt (Niederschlag).
Pump-and-tracer-Verfahren: Bei diesem Verfahren wirddas Wasser z. B. mit Farbstoffen künstlich „markiert“, umdas Fließverhalten (z. B. Fließgeschwindigkeit) beobach-ten zu können.
Pump-and-treat-Verfahren: Ein Sanierungsverfahren, beidem das verschmutzte Grundwasser über Brunnen oderDrainagen entnommen und anschließend gereinigt wird.
Quartärer Grundwasserleiter: Quartäre Grundwasser-leiter sind im jüngsten (vor 2,6 Millionen Jahren begonne-nen und bis heute noch andauernden) Zeitabschnitt derErdgeschichte, dem Quartär, entstanden.
Rammkernsondierungen: Die Rammkernsondierung isteine einfache Methode zur Erkundung des Bodenaufbausund zur Entnahme von Bodenproben mithilfe einer hoh-len Stahlsonde, die in den Untergrund getrieben wird.
Redox-Kombinationsreaktoren: In kontaminiertemGrundwasser ist meist kein gelöster Sauerstoff mehr vor-handen, weil dieser (wie bei der Verbrennung) zur Oxida-tion des Kohlenstoffs (der Schadstoffverbindungen) ver-braucht worden ist. Die Kombinationsreaktoren findenEinsatz bei der sukzessiven Behandlung von Schadstoffge-mischen: Zum restlosen Abbau aller Schadstoffe wird demGrundwasser zunächst Sauerstoff zugefügt, um positiveRedox-Bedingungen herbeizuführen. Danach herrschenim Grundwasser wieder negative Redox-Bedingungen,also Sauerstofffreiheit. Unter diesen reduzierenden Bedin-gungen lassen sich dann einige weitere Schadstoffe zer-stören.
Redoxmilieu: Eine Redoxreaktion (genauer: Reduktions-Oxidations-Reaktion) ist eine Stoffumwandlung, bei derein Reaktionspartner Elektronen auf den anderen über-trägt. Bei einer solchen Elektronenübertragungs-Reaktionfinden also eine Elektronenabgabe (Oxidation, wie beieiner Verbrennung) durch einen Stoff sowie eine Elektro-nenaufnahme (Reduktion) durch einen weiteren Stoffstatt. Das Redoxmilieu beschreibt den diesbezüglichenchemischen Zustand des umgebenden Mediums.

Reduktive Dechlorierung: Verfahren, bei dem Chlorunter Ausschluss von Sauerstoff aus Chemikalien entferntwird. Dieser Prozess ist z. B. für die Sanierung von Grund-wasserschäden wichtig.
Renaturierung: Rückbau von Flussbegradigungen oderVerbauungen des Flussbetts mit dem Ziel, wieder natürli-che Fließverhältnisse herzustellen.
Retardation: Der Begriff kommt von „retardare“ (lat. fürverzögern) und wird im Zusammenhang mit Stofftrans-port verwendet. Er beschreibt die Verlangsamung einesStoffes in Bezug auf das sich bewegende Medium, in demer transportiert wird.
Retention: In der Wasserwirtschaft versteht man darun-ter die ausgleichende Wirkung von Stauräumen auf denAbfluss in Fließgewässern, vgl. Retentionsräume.
Retentionsräume: Im Seitenbereich des Flussbetts und inder Flussaue wird bei Überflutungen ein Teil des Wasserszwischengespeichert. Dies führt dazu, dass das Wasserflussabwärts langsamer steigt. Die Hochwasserwelle wirdverzögert und verläuft flacher. Je geringer das Gefälle, des-to größer die Retention. Die Fläche, die zur Retentionbeiträgt, heißt Retentionsfläche.
Rohwasser: Unbehandeltes Wasser: bevor es beispielswei-se als Trinkwasser aufbereitet oder gereinigt ist.
Salz(wasser)intrusion: Eindringen von Salz- oder Brack-wasser in das Grundwasser durch Verschiebung von Süß-/Salzwassergrenzen.
Schadstofffahne: Die Ausbreitung gelöster Schadstoffe imAquifer (Grundwasserleiter).
Scheibentauchkörper: Maschinelle Einheit mit auf einerhorizontalen Achse angebrachten Scheiben, die etwa zurHälfte unterhalb der Achse in den Abwasserbehälter ein-getaucht sind und rotieren. Der sich auf den Oberflächenbildende Biofilm wird durch die Rotation der Scheiben mitSubstrat und Luftsauerstoff versorgt.
Schwarzwasser: Das komplette Sanitär-Abwasser aus Toi-letten und Urinalen.
Sediment: Durch Absetzen (Sedimentation) von minerali-schen und/oder organischen Feststoffen entstandeneAblagerungen in Gewässern. Man unterscheidet klasti-sche Sedimente (Schwebstoffe, Sand, Steine), chemische(aus wässrigen Lösungen ausgeschiedene Stoffe, z. B. Kar-bonate) und biogene (abgelagerte Organismen oderderen Reste, z. B. Muschelkalk).
Seismik: Erforschung der Erdkruste mittels künstlicherzeugter Schallwellen.
Sorption: Aufnahme einer gasförmigen oder gelöstenSubstanz durch einen anderen festen oder flüssigen Stoff.Sorption bezeichnet Vorgänge, die zu einer Anreicherungeines Stoffes innerhalb einer Phase (Absorption) oder aufeiner Grenzfläche (Adsorption) zwischen zwei Phasen füh-ren. Der Begriff Sorption steht für Prozesse, bei denennicht zweifelsfrei zwischen Ab- und Adsorption zu unter-schieden ist. Der sorbierende Stoff wird auch als Sorptions-mittel (bzw. Sorptionsmaterial) bezeichnet.
Spektroskopie: Messen des Spektrums einer Strahlen-quelle.
Spin-off-Unternehmen: Bei einem Spin-Off gliedert einebestehende Firma oder Institution einen Teil des Unter-nehmens bzw. der Institution als eigenständige Firma aus.
Spurenstoffe: Als Spurenstoffe werden Substanzenbezeichnet, die in Konzentrationen kleiner 100 Mikro-gramm je Liter in Wassern gefunden werden. Dabei kannes sich um anorganische und organische Spurenstoffehandeln, die die Wasserqualität beinträchtigen.
Stoffliche Verwertung: Gewinnung von Rohstoffen ausAbfällen, ihre Rückführung in den Wirtschaftskreislaufund die Verarbeitung zu neuen Produkten (Recycling).
Stratigrafie: Teilgebiet der Geowissenschaften, das sichder Untersuchung von Schichtungen und ihrer zeitlichenZuordnung widmet.
Strippen: Entfernung von Wasserinhaltsstoffen durchEinblasen von Luft/Gasen. Dadurch werden gelöste Stoffein die gasförmige Phase überführt und somit aus demWasser entfernt.
Struvit (auch: Ammonium-Magnesiumphosphat): Eineschwerlösliche Verbindung des Ammoniums und desMagnesiums; das Mineral ist benannt nach dem Natur-kundler Heinrich Christoph Gottfried von Struve (1772–1851).
Suspension: Eine Suspension ist ein Stoffgemisch auseiner Flüssigkeit und darin fein verteilten Feststoffen, die –beispielsweise durch einen Rührer – in der Schwebe gehal-ten werden.
Technogene Zone: Im Untergrund befindliche Wasser-ver- und -entsorgungsnetze (Kanalisation) werden auchals technogene Zone bezeichnet.
RESSOURCE WASSER170

GLOSSAR 171
Tektonik: Umschreibt den Aufbau bzw. die Gliederungder Erdkruste.
Tertiär: Als Tertiär wird der geologische Zeitabschnitt derErdneuzeit bezeichnet, also vom Ende der Kreidezeit (vor65 Millionen Jahren) bis hin zum Beginn des Quartärs (vorca. 2,6 Millionen Jahren).
Tetrachlorethen: Farblose, flüchtige Flüssigkeit. Auch alsPerchlorethylen (PCE) bezeichnet. Ist ein außerordentlichgiftiger chlorierter Kohlenwasserstoff ( CKW). TCE ist alskrebserzeugender Gefahrstoff der Kategorie 3 eingestuft.
Thermische Abfallbehandlung: Verbrennung von Abfall.
Topografie: Befasst sich mit der Vermessung, Darstellungund Beschreibung von Gelände, Orten und Landschaften.
Toxizität: Giftigkeit einer Substanz.
Toxizitätsparameter: Charakteristische Eigenschaften,die die Giftigkeit eines Stoffes näher beschreiben.
Trichlorethen (TCE): Aliphatische, chlorhaltige, organi-sche Verbindung. Eines der gebräuchlichsten Reinigungs-und Entfettungsmittel. Es dient auch als Extraktionsmittelfür natürliche Fette, Harze, Öle und Wachse. Der Stoffgehört zu den leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasser-stoffen ( LCKW) und gilt als krebserzeugend und keim-zellschädigend, Gefahrstoff der Kategorie 1.
Tropfkörper (auch: Rieselbettreaktor, Rieselstromreak-tor): Vorrichtung zur Abwasserreinigung, bei der die Rei-nigung durch eine Verrieselung des Abwassers über einporöses Festbett (z. B. Lavaschlacke) erfolgt. Mikroorganis-men (auch „biologischer Rasen“ genannt) auf dem Fest-bett bauen biologisch die gelösten organischen Inhalts-stoffe ab.
Trübstoffarm: Trübungen entstehen im Wasser durchorganische und anorganische Schwebstoffe, sowie durchlebende organische Stoffe, die durch Filter schwer zu ent-fernen sind. Trübstoffarmes Wasser ist entsprechend kla-rer und kann mittels eines Langsamfilters gereinigt wer-den.
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket: Das UASB-Ver-fahren ist ein kontinuierliches Verfahren, bei dem derReaktor ständig von Abwasser und Schlamm durchflossenwird. Die Abwasserzuführung erfolgt im unteren Bereichdes Reaktors und durchfließt diesen im Gegenstrom.Durch die spezielle Gestaltung des Reaktorraumes erfolgteine Unterteilung in Schlammbett (anaerobe Reaktions-zone), Gas-Feststoff-Trenneinrichtung und Sedimenta-tionsraum.
Überschussschlamm: Der bei der biologischen Abwasser-reinigung gebildete Zuwachs an Biomasse ( Belebt-schlamm). Er wird aus dem Belebungsbecken abgezogen,entwässert und fällt als „Klärschlamm“ an.
Ultrafiltration: Vgl. Mikrofiltration.
Umkehrosmose: Bei der Osmose diffundiert (wandert) einLösungsmittel (etwa Wasser) durch eine semipermeable(nur für das Lösungsmittel durchlässige) Membran. Dabeidiffundiert das Lösungsmittel vom Bereich mit niedrige-rer Konzentration des gelösten Stoffes in den Bereich mithöherer Konzentration. Bei der Umkehrosmose wird dernatürliche Osmoseprozess mittels Druck umgekehrt. DieSalze verbleiben dabei vor der Membran und werden alsKonzentrat abgeleitet.
Umweltföderalismus: Verteilung von (Entscheidungs-)Befugnissen und Aufgaben auf verschiedene Akteure imUmweltbereich.
Vergärung: Abbau von biogenem Material durch Mikroor-ganismen in Abwesenheit von Sauerstoff (anaerobe Bedin-gungen). Mehrere Bakteriengruppen, die sehr eng zusam-menarbeiten, verwandeln Biomasse in Biogas.
Vermikompostierung: Hierbei handelt es sich um einen aeroben Kompostierungsprozess, der von Mikroorga-
nismen und Würmern geleistet wird. Vorteile gegenüberder konventionellen Kompostierung sind eine höhere Pro-zessgeschwindigkeit, die höhere Mineralisierungsrate derenthaltenen Nährstoffe sowie die Umsetzbarkeit von rela-tiv kleinen Mengen.
Versauerung: Eintrag von Säuren in Gewässer und Böden.Beispielsweise durch „sauren Regen“ oder durch dieAbbauprodukte des Pyrits auf Abraumhalden des Braun-und Steinkohlebergbaus.
Viskosität: Die Viskosität beschreibt die Zähigkeit vonFlüssigkeiten. Sie ist ein Maß für den Widerstand einerFlüssigkeit gegen das Fließen und wird durch den Rei-bungswiderstand, den eine Flüssigkeit einer Deformationentgegensetzt, definiert.
Vorfluter: Mit Vorfluter wird in der Hydrologie jeglicheArt von Gerinne, zum Beispiel Gewässer und Bodendraina-gen, bezeichnet, in denen Wasser in Form von Abwasser,Regenwasser oder Drainagewasser in ein Gewässer abflie-ßen kann. Natürliche Vorfluter sind offene Fließgewässer,die Wasser aus anderen Gewässern, aus Grundwasserkör-pern oder Abfluss-Systemen aufnehmen und ableiten.

Vorklärschlamm: Abwasser gelangt in der Kläranlageüber den Sand- und Fettfang in das Vorklärbecken. In die-ser ersten Klärkammer setzen sich ungelöste Stoffe alssogenannter Vorklärschlamm ab (mechanische Reini-gung).
Voroxidation mit Kaliumpermanganat: Kaliumperman-ganat (KMnO4) ist ein starkes Oxidationsmittel (vgl. auch:
ISCO), das bei der Trinkwasseraufbereitung z. B. zu Ent-eisung verwendet werden kann, bzw. Sulfit zu Sulfat oxi-diert.
Vulnerabilität: „Verwundbarkeit“. In der Ökologie istdamit eine besondere Empfindlichkeit gegenüberUmweltbedingungen und Eingriffen von außen gemeint.
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Vgl. EU-Wasserrah-menrichtlinie.
Water Governance: Der Begriff umschreibt einen ganz-heitlichen, ökologische, wirtschaftliche und sozialeAspekte umfassenden, regulatorische wie nicht-regulato-rische Maßnahmen einschließenden Prozess des Wasser-managements. Zentral ist beim „Water Governance“-Ansatz die umfassende und frühe Teilnahme der Öffent-lichkeit an den Entscheidungsprozessen (z. B. armeMenschen, die bislang keinen oder nur einen unzurei-chenden Zugang zu Trinkwasser haben), auch von Grup-pen mit unterschiedlichen Interessen; in diesem Sinn sollWater Governance auch konfliktverhütend oder konflikt-lösend wirken (das gilt besonders für Wassermangelge-biete).
WRRL: Wasserrahmenrichtlinie der EuropäischenGemeinschaft, vgl. EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Zeolith-gestützte Pd-Katalysatoren: Die wirksamen Sub-stanzen eines Katalysators sind häufig Edelmetalle derPlatin-Gruppe; in diesem Falle Palladium (Pd). In einemüblichen Pkw-Abgaskatalysator sind diese feinsten Edel-metallpartikel auf porösen Keramikoberflächen aufge-bracht, um einen möglichst intensiven Kontakt mit demzu reinigenden Medium zu haben. Die gleiche Funktionhaben hier Zeolithe, natürlich vorkommende, aber auchindustriell hergestellte Mineralien mit großer Oberfläche(Porosität). Sie werden auch als „Molekularsiebe“ bezeich-net. Die feinen Palladiumpartikel in den Poren der Zeolit-he bauen die kleinen Schadstoffmoleküle ab. Die großen,schwefelhaltigen Moleküle, die im Grundwasser auch vor-kommen, bleiben außen vor.
RESSOURCE WASSER172

GLOSSAR 173
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum gewerb-
lichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/
Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/ Wahlhelfern während eines Wahlkampfes
zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Land-
tags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift
der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die
als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden könnte.