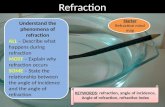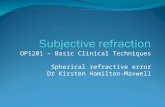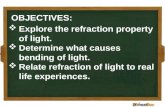Refraktion unter Akkommodationskontrolle - phtla-hall.tsn.at · 4 1 Abstract The main purpose of...
Transcript of Refraktion unter Akkommodationskontrolle - phtla-hall.tsn.at · 4 1 Abstract The main purpose of...
RReeffrraakkttiioonnuunntteerr
AAkkkkoommmmooddaattiioonnsskkoonnttrroollllee
DDiipplloommaarrbbeeiittvveerrffaassssttvvoonn
SSeelliinnaaEEll--ZZaawwii
uunndd
PPaattrriicciiaaOOeettsscchh
PPHHTTLLffüürrOOppttoommeettrriiee
BBeettrreeuueerr::DDiippll..IInngg((FFHH))GGuussttaavvPPööllttnneerr
EEmmiillyyHHaarrggrreeaavveess,,BBSSccMMSScc
2
Inhaltsverzeichnis
1 ABSTRACT ..................................................................................................................................... 4
2 EINLEITUNG .................................................................................................................................. 5
3 ZIEL DER ARBEIT ............................................................................................................................ 6
4 ANAMNESE ................................................................................................................................... 7
5 FEHLSICHTIGKEITEN ...................................................................................................................... 8
5.1 DAS KURZSICHTIGE AUGE (MYOPIE) .............................................................................................. 8 5.2 DAS WEITSICHTIGE AUGE (HYPEROPIE) ......................................................................................... 10 5.3 ASTIGMATISMUS (STABSICHTIGKEIT) ............................................................................................ 12
6 VISUS .......................................................................................................................................... 13
7 AKKOMMODATION .................................................................................................................... 14
7.1 AKKOMMODATIONSRÜCKSTAND – LAG OF ACCOMMODATION ............................................................ 16
8 DIE OBJEKTIVE REFRAKTION ....................................................................................................... 17
9 DIE SUBJEKTIVE REFRAKTION ...................................................................................................... 18
9.1 DIE KONVENTIONELLE REFRAKTION .............................................................................................. 19 9.2 DIE SUBJEKTIVE REFRAKTION UNTER AKKOMMODATIONSKONTROLLE ................................................... 22 9.3 NRA UND PRA ...................................................................................................................... 24
10 DER BINOKULARE ABGLEICH ....................................................................................................... 25
10.1 DER BINOKULARE ABGLEICH AM POSITIV POLARISIERTEN POLAKREUZ.................................................... 26
11 DER KREUZTEST AM POLATEST (PHORIETENDENZ) ..................................................................... 27
12 DER TESTAUFBAU ....................................................................................................................... 29
12.1 CHECKLISTE KONVENTIONELLE REFRAKTION: .................................................................................. 30 12.2 CHECKLISTE REFRAKTION UNTER AKKOMMODATIONSKONTROLLE: ....................................................... 31
13 DIE AUSWERTUNG DER MESSERGEBNISSE .................................................................................. 32
13.1 VERÄNDERUNG DER DIOPTRIEN .................................................................................................. 32 13.2 ÜBERSICHT DER DIOPTRIENVERÄNDERUNGEN ................................................................................. 33 13.3 AUSWIRKUNG AUF DEN VISUS .................................................................................................... 34 13.4 STÄRKENUNTERSCHIED UM ±0,25 DPT ......................................................................................... 35 13.5 STÄRKENUNTERSCHIED ÜBER ±0,50 DPT ....................................................................................... 36
14 FAZIT........................................................................................................................................... 37
3
15 ANHANG ..................................................................................................................................... 39
15.1 VERFASSER DER EINZELNEN KAPITEL ............................................................................................. 39 15.2 ZEITAUFZEICHNUNGEN EL-ZAWI SELINA ........................................................................................ 40 15.3 ZEITAUFZEICHNUNGEN OETSCH PATRICIA ...................................................................................... 42
16 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................................................. 45
17 MESSDATEN ................................................................................................................................ 46
17.1 REFRAKTIONSPROTOKOLL .......................................................................................................... 48
4
1 Abstract
The main purpose of this diploma thesis was to compare two different methods of
refraction for people with ametropia.
30 participants were refracted with both methods. The results were compared to see
which method was more accurate for myopes, and which was more accurate for
hyperopes. The intention of this study was to identify the most accurate method of
refraction in order to find the best way to measure our future customers.
First, the participants were refracted using the conventional refraction technique with
the optotypes at 6 metres. The results were recorded. The same participants were
then refracted with the optotypes at 40cm. A 2.50 diopter addition was added to
compensate for the viewing distance. Theoretically the second method should reduce
accommodation in young hyperopes and should therefore be more precise.
The refraction technique – using the phoropter and the politest – and the test
conditions, such as lighting and optotypes, were kept the same for both methods. The
visual acuity was measured at 6m to allow for direct comparison. Both methods were
carried out on the same day, one after the other.
An accurate evaluation of the results of our experiment produced some really
interesting and unexpected outcomes. In summary, we can say that refraction with
+2,50 diopters leads to an overcorrection of short-sighted people and to an
undercorrection of far-sighted people. We expected higher diopters and therefore
more accurate measurements for hyperopes. One theory to explain these results is
that our participants got tired during the refractions and therefore were more
sensitive for minus – glasses because of the higher contrast. The other theory is the
strong accommodation of our young participants, meaning that they - despite the
+2,50 diopter addition - were not completely able to leave the accommodation state.
5
2 Einleitung
Da die Refraktion Hauptbestandteil einer Augenoptikmeisterin/ eines
Augenoptikmeisters darstellt und diese/r tagtäglich damit konfrontiert werden, war es
uns ein Anliegen unsere Facharbeit diesem Thema zu widmen. Diese Arbeit basiert auf
dem Vergleich zweier subjektiver Refraktionsbestimmungen. Zum Einen, die
heutzutage hauptsächlich angewandte konventionelle Refraktion in 6 Meter, zum
Anderen eine Refraktion unter Akkommodationskontrolle. Um eine stabile
Akkommodationssituation zu erhalten, wurde die Messung unter Vorgabe von
zusätzlichen +2,50 Dioptrien in 40cm Abstand durchgeführt. Diese Methode wurde uns
im Zuge unserer Ausbildung an der PHTL für Optometrie von Dipl. Ing. (FH) Gustav
Pöltner gelehrt. Da diese Refraktionsmethoden grundsätzlich demselben Messvorgang
unterliegen, stellte sich uns die Frage ob sich Abweichungen der Refraktionswerte
feststellen lassen. Zeitgleich wollten wir herausfinden, ob sich eine der Refraktionen
besser eignet um Hyperope/Myope exakter zu messen und ob sich folglich eine
Veränderung der Phorietendenzen abzeichnet.
Um eine deutliche Aussage treffen zu können, haben wir 30 vorausgewählte
Probandinnen/Probanden vermessen. Davon waren zwei Drittel myop und ein Drittel
hyperop. Die Refraktionstechniken wurden unter gleichen Lichtverhältnissen, am
selben Phoropter und denselben Optotypen (Buchstabe einzeilig) durchgeführt. Beide
Refraktionen wurden am selben Tag, direkt hintereinander vorgenommen.
Die genaue Auswertung der Messergebnisse brachte einige unerwartete Ergebnisse.
Zusammenfassend können wir sagen, dass bei der Refraktion unter
Akkommodationskontrolle vermehrt eine Überkorrektion bei Myopen und eine
Unterkorrektion bei Hyperopen auftritt.
6
3 Ziel der Arbeit
Ziel dieser Facharbeit war es, herauszufinden ob sich eine dieser Messmethoden für
die Refraktion einer der Fehlsichtigkeiten in der Praxis besser bewährt. Ein besonderes
Augenmerk haben wir dabei auf die Messung junger hyperoper Personen gelegt, da
diese aufgrund ihrer Akkommodation in der Refraktion häufig sehr komplexe Fälle sein
können. Zusätzlich haben wir uns am Ende jeder Refraktion mittels Kreuztest am
Polatest ein Bild über die jeweiligen Phorietendenzen gemacht, um herauszufinden ob
diese bei einer der beiden verglichenen Messmethoden geringer ausfallen oder im
besten Fall nicht mehr vorliegen. Grundlage unsere Messungen war die Annahmen,
dass Hyperope bei der Refraktion unter Akkommodationskontrolle eindeutig
vollkorrigiert und mit maximalen Plus bei bestem Visus versorgt werden können und
keine Resthyperopie, die fälschlich als Esophorie erkannt werden könnte, verbleibt. Bei
Myopen sollte laut Theorie keine Differenz feststellbar sein.
Durch überlegte und sinnvolle Anordnung der Testreihen und durch Messung der
Prüflinge am selben Tag direkt hintereinander, konnten wir sicherstellen, dass wir
vergleichbare Messergebnisse von den beiden Refraktionsmethoden erhalten.
Schwankungen in den Ergebnissen lassen sich folglich nur auf die unterschiedliche
subjektive Wahrnehmung des Probanden und den Einfluss des
Akkommodationsrückstandes zurückführen.
In der schlussendlichen Auswertung der Messergebnisse möchten wir aufzeigen, in
welcher gegebenen Situation die Anwendung der Refraktion unter
Akkommodationskontrolle sinnvoll ist, um zu einem exakteren Ergebnis zu kommen.
7
4 Anamnese
Unter Anamnese versteht man ein gezieltes und professionelles Erfragen medizinisch
relevanter Details und anderer Aspekte die für die Refraktion und die weitere
Vorgehensweise wichtig sind. Ebenfalls relevant ist die medizinische Vorgeschichte
innerhalb der Familie, da manche Erkrankungen erblich bedingt sind. Die
Augenoptikmeisterin/der Augenoptikmeister darf keine Diagnose stellen, dennoch ist
der Erhalt der Information absolut notwendig, damit bei den Messungen darauf
eingegangen werden kann und im Zweifelsfall das frühzeitige Aufsuchen einer
Augenärztin/eines Augenarztes empfohlen werden kann.
Die Anamnese ist zeitgleich auch die Grundlage für die Auswahl der Screening – Tests.
Je detaillierter und genauer die Angaben der Probandin/des Probanden gegeben
werden, umso gezielter können Messungen durchgeführt werden, da anhand dieser
gesammelten Information entschieden wird, welche Art der Refraktion erfolgt. Bei
optimaler Zusammenarbeit zwischen Kundin/Kunde und Refraktionistin/Refraktionist
verläuft die Refraktion folglich sehr rasch und resultiert in einer korrekten Versorgung
der Kundin/des Kunden durch Sehhilfen.
Jegliche Information der Kundin/des Kunden unterliegt der Schweigepflicht und muss
von der Refraktionistin/dem Refraktionisten aufgrund der Dokumentationspflicht
protokolliert werden.
Für unsere Projektarbeit haben wir eine Vorauswahl getroffen, welche
Probandinnen/Probanden wir in unsere Studie aufnehmen, um mögliche
Fehlerquellen, die den Vergleich der zwei Messmethoden negativ beeinflussen
könnten, auszuschließen.
8
Vor Beginn der Messungen haben wir unsere Probandinnen/Probanden nach
asthenopischen Beschwerden, bekannten Phorien und für uns relevanter medizinscher
Vorgeschichte befragt. Diese kurze Anamnese ist für die Praxis ungeeignet, erfüllt
jedoch alle Kriterien die wir für unsere Projektarbeit benötigten. Einige unserer
Probandinnen/Probanden gaben an unter asthenopischen Beschwerden zu leiden und
manche wussten, dass sie eine Phorietendenz aufweisen, welche aber keine Korrektur
benötigt. Niemand unserer Prüflinge gab eine Operation, eine Erkrankung oder eine
Verletzung am Auge an, was für unser Projekt ein Ausschlussgrund gewesen wäre.
Jede für unser Projekt relevante Information haben wir in den Refraktionsprotokollen
niedergeschrieben, um diese bei Bedarf in die letztendliche Auswertung einfließen zu
lassen.
[1] Pöltner; [2] Hargreaves
5 Fehlsichtigkeiten
5.1 Das kurzsichtige Auge (Myopie)
Bei einem rechtsichtigen Auge fällt der bildseitige Brennpunkt eines Auges genau auf
die Netzhaut. Liegt dieser Brennpunkt jedoch etwas vor der Netzhaut, so spricht man
von einem kurzsichtigen Auge. Diese Brennweite ist also kürzer als die sagittale
Augenlänge, wobei die Ursache entweder in einem zu hohen Brechwert bei normaler
Augenlänge (Brechungsmyopie) liegen kann oder in der zu großen Länge bei normalem
Brechwert (Achsenmyopie). Das endgültige Bild eines weit entfernten Objektes kommt
dadurch schon vor der Netzhaut zustande und es erscheinen deshalb unscharf.
9
Abbildung Brechungs-Myopie
(Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an Heinz Diepes: Refraktionsbestimmung)
Die ungefähre Lage des Fernpunktes lässt sich beim kurzsichtigen Auge praktisch
einfach herausfinden, da er nicht unendlich fern liegt, sondern in einer messbaren
Entfernung vor dem Auge. Die/Der Kurzsichtige kann nur nah gelegene Objekte
deutlich sehen und wenn die Person das Objekt von weither annähert, so wird es ohne
Akkommodation deutlich sichtbar sobald es sich in ihrem/seinem Fernpunkt befinden.
Wenn man der kurzsichtigen Person ein kleines Sehzeichen zum Beobachten gibt und
dem Auge nähert, so ist der Punkt, in welchem die Probe erstmals scharf gesehen wird,
der Fernpunkt. Misst man die Streck in Metern und nimmt daraus den Kehrwert
(1/Strecke in m) so erhält man die Refraktion des kurzsichtigen Auges. Liegt dieser
Punkt z.B. in 0,5m Abstand, so ist die Refraktion 1/-0,5= -2,00 Dioptrien. Man kann sich
dabei ein Koordinatensystem vorstellen wobei alles vor dem Auge als Minus gewertet
wird und alles hinter dem Auge als Plus. Dieser errechnete Wert gibt uns gleichzeitig
auch das ungefähre Brillenglas an, welches die/der Myope als Korrektur benötigt.
Allerding ist dies nur ein Anhaltspunkt und kann somit von der letztendlich benötigten
Korrektur abweichen. Gegenüber der/dem nichtkorrigierten Kurzsichtigen kann
die/der Kurzsichtige welche/r eine Brille trägt, Dinge in größerer Entfernung
betrachten, wodurch müheloseres und scharfes Sehen ermöglicht wird.
[3] Raskop
10
5.2 Das weitsichtige Auge (Hyperopie)
Die Hyperopie ist eine Fehlsichtigkeit die auf zwei Arten entstehen kann. Sehr häufig ist
das Auge, im Verhältnis zu dessen Brechkraft, zu klein gewachsen. Im selteneren Fall
ist die Gesamtbrechkraft des optischen Systems, bei normaler Augenlänge zu gering.
Diese Art der Hyperopie kann auch die Folge einer Verletzung oder durch eine
Operation, bei der die Augenlinse entfernt wird, entstehen.
Sowohl Längen- als auch Brechungshyperopie führen dazu, dass Lichtstrahlen, die das
Auge durchlaufen, auf der Netzhaut einen unscharfen Zerstreuungskreis bilden und
erst virtuell hinter der Netzhaut ein scharfes Bild ergeben.
„Der Fernpunkt liegt virtuell hinter dem Auge. Der Ferpunktabstand wird, da er in
Lichtrichtung verläuft, positiv.“ [4] (Diepes, Seite 56)
Daraus folgt, dass das Refraktionsdefizit des hyperopen Auges negativ ist, somit einer
Zerstreuungslinse entspricht und die Fernpunktrefrakion/der Fernpunktabstand positiv
ist.
Abbildung Brechungs-Hyperopie
(Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an Heinz Diepes: Refraktionsbestimmung)
In der Korrektion benötigt ein hyperopes Auge daher eine Konvexlinse, die die
Lichtstrahlen sammelt und diese ohne Zerstreuungskreis scharf auf die Netzhaut
abbildet.
11
Die Hyperopie ist die häufigste Ametropie, kann sich aber bei Kindern durch das
Wachstum noch reduzieren. Oftmals bleibt eine Hyperopie unerkannt, da die
Kundin/der Kunde durch Nahakkommodation die Fehlsichtigkeit teilweise oder ganz
ausgleichen kann und folglich kein subjektiv schlechtes Sehen wahrnimmt. Allerdings
kann eine unkorrigierte oder zu niedrig korrigierte Hyperopie aufgrund der
Nahakkommodation in die Ferne zu asthenopischen Beschwerden, wie
Kopfschmerzen, brennenden oder tränenden Augen oder Müdigkeit, führen.
In der Refraktion gestaltet sich die korrekte Messung hyperoper Personen, besonders
Personen unter dem 30. Lebensjahr, häufig als schwierig. Junge Hyperope gleichen ihre
Fehlsichtigkeit durch Akkommodation meist vollständig aus und geben diesen
Akkommodationszustand oft auch während der Refraktion, trotz zusätzlichem
Nebelglas, nicht auf. Es kann sein, dass das Auge so stark an den akkommodierten
Zustand gewöhnt ist, dass die Akkommodation erst nach längerem tragen einer
Fernbrille mit Plusstärken in seine Ruhelage geht. Erst dann ist eine exakte Refraktion
mit Vollkorrektion möglich und sinnvoll.
Ziel unsere Diplomarbeit war es, herauszufinden welche der beiden verglichenen
Messmethoden sich besser eignet, den gewohnten Akkommodationszustand und die
daraus resultierende Konvergenz während der Refraktion zu lösen und dadurch
Refraktionsfehler bei Hyperopen zu minimieren oder bestenfalls auszuschließen.
12
5.3 Astigmatismus (Stabsichtigkeit)
Unter Astigmatismus, auch häufig Hornhautverkrümmung genannt, versteht man in
der Augenoptik ein Auge bei dem sich ungleiche Refraktionsdefizite ergeben, die durch
zwei senkrecht gekreuzten Hauptschnitte entstehen. Einer dieser Hauptschnitte ist
stärker brechend und exakt 90 Grad dazu liegt der schwächer brechende Hauptschnitt.
Die Folge ist ein verzerrtes Netzhautbild, welches zum Beispiel statt einem Kreis eine
Ellipse darstellt. Der regelmäßige Astigmatismus wird durch die Richtung der
Hauptschnitte in Astigmatismus rectus (vertikal), Astigmatismus inversus (horizontal)
und Astigmatismus obliquus (schräg) unterteilt. Liegt der stärker brechende
Hauptschnitt, auch steilerer Hauptschnitt genannt, senkrecht auf ungefähr 90°, so ist
die Rede von einem Astigmatismus rectus. Liegt der stärker brechende Hauptschnitt
waagrecht auf ungefähr 180°, so ist es ein Astigmatismus inversus und liegt der
stärkere Hauptschnitt schief auf ungefähr 135° oder 45°, so spricht man von einem
Astigmatismus obliquus.
Ist der Gesamtbrechwert eines Auges astigmatisch, so wird dieser mittels zylindrischer
Korrektionsgläser ausgeglichen. Diese Brillengläser haben zwei senkrecht aufeinander
stehende unterschiedlich gekrümmte Radien. Die Vorgehensweise der Messung eines
Zylinders wird im Kapitel Subjektive Refraktion 9 erklärt.
[5] (Berke A, Färber R.)
13
6 Visus
„Der Visus ist die geometrisch optische Leistungsbeschreibung eines Auges.“ [6] (Pöltner
G.-Skriptum „Einführung Refraktion“-Merksatz Schober)
Die Bezeichnung „Visus“ wird verwendet um die Sehschärfe eines Auges zu erklären.
Dabei geht man von einem Auflösungsvermögen für zwei eng beieinanderliegende
Punkte aus. Die Messung des Auflösungsvermögens wird mittels Sehzeichen und
definierten Messbedingungen durchgeführt. Die Strichbreite und Aussparungsbreite
dieser Sehzeichen erscheint unter einem Winkel von 1 Winkelminute Minute. Die für
diese Facharbeit verwendeten Optotypen sind Buchstaben, die logarithmisch
berechnet sind.
[7] Diepes
Interessant ist der monokulare Visus pro Auge sowie der binokulare Visus. Um einen
Vergleich feststellen zu können, wird der Visus zuerst ohne Korrektion (Visus s.c. =
(lat.) sine correctione freier Visus) und nach der kompletten Refraktion, mit der
Vollkorrektion (Visus c.c = (lat.) cum correctione) ermittelt.
Priorität dieser Facharbeit hatte die Vergleichbarkeit der Enddaten, weshalb wir jeden
Visus mit denselben Kriterien gemessen haben. Von großer Bedeutung, war für uns der
letztendiche Visus mit der Vollkorrektion nach dem binokularen Abgleich, ganz gleich
ob zuvor die konventionelle Refraktion oder die Refraktion in der Nähe mit
Ausgleichsglas angewandt wurde. Es wurden dafür immer dieselben Sehzeichen
verwendet, mit den gleichen Abständen zwischen den Optotypen, auf derselben
Refraktionseinheit und die gleichen Lichtverhältnisse um eine Verfälschung zu
vermeiden. Auch die Messentfernung konnte für den letztendlichen Visus stets
konstant gehalten werden, da mit dem Phoropter auf 6m Entfernung zur Sehtafel
gemessen wurde.
14
Eine Visus Stufe wurde als gesehen gewertet, wenn mindestens 60% der Optotypen
erkannt wurden. Für unsere Auswertung war es allerdings notwendig, die Visusstufen
mit 0,1 aufzuwerten, wenn die zu prüfende Person etwas weniger als 60% der
nächsthöheren Visusstufe noch erkannt hat. Somit ergaben sich Werte wie V 1,1 wenn
noch 2 von 5 der Optotypen des V 1,25 erkannt wurden. Der Grund dafür, war die
leichtere Differenzierung der Verbesserung oder Verschlechterung der erreichten
Sehschärfe.
7 Akkommodation
„Ist die Fähigkeit des Auges den Brechwert zu verändern. Verschieden weit entfernte
Objektpunkte können dadurch scharf gesehen werden.“[8] (Pöltner G., Skriptum „004
Akkommodation“)
Die Akkommodation wird daher grundsätzlich nur zum Betrachten von Gegenständen
in der Nähe verwendet. Ist die Akkommodation bei einem emmetropen Auge in
Ruhelage, werden unendlich weit entfernte Objektpunkte scharf auf die Netzhaut
abgebildet. Der Vorgang der Akkommodation entsteht im Auge durch den Ziliarkörper
und die Augenlinse. Die Augenlinse ist an den Zonulafasern rundum am ringförmigen
Ziliarmuskel befestigt. In Ruhelage ist der Ziliarmuskel entspannt, die Zonulafasern sind
gespannt und halten die Augenlinse in ihrem flachsten Zustand. Durch unbewusstes
anspannen des Ziliarmuskels werden die Zonulafasern gelockert und die Augenlinse
wird etwas kugeliger, dadurch erhöht sich deren Brechkraft und Objekte in der Nähe
können scharf auf der Netzhaut abgebildet werden.
15
Im Laufe des Lebens verliert die Augenlinse ihre Flexibilität wodurch die mögliche
Brechkrafterhöhung geringer wird und ebenso die Akkommodationsbreite. Wird ein
Teil der altersadäquat vorhandenen Akkommodationsbreite für den Blick in die Ferne
aufgewandt, ist für das Scharfsehen auf Objektpunkte in der Nähe nicht mehr
ausreichend Akkommodationsbreite vorhanden und der Objektpunkt kann folglich
nicht scharf auf die Netzhaut abgebildet werden.
Hyperope Personen die zu niedrig oder gar unkorrigiert sind, gleichen ihre
Fehlsichtigkeit durch Nahakkommodation in die Ferne ganz oder teilweise aus. Das
durchgehende Aufrechterhalten des Nahakkommodationszustandes führt aber in den
meisten Fällen zu asthenopischen Beschwerden.
Hinzu kommt, dass die Akkommodation nicht alleine auftritt, sondern ein Anteil des
Naheinstellungstrias ist.
„Unter Naheinstellungstrias versteht man in der Augenheilkunde das gleichzeitige
Auftreten einer Konvergenzbewegung, einer Pupillenverengung (Miosis) und einer
Nahakkommodation, die durch einen übergeordneten neurophysiologischen Regelkreis
miteinander gekoppelt sind. Dabei steht das Ausmaß der Konvergenzbewegung in
einem direkten Verhältnis zur aufgewendeten Akkommodationsleistung, das im
sogenannten AC/A-Quotienten ausgedrückt wird.“ [9] (www.biologie-
seite.de/Biologie/Naheinstellungstrias)
Dieses Phänomen spielt bei der Korrektion Hyperoper Personen eine wichtige Rolle. Da
der Wert der aufgewendeten Nahakkommodation in direktem Verhältnis zum Ausmaß
der Konvergenzbewegung steht, hat der Hyperope bei Ausgleich seiner Fehlsichtigkeit
in die Ferne durch Nahakkommodation automatisch eine Konvergenzstellung seiner
Augen. Eine unkorrigierte oder nicht vollauskorrigierte Hyperopie kann daher
fälschlicherweise als Esophorie erkannt und in Folge falsch versorgt werden.
16
Aus diesem Grund haben wir für unsere Projektarbeit den Kreuztest am Polatest
zusätzlich in die Messreihe aufgenommen. Wir wollten unter anderem herausfinden,
ob bei einer der beiden verglichenen Refraktionsmethoden mögliche
Esophorietendenzen bei Hyperopen deutlich geringer ist.
[9] www.biologie-seite.de
7.1 Akkommodationsrückstand – Lag of accommodation
In den meisten Fällen akkommodiert das Augenpaar nicht exakt auf einen
Objektpunkt, sondern knapp dahinter, also in größerem Abstand vom Augenpaar.
Dieser Anteil, der weniger akkommodiert wird, heißt Akkommodationsrückstand oder
Akkommodationsdefizit. Ein Akkommodationsrückstand von +0,25 bis +0,75 Dioptrien
ist ein normaler Wert und kann unter Umständen zwischen linkem und rechtem Auge
leicht unterschiedlich sein. Natürlich beeinflusst der Akkommodationsrückstand auch
das letztendliche Ergebnis der Refraktion. Es ist davon auszugehen, dass junge
hyperope Personen einen tendenziell höheren Akkommodationsrückstand als myope
Personen derselben Altersgruppe haben.
Eine Theorie erklärt, warum trotz des Akkommodationsdefizites Objektpunkte scharf
gesehen werden können. Es gibt verschiedene Hypothesen darüber, welcher Anteil des
Naheinstellungstrias als erstes den Impuls gibt. Eine Hypothese besagt, dass das
Augenpaar zuerst konvergiert und erst unmittelbar danach akkommodiert. Das
bedeutet, die Akkommodation kann in drei Anteile unterschieden werden. Der erste
Anteil an Akkommodation wird ausschließlich durch die Konvergenzbewegung
ausgelöst. Darauf folgt die Scharfeinstellung, der Anteil der Akkommodation der einen
Objektpunkt tatsächlich scharf abbildet und letztendlich die Abbildungstiefe, die das
Akkommodationsdefizit überbrückt und Objektpunkte können scharf gesehen werden.
[10] Diepes, [2] Hargreaves
17
8 Die objektive Refraktion
Die objektive Refraktion ist eine Refraktionsmethode die kein aktives mitwirken und
keine Angabe über das subjektive Empfinden der Probandin/des Probanden benötigt.
Die Probandin/der Proband wird dazu aufgefordert eine bestimmte Haltung
einzunehmen und sich zu entspannen. Die Bestimmung der Refraktionswerte erfolgt
durch die Augenoptikmeisterin/den Augenoptikmeister mittels einer Messmethode.
Die objektive Messung setzt die Fernakkommodation des Prüflings voraus, da diese
aber nicht mit Sicherheit garantiert werden kann, dient die objektive Refraktion nur als
Grundlage und Richtwert für die nachfolgende subjektive Refraktion. In bestimmten
Fällen, wie zum Beispiel bei Kindern oder Probandinnen/Probanden mit mangelnder
Compliance, kann die objektive Refraktion die subjektive ersetzen. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten die objektive Messung durchzuführen. Unter anderen die
Skiaskopie, der mechanische Refraktometer oder der Autorefraktometer.
Wir haben für unsere Projektarbeit von Skiaskopie und mechanischen Refraktometer
aus Zeitgründen Abstand genommen und mit dem zu Verfügung stehenden
Autorefraktometer in unseren Refraktionsräumen gearbeitet. Der Autorefraktometer
ist eine Apparatur, die ein Muster auf den Augenhintergrund des Prüflings projiziert,
Messgläser vorgibt und das projizierte Muster scharfstellt. Dieser Ablauf erfolgt sehr
schnell und der Autorefraktometer kommt innerhalb kürzester Zeit zu einem Ergebnis.
Die Probandin/der Proband wird lediglich aufgefordert hinter dem Apparat Platz zu
nehmen, sich mit Kinn und Stirn an die Kopfstütze anzulehnen und entspannt auf das
dargebotene Bild im Gerät zu blicken. Zusätzlich gibt uns der Autorefraktometer
Auskunft über den Gesamtaugenabstand den wir in den Phoropter übernehmen
können.
18
9 Die subjektive Refraktion
Nach der objektiven Refraktion folgt stets die subjektive Refraktion, die nur mit der
Aussage der Probandin/des Probanden funktioniert. Der generelle Ablauf beginnt mit
der Bestimmung des freien Visus (s.c.) und falls vorhanden der Visus mit letzter
Korrektion (c.c.). Folglich findet die monokulare Fernrefraktion statt, danach kommt
der monokulare Feinabgleich und geht weiter bis zum binokularen Abgleich (siehe
Kapitel 11). Zum Thema subjektive Refraktionen gehören aber auch die Prüfung der
Winkelfehlsichtigkeit, des Farbsehens, der Kontrastwahrnehmung, die Nahrefraktion
und alle Arten an Refraktionen, in welcher die/der Proband/in ihr/sein subjektives
Empfinden mitteilen muss. Allerdings werden in dieser Facharbeit nur die dafür
benötigten subjektiven Refraktionsmethoden erklärt.
„Grundlage der meisten Verfahren der monokularen subjektiven
Refraktionsbestimmung für die Ferne ist bekanntlich die Sehschärfe oder genauer: die
Änderung der Sehschärfe beim Wechsel des vorgeschalteten Glases.“[11] (Diepes, Seite
258)
Die Probandin/Der Proband bekommt ein Glas vorgeschaltet und muss nun anhand
ihres/seines Seheindruckes berichten ob die Sehschärfe mit diesem Glas besser oder
schlechter ist. Um verschiedenste Unklarheiten im Vorhinein aus dem Weg zu räumen
werden unterschiedliche Fragetechniken verwendet und somit können gezielte
Ergebnisse erlangt werden.
19
9.1 Die konventionelle Refraktion
Als konventionelle Refraktion bezeichnen wir eine der häufigsten angewendeten
Fernrefraktionsmethoden. Klassisch beginnt man mit der Feststellung des Besten
sphärischen Glases monokular auf die Ferne. Zweiter Schritt ist die Messung des
Zylinders bei astigmatischem Auge, während die Sphäre teilweise nachkorrigiert
werden muss. Hat man nun ein Auge vollkorrigiert, so misst man das zweite Auge
monokular, auf gleiche Weise. Nachdem beide Augen vollkorrigiert sind, folgt der
binokulare Abgleich unter monokularen Bedingungen. Der Visus wird anfangs ohne
Korrektion notiert und nach den Messungen wieder, um eine Steigerung oder einen
Verlust feststellen zu können. Nun folgt die genaue Erklärung zu den einzelnen
Messvorgängen.
1. Die sphärische Vollkorrektion:
Man beginnt immer mit der Bestimmung des besten sphärischen Glases monokular.
Ein Auge sieht die Sehzeichen während das andere Auge abgedeckt ist. Bei der
sphärischen Refraktion soll stets das stärkste Plusglas bzw. das schwächste Minusglas
mit dem bestmöglichen Visus genommen werden. Die Refraktionistin/Der Refraktionist
muss sich bewusst sein, dass das beste sphärische Glas erreicht wurde, wenn der Visus
fällt sobald man mehr Plus gibt und nicht steigt, wenn man mehr Minus gibt.
Die Fragestellung bei Plus Gläsern lautet somit immer: „Wird es mit dem nächsten Glas
schlechter oder bleibt es gleich?“
Die Fragestellung bei Minus Gläsern lautet daher wie folgt: „Wird es mit dem nächsten
Glas besser oder nur kleiner und schwärzer?“
Sobald die Probandin/der Proband weder das Plus annimmt, noch eine Verbesserung
mit mehr Minus erreicht, wurde das beste sphärische Glas ermittelt.
20
2. Astigmatismus Bestimmung mit dem Kreuzzylinder
Bei einem astigmatischen Auge reicht für eine optimale Sehleistung die Korrektion mit
dem besten sphärischen Glas oftmals nicht aus. Besondere acht sollte man auf den bis
jetzt erreichten Visus geben, denn ist der niedriger als erwartet, liegt häufig ein
Astigmatismus vor. Dieser kann mit zylindrischen Gläsern ausgeglichen werden solange
es keinen Pathologischen Grund dafür gibt.
Nachdem das beste sphärische Glas bereits ermittelt wurde, werden mittels
Kreuzzylinder die Zylinderstärke und die Achsenlage bestimmt. Der Kreuzzylinder (kurz
KZZ) besteht aus zwei Planzylindern, einmal mit einem negativen Wert und einmal mit
einem positiven Wert, aber jeweils mit demselben Betrag. Die Achsen der Planzylinder
liegen 90° zueinander. Die zwei gebräuchlichsten KZZ sind ±0,25 und ±0,50.
Der ±0,25 KZZ hat einen sphärischen Wert von +0,25 Dioptrien und einen zylindrischen
Wert von -0,50 Dioptrien. Im Grunde ist der Zylinder immer doppelt so hoch als die
Sphäre und besitzt das gegenteilige Vorzeichen.
Der ±0,50 KZZ hat einen sphärischen Wert von +0,50 Dioptrien mit -1,00 Dioptrie
Zylinder.
Hat die prüfende Person mit dem besten sphärischen Glas einen Visus über 0,5
erreicht, so verwendet man den ±0,25 KZZ. Erreicht er keinen Visus von 0,5, verwendet
man den ±0,50 KZZ.
Um einen deutlicheren Unterschied zu erzeugen, schaltet man nun die höchst
gesehene Visusstufe auf 1- 2 Visusstufen größer. Der KZZ wird mit den roten Punkten
(Minuszylinder Achse) zuerst auf 90° gelegt auf 180°, auf 135° und zuletzt auf 45°.
Die Fragestellung lautet: Ist der Seheindruck mit dem Glas besser, oder ohne?
21
Ist einer der Lagen besser als ohne KZZ, liegt eine Hornhautverkrümmung vor und die
komplette Sphäro-Zylindrische Kombination kann in den Phoropter eingesetzt werden.
Nun überprüft man die Stärke indem man den KZZ mit den roten Punkten auf die
Minuszylinderachse legt und dann wendet, sodass die weißen Punkte (Pluszylinder) auf
der Minuszylinderachse liegen.
Die Fragestellung lautet: Ist der Seheindruck mit dem Glas Nummer eins besser, oder
mit dem Glas Nummer zwei?
Ist die Antwort, dass der Seheindruck mit dem Glas besser ist wo die roten Punkte
aufliegen, muss der Zylinder verstärkt werden und ist es mit den weißen besser, muss
er abgeschwächt werden.
Wurde anfangs jedoch keine Achsenlage als besser wahrgenommen so vergleicht man
direkt die Sehendrücke durch wenden, zwischen 90° mit 180° und 45° mit 135°
Die Fragestellung lautet: Ist der Seheindruck mit dem Glas Nummer eins besser, oder
mit dem Glas Nummer zwei?
Ist wieder keine davon besser, liegt kein Astigmatismus vor. Ist ein Seheindruck besser,
ist der Zylinder vermutlich kleiner als der KZZ.
Zum Prüfen der Achse wird der KZZ mit dem Stiel auf die Minuszylinderachse gelegt.
Auch hier wird er gewendet und der Seheindruck mit Nummer 1 und Nummer 2 wird
verglichen. Die Achse wird in Richtung Minusachse (rote Punkte) nachgedreht bis beide
Bilder gleich sind. Dies sollte schon nach dem Einsetzen des ersten Zylinders
durchgeführt, weil die Stärke oft abweicht, wenn die Achse nicht exakt ist.
[12] Diepes
22
9.2 Die subjektive Refraktion unter Akkommodationskontrolle
Um eine Akkommodationskontrolle zu erhalten, wird die Refraktion auf 40cm
Entfernung unter Vorgabe von zusätzlichen +2,50 Dioptrien durchgeführt.
Präsentiert man die Optotypen in einem Abstand von 40cm, ohne Vorgabe von
zusätzlichen +2,50 Dioptrien ist der Proband gezwungen auf diese Nahdistanz zu
akkommodieren. Der Kehrwert von 40cm ergibt +2,50 Dioptrien, das heißt der
Proband müsste ohne Zusatz +2,50 Dioptrien seiner Akkommodationsbreite
aufwenden, um auf 40cm scharf lesen zu können. Nach Vorgabe der zusätzlichen +2,50
Dioptrien ist die Akkommodation auf diese Distanz theoretisch verhindert. (siehe
Kapitel 8.Akkommodation, 8.1 Lag of Accommodation)
Abbildung Phoropter in Konvergenzstellung mit Nahmessstab auf 40 cm
(Bildquelle: eigene Aufnahme)
23
Der Ablauf der Refraktion unter Akkommodationskontrolle verläuft sehr ähnlich wie
die konventionelle Refraktion, mit kleinen Abweichungen. Nach Feststellung des freien
Visus wird der Phoropter in Konvergenzstellung gebracht und der Nahmessstab wird
montiert. Manche Geräte haben die Möglichkeit zusätzlich zur Konvergenzstellung
auch die Blicksenkung anzupassen. Da an unserem Phoropter keine Neigung möglich
ist, wurden die Messungen nur in Konvergenzstellung durchgeführt.
Unter Vorgabe von zusätzlichen +2,50 Dioptrien werden nun die Optotypen in 40cm
präsentiert. Wie auch in der konventionellen Refraktion werden die objektiven
Messwerte als Grundlage verwendet. Ab diesem Zeitpunkt verläuft die Refraktion
ident mit der konventionellen Refraktion. Es werden monokular jeweils Sphäre,
Zylinder und Zylinderachse bestimmt und ein abschließender binokularer Feinabgleich
am Kreuztest am Polatest unter Nebelung von zusätzlichen +0,75 Diotprien
durchgeführt. Während unserer Messungen waren wir bei vereinzelten
Probandinnen/Probanden gezwungen die Nebelung für den Kreuztest am Polatest auf
+0,50 oder +0,25 Dioptrien zu verringern, da manche den Kreuztest nicht mehr zu
einem Bild verschmelzen konnten und somit keine Angaben über den
Schwärzungsunterschied geben konnten.
Die abschließende Messung des vollkorrigierten Visus und der Phorietendenz haben
wir für unsere Projektarbeit ohne Vorgabe von zusätzlichen Plusgläsern in der
normalen Refraktionsentfernung von 6 Metern durchgeführt. Einerseits um Werte zu
erhalten die wir in der Auswertung tatsächlich vergleichen können, andererseits weil
die höchste Visusstufe auf der Nahmesstafel bei 1,0 liegt.
24
9.3 NRA und PRA
Die Grundlage für die Refraktion unter Akkommdoationskontrolle bildet die Messung
der NRA (negative relative Akkommodation) und die PRA (positive relative
Akkommodation).
Um die NRA zu messen wird bei bereits vorgegebener vollkorrigierenden Fernstärke
die Messung in 40cm auf die Duan´sche Strichfigur, bei vorgeneigtem Phoropter in
Konvergenzstellung, durchgeführt. Es werden solange Plusgläser vorgegeben, bis der
Proband die Strichfigur nicht mehr scharf wahrnehmen kann. Dies ist das Ergebnis der
negativen relativen Akkommodation.
Für die Messung der PRA verläuft die Messung gleich, nur unter Vorgabe von
Minusgläsern, bis die Strichfigur nicht mehr scharf wahrgenommen werden kann.
Aus der Differenz von NRA und PRA kann man die RAB (relative
Akkommodationsbreite) berechnen und in weitere Folge auch den Nahzusatz
bestimmen.
Bei korrekter Vollkorrektion beträgt die negative relative Akkommodation +2,50
Dioptrien auf 40 cm. In Folge dessen, kann davon ausgegangen werden, dass bei der
Refraktion in 40cm unter Vorgabe von +2,50 Dioptrien eine genaue Vollkorrektion für
die Ferne erreicht werden kann. Diese Messmethode entspricht unserer verwendeten
subjektiven Refraktion unter Akkommodationskontrolle, beschrieben unter Punkt 9.2.
25
10 Der binokulare Abgleich
Das Ziel der Refraktion ist immer das binokulare Sehen gewährleisten zu können, falls
die physiologischen Gegebenheiten das voraussetzen.
Da ein Refraktionsgleichgewicht mit beiden Augen erreicht werden soll, verwendet
man binokulare Abgleichtests. Zudem bestrebt man die Vollkorrektion beider Augen.
Um einen binokularen Abgleich ordnungsgemäß durchführen zu können und um
eindeutige Angaben von der prüfenden Person zu erhalten sind folgende Faktoren
maßgebend: Eine monokulare Vollkorrektion sowie einen guten monokularen Visus
auf beiden Augen. Der Visus muss annähernd gleich auf beiden Augen sein und eine
stärkere Anisometropie (ungleiche Fehlsichtigkeit beider Augen) welche zur Folge eine
Aniseikonie trägt, darf nicht vorliegen. Der Abgleich wird mit sphärischen Gläsern
durchgeführt, welche maximal ±0,5 Dioptrien betragen.
[13] Diepes
26
10.1 Der binokulare Abgleich am positiv polarisierten Polakreuz
Nach Abschluss der subjektiven monokularen Refraktion und des Erreichens der
Vollkorrektion sollte stets ein binokularer Abgleich erfolgen um ein
Refraktionsgleichgewicht zu erlangen. Es sei umstritten welcher Test dafür am besten
vorgesehen ist, wichtig ist nur, dass beide Auge einen annähernd gleichen Seheindruck
erhalten wie es zum Beispiel der Pola-Kreuztest ermöglicht. Das Sehzeichen (in
unserem Fall das Kreuz) ist positiv polarisiert und der Hintergrund ist negativ
polarisiert. Man schaltet dem Prüfling mit der Vollkorrektion den Polarisationsfilter auf
beiden Augen vor. Wichtig dabei ist, dass die Polfilter in entgegengesetzter Richtung
polarisieren, sprich das eine Auge (Rechtes Auge) hat den Polfilter mit 45° Grad
vorgeschalten und vor dem anderen Auge (Linkes Auge) wird der Filter mit 135° Grad
vorgesetzt. Dies bewirkt einen unterschiedlichen Seheindruck pro Auge.
Um ein akkommodieren auf das polarisierte Kreuz zu verhindern, gibt man ein
zusätzliches Nebelglas mit +0,75 Dioptrien vor jedes Auge dazu. Die Probandin/Der
Proband hat nun seine Vollkorrektion, das Nebelglas und den Polarisationsfilter im
Phoropter. Das Pola-Kreuz wird vorgeschaltet und die Probandin/der Proband muss
den senkrechten Balken und den waagrechten Balken auf seine Schwärze beurteilen.
Es gilt herauszufinden ob sich die beiden Balken in Kontrast bzw. Schwärze
unterscheiden.
Sollte der senkrechte Balken (R) schwärzer als der waagrechte Balken (L) sein, so gibt
man +0,25 Dioptrien vor das rechte Auge um eine Schwärzungsgleiche zu erreichen.
Wenn dies nicht erreicht wird, gibt man -0,25 Dioptrien vor das linke Auge.
Ist aber zuerst der waagrechte Balken (L) der Schwärzere, so gibt man +0,25 Dioptrien
vor das linke Auge. Entsteht dadurch keine Schwärzungsgleiche, so versucht man es
mit -0,25 Dioptrien vor dem rechten Auge.
Ziel ist es, eine Gleichheit der Schwärze zu erreichen.
27
11 Der Kreuztest am Polatest (Phorietendenz)
Der Kreuztest am Polatest ist ein positiv polarisierter Test und wird binokular mit
vorgehaltenem Polfilter durchgeführt. Voraussetzung ist die Vollkorrektion des
Prüflings.
Die Testanordnung zeigt ein in alle Richtungen gleich großes Kreuz, wobei das rechte
Auge den senkrechten und das linke Auge den waagerechten Balken wahrnimmt. Die
Mitte des Kreuzes ist weiß, dadurch kann eine Orthophorie eindeutig erkannt werden
und zusätzlich ist es für den Prüfling einfacher anzugeben wie groß die Auswanderung
eines Balkens ist. Liegt eine Orthophorie vor, sieht der Proband ein Kreuz ohne
Auswanderungen.
Abbildung Kreuztest am Polatest
(Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an Heinz Diepes: Refraktionsbestimmung)
28
Bei einer Exophorie wandert der senkrechte Balken nach links, bei einer Esophorie
wandert der senkrechte Balken nach rechts. Je nach Stärke der vorliegenden Phorie,
kann die Auswanderung größer oder kleiner sein. Zeitgleich kann man am Kreuztest
am Polatest auch Höhenphorien erkennen. Ist der waagrechte Balken nach oben
versetzt handelt es sich um eine Hyperphorie des rechten Auges, ist der Balken nach
unten versetzt ist es eine Hyperphorie am linken Auge. Auch eine Kombination aus
Höhen- und Vertikalphorie kann am Kreuztest erkannt werden.
Abbildung Phorietendenzen
(Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an Heinz Diepes: Die Refraktionsbestimmung)
Für eine Prismenkorrektion ist der Kreuztest alleine nicht ausreichend, sondern wird
mit anderen Heterophorietests in eine Messreihe angeordnet.
Wir haben den Kreuztest am Polatest in unsere Diplomarbeit als abschließenden Test
in unsere Messreihe aufgenommen, um eventuell vorhandene Phorietendenzen
vergleichen zu können. Wir haben jede Probandin/jeden Probanden gebeten eine
Skizze des subjektiven Seheindruckes auf das Refraktionsprotokoll zu zeichnen. Im
Protokoll wurde nur eine Phorietendenz niedergeschrieben, wir haben keine
Phoriekorrektion vorgenommen und folglich auch keine Angaben der Prismendioptrien
gemacht. Eines unsere Ziele war es, herauszufinden ob bei einer der beiden
Refraktionsmethoden Phorietendenzen nach der Vollkorrektion deutlich geringer sind
als bei der anderen Methode.
29
12 Der Testaufbau
Um in der Auswertung vergleichbare Testergebnisse zu erhalten, haben wir alle
Messungen unter denselben Bedingungen durchgeführt. Unsere Schule, die PHTL für
Optometrie, hat uns die für unsere Messungen benötigten Geräte auch außerhalb der
Unterrichtszeit dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Alle Messungen wurden in
der Refraktionskoje West 2 auf dem Zeiss Refraktionsbildschirm „i.Polatest“ und dem
Phoropter „Magnon RT – 500“ durchgeführt und protokolliert. Um keine
Abweichungen im Kontrast zu erhalten, haben wir vor jeder Messung für dieselben
Lichtverhältnisse im Raum gesorgt und die Jalousien geschlossen, um von wechselnder
Helligkeit im Freien unabhängig zu sein.
Für die objektive Refraktion fiel unsere Wahl auf den Autorefraktometer „Rodenstock
CX – 520 AUTO REF/KERATOMETER“. Ausgehend von diesen objektiven
Refraktionswerten und des angegebenen Gesamtaugenabstandes haben wir die
subjektiven Refraktionen auf der Refraktionseinheit durchgeführt. Wir haben uns
entschieden sowohl für die konventionelle, als auch für die Refraktion unter
Akkommodationskontrolle, einzeilige Buchstaben als Optotypen zu verwenden.
Um während der Messungen keinen wichtigen Schritt unserer aufgebauten Testreihe
zu vergessen, haben wir Checklisten angefertigt und anhand dieser die Messungen
genau durchgeführt.
30
12.1 Checkliste konventionelle Refraktion:
• Anamnese (Asthenopische Beschwerden, bekannte Phorien, Brille od. CL,
medizinische Vorgeschichte, Medikamente)
• Objektive Refraktion mit dem Autorefraktometer
• Freier Visus monokular und binokular auf 6 Meter
• Refraktion am Zeiss Gerät West 2 (Sphäre und Zylinder), ausgehend von den
objektiven Werten
• Sehzeichen: Buchstaben, Einzeilig bis zum maximalen Visus;
• Binokulare Feinabgleich am Kreuztest mit Polfilter unter Vorgabe einer
Nebelung mit +0,75dpt)
• Feinabgleich mit +/-0,25dpt auf 6m
• Nebelglas entfernen, Polfilter entfernen
• Eso/Exo Tendenz am Kreuztest am Polatest auf 6 Meter
• Monokularer Visus mit Vollkorrektion
• Binokularer Visus mit Vollkorrektion
• Werte notieren
31
12.2 Checkliste Refraktion unter Akkommodationskontrolle:
• Anamnese (Asthenopische Beschwerden, bekannte Phorien, Brille od. CL,
medizinische Vorgeschichte, Medikamente)
• Objektive Refraktion mit dem Autorefraktometer
• Freier Visus monokular und binokular auf 6 Meter
• +2,50 vorgeben, Konvergenzstellung des Phoropters, Nahmessstab montieren
• Refraktion am Zeiss Gerät West 2 mit Nahmessstab und Optotypen in 40cm
(Sphäre und Zylinder)
• Sehzeichen: Buchstaben, bis max. Visus (in diesem Fall 1,0)
• Binokularer Feinabgleich mit +/- 0,25dpt am Kreuztest im Zeiss Nahmessgerät
mit Polfilter (Nebeln mit +0,75dpt)
• Nebelglas entfernen
• Nahmessstab, +2,50dpt und Konvergenzstellung entfernen
• Eso/Exo Tendenz am Kreuztest am Polatest auf 6m mit Polfilter
• Polfilter entfernen
• Monokularer Visus auf 6m
• Binokularer Visus auf 6m
• Werte notieren
Bild: Phoropter in Konvergenzstellung
mit montiertem Nahmessstab
(Bilquelle: eigene Aufnahme)
32
13 Die Auswertung der Messergebnisse
Für die Auswertung unserer Ergebnisse haben wir die Messwerte der konventionellen
Refraktion als Ausgangswert verwendet. Von diesen jeweiligen Werten ausgehend,
haben wir die Differenz zum Messwert der Refraktion unter Akkommodationskontrolle
gebildet. Im Zuge unserer Projektarbeit haben wir 30 Probanden vermessen, davon 20
Myope und 10 Hyperope.
13.1 Veränderung der Dioptrien
Abbildung 13.1.:
Bei der Auswertung der Messdaten fällt auf, dass bei nur 20% der gemessenen
Probandinnen/Probanden konventionelle Refraktion und Refraktion unter
Akkommodationskontrolle, exakt gleiche Ergebnisse liefern.
80%
20%
Veränderung
keine Veränderung
33
13.2 Übersicht der Dioptrienveränderungen
Abbildung 13.2.:
In diesem Diagramm zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Prüflinge bei der
Refraktion unter Akkommodationskontrolle auf mehr Minus angesprochen haben. Bei
zwei Personen blieb der sphärische Wert gleich, allerdings sprachen sie auf einen
höheren Minuszylinder an. Nur 4 der gemessenen Personen haben die aufgestellte
These bestätigt und einen höheren Pluswert angenommen, aber nur einer davon war
Hyperop. Nicht Aussagekräftig genug waren die Messdaten von zwei Personen, bei
denen jeweils ein Auge mehr Minus verlangte und das andere mehr Plus akzeptierte.
53%
13%7%
20%
7%
16 Personen:Binokular sphärischmehr Minus4 Personen: Binokularsphärisch mehr Plus
2 Personen: 1 Augemehr Plus/1 Augemehr Minus6 Personen: keineVeränderung
2 Personen:zylindrisch mehrMinus
34
13.3 Auswirkung auf den Visus
Abbildung 13.3.:
Dieses Diagramm stellt die Visus Veränderung der 24 Personen dar, bei welchen eine
Änderung der Messwerte vorliegt. Nur bei 25% (6 Personen) hatte die Dioptrien
Änderung eine Auswirkung auf den Visus. Jedoch ist der Visus nur bei 2 Probanden
wahrnehmbar gestiegen, bei 4 Probanden sogar gesunken. Da bei diesen 2 Personen,
deren Visus nach der Refraktion unter Akkommodationskontrolle gestiegen ist, eine
Person hyperop und die andere myop waren, konnten keine Schlüsse daraus gezogen
werden, ob sich eine der beiden Methoden bei einer Fehlsichtigkeit besser bewährt.
75%
25%
Unverändert
Verändert
35
13.4 Stärkenunterschied um ±0,25 dpt
Dieses Diagramm stellt die Änderung um ±0,25 Dioptrien dar. 20% (6 Personen)
verlangten bei der Refraktion unter Akkommodationskontrolle um –0,25 dpt mehr,
10% (3 Personen) hingegen um +0,25 dpt mehr. Das grüne Feld zeigt die „sonstigen“
Personen, die bereits in den anderen Diagrammen ausgewertet wurden oder keine
Dioptrien Veränderung hatten.
20%
10%70%
Stärkenunterschied um ±0,25 dpt
-0,25
+0,25
sonstige
36
13.5 Stärkenunterschied über ±0,50 dpt
Abbildung 13.4.:
In diesem Balkendiagramm wird die Stärkendifferenz von mindestens ±0,50 Dioptrien
veranschaulicht. Die Werte der konventionellen Refraktion wurden als Ausgangswert
verwendet und mit jener der Refraktion unter Akkommodationskontrolle verglichen.
Von unseren 30 gemessenen Probanden (davon 20 myop; 10 hyperop) haben 7 Myope
(23,3%) und 3 Hyperope (10%) mehr als 0,50 dpt Minus mehr benötigt. Sichtbar wird,
dass nur eine Person mehr als 0,50 dpt Plus angenommen hat.
0
5
10
15
20
25
30
Probanden(gesamt 30)
> -0,50 dpt > +0,50 dpt
Myop 20 7 1Hyperop 10 3 0
Myop
Hyperop
37
14 Fazit
Das Ziel dieser Facharbeit ist eine Differenzierung der Refraktionswerte des Vergleichs
zwischen der konventionellen Refraktion mit der Refraktion unter
Akkommodationskontrolle. Allgemein lassen sich eine Erhöhung der Minusstärke
sowie die Abschwächung der Plusstärke feststellen. Eine Visus Steigerung konnte sich
dadurch allerdings nicht deutlich erkennbar machen: Was uns daraus schließen lässt,
dass die Messung auf 40cm mit zusätzlichen +2,50 Dioptrien zu einer zu leichten
Überkorrektion bei Myopen und einer Unterkorrektion bei Hyperopen Personen
führen kann.
Da wir die Messung unter Akkommodationskontrolle stets nach der konventionellen
Refraktion angereiht haben, könnte die lange Belastung der Augen zu einer Zunahme
der Minusstärke geführt haben. Die Abweichung betrug in einigen Fällen nur -0,25
Dioptrien und könnte auf den höheren Kontrast zurückgeführt werden. Diese Theorie
würde die geringe Anzahl der Visussteigerung zusätzlich erklären.
In 11 Fällen (36,6%) konnte eine Änderung von ±0,50 Dioptrien oder mehr eruiert
werden, doch auch hier konnte nur bei einer Person eine deutliche Verbesserung des
Fernvisus gemessen werden. 10 dieser 11 Prüflinge (entsprechen 90,9%) benötigten
bei der Messung unter Akkommodationskontrolle mehr Minuswirkung.
Dies könnten wir uns dadurch erklären, dass die gewohnte Tiefenschärfe und der
Kontrast auf 40cm aufgrund des Ausgleichsglases nicht mehr gegeben waren und
durch ein zusätzliches Minusglas kompensiert wurde. Ein anderer Faktor für die
Veränderungen um nur ±0,25 dpt könnte der Lag of Accommodation sein, da ein
Akkommodationsrückstand von in etwa 0,50 dpt als Durchschnitt gilt.
38
Zusätzlich könnte der starke Akkommodationsdrang unserer jungen Prüflinge, die
unter Umständen trotz Ausgleichsglas nicht in völliger Ruhelage der Akkommodation
gelangen und das Ausgleichsglas als Nebelung empfinden, ein Grund sein. Zu
berücksichtigen ist dabei, dass die nicht vorhandene Blicksenkung des Phoropters
allgemein die Messergebnisse verändert haben könnte, da wir gegen den natürlichen
Reflex der Kopfneigung beim Blick in die Nähe gearbeitet haben. Allerdings sind diese
Theorien nur Überlegungen unsererseits, die wir erst im Zuge der Auswertung
aufgestellt haben. Die Belegung der Thesen war nicht im Rahmen unserer
Möglichkeiten.
Bei der konventionellen Refraktion wurden 10 Phorietendenzen festgestellt, aber nur
bei 3 (33,3%) erwies sich tatsächlich eine leichte Abweichung mit der 2.
Refraktionssmethode. Aufgrund dessen, empfanden wir diese Messergebnisse als
nicht Aussagekräftig.
39
15 Anhang
15.1 Verfasser der einzelnen Kapitel
1. Abstract Þ El-Zawi, Oetsch
2. Einleitung Þ El-Zawi, Oetsch
3. Ziel der Arbeit Þ El-Zawi, Oetsch
4. Anamnese Þ Oetsch
5. Fehlsichtigkeiten
5.1. Myopie Þ El-Zawi
5.2. Hyperopie Þ Oetsch
5.3. Astigmatismus Þ El-Zawi
6. Visus Þ El-Zawi
7. Akkommodation Þ Oetsch
7.1. Akkommodationsrückstand Þ Oetsch
8. Die objektive Refraktion Þ Oetsch
9. Die subjektive Refraktion Þ El-Zawi
9.1. Die konventionelle Refraktion Þ El-Zawi
9.2. Die subjektive Refraktion unter Akkommodationskontrolle Þ Oetsch
9.3. NRA und PRA Þ Oetsch
10. Der binokulare Abgleich Þ El-Zawi
10.1. Der binokulare Abgleich am positiv polarisierten Polakreuz Þ El-Zawi
11. Der Kreuztest am Polatest Þ Oetsch
12. Der Testaufbau Þ El-Zawi, Oetsch
13. Auswertung der Messergebnisse Þ El-Zawi, Oetsch
14. Fazit Þ El-Zawi, Oetsch
40
15.2 Zeitaufzeichnungen El-Zawi Selina
20.Jun 1,5 Std. Gespräch mit Frau Hargreaves
21.Jun 1,5 Std. Gespräch mit Hr. Pöltner
25.Jun 1 Std. Text zusammenstellen für Diplomarbeitsantrag
(Unterschriften der Betreuungslehrer
zwischendurch geholt)
18.Sep 1 Std. Text vorbereiten für die Einreichung des Antrags
(Unterricht mit Hr. Direktor)
19.Sep 1 Std. Infogespräch mit Frau Sieß im Unterricht
25.Sep 2 Std. Text für Einreichung fertigstellen
26.Sep 1 Std. Korrekturlesen des Textes mit Frau Sieß,
anschließend Änderungen vorgenommen.
27.Sep 0,5 Std. Korrekturlesen des Textes mit unserem
Hauptbetreuer Herr Pöltner
05.Feb 2 Std. Aufteilung der Theorie
06.Feb 3 Std. Einlesen in die Literatur
13.Feb 2,5 Std. Einlesen in die Literatur
15.Feb 2 Std. Text Erstellung
18.Feb 3 Std. Texterfassung
20.Feb 2 Std. Refraktionseinheit planen
25.Feb 3 Std. Testmessung, Erstellen der Checkliste,
Problembehebung
27. Feb 0,5 Std. Besprechung
12.Mär 3 Std. Messungen
13.Mär 3 Std. Messungen
41
22.Mär 3,5 Std. Texterfassung
14.Mär 5,5 Std. Messungen
24.Mär 6 Std. Text Erfassung
26.Mär 3,5 Std. Messungen
27.Mär 4 Std. Messungen
27.Mär 2 Std. Bilddateien erstellen
03.Apr 3,5 Std. Messungen
05.Apr 3 Std. Messungen
09.Apr 4 Std. Messungen
11.Apr 3 Std. Text Erfassung
24.Apr 1,5 Std. Text und Formatierung
26.Apr 2,5 Std. Messungen
01.Mai 4,5 Std. Text Erfassung
03.Mai 3 Std. Text Erfassung
04.Mai 2,5 Std. Formatierung
05.Mai 4 Std. Text und Formatierung
06.Mai 7 Std. Zusammenfügen der Themengebiete,
Auswertung der Messergebnisse; Fazit, Abstract,
Einleitung formuliert
06.Mai 0,5 Std. Versenden der Diplomarbeit zum Korrekturlesen
an Herrn Pöltner
08.Mai 0,5 Std. Besprechung Frau Sieß
09.Mai 1 Std. Nachbesprechung Hr. Pöltner
13.Mai 4,5 Std. Korrektur der Diplomarbeit, Hinzufügen von
Fotos, neu Formatieren
42
15.Mai 2 Std. letzte Formatierung und Binden lassen
Gesamt:
105
Stunden
15.3 Zeitaufzeichnungen Oetsch Patricia
20. Juni 1,5 Std. Gespräch mit Fr. Hargreaves
21. Juni 1,5 Std. Gespräch mit Hr. Pöltner
25. Juni 1 Std Text zusammenstellen für Diplomarbeitsantrag (Unterschriften
der Betreuungslehrer zwischendurch eingeholt)
18. Sep. 1 Std. Text vorbereiten für die Einreichung des Antrags
19. Sep. 1 Std. Infogespräch mit Fr. Sieß
25. Sep. 2 Std. Text für Einreichung fertigstellen
26. Sep. 1 Std. Korrekturlesen des Textes mit Fr. Sieß; Änderungen
27. Sep. 0,5 Std. Korrekturlesen des Textes mit Hr. Pöltner
05. Feb. 2 Std. Aufteilung der Theorie
06. Feb. 2 Std. Aufsuchen der Literatur und einlese
15. Feb. 3 Std. Einlesen in die Literatur
16. Feb. 1 Std. Texterstellung
18. Feb. 3 Std. Texterstellung und Planung der Refraktion
43
19. Feb. 2 Std. Texterstellung
20. Feb. 2 Std. Refraktionseinheit planen
25. Feb. 3 Std. Testmessung, Erstellen der Checkliste, Problembehebung
27. Feb. 0,5 Std. Besprechung der Dipl.Arbeit mit Fr. Hargreaves
12. Mär. 3 Std. Messungen
13. Mär. 3 Std. Messungen
14. Mär. 5,5 Std. Messungen
26. Mär. 3,5 Std. Messungen
27. Mär. 4 Std. Messungen
27. Mär. 2 Std. Bilddateien erstellen
03. Apr. 3,5 Std. Messungen
05. Apr. 3 Std. Messungen
09. Apr. 4 Std. Messungen
19. Apr. 3 Std. Texterstellung
26. Apr. 2,5 Std. Messungen
27. Apr. 3 Std. Texterstellung
28. Apr. 4 Std. Texterstellung
02. Mai 1 Std. Formatierung meiner Teilbereiche
03. Mai 3 Std. Texterstellung
04. Mai 3 Std. Texterstellung
44
05. Mai 5 Std. Vollendung und Kontrolle meiner Passagen
06. Mai 7 Std. Zusammenfügen der Themengebiete, Auswertung der
Messergebnisse; Fazit, Abstract, Einleitung formulieren
06. Mai 0,5 Std. Versenden der Dipl. Arbeit an Hr. Pöltner
08. Mai 0,5 Std. Besprechung mit Fr. Sieß
09. Mai 1 Std. Nachbesprechung mit Hr. Pöltner
13. Mai 4,5 Std. Korrektur der Diplomarbeit, Hinzufügen von Fotos, neu
formatieren
15. Mai 2 Std. Letzte Formatierung und binden lassen
Gesamt 99,5 Stunden
45
16 Literaturverzeichnis
[1] Pöltner, G. Skriptum 012 Anamnese
[2] Hargreaves, E. Skriptum Schule
[3] Raskop, E. (1959). Handbuch für den Augenoptiker. Stuttgart: Deva- Fachverlag
8.neubearbeitete Auflage, Seite 146-149
[4] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 56
[5]Berke, A.; Färber, R. Refraktionsbestimmung Teil 1. In Optische und physiologische
Grundlagen (S. 46).
[6] Pöltner, G. Skriptum 001 Einführung Refraktion
[7] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 86
[8] Pöltner, G. Skriptum 004 Akkommodation
[9] biologie-seite.de. Aufgerufen am 03. 05 2019 von https://www.biologie-
seite.de/Biologie/Naheinstellungtrias
[10] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 154
[11] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 258
[12] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 275
[13] Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung. Pforzheim: Heinz Postenrieder 2.
Auflage, Seite 334-335
48
17.1 Refraktionsprotokoll
Probandennummer:
Alter:
Geschlecht:
Anamnese:
Objektive Refraktion:
Sph. Zyl. Achse Visus s.c.
R:
L:
Binokularer Visus s.c.:
Refraktionsergebnis:
Sph. Zyl. Achse Visus c.c.
R:
L:
Binokularer Visus c.c.:
PPhhoorriieetteennddeennzz::
Skizze Kreuztest am Polatest:
Ich stimme zu, dass meine Daten (Name, Alter Ergebnisse,…) zum Zweck –
Durchführung von Sehtests, Verwendung der Daten für die Diplomarbeit – verarbeitet
und in der Diplomarbeit festgehalten werden.
Datum und Unterschrift:
49
Eidesstattliche Erklärung
Selina El-Zawi und Patricia Oetsch erklären hiermit an Eides Statt, dass wir die
vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Verwendung anderer als der angegebenen
Hilfsmittel angefertigt haben. Jegliche aus fremden Quellen direkt oder indirekt
übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher
in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch
noch nicht veröffentlicht.
Hall in Tirol, Mai 2019
Selina El-Zawi Patricia Oetsch