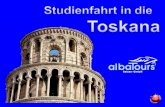Natur und Landschaft - Federal Council...RobertGogel,RuedeFamenen,CH-1446Baulmes(français)...
Transcript of Natur und Landschaft - Federal Council...RobertGogel,RuedeFamenen,CH-1446Baulmes(français)...

SCHRIFTENREIHEUMWELT NR. 325
Bundesamt fürUmwelt, Wald undLandschaftBUWAL
Kartierung undBewertung derTrockenwiesenund -weiden von nationalerBedeutung
Technischer Bericht
Natur und Landschaft


SCHRIFTENREIHEUMWELT NR. 325
Natur und Landschaft
Kartierung undBewertung derTrockenwiesenund -weiden von nationalerBedeutung
Technischer Bericht
Herausgegeben vom Bundesamtfür Umwelt, Wald und LandschaftBUWALBern, 2001
AutorenStefan EggenbergThomas DalangMichael DipnerCornelia Mayer

IMPRESSUM
HerausgeberBundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), CH-3003 Bern
Autorinnen/AutorenDr. Stefan Eggenberg, Atelier für Naturschutz und Umweltfragen UNA AG,Mühlenplatz 3, CH-3011 BernDr. Thomas Dalang, Eidg. Forschungsanstalt WSL,Zürcherstrasse 111, CH-8903 BirmensdorfMichael Dipner, oekoskop, Lautengartenstrasse 6, CH-4052 BaselCornelia Mayer, puls, Mühlemattstrasse 45, CH-3007 Bern
Fachliche BegleitungChristian Hedinger, Res Hofmann, Mary Leibundgut, Alexandre Maillefer,Martin Urech, Gabi Volkart
ZitierungEggenberg, S., Dalang, T., Dipner, M., Mayer, C., 2001:Kartierung und Bewertung der Trockenwiesen und -weiden von nationalerBedeutung. Technischer Bericht. Schriftenreihe Umwelt Nr. 325.Hrsg.: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern. 252 S.
FotosAlle Fotos sind von Stefan Eggenberg, ausser:Christian Hedinger, S. 134 (2. Reihe links), S. 204 (unten rechts),Guido Masé, S. 216 (oben).Photogrammetrie Perrinjaquet, S. 40 (Bild 7), S. 106 (mitte).Die Farb-Infrarot-Luftbilder sind von: Bundesamt für LandestopographieFlugdienst / Koordinationsstelle für Luftaufnahmen (KSL), 8600 Dübendorf
KartenReproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA013260)
Projektleitung BUWALEdith Madl Kubik, Abteilung Natur
ÜbersetzungenRobert Gogel, Rue de Famenen, CH-1446 Baulmes (français)Beatrice Jann, Via Nolgio 3, CH-6900 Massagno (italiano)Hilary Vanessa Martin, av. de Montoie 41, CH-1007 Lausanne (english)In Zusammenarbeit mit Services linguistiques de l’OFEFP – Servizi linguisticidell’UFAFP, Bern
GestaltungInhalt: Visuelle Gestaltung, Nicole Seliner, Plänkestrasse 10, CH-2502 Biel
BezugBUWALDokumentationCH-3003 BernFax + 41 (0) 31 324 02 16, E-Mail: [email protected]: www.admin.ch/buwal/publikat/d/
BestellnummerSRU-325-D
PreisCHF 40.– (inkl. MWSt)
© BUWAL 2001
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 2

ABSTRACTS 6
VORWORT 8
1 ZUSAMMENFASSUNG (Michael Dipner) 9
2 DAS PROJEKT TWW (Michael Dipner) 132.1 Einleitung 142.2 Ausgangslage 142.2.1 TWW: Gefährdete Vielfalt 142.2.2 Gesetzliche Grundlagen 172.2.3 Übrige Rahmenbedingungen 192.3 Projektziele 202.3.1 Übergeordnete Zielsetzungen 202.3.2 Ziele des Teilprojektes Erhebung 212.3.3 Ziele des Teilprojektes Bewertung 222.4 Projektorganisation 232.5 Stand der Arbeiten 242.5.1 Stand der Erhebungsarbeiten 242.5.2 Interpretation der Resultate 252.6 Gesamtplanung 27
3 KARTIERMETHODE (Stefan Eggenberg) 293.1 Problemstellung 313.2 Entwicklung der Methode 333.2.1 Wichtige Vorarbeiten 333.2.2 Meilensteine zur Methodenentwicklung 353.2.3 Methodenvarianten: DIF und INT 373.2.4 Vorgehensvarianten 393.2.5 Vorgehensvariante 2 413.2.6 Vorgehensvariante 3 433.3 Regionalisierungen 453.3.1 Gliederung der Schweiz in Naturräume 453.3.2 Floristische Gliederungen 473.3.3 Naturräumliche Regionen im TWW-Projekt 493.3.4 Beschreibung der Kartierregionen 513.4 Kartiergebiete 533.4.1 Die begangenen Kartiergebiete 533.4.2 Abzusuchende Gebiete 553.4.3 Selektierte Objekte 573.5 Grundlagen der Kartierung 593.5.1 Allgemeines zu Kartiergrundlagen 593.5.2 Luftbilder und Luftbildfolien 613.5.3 Luftbildtypen 633.5.4 Kartierverhalten und Vorbereitung 653.5.5 Kartierablauf in abzusuchenden Gebieten 673.5.6 Kartierablauf bei selektierten Objekten 693.6 Objektkonzept 713.6.1 Allgemeines 713.6.2 Minimalflächen 733.6.3 Flächenschätzung 75
3INHALTSVERZEICHNIS
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 3

INHALTSVERZEICHNIS4
3.7 Grenzkriterien 773.7.1 Regeln zum Abgrenzen von Teilobjekten 773.7.2 Grenzkriterien für die DIF-Methode 793.7.3 Kartiererleichterungen im DIF 813.7.4 Grenzkriterien für die INT-Methode 833.7.5 Einträge in das Luftbild 853.7.6 Allgemeines zum Schwellenschlüssel 873.7.7 Erklärungen zu den Schwellenkriterien 893.7.8 Hauptkriterien des Schwellenschlüssels 913.8 Qualitätssicherung 933.8.1 Fehlerquellen 933.8.2 Ausbildung 953.8.3 Eichung 973.8.4 Kontrolle 983.8.5 Genauigkeitsuntersuchungen 99
4 LUFTBILDINTERPRETATION (Cornelia Mayer) 1014.1 Allgemeines 1034.2 Erstbegehung 1034.3 Stereoskopische Flächenabgrenzung 1054.4 Feldkartierung 1054.5 Stereoskopische Nachbearbeitung 1074.6 Photogrammetrische Auswertung 107
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE (Stefan Eggenberg) 1095.1 Testflächen 1115.1.1 Beschreibung der Vegetation 1115.1.2 Festlegung der Testfläche 1135.1.3 Messung des Mittelpunktes 1155.1.4 Aufnahme der Arten 1175.1.5 Vollständigkeit der Artenliste 1195.1.6 Bestimmung der Vegetation 1215.1.7 Indexschlüssel 1235.1.8 Vegetationsangabe auf dem Protokollblatt 1255.2 Seltene Arten 1275.3 Verbuschung 1295.3.1 Angabe der Verbuschung 1295.3.2 Hauptart Verbuschung 1315.4 Nutzung 1335.4.1 Allgemeines 1335.4.2 Beschreibung der Nutzungstypen 1355.4.3 Schwierige Nutzungsansprache 1375.5 Strukturelemente 1395.5.1 Strukturelemente als Lebensraum für Tiere 1395.5.2 Definition der Strukturelemente 1415.5.3 Beschreibung der Einschlüsse und Grenzelemente 1435.6 Vernetzung 1475.7 Weitere Parameter 1495.7.1 Das Protokollblatt 1495.7.2 Zeit- und Lageparameter 1515.7.3 Vergleich mit Kantonsobjekten 1535.8 Bemerkungen und Hinweise 155
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 4

5INHALTSVERZEICHNIS
6 SINGULARITÄTEN (Stefan Eggenberg) 1576.1 Definition von Singularitäten 1596.2 Typisierung der Singularitäten 1616.3 Aufnahme und Beschreibung der Singularitäten 1636.4 Behandlung der Singularitäten 1656.5 Bewertung und Klassierung der Singularitäten 167
7 VEGETATION (Stefan Eggenberg) 1697.1 Ökologie des Grünlandes 1717.1.1 Komponenten der Vegetation 1717.1.2 Ökogramme der Grünlandgesellschaften 1737.2 Klassifikation der Wiesen und Weiden 1757.3 Vegetationsgruppen 1777.3.1 Vegetationsgruppe AE 1797.3.2 Vegetationsgruppe MBAE 1817.3.3 Vegetationsgruppe MB 1837.3.4 Vegetationsgruppe MBXB 1857.3.5 Vegetationsgruppe XB 1877.3.6 Vegetationsgruppe MBSP 1897.3.7 Vegetationsgruppe SP 1917.3.8 Vegetationsgruppe CB 1937.3.9 Vegetationsgruppe LL 1957.3.10 Vegetationsgruppe OR 1977.3.11 Vegetationsgruppe AI 1997.3.12 Vegetationsgruppe SV 2017.3.13 Vegetationsgruppe CA 2037.3.14 Vegetationsgruppe CF 2057.3.15 Vegetationsgruppe NS 2077.3.16 Vegetationsgruppe FV 2097.3.17 Vegetationsgruppe FP 2117.3.18 Vegetationsgruppe LH 213
8 BEWERTUNG (Thomas Dalang) 2158.1 Grundsätzliches 2178.2 Ablauf der Bewertung in zwei Phasen 2198.3 Elemente der Nutzwertanalyse 2218.4 Bewertung der Vegetationstypen 2238.5 Bewertung der Objekte 2258.5.1 Kriterium Vegetation 2258.5.2 Kriterium Vegetationskundliche Diversität 2278.5.3 Kriterium Floristisches Potential 2278.5.4 Kriterium Strukturelemente 2298.5.5 Kriterium Aggregierungsgrad 2318.5.6 Kriterium Vernetzung 2318.6 Klassieren der Objekte 233
Literaturverzeichnis 236Glossar 238Abkürzungen 244Vegetationsschlüssel 1-3 245Publikationsliste 248
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 5

Keywords: Trockenwiesen und -weiden;Trockenstandort; Arten- und Biotop-schutz, Bundesinventar; Vegetationskar-tierung; Luftbildinterpretation; Lebens-raumbewertung
Die Kartierung und Bewertungvon Trockenwiesen und -weidender Schweiz
Trockenwiesen und -weiden sind vonlandwirtschaftlicher Nutzung geprägte,artenreiche Lebensräume. Die Ausprä-gungen dieses Lebensraumes sind auf-grund unterschiedlicher naturräumlicherund kulturhistorischer Verhältnisse äus-serst vielfältig. 40% der Pflanzenartenund teilweise über 50% der Tierarten, dieauf Trockenstandorte angewiesen sind,befinden sich jedoch auf den Roten Lis-ten und sind gefährdet oder vom Aus-sterben bedroht. Der Grund liegt im nochimmer anhaltenden Flächenverlust. Inden vergangenen 60 Jahren sind schät-zungsweise 90% der Trockenwiesen und-weiden in der Schweiz verschwunden.
Auf der Basis des Bundesgesetzes überden Natur- und Heimatschutz werdendeshalb die wertvollsten Flächen im Rah-men des Projektes “Trockenwiesen und-weiden der Schweiz” (TWW) kartiert undbewertet, damit ihnenmit einemBundes-inventar verstärkt der gesetzlich vorgese-hene Schutz zukommen kann.
Um die Bedürfnisse optimal abdecken zukönnen, wurde eine spezifische, zielorien-tierte Erhebungsmethode entwickelt. ImZentrum steht die differenzierte und luft-bildgestützte Kartierung der Vegetationmittels eines modular aufgebauten Ve-getationsschlüssels. Seit 1995 wird dieMethode in verschiedenen Landesteilenund Naturräumen angewandt und lau-fend verbessert und ergänzt. Parallel da-zu wurde gestützt auf das Modell derNutzwertanalyse ein Bewertungs- undKlassierungsverfahren entwickelt. Damitkönnen Bewertungsideen mit Hilfe vonKriterien unterschiedlicher Qualität undMessgenauigkeit transparent und nach-vollziehbar umgesetzt werden. Der vorlie-gende Bericht beschreibt diese beidenausgereiften Methoden. Als Ergänzungwerden das im Projekt TWW gewählteSingularitätsverfahren sowie erste Resul-tate präsentiert.
ABSTRACTS6
The Cartography and Evaluationof Dry Grassland in Switzerland
Dry grassland sites are species-rich habi-tats characterised by their use for agri-cultural purposes. The distinctive charac-teristics of these habitats vary enormous-ly, depending on the natural region towhich the site belongs, and the culturalhistory of the site. About 40 % of plantspecies growing on dry sites, and in somecases over 50% of the animal species arehowever included in the red lists, and areendangered or threatened with extinc-tion. This is a result of the continuousdecline in the area of dry grassland. It isestimated that about 90 % of dry grass-land in Switzerland has disappeared overthe past 60 years.
Therefore, based on the Federal Law onthe Protection of Nature and Landscape,the most valuable areas are beingmapped and evaluated, as part of a proj-ect called “Dry Grassland in Switzerland”(DGS), so that with a federal inventorythese sites can be given the increasedprotection provided for by law.
A specific, target-oriented surveymethodhas been developed tomeet the needs ofthe project as closely as possible. Thecentral part is the differentiated mappingof the vegetation, using aerial photo-graphs, and a modular vegetation key.Since 1995, the method has been ap-plied in different parts of Switzerland, andin different natural regions, and it hasbeen progressively added to, and im-proved. In parallel with this, a procedurefor the evaluation and classification of drygrassland has been developed, based onthe model of utility analysis. This ap-
proach enables ideas on evaluation to beimplemented in a way that is transparentand comprehensible, using criteria thatvary in quality and accuracy. The presentreport describes both these methods intheir developed form. In addition, the pro-cedure chosen for singularities in the DGSproject is presented, as well as some ini-tial results.
Keywords: dry grassland; dry site;species and biotope conservation; feder-al inventory; cartography of vegetation;interpretation of aerial photographs; habi-tat evaluation
Cartographie et évaluationdes prairies et pâturages secsde Suisse
Les prairies et pâturages secs sont desmilieux riches en espèces conditionnéspar l’exploitation agricole. Ils présententune grande diversité d’aspects en fonc-tion des conditions locales – naturelles,culturelles et historiques. Aujourd’hui,40% des espèces végétales et parfoisplus de 50% des espèces animales in-féodées à ce type de biotopes figurentsur la Liste rouge et sont menacées dedisparition. Cette évolution est due à laconstante régression des surfaces de cetype.
On estime que 90% des prairies et pâtu-rages secs de Suisse ont disparu aucours des 60 dernières années. Les sur-faces les plus précieuses font maintenantl’objet d’une cartographie et d’une éva-luation dans le cadre du projet “Prairies etpâturages secs de Suisse” (PPS), fondésur la loi fédérale sur la protection de lanature et du paysage. Les objets du futurinventaire fédéral des prairies et pâtu-rages secs bénéficieront de la protectionrenforcée prévue par la loi. Une méthodede relevé spécifique a été développéepour répondre de manière optimale auxexigences de leur protection. Elle est
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 6

7ABSTRACTS
La cartografia e la valutazionedei prati e pascoli secchidella Svizzera
I prati e pascoli secchi sono ambienti vi-tali ricchi di specie che portano l’impron-ta dell’utilizzazione agricola. I caratterimultiformi che tali spazi vitali possono as-sumere sono dati dalle diverse condizio-ni naturali e storico-culturali. Il 40% dellespecie vegetali e in parte più del 50% del-le specie animali dipendenti dalle zonearide si trovano sulle Liste rosse e sonominacciate o in via d’estinzione. Il motivorisiede nella costante perdita di superficieche si registra tuttora.
Si stima che negli ultimi 60 anni sia scom-parso il 90% dei prati e pascoli secchi del-la Svizzera. Giusta la legge federale sullaprotezione della natura e del paesaggio,
nell’ambito del progetto „Prati e pascolisecchi della Svizzera“ (PPS) sono statecartografate e valutate le superfici piùpregevoli di questi spazi vitali affinché, at-traverso il loro inserimento in un inventa-rio federale, possano beneficiare dellaprotezione prevista dalla legge.
Per poter soddisfare in modo ottimale leesigenze, è stato sviluppato unmetodo dirilevamento specifico e mirato. Esso sifonda sulla cartografia differenziata dellavegetazione grazie a una chiave della ve-getazione strutturata in maniera modula-re e sostenuta da immagini aeree. Dal1995 questo metodo è impiegato in di-verse regioni del Paese e in diversi am-bienti naturali e costantemente perfezio-nato e completato. Parallelamente è sta-to creato un procedimento di valutazionee classificazione basato sul modello del-l’analisi dei valori di rendimento. In questomodo si possono applicare in modo ri-producibile e trasparente le idee di valu-tazione con l’ausilio di criteri di diversaqualità e precisione. Il presente rapportodescrive queste due metodologie ormaiben sviluppate. Come complemento ven-gono presentati il procedimento sceltonell’ambito del progetto PPS per trattarele singolarità nonché alcuni primi risultati.
Keywords: Prati e pascoli secchi; zonearide; protezione delle specie e dei bioto-pi, inventario federale; cartografia dellavegetazione; interpretazione di immaginiaeree; valutazione di ambienti vitali.
basée sur une cartographie spécifique dela végétation à l’aide de photographiesaériennes et d’une clé de végétationmodulaire. Appliquée depuis 1995 dansdifférentes régions naturelles et géogra-phiques du pays, la méthode est réguliè-rement améliorée et complétée. Paral-lèlement a été développé un processusd’évaluation et de classement des objetsbasé sur le modèle de l’analyse de la va-leur d’utilité. Ainsi, les principes d’évalua-tion peuvent être appliqués de manièreparfaitement transparente avec des cri-tères de qualité de précision variable. Leprésent rapport décrit ces deux mé-thodes déjà largement éprouvées au sta-de actuel de leur développement. Encomplément sont présentés le traitementdes singularités mis au point pour le pro-jet PPS, ainsi que les premiers résultats.
Keywords: prairies et pâturages secs;station sèche; protection des espèces etdes biotopes; inventaire fédéral; carto-graphie de la végétation; interprétationdes photographies aériennes; évaluationdu milieu naturel.
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 7

Blumenreiche Heuwiesen undextensiv genutzte Weiden – einst inunserem Landweit verbreitete Nutzungs-typen: reichen die kantonalen Schutzpro-gramme, reicht die zunehmend ökologi-sche Ausrichtung der Landwirtschaft fürihren Schutz denn nicht aus? Müssenauch diese Lebensräume tatsächlichnoch durch den Bund inventarisiert undkatalogisiert werden?
Die Realität muss uns nachdenklich stim-men. Seit den 40er-Jahren des 20. Jahr-hunderts sind von den einst häufigen ar-tenreichen Wiesen und Weiden noch10% übrig geblieben. Auch heute nochverschwinden Jahr für Jahr zahlreichedieser ökologisch so wertvollen Flächen.Gründe dafür gibt es viele: Intensivierungder landwirtschaftlichen Nutzung, Auf-forstung, Überbauung, Infrastrukturvor-haben, touristische Erschliessung oderaber Nutzungsaufgabe sind nur einigeBeispiele.
Die Wissenschaft zählt die hier beschrie-benen Lebensräume zu den Trocken- undHalbtrockenrasen und zu den Vegeta-tionstypen auf wechseltrockenen Stand-orten.
Mit dem Projekt TWW, Inventar derTrockenwiesen und -weiden der Schweiz,werden verschiedene Ziele verfolgt:
Nachdem der Schutz der Moore, derMoorlandschaften und der Auengebietein den letzten zehn bis zwanzig Jahren dieBemühungen von Bund und Kantonengeprägt hat, sollen nun die Lebensräumeauf trockenen Standorten systematischerfasst und bewertet werden.
Über artenreiche Wiesen und Weiden aufnährstoffarmen, wenig mächtigen undwasserdurchlässigen Böden und überihre Bedeutung für die Erhaltung der bio-logischen Vielfalt ist zwar in der Wissen-schaft viel Wissen vorhanden und in derBevölkerung sind die blumenreichenWie-sen ein beliebtes Ausflugs- und Wander-ziel. Eine gesamtschweizerische Über-
sicht über deren Verbreitung und regio-nale Ausprägungen fehlt aber bisher.Diese Lücke soll mit dem TWWgeschlos-sen werden.
Trockenwiesen und -weiden sind Zeugenund zugleich Ergebnis jahrhundertealterLandnutzungsformen. Nicht “Natur pur”machte in der Vergangenheit ihr Wesenaus, sondern das Bemühen der Men-schen, dem kargen Boden in oftmalsschwer zugänglichem Gelände zusätzli-ches Futter für das Vieh abzuringen. DasProjekt TWW will diese Nutzungsge-schichte gemeinsam mit Fachleuten ausder Land- und Forstwirtschaft dokumen-tieren.
Die Armut des Bodens steht in markan-tem Gegensatz zum farbenprächtigenReichtum an Blütenpflanzen, Tagfalternund vielen anderen Tierarten, die auf denhier beschriebenen Lebensraum ange-wiesen sind. Wenn wir uns mit der über-wältigenden Farbenpracht und Vielfalt derTrockenwiesen und -weiden beschäfti-gen, so dürfen wir darüber nicht ihreGeschichte und Herkunft übersehen.Über die Jahrhunderte bis ins 20. Jahr-hundert hinein ist sie untrennbar auchmitgrosser sozialer Not der Land- und Berg-bevölkerung verknüpft. Die Unterstüt-zung der Menschen, welche die Pflegeder Biotope sicherstellen und die Suchenach sanften Technologien, die derenArbeit erleichtern können, charakterisie-ren denn auch das Umsetzungskonzeptdes TWW-Projektes für den Schutz desfür die Erhaltung der biologischen Vielfaltwichtigen Lebensraumes. Dieser Aspektwird jedoch Gegenstand eines zukünfti-gen Berichtes sein.
Die vorliegende Publikation erläutert dasmethodische Vorgehen bei der Auswahlder Objekte, deren Kartierung und deranschliessenden Bewertung. Der Berichterscheint im jetzigen Zeitpunkt, obwohldie Kartierung und Bewertung der TWW-Objekte erst in einigen Jahren abge-schlossen sein wird. Damit sollen Kantoneund weitere betroffene und interessierte
Kreise in einem frühen Zeitpunkt über dieGrundlagen für den anschliessenden po-litischen Prozess (Vernehmlassung beiden Kantonen und Gemeinden sowie beiden privaten Wirtschafts- und Schutzor-ganisationen und Beschluss des Bun-desrates) informiert werden.
BUNDESAMT FÜR UMWELT,WALD UND LANDSCHAFT
Franz-Sepp StulzChef der Abteilung Natur
VORWORT8
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 8

91 ZUSAMMENFASSUNG
DAS PROJEKT“TROCKENWIESEN UND-WEIDEN DER SCHWEIZ”
Trockenwiesen und -weiden sind arten-reiche Lebensräume einer wärmelieben-den Flora und Fauna. Sie sind Produkteiner traditionellen, räumlich fein differen-zierten landwirtschaftlichen Nutzung. Zu-sammen mit der naturräumlichen Vielfaltder Schweiz ist die extensive Nutzung dieUrsache für eine enorme Vielfalt an ver-schiedenen Typen von Trockenwiesenund -weiden. Das Bundesgesetz überden Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli1966 (NHG) zählt diese Biotope – im Ge-setz als Trockenrasen bezeichnet – zuden besonders zu schützenden Lebens-räumen.
Der Bundesrat bezeichnet die Biotopevon nationaler Bedeutung (Artikel 18aNHG). Auf dieser gesetzlichen Basis undin Erfüllung der Konvention über die Er-haltung der Biologischen Vielfalt von Riode Janeiro 1992 gab das Bundesamt fürUmwelt, Wald und Landschaft 1994 grü-nes Licht für das Projekt “Trockenwiesenund -weiden der Schweiz”, unter ande-rem mit den Zielen,
1 eine Übersicht über Verbreitung, Aus-prägung und Gefährdung der trocke-nen und wechseltrockenen Wiesenund Weiden zu erhalten,
2 die trockenen und wechseltrockenenWiesen und Weiden von nationalerBedeutung zu bezeichnen,
3 umsetzungstaugliche Grundlagen fürBund und Kantone zu erarbeiten und
4 Grundlagen für die spätere Erfolgs-kontrolle zu schaffen.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden imRahmen von Vorprojekten eine spezifi-sche Kartiermethode und ein darauf ab-gestimmtes Singularitäts- und Bewer-tungsverfahren entwickelt, getestet undoptimiert. Diese Arbeiten werden von ver-schiedenen Expertengremien begleitet.Das BUWAL hat sich nach einer einge-
henden Projektanalyse 1998 entschie-den, an den Qualitätszielen festzuhalten.Der ursprünglich vorgesehene Abschlussdes Projektes im Jahr 2004 musste je-doch auf Grund der Sparziele für denBundeshaushalt um vier Jahre hinausge-schoben werden. Als Resultat der Ent-wicklungsarbeiten liegen nun breit abge-stützte und bereits in vielen Landesteilenerprobte Grundlagen vor, die im Rahmendieser Publikation dem Fachpublikumund der interessierten Öffentlichkeit vor-gestellt werden sollen.
Die Kartiermethode
Zielorientierte MethodeDie Kartiermethode für Trockenwiesenund -weiden muss Ergebnisse liefern, diebezüglich Abbildung der Lebensraum-vielfalt, der Bewertung, der Umsetzungund der Erfolgskontrolle die gestecktenZielsetzungen erfüllen und gleichzeitigfinanzielle Rahmenbedingungen einhal-ten. Resultat der Entwicklungen ist eineKartiermethode, deren Eckpunkte im fol-genden dargestellt werden.
Pragmatische LösungenGrundsätzlich wurden realitätsnahe prag-matische Lösungen gesucht. Dies spie-gelt sich in der Kartiermethode in vielfälti-ger Weise wieder. Je nach Ausgangssitu-ation in den verschiedenen Kantonen undRegionen werden angepasste Varianteneiner möglichst einheitlichen Methode an-gewendet.
Zwei Methodenvarianten tragen der un-terschiedlichen Verbreitung und Ausprä-gung in den tieferen und höherenLagen der Schweiz Rechnung. DieMethodenvariante DIF, die differenzierteVegetationsaufnahme in den tieferge-legenen Regionen, erfasst die Objektewesentlich präziser als es die Methoden-variante INT, die integrale Aufnahme, inden nicht mehr ganzjährig genutztenSömmerungsgebieten erlaubt. Grunddafür sind einerseits die grössere Ver-breitung von Trockenvegetation mit ent-
sprechend höherem Aufwand in denhöheren Lagen und andererseits dasvermehrte Auftreten von schwer zu kar-tierenden Mosaiken.
Die Kenntnisse über die Trockenvege-tation und die vorliegenden Kartiergrund-lagen sind in den einzelnen Kantonensehr unterschiedlich. Um diesen unter-schiedlichen Vorraussetzungen optimalRechnung zu tragen, werden verschie-dene Vorgehensvarianten definiert.
• Vorgehensvariante 1 in Kantonen mitbestehendem kantonalen Inventar: Miteinem rechnerischen Selektionsver-fahren werden die besten Inventar-objekte ausgewählt. Die selektiertenObjekte werden anschliessend gezieltaufgesucht und kartiert. Die Perimeterwerden unter demStereoskop auf Ori-ginalluftbilder übertragen und photo-grammetrisch ausgewertet.
• Vorgehensvariante 2 in Kantonen oh-ne kantonales Inventar: RegionaleExpertinnen und Experten bezeichnenTWW-Potenzialflächen. Für diese Flä-chen werden Farbinfrarot-Luftbilderproduziert und stereoskopisch vor-interpretiert. Damit soll der Suchauf-wand im Feld reduziert werden. DieKartierung präzisiert die Vorinterpreta-tion. Es folgt eine Nachbereitung unterdem Stereoskop und die Photogram-metrie der kartierten Flächen.
• Vorgehensvariante 3 kommt in Kanto-nen mit Inventar und Orthophotos zurAnwendung. Nach einer Selektionwerden die kantonalen Objekte kar-tiert und anschliessend die Perimeterdirekt ab Orthophoto digitalisiert.
Nicht mehr zur Anwendung gelangt einVorgehen mit Handübertrag der Perime-ter vom Luftbild auf Übersichtspläne, dasich die Fehleranfälligkeit als zu grosserwies.
Auch die unterschiedlichen naturräum-lichen und klimatischen Voraussetzungenfür das Vorkommen von Trockenvege-tation in der Schweiz werden im Projekt
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 9

berücksichtigt. Es ist ein wichtiges Ziel, inallen Landesteilen und Höhenstufen diewertvollen Trockenwiesen und -weidenzu erheben und nicht nur in den verhält-nismässig trockenwarmen Vorzugsgebie-ten des Jurabogens und der inneralpinenTäler. Damit sollen bewusst sowohl dieVielfalt des Lebensraumes TWW und derihn charakterisierenden Arten wie auchdie genetische Vielfalt erfasst werden.Aus diesem Grund wurden regional ver-schiedene Schwellenkriterien definiert,insbesondere bezüglich Minimalfläche,aber auch bezüglich Vegetation.
Vegetation im Mittelpunkt:Schwellenschlüssel,Hauptschlüssel, IndexschlüsselIm Zentrum der Kartierung steht dieVegetation. In einem ersten Schrittwerden die Perimeter der Trockenwiesenund -weiden abgegrenzt. VerschiedeneSchwellenkriterien definieren die Regelnzur Abgrenzung gegenüber Fremdvege-tation. Mit einem Hauptschlüssel wird dieFläche einem pflanzensoziologischenVerband zugeordnet. Diese Zuordnungerfolgt mit pflanzensoziologisch zu-sammengestellten Artenlisten. Ein Index-schlüssel schliesslich dient zur ökologi-schen Präzisierung des Verbandes.Schlüssel und Artenlisten sind für dieganze Schweiz für alle Höhenlagen ein-heitlich. Es werden aufgrund der vorkom-menden Arten bis zu zwei Indices verge-ben. Neben der Hauptvegetation könnenzudem verschiedene Typen von Begleit-vegetation festgehalten werden. Mit die-sem Vorgehen wird die Vielfalt der Vege-tation einer Trockenwiese oder -weideumfassend abgebildet.
Im Zentrum der Vegetationsbestimmungsteht die Aufnahme einer möglichst re-präsentativen und homogenen Testflächein jeder Kartiereinheit. Diese wird mittelsGPS (global positioning system) exakteingemessen. Die Gefässpflanzenartenund deren Deckung werden auf einemProtokollblatt aufgenommen. Die Arten-liste ist möglichst vollständig, der De-ckungsanteil aller Arten wird geschätzt
und auch Begleitarten sowie seltene Ar-ten werden erfasst. Diese Vegetations-aufnahmen sind Basis einer späterenErfolgskontrolle.
Die Vegetationsschlüssel liefern zahlreicheverschiedene Vegetationstypen. Für über-regionale Vergleiche ist es sinnvoll, die vie-len Vegetationstypen zu wenigen Vegeta-tionsgruppen zusammenzufassen. Auchdie Bewertung verwendet nicht direkt dieVegetationstypen, sondern entsprechendihren Bedürfnissen angepasste Vegeta-tionsgruppen. Die in der Bewertung ver-wendeten 18 Vegetationsgruppen werdenin Kapitel 7 mit ihrer Ökologie, Pflanzen-soziologie und Verbreitung beschrieben.Hier werden auch einige im Rahmen desProjektes bereits erhobene Daten ausge-wertet und diskutiert.
Weitere ParameterFür Umsetzung, Bewertung und Erfolgs-kontrolle sind neben der Vegetation wei-tere Informationen von grosser Bedeu-tung und werden im Feld erhoben: Ver-buschungsgrad und Verbuschungsart,Haupt- und Nebennutzung, faunistischrelevante Struktur- und Grenzelementewie Waldränder, Felspartien, Vernässun-gen, Hecken etc. sowie eine Einschät-zung zur landschaftlichen Vernetzung derFläche. Individuell können die Kartierper-sonen weitergehende Bemerkungen oderHinweise festhalten.
Luftbildinterpretationund PhotogrammetrieDie Kartierung wird in verschiedenen Vor-gehensvarianten von Luftbildinterpreta-tion, Luftbildnachbearbeitung und Photo-grammetrie unterstützt. Ziel ist es einer-seits, den Aufwand der Feldarbeit durchEliminierung des Absuchens in Potenzial-gebieten zu verringern, andererseits diegeometrische Genauigkeit im Hinblick aufdie Erfolgskontrolle massiv zu erhöhen.Die Luftbildbearbeitung gliedert sich imWesentlichen in eine Modellausschei-dung zur Auswahl der optimalen Luftbil-der, in eine Erstbegehung des Geländeszum Kennenlernen der regionsspezifi-
schen Vegetationsstruktur, in eine stere-oskopische Vorabgrenzung der Objekte,in eine Nachbearbeitung der Feldperime-ter unter dem Stereoskop sowie in diephotogrammetrische Auswertung derPerimeter.
QualitätssicherungTrotz der detaillierten Methode und denpräzisen Kartierregeln kann die komplexeRealität des Lebensraumes Trockenwie-se und -weide nicht vollständig objektivund reproduzierbar erfasst werden.Mittels Schulung, Eichung und Kontrollesollen der individuelle Interpretationspiel-raum und somit Abweichungen jedochminimal gehalten werden. BegleitendeUntersuchungen geben Aufschluss überdie Bandbreite der Interpretationsunter-schiede zwischen den Bearbeiterinnenund Bearbeitern.
Singularitäten
Die präzis definierte und strikt einzuhal-tende Kartiermethode hat zur Folge, dasseinzelne wertvolle Trockenstandorte ausbestimmten Gründen durch das standar-disierte Aufnahmeraster fallen und nichterfasst werden. Das Singularitätenverfah-ren wirkt diesem in der Vielfältikeit derNatur begründeten Mangel der standar-disierten Erhebungsmethode mit eben-falls definierten Kriterien und Abläufenentgegen.
Weist eine Singularität bestimmte Eigen-schaften auf, werden die notwendigenFeld- und Literaturdaten zusammenge-tragen und einem Expertengremium zurBeurteilung vorgelegt. Im Vordergrunddieses Verfahrens stehen Objekte, diebesondere Vorkommen an Pflanzen oderTieren aufweisen, die kulturlandschaftlichvon besonderer Bedeutung sind oderderen Vegetation – obwohl nicht schlüs-selkonform – TWW-verwandt und wert-voll ist.
Auch die Bewertungsmethode ist relativeng definiert. Mit einem begründeten
1 ZUSAMMENFASSUNG10
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 10

111 ZUSAMMENFASSUNG
Singularitätsantrag können kantonaleFachstellen, andere Expertinnen undExperten, aber auch Kartiererinnen undKartierer die Überprüfung eines im Be-wertungs- und Klassierungsverfahrenunterbewerteten Objektes beim BUWALbeantragen. Der Antrag wird anschlies-send einer speziell eingesetzten Exper-tenkommission zur Beurteilung unter-breitet.
Bewertung
Die erfassten Felddaten werden mit einermodifizierten Nutzwertanalyse bewertetund klassiert. Dieses Verfahren eignetsich aus folgenden Gründen: Bewer-tungsideen können differenziert umge-setzt und Bewertungsentscheide könnenklar strukturiert werden. Seine Wirkungs-weise ist transparent und auch für gros-se Datenmengen geeignet. Es ist leicht zurevidieren und flexibel.
Das Bewertungsverfahren berücksichtigtdie sechs Kriterien Vegetation, Diversitätder Vegetation, das Potenzial für seltenePflanzen- respektive für typische Tierar-ten von Trockenstandorten sowie dieFläche des Objektes und seine Vernet-zung mit benachbarten Biotopen. DieKlassierung bezieht zudem räumlicheKriterien sowie Mengenziele ein.
Aufgrund der langen Projektdauer ist esein zentrales Anliegen des Projektes,dass die Ergebnisse aus Kartierung undBewertung nach Abschluss der Arbeitenin einem Kanton möglichst bald in dieUmsetzung und in den kantonalen Voll-zug einfliessen können. Daher wird dieBewertung in zwei Phasen durchgeführt:
• Phase 1: provisorische kantonsweiseBewertung, um Bund und Kantonennach Abschluss der Kartierarbeiten ineinem Kanton eine rasche Prioritäten-setzung für Schutzmassnahmen zuermöglichen.
• Phase 2: Schlussbewertung zur defi-nitiven Bezeichnung der Objekte von
nationaler Bedeutung nach Abschlussder Kartierarbeiten in der ganzenSchweiz.
Die Phase 1 erfolgt für jeden Kanton se-parat in drei Schritten: Zuerst werden diezu kleinen Objekte ausgeschieden unddie bereits bekannten Singularitätengekennzeichnet. Im zweiten Schritt wirdder Datensatz eines jeden Objektes nut-zwertanalytisch bearbeitet. Dabei wirdzuerst die Vegetation auf regionalem Ni-veau nach den Kriterien Seltenheit, Re-präsentativität und Schutzwürdigkeit be-wertet, dann mit der Bewertung der fünfweiteren Kriterien der Objektwert gebildetund schliesslich werden alle Objekte ent-sprechend ihrem Wert in einer Ranglistegeordnet. Im dritten Schritt wird dieRangliste in drei Klassen unterteilt. Diewertvollsten Objekte, die ungefähr dieHälfte der gesamten kartierten Flächeumfassen, gelangen in die Klasse von na-tionaler Bedeutung. Ihnen kommt bei derUmsetzung erste Priorität zu. In der zwei-ten Klasse befindet sich ein grosser Teilder etwas weniger wertvollen Objekte vonteilweise nationaler Bedeutung. Sie wei-sen das grösste Aufwertungspotenzialauf und könntenmit verhältnismässig we-nig Aufwand den Sprung in die nationaleKlasse schaffen. Das letzte Viertel derObjekte gelangt in die dritte Klasse vonnicht nationaler Bedeutung. Im letztenSchritt von Phase 1 wird der Klassie-rungsvorschlag mit den kantonalen Be-hörden diskutiert und bereinigt.
In Phase 2 schliesslich werden gegen En-de des Projektes die Objekte der zweitenKlasse aus allen Kantonen gemeinsambewertet und entweder der Klasse vonnationaler Bedeutung oder aber von nichtnationaler Bedeutung zugeordnet.
Ausblick
Eine erste Serie des Bundesinventars sollzusammen mit der Verordnung späte-stens 2002 in die Vernehmlassung beiden Kantonen gehen und anschliessend
vom Bundesrat in Kraft gesetzt werden.Der Abschluss des Projektes erfolgt mitder Inkraftsetzung der letzten Serie imJahr 2008.
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 11

12
Anfang deutsch def.:Anfang deutsch def. 23.1.2007 13:19 Page 12

132 DAS PROJEKT TWW
2 DAS PROJEKT TWW (Michael Dipner)2.1 Einleitung 142.2 Ausgangslage 142.2.1 TWW: Gefährdete Vielfalt 142.2.2 Gesetzliche Grundlagen 172.2.3 Übrige Rahmenbedingungen 192.3 Projektziele 202.3.1 Übergeordnete Zielsetzungen 202.3.2 Ziele des Teilprojektes Erhebung 212.3.3 Ziele des Teilprojektes Bewertung 222.4 Projektorganisation 232.5 Stand der Arbeiten 242.5.1 Stand der Erhebungsarbeiten 242.5.2 Interpretation der Resultate 252.6 Gesamtplanung 27
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 13

Kennartstatus * 1 2 3 4 5 6 Tot 1+2 1+2+3
Aves (Vögel) 0 7 23 58 103 0 191 7 30
Reptilia (Reptilien) 0 1 6 5 3 0 15 1 7
Mollusca (Weichtiere) 9 21 8 21 162 26 247 30 38
Carabidae (Laufkäfer) 15 58 78 87 237 36 511 73 151
Apoidea (Wildbienen) 7 86 242 79 56 110 580 93 335
Heteroptera (Wanzen) 0 100 114 127 281 0 622 100 214
Saltatoria (Heuschrecken) 8 24 31 22 23 4 112 32 63
Rhopalocera (Tagfalter) 32 47 67 39 13 5 203 79 146Hesperidae (Dickkopffalter)
Total 71 344 569 438 878 181 2481 415 984
*Kennartstatus:
1 Ausschliesslich in TWW2 Vorwiegend in TWW3 Typisch, aber nicht vorwiegend in TWW4 Gelegentlich in TWW5 Nicht in TWW6 Unbestimmt
Kommentar:Nach dem aktuellen Datenstand sind knapp17% aller Arten der untersuchten Tiergruppenausschliesslich oder vorwiegend auf TWWangewiesen (Kennartstatus 1 und 2). Amstärksten ist die Bindung zu diesem Lebens-raum bei den Tagfaltern und Dickkopffalternmit fast 40% und bei den Heuschrecken mitfast 30%. Zählt man bei allen Tiergruppennoch diejenigen Arten mit Kennartstatus 3(Typisch, aber nicht vorwiegend in TWW) hin-zu, so sind es beinahe 40% aller Tierarten, dieauf TWW als Lebensraum angewiesen sind.
2.1 EINLEITUNG
1994 wurde durch das BUWAL ein Pro-jekt unter dem Namen “Trockenwiesenund -weiden der Schweiz”, kurz TWW,gestartet. Dieses Projekt basiert auf derLeitidee, die trockenen und wechseltro-ckenen Wiesen und Weiden der Schweizsowie ihr Potenzial als Lebensraum fürFlora und Fauna, insbesondere für ge-fährdete Arten zu erfassen, zu schützen,zu pflegen und zu fördern. Nach 7 Jahrensind die wichtigen Projektbereiche derDatenerhebung und der Datenbewertungin der Routinephase. Die methodischenWerkzeuge dieser Projektteile sollen mitdieser Publikation nun einer breiteren Öf-fentlichkeit zugänglich und nutzbar ge-macht werden.
Die methodischen Grundlagen sollen imUmfeld des Gesamtprojektes dargestelltwerden. In einem ersten Teil werden da-her Ausgangslage, das Projekt als sol-ches und die ersten Resultate vorgestellt.
2.2 AUSGANGSLAGE
2.2.1 TWW: Gefährdete Vielfalt
Trockenwiesen und -weiden der Schweizsind in der Regel ein Produkt jahrhunder-tealter nachhaltiger Nutzung durch denMenschen. Sie sind wichtiger Bestandteileiner traditionellen landwirtschaftlichenKulturlandschaft und prägen noch heuteviele Gegenden der Schweiz. Ihre bunteVielfalt wird in breiten Bevölkerungskrei-sen wahrgenommen und geschätzt.
Trockenwiesen und -weiden (TWW) sindäusserst artenreiche Lebensräume. Ge-mäss der Roten Liste der Farn- und Blü-tenpflanzen der Schweiz sind 350 Pflan-zenarten bzw. 13.1% auf magere Wiesenangewiesen. Mit bis zu 100 Arten pro Aregehören die TWW zu den artenreichstenPflanzengesellschaften der Schweiz.
2 DAS PROJEKT TWW14
LEBENSRAUMBINDUNG UND ARTENVIELFALT IN TWW
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 14

152 DAS PROJEKT TWW
Auch bezüglich Fauna ist der Arten-reichtum ausserordentlich. Gepp (1986)schätzte die Insektenvielfalt eines Tro-ckenrasens in Österreich auf über 1’000Arten, darunter 30 Heuschrecken-, 100Wanzen-, 25 Netzflügler-, 150 Käfer-, 145Nachtfalter-, 140 Kleinschmetterlings-,80 Tagfalter-, 65 Bienen-, 50 Grabwes-pen-, 40 Schwebfliegen- und 35 Amei-senarten. Diese Angaben sind durchausmit Daten aus der Schweiz vergleichbar,wie eine Auswertung der Faunadaten-bank der Professur für Natur + Land-schaft der ETH-Zürich (Walter, T. Schnei-der, K., Umbricht, M. / Stand Januar1999) in nebenstehender Tabelle zeigt.
Diese artenreichen Trockenwiesen und-weiden sind gefährdet. Der Rückgangwird seit 1945 auf 90% geschätzt. DerRückgang an TWW wird auch durch dieErfahrungen im Projekt bestätigt. In denTestkartierungen in den Kantonen VS undVD, aber auch bei der Neukartierung vonkantonalen Inventarobjekten musstenweitere Verluste festgestellt werden. Diesbedeutet, dass der Rückgang dieserwertvollen Lebensräume immer nochfortschreitet. Gründe dafür sind inerster Linie weitere Intensivierungen derLandnutzung und des Landschaftsver-brauchs, immer mehr aber auch dieNutzungsaufgabe mit nachfolgender Ver-gandung.
Diese Entwicklung hat eine akute Gefähr-dung der auf diesen Lebensraum ange-wiesenen Arten zur Folge. Gesamt-schweizerisch sind 40% der Pflanzenar-ten von TWW auf der Roten Liste. ImMittelland sind es sogar 70%. Auch beiden Tierarten sind zahlreiche Arten sel-ten, gefährdet, vom Aussterben bedrohtoder ausgestorben. Die nebenstehendeAbbildung zeigt die Situation am Beispielder Tag- und Dickkopffalter auf.
Legende:
ausgestorben oder verschollenvom Aussterben bedrohtstark gefährdetgefährdetpotenziell gefährdetnicht gefährdet
K1,2 Kennartstatus 1,2 (ausschliessendoder vorwiegend in TWW)
Kommentar:Von den insgesamt 203 Tag- und Dickkopf-faltern der Faunadatenbank (Professur fürNatur und Landschaft der ETH Zürich) sindrund 50% auf der Roten Liste. Von 79 Arten,die ausschliesslich oder vorwiegend in TWWvorkommen (Kennartstatus 1 und 2), sind esgegen 70%. Arten mit einer hohen Bindung anTWW sind somit überproportional gefährdet.
Auch andere Tiergruppen weisen eine analogeTendenz auf.
RL-STATUS VON TAG- UND DICKKOPFFALTERN NACH GONSETH, 1994
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%Alle K1,2
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 15

A Geschichtlicher Abriss
1966 Das Bundesgesetz über den Natur und Heimatschutz (NHG) wird beschlossen, mitdem Zweck (unter anderem), die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.
1979 Die Schweiz unterzeichnet die Berner Konvention, die Massnahmen zum Schutz vongefährdeten Arten und Lebensräumen fordert.
1980 Der Bundesrat erlässt die Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge an dieLandwirtschaft mit erschwerten Produktionsbedingungen. Im Artikel 7 sind die“besonderen Anforderungen an die Bewirtschaftung bei Streueland undTrockenstandorten” formuliert.
1987 Der Artikel 18 NHG wird erweitert. Trockenrasen werden namentlich als schützens-werte Lebensräume erwähnt. Nach Artikel 18 a bezeichnet der Bundesrat nachAnhören der Kantone die Trockenstandorte von nationaler Bedeutung und legt dieSchutzziele fest.
1992 Die Schweiz unterzeichnet die Konvention zur Erhaltung der Biodiversität amUmweltgipfel in Rio de Janeiro. Danach sind Massnahmen zur Erfassung undErhaltung der Biodiversität einzuleiten.
1998 (1992) Trockenwiesen sind nach Artikel 76 (31b) des Landwirtschaftsgesetzes (LwG)beitragsberechtigt.
1998 Nach der Direktzahlungsverordnung (DZV) sind extensive und wenig intensiveWiesen beitragsberechtigt.
2 DAS PROJEKT TWW16
WICHTIGE TWW-RELEVANTE GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 16

B Kernaussagen einzelner Artikel
Artikel Kernaussage
NHG: Art. 18a Abs.2 Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope vonnationaler Bedeutung an und treffen rechtzeitig die zweckmässigenMassnahmen (nachdem sie der Bundesrat bezeichnet hat).
NHG: Art 18b Abs. 1 Die Kantone sorgen für den Schutz und Unterhalt der Biotope vonregionaler und lokaler Bedeutung.
NHV: Art. 14 Abs. 3 Die Bezeichnung und Bewertung schutzwürdiger Biotope erfolgtinsbesondere unter Zuhilfenahme von ökologischen Kennarten,der gesetzlich geschützten Arten sowie der in den Roten Listenaufgeführten gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten.
NHV: Art 16 Abs. 1 und 2 Die Bezeichnung der Biotope von nationaler Bedeutung sowie dieFestlegung der Schutzziele werden in besonderen Verordnungengeregelt. Die Inventare sind nicht abschliessend.Sie sind regelmässig zu überprüfen und nachzuführen.
NHV: Art. 29 Abs. 1a Bis der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnethat und solange die einzelnen Inventare nicht abgeschlossen sind,sorgen die Kantone mit geeigneten Sofortmassnahmen dafür, dasssich der Zustand von Biotopen, denen aufgrund der vorhandenenErkenntnisse und Unterlagen nationale Bedeutung zukommt,nicht verschlechtert.
NHG: Art 18c Abs. 1 und 2 Schutz und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung sollenwenn möglich aufgrund von Vereinbarungen mit den Grundeigen-tümern und Bewirtschaftern sowie durch angepasste land- undforstwirtschaftliche Nutzung erreicht werden. Grundeigentümer oderBewirtschafter haben Anspruch auf angemessene Abgeltung.
DZV: Art 40 Abs. 1a und b Beiträge für den ökologischen Ausgleich werden auf der land-wirtschaftlichen Nutzfläche (neben anderen) gewährt für extensivgenutzte Wiesen; wenig intensiv genutzte Wiesen.
172 DAS PROJEKT TWW
2.2.2 Gesetzliche Grundlagen
Um dieser nicht nur bei TWW, sondernbei den meisten artenreichen Lebensräu-men festgestellten negativen EntwicklungEinhalt zu gebieten, wurde vom Gesetz-geber detailliertes Recht gesetzt.
Der zentrale Gesetzesauftrag, der demProjekt TWW zu Grunde liegt, ist imBundesgesetz über den Natur- und Hei-matschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 in Ar-tikel 18, Absatz 1 und 1bis festgehalten:
1 Dem Aussterben einheimischer Tier-
und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung
genügend grosser Lebensräume (Bioto-
pe) und andere geeignete Massnahmen
entgegenzuwirken.
1bis Besonders zu schützen sind Uferbe-
reiche, Riedgebiete und Moore, seltene
Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehöl-
ze, Trockenrasen und weitere Standorte,
die eine ausgleichende Funktion im Na-
turhaushalt erfüllen oder besonders gün-
stige Voraussetzungen für Lebensge-
meinschaften aufweisen.
Mit Artikel 18a Absatz 1 erhält derBundesrat die Aufgabe, die besonderswertvollen Objekte zu bezeichnen:
Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören
der Kantone die Biotope von nationaler
Bedeutung. Er bestimmt die Lage der Bio-
tope und legt die Schutzziele fest.
In zahlreichen weiteren Artikeln des NHGund der Verordnung über den Natur- undHeimatschutz (NHV), im Landwirtschafts-gesetz (LwG) und der Direktzahlungsver-ordnung (DZV) sowie in der Raumpla-nungs- und Umweltschutzgesetzgebungfinden sich weitere TWW-relevante recht-liche Grundlagen sowohl für die Datener-hebung wie auch betreffend Aufgaben-teilung zwischen Bund und Kantonen . Inden Tabellen werden die wichtigsten sinn-gemäss wiedergegeben.
WICHTIGE TWW-RELEVANTE GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 17

2 DAS PROJEKT TWW18
AUSZUG AUS DER KONVENTIONÜBER DIE BIOLOGISCHE VIELFALT VOMERDGIPFEL IN RIO DE JANEIRO, 1992.
KONVENTION ÜBER DIE BIOLOGISCHE VIELFALT
Die biologische Vielfalt der Welt – die Artenvielfalt der Lebewesen –ist aus ökologischen, genetischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissen-schaftlichen, erzieherischen, kulturellen und ästhetischen Gründenvon hohem Wert.
Die Welt muss die biologische Vielfalt erhalten und ihre Grundelemen-te auf gerechte und ausgewogene Art nachhaltig nutzen. Das heisst,die Nutzung muss qualitativ und quantitativ so erfolgen, dass diebiologische Vielfalt langfristig nicht weiter gefährdet wird.
Die Länder haben das Recht, über ihre biologischen Ressourcenzu verfügen, aber sie sind auch dafür verantwortlich, dass ihre biolo-gische Vielfalt erhalten bleibt und dass ihre biologischen Ressourcenauf nachhaltige Weise genutzt werden.
Die Länder, welche die Konvention unterzeichnen, verpflichten sich:
• Die Grundelemente der biologischen Vielfalt zu bestimmen,welche für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung wichtig sind,und Tätigkeiten zu überwachen, die diese Vielfalt beeinträchtigenkönnten.
• Nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung undnachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt auszuarbeiten.
• Gesetze zum Schutz gefährdeter Spezies auszuarbeiten,Schutzgebiete zur Erhaltung der biologischen Vielfalt zu schaffenund eine umweltgerechte Entwicklung der umliegenden Gebietezu fördern.
• Unter Beteiligung der Öffentlichkeit Projekte, welche die bio-logische Vielfalt gefährden, einer Umweltverträglichkeitsprüfungzu unterziehen, um Schäden zu vermeiden oder auf ein Minimumzu begrenzen.
• Die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfaltin die nationale Planung und Politik zu integrieren.
• Den Menschen mit Hilfe von Medien und Aufklärungsprogrammenzu zeigen, wie wichtig die biologische Vielfalt ist und wie notwendigdie Massnahmen zu ihrer Erhaltung sind.
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 18

192 DAS PROJEKT TWW
2.2.3 ÜbrigeRahmenbedingungen
Neben diesen oben aufgeführten gesetz-lichen Grundlagen auf Bundesebene sindzahlreiche weitere Grundlagen, Rahmen-bedingungen und Entwicklungen im Zu-sammenhang mit dem Lebensraum unddem Projekt TWW zu beachten.
NaturschutzpolitikAuf der Basis der Verordnung über Be-wirtschaftungsbeiträge an die Land-wirtschaft mit erschwerten Produk-tionsbedingungen vom 16. Juni 1980inventarisierten mehrere Kantone ihreTrockenstandorte vollständig oder teil-weise. Dabei kam in den meisten Fällenein im Auftrag des Bundes erarbeiteterKartierschlüssel zur Anwendung. Trotzdieser Inventare für TWW fehlt heute einegesamtschweizerische Übersicht überdiesen Lebensraum, da die Daten einesehr unterschiedliche Qualität aufweisenund teilweise veraltet sind. Eine nationalePrioritätensetzung zur Erhaltung und För-derung ist somit nicht möglich. Zudemfehlt eine Grundlage für eine gesamt-schweizerische Erfolgskontrolle.
Agrarpolitik 2002Im Zuge der Neuorientieung der Land-wirtschaftspolitik der Schweiz bildet ne-ben der Marktorientierung die Ökolo-gisierung ein wichtiges Ziel. ExtensiveWiesen als Element des ökologischenAusgleichs spielen bereits jetzt einewichtige Rolle bei diesen Bestrebungen.Gemäss einer Studie von Baur et al.,1997 haben extensiv genutzte Wiesenund -weiden für die Erhaltung und För-derung der Biodiversität im Landwirt-schaftsgebiet eine herausragende Be-deutung und sind demnach besondersförderungswürdig. Aus der Sicht desTWW ist jedoch zu bemerken, dass dieaktuellen Beitragskriterien gemäss Land-wirtschaftsgesetz gewisse TWW aus-schliessen. Flächen im Sömmerungsge-biet, Weiden und Flächen ausserhalb derlandwirtschaftlichen Nutzfläche erhaltenbeispielsweise keine Beiträge.
LandschaftskonzeptSchweiz (LKS)Das LKS ist ein Konzept nach Artikel 13des Bundesgesetzes über die Raumpla-nung (RPG) vom 22. Juni 1979. Für denBund ist das LKS eine massgebendeGrundlage, um seine raumwirksamenTätigkeiten – ausgerichtet auf die Zieleund Planungsgrundsätze des RPG sowieden Zweck und die Pflichten des NHG –zu erfüllen und um mehr Kohärenz inseinem raumwirksamen Handeln zu er-zielen. Gestützt auf die partnerschaftlicherarbeiteten Ziele und Massnahmen,formuliert es die Anforderungen des Na-tur-, Landschafts- und Heimatschutzesan den Vollzug von Aufgaben im Zustän-digkeitsbereich des Bundes. Das TWWist ein Mosaikstein in der Umsetzung die-ses umfassenden Konzeptes.
Konvention von Rio (1992)Die Schweiz hat das Übereinkommenüber die Erhaltung und nachhaltigeNutzung der biologischen Vielfalt am 21.November 1994 ratifiziert. Sie trägt seit-her aktiv zur Umsetzung der Konventionauf nationaler, regionaler und internatio-naler Ebene bei. Unter anderem sollen ge-mäss dieser Konvention die Grundele-mente der Vielfalt bestimmt, nationaleStrategien zur Erhaltung und nachhaltigenNutzung ausgearbeitet und die Forschungdiesbezüglich gefördert werden. Zudemsoll die Bewusstseinsbildung in der Bevöl-kerung für die Bedeutung der Erhaltungder biologischen Vielfalt gefördert werden.Das Projekt TWW stellt auch hier einenBeitrag zur konkreten Umsetzung dar.
Die Konvention von Bern (1979)über die Erhaltung der europäischen wild-lebenden Tiere und Pflanzen und ihrernatürlichen Lebensräume fordert Mass-nahmen zum Schutz und zur Förderungder gefährdeten und empfindlichen Artenund deren Lebensräume. Sie wurde am12. März 1981 durch die Schweiz unter-zeichnet. Über 30 Tier- und Pflanzenar-ten, die auf der Liste der streng ge-schützten Arten stehen, sind zumindestteilweise auf TWW angewiesen.
Die Habitatsrichtlinie der EU,welche eine Liste von Lebensräumen undArten von gemeinschaftlichem Interessebezeichnet, führt u.a. lückige Kalk-Pio-nierrasen, alpines Grasland auf Silikat,alpine Kalkrasen, Kalk-Trockenrasen (prio-ritär mit seltenen Orchideen) und mon-tane Borstgrasrasen (prioritär) als zuschützende Lebensräume auf. Das Pro-jekt TWW umfasst somit Lebensräumevon übernationaler Bedeutung.
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 19

OBERZIELE DES PROJEKTES
Gesamtschweizerische Übersicht schaffen
Bezeichnen der Objekte von nationaler Bedeutung
Umsetzungstaugliche Grundlagen schaffen
TWW-spezifisches Schutzprogramm entwickeln
Voraussetzung für Erfolgskontrolle schaffen
2.3 PROJEKTZIELE
Die Zielsetzungen des Projektes TWWgliedern sich in Leitidee, Oberziele sowieZiele der verschiedenen Teilprojekte.Nachfolgend sind Leitidee, Oberziele so-wie die Ziele für die in dieser Publikationdetailliert behandelten Teilprojekte “Erhe-bung” und “Bewertung” wiedergegeben.
2.3.1 ÜbergeordneteZielsetzungen
Leitidee und Auftrag• Die trockenen und wechseltrockenen
Wiesen und Weiden der Schweiz, so-wie ihr Potenzial als Lebensraum fürFlora und Fauna, insbesondere fürgefährdete Arten erfassen, schützen,pflegen und fördern.
• Die dazu erforderlichen Pflege- undBewirtschaftungsformen erhalten undfördern.
Die Oberziele des Projektes• Bis ins Jahr 2008 eine gesamtschwei-
zerische Übersicht über die trockenenund wechseltrockenen Wiesen undWeiden der Schweiz als Teil der biolo-gischen Vielfalt im Sinne der Konven-tion von Rio 1992 schaffen.
• Die trockenen und wechseltrockenenWiesen und Weiden von nationaler Be-deutung nach Art. 18a NHG bezeich-nen und die Schutzziele formulieren.
• Umsetzungstaugliche Grundlagen fürBund und Kantone schaffen, die fürden Schutz und die Förderung derTWW auf kantonaler Ebene keineZweitkartierung (Detailkartierung) er-fordern. Vollzugshilfen erarbeiten.
• Die Grundlagen mit der notwendigengeometrischen und inhaltlichen Ge-nauigkeit schaffen, damit die erste Fol-geerhebung im Rahmen der Erfolgs-kontrolle der Naturschutzmassnah-men in den TWW ab 2005 bereitsrepräsentative Aussagen über Verän-derungen in den TWW ermöglichen.Das Erfolgskontrollekonzept und -pro-
2 DAS PROJEKT TWW20
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:44 Page 20

212 DAS PROJEKT TWW
gramm erarbeiten.• Ein TWW-spezifisches Schutzpro-
gramm entwickeln, das den Schutzund die Förderung der TWW optimalauf die Zusammenarbeit mit den Kan-tonen, der Land- und Forstwirtschaft,der Raumplanung und weiteren TWW-relevanten Bereichen abstimmt.
2.3.2 Ziele des TeilprojektesErhebung
• Die TWW in der ganzen Schweiz nacheinem einheitlichen und nachvollzieh-baren Verfahren kartieren und die ge-samtschweizerische Übersicht überdie TWW erarbeiten.
• Die typischen und seltenen Vegeta-tionstypen der TWW regional differen-ziert erfassen und auskartieren (unter-halb der Sömmerungsgrenze), resp.teilweise auskartieren (oberhalb derSömmerungsgrenze).
• Die floristische Zusammensetzung derauskartierten Flächen durch die Erhe-bung einer Artenliste innerhalb einerlokalisierbaren Referenzfläche doku-mentieren.
• Das faunistische Potenzial der auskar-tierten Flächen durch die qualitativeErfassung der Struktur- und Grenzele-mente abschätzbar machen.
In den Kapiteln 3 - 5 wird die Methodikbeschrieben, wie diese Ziele erreicht wer-den sollen. Im Kapitel 7 werden Ökologie,Klassifikation und Typologie der erhobe-nen Vegetationseinheiten charakterisiert.
ZIELE DES TEILPROJEKTES ERHEBUNG
Nach einheitlichen Verfahren kartieren
Möglichst genaue Lokalisierung von Grenzlinie und Referenzfläche
Typische und seltene Vegetationstypen erfassen
Pflanzenarten-Liste in einer Referenzfläche erheben
Faunistisches Potenzial erfassen
Hohe Lagegenauigkeit durch Photogrammetrie
TWW-OBJEKT
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 21

2.3.3 Ziele desTeilprojektes Bewertung
1. Jene Objekte als wertvoll einstufenund hoch bewerten, die für TWW-typi-sche Arten gute bis sehr gute Lebens-bedingungen bieten.
2. Objekte hoch bewerten, wenn sie fol-gende sechs Kriterien gut erfüllen:
• einen hohen Anteil TWW-typischerVegetation enthalten (gemäss Kartier-schlüssel).
• ein hohes Potenzial für seltene TWW-typische Pflanzenarten aufweisen.
• viele für TWW-typische Tierarten wert-volle Strukturelemente aufweisen.
• genügend gross sind, oder in einemTWW-reichen Gebiet liegen.
• gut mit ihrer Umgebung vernetzt sind.• eine hohe Diversität der vorkommen-
den TWW-Vegetationstypen aufweisen.
Auf Grund der Bedeutung für zahlreichegefährdete Tierarten kommt dem Krite-rium Strukturvielfalt bei der Bewertungneben dem Wert der Vegetation grossesGewicht zu. Verschiedene Studien bele-gen für Weiden gegenüber Wiesen diesignifikant höhere faunistische Artenzahlund führen dies schwergewichtig auf denFaktor Strukturvielfalt zurück.
In Kapitel 8 wird das komplexe Bewer-tungs- und Klassierungsverfahren be-schrieben, mit dem diese Ziele auf trans-parente und nachvollziehbare Weiseerreicht werden sollen. In Kapitel 6 wirddas Klassierungsvorgehen bei Spezial-fällen, den sogenannten Singularitäten,dargelegt.
2 DAS PROJEKT TWW22
Grosse Fläche Gute Vernetzung Diversität Vegetationstypen
Wertvolle Vegetation Hohes Artenpotential Viele Strukturelemente
Einstufung:
WERTVOLL
(hoher Rang in der Rangliste)
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 22

232 DAS PROJEKT TWW
2.4 PROJEKT-ORGANISATION
Der vorliegende Bericht beschreibt diemethodischen Grundlagen der Datener-hebung und Objektklassierung. Damitwird nur ein – wenn auch zentraler – Teileines komplexen Ganzen behandelt. Da-tenerhebung und Bewertung sind in einkonsistentes Gesamtsystem eingebettet.Das Organigramm des Projektes TWWgeht aus nebenstehender Abbildung her-vor. Zentral ist die Gliederung in die dreiProjektbereiche “Inventar”, “Umsetzung”und “Erfolgskontrolle”. Diesen Bereichensind die einzelnen Teilprojekte zugeord-net. Ergänzt wird diese Bereichsstrukturdurch die Querschnittsaufabe “Kommu-nikation”. Die operative Leitung obliegtder Steuergruppe.
Dem Projekt sind auf verschiedenen Stu-fen beratende Gremien in Stabsfunktionzur Seite gestellt: Fachexpertinnen und-experten auf Projektbereichsebene, so-wie Projektkommission und Projektaus-schuss auf Stufe Gesamtprojekt. Damitist eine fachliche Absicherung, eine Kun-denorientierung (v.a. zu den Kantonen)und eine Abstützung im BUWAL gege-ben.
Im TWW-Projekthandbuch sind Projekt-struktur, Aufbau- und Ablauforganisationdes Projektes im Detail festgehalten.
SektionschefBiotop- und Artenschutz
Erich Kohli
Projektleiterin (PL)BUWAL
Edith Madl Kubik
Steuergruppe (SG)Koordinator (PK)
Christian Hedinger, UNA
Kartierung:Stefan Eggenberg, UNALuftbildbearbeitung:Martin Urech, pulsDatenverarbeitung:Alexandre Maillefer,Statistique - GéoinformatiqueBewertung:Thomas Dalang,WSL
ProjektbereichInventar (BLI)
Leitung:Martin Urech, puls
Teilprojektleitungen:
Beratung,Umsetzungsbegleitung:Michael Dipner, ÖkoskopGaby Volkart, EconatVollzugshilfen:Michael Dipner, ÖkoskopBewirtschaftungrichtlinienund -empfehlungen:Gaby Volkart
ProjektbereichUmsetzung (BLU)
Leitung:Michael Dipner, Ökoskop
Expertinnen undExperten
Teilprojektleitungen:
Vorprojekt undKonzeption:Thomas Dalang,WSLChristian Hedinger, UNA
ProjektbereichErfolgskontrolle (BLE)
(im Aufbau) Leitung ad interim:Christian Hedinger, UNA
Teilprojektleitungen:
Expertinnen undExperten
Expertinnen undExperten
BUWALAbteilung NaturFranz-Sepp Stulz
Projektausschuss (PA)BUWAL-intern (Abt. N, Abt. L, Rechtsdienst)
Projektkommission (PK)kantonale Fachstellen, BLW,WSL
Konferenz der kantonalenBeauftragten für Natur undLandschaftsschutz (KBNL)
Bundesämter
Internes Kontrollsystem (IKS)Rechnungsprüfung / -revision
Kommunikation (SKom):Michael Dipner, ÖkoskopGaby Volkart, Econat
Projektteam (PT)
ORGANIGRAMM GESAMTPROJEKT TWW
Legende:
Stammorganisation BUWALund projektexterne Institutionen
Vertretung BUWALin Projektorganisation
Projektorganisation
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 23

ANZAHL OBJEKTE, KARTIERTE FLÄCHE, BEARBEITUNGSSTAND FEBRUAR 2001
AG AI AR BE BL BS FR GE GR JU LU NE NW SG TI UR VD CH
TWW-ObjekteDIF* 134 6 1 26 81 6 53 16 777 99 25 200 34 167 165 115 1 1893
TWW-ObjekteINT** 0 5 3 13 0 0 102 0 40 0 23 0 52 51 20 110 24 443
TotalObjekte 134 11 4 39 81 6 155 16 817 99 48 200 86 218 185 225 25 2336
TWW-FlächeDIF* (ha) 228 5 <1 41 258 5 59 17 3210 395 34 736 54 224 273 194 1 5696
TWW-FlächeINT* (ha) 0 28 4 53 0 0 709 0 176 0 89 0 258 154 212 626 308 2617
TotalFläche(ha) 228 33 5 94 258 5 768 17 3386 395 123 736 312 378 485 820 309 8313
DIF*: landwirtschaftliche Produktionszonen unterhalb der SömmerungslinieINT*: SömmerungsgebietStand der Auswertung: für die Kantone GR, JU, LU, NE und UR: provisorischer Stand Februar 2001alle anderen Kantone: Stand April 2000
2.5 STANDDER ARBEITEN
2.5.1 Stand derErhebungsarbeiten
Der Stand der Kartierarbeiten in den ein-zelnen Kantonen geht aus nebenstehen-der Karte hervor. Von 1995 bis 2000wurden die Kartierarbeiten in 14 Kanto-nen durchgeführt und abgeschlossen. ImKanton Graubünden wird die Kartierungbis 2002 dauern. In mehreren Kantonen(Bern, Waadt, Wallis) wurden Testkartie-rungen zur Optimierung der Methode unddes Aufwandes durchgeführt. Anfang2000 konnten die Daten von 12 abge-schlossenen Kantonen provisorisch be-wertet und die Objekte drei Klassen (na-tionale Bedeutung, teilweise nationaleBedeutung, nicht nationale Bedeutung)zugeordnet werden. Die Kartier- und Be-wertungsergebnisse werden mit den zu-ständigen kantonalen Behörden disku-tiert und bereinigt. Im Anschluss an dieKartierung und Bewertung folgen aufkantonaler Ebene die Umsetzungsarbei-ten, die für die Sicherung der erhobenenFlächen von zentraler Bedeutung sind.
Die kartierte TWW-Fläche umfasst Ende2000 gut 8’000 ha. Sie verteilt sich sehrunterschiedlich auf die bearbeiteten Kan-tone. Rund ein Drittel der Fläche liegt imSömmerungsgebiet (INT), wo mit einerleicht vereinfachten Methodenvariantegearbeitet wird, der Rest liegt in den tie-feren Lagen unterhalb der Sömmerungs-linie (DIF).
Die konkreten Zahlen sind in nebenste-hender Tabelle zusammengestellt.
2 DAS PROJEKT TWW24
Kanton noch nicht bearbeitetKartierung abgeschlossenMehr als 50% bearbeitetPilotkartierung
STAND DER ERHEBUNGSARBEITEN IM PROJEKT TWW, STAND 2000
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 24

252 DAS PROJEKT TWW
2.5.2 Interpretationder Resultate
VegetationDer Vegetationsschlüssel der TWW er-laubt durch seinen flexiblen Aufbau, dassder Vielfalt von Wiesentypen in derSchweiz mit einer Vielzahl verschiedenerVegetationstypen begegnet werdenkann. Insgesamt wuden bis jetzt 228 ver-schiedene Vegetationstypen erfasst.
Viele dieser Vegetationstypen sind sichähnlich in ihrer Struktur und ihrer Arten-zusammensetzung. Für verschiedeneAuswertungen macht es Sinn, die primä-ren Vegetationstypen zu Gruppen zu-sammenzufassen. Um die kartierte Vege-tation mit anderen europäischen Vegeta-tionseinheiten zu vergleichen, werdenunsere fein gegliederten Vegetationsty-pen zu entsprechenden “europakompati-blen“ Gruppen zusammengefasst. Ausnebenstehender Tabelle gehen die ver-schiedenen Gruppen hervor.
Aus der Häufigkeit der Vegetationsgrup-pen lässt sich die Geographie der bishe-rigen Kartierarbeit ablesen. Jura undNordalpen sind die besten bisher bear-beiteten Regionen. Hier herrschen Kalk-gebiete vor und die typischen Vegeta-tionsgruppen sind, zumindest für die hö-heren Lagen, die Blaugrashalde (SV) unddie Rostseggenhalde (CF). Mehr als dieHälfte der kartierten Vegetationstypen ge-hören aber zu den klassischen Mesobro-meten und ihren Übergängen zu denFettwiesen (MB, MBAE, AEMB).
HöhenstufenDie insgesamt grösste TWW-Fläche liegtnicht im Flachland oder in den Talböden,trotz der hier jeweils höheren Durch-schnittstemperaturen. TWW-Objekte vonansehnlicher Grösse finden wir am häu-figsten in einem Höhengürtel zwischen1000 und 1250 m.ü.M. Dies ist in vielenFällen die Zone zwischen den Talsiedlun-gen und den Maiensässen. Die Landwirt-schaft ist hier oft extensiver, die Flächensind hochgelegen für die Talbetriebe und
VEGETATIONSGRUPPEN TWW
Eine Auswertung der kartierten Vegetation nach diesen Gruppen zeigt Abbildung S. 26.
Code Soziologie Benennung
CB Cyrsio-Brachypodion Subkontinentaler Trockenrasen
FP Festucio paniculatae Goldschwingelhalde
LL (low diversity, low altitude) Artenarmer Trockenrasen der tieferen Lagen
AI Agropyrion intermedii Halbruderaler Trockenrasen
SP Stipo-Poion Steppenartiger Trockenrasen
MBSP/MBXB Mesobromion/Stipo-PoionMesobromion/Xerobromion Übergang Halbtrockenrasen-Steppenrasen
XB Xerobromion Subatlantischer Trockenrasen
CF Caricion ferrugineae Rostseggenhalde
AEMB Arrhenatherion elatiorismit Arten des Mesobromion Trockene artenreiche Fettwiese
FV Festucion variae Buntschwingelhalde
SV Seslerion variae Blaugrashalde
NS Nardion strictae Borstgrasrasen
OR Origanietalia Trockene Saumgesellschaft
MBAE Mesobromion/Arrhenatherion Nährstoffreicherer Halbtrockenrasen
MB Mesobromion Echter Halbtrockenrasen
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 25


272 DAS PROJEKT TWW
2.6 GESAMTPLANUNG
Der bisherige Kartierverlauf im ProjektTWW (inklusive der verschiedenen Test-kartierungen) sowie die Planung für diekommenden Jahre werden in der neben-stehenden Tabelle dargestellt.
Der Kartierplanung ab 1999 liegt dasGliederungsprinzip zugrunde, die arbeits-intensiven Kantone GR, VS, VD und BEgemäss Priorität nacheinander zu bear-beiten. Die Bearbeitung der “kleineren”Kantone ist darin eingebettet und wirdmassgeblich durch die Bereitstellung vonLuftbildern und somit einer optimalenFlugplanung bestimmt. Diese Planungwird jährlich überprüft und aufgrund deraktuellen Luftbildsituation oder geänder-ten kantonalen Prioritäten angepasst.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BL/BS 47 2
UR 59 110 115
NW 112
GE 12 2
FR 120 49
SG 163 76 58
TI 151 4 52 44
AG 12 62
AI/AR 22
NE 136
JU 110
LU 95
GR 212 29 112 171 420 390 110
VS 4 120 250 230 104
OW 82
GL 81
VD 120 180 120
ZH 76
SH 55
TG 21
BE 100 193
SZ 93 60
SO 91
KARTIERVERLAUF UND -PLANUNG TWWDie Zahlen erläutern die Anzahl notwendiger Kartiertage.
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 27

28
Kapitel 2 deutsch def.:Kapitel 2 deutsch def. 23.1.2007 14:45 Page 28

3 KARTIERMETHODE (Stefan Eggenberg)3.1 Problemstellung 313.2 Entwicklung der Methode 333.2.1 Wichtige Vorarbeiten 333.2.2 Meilensteine zur Methodenentwicklung 353.2.3 Methodenvarianten: DIF und INT 373.2.4 Vorgehensvarianten 393.2.5 Vorgehensvariante 2 413.2.6 Vorgehensvariante 3 433.3 Regionalisierungen 453.3.1 Gliederung der Schweiz in Naturräume 453.3.2 Floristische Gliederungen 473.3.3 Naturräumliche Regionen im TWW-Projekt 493.3.4 Beschreibung der Kartierregionen 513.4 Kartiergebiete 533.4.1 Die begangenen Kartiergebiete 533.4.2 Abzusuchende Gebiete 553.4.3 Selektierte Objekte 573.5 Grundlagen der Kartierung 593.5.1 Allgemeines zu Kartiergrundlagen 593.5.2 Luftbilder und Luftbildfolien 613.5.3 Luftbildtypen 633.5.4 Kartierverhalten und Vorbereitung 653.5.5 Kartierablauf in abzusuchenden Gebieten 673.5.6 Kartierablauf bei selektierten Objekten 693.6 Objektkonzept 713.6.1 Allgemeines 713.6.2 Minimalflächen 733.6.3 Flächenschätzung 753.7 Grenzkriterien 773.7.1 Regeln zum Abgrenzen von Teilobjekten 773.7.2 Grenzkriterien für die DIF-Methode 793.7.3 Kartiererleichterungen im DIF 813.7.4 Grenzkriterien für die INT-Methode 833.7.5 Einträge in das Luftbild 853.7.6 Allgemeines zum Schwellenschlüssel 873.7.7 Erklärungen zu den Schwellenkriterien 893.7.8 Hauptkriterien des Schwellenschlüssels 913.8 Qualitätssicherung 933.8.1 Fehlerquellen 933.8.2 Ausbildung 953.8.3 Eichung 973.8.4 Kontrolle 983.8.5 Genauigkeitsuntersuchungen 99
293 KARTIERMETHODE
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 29

3 KARTIERMETHODE30
PROBLEMSTELLUNG
Bezeichnung nationaler Objekte
BewertungKlassierung
bewertbare Daten
Durchführung von Erfolgskontrollen
WirkungskontrolleErfolgskontrolle
kontrollierbare Daten
Schaffung von Vollzugsgrundlagen
UmsetzungVollzug
umsetzungsbereite Daten
OBERZIELE DES PROJEKTES
GRENZZIEHUNG BESCHREIBUNG DES INHALTES
eindeutig metergenau reproduzierbar (semi)-quantitativ vollzugsrelevant reproduzierbar
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 30

313 KARTIERMETHODE
3.1 PROBLEMSTELLUNG
Gemäss den Oberzielen des Projektes(Kap. 2.3.1) soll die Kartiermethode Er-gebnisse liefern, die es erlauben, dass
• Objekte von nationaler Bedeutung be-zeichnet werden können,
• diese Ergebnisse direkt umsetzungs-tauglich sind, d.h. dass eine weitereFeldbegehung nicht nötig ist,
• die Daten tauglich für eine Erfolgskon-trolle sind.
Ausserdem sollten die bestehenden kan-tonalen Trockenwieseninventare optimalgenutzt werden.
Zur Erfüllung dieser Ziele braucht dieKartiermethode ein geeignetes Objekt-konzept und eine sorgfältige Auswahl vonbeschreibenden Merkmalen.
ObjektkonzeptObjekte sind Ausschnitte aus der Land-schaft, die den vorgegebenen Minimal-bedingungen genügen. Für nationaleInventare ist zunächst eine minimaleFlächengrösse der Objekte von Bedeu-tung. Minimalflächen werden im Kapitel3.6.2 erläutert. Neben der Quantität derFlächemuss auch deren Qualität beurteiltwerden. Die minimalen Qualitätskriterienwerden meist in der Form eines Schwel-lenschlüssels formuliert. Dieser wird inKapitel 3.7.6 erläutert.
Neben diesen beiden Grundpfeilern jedesObjektkonzeptes gibt es eine Anzahl vonweiteren Fragen im Zusammenhang mitder Flächenabgrenzung im Gelände:
• Wie wird mit Ansammlungen von klei-neren TWW-Flächen umgegangen?
• Muss die Objektfläche zusammen-hängend sein oder können auch in derNähe liegende, kleine “Satellitenflä-chen” einem Objekt zugeschlagenwerden?
• Wie gross dürfen in diesem Fall dieAbstände sein?
Die Einheitlichkeit (Homogenität, Unifor-mität) der Objektfläche stellt weitere Fra-gen an ein Objektkonzept. Die mit denSchwellenkriterien abgegrenzte Flächekann in sich bezüglich Vegetation, Nut-zung, Verbuschung, usw. sehr uneinheit-lich sein. Da umsetzungsorientierte Re-sultate verlangt werden, ist es wichtig, fürbestimmte Merkmale Einheitsflächen zudefinieren, damit verbuschte Stellen, be-sonders artenreiche Wiesen usw. genaulokalisiert werden können. Das führte da-zu, dass neben den Objekten auch Teil-objekte in das Konzept aufgenommenwerden mussten.
Die im Gelände und auf dem Luftbild er-kennbare Objektgrenze sollte mit mög-lichst geringem Übertragungsfehler aufKarten transferiert werden können. Kapi-tel 3.2.4, 3.2.5 und 3.2.6 erläutern dieverschiedenen Vorgehensweisen, die hierje nach Ausgangslage für die jeweiligenKantone gewählt worden sind. In Kapitel4 wird auf die Möglichkeiten der Luftbild-auswertungen noch näher eingegangen.
Beschreibende MerkmaleBei der Auswahl der beschreibendenMerkmale ist besonders auf die Erfüllungder Oberziele zu achten. Zur Bezeich-nung von Objekten mit unterschiedlicher(regionaler, nationaler) Bedeutung brauchtes Merkmale, die bewertet werden kön-nen. Die Bewertung der im Kapitel 5 dar-gestellten Merkmale des TWW-Projekteswird in Kapitel 8 erläutert. Eine Be-sonderheit der TWW-Bewertung bestehtdarin, dass neben der Vegetation auchzoologisch relevante Strukturmerkmaleder Teilobjekte miteinbezogen werden(Kapitel 5.5). Auf die möglichst genaueErhebung von Merkmalen, die der di-rekten Umsetzung dienen, wie zum Bei-spiel die Nutzungsform oder der Verbu-schungsgrad wird besonders geachtet.Auch die Vegetationsbeschreibung wirdso gestaltet, dass aus dem Vegetations-typ umsetzungsrelevante ökologische In-formationen herausgelesen werden kön-nen. Schliesslich sollte die Datenerhe-bung bereits die Bedürfnisse einer
späteren Erfolgskontrolle berücksichti-gen. Die Objektmerkmale müssen erneuterhoben werden können und mit einergenügenden Zuverlässigkeit mit der Er-sterhebung vergleichbar sein. Im Kapitel5.1.3 wird zu diesem Thema der Einsatzvon GPS-Geräten bei der Datenerhebungerläutert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 31

ARBEITEN VOR DEM TWW-PROJEKT
Arbeiten von Zoller im Basler JuraIm klassischen Untersuchungsgebiet von Zoller(1954) über die Mesobromion-Halbtrockenrasenzwischen Laufen (oben links) und Reigoldswil(rechts) wurden nach 30 Jahren die Erhebungenwiederholt. An vielen Orten zeigte sich einmarkanter Rückgang der Halbtrockenrasen.
Die kleinen Polygone sind Siedlungsgebiete,die Schattierungen kennzeichnen die Höhen-stufen.
ganzer KreisBestandesfläche 1950
schwarzer SektorBestandesfläche 1980
3 KARTIERMETHODE32
Verbreitung derHalbtrockenrasen in der Schweiznach Hegg et al. (1993)
BLN-Gebiet Mont d’Orge bei SionDer freistehende Hügel aus Sandsteinen undSandkalken ist auf der Südseite von Felsenstep-pen bewachsen, die sehr seltene und gefährdetePflanzen und Tiere beherbergen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 32

333 KARTIERMETHODE
3.2 ENTWICKLUNGDER METHODE
3.2.1 Wichtige Vorarbeiten
1926 In seiner Vegetationsbeschrei-bung der Linthebene beschreibt Kochdas Arrhenatherion als pflanzensozio-logischen Verband der Tal-Fettwiesen.
1938 In ihrem Prodromus der Pflan-zengesellschaften definieren Braun-Blan-quet und Moor das Mesobromion unddas Xerobromion.
1947 Die Bergfettwiesen (Polygono-Trisetion) der Schweiz werden von Mar-schall in einer Vegetationsmonographieabgehandelt.
1954 Zoller beschreibt die Typen derBromus erectus - Wiesen des Juras undweist auf die Gefährdungssituation hin.
1977 Landolt veröffentlicht die öko-logischen Zeigerwerte zur SchweizerFlora.
1977 Landolt veröffentlicht die RoteListe der Blütenpflanzen und stellt Analy-sen einzelner ökologischer Gruppen vor.Gemäss dieser Analyse hat die Gruppeder Pflanzen magerer Wiesen in derSchweiz einen Anteil von 32% an gefähr-deten Arten. Im Mittelland sind es sogarüber 70%.
1977/83 Der Bund lässt ein Inventar derLandschaften und Naturdenkmäler vonnationaler Bedeutung erstellen (BLN-Inventar). Dabei finden sich auch Land-schaften, die von Trockenstandorten ge-prägt sind. Zum Beispiel: Chilpen (BL),Vallon de l’Allondon (GE), Mont Vully (FR),Mont d’Orge (VS), Monte San Giorgio (TI),Monte Caslano (TI), Unteres Domleschg(GR), Ramosch (GR) und andere.
1981 Mit seiner Arbeit an Mähwiesenin den zentralalpinen Talschaften Goms,Bedretto, Urseren und Sumvitgmacht Bi-
schof auf die rasche Vergandung derWiesen bei Aufgabe ihrer Nutzung auf-merksam. Heute ist die Wiesennutzungdort praktisch verschwunden.
1981 Als Grundlage für eine standort-gemässe Nutzung von Wiesen und Wei-den entwickeln Dietl, Berger und Ofnerden Begriff “Pflanzenstandort” und publi-zieren einen Schlüssel für die Kartierungvon Pflanzenstandorten.
1981 Das Bundesamt für Forstwesen(heute BUWAL) lässt durch die FirmaANL eine Kartiermethode zur Erfassungder Halbtrocken- und Trockenrasen derSchweiz ausarbeiten. Der Kartierschlüs-sel geht von den Zeigerwerten der ver-schiedenen Pflanzenarten aus.
1983 Der Kanton SO entwickelt eineigenes Modell zur Beurteilung und Er-haltung der Trockenwiesen.
1984 Die ANL-Methode gelangt erst-mals in einigen Kantonen zur Anwen-dung.
1985 Beim Inventar des Kantons BEwird in der Erfassung die grobe Artenzu-sammensetzung erhoben.
1989 Für das Inventar im Kanton VDwerden sowohl der ANL-Code, als auchdie Artenlisten verändert.
1992 Hegg, Béguin und Zoller veröf-fentlichen einen Atlas der schutzwürdi-gen Vegetationstypen der Schweiz. Da-bei werden unter anderem Steppen- undTrockenrasen (Typ 10) und Halbtrocken-rasen (Typ 11) behandelt. Ihre Gefähr-dung wird als äusserst gross bezeichnet.Für die Alpinen Rasen (Typ 1) werden Ge-fährdungen durch Tourismus und Ände-rung der Nutzung angegeben.
1993 Dalang versucht an der WSL,die Daten der verschiedenen Kantonsin-ventare zu einem Bundesinventar zu-sammenzufassen. Die unterschiedlichenBearbeitungsmethoden verunmöglichen
eine Zusammenfassung. Eine gesamt-schweizerische Neubearbeitung scheintnotwendig zu sein.
1994 Duelli et al. veröffentlichen dieRote Liste der gefährdeten Tierarten derSchweiz. Sie zeigen u.a., dass über 60%der Heuschrecken gefährdet sind.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 33

3 KARTIERMETHODE34
TESTKARTIERUNGEN 1994
In über 50 Gebieten wurden die Entwürfe derKartiermethode ausgetestet, mit dem Ziel, einegesamtschweizerische Methode zu definierenund zu verbessern.
Rote Punkte: Testgebiete in den TieflagenBlaue Punkte: Testgebiete in der subalpinenStufe
PILOTKARTIERUNGEN 1995
In den Kantonen BS, BL und in den tieferenLagen des Kantons UR wurde 1995 mit derDatenerhebung begonnen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 34

353 KARTIERMETHODE
3.2.2 Meilensteine zurMethodenentwicklung
Entwicklung der TWW-Methode
1994 Aufgrund der inkonsistenten Da-tenlage in den Kantonsinventaren gibtdas BUWAL den Auftrag zu einer neu zuerhebenden nationalen Übersicht der tro-ckenen und wechseltrockenen Wiesenund Weiden. Die MethodenentwicklungTWW beginnt.
1994 Die Daten aus den bestehendenKantonsinventaren sollen soweit als mög-lich für die Neukartierung genutzt wer-den. Es entsteht die Idee von abzu-suchenden Gebieten und selektiertenObjekten.
1994 Die Grundzüge der Feldmetho-de mit Objektkonzept und Parameter-definition werden von der Firma UNAentwickelt. Die zu kartierenden Vegeta-tionstypen werden definiert und ein pro-visorischer Schlüssel wird entworfen. ImGegensatz zur ANL-Methode basiert dieMethode TWW auf pflanzensoziologi-schen Klassierungen.
1995 Beginn der Datenerhebung inden Kantonen BL, BS, UR (Pilotphase)nach “Methode DIF”.
Weiterentwicklung der Methode: Anpas-sung an die subalpinen Grünlandtypen(“Methode INT”)
1996 Beide Methoden (DIF und INT)gelangen in den Kantonen NW, GE, GR,SG, UR, FR, TI zur Anwendung. Kartiertwird auf Luftbildabzügen mit anschlies-sendem Handübertrag auf Parzellenplä-ne. Der Planübertrag von Hand erweistsich als unzureichend bezüglich La-gegenauigkeit der Resultate.
1996 Test Luftbildinterpretation: dieVerwendung von stereoskopisch vor-interpretierten Luftbildern und der Photo-grammetrie wird durch die Firma pulsgeprüft.
1997 Die durch Vorinterpretation undPhotogrammetrie ergänzte Feldkartie-rung wird als Pilotversuch in den Kanto-nen GR, AG, VD, BE getestet.
1997 Das BUWAL definiert drei Vor-gehensvarianten. Variante 0: nur Feld-kartierung, Variante 1: zusätzlich mitPhotogrammetrie, Variante 2: mit Luft-bildinterpretation und Photogrammetrie.Vorgehensvariante 0 wird nicht mehr an-gewendet.
1998 Die Methode wird um die Vorge-hensvariante 3 erweitert (mit Orthopho-tos). Erste Anwendungen haben 2000stattgefunden (Kanton JU).
1998 Die Erhebung der Parameterwird soweit verbessert, dass die Datenals Ersterhebung einer späteren Erfolgs-kontrolle verwendet werden können.
1999 Parallel zur Kartierung wird unterder Leitung der Eidg. Forschungsanstaltfür Wald, Schnee und Landschaft (WSL)in Birmensdorf ein Test durchgeführt, umden subjektiven Einfluss der Kartierper-son auf das Kartierresultat besser ab-schätzen zu können. Mit dem Testergeb-nis können Rückschlüsse auf die Verläss-lichkeit der Resultate gemacht werden.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 35

Methodenvariante DIF
• Vegetationstypen werden auskartiert
• Unterschiedliche Verbuschungsgrade werden auskartiert.
• Grosse Einschluss-Unterschiede werden auskartiert.
• Objekte bestehen meist aus mehreren Teilobjekten.
• Minimalfläche für Teilobjekt ist klein.
• Kartierfortschritt: wenig Fläche, aber viele Teilobjekte pro Tag.
Methodenvariante INT
• Nur artenreiche und artenarme Vegetationstypen werden getrennt.
• Unterschiedliche Verbuschungsgrade werden nicht auskartiert.
• Grosse Einschluss-Unterschiede werden nicht auskartiert.
• Objekte bestehen oft nur aus einem Teilobjekt.
• Minimalfläche für Teilobjekt ist gross.
• Kartierfortschritt: viel Fläche, aber wenige Teilobjekte pro Tag.
3 KARTIERMETHODE36
METHODENVARIANTEN
Talgebiet Sömmerungslinie Sömmerungsgebiet
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 36

373 KARTIERMETHODE
3.2.3 Methodenvarianten:DIF und INT
Es gehört zu den Anforderungen an dieKartiermethode, dass ihre Resultate di-rekt für Bewertung, Umsetzung und Er-folgskontrolle verwendbar sein sollen. ZurErreichung dieser Ziele gehört aber auchdie Einschränkung, dass die personellenund finanziellen Mittel optimal einzuset-zen sind. Aufwand und Ertrag müssen ineinem sinnvollen Gleichgewicht sein.
Mit zunehmender Meereshöhe wird dieKartierung aufwendiger. Die Trockenwie-senflecken werden grösser und die Be-wirtschaftung ist allgemein weniger inten-siv. Insbesondere die grossen Weiden derAlp- oder Sömmerungsgebiete mit ihreroft mosaikartig ausgebildeten Vegetationsind für die Kartierung anspruchsvoll undzeitaufwendig. Es stellt sich die Frage, wiehier der Kartieraufwand gegenüber der“Talmethode” minimiert und gleichzeitigeine Vergleichbarkeit (Konsistenz) der Re-sultate aufrecht erhalten werden kann.
Durch gezielte Vereinfachungen an derMethode der tieferen Lagen kann der Auf-wand leicht verringert werden. Als Grenz-linie, bei der ein Wechsel zwischen denMethodenvarianten stattfindet, wird dieSömmerungslinie benutzt. Dies ist dieoffizielle obere Grenze der landwirtschaft-lichen Nutzfläche und stellt den Übergangvon Ganzjahresbetrieben zu den Söm-merungsgebieten dar. Auf diesen Alpflä-chen wird das Vieh während der Som-mermonate geweidet.
Der wichtigste Unterschied der beidenMethodenvarianten besteht darin, dassim Gegensatz zu den tieferen Lagenoberhalb der Sömmerungslinie die Vege-tationstypen nicht mehr auskartiert wer-den. Oder mit anderen Worten: die Vege-tation ist kein Grenzgebungskriteriummehr. Das hat zur Folge, dass die wert-vollen Vegetationstypen zwar noch im-mer erfasst werden, aber sie sind im Mo-saik der verschiedenen Vegetationstypennicht mehr lokalisierbar.
Wir sprechen daher von der aufwendige-ren Differentialmethode (DIF), die zwi-schen verschiedenen Vegetationstypendifferenziert, und der Integralmethode(INT), die verschiedene zusammenhän-gende Vegetationstypen in Teilobjekte zu-sammenfasst, sie integral erfasst.
Differentialmethode (DIF)Sobald der dominante Vegetationstypändert, muss ein neues Teilobjekt ausge-schieden werden, sofern die Minimalflä-che eingehalten werden kann. Selbst beigleichbleibendem Vegetationstyp werdenneue Teilobjekte abgegrenzt, wenn sichder Grad der Verbuschung oder die Men-ge der Einschlüsse stark genug ändern.Dieses sehr differenzierende Vorgehenhat den Vorteil, dass die Resultate derKartierung direkt für den Abschluss vonspezifischen Bewirtschaftungsverträgenverwendet werden können und dass sichleicht eine Erfolgskontrolle darauf aufbau-en lässt. Als Nachteil gilt der wesentlichhöhere Arbeitsaufwand.
Integralmethode (INT)Bei dieser Methodenvariante könnenganze Vegetationsmosaike zu einem Teil-objekt zusammengefasst werden, auchwenn die einzelnen “Mosaiksteinchen”die Minimalfläche für eigene Teilobjekteerreichen würden. Damit besteht eine ge-wisse Ähnlichkeit mit anderen Kartierme-thoden des Bundes (z.B. Nationale Flach-moorkartierung). Es wird derselbe Vege-tationsschlüssel wie bei DIF verwendet.Für das Teilobjekt wird aber nicht mehrein dominanter Vegetationstyp mit Be-gleitvegetation angegeben, sondern eswerden die prozentualen Anteile aller imTeilobjekt gefundenen Vegetationstypennotiert. Vegetationstypen hingegen, dieGrenzfälle gegenüber Fremdvegetationdarstellen (z.B. Übergang zu Fettwiesenoder artenarme Rasen), werden weiterhinauskartiert, um eine Flexibilität bei derUmsetzung und Bewertung zu gewähr-leisten. Die verschiedenen Nutzungenwerden weiterhin abgegrenzt. Damitsich nicht Teilobjekte ergeben, die ganzeTalhänge umfassen, können Teilobjekte
entlang von Geländegrenzen (Grate,Gräben, Bäche, etc.) aufgeteilt werden.
Übergänge zwischenden MethodenSelbst unterhalb der Sömmerungslinie istes in manchen Situationen notwendig,den Arbeitsaufwand zu verringern. In Ka-pitel 3.7.3 werden die dafür vorgesehe-nen Kartiererleichterungen vorgestellt.
Spezielle Situation im JuraIm Hochjura ist die Sömmerungslinie oftkeine taugliche Methodengrenze. Söm-merungsgebiete liegen nicht generelloberhalb der landwirtschaftlichen Nutz-fläche, es handelt sich in vielen Fälleneher um ein mosaikartiges Nebeneinan-der von INT- und DIF-Flächen. Anstelleder Sömmerungslinie wird daher mit Zei-gerarten für höher gelegene Wiesen undWeiden gearbeitet. Diese “Höhenzeiger”sind in der Artengruppe AE3 zusammen-gefasst.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 37

3 KARTIERMETHODE38
VORGEHENSVARIANTE 0
Die Trockenwiese wird im Feld direkt auf den Luft-bildabzug eingezeichnet. Anschliessend wird dieauf dem verzerrten Luftbild gezeichnete Flächedurch die Kartierperson von Hand auf eine Karteübertragen, von wo sie digitalisiert wird.
1 Feldkartierung 1 Feldkartierung
2 Luftbildabzugmit eingezeichnetenTeilobjekten
2 Luftbildabzugmit eingezeichneten
Teilobjekten
3 Übertrag derGrenzen auf dieOriginalluftbilder
3 Handübertragder Grenzenvom Luftbildabzugauf die Karte
4 Karte miteingezeichnetenTeilobjekten
5 Karte miteingezeichneten
Teilobjekten
VORGEHENSVARIANTE 1
Die Trockenwiese wird direkt auf dem Luftbild-abzug eingezeichnet. Nach der Kartierungwerden die Grenzen unter dem Stereoskop aufdas Originalluftbild übertragen. Bei der photo-grammetrischen Auswertung werden die Bilderentzerrt und die Teilobjektgrenzen digitalisiert.Der Handübertrag auf die Karte entfällt.
4 Photogrammetrische Auswertung
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 38

393 KARTIERMETHODE
3.2.4 Vorgehensvarianten
In den verschiedenen Kantonen sindunterschiedliche Grundlagen für die Kar-tierung vorhanden. Es wurden daher imLaufe der Methodenentwicklung ver-schiedene Vorgehensvarianten entwi-ckelt. Es sind keine Varianten der Erhe-bungsmethode (vgl. Kap. 3.2.3), sondernverschiedene Vorgehensweisen, wie dieTrockenwiesenflächen auf dem Luftbilderfasst und digitalisiert werden.
Vorgehensvariante 0Als Grundlage werden Luftbilder aus be-stehenden Luftbildarchiven (KSL, WSL,Swissair, Landestopographie) verwendet.Die Kartierperson führt einen Luftbildab-zug (vergrössert auf den Maßstab1:5’000 bis 1:10’000) imGeländemit, aufwelchem sie die Teilobjektgrenzen ein-zeichnet und anschliessend von Hand aufeinen Plan überträgt. Von diesem Planwerden die Linien später digitalisiert. Die-ses klassische Vorgehen beinhaltet ver-schiedene Fehlerquellen. Insbesondereder Handübertrag der – bedingt durch dieZentralperspektive des Luftbildes – ver-zerrten Linie auf den Plan ist äusserstschwierig. Dazu kommt die Ungenauigkeitvieler Pläne. Werden die Pläne zu einemspäteren Zeitpunkt nachgeführt, kann esvorkommen, dass die Teilobjektgrenzenmassiv verschoben werden.
Vorteile der Variante sind die tiefen Kos-ten und die dank geringeren Qualitäts-ansprüchen relativ gute Verfügbarkeitder Luftbilder. Nachteile sind die man-gelnde Genauigkeit der Grenzen, dieschlechte Kalkulierbarkeit des Kartierauf-wandes und die aufwendige Gelände-arbeit.
Die Vorgehensvariante 0 wird nicht mehrangewendet.
Teile der Erhebungsmethode, die
nur in der Vorgehensvariante 0 verwendet
wurden, sind so im Text markiert.
0
Vorgehensvariante 1Als Kartiergrundlage dienen vorwiegendColor-Infrarot-Luftbilder (CIR) im Maß-stab 1:10’000, welche speziell für dasTWW-Projekt von der Koordinations-stelle für Luftaufnahmen (KSL) geflogenwerden. Sind bereits CIR-Luftbilder vor-handen, welche nicht älter als 10 Jahresind und einen Maßstab von 1:15’000oder grösser haben, wird auf diese zu-rückgegriffen.
Die neu geflogenen Bilder haben eineLängsüberdeckung von 75%, d. h. aufdem Folgebild sind 75% der letzten Auf-nahme ebenfalls abgebildet. Die Quer-überdeckung beträgt 25%. Dem Flug-programm liegt eine detaillierte Flug-planung zugrunde.
Die Kartierperson führt im Gelände einenLuftbildabzug (mind. 1:10’000) mit, aufwelchem sie die Teilobjektgrenzen ein-zeichnet. Nach der Feldkartierung wer-den die Teilobjektgrenzen im Büro vonLuftbildinterpretinnen mit Hilfe einesStereoskops auf die Originalluftbilder(bzw. auf darübergelegte Folien) über-tragen. Diese gelangen anschliessend indie photogrammetrische Auswertung,wo die Bilder mittels Passpunkten aus-gerichtet, entzerrt und die Teilobjekt-grenzen digitalisiert werden.
Die Kartierung nach Vorgehensvariante 1liefert eine hohe Lage- und Perimeterge-nauigkeit der Teilobjekte. Dank der gutenQualität der verwendeten CIR-Luftbilderwird den Kartierpersonen zudem dasAuffinden und Abgrenzen von Trockenve-getation erleichtert. Da vor der Feldbege-hung keine Interpretation der Luftbilderstattfindet, bleibt die Einschätzung deszu erwartenden Kartieraufwandes bei ab-zusuchenden Gebieten nach wie vorschwierig (das gesamte abzusuchendeGebiet muss begangenwerden). Aus die-sen beiden Gründen kommt die Kartie-rung nach Vorgehensvariante 1 nur inKantonen zum Zuge, welche bereits überein kantonales Inventar verfügen. Für dasgezielte Anlaufen selektierter Kantons-
objekte kann auf Luftbildinterpretation(vgl. Vorgehensvariante 2) verzichtet wer-den.
Teile der Erhebungsmethode, die
nur in der Vorgehensvariante 1 verwendet
werden, sind so im Text markiert.
1
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 39

3 KARTIERMETHODE40
VORGEHENSVARIANTE 2
Nach einer Erstbegehung im Gelände wird dasLuftbild unter dem Stereoskop vorinterpretiert.Während der eigentlichen Feldarbeit werdendie ausgeschiedenen provisorischen Teilobjekt-grenzen auf einer Folienkopie berichtigt undanschliessend auf die Originalfolie übertragen.Dann wird das Luftbild mit der Folie photo-grammetrisch ausgewertet und die Grenzenkönnen auf eine Karte übertragen werden.
8 Karte mit eingezeichnetenTeilobjekten
3 Stereoskopische Abgrenzungpotenzieller Trockenvegetation
7 Photogrammetrische Auswertung
2 Erstbegehung im Gelände
1 Vorbereitung Erstbegehung(Stichprobeflächen)
6 Stereoskopischer Übertrag derGrenzkorrekturen auf die Originalluftbilder
5 Korrektur der vorinterpretierten Teilobjekte
4 Feldkartierung
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 40

413 KARTIERMETHODE
3.2.5 Vorgehensvariante 2
Diese Variante stellt die gleichen Anforde-rungen an die Kartiergrundlagen wie dieVorgehensvariante 1. Neben bereits vor-handenen CIR-Luftbildern (Maßstab1:10’000 oder grösser, nicht älter als 10Jahre) handelt es sich vor allem um CIR-Luftbilder im Maßstab 1:10’000, welchevon der KSL in jährlichen Tranchen fürdas TWW-Projekt geflogen werden. Dieneu geflogenen Bilder haben eine Längs-überdeckung von 75%, d. h. auf dem Fol-gebild sind 75% der letzten Aufnahmeebenfalls abgebildet. Die Querüberde-ckung beträgt 25%. Dem Flugprogrammliegt eine detaillierte Flugplanung zu-grunde.
Die Erhebung nach Vorgehensvariante2 lässt sich in verschiedene Phasenunterteilen. Es sind dies: Erstbegehung,stereoskopische Flächenabgrenzung,Feldkartierung, stereoskopische Nach-bearbeitung, Photogrammetrische Aus-wertung. Die einzelnen Schritte werdenim Kapitel 4 näher erläutert.
Die Vorteile der Erhebung nach Vorge-hensvariante 2 liegen hauptsächlich inder hohen Genauigkeit der Teilobjekt-grenzen und der Einsparung an Kartier-zeit durch die stereoskopische Flächen-abgrenzung, denn es muss nicht mehrdas gesamte abzusuchende Gebiet be-gangen werden. Aus diesem Grund wirdVorgehensvariante 2 bevorzugt in Gebie-ten mit ausgedehnten abzusuchendenGebieten angewendet. Im Weiteren las-sen sich auf Basis der stereoskopischenAbgrenzung und den Erfahrungen derInterpretInnen aus der Erstbegehung ge-nauere Prognosen bezüglich des zu er-wartenden Kartieraufwandes machen(Kartierplanung). Von Vorteil ist weiter diegute Luftbildqualität, welche den Kar-tierpersonen das Erkennen und Abgren-zen von Trockenvegetation erleichtert.
Die Luftbildinterpretation “entlastet dieFeldarbeit” – wie Bierhals (1988) treffendformuliert – “um das Unwesentliche, wie
das Orientieren, Suchen, Abmessen undermöglicht die Konzentration der Gelän-dekartierung auf den Bereich, wo sie derLuftbildinterpretation überlegen ist: Aufdie genaue Kennzeichnung der Ausprä-gung der abgegrenzten Biotope, auf dieErfassung der Arten, der Gesellschaften,der Beeinträchtigungen etc.”
Als Nachteil dieser Variante sind die grös-sere Komplexität der Logistik und dieMehrkosten durch Erstbegehung undLuftbildinterpretation zu nennen.
Teile der Erhebungsmethode, die
nur in der Vorgehensvariante 2 verwendet
werden, sind so im Text markiert.
2
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 41

3 KARTIERMETHODE42
VORGEHENSVARIANTE 3
Wenn das Luftbild als Orthophoto entzerrtvorliegt, können die eingezeichnetenGrenzen direkt digitalisiert werden. Orthophotoskönnen nur monoskopisch ausgewertet werden.Die stereoskopische Luftbildinterpretation fälltsomit weg.
1 Feldkartierung
2 Eintragen der Grenzenauf einen Abzug des Orthophotos
3 Handübertrag der Grenzen vomLuftbildabzug auf eine Transparentfolie
4 Digitalisieren der Grenzendirekt ab Transparentfolie
5 Karte mit eingezeichnetenTeilobjekten
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 42

433 KARTIERMETHODE
3.2.6 Vorgehensvariante 3
Die Kartierperson führt im Gelände eineAusschnitt-Laserkopie eines Orthopho-toplanes im Massstab 1:5’000 bis1:10’000mit (vgl. Kap. 3.5.3), auf welchersie die Teilobjektgrenzen einzeichnet. Die-se Grenzen werden anschliessend 1:1von Hand auf eine Transparentfolie über-tragen, welche auf dem Original-Ortho-photoplan aufliegt. Die Fixierung derFolie auf dem Orthophoto erfolgt mittelsPasslochstanzungen, damit Folienver-schiebungen und daraus resultierendeÜbertragungsfehler vermieden werdenkönnen. Das Einzeichnen der Grenzenauf der Folie entspricht dem Handüber-trag auf den Plan in Vorgehensvariante 0(vgl. Kap. 3.2.4), allerdings sind beim vor-liegenden Verfahren die Übertragungs-fehler viel geringer, da im Gegensatz zurVariante 0 mit der gleichen Grundlage(Orthophoto) gearbeitet wird. Die Ver-wendung von Ausschnitt-Laserkopien imFeld mit anschliessendem Handübertragder Grenzen ist nötig, weil die oft gross-formatigen Orthophotopläne für die Feld-arbeit zu wenig handlich sind. Zudemkann auf der Kopie besser korrigiert wer-den und es können Kommentare beige-fügt werden. Die auf den Transparentfo-lien eingetragenen Teilobjektgrenzen kön-nen später direkt von der eingescanntenFolie halbautomatisch digitalisiert wer-den. Luftbildinterpretation und Photo-grammetrie entfallen, so dass bei derNachbearbeitung nur noch die Kosten fürdie Digitalisierung der Kartiergrenzen an-fallen.
Orthophotos können nur monoskopischausgewertet werden. Die stereoskopi-sche Luftbildinterpretation fällt somit weg.Aus diesem Grund werden Orthophotosnach dem heutigen Planungsstand vor-zugsweise in Kantonen mit selektiertenObjekten aus den kantonalen Inventareneingesetzt, wo die Kartierobjekte auchohne stereoskopische Flächenabgren-zung gezielt aufgesucht werden können.
Da es sich bei der Herstellung von Ortho-photos um einen arbeitsaufwendigen undteuren Vorgang handelt, der auch dieKosten der Vorgehensvariante 2 (Erstbe-gehung, Luftbildinterpretation und photo-grammetrische Auswertung) übertrifft,werden Orthophotos nur dann einge-setzt, wenn sie in einem Kanton bereitsvorhanden sind. Als weitere Bedingun-gen müssen die Orthophotos auf einemgenaueren Höhenmodell als demDHM25(vgl. Kap. 3.5.3) basieren und in Farb-oder CIR-Qualität vorliegen.
Wo Orthophotos vorhanden sind, kön-nen nach Möglichkeit Orthophotoplänemit Spezialeinträgen für die Kartierung(z.B. Koordinatenraster, Höhenkurven,Mittelpunkte der aufzusuchenden Kar-tierflächen etc.) hergestellt werden.
Im Fall von bestehenden, für die Kartie-rung geeigneten Orthophotos handelt essich bei der Vorgehensvariante 3 um einerelativ kostengünstige Variante, welchezudem eine hohe Genauigkeit der Kar-tiergrenzen gewährleistet.
Teile der Erhebungsmethode, die
nur in der Vorgehensvariante 3 verwendet
werden, sind so im Text markiert.
3
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:43 Page 43

3 KARTIERMETHODE44
GEOGRAPHISCHE GLIEDERUNGEN
Naturräumliche Gliederung der Schweiznach Gutersohn (1973)
Dargestellt ist die Gliederung erster undzweiter Ordnung: Jura (blau), Mittelland (grün),Nordalpen (rot), Inneralpen (orange),Südalpen (beige).
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 44

453 KARTIERMETHODE
3.3 REGIONALISIERUNGEN
3.3.1 Gliederung der Schweizin Naturräume
Ungleiche Verteilung der TWWDie Trockenvegetation ist in der Schweizqualitativ und quantitativ sehr unter-schiedlich verteilt. Warme, trockene Re-gionen, wie die inneralpinen Täler, derJurasüdfuss oder die kollinen Stufen inden Kantonen GE, BS und TI haben be-sonders günstige Voraussetzungen fürTrockenvegetation. Hier sind Trockenwie-sen und -weiden generell grossflächigerund ihre Vegetation ist spezieller undwertvoller als in den übrigen Regionen derSchweiz. Für grosse Gebiete der Schweizwürden überhaupt keine Objekte mehrden “Sprung” in die Kategorie “nationaleBedeutung” schaffen, da sie im Vergleichmit den Objekten aus den trockenwar-men Regionen nicht bestehen können.Die kleinen, verhältnismässig unspekta-kulären Objekte im Mittelland und in denNordalpentälern würden gewissermas-sen von den Bündner und Walliser Ob-jekten auf die hintersten Plätze einerRangliste verwiesen. Die TWW von natio-naler Bedeutung würden sich in der Fol-ge stark auf die trockenwarmen Regio-nen konzentrieren.
Wenn es aber aus naturschutzpolitischenGründen ein wichtiges Ziel ist, in allen Re-gionen eine gewisse Anzahl von TWW-Objekten zu bezeichnen, so sollten nurObjekte aus einem bioklimatisch relativeinheitlichen Raum unter sich verglichenwerden.
Ungleicher ArbeitsaufwandEntsprechend der ungleichen Verteilungder TWW ist auch der Kartieraufwand inden verschiedenen Regionen sehr unter-schiedlich. Die Kartiermethode muss ge-mäss den grundsätzlichen Zielsetzungendes Projektes für die gesamte Schweizeinheitlich bleiben, aber mit der Festle-gung unterschiedlicher Minimalflächenhaben wir ein vorzügliches Steuerinstru-
ment für die Feldarbeit. Für trockenwar-me und hochgelegene Regionen geltengrössere Minimalflächen.
Regionen nach GutersohnNeben demKlima sind für TWWauch an-dere Geofaktoren wie Relief, Geologieund Gewässer von Bedeutung. Aus demZusammenwirken dieser Faktoren ent-stehen mit besonderen Eigenschaftenausgestattete Naturräume, die Guter-sohn 1973 in einem Kartenblatt des “At-las der Schweiz” dargestellt hat. DieserKarte entnehmenwir die Grenzen der dreiHauptregionen der Schweiz: Jura, Mittel-land, Alpen. Diese Einteilung ist für dieZwecke des TWW-Projektes noch zugrob. Erst die nächst feinere, teilweise so-gar eine noch feinere Einteilung bringt fürdie TWWeine sinnvolle Naturraumgliede-rung. So kann beispielsweise der Ketten-jura vom Tafeljura unterschieden werden.Letzterer hat generell ungünstigere Vor-aussetzung für TWW. Die trockenen, sub-kontinentalen Inneralpen werden von denfeuchten Nord- und Südalpen geschie-den. Der Kanton GR wird in Nord- undMittelbünden, inneralpines Engadin /Münstertal und die Südtäler Misox, Ber-gell, Puschlav getrennt. Eine Darstellungder “Gutersohnschen Grenzen” ist ne-benstehender Karte zu entnehmen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 45

3 KARTIERMETHODE46
FLORISTISCHE GLIEDERUNGEN
Regionen nach Landolt (1991)Regionen der Roten Liste der Höheren Pflanzen,mit 1. Jura, 2. Mittelland, 3. Nordalpen,4. Inneralpen, 5. Südalpen.
Regionen nach Welten & Sutter (1982)Regionen für die Kartierung der Schweizer Flora.
hellgrün: Talflächen.gelb: Bergflächen oberhalb der Waldgrenze.
Regionen nach Wohlgemuth (1993)Aufgrund des Verbreitungsatlas von Welten &Sutter (1982) berechnete Floristische Regionenmit ähnlichem Artbesatz.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 46

473 KARTIERMETHODE
3.3.2 Floristische Gliederungen
Da bei der TWW-Kartierung die Vege-tation eines der wichtigsten Kriterien zurDefinition von Objekten ist, sind die be-reits bestehenden Regionalisierungen,die auf botanischen Überlegungen basie-ren, von besonderer Wichtigkeit. ZweiRegionalisierungen sind dabei besondershervorzuheben: die Regionen der RotenListe von Landolt (1991) und die Regio-nen, die Wohlgemuth aus den Daten derPflanzenverbreitung nachWelten & Sutterberechnet hat (Welten & Sutter 1982,Wohlgemuth 1993, 1998).
Regionen nach Landolt (1991)Die Schweiz wurde in Regionen aufge-teilt, die für Pflanzen ähnliche ökologischeund pflanzengeografische Bedingungenaufweisen sollen. Um einzelne Kantonenicht mehr als drei Regionen zuteilen zumüssen, wurden die Grenzen teilweiseden Kantonsgrenzen entlang gezogen.Es werden 10 Regionen unterschieden.Auffällig ist, dass das Zürcher Unterland,das Weinland und der nördliche Teil desKantons Thurgau zusammen mit demSchaffhauser Randen zur Region Nord-ostschweiz zusammengefasst wurde.Die Südgrenze desMittellandes liegt dort,wo die ersten Erhebungen 1400 m errei-chen (topografisches Kriterium!). DerKanton Schwyz und die beiden Appenzellwerden ganz zu den Nordalpen gezählt.Das Unterwallis wird ebenfalls zu denNordalpen geschlagen. Die Südalpenumfassen die Simplon-Südseite, dasTessin, das Misox, das Bergell und dasPuschlav.
Kartiereinheitenvon Welten & Sutter (1982)Bei der Kartierung wurde bewusst aufeine Rastererhebung verzichtet, um dieVerbreitung der Pflanzen in Bezug auf dasRelief sichtbar zu machen. Bei der Defini-tion der Kartier-Einheitsflächen wurdedarauf geachtet, möglichst einheitliche,natürliche Landschaftsausschnitte von60-100 km2 abzugrenzen. Berg- undTalflächen wurden entlang der Waldgren-
ze voneinander getrennt. Diese Grenzedient beim TWW-Projekt als Obergrenzeder Kartierung vonWeiden. Die Talflächenwurden entlang natürlicher Grenzen (Tal-stufen, Steilrippen, Schluchten, Gewäs-ser) abgegrenzt. Auf diese Weise sind593 Kartierflächen entstanden. Eine Dis-kussion zur Grenzziehung geben Urmi &Schnyder (1996).
Regionen nachWohlgemuth (1993, 1998)Durch eine Auswertung des Atlas vonWelten & Sutter (1982) hat Wohlgemuthverschiedene floristische Regionen mitähnlichem Artenbesatz berechnet. DieEinteilung in 11 floristische Regionen gibtdie besten Hinweise für eine Regionali-sierung der Kartierarbeiten.
Es ist auffällig, dass der Jura nicht feinerunterteilt wird; dagegen wird das Mittel-land in drei Regionen gegliedert. Alsfloristisch ähnliche Regionen erscheinendabei das Genferseegebiet und Basel,der Aargauer Jura und die Nordost-schweiz mit vorwiegend Magerwiesen-und Waldpflanzen als Trennarten (z.B.Buglossoides purpurocaerulea, Globula-ria bisnagarica, Quercus pubescens) zumrestlichen Mittelland. Dieses wiederumwird in einen westlichen und in einen öst-lichen Teil getrennt (durch hauptsächlichWald- und Sumpfpflanzen wie z.B. Gen-tiana asclepiadea, Gymnadenia odoratis-sima, Taxus baccata), wobei die Grenz-linie grösstenteils von der Suhre (AG)gebildet wird. Die Nordalpen sind eben-falls dreigeteilt: (1) das Alpenvorland, woviele Gebirgspflanzen noch fehlen; (2)das klassische Voralpengebiet; (3) dasUnterwallis und die tieferen Lagen desBündnerlandes mitsamt dem St. GallerRheintal und dem Seeztal, zwei floristischähnliche, aber getrennt gelegene Gebie-te mit charakteristischen Magerwiesen-und Unkraut- oder Ruderalpflanzen. AlsTrennarten zum Alpenvorland und Voral-pengebiet sind z.B. Artemisia absinthium,Artemisia campestris und Peucedanumoreoselinum zu nennen. Die Zentralalpen
werden in ein westliches, ein zentrales (in-klusive höchste Tallagen des Wallis) undein östliches Gebiet gegliedert. Währenddas westliche Gebiet von den typischentrockenheitsertragenden Walliser Artengeprägt ist, wird das östliche Gebiethauptsächlich durch Gebirgspflanzen derOstalpen (z.B. Clematis alpina, Crepisalpestris etc.) charakterisiert. Das zentra-le Gebiet dazwischen ist geprägt durchdas Fehlen von Arten, welche westlichund östlich davon weitverbreitet sind (z.B.Galium boreale, Asperula cynanchica).
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 47

3 KARTIERMETHODE48
TWW-KartierregionenRegionen für die TWW-Kartierung
Auf der Grundlage von Gutersohn (1973),modifiziert nach Landolt (1991) und bereinigtnach Welten & Sutter (1982).
TWW-BewertungsregionenRegionen für die TWW-Bewertung
Auf der Grundlage der biogeografischenRegionen der Schweiz (Gonseth Y.,Wohlgemuth T. et al. 2001, in Vorbereitung).
REGIONEN FÜR DIE TWW-KARTIERUNG
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 48

493 KARTIERMETHODE
3.3.3 Naturräumliche Regionenim TWW-Projekt
KartierregionenFür die Kartierung und die Bewertungder TWW-Objekte werden unterschied-liche Quellen zur Gliederung der Schweizverwendet:
• Kartierregionen: kombiniert ausder morphologischenGliederung nachGutersohn und der botanischen Glie-derung nach Landolt. Grenzverläufeentlang von Flächen aus dem Atlasvon Welten & Sutter (1982).
Die Kartierregionen werden im Kapitel3.3.4 detailliert vorgestellt.
• Bewertungsregionen: kombiniertnach floristischen und faunistischenDaten, berechnet von Gonseth, Butler& Sensonnens. Grenzverläufe entlangvon Flächen aus demAtlas vonWelten& Sutter (1982).
Die Wahl von zwei verschiedenen Re-gionalisierungen hat den Vorteil, dasswir uns Erfordernissen der Kartierungbzw. der Bewertung optimal anpassenkönnen:
• Die Regionalisierung für die Datener-hebung (Kartierregionen) ist ein Instru-ment zur Steuerung des Kartierauf-wandes.
• Bei der Kartierung spielt die Regiona-lisierung nur bei der Festlegung derMinimalflächen eine Rolle.
• In der Bewertung der Objekte wird mitder BUWAL-Regioneneinteilung eineoffizielle Einteilung verwendet, die mitanderen Daten des BUWAL kompa-tibel sein dürfte.
Da bei der Kartierung die Daten für alleRegionen auf die gleiche Weise erhobenwerden, ergeben sich keine Konsistenz-probleme zwischen den verschiedenenRegionalisierungen.
BewertungsregionenIm Rahmen ihrer Arbeit über ökologischeAusgleichsflächen haben Gonseth &Mulhauser (1996) eine Gliederung derSchweiz vorgeschlagen. Diese Regiona-lisierung wird, mit Einbindung weitererArbeiten (z.B. Wohlgemuth 1993), heuteoffiziell vom BUWAL verwendet. Die Be-wertungsregionen sindweitgehend iden-tisch mit den Kartierregionen (vgl. oben),es gibt aber folgende Unterschiede:
• Falten- und Tafeljura werden nichtunterschieden.
• Basel nördlich des Jura wird demMittelland zugeordnet.
• Das Mittelland wird nicht unterteilt.• Die Grenze zwischen dem Mittelland
und den Nordalpen ist geringfügignach Norden verschoben.
• Nordbünden wird zu den Nordalpengerechnet.
• Der nördliche Teil des St. Galler Rhein-tales wird zum Mittelland gerechnet.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 49

3 KARTIERMETHODE50
13
00
14
15
24
3222
11
21 31
41 51
52
53
54 55
4342
TWW-KARTIERREGIONEN
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 50

513 KARTIERMETHODE
3.3.4 Beschreibungder Kartierregionen
Die Quellen zur Abgrenzung der TWW-Kartierregionen sind im Kapitel 3.3.3erläutert.
0 Sundgau - OberrheinischeTiefebene
Kanton Basel-Stadt und nordwestlicheTeile des Kantons Basel-Landschaft.Klimatische Gunstlage am Rande derOberrheinischen Tiefebene.
1 JuraFalten- und Tafeljura, inkl. Randen vonSchaffhausen.
• 11 FaltenjuraWaadtländer bis Solothurner Jura,inkl. Teile des Basler und Aargauer Ju-ras. Gefaltete Kalkformationen mitsteilen trockenenHängen und trocke-nen Kuppen. Mulden nährstoffreich,Mergelschichten mit Staunässe.
• 13 AjoieTeil des Tafeljuras, mit relativ mildemKlima.
• 14 TafeljuraBasler und Aargauer Tafeljura. Flach-liegende Kalkformationen mit trocke-nen Kanten und Hängen.
• 15 RandenFortsetzung des Tafeljuras, Verbin-dung zur Schwäbischen Alb. Kalk-gesteine.
2 Mittelland
• 21 Bassin lémaniqueKlimatisch milde Region im Umfelddes Genfersees.
• 22 Westliches MittellandNach Osten bis zur Luzerner Kan-tonsgrenze. Tiefste Punkte im Nor-
den (Seeland, Seebezirk) mit mildemKlima. Gegen Süden allmählich an-steigend.
• 24 Östliches MittellandAllgemein feuchter als das westlicheMittelland. Gunstlagen im Norden(Zürcher Unterland, Thurgau). GegenSüden allmählich ansteigend.
3 Nordalpen
• 31 Westliche NordalpenWaadtländer Alpen und Berner Ober-land, dazu auch das ganze Unter-wallis nördlich des Rhoneknies. Vor-wiegend harte Kalke und Flysch. ImOsten Silikat des Aarmassivs.
• 32 Östliche NordalpenInnerschweizer Alpenkantone, Tog-genburg und das St. Galler Rheintal.Mit Ausnahme des Gotthardmassivsvorwiegend mit harten Kalken, steilenHängen.
4 Inneralpen
• 41 WallisDas ganze Mittel- und Oberwallis mitAusnahme der Simplon-Südseite.Subkontinentales Klimaregime imRegenschatten der hohen Gebirge.Kalke und Silikate.
• 42 Nord- und MittelbündenDie Rheintäler, das Prättigau unddas Landwassertal, nach Südostenbis zur Hauptwasserscheide. Trocken-gebiete im Churer Becken, Hinterrheinund Albulatal. Vorwiegend Bündner-schiefer.
• 43 Engadin und MünstertalVom Maloja bis zur Landesgrenze,inkl. Münstertal. Inneralpines Hochtal,Trockengebiete v.a. im Unterengadinund Münstertal. Silikat im Oberen-gadin, Bündnerschiefer im Unteren-gadin.
5 Südalpen
• 51 Simplon-SüdseiteSüdseite des Simplon bis Gondo.Silikat. Übergang von inneralpinemzu insubrischem Klima.
• 52 Nordtessin und MisoxMisox (GR) und Tessin nördlich desMonte Ceneri. Vorwiegend Silikat-gesteine, insubrisches niederschlags-reiches Klima.
• 53 SüdtessinTessin südlich des Monte Ceneri,Luganese und Mendrisiotto. Im Nor-den silikatisch, im Süden und Osteneinzelne Kalkgebiete. InsubrischesKlima.
• 54 BergellSüdseite des Maloja. Silikatgesteine,insubrisches Klima.
• 55 PuschlavSüdseite der Bernina, VorwiegendSilikatgesteine.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 51

3 KARTIERMETHODE52
Kantone mit abzusuchenden GebietenKantone, in denen vorwiegend abzusuchendeGebiete kartiert werden
Kantone mitselektierten KantonsobjektenKantone, in denen vorwiegend selektierteObjekte kartiert werden
ÜBERSICHT KARTIERGEBIETE
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 52

533 KARTIERMETHODE
3.4 KARTIERGEBIETE
3.4.1 Die begangenenKartiergebiete
Um nicht die gesamte Oberfläche derSchweiz nach Trockenvegetation absu-chen zu müssen, wurden verschiedeneVerfahren zur Begrenzung des Suchauf-wandes angewendet.
Kenntnisse über potentielle oder tatsäch-liche TWW-Standorte können aus ver-schiedenen Quellen gewonnen werden.Eine systematische Auswertung vonStandortfaktoren wie Geologie, Klimaund Landnutzung kann Hinweise aufmögliche TWW-Standorte liefern. Viel-fach verfügen auch Regionalkenner übersehr genaue und umfassende Kenntnissevon möglichen Lokalitäten. Aus den ver-schiedenen Tests, die durchgeführt wur-den, hat sich neben der Konsultation derKantonsinventare die Befragung von Re-gionalexpertinnen und -experten als dasoptimale Vorgehen erwiesen. Dies hat fol-gende Gründe:
• Viele Kantone und Regionen wurdenbereits einmal inventarisiert.
• Die Kenntnis über bestehende Mager-und Trockenwiesen ist allgemein sehrgross.
• Die Kartiergebiete können aufgrunddieser Quellen relativ genau einge-grenzt werden.
• Die Faktoren, die zu einer bewirtschaf-teten Fläche mit Trockenvegetation imSinne unserer Methode führen sind sokomplex, dass eine Modellierungschwierig ist. Neben Relief, Klima,Geologie, Boden spielen auch Nut-zungs- und Siedlungsgeschichte einegrosse Rolle.
• DurchModellierungen berechnete Po-tenzialflächen sind generell zu gross.
• Die Übereinstimmung von berechne-ten Potenzialflächen mit Kantonsob-jekten aus bestehenden Inventaren istschlecht.
Nach der Expertinnen- und Expertenbe-fragung in den einzelnen Kantonen liegenKarten mit abzusuchenden Gebieten vor,die als Ausgangslage für die Kartierungdienen. Die bestehenden Inventare derKantone wurden einem systematischenSelektionsverfahren unterzogen und eben-falls den Regionalexpertinnen und Regio-nalexperten sowie den kantonalen Natur-schutz-Fachstellen zur Stellungnahmeunterbreitet.
Ausgehend von diesen Vorarbeiten exis-tieren für die Kartierung zwei Vorgaben:
• Abzusuchende Gebiete• Selektierte Objekte aus
Kantonsinventaren
Die Karte zeigt Kantone mit selektiertenObjekten und solche, die nur abzusu-chende Gebiete aufweisen. In Kantonenmit selektierten Objekten können, als Er-gänzung zu den im Kantonsinventar er-fassten Vegetationstypen, ebenfalls ab-zusuchende Gebiete definiert wordensein.
Vorarbeit der KantoneDurch das oben beschriebene Vorgehenwird die Vorarbeit der Kantone so gut alsmöglich einbezogen. Da sich die TWW-Methode der Erhebung und Weiterverar-beitung der Daten in jedem Fall von denkantonalen Verfahren unterscheidet undzudem viele kantonale Erhebungen nichtmehr aktuell sind, ist es unumgänglich,dass alle selektierten Kantonsobjektenochmals aufgesucht werden.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 53

3 KARTIERMETHODE54
Abzusuchende Gebiete in der Schweiz.Sie liegen grösstenteils in Kantonen ohneTrockenwieseninventar.
Einschränkung der Kartierarbeit durchAbgrenzung von abzusuchenden Gebieten.
Ausschnitt vom Col de Jaman (VD)
ABZUSUCHENDE GEBIETE
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 54

553 KARTIERMETHODE
3.4.2 Abzusuchende Gebiete
In Gebieten ohne (zuverlässiges) Trocken-wieseninventar von Kantonen oder Ge-meinden sind – in enger Zusammenarbeitmit den kantonalen Fachstellen – vonRegionalexpertinnen und -experten Flä-chen abgegrenzt worden, in denen dasVorhandensein von Trockenwiesenvege-tation von möglicherweise nationaler Be-deutung eine grosse Wahrscheinlichkeitbesitzt. Diese als abzusuchende Gebietebezeichneten Flächen dienen als Aus-gangslage für die Planung, Material-beschaffung, Luftbildinterpretation undFeldkartierung. Die abzusuchenden Ge-biete wurden von den kantonalen Natur-schutz-Fachstellen geprüft, ergänzt undgenehmigt.
Sammeln der AbgrenzungenBei der Befragung wurden die Gebieteauf Landeskarten 1:25’000 eingezeich-net. Vermutete Wildheuflächen wurdenspeziell gekennzeichnet.
DarstellungDie angegebenen abzusuchenden Ge-biete wurden digitalisiert und können somit anderen Karteninhalten und in ver-schiedenen Massstäben ausgedrucktwerden. Jedes abzusuchende Gebietwird mit einer Nummer versehen, um dieKommunikation bei der Planung und Kar-tierung zu erleichtern.
Für die Kartierung werden transparenteAuflagefolien hergestellt (Kartierplots), diesich auf eine Landeskarte 1:25’000 legenlassen. Hier sind die Flächen mit unter-schiedlichen Farben und Nummern ver-sehen.
Nach der erfolgten Kartierung werden dieFlächen auf demPlot mit der Nummer derKartierperson und dem Datum der Kar-tierung versehen.
Übersichtsplot KantonVor der Kartierung werden alle für diePlanung relevanten Daten auf einem Kar-tenausdruck kantonsweise zusammen-
gestellt. Dieser Übersichtsplot wird für je-den zu bearbeitenden Kanton vor derKartiersaison aktualisiert, so dass der je-weilige Bearbeitungsstand ersichtlich ist.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 55

3 KARTIERMETHODE56
Selektierte Objekte aus Kantonsinventaren.
Übernahme eines kantonalen Inventares alsBasis für die Definition von selektierten Objekten(rote Kreuze), die nochmals begangen werden.In nebenstehendem Beispiel aus dem KantonSchaffhausen wurden von Lokalexperten nochzusätzliche abzusuchende Gebiete (blau)angegeben.
SELEKTIERTE OBJEKTE
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 56

573 KARTIERMETHODE
3.4.3 Selektierte Objekte
In Kantonen mit einem Inventar der Tro-ckenstandorte werden die bereits kartier-ten Regionen nicht erneut abgesucht. Inden Kantonsinventaren fehlen jedoch Da-ten, die für eine vergleichende Übersichtder Trockenwiesen und -weiden derSchweiz nötig wären. Um Kantonsobjek-te im Bewertungsverfahren mit den übri-gen kartierten Teilobjekten vergleichen zukönnen, müssen dieselben Parameter zurVerfügung stehen. Es werden daher alleselektierten Kantonsobjekte aufgesuchtund neu als Teilobjekte nach der Bundes-methode kartiert.
Wir sprechen von selektierten Objekten,weil nur diejenigen kantonalen Objekteerneut aufgesucht werden, die eineChance auf nationale Bedeutung haben.Das Auswahlverfahren dieser Teilmengeerfolgt in zwei Teilschritten:
• Quantitative EinschränkungEin selektiertes Objekt muss den Mini-malflächen-Anforderungen genügenund muss unterhalb der Waldgrenzeliegen.
• Qualitative EinschränkungEin selektiertes Objekt muss zu den30% besten Objekten des entspre-chenden Kantons gehören.
Während die erste Einschränkung ein ein-faches Verfahren darstellt, erfordert diezweite eine aufwendige Rangierung, dieim Folgenden noch näher erläutert wird.
Kantonale Inventare• Aargau• Basel-Landschaft• Basel-Stadt• Bern• Freiburg• Genf• Glarus• Jura• Luzern• Neuenburg• Obwalden• Schaffhausen
• Solothurn• Tessin• Thurgau (teilweise)• Waadt• Wallis• Zürich
Die Kantone Appenzell (AI und AR), St.Gallen, Graubünden, Nidwalden, Schwyzund Uri verfügen über kein Kantonsin-ventar.
Rangierungder kantonalen ObjekteIn jedem Kanton wurden aus der Vertei-lung der Objekte über die Kantonsflächenach einem bestimmten Verfahren Ag-gregate gebildet (“Minimaltree-Verfah-ren”). Die Objekte wurden so untereinan-der verbunden, das die Summe aller Ver-bindungen möglichst klein bleibt. DurchWeglassen der längeren Verbindungenentstehen für jeden Kanton mehrere Ob-jekt-Aggregate. Jedes Objekt des Aggre-gates erhält nun einen Wert, der abhän-gig ist von:
• Fläche• Vegetation (meist ANL-Nummer)• Höhenstufe (in tiefen Lagen habenOb-
jekte einen höheren Wert als gleichgrosse Objekte in höheren Lagen)
Aus jedem Aggregat werden anschlies-send die 30% ambesten bewerteten Ob-jekte ausgewählt.
DarstellungMit wenigen Ausnahmen liegen die se-lektierten Objekte digital nur als Punktda-ten vor und wurden als solche in dasGeographische Informationssystem ein-gelesen. Jedes der selektierten Objektebesitzt eine Nummer aus dem Kantons-inventar, das während der Kartierung alsReferenznummer dient und auch auf demProtokollblatt (unter Angaben zum Kan-tonsobjekt) erfasst wird.
Für die Kartierung werden transparenteAuflagefolien hergestellt (Kartierplots), diesich auf eine Landeskarte 1:25’000 legen
lassen. Hier sind die Objekte mit einemKreuz markiert und mit der kantonalenReferenznummer versehen. Blaue Kreu-ze werden mit der Methode INT, rote mitDIF kartiert. Bearbeitete Objekte werdennach der Kartierung auf dem Plot einge-kreist und mit der Nummer der Kartier-person und dem Datum der Kartierungversehen.
Mitlauf-TeilobjekteAusgehend vom selektierten Objekt wirdauf dem Luftbild und im Gelände soweitkartiert, bis die Grenzen eines Objektesim Sinne der Bundesmethode erreichtsind. Es ist also durchaus möglich, dassfür ein selektiertes Objekt mehrere Teilob-jekte aufgenommen werden müssen. Wirsprechen von sogenannten Mitlauf-Teil-objekten.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 57

3 KARTIERMETHODE58
Ausschnitt LK25Landeskarte 1:25’000Für die Planung und die Orientierungim Gelände.
Kartierplot zum Ausschnitt LK25Transparente Auflagefolie zur Landeskarte1:25’000. Enthält Informationen über abzusu-chende Gebiete im DIF (rot) und INT (blau),zeigt die Sömmerungslinie (orange),die alpine Stufe (grau), die Gemeindegrenzen(grün) und die Fluglinien (violett).
KARTIERMATERIAL I
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 58

593 KARTIERMETHODE
3.5 GRUNDLAGENDER KARTIERUNG
3.5.1 Allgemeines zuKartiergrundlagen
Für Biotopkartierungen können verschie-dene Grundlagen verwendet werden.Je nach Genauigkeitsanspruch, Detail-lierungsgrad und verfügbaren finanziellenMitteln werden üblicherweise neben Kar-ten und Plänen auch Luftbilder, Ortho-photos und vermehrt auch Satellitenbil-der eingesetzt. Während sich die Auflö-sung von Luftbildern im Bereich vonZentimetern bis wenigen Dezimetern be-wegt, können auf Satellitenbildern heutebereits Strukturen von wenigen Meternunterschieden werden.
Als Grundlage für die TWW-Kartierungdienen Luftbilder und Orthophotos. Beiden Luftbildern handelt es sich vorwie-gend um Color-Infrarot-Luftbilder (CIR-Luftbilder), welche im Maßstab 1:10’000laufend für das TWW-Projekt geflogenwerden. Daneben werden bereits vor-handene Bilder, wie beispielsweise dieSANASILVA-CIR-Luftbilder im Maßstab1:9’000 verwendet. Die ältesten berück-sichtigten Bilder stammen aus dem Jahr1989. Farb- und Schwarzweiss-Luftbil-der werden nur in Ausnahmefällen beige-zogen.
Karten und Pläne
LandeskarteDie Landeskarten im Massstab 1:25’000(LK25) dienen der Arbeitsvorbereitung,der persönlichen Orientierung, sowie derÜbersicht über den Stand der Arbeiteneiner Kartiergruppe. Von jedem zu bear-beitenden Kartenblatt existieren zweiExemplare:
• Ungefaltete Planokarte als topogra-phische Unterlage der Kartierplots.
• Jede Kartierperson verfügt über einepersönliche Karte zur eigenen Tages-
planung und Vorbereitung, sowie zurOrientierung bei der Kartierung imGelände.
KartierplotZur Planokarte gehört eine transparenteAuflagefolie. Diese enthält Informationenbezüglich abzusuchenden Gebieten,selektierten Kantonsobjekten, Sömme-rungslinie (nach Angaben des BLW),Waldgrenzlinie (nach Kartierflächen ausWelten & Sutter 1982), offiziellen Ge-meindenummern sowie eine Flugüber-sicht mit Luftbildmittelpunkten und Mo-dellgrenzen.
Auf die Auflagefolie werden die Modell-grenzen (siehe Kap. 4), die Arbeitsfort-schritte sowie Veränderungen bei denabzusuchenden Gebieten eingetragen.
Kantonale ÜbersichtsplänePläne sind nur zu Beginn des Projek-
tes in Kantonen zum Einsatz gelangt, die
nach der Vorgehensvariante 0 bearbeitet
wurden.
Übersichtspläne sind bis auf wenige Teil-
gebiete für die ganze Schweiz flächende-
ckend (oft auch digital) vorhanden. Neben
der allgemeinen Situation enthalten sie
Höhenkurven, manchmal auch Parzellen-
grenzen. Die Pläne sind im Massstab
1:5’000 und 1:10’000 bei den kantonalen
Vermessungsämtern erhältlich. Je nach
Region ist allerdings mit grossen Unter-
schieden bezüglich Qualität, Genauigkeit
und Nachführungsstand der Pläne zu
rechnen.
Aufgrund des hohen Anspruches an La-
ge- und Perimetergenauigkeit wird im
TWW-Projekt inzwischen auf den relativ
fehleranfälligen Handübertrag vom Luft-
bild auf den Plan verzichtet.
Pläne werden nur dann im Feld mit-geführt, wenn ein auf dieser Grundlageerstelltes kantonales Inventar vorliegt undselektierte Kantonsobjekte aufgesuchtwerden (Kap. 3.4.3). In diesem Fall
0
dienen die Pläne nebst dem Perimeter-vergleich (Kap. 5.7.3) auch als Orientie-rungshilfe im Feld sowie als Grundlagezur Minimalflächenschätzung.
Formulare
Sobald ein Teilobjekt im Gelände festge-stellt und seine Grenzen auf dem Luft-bildabzug (bzw. der darüber fixierten Fo-lie) eingetragen wurden, wirdmit Hilfe vonFormularen der Inhalt des Teilobjektesfestgehalten.
ProtokollblattVorderseite: Angaben zur Lage, zur Ve-getation, zu Nutzung/Umsetzung und zufaunistisch relevanten Einschlüssen undGrenzelementen. Dies sind die Parameterfür die Bewertung und Erfolgskontrolle.Rückseite: Angaben zu den gefundenenPflanzenarten.
BemerkungsblattFalls auf dem Protokollblatt zu irgend ei-ner dafür vorgesehenen Kategorie Be-merkungen anzubringen sind, die dasProtokollierte präzisieren, vervollständi-gen und mit Hinweisen zum Vollzug ver-sehen, so ist das entsprechende Feld an-zukreuzen. Die Bemerkung wird auf eineigenes Formular geschrieben.
Formular für SingularitätenFür Singularitäten wird ein zusätzlichesFormular ausgefüllt.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 59

KARTIERMATERIAL II
Luftbilder und LuftbildfolienWährend den Feldarbeiten werden nur Luft-bildabzüge verwendet. Alle Abzüge tragen aufder Rückseite eine Etikette mit den wesentlichenAngaben zum Luftbild:
3 KARTIERMETHODE60
Luftbildabzug und Feldfoliefür Vorgehensvariante 2
Anzahl Schnittteile
Ungefährer Massstab des Originalluftbildes
Ungefährer Massstab des Luftbildabzuges
Anzahl Exemplare desselben LuftbildabzugesArchivnummer des Luftbildabzuges(TWW- Archivnummer, abgeleitet aus
der Landeskartennummer)
Kanton
Datum der Luftbildaufnahme
Vergrösserung gegenüber Originalluftbild
Archivnummer des Originalluftbildes
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 60

613 KARTIERMETHODE
3.5.2 Luftbilder undLuftbildfolien
Originalluftbilder
Originalluftbilder sind Diapositive einersenkrechten Geländeaufnahme aus derLuft. Sie sind nicht flächentreu, sondernzentralperspektivisch verzerrt. Sie wer-den nur für die stereoskopische Ab-grenzung und Nachbearbeitung und fürdie photogrammetrische Auswertung ver-wendet (Kap. 4). Es gibt verschiedeneLuftbildtypen (Kap. 3.5.3).
LuftbildabzügeFür die Feldarbeit stehen den Kartierper-sonen Papierabzüge der Originalluftbilderzur Verfügung. Alle Luftbildabzüge tragenauf ihrer Rückseite eine Etikette mitAngaben zu Fluglinie, Luftbildnummer,Flugdatum, Originalmassstab und Luft-bildarchiv-Nummer.
OriginalfolieDie Originalfolie wird für die stereoskopi-sche Abgrenzung direkt auf dem Origi-nalluftbild fixiert.
FeldfolieVon den Originalfolien werden Folien-kopien hergestellt und auf den Luftbild-abzügen fixiert. Sie werden für die Feld-kartierung verwendet.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 61

KARTIERMATERIAL III
Schwarzweiss-Luftbild
Farb-Luftbild
Color-Infrarot-Luftbild
3 KARTIERMETHODE62
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 62

633 KARTIERMETHODE
3.5.3 Luftbildtypen
In der TWW-Kartierung kommen folgendeLuftbildtypen zum Einsatz:
Schwarzweiss-LuftbilderSchwarzweiss-Luftbilder sind flächen-deckend für die ganze Schweiz beimBundesamt für Landestopographie vor-handen. Die Bilder werden alle sechsJahre aktualisiert. Der Bildmassstab liegtin der Regel zwischen 1:25’000 und1:35’000.
Biotopgrenzen sind auf Schwarzweiss-Luftbildernmeist erkennbar. Weit schwie-riger ist es, den Biotopinhalt aufgrund derwenig differenzierenden Grautöne anzu-sprechen. Schwarzweiss-Luftbilder kom-men daher bei der TWW-Kartierung nur inAusnahmefällen zum Einsatz.
Farb-LuftbilderFarb-Luftbilder liefern je nach Massstabund Biotoptyp gute Kartierergebnisse.Die Ansprache von Trockenvegetation istjedoch im Allgemeinen schwierig undunzuverlässig. Dazu kommt, dass beikleinem Massstab die Bildqualität durchverblassende Farben und Blaustich häu-fig nachlässt. Für die TWW-Kartierungwerden Farb-Luftbilder nur in Ausnahme-fällen und als Alternative zu CIR-Luft-bildern eingesetzt.
CIR-LuftbilderDer Color-Infrarot-Film besteht wie derFarbfilm aus drei farbempfindlichenSchichten. Die blauempfindliche Schichtist allerdings ersetzt durch eine im nahenInfrarot-Bereich (700-880 nm) empfindli-che Schicht, weshalb die verschiedenenVegetationstypen in unterschiedlichenRottönen erscheinen. Im Bereich des na-hen Infrarots wird ein grösserer Anteil desauf die Pflanzen auftreffenden Lichtes re-flektiert als im Bereich des sichtbarenLichtes. Aus diesem Grund werden Re-flexionsunterschiede verschiedener Ve-getationstypen im CIR-Luftbild bessersichtbar als im Farb-Luftbild (bessereFarb- und Helligkeitsdifferenzierung). Die
Reflexion des einfallenden Infrarot-Anteilshängt von der Struktur des Schwamm-gewebes einer Pflanze ab, da die Refle-xion vor allem an den Grenzflächen derluftgefüllten Hohlräume und wasserhalti-gen Zellwänden des Schwammparen-chyms stattfindet. Pflanzenbestände,welche über eine eingeschränkte Was-serversorgung verfügen (Trockenvege-tation!) zeigen aufgrund ihres verändertenSchwammgewebes eine verringerteReflexion im nahen IR-Bereich. Ähnlichverhält es sich mit nährstoffarmenBeständen. Sowohl trockene als auchnährstoffarme Vegetationstypen erschei-nen im CIR-Luftbild daher heller als was-sergesättigte und/oder nährstoffreicheVegetationstypen.
Diese Tatsache ermöglicht es, die Luft-bilder bereits vor der eigentlichen Feld-kartierung stereoskopisch auf Trocken-vegetation hin abzusuchen und denKartieraufwand somit zu reduzieren(Kap. 3.2.5, Kap. 4). Wichtig für eineoptimale Nutzung der CIR-Luftbilder istder Befliegungszeitpunkt. Idealerweisesollten Trockenbiotope vor der erstenNutzung beflogen werden, damit Vege-tations- nicht durch Nutzungsgrenzenverwischt werden. Da die Aufnahme vonCIR-Luftbildern jedoch besondere undeher seltene Witterungsbedingungenvoraussetzt (wolkenloser, dunstfreierHimmel, idealer Sonnenstand), muss derZeitraum der Befliegungen auf die ge-samte Vegetationsperiode ausgedehntwerden. Bilder mit frischen Nutzungs-grenzen sind somit nicht zu umgehen.
OrthophotosBeim Orthophoto handelt es sich um einLuftbild, welches mit Hilfe eines digitalenHöhenmodells entzerrt und somit von derZentralperspektive des Luftbildes in eineorthogonale Projektion (senkrechte Pa-rallelprojektion) gebracht wurde. DasOrthophoto besitzt einen über den ge-samten Landschaftsausschnitt einheit-lichen Massstab. Die Genauigkeit einesOrthophotos hängt von der Genauigkeitdes verwendeten Höhenmodells ab. Das
heute vielfach verwendete DHM 25basiert auf den Höhenlinien der Landes-karte 1:25’000. Je nach Geländereliefweist es Lagefehler von einigen Meternauf, was dem hohen Anspruch der TWW-Kartierung bezüglich Lagegenauigkeitder Teilobjekte nicht genügt. Durch Zu-satzauswertungen (Verdichtung des Git-ternetzes) kann das DHM 25 jedoch soverbessert werden, dass der Lagefehlerbei max. 1 m liegt. Zum heutigen Zeit-punkt verfügen die beiden Kantone Juraund Obwalden über ein derartiges “ver-bessertes” digitales Höhenmodell undwerden mit Orthophotos kartiert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 63

ABBILDUNG AUS INFOBLATT
Informations-Faltblatt des BUWAL
3 KARTIERMETHODE64
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 64

653 KARTIERMETHODE
3.5.4 Kartierverhaltenund Vorbereitung
Kartierverhalten
Von der kantonalen Naturschutzfach-stelle oder dem Projektteam werden imAllgemeinen die Gemeinden, die Acker-baustellenleiter und manchmal auch ein-zelne Bewirtschafterinnen und Bewirt-schafter im Voraus über die bevorstehen-de Kartierung unterrichtet.
Die Kartierpersonen können mit einer of-fenen Informationshaltung gegenüber derBevölkerung dazu beitragen, dass dieUmsetzung gelingt.
• Es können Leute eingeladen werden,die Kartierung ein bis zwei Stunden zubegleiten.
• Werden bei der Kartierarbeit Landwir-te angetroffen, so sind sie zu begrüs-sen und kurz über Sinn und Zweck derArbeit zu informieren.
• Die Vegetation ist nur dann zu betre-ten, wenn es für die Aufnahmen not-wendig ist. Wenn möglich sind Wegeoder Kulturgrenzen zu benützen. Ab-kürzungen über Kulturland sind zuvermeiden.
• In jedem Gespräch sind die Zielset-zungen des Projektes vorzustellen(Übersicht der trockenen Wiesen undWeiden der Schweiz erstellen, Grund-lagen für Beitragszahlungen schaffen,internationale Abmachungen erfüllen,etc.).
• Werden Skepsis und Einwände ge-äussert, ist darauf hinzuweisen, dassbestehende Verträge fast immer bei-behalten werden können.
• Als Prinzipien der Umsetzung gelten:Abgeltung von ökologischen Leistun-gen; Rahmen durch den Bund vorge-geben; Vollzug weiterhin durch dieKantone; Freiwilligkeit.
• Ein Faltblatt mit weiteren Informatio-nen soll an Landwirte und andereinteressierte Personen abgegebenwerden.
Kartiervorbereitung
Abzusuchende GebieteAm Vorabend des Kartiertages werdendie abzusuchenden Gebiete (Kap. 3.4.2)auf die persönliche Arbeitskarte übertra-gen. Grosse Gebiete können unter denKartierpersonen aufgeteilt werden. DieGebietsaufteilung kann auch unter As-pekten der Sicherheit bei gefährlichenGebieten oder Optimierung der Trans-portmittel vorgenommen werden.
Auf dem Kartierplot (Kap. 3.5.1) wirdzunächst nichts eingetragen. Erst nachdem Kartiertag werden die abgesuchtenGebiete eingetragen und mit der persön-lichen Nummer und dem Datum verse-hen. So bleibt die Übersicht über noch zukartierende Gebiete erhalten und der fürdie Kartierung benötigte Zeitaufwandkann anhand des Datums rekonstruiertwerden.
Selektierte ObjekteDie selektierten Objekte (Kap. 3.4.3) sindauf dem Kartierplot mit einem Kreuz ein-getragen, das ungefähr den Mittelpunktdes Kantonsobjektes kennzeichnet.Nach Absprache mit den anderen Kartie-rerinnen und Kartierer werden – je nachVerteilung der Kreuze auf der Karte – 6 bis10 Kreuze auf die persönliche Feldkarteübertragen (Tagesration). In der Nähe lie-gende abzusuchende Gebiete werdenebenfalls eingetragen. Nach dem Kartier-tag werden die bearbeiteten selektiertenObjekte auf dem Kartierplot markiert undmit persönlicher Nummer und dem Da-tum versehen. So bleibt die Übersichtüber noch zu kartierende Gebiete undKantonsobjekte erhalten und der für dieKartierung benötigte Zeitaufwand kannanhand des Datums rekonstruiert wer-den.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 65

1 Überblick verschaffen
3 Testfläche festlegen
4 Grenzen festlegen
6 Fremdvegetation abstreichen
KARTIERABLAUF I
Luftbildabzug ohne vorinterpretierte Teilobjekte(Vorgehensvariante 1).
extensive Nutzung
wechselfeuchte Fläche
gebüschreiche Fläche
möglicher Trockenstandort
Luftbildabzug mit Teilobjektabgrenzungen(Vorgehensvariante 2 ).
3 KARTIERMETHODE66
1 3
4
6
1 3
4
6
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 66

673 KARTIERMETHODE
3.5.5 Kartierablauf inabzusuchenden Gebieten
(vgl. auch Kap. 3.4.2)
1. Überblick verschaffenKantone mit abzusuchenden Gebietenwerden heute in der Regel nach Vor-gehensvariante 2 (Kap. 3.2.5) kartiert. InKantonenmit bestehendem Inventar wer-den neben selektierten Objekten z.T.auch abzusuchende Gebiete bearbeitet.Diese werden nach Vorgehensvarianten 1oder 3 kartiert.
Beim Aufsuchen eines vorabgegrenztenTeilobjektes ist es wichtig, sich zuersteinen Überblick zu verschaffen. Trocke-nere Vegetation ist meist schon aus Dis-tanz erkennbar und hebt sich durch denBlumenreichtum und das weniger satteGrün von der übrigen Vegetation ab. ImWeiteren muss die Vegetation “stratifi-ziert” werden, d.h. die Textur, das ausDistanz erkennbare Mosaik aus verschie-denen Grüntönen, wird analysiert undmitden Geländeeigenschaften verglichen.So können beispielsweise Zusammen-hänge zwischen Hangneigungen und be-stimmten Farbtönen der Vegetation er-kannt werden.
Bei der Feldarbeit werden gezielt die
vorabgegrenzten Teilobjekte aufgesucht,
d.h. es wird nicht das ganze Gebiet be-
gangen. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Luftbildinterpretinnen
das Gebiet unter dem Stereoskop flächig
auf potentielle Trockenvegetation hin ab-
gesucht haben.
Der Auftrag zum Absuchen eines
Gebietes ist flexibel zu interpretieren: bei-
spielsweisemüssenWaldlichtungen, wel-
che die Minimalflächenanforderungen
nicht erfüllen, nicht abgesucht werden.
Zusätzlich sind auch gewisse sichere
Analogieschlüsse mit Hilfe des Luftbildes
zulässig (“Luftbildinterpretation während
der Geländearbeit”).
1/3
2
2. Vorabgrenzung TeilobjektAufgrund der Gelände- und Luftbildana-lyse kann ein Teilobjekt provisorisch ab-gegrenzt werden.
Diesen Teilschritt übernimmt die
stereoskopische Flächenabgrenzung.
Die vermuteten Grenzen können provi-sorisch ins Luftbild eingetragen werdenoder auch imaginär gedacht werden. Diegenaue Grenzziehung erfolgt später.
3. Testfläche festlegenIm provisorischen Teilobjekt wird nunsorgfältig die Testfläche für die Vegeta-tionsbestimmung ausgewählt. Die mög-lichst homogene, kreisförmige Fläche mit3 m Radius sollte so gewählt werden,dass sie für die dominante Vegetation deskünftigen Teilobjektes möglichst reprä-sentativ ist (Kap. 5.1.2). Während der Ve-getationsaufnahme wird der Mittelpunktmit einem GPS vermessen.
4. Grenze festlegenAnschliessend wird, ausgehend von derTestfläche, die Wiese oder Weide soweitabgeschritten, bis die Grenze der Tro-ckenvegetation erreicht ist oder sichdie Grenzkriterien verändern (meist beiWechsel des dominanten Vegetations-typs). Für die Methoden INT und DIF istder Katalog der zu berücksichtigendenGrenzkriterien verschieden (Kap. 3.2.3,Kap. 3.7.1).
Die von der Luftbildinterpretation
vorgeschlagene Grenze wird überprüft
und, falls nötig, auf der über dem Luft-
bildabzug fixierten Feldfolie korrigiert.
5. Protokollblatt fürdas Teilobjekt ausfüllenBereits während dem Abschreiten desTeilobjektes werden Funde wie Ein-schlüsse, seltene Arten usw. auf demProtokollblatt notiert. Am Ende der Bear-beitung eines Teilobjektes steht nun dieVervollständigung des Protokollblattes.Dies sollte unbedingt noch im Geländegeschehen, da viele Parameter am Ende
2
2
des Arbeitstages nicht mehr bestimmtwerden können (Kap. 5.7.1).
6. Fremdvegetation abstreichenGrenzt das Teilobjekt an Fremdvegetation,so wird diese im Luftbild mit einem Codemarkiert, der dem Fremdvegetations-Typentspricht. Offensichtliche Fremdvegeta-tion (Wald, Acker, Gärten) muss nicht ab-gestrichen werden.
Besonderheiten und Probleme können impersönlichen Feldbuch notiert werden.Besondere Situationen oder typischeLandschaftsaspekte können allenfalls miteinem Dia festgehalten werden.
Wichtig: Während der Begehung soll-ten wenn immer möglich nur bestehendeWege benutzt werden.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 67

KARTIERABLAUF II
Luftbildabzug mit selektiertem Kantonsobjekt(das Kreuz markiert den Objektmittelpunkt),Vorgehensvariante 1.
1 Kantonsobjekt aufsuchen
2 Verworfenes selektiertes Objekt.Die Fläche wird abgestrichen und miteinem Abstreichcode versehen.
4 Testfläche festlegen
5 Grenze festlegen
8 Mitlauf-Teilobjekt
+ Selektierte Kantonsobjekte
3 KARTIERMETHODE68
2
2
4
5
8
1
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 68

693 KARTIERMETHODE
3.5.6 Kartierablauf beiselektierten Objekten
1. Kantonsobjekt aufsuchenIst kein abzusuchendes Gebiet um einselektiertes Kantonsobjekt auf dem Kar-tierplot eingetragen, so wird bei derGeländearbeit direkt das selektierte Kan-tonsobjekt aufgesucht, das umliegendeGelände wird nicht abgesucht. Für dieKartierung wird eine Kartenkopie ausdem kantonalen Inventar mitgenommen.Nach den Vorschriften zur Aufnahme vonTeilobjekten (Minimalgrösse, Grenzkri-terien, Schlüsselschwelle, usw.) wirddas Teilobjekt neu definiert und abge-schritten.
2. Was tun, wenn das selektierteObjekt verworfen werden muss?Wenn das selektierte Kantonsobjekt dieAufnahmekriterien nicht erfüllt, wird dasKreuz in der Karte auf den Luftbildabzugoder das Orthophoto übertragen. Die dasKreuz umgebende Fläche wird abgestri-chen und mit einem Abstrich-Code ver-sehen (analog abzusuchende Gebiete).Das Protokollblatt wird nur minimal aus-gefüllt. Dann kann das nächste selektier-te Objekt aufgesucht werden.
3. Vorabgrenzung TeilobjektIst die Aufnahmeschwelle erfüllt, so wirdein Teilobjekt provisorisch abgegrenzt.
Die vermuteten Grenzen können provi-sorisch ins Luftbild eingetragen werdenoder auch imaginär gedacht werden. Diegenaue Grenzziehung erfolgt später.
4. Testfläche festlegenIn diesem provisorischen Teilobjekt wirdnun sorgfältig die Testfläche für die Ve-getationsbestimmung ausgewählt. Diemöglichst homogene, kreisförmige Flä-che mit 3 m Radius sollte so gewähltwerden, dass sie für die dominante Ve-getation des künftigen Teilobjektes mög-lichst repräsentativ ist (Kap. 5.1.2). Wäh-rend der Vegetationsaufnahme wird derMittelpunkt mit einem GPS vermessen.
5. Grenze festlegenAnschliessend wird, ausgehend von derTestfläche, die Wiese oder Weide soweitabgeschritten, bis die Grenze der Tro-ckenvegetation erreicht ist oder sichdie Grenzkriterien verändern (meist beiWechsel des dominanten Vegetations-typs). Für die Methoden INT und DIF istder Katalog der zu berücksichtigendenGrenzkriterien verschieden (Kap. 3.2.3,Kap. 3.7.1).
6. Protokollblatt für das Teilob-jekt ausfüllenBereits während dem Abschreiten desTeilobjektes werden Funde wie Ein-schlüsse, seltene Arten usw. auf demProtokollblatt notiert. Am Ende der Bear-beitung eines Teilobjektes steht nun dieVervollständigung des Protokollblattes.Insbesondere muss der Teilobjekt-Peri-meter mit dem Kantons-Perimeter ver-glichen werden (Kap. 5.7.3). Dies sollteunbedingt noch im Gelände geschehen,da viele Parameter am Ende des Arbeits-tages nicht mehr bestimmt werden kön-nen.
7. Fremdvegetation abstreichenGrenzt das Teilobjekt an Fremdvegeta-tion, so wird diese im Luftbild mit einemCode markiert, der dem Fremdvege-tations-Typ entspricht. OffensichtlicheFremdvegetation (Wald, Acker, Gärten)muss nicht abgestrichen werden.
8. Mitlauf-TeilobjekteIst das Teilobjekt von Fremdvegetationumgeben, ist die Kontrolle des selektier-ten Objektes damit abgeschlossen. An-dernfalls werden weitere Teilobjekte andas ursprünglich selektierte kantonaleObjekt angehängt. Es entstehen soge-nannte Mitlauf-Teilobjekte, die indirekt,über das selektierte Teilobjekt, in dieÜbersicht gelangen. Zusammen mit demselektierten Teilobjekt bilden sie dasselektierte Objekt, für das die Objekt-Minimalfläche erfüllt sein muss. Es istmöglich, dass auf diese Weise auchmehrere selektierte Teilobjekte unterein-ander verbunden werden.
Besonderheiten und Probleme können impersönlichen Feldbuch notiert werden.Besondere Situationen oder typischeLandschaftsaspekte können allenfalls miteinem Dia festgehalten werden.
Wichtig: Während der Begehung soll-ten wenn immer möglich nur bestehendeWege benutzt werden.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 69

aneinander grenzend:Teilobjekte berühren sich an einem Punkt.
aneinander grenzend:Teilobjekte sind durch eine Eisenbahnliniegetrennt.
aneinander grenzend:Teilobjekte sind von einem bis 10 m breitenStreifen mit Fremdvegetation getrennt.
aneinander grenzend:Teilobjekte sind sich durch einen Bachlaufgetrennt.
OBJEKT UND TEILOBJEKT
Alle aneinander grenzenden Teilobjektebilden ein Objekt.
1 Teilobjekt-Nummer
2 Teilobjekt
3 Objekt-Nummer
Spezialfälle aneinander grenzenderTeilobjekte
3 KARTIERMETHODE70
1
2
2
2
2
3
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 70

713 KARTIERMETHODE
3.6 OBJEKTKONZEPT
3.6.1 Allgemeines
Um die unterschiedlichen Ziele der Kar-tierung zu erfüllen, hat es sich als sinnvollerwiesen, im Gegensatz zu anderen Kar-tierungen zwei Kartiereinheiten zu ver-wenden, die hierarchisch miteinanderverknüpft sind: das Teilobjekt und dasObjekt (siehe auch Kap. 3.1).
TeilobjektDas Teilobjekt, das vorwiegend ausTWW-Vegetation besteht, ist die einzigeErhebungseinheit der TWW-Kartierung.Jedes Teilobjekt wird auf dem Luftbild miteinem Perimeter festgehalten und mit ei-nem Protokollblatt beschrieben. Die imGelände aufgenommenen Daten bezie-hen sich immer nur auf das jeweilige Teil-objekt.
Teilobjekte müssen eine vorgegebeneMinimalfläche aufweisen, die je nachRegion unterschiedlich gross sein kann.Wenn Teilobjekte nicht an andere Teilob-jekte angrenzen – also isoliert sind –,müssen sie die Minimalfläche für Objekteaufweisen, andernfalls können sie nichtaufgenommen werden.
Die Grenzkriterien (Kap. 3.7.1) sind in ei-nem Teilobjekt homogen; sobald sie sichverändern, muss ein neues Teilobjektausgeschieden werden.
ObjektAneinandergrenzende Teilobjekte werdenzu einem Objekt zusammengefasst. DerBegriff des Objektes dient der Festlegungder Minimalfläche der zu kartierendenTWW-Flächen und als Einheit für die Be-wertung. Auf der Ebene des Objekteswerden keine Daten protokolliert. Ein Ob-jekt muss eine Minimalfläche aufweisen,die je nach Region unterschiedlich grosssein kann. Im einfachsten Fall besteht dasObjekt aus nur einem Teilobjekt, und sei-ne Fläche ist mit der Fläche des Teilob-jektes identisch. Um aufgenommen zu
werden, muss ein solches isoliertes Teil-objekt die Minimalfläche für Objekte auf-weisen.
FlächenschätzungDie Fläche von Objekten und Teilobjektenwird im Gelände undmit Hilfe von Karten,Luftbild oder Plangrundlagen geschätzt.Für die Schätzung der Fläche gilt immerderen Projektion auf der Karte.
Was heisst“aneinander grenzen” ?Für die Bestimmung der Objektfläche istes entscheidend, ob die Teilobjekte an-einander grenzen oder nicht.
• Teilobjekte, die sich nur an einemPunkt berühren, gelten als aneinandergrenzend.
• Sie werden ebenfalls als aneinandergrenzend betrachtet, wenn sie durchein lineares Element (Hecke, einspuri-ge Strasse, Eisenbahn, Bachlauf etc.)getrennt sind.
• Bei Grenzelementen, die sowohl line-ar als auch flächig auftreten können(Streifen mit Gebüsch, Fettwiesen-streifen etc.) gilt eine maximale Breitevon 10 m als Richtgrösse, um sie als“linear” ansprechen zu können (Anm.:Wird das Objekt an einem linearenGrenzelement abgeschlossen, so istder Rand des Grenzelementes alsGrenze zu verwenden).
• Knapp isolierte Teilobjekte werden beider Grenzziehung nach Möglichkeitzusammengeführt.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 71

Die Trockenvegetation erreicht zwardie Grösse eines Teilobjektes,
aber nicht diejenige eines Objektes
Die Trockenwiese wird nicht kartiert.Sie wird mit “P” (= Fläche zu klein)
abgestrichen
Es wird ein Objekt mit zwei Teilobjekten kartiert,die beide Begleitvegetation aufweisen
Minimalfläche Teilobjekt
Die Trockenvegetation ist aus drei verschiedenenVegetationstypen zusammengesetzt.Zwei Flächen erreichen die Grösse einesTeilobjektes, das Gesamtmosaik hat Objekt-grösse
3 KARTIERMETHODE72
MINIMALFLÄCHENFÜR OBJEKTE/TEILOBJEKTE
Das Beispiel zeigt den Unterschied zwischeneinem Fall, wo die Minimalfläche erreicht wird,und einem, wo dies nicht der Fall ist.
UNTERSCHIEDE IN DEN HÖHENKLASSEN
Der Kartenausschnitt der Region Niesen (KantonBern) macht den Unterschied in der Grösse derObjekte in verschiedenen Höhenstufen deutlich.
Minimalfläche Objekt
Niesenkette
Engstligental
Kandertal
In der Höhe sind TWW-Flächen imAllgemeinen grösser und häufiger.
In der Ebene und den Tallagen sindTWW-Flächen meist klein und oft isoliert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 72

733 KARTIERMETHODE
3.6.2 Minimalflächen
Damit Trockenvegetation kartiert wird,muss sie eine minimale zusammenhän-gende Fläche aufweisen. Dadurch wirdverhindert, dass auch kleinste Fleckenvon Trockenböschungen oder Trocken-säumen aufgenommen werden müssen.Die Minimalflächen werden aus natur-schutzpolitischen Gründen festgelegt, sielassen sich nicht generell ökologisch ab-leiten, da auch kleine Flecken wichtigeökologische Funktionen haben können.Minimalflächen sind auch eine wichtigeSteuergrösse, die den anfallenden Kar-tieraufwand stark beeinflusst. Die Wahlder Minimalflächengrösse ist letztlich ei-ne finanzielle Frage. Bei einer Kartierungauf nationaler Ebene werden relativ gros-se Minimalflächen festgesetzt; bei einerregionalen oder lokalen Kartierung kön-nen die Minimalflächen entsprechendherabgesetzt werden.
Minimalfläche für das ObjektDie wichtigste Minimalfläche ist diejenigedes Objektes, d.h. die minimale zu-sammenhängende Fläche mit Trocken-vegetation. Diese entscheidet, ob dasObjekt bearbeitet wird und somit Eingangin die nationale Übersicht der TWWfindet. Zusammen mit dem Objekt sindnatürlich auch alle seine Teilobjekte vondiesem wichtigen Schwellenwert be-troffen. Neben den Anforderungen an dieVegetation ist dies somit das wichtigsteKriterium zur Aufnahme einer TWW-Fläche. Zudem sind die Minimalflächender Objekte ein wichtiger Faktor für dieEinschränkung des Kartieraufwandes.
Minimalfläche für das TeilobjektInnerhalb des Objektes werden Teilobjek-te wie Mosaiksteine auskartiert. Die Re-geln zum Auskartieren werden weiter un-ten beschrieben. Die Minimalfläche desTeilobjektes definiert damit die Auflö-sungsgenauigkeit des Vegetationsmo-saiks. Grosse Minimalflächen ergebeneine grobe, kleine Minimalflächen einedetaillierte Kartierung. Kleinere Fleckenseltener Vegetation werden bei grossen
Minimalflächen zwar mit ihrem prozentu-alen Anteil erfasst (als Begleitvegetation),sie können aber nicht lokalisiert werden.Diese Einschränkung hat keine Bedeu-tung für die spätere Bewertung, die aufder Basis der gesamten Objekte erfolgt,wohl aber für die Umsetzung.
Regionale UnterschiedeIn warmen und eher trockenen Regionensind die Anteile und damit auch die Flä-chen der Trockenwiesenflecken um einVielfaches grösser als in den nieder-schlagsreichen Regionen. Es ist daheraus ökologischer und naturschutzpoliti-scher Sicht sinnvoll, die Minimalflächenregional verschieden festzulegen.
Unterschiede in HöhenklassenMit zunehmender Meereshöhe werdendie TWW-Flächen im Allgemeinen grös-ser und häufiger. Es werden daher ver-schiedene Höhenklassen mit unter-schiedlichenMinimalflächen gebildet. DieHöhengrenzen sind streng zu interpre-tieren: Sobald eine Fläche nicht mehrdie untere Höhenklasse berührt, wirdkonsequent die Minimalfläche der oberenHöhenklasse angewendet.
Unterschiedliche NutzungenWeiden sind im Allgemeinen grösser undhäufiger als Wiesen. Würde die Nutzungbei der Festlegung der Minimalflächenicht berücksichtigt, so würden weit we-niger Wiesen in die Übersicht gelangen,sie würden von den Weiden “verdrängt”.Für Wiesen wurden daher kleinere Mini-malflächen festgelegt als für Weiden. ImZweifelsfalle wird die Minimalfläche fürWiesen angewendet.
Minimalfläche für BrachenKann die Brache als ehemaligeWeide an-gesprochen werden, so gelten die Mini-malflächen fürWeiden. Andernfalls gilt dieMinimalfläche für Wiesen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 73

3 KARTIERMETHODE74
MINIMALE BREITENBEI DER KARTIERUNG
Teilobjekte dürfen aus pragmatischen Gründeneine minimale Breite nicht unterschreiten.
DIF
INT
minimale Breite des Objektes minimale Breite des Teilobjektesinnerhalb des Objektes
PROJEKTIONSFLÄCHE
Als Fläche gilt die Projektion. Bei einem Winkelvon ca. 35 Grad beträgt die Reduktion der Flächedurch die Projektion ca. 20%.
35˚
Bei einem Winkel von ca. 10 Grad beträgtdie Reduktion der Fläche durch die Projektionweniger als 2%.
Höher gelegenes Gelände ist vergrössert,hat einen grösseren Massstab.
VERZERRUNG DER LUFTBILDABZÜGE
Unverzerrter Bildmittelpunkt
Ränder sind gegenüber der Mitte verzerrt.
Tiefer gelegenes Gelände ist verkleinert,hat einen kleineren Massstab.
10˚
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 74

753 KARTIERMETHODE
3.6.3 Flächenschätzung
Im Gelände müssen Objekt- und Teilob-jektfläche abgeschätzt werden, um si-cherzugehen, dass sie die Minimalflächeerfüllen. Eine gute Schätzung setzt einegewisse Erfahrung voraus, die man sichdurch Ausbildung und Eichung aneignenkann. Es ist ratsam, sich zu Beginn derKartierung die Grösse ausgemessenerFlächen und Distanzen einzuprägen (z.B.10 x 10 m = 1 Are, 30 x 30 m = 9 Aren).
Neben dem Augenmass dienen Karten,Pläne und Luftbildabzüge als Grundlagefür die Flächenschätzung.
Mit Hilfe der Feldpläne kann die
Flächenschätzung überprüft werden.
Da Pläne nur noch bei der Kartierung se-lektierter Objekte mitgeführt werden,erfolgt die Flächenschätzung zumeist mitHilfe des Luftbildabzuges und einer Flä-chenschablone.
Flächenschätzungmit dem LuftbildFlächen auf dem Luftbildabzug sind nichtleicht zu schätzen, da der abgebildeteLandschaftsausschnitt durch die Zen-tralprojektion eine geometrisch bedingteReliefverzerrung und damit Massstabs-unterschiede aufweist. Lediglich der Bild-mittelpunkt ist unverzerrt abgebildet. DieZentralprojektion bewirkt, dass Punkte,die höher oder tiefer als der Bildmittel-punkt liegen, in Bezug auf den Bildmittel-punkt radial nach aussen bzw. nachinnen verschoben werden.
Ein Luftbild erscheint nur in völlig ebenemGelände verzerrungsfrei und weist einenüber das ganze Bild konstanten Mass-stab auf. Der Massstab höher gelegenerGeländepunkte ist aufgrund der geringe-ren Distanz zur Kamera grösser als derMassstab tiefer gelegenen Geländes.Der auf dem Luftbildabzug angegebeneMassstab ist daher lediglich als mittlererBildmassstab anzusehen. Selbstverständ-
0
lich ist es unumgänglich, dass auch Ob-jekte aufgenommen werden, die eher et-was zu klein sind, zumal im Zweifelsfallezugunsten der Fläche entschieden wird.
BruttoflächeFür die Beurteilung der Minimalflächenwird stets die Bruttofläche innerhalb desPerimeters gerechnet, d.h. allfällige Ein-schlüsse werden mitgezählt.
ProjektionsflächeFür Teilobjekte in Hanglage gilt nicht dieeffektive Fläche, sondern deren orthogo-nale Projektion auf Luftbild und Karte. DerUnterschied zwischen realer und proji-zierter Fläche macht sich allerdings erstbei Neigungen ab ca. 20° bemerkbar.
MinimalbreiteFür Teilobjekte muss auch eine minimaleBreite definiert werden, damit sie karto-grafisch überhaupt dargestellt werdenkönnen und damit Objekte nicht unnötigkompliziert kartiert werden müssen. AmObjektrand beträgt die Minimalbreite fürTeilobjekte (und damit auch für Objekte)5 m. In Gebieten, die mit INT kartiert wer-den, beträgt die minimale Breite amRandvon Objekten sogar 10 m.
Auch beim Auskartieren innerhalb derObjekte werden minimale Breiten vorge-geben, um den Aufwand zu optimieren:hier gilt eine Minimalbreite von 20 m.
Minimalflächen als SteuergrösseWenn sich im Verlauf der Kartierung her-ausstellt, dass die festgelegten Minimal-flächen zu unverhältnismässig hohemKartieraufwand führen, so können sievergrössert werden.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 75

Vegetationstyp VegetationstypVerbuschung
Nutzung Gemeindezugehörigkeit
Gemeindegrenze
REGELN ZUM ABGRENZENVON TEILOBJEKTEN
Teilobjekte sind Einheitsflächenbezüglich folgender Merkmale:
3 KARTIERMETHODE76
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 76

773 KARTIERMETHODE
3.7 GRENZKRITERIEN
3.7.1 Regeln zum Abgrenzenvon Teilobjekten
AllgemeinesBei der Grenzziehung im Gelände müs-sen zwei verschiedene Gruppen vonGrenzregeln unterschieden werden:
• Abgrenzung gegenüber Fremdvegeta-tion (Vegetationsschlüssel 1: Schwel-lenschlüssel)
• Abgrenzung innerhalb der Schlüssel-vegetation (Grenzkriterien für Einheits-flächen, Kap. 3.7.2 ff).
EinheitsflächenBei jeder Kartierung werden auf einerKarte Flächen umgrenzt, die in der Land-schaft gleiche oder ähnliche Werteannehmen. Solange nur auf einen Para-meter geachtet wird, entstehen thema-tische Karten, z.B. Vegetationskarten mitdem Parameter Vegetation, geologischeKarten mit dem Parameter Geologie, Ge-meindekarten mit dem Parameter Ge-meindezugehörigkeit, usw.
Es gibt aber auch Kartierungen, bei de-nen eine ganze Reihe von Parameterngleichzeitig homogen sein muss, z.B. Ge-meindezugehörigkeit und Vegetation. Insolchen Fällen spricht man von Einheits-flächen. Die Parameter, die für die Ab-grenzung der Einheitsflächen verwendetwerden, nennt man Grenzkriterien. DieTWW-Kartierung ist eine Einheitsflä-chenkartierung. Bei der Zusammenstel-lung der Grenzkriterien wurde darauf ge-achtet, dass durch sie Einheitsflächenentstehen, die dem Zweck der Kartierungdienlich sind. Die folgende Liste gibt einenÜberblick über die verwendeten Grenz-kriterien.
VegetationstypMit dem Vegetationstyp kann die Biodi-versität der Trockenstandorte am bestenerfasst und lokalisiert werden. Die Vege-tationsunterschiede werden derart detail-
liert erfasst, dass für jede Region und Hö-henstufe die jeweils besten Vegetations-typen bezeichnet werden können. Damithaben wir die Voraussetzung sowohl fürdas Setzen von Prioritäten in der Um-setzung als auch für die Erfolgskontrolle.Wir erhalten eine genaue, kontrollierbareÜbersicht über die Verbreitung gefähr-deter TWW.
NutzungTeilobjekte werden entlang von Nut-zungsgrenzen abgetrennt, sind also auchin Bezug auf die Nutzung homogen.Durch diese Abgrenzung können die Flä-chen direkt für den Vollzug verwendetwerden. Eine nochmalige Begehung istnicht notwendig; mit den Bewirtschafte-rinnen und Bewirtschaftern können auf-grund der Daten direkt Verträge abge-schlossen werden.
GemeindezugehörigkeitUm den späteren Vollzug zu erleichtern,sollen Teilobjekte nicht von Gemeinde-grenzen durchschnitten werden.
VerbuschungDie Verbuschung ist für Vollzug und Er-folgskontrolle ein wichtiger Parameterbzw. Indikator.
Anteil EinschlüsseGrosse Unterschiede beim Anteil der Ein-schlüsse innerhalb einer Fläche würdenden Vollzug und die Erfolgskontrolle er-schweren.
Geländeform(geomorphologische Grenze)Bei der Kartierung nach der INT-Methodebesteht die Gefahr, dass grosse Flächenentstehen. Um den Vollzug nicht zu er-schweren, werden grosse Teilobjekte beimarkantem Wechsel in der Geländeformgetrennt.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 77

2
1
3 KARTIERMETHODE78
GRENZKRITERIEN FÜR DIE DIF-METHODE
Beispiel einer EinschlussgrenzeIm Luftbild sind für das rechte Teilobjektgrössere Felsflächen sichtbar. Daher wirdes vom linken Teilobjekt abgetrennt.
1 keine Felseinschlüsse
2 felsige Einschlüsse
1 Das Teilobjekt wird an derEinschlussgrenze abgetrennt.Oben: grosse EinschlüsseUnten: keine Einschlüsse.
2 Das Teilobjekt wird an derVegetationsgrenze abgetrennt.
3 Das Teilobjekt wird an derGemeindegrenze abgetrennt.
4 Das Teilobjekt ist zu klein; die Flächewird (trotz Grenzkriterium Gemeindegrenze)an das angrenzende Teilobjekt angehängt(Bemerkung im Protokollblatt!).
5 Das Teilobjekt wird an der Nutzungsgrenzeabgetrennt (schraffiert: Wiese,nicht schraffiert: Weide).
1
25
4
3
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 78

793 KARTIERMETHODE
3.7.2 Grenzkriterienfür die DIF-Methode
Für die differenzierende Methode der tie-feren Lagen (DIF-Methode) wird im Grun-de genommen eine Vegetationskartie-rung durchgeführt, wobei die einzelnenVegetationstypen eine minimale Flä-chengrösse im Gelände erreichen müs-sen, damit sie auskartiert werden. Derdominante Vegetationstyp wird hier zumwichtigsten Kriterium der Abgrenzungvon Teilobjekten. Es tragen aber nochweitere Kriterien zur Abgrenzung ver-schiedener Teilobjekte bei. Die Grenz-kriterien wurden so gewählt, dass die Teil-objekte differenziert bewertet werdenkönnen und dass die Resultate direkt fürdie Umsetzung (z.B. für den Abschlussvon Bewirtschaftungsverträgen) verwend-bar sind. In den nebenstehenden Skizzensind die Kriterien veranschaulicht, die imFolgenden noch etwas erläutert werden.
Politische GrenzeEin Teilobjekt darf nicht in zwei verschie-denen Kantonen liegen. Liegt ein kleinerTeil (kleiner als die Minimalfläche für Teil-objekte) des Teilobjektes im Nachbarkan-ton, so muss er weggelassen werden; esist aber unbedingt eine Bemerkung anzu-bringen.
Ein Teilobjekt sollte grundsätzlich nicht inzwei verschiedenen Gemeinden liegen.Liegt trotzdem ein kleiner Teil des Teilob-jektes in der Nachbargemeinde, so wirddieser Teil zum Teilobjekt gerechnet. Auchhier ist eine Bemerkung anzubringen.
NutzungsgrenzeEin Teilobjekt umfasst einen einheitlichenHauptnutzungstyp (Wiese, Weide, Bra-che). Bei unsicherem Nutzungswechselsollte vorsichtigerweise keine Grenze ge-zogen werden. Hat ein kleiner Teil (kleinerals die Minimalfläche für Teilobjekte) desTeilobjektes einen anderen Nutzungstyp,z.B. gemähte Trockenvegetation ausser-halb desWeidezaunes, so wird dieser Teiltrotzdem zum Teilobjekt gerechnet. Es isteine Bemerkung anzubringen.
VegetationsgrenzeEine Teilobjektgrenze führt entlang derGrenze des dominierenden Vegetations-typs. Angrenzende Schlüsselvegetation,die nicht die Minimalfläche erreicht, wirdals Begleitvegetation zum Teilobjekt ge-schlagen. Wenn Begleitvegetation anzwei Teilobjekte grenzt, so sollte sie dem“schlechteren” Teilobjekt zugeschlagenwerden, damit die “besten” Teilobjekteam genauesten lokalisierbar sind.
VerbuschungsgrenzeDer Grad der Verbuschung eines Be-standes wird in drei Stufen erfasst. Ändertsich der Verbuschungsgrad, so muss einneues Teilobjekt abgegrenzt werden.
EinschlussgrenzeFlächige Einschlüsse wie Felsen, Flach-moore oder Fettwiesen werden auf 5%genau geschätzt. Wenn sich der Anteildieser Einschlüsse um mehr als 20%ändert, so ist ein neues Teilobjekt ab-zugrenzen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 79

3 KARTIERMETHODE80
KARTIERERLEICHTERUNGEN IM DIF
Um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, wird inspeziellen Situationen die Vegetationskartierungvereinfacht. Vegetationsmosaike, die keinendeutlichen Gradienten aufweisen, könnenzu einem Teilobjekt zusammengefasst werden.Solche Mosaike kann es in Weiden geben,aber auch in kleinparzelligen Wiesenhängen,wie man sie oft in den inneralpinen Tälernantrifft.
Bild: komplexes Weidemosaik auf einem
Lawinenkegel.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 80

813 KARTIERMETHODE
3.7.3 Kartiererleichterungenim DIF
Es gibt Situationen, in denen ein Aus-kartieren der Vegetation nach demDIF Grenzkriterium “Vegetationsgrenze”unverhältnismässig aufwendig wird. WennTrockengebiete nicht genutzt werdenoder sich kleine Vegetationsunterschiedemosaikartig immer wiederholen, so ist esangebracht, eine Lockerung der Vegeta-tionsgrenzen-Regel auch im DIF-Gebietzuzulassen. Wir beschreiben drei Fälle,bei denen diese Kartiererleichterung zu-lässig ist.
WeidemosaikBei Weiden ergibt sich oft das Problem,dass selbst bei einer Teilobjekt-Minimal-fläche von 20 a die Mosaikflächen einerWeide in zahlreiche einzelne Teilobjektezerfallen. Es besteht daher die Möglich-keit, in solchen Fällen das Mosaik als Ein-heit einem Teilobjekt zuzuweisen, um einarbeitsaufwendiges, sinnloses Auskar-tieren der Mosaikteile zu verhindern.Wichtig ist hierbei, dass es sich um einechtes Mosaik handelt (sich wiederho-lende und abwechselnde Verzahnungverschiedener Vegetationstypen), undnicht um einen Gradienten.
Kleinparzellige WiesenIn den Trockengebieten der Schweiz (v.a.Wallis und Graubünden) gibt es oft gros-se, trockene Hängemit kleinen Parzellen,die leicht unterschiedliche, aber mosaik-artig sich wiederholende Vegetation auf-weisen. Hier können zur Vereinfachunggrössere Teilobjekte gemacht werden. Esist aber wichtig, dass allfällige Gradientenim Hang trotzdem getrennt erfasst wer-den. Auch die Abgrenzung beim Nut-zungswechsel Wiese – Weide muss un-bedingt eingehalten werden.
Walliser FelsensteppenIm Wallis werden die trockensten Hänge,die von subkontinentalen Felsensteppenbesiedelt werden, heute nicht mehrgenutzt. Felsensteppen haben hier gros-se Ausdehnungen und es bilden sich
Mosaike mit verschiedenen Vegetations-typen, Verbuschungsgraden und Ein-schlüssen wie Felsen und Erdanrisse.
Da eine genaue Lokalisierbarkeit ver-schiedener Vegetationstypen und Verbu-schungsgrade für die Umsetzung weni-ger relevant ist als die Felsensteppen-fläche als Ganzes, macht es wenig Sinn,diese Lebensräume auszukartieren. Hiergelten die Kartiererleichterungen wiefolgt:
• keine Vegetationstypen auskartieren,• keine Verbuschungsgrade auskartie-
ren• keineWechsel im Anteil der Einschlüs-
se auskartieren
Analog zur Kartierung nach der MethodeINT werden einzig die schlechtestenVegetationstypen (AE oder LL im Index)auskartiert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 81

3 KARTIERMETHODE82
GRENZKRITERIEN FÜR DIE INT-METHODE
1 Der Flurname “Grossplangg” ist ein Hinweisfür (einstige) Wildheunutzung.
2 Das Teilobjekt wird an der Nutzungsgrenzeabgetrennt.
3 Das Teilobjekt wird nur an der Vegetations-grenze abgetrennt, um die “schlechteren”Vegetationstypen lokalisieren zu können.
4 Das Teilobjekt wird nur an geomorpholo-gischen Grenzen abgetrennt, um übergrosseTeilobjekte zu vermeiden.
5 Graben mit Bachlauf
1
2
3
5
4CFAE
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 82

833 KARTIERMETHODE
3.7.4 Grenzkriterien für dieINT-Methode
Mit der Methodenvariante INT werdenVegetationsmosaike kartiert. Die Anteileder verschiedenen Vegetationstypenwerden in Prozent der Teilobjektfläche an-gegeben. Zum Bestimmen der Vegeta-tion dient derselbe Schlüssel wie bei derDIF-Methode. Um den Vollzug dennochzu erleichtern, wird die Nutzung alsGrenzkriterium beibehalten. Grosse, sichüber ganze Talhänge erstreckende Wei-den werden entlang geomorphologischerGrenzen abgetrennt. Im Gegensatz zuden übrigen Vegetationstypen werdendiejenigen mit den Haupttypen AE undOR auskartiert (abgetrennt). Dasselbe giltfür artenarme Vegetationstypen von CF,SV, FV und NS. Damit wird eine bessereLokalisierung für den Vollzug angestrebtund gleichzeitig eine flexiblere spätereBewertung ermöglicht.
Politische GrenzeEin Teilobjekt darf nicht in zwei verschie-denen Kantonen liegen. Liegt ein kleinerTeil (kleiner als die Minimalfläche für Teil-objekte) des Teilobjektes im Nachbarkan-ton, so muss er weggelassen werden; esist aber unbedingt eine Bemerkung anzu-bringen.
Ein Teilobjekt sollte grundsätzlich nicht inzwei verschiedenen Gemeinden liegen.Liegt trotzdem ein kleiner Teil des Teilob-jektes in der Nachbargemeinde, so wirddieser Teil zum Teilobjekt gerechnet. Auchhier ist eine Bemerkung anzubringen.
NutzungsgrenzeEin Teilobjekt umfasst einen einheitlichenHauptnutzungstyp (Wiese, Weide, Bra-che). Bei unsicherem Nutzungswechselsollte vorsichtigerweise keine Grenze ge-zogen werden. Hat ein kleiner Teil (kleinerals die Minimalfläche für Teilobjekte) desTeilobjektes einen anderen Nutzungstyp,z.B. gemähte Trockenvegetation ausser-halb des Weidezaunes, so wird dieser Teiltrotzdem zum Teilobjekt gerechnet. In die-sem Fall ist eine Bemerkung anzubringen.
VegetationsgrenzeNach der INT-Methode werden Teilobjektegrundsätzlich nicht entlang von Vegeta-tionsgrenzen abgegrenzt. Die “schlech-teste” Vegetation an der Schwelle zurFremdvegetation wird aber dennoch aus-kartiert, damit bei allfälligen späteren ver-schärften Umsetzungsentscheiden dieObjekte entsprechend verkleinert werdenkönnen. Die Vegetation wird abgegrenzt,wenn sie
• den Haupttyp AE aufweist(z.B. AEMB, AEMBOR),
• den Haupttyp OR aufweist(z B. ORMB, ORAE),
• einen Haupttyp der höheren Lagenaufweist (SV, CF, FV, NS), ohne voneinem Index der höheren Lagen(z.B. SVAE, CFOR, NS) begleitet zuwerden. Artenreiche Typen wie FVFV,CFAECF, SVCFOR werden nichtauskartiert.
Geomorphologische GrenzeDa nach der INT-Methode die Vegetationnur noch in bestimmten Fällen als Grenz-kriterium verwendet wird, ist es möglich,dass übergrosse Teilobjekte entstehen.Um auch hier die Umsetzung zu erleich-tern, sollten Teilobjekte, die grösser als 10ha sind, entlang sinnvoller geomorpholo-gischer Grenzen getrennt werden, z.B.:
• markante Expositionswechsel• Bachläufe• Gräben• Grate
Auf die Bewertung hat die Grenzziehungkeinen Einfluss, da das ganze Objektweiterhin dieselbe Bewertungseinheitdarstellt.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 83

3 KARTIERMETHODE84
GRENZZIEHUNG AUF DEM LUFTBILD
1 Die Grenze wird genau entlang derVegetationsgrenze gezogen (“erfolgs-kontrollenorientierte Grenzziehung”).
2 Fremdvegetation am Rand der Teilobjektewird mit dem entsprechenden Code(hier G = zu fett) abgestrichen.
3 Parzellengrenzen spielen bei derGrenzziehung keine Rolle.
4 Vorinterpretierte Teilobjekte, die verworfenwerden, sind abzustreichen und mit demAbstreichcode (hier G = zu fett) zu versehen.
5 Im Schattenwurf von Bäumen ist dieGrenzziehung auf dem Luftbild oft schwierig.Feldanschauung ist notwendig.
6 Einschlüsse, die Teilobjektgrösse erreichen,werden abgestrichen.
7 Offensichtliche Fremdvegetation wieAcker oder Wald muss nichtabgestrichen werden.
Linienführung bei randlichsich fleckenartig auflösenderTrockenvegetation
1 Zwischenräume mit Fremdvegetationsollen kleiner sein, als die dazugewonneneTrockenfläche.
2 Bei der Linienführung wird darauf geachtet,dass die Umrisslinie möglichst kurz bleibt.
3 Für den Einbezug dieses Fleckens muss zuvielFremdvegetation in Kauf genommen werden.
1
2
4
5
6
7
7
3
1
2
3
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 84

853 KARTIERMETHODE
3.7.5 Einträge in das Luftbild
Je nach Vorgehensvariante und Arbeits-schritt wird entweder mit Originalluftbil-dern (Diapositiven) oder entsprechendenPapierabzügen, den sog. Luftbildab-zügen gearbeitet. Während Originalluft-bilder nur im Büro bearbeitet werden,sind Luftbildabzüge für die Feldarbeitbestimmt.
Werden Originalluftbilder stereosko-
pisch vorabgegrenzt (Kap. 4), so ge-
schieht dies auf einer über das Original-
luftbild gelegten Folie (“Originalfolie”) mit
Hilfe eines Tuschestiftes. Von dieser Folie
wird eine Kopie erstellt, welche als Feld-
folie über die Luftbildabzüge geklebt wird.
Alle Feldeinträge der Kartierpersonenwie
Grenzkorrekturen, Abstreichcodes, Lage
der Testflächen sowie Teilobjektnummer
werden mit wasserfestem Filzstift direkt
auf die Feldfolie eingetragen und von den
Luftbildinterpretinnen anschliessend un-
ter dem Stereoskop auf die Originalfolien
übertragen.
Feldeinträge, wie Teilobjekt- und Ob-
jektgrenzen, Abstreichcodes, usw. wer-
den direkt auf dem Luftbildabzug einge-
tragen. In die Teilobjektflächewird dessen
Nummer eingetragen oder die Nummer
wird – wenn in der Fläche nicht genügend
Platz zur Verfügung steht – neben das
Teilobjekt geschrieben.
LinienführungDie Linienführung ist im Hinblick auf einespätere Erfolgskontrolle den tatsäch-lichen Verhältnissen anzupassen, d.h. eswerden die effektiven Vegetationsgrenzendargestellt. Die Toleranz in der Linienfüh-rung ist dabei vom Luftbildmassstab undvon der Strichdicke abhängig. Im bestenFall rechnen wir mit einer Toleranz von± 2 m für die DIF- und ± 4 m für die INT-Gebiete.
Wenn sich amRande des Teilobjektes dieTrockenvegetation fleckenartig auflöst, sosoll die Grenzlinie so gezogen werden,dass die Trockenvegetation überall domi-
0/1/3
2
niert; wenn Flecken angehängt werden,so müssen diese grossflächiger sein, alsdie dazwischenliegende Fremdvegeta-tion. Bei der Grenzziehung ist dabei einemöglichst einfache, sinnvolle Geometrieeinzuhalten (d.h. die Umrisslinie muss sokurz wie möglich bleiben).
Abstreichen derFremdvegetationAuf dem Luftbild wird das gesamte Ge-biet, das abgesucht wurde und die Mini-malanforderungen für die Aufnahme nichterfüllte, durch eine weite Schraffierung“abgestrichen”. Wo möglich wird miteinem Buchstabencode der Grund fürdas Verwerfen der Fläche angegeben.
Falls Flächen wegen Unbegehbarkeit ab-gestrichen wurden, der Vegetationstypaus Distanz aber näherungsweise an-gegeben werden könnte, so bestehtdie Möglichkeit, neben dem Abstreich-code R auch einen Vegetationscodeanzugeben. Es sollten nur die Codes derHaupttypen (CF, SV, usw.) dafür ver-wendet werden.
EinschlüsseFremdvegetation, die als Insel innerhalbeines Teilobjektes selbst die Minimal-fläche eines Teilobjektes einnimmt, wirdmit einer Schraffur gekennzeichnet undebenfalls mit einem Abstreichcode ver-sehen.
Knapp isolierte TeilobjekteTeilobjekte werden zum gleichen Objektgezählt, wenn sie sich berühren. DieMinimalfläche der Objekte gilt für dieFlächensumme der sich berührendenTeilobjekte. Isolierte Teilobjekte werdenbei der Grenzziehung nach Möglichkeitzusammengeführt (Kap. 3.6.1).
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 85

KRITERIEN ZUR ABGRENZUNGDER TWW-OBJEKTE GEGENÜBERDEM REST DER LANDSCHAFT
TWW-Flächen haben ganz bestimmteEigenschaften, die sie vom Rest der Landschaftunterscheiden. Der grösste Teil dieser Kriterienstützt sich auf Merkmale in der Vegetations-schicht. Aus der Sicht der Vegetation entsprichtdie Grenze zwischen TWW-Objekten unddem Rest der Landschaft dem Übergang vonSchlüsselvegetation zu Fremdvegetation.Diese Grenze ist hier durch einen Kreisdargestellt. Man beachte, dass die Schlüssel-vegetation absichtlich zum grössten Teilindirekt bzw. negativ definiert ist!
3 KARTIERMETHODE86
Fläche ist bewirtschaftet(nur INT)
Anteil Fremdvegetationmax. 50%
Kriterien Flachmoorschlüsselnicht erfüllt
Baumschichtmax. 50%
Fels,Schutt und Fremdvegetationzusammen max. 75%
Zwergsträuchermax. 25%
Hochstauden, mesophile Säume,Ruderalarten
zusammen max. 50%
SchlüsselvegetationSteiles Gelände (Begehbarkeit)
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 86

873 KARTIERMETHODE
3.7.6 Allgemeines zumSchwellenschlüssel
Lebensrauminventare sind eine Zusam-menstellung von Ausschnitten einer Land-schaft, die bestimmten Kriterien genügen.Damit Landschaftsausschnitte in die Üb-ersicht der schweizerischen Trockenwie-sen- und weiden aufgenommen werden,müssen sie eine ganze Reihe von Kriterienerfüllen. Die Kriterien mit ihren Schwellen-werten sind für die Kartierung in einerCheckliste, dem sog. “Schwellenschlüs-sel”, zusammengestellt.
Vegetationskundliche KriterienDie Methode der Trockenwiesenkartie-rung stützt sich im Schwellenschlüsselvor allem auf Kriterien, die ihre Merkmaleder Vegetationsdecke entnehmen. DieKenntnis von Pflanzenarten auch imvegetativen Zustand ist dabei unabding-bar. Erfahrungen im vegetationskund-lichen Schätzen von Deckungswertenist ebenso wichtig, wie eine gewisse Er-fahrung mit der soziologischen Aussage-kraft gewisser Arten. Beim Versuch, denSchlüssel anzuwenden, wird das schnellersichtlich.
Soziologische ArtengruppenDie für den Schwellenschlüssel entschei-denden Arten werden zu Gruppen zu-sammengefasst, die als Kennartengrup-pe für pflanzensoziologische Verbändedienen. Allerdings ist die Zugehörigkeit ei-ner Art zu einer Kennartengruppe auspragmatischen Gründen oft enger oderweiter gefasst, als in mancher pflanzen-soziologischen Literatur. Die wichtigstenQuellen bei der Zusammenstellung derArtengruppen sind Ellenberg (1996),Theurillat (1996), Mucina et al. (1993),Oberdorfer (1977ff.) und Braun-Blanquet(1971, 1969).
Die Artengruppen, charakteristisch für ei-ne soziologische Einheit (meist Verband),werden mit einem zweistelligen Buch-stabencode benannt.Bsp.: MO für Molinion; AE für Arrhena-therion elatioris, XB für Xerobromion.
SchlüsselvegetationFür jedes Kriterium des Schlüssels mussder definierte Schwellenwert erreicht wer-den. Wenn diese Kriterien in einer Flächeerfüllt sind, so bezeichnen wir die Vege-tation innerhalb dieser Fläche, ohne siegenauer zu definieren, als Schlüsselve-getation. Die Schlüsselvegetation wirdspäter mit Haupt- und Indexschlüsselnäher definiert werden.
FremdvegetationIst für einen Flächenausschnitt eines derKriterien im Schwellenschlüssel nicht er-füllt, so bezeichnen wir die Vegetationdieser Fläche als Fremdvegetation. Mitdem Schwellenschlüssel wird so dieAbgrenzung der Trockenvegetation ge-genüber Fremdvegetation ermittelt. Typi-sche Fremdvegetationen sind Fettwie-sen, Wald, Moore, Felsvegetation, Hoch-staudenfluren, usw.
Allgemeiner SchwellenwertGrundsätzlich wird Schlüsselvegetation,welche die Minimalflächengrösse er-reicht, in die TWW-Übersicht aufgenom-men und Fremdvegetation wird verwor-fen. Oft ist aber die Grenzziehung nicht soeinfach, da sich Fremd- und Schlüsselve-getation durchdringen können. SolcheÜbergänge erschweren die Kartierung,sind aber recht häufig. Bei solchenMischformen gilt die allgemeine Regel:
• In Teilobjekten darf der Deckungsanteilder Fremdvegetation 50% nicht über-steigen.
Da sich innerhalb der Teilobjekte noch ve-getationslose Einschlüsse wie Felsen,Wege oder Gebäude befinden können,muss präzisiert werden, dass sich diese50%-Regel stets auf die vegetationsbe-deckte Fläche bezieht:
• In Teilobjekten darf der Deckungsanteilvon Fremdvegetation an der vegeta-tionsbedeckten Fläche 50% nichtübersteigen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 87

Obergrenze der KartierungDas angefangene Objekt wird nach oben sinnvollabgeschlossen. Schwarze Linie: Obergrenze.
ALLGEMEINE ABGRENZUNGEN
3 KARTIERMETHODE88
Es dürfen höchstens 9 Flachmoorarten vor-kommen und Flachmoorarten dürfen nicht mehrals 50% decken.
Die Fläche muss begehbar sein.
Die Schlüsselvegetation deckt mindestens 25%der ganzen Teilobjektfläche.
Die Baumschicht darf höchstens 50% decken.
Mesophile Hochstauden, Saum- und Ruderal-arten dürfen zusammen höchstens 50% decken.
Oberhalb der Sömmerungslinie (in der Alpstufe)muss die Fläche bewirtschaftet sein.
Die Schlüsselvegetation deckt mindestens 50%der vegetationsbedeckten Fläche.
Zwergsträucher und Besenginster dürfen höch-stens 25% decken (im Unterwuchs von Wiesendarf die Deckung auch höher sein).
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 88

893 KARTIERMETHODE
3.7.7 Erklärungen zu denSchwellenkriterien
BegehbarkeitFelsen und steile Grashänge, derenBegehung gefährlich ist, werden nichtaufgenommen, aber gegebenenfalls mitentsprechendem Code auf dem Luft-bildabzug markiert. Für einzelne Vegeta-tionstypen ist eine Aufnahme aus Dis-tanz möglich. Für kritische Gesellschaf-ten (fette Weiden, artenarme Nardeten)sollte nie eine Vegetationsbeurteilungaus Distanz erfolgen. Die Vegetations-beurteilung aus Distanz ist nur mit genü-gender Erfahrung und nur für eindeutigerkennbare Vegetationstypen möglich.Beispiele: FVFP - Goldschwingelrasen imTessin, CFCF - Artenreiche Rostseggen-halden.
Absolute ObergrenzeDie Kartierung der TWW erfolgt grund-sätzlich nur bis zur Waldgrenze. Ober-halb der Waldgrenze werden nur ge-mähte Flächen erfasst (Wildheuflächen).Unterhalb der Obergrenze angefangeneObjekte werden nach oben bis zumnächsten Wechsel in der Geländeformoder bis zum Abschluss des Vegeta-tionstyps fortgesetzt.
Minimale DeckungDie Deckungsprozente gelten hier relativzur ganzen Teilobjektfläche! Diese For-derung, dass die Schlüsselvegetationmindestens 25% der Fläche bedeckenmuss, heisst umgekehrt, dass der Anteilan Fremdvegetation und die vegeta-tionsfreie Fläche zusammen 75% nichtüberschreiten dürfen. Damit erfolgt eineeindeutige Abgrenzung gegenüber Felsund Schutt.
FremdvegetationDie Deckungsprozente gelten hier relativzur Vegetationsfläche. Diese Forderungheisst umgekehrt: der Anteil an Fremd-vegetation (d.h. Moore, Ruderalvege-tation, artenarme Fettwiesen, usw.) darf50% der Vegetationsfläche nicht über-schreiten.
BewirtschaftungDie Einschränkung, dass Brachen
nicht kartiert werden, gilt nur oberhalb der
Sömmerungslinie, wo mit der Methode
INT gearbeitet wird. Oft ist es nicht ein-
fach, diese Frage zu beantworten und es
gilt der Grundsatz, dass im Zweifelsfalle
die Fläche aufzunehmen ist. Die Proble-
matik der Nutzungsansprache ist in einem
speziellen Kapitel erläutert (Kap. 5.4.1).
BaumschichtGehölze ab einer Wuchshöhe von 5 mgelten als Bäume. Damit sollte diesesSchwellenkriterium auf dem Luftbild ab-geschätzt werden können. Alle Gehölzeunter 5 m gelten als Sträucher.
ZwergsträucherEs wird nur die Deckung von Zwerg-sträuchern geschätzt, die zur Artengrup-pe ZS gehören. Bei Wiesen geltendie Arten aus ZS nur, wenn diese inder obersten Feldschicht anzutreffensind. Wenn beispielsweise Calluna oderVaccinium im Unterwuchs der Wiesen-gräser und -kräuter gedeihen, so ist diesnoch keine echte Platzkonkurrenz derWiesenvegetation. In diesem Fall sinddie Zwergsträucher nicht anzurechnen.
MooreUm Überschneidungen mit dem Flach-moorinventar zu vermeiden, gilt dieFlachmoordefinition aus der Kartierungder Flachmoore als Schwellenkriteriumgegenüber den zu kartierenden wech-selfeuchten Wiesen und Weiden. DieSchwelle für Trockenvegetation beinhal-tet zwei Kriterien, die beide gleichzeitigerfüllt sein müssen:
• Es dürfen nicht mehr als 9 Arten derFlachmoorliste vorkommen.
• Die Arten der Flachmoorliste dürfennicht mehr als 50% decken.
Das Kriterium “Deckung der Flachmoor-arten ist grösser als die Deckung derübrigen Arten” wird nur für die Kraut-schicht (ohne Moosschicht) angewen-det. Neben den Arten der Flachmoorliste
INT
gelten auch die übrigen Arten der Arten-gruppe MO als “Flachmoorarten”.MO = Molinion (Verband der Pfeifen-graswiesen)
Hochstauden,Saum- und UnkrautflurenMesophile Säume, Hochstaudenflurenund Ruderalfluren werden nicht kartiert.Als flächig auftretende Vegetation dürfendie Arten der Gruppen AD, AV und OR2zusammen 50% Deckung nicht über-steigen.
AD = Betulo-Adenostyletalia (Ordnungder subalpinen Hochstaudenfluren)AV = Artemisietalia vulgaris (Ordnung derRuderalgesellschaften, Unkrautfluren)OR2 =Origanietalia (Ordnung der Saum-gesellschaften), mesophiler, nährstoff-reicher Teil, z.B. Trifolion medii, inkl.Glechometalia und Convolvuletalia.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 89

SchlüsselvegetationSpezialfälle
oft mit:Luzula sylvaticaAnemone nemorosaFragaria vescaGlechoma hederaceaAjuga reptans
zum Beispiel:Onobrychis viciifoliaSanguisorba minorBromus erectusPlantago mediaPrimula verisSalvia pratensis
mit:Rhinantus alectorolophus
zum Beispiel:Potentilla aureaCampanula barbataTrifolium alpinumArnica montanaGeum montanumHieracium lactucella
Fettwiesenarten (AE),Borstgras (NS1) undFlaumhafer (MB2)decken zusammenweniger als 50%
Es hat mindestens 6Arten aus den
Halbtrockenrasen (MB)
schattige,moosreiche Bestände
Klappertopfdeckt mehr als 20%
Es hat mindestens 6 Artenaus dem Borstgrasrasen (NS2)
Es hat mindestens 6 Artenaus der Rostseggenhalde (CF)
zum Beispiel:Pulsatilla alpinaAnemone narcissifloraCarex ferrugineaCentaurea montanaGlobularia nudicaulisTraunsteinera globosa
3 KARTIERMETHODE90
DEFINITION DERSCHLÜSSELVEGETATION
Der innere Kreis ist das negative Hauptkriterium:alle Pflanzenbestände, die weniger als 50%Anteil an Arten der Fettwiesen, nährstoffreichenSäume und der artenarmen Borstgrasrasenbesitzen, können als Schlüsselvegetationbezeichnet werden. Dieses Negativkriteriumgilt nicht, wenn es sich um Klappertopf-reicheoder um schattige, moosreiche Beständehandelt. Neben dem Negativkriterium gibtes noch die drei positiven Kriterien, die alsäussere Kreise dargestellt sind.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 90

913 KARTIERMETHODE
3.7.8 Hauptkriterien desSchwellenschlüssels
Der weitaus häufigste und schwierigsteFall während der Kartierung ist die Ab-grenzung der Schlüsselvegetation gegenFettwiesen, Fettweiden und artenarmeBorstgrasrasen. Um eine vernünftigeGrenzziehung zu definieren, die für dieganze Schweiz Gültigkeit hat, muss einekompliziert aufgebaute Definition zu-sammengestellt werden, die auch einigeder wichtigsten Spezialfälle berücksich-tigt. Wird die Schwelle zu hoch angesetzt,werden wertvolle Flächen nicht erfasst,die durch ihre Nähe zur Fettvegetationbesonders gefährdet sind. Wird dieSchwelle zu tief angesetzt, so wird eineErhebung ausgelöst, deren Aufwand inden hohen, abgelegenen Tälern der Al-pen nicht zu verantworten ist. Das Haupt-kriterium ist daher der delikateste Teil derSchwelle und muss während der Kartie-rung (durch die Eichperson) korrigiertwerden können.
Das Hauptkriterium hat ein positives undein negatives Teilkriterium. Es ist erfüllt,wenn eines der beiden Teilkriterien erfülltist (“oder”-Verknüpfung!).
Negative AbgrenzungFettwiesen und Borstgrasrasen werdennegativ abgegrenzt, d.h. grundsätzlichkönnen alle Vegetationstypen, die nichtdas Negativkriterium erfüllen, als Schlüs-selvegetation angesehen werden. Diese“grosse Pforte” macht es nötig, dass zahl-reiche Zusatzkriterien definiert werden,um nicht wünschenswerte Vegetation als“Fremdvegetation” ausschliessen zu kön-nen. Es hat aber den Vorteil, dass vielegänzlich verschiedene Vegetationstypendie Schwelle passieren können, wie diesvon der Methode erwartet wird. Als “ne-gative” Arten gelten alle Arten der AE-Gruppen und die Gruppe NS1.AE = Arrhenatherion elatioris (Fettwiesenund -weiden)NS1 = Nardion strictae (Borstgrasrasen)– nur Hauptgräser, die oft artenarmenVarianten dominieren.
Positive AbgrenzungDas positive Kriterium ist bei der Abgren-zung gegenüber Fettwiesen und Borst-grasrasen am einfachsten anzuwenden.Es müssen Zeigerarten gezählt werden:wenn auf 25m2 sechs Arten aus MB oderNS2 oder CF gefundenwerden, dann be-steht diese Testfläche aus Schlüsselve-getation. Gerade für viele Rostseggen-halden ist diese Form der Schwelle nötig,da sie oft grosse Anteile an Arten aus derGruppe AE besitzen. Auch wenn die AE-Arten deckungsmässig 50% übersteigen,kann die Fläche aufgenommen werden,wenn mindestens 6 Zeigerarten aus denerwähnten Gruppen gezählt werden.
MB = Mesobromion (Verband der Halb-trockenrasen). Es gelten beide Unter-gruppen MB1 und MB2.NS2 = Nardion strictae (Verband derBorstgrasrasen) = nur Zeigerpflanzen fürartenreiche Borstgrasrasen.CF = Caricion ferrugineae (Verband derRostseggenhalden).
Spezialfälle 1Bei den folgenden Spezialfällen darf dasNegativkriterium (“die grosse Pforte”)nicht angewendet werden.
FlaumhaferwiesenWenn die Vegetation neben AE-Artenstark von MB2-Arten dominiert wird(insbesondere durch Helictotrichon pu-bescens), somüssenmindestens 6MB1-Arten gefunden werden.
Moosreiche VegetationIn Schattenlagen decken die Kräuter oftnur noch spärlich und die Lücken werdendurch eine dichte Moosschicht gefüllt.Hier müssen mindestens 6 Arten aus MBoder CF vorhanden sein.
KlappertopfwiesenDer Halbparasit Rhinanthus alectorolo-phus kann oft ganze Bergwiesen befallenundmassenhaft auftreten. In solchen Fäl-len müssen mindestens 6 Zeigerartenvorhanden sein.
Spezialfälle 2Bei den folgenden Spezialfällenmuss dasNegativkriterium (“die grosse Pforte” ) an-gewendet werden. Die Positivkriteriengelten nicht, auch wenn die 6 Arten ausMB, NS2 oder CF vorhanden sind.
Weiden der höheren Lagen. In INT-
Regionen darf der Anteil der Fettwiesen-
arten (inkl. Nardus stricta) in Weiden 50%
nicht übersteigen.
Im Jura werden Fettweiden mit AEMB-Vegetation nicht mehr aufgenommen,sobald mindestens zwei Arten aus derArtengruppe AE3 vorkommen
INT
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 91

FEHLERQUELLEN
Die beiden Luftbildausschnitte zeigen zwei un-abhängige Ergebnisse von zwei verschiedenenKartierpersonen am gleichen Objekt. Die Unter-schiede in der Grenzziehung sind auf dieunterschiedlichen Zeitpunkte der Begehung,die verschiedene Lokalerfahrung und unter-schiedliche Einschätzung von Deckungsanteilenzurückzuführen.
Luftbildausschnitt 2Genauigkeitstest Trin
Luftbildausschnitt 1Genauigkeitstest Trin
3 KARTIERMETHODE92
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 92

933 KARTIERMETHODE
3.8 QUALITÄTSSICHERUNG
3.8.1 Fehlerquellen
Die hier beschriebene Methode liefertmehrere Teilresultate: Objekt- und Teilob-jektperimeter als Grenzlinien im Luftbild;faunistische, floristische und vegetations-kundliche Angaben zu jedem Teilobjekt,usw. Zu jedem dieser Teilresultate gibt esVorschriften, wie sie zu erheben sind. Die-se Vorschriften sollten so gestaltet wer-den, dass ein optimales Verhältnis zwi-schen Aufwand, Ertrag und Fehleranfäl-ligkeit gefunden wird. Aufwand undZuverlässigkeit sind oft gegenläufig undder Entscheid, eine Vorschrift trotz be-kannter oder vermuteter Anfälligkeit ein-zuführen, weil sie hohen Ertrag bei ge-ringem Aufwand liefert, kann als “me-thodenbedingte Fehlerquelle” bezeichnetwerden. Die möglichen Fehler, die sichbei der Aufnahme einschleichen, könnenin “objektive” und “subjektive” Fehler un-terschieden werden.
Methodenbedingte FehlerquellenDie Methode ist als Ganzes relativ umfas-send und damit auch aufwendig. An dieKartierleute werden hohe Anforderungengestellt und es muss mit personenbe-dingten Schwankungen gerechnet wer-den. Mit wenigen Ausnahmen sind dieResultate der Kartierung geschätzte undnicht gemessene Werte und damit kön-nen diese Werte starken Schwankungenunterliegen. Es gilt allerdings zu relativie-ren, dass bei Umsetzung und Bewertungder “logistische Wert” für viele Merkmalebereits genügt, d.h. die Information überdas Vorhandensein oder Fehlen vonMerkmalen wie Arten oder Strukturele-menten (als Einschluss oder Grenzele-ment) ist bereits weitgehend brauchbar.Die Häufigkeit von Arten und Struktur-elementen wird halbquantitativ grob ge-schätzt und ist entsprechend wenigerzuverlässig. Hinter scheinbar eindeutigenResultaten wie der Nutzungsform oderder Lagebeschreibung können sich eben-falls Fehler einschleichen.
Entsprechend der grossen Gewichtungder Vegetetation in der Charakterisierungund Bewertung der Objekte werden imFolgenden die Fehlerquellen bei der Ve-getationsansprache noch ausführlicherbesprochen.
Objektive FehlerquellenÜber natürliche Schwankungen des Ob-jektes, insbesondere in der Vegetations-decke, ist inzwischen in der Vegetations-kunde recht viel bekannt. Es habengrundsätzlich drei Prozesse einen Ein-fluss auf Veränderungen in der Vege-tation.
• Phänologische Veränderungen. ImLauf des Jahres wachsen, blühen undfruchten die Arten einer Vegetations-decke zu unterschiedlichen Zeiten.Neben den dominierenden Spätfrüh-lings- bis Frühsommerblühern gibt esals Extreme die Frühblüher (ab Febru-ar) und die Spätsommer-Herbstblüher(August bis Oktober). Während derKartiersaison (Mai bis Juli) sind einigeSchlüsselarten, die früh im Jahr blü-hen, schon bald einmal verblüht undes besteht die Gefahr, dass sie über-sehen werden.
• Fluktuationen. Aus der Untersuchungvon Dauerflächen ist bekannt, dasssich die Häufigkeit von einzelnen Ar-ten, und sogar ihr Vorkommen über-haupt, sich von Jahr zu Jahr verän-dern kann. Diese Ergebnisse gelten fürFlächenausschnitte in der Vegetation.Eine Schlüsselart kann zwar dauerndin der dominierenden Vegetation einesTeilobjektes vertreten sein und trotz-dem in einigen Jahren in der Testflächefehlen, während sie in anderen Jahrenstark vertreten ist. Fluktuationen sindstark vom lokalen Witterungsverlaufeines Jahres und von populationsbio-logischen Parametern der verschiede-nen Arten abhängig.
• Sukzessionen. Wenn sich Bodenver-hältnisse oder das allgemeine und lo-kale Klima verändern, dann verändertsich – mit unterschiedlich starkerzeitlicher Verzögerung – auch die Zu-
sammensetzung der Vegetation. Beigrossen Unterschieden kann dies zurVeränderung der Pflanzengesellschaftführen. Man spricht dann in der Vege-tationskunde von einer Sukzession. Istein während der Kartierung aufge-nommener Bestand nicht im Gleich-gewicht mit den herrschenden Stand-ortsfaktoren, so ist eine Veränderungder Vegetationsdecke zu erwarten,selbst wenn der Status Quo unterSchutz gestellt würde.
Subjektive FehlerquellenSelbst wenn alle Teilobjekte von ein undderselben Kartierperson aufgenommenwürden, wären subjektive Fehler nicht zuvermeiden, da die Kartierung stets eineInterpretation des Objektes darstellt. Wienaheman an die “Wahrheit des Objektes”herankommt, hängt von Ausbildung, Er-fahrung, Beobachtungsgabe, Konzentra-tionsfähigkeit, Schätzfähigkeit, ja sogarvon der Tagesform oder der momentanenVerfassung einer Kartierperson ab. DieTatsache, dass viele verschiedene Kar-tierleute mit unterschiedlicher beruflicherHerkunft an den Felderhebungen beteiligtsind, verstärkt nochmals die subjektivenFehlerquellen.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 93

3 KARTIERMETHODE94
Geographische Übersicht erhalten(Ausschnitt aus der Landeskarte der Schweiz, 1 : 100’000).
EINIGE LERNZIELE DER REGIONALAUSBILDUNG
Typische Arten und Vegetationstypen kennenlernen(Asperula purpurea bei Meride, TI).
Geologische Verhältnisse kennenlernen(Ausschnitt aus der Geologischen Karte der Schweiz, 1980, 1 : 500‘000).
Regionalspezifische Nutzungen kennenlernen(Mähnutzung im Tessin).
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 94

953 KARTIERMETHODE
3.8.2 Ausbildung
Übersicht über dieQualitätssicherungZur Verminderung personenbedingterUnterschiede, Erhöhung der Zuverlässig-keit und Sicherung der Qualität werdenim TWW-Projekt verschiedene Strategienverfolgt.
• Ausbildung: zur Einschulung und fort-laufenden Repetition der aufwendigenMethode
• Eichung: zum gegenseitigen Anglei-chen in der Anwendung der Methodezwischen den Kartiergruppen und-personen
• Eichung der Luftbildinterpretinnen• Gegenseitige Feldkontrolle• Eingabekontrolle durch die Kartierper-
son, zum Auffinden von Fehlern be-reits bei der Ersteingabe der Daten inden Computer
• Kontrolle bei der Abgabe der Proto-kollblätter und Luftbilder an die Mate-rialflussstelle
• Kontrolle der Teilobjektblätter nachdem Druck
• Kontrolle der Originalfolien vor derWeitergabe an die Photogrammetrie
• Kontrolle der Resultate aus der Photo-grammetrie
AusbildungsformenDie Methode mit all ihren Anforderungenund Vorschriften muss so vermittelt wer-den, dass die Kartierpersonen ihren spe-ziellen Aufgaben in einem bestimmtenKanton, in einer bestimmten Region ge-wachsen sind. Die Ausbildung findet inerster Linie an eigens dafür organisiertenAusbildungstagen statt. Aber nicht alleskann direkt vermittelt werden: Das fort-laufende Lernen während der Kartierar-beit und das Sammeln von Erfahrungenspielt eine ebenso wichtige Rolle.
Zum Vermitteln verschiedener Aspekteder Kartierarbeit gibt es die folgendenAusbildungsveranstaltungen:
• Vorschulung: Erster Kontakt mitder Kartiermethode während eineröffentlichen Veranstaltung. Ausschrei-bung als öffentlicher Kurs. Dauer: 1 –2 Tage.
• Grundausbildung: Erste Einfüh-rung in die Kartiermethode für neuangestellte Kartierpersonen. Dauer: imAllgemeinen 2 Tage.
• Saisonausbildung: TheoretischesAuffrischen derGrundaspekte der Kar-tiermethode und Mitteilen der metho-dischen und technischen Neuerun-gen. Dauer: 1 Tag zu Beginn jeder Kar-tiersaison.
• Regionalausbildung: PraktischesAuffrischen der Grundaspekte derMethode mit Übungen im Gelände.Einführung in die geografischen, ag-ronomischen und vegetationskund-lichen Besonderheiten einer Kartier-region. Dauer: 0.5 – 1 Tag.
• Artenkurs: Schulung der Arten-kenntnisse.
• Interpretationsausbildung:Spezialausbildung für Luftbildinterpre-tinnen und -interpreten.
• Gruppenleitungsausbildung:Spezialausbildung für Gruppenleiterin-nen und -leiter.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 95

3 KARTIERMETHODE96
Parallel durchgeführte Kartierungen vergleichen und diskutieren.
TYPISCHE ELEMENTE VON EICHUNGSTAGEN
Artenkenntnisse austauschen.
Deckungsschätzungen üben und angleichen.
Wenn nötig, Methodenanpassungen diskutieren und definieren.Änderungen auf Eichungsprotokollen festhalten.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 96

973 KARTIERMETHODE
3.8.3 Eichung
Zur Gewährleistung einer einheitlich an-gewandten Methode genügt es nicht, dieKartierpersonen zu Beginn der Kartierungin einer Region auszubilden. Zu häufigtreten schwierige Fälle und neue Situa-tionen auf; zu gross ist die Gefahr, dassKartiergruppen eigene Varianten der Me-thode entwickeln, jeweils angepasst andie Gegebenheiten einer Region. Aucherfahrene Kartierpersonen müssen dahernoch an den Eichungen teilnehmen.
ZielUmden Einfluss subjektiver Interpretationder Methode (insbesondere in schwieri-gen Situationen) zu minimieren, werdenregelmässig Treffen mit der Kartierleitungim Gelände vereinbart. Diese Veranstal-tungen sollen die einheitliche Anwendungder Kartiermethode fördern und eine Be-stätigung der korrekten Verwendung derMethode geben. Die Eichung sollte mög-lichst immer von der gleichen Persondurchgeführt werden, um den Erfah-rungstransfer zwischen den Kartiergrup-pen zu erleichtern.
DurchführungAn den Eichungstagen treffen sich alleMitglieder einer Kartiergruppe im Ge-lände, an einem Teilobjekt in ihrer Kartier-region und tauschen Fragen, Beobach-tungen, Bemerkungen und Erfahrungenmit der Kartierleitung aus. Die Eichungs-tage werden möglichst früh mit denKartierpersonen abgesprochen. Folgen-der Rhythmus hat sich bewährt:
• Erste Eichung nach ca. 1 Woche• Zweite Eichung nach ca. 3 Wochen• Dritte Eichung nach ca. 6 Wochen
Dabei muss der Kartierbeginn in neuenRegionen und der Methodenwechsel vonDIF nach INT (“Alpaufzug”) mitberücksich-tigt werden. Oft werden Eichungen undRegionalausbildungen auch kombiniert.
Folgende Punkte werden an Eichungsta-gen besonders behandelt:
• Teilobjekte gemeinsam kartieren• Probleme der Grenzziehung bespre-
chen• Vegetationsansprache vergleichen• Schwierigkeiten beim Bestimmen
kritischer Arten austauschen• Absuchstrategien vermitteln• Diverses, Administratives
EichungsblätterDie Kartierleitung sammelt die Erfahrun-gen der Eichungstage und notiert diewichtigsten Präzisierungen und Ergän-zungen zur Methode auf sog. Eichungs-blättern. Diese werden an das gesamteKartierteam verteilt. Im folgenden Kartier-jahr wird der Inhalt der Eichungsblätter insKartierhandbuch integriert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 97

3.8.4 Kontrolle
Während bei den Eichungen ganze Kar-tiergruppen die Gelegenheit erhalten, ei-gene Sicherheiten und Unsicherheiten inder Anwendung der Methode zu klären,so ist dies bei der Kontrolle die einzelneKartierperson. Indem ein bereits kartier-tes Teilobjekt von einer anderen Personnochmals begangen und kartiert wird,ergeben sich aus dem Vergleich der Re-sultate aufschlussreiche Diskussions-punkte.
Auch bei doppelter Durchsicht derKartierresultate können Interpretations-schwierigkeiten, aber auch unvermeidlichauftretende Flüchtigkeitsfehler entdecktwerden. Die Erfahrungen während derbisherigen Kartierung haben gezeigt,dass die billigste und effizienteste Formder Qualitätssicherung dann gegeben ist,wenn die Kontrolle frühzeitig einsetzt undauf allen Organisationsstufen weiterge-tragen wird.
ZielDie Kontrolle in all ihren Formen hat dasZiel, Sicherheiten und Unsicherheiten ein-zelner Personen bei den einzelnen Pha-sen der Kartierung eines Teilobjektessichtbar zumachen. Sowohl Sicherheiten(“Sattelfestigkeit”), wie Unsicherheitensollen gemeinsam besprochen werdenund sind gegebenenfalls auch mit derKartierleitung zu diskutieren. Flüchtig-keitsfehler sollen so gut und so früh wiemöglich eliminiert werden.
DurchführungDie Kontrollen finden während verschie-denen Phasen der Kartierung statt.
• Feldkontrolle innerhalbKartiergruppeJede Kartierperson hat die Möglich-keit, einige Teilobjekte von einem an-deren Gruppenmitglied nachkartierenzu lassen, um die Resultate diskutie-ren zu können. Die Auswahl des Teil-objektes trifft die Person, von der dieErstkartierung stammt.
ERGEBNISSE VON FELDKONTROLLEN
Alle Abweichungen zwischen Kartierperson-Protokollblatt und Befund der Kontrollpersonwerden auf dem speziellen Kontroll-Proto-kollblatt notiert und bewertet. Die Bewertungerfolgt in einer vierteiligen Skala:
o Keine Abweichung.
A Abweichung innerhalb despersönlichen Interpretationsspielraumes.Trotz zahlreicher Regeln ist bei jeder Kartier-methode ein gewisser Interpretationsspielraumgegeben. Abweichungen in dieser Bewer-
tungsklasse zeigen den Spielraum zwischenverschiedenen Kartierpersonen auf und sindauch für eine Auswertung bezüglich derErfolgskontrolle wichtig.
B Persönlicher Interpretationsspielraumüberschritten, Abweichung jedoch ohnewesentlichen Einfluss auf Bewertung.Die Bewertungparameter sind nicht odernur in einem unwesentlichen Grad betroffen.
C Wesentliche Fehleinschätzung mitEinfluss auf Bewertung oder fehlende/falscheAngaben, die eine Neubegehung nötigmachen.
3 KARTIERMETHODE98
Ergebnisse aus den Feldkontrollen 1996
Perimeter 1996 Artenliste / Vegetation 1996
Perimeter 2000 Artenliste / Vegetation 2000
Ergebnisse aus den Feldkontrollen 2000
B14%
C4%
o60%A
22%
B25%
C15%
o15%
A45%
B11%
C0%
o65%A
24%
A19%
C0%
o64%
B17%
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 98

993 KARTIERMETHODE
• Feldkontrolleausserhalb KartiergruppeVon jeder Kartierperson werden durchaussenstehende Kartierpersonen ein-zelne Teilobjekte nachkartiert. DieWahl des Teilobjektes kann zufälligsein. Es kann aber auch auf Wünscheder Kartierperson Rücksicht genom-menwerden.Welche Teilobjekte nach-kartiert werden, bestimmt die Kontroll-person. Ein spezielles Kontrollprotokollbegleitet dabei das Teilobjekt von derersten externen Kontrolle durch dieKartiergruppenleitung bis zur Über-prüfung im Gelände, was die syste-matische Auswertung und Beurteilungerleichtert.
• EingabekontrolleDie Ergebnisse der Kartierung werdennach jedemKartiertag in einen tragba-ren Computer eingegeben. Die Ein-gabemasken sind so gestaltet, dassfehlende oder falsche Eingaben durchWarnmeldungen kenntlich gemachtwerden.
• Materialfluss - KontrolleDie Protokolle werden jede Woche andie “Koordinationsstelle Materialfluss”gesendet. Damit kann einerseits dasVerlustrisiko vermindert werden. An-derseits kann eine erste Kontrolle derÜbereinstimmung zwischen EDV-Da-ten aus der Eingabe durch die Kar-tierpersonen und den Protokollblätternvorgenommen werden.
3.8.5 Genauigkeits-untersuchungen
Für die Qualitätssicherung während derKartierung, aber auch als Vorbereitung fürdie Erfolgskontrolle, ist es bedeutsam,wenn über die Qualität der Kartierresulta-te möglichst genau Auskunft gegebenwerden kann. Aufgrund der Erfahrungenaus Eichung und Kontrolle lassen sichbereits heikle Parameter erahnen, abererst eine systematischere Untersuchungkann verlässliche Hinweise geben, wie
stark die Kartierresultate aufgrund dersubjektiven Fehlerquellen (Kap. 3.8.1)schwanken können.
Für folgende Teilprojekte ist das Resultatder Genauigkeitsuntersuchungen beson-ders bedeutsam:
• Bewertung: Sicherheit der Aussagenwerden erhöht.
• Kartierung: Qualitätssicherung undAusbildung erhalten wertvolle Hin-weise.
• Berichterstattung: Vertrauensbereichfür alle Parameter wird grösser.
• Erfolgskontrolle: Die minimale Grössevon erkennbaren Veränderungen beider Wirkungskontrolle ist bekannt.
Die Genauigkeitsuntersuchungenwerdenvon der Forschungsanstalt WSL geleitet.
ZieleZiel der Untersuchungen ist es, Aussagenüber die Schwankungsbreite der Ergeb-nisse unter Praxisbedingungen zu er-halten. Es ist nicht das vorrangige Ziel,eine interne Bewertung der einzelnenKartierpersonen durchzuführen. Schwer-punkt der Untersuchungen ist die Feldar-beit. Sie wird innerhalb des gesamtenKartierprozesses als die kritischste Pha-se für subjektive Fehlerquellen betrachtet.Als Grundeinheit für die Genauigkeits-untersuchungen dient nicht das Teil-objekt, sondern das Objekt. FolgendeFragestellungen sind zu klären:
• Wie einheitlich erfolgt die Grenz-ziehung im Luftbild durch verschie-dene Luftbildinterpretinnen?
• Wie unterschiedlich sind die Grenz-korrekturen des vorinterpretiertenLuftbildabzuges durch verschiedeneKartierpersonen?
• Wie einheitlich ist die Aufnahme imFeld durch verschiedene Kartierper-sonen?
• Wie einheitlich erfolgt die Nachbear-beitung und die photogrammetrischeAuswertung?
DurchführungEs werden mehrere Objekte von mehre-ren Kartierpersonen nacheinander aufge-nommen. Alle teilnehmenden Personenführen unabhängig voneinander die ent-sprechenden Arbeitsschritte durch. DieFeldaufnahmen sind möglichst zum glei-chen phänologischen Zeitpunkt wie dieErstaufnahme durchzuführen.
Alle Ergebnisse werden mittels deskrip-tiver Statistik ausgewertet. Die Auswir-kungen auf die Bewertung der Flächenwerden simuliert und analysiert.
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 99

100
Kapitel 3 deutsch def.:Kapitel 3 deutsch def. 23.1.2007 13:44 Page 100

1014 LUFTBILDINTERPRETATION
4 LUFTBILDINTERPRETATION (Cornelia Mayer)4.1 Allgemeines 1034.2 Erstbegehung 1034.3 Stereoskopische Flächenabgrenzung 1054.4 Feldkartierung 1054.5 Stereoskopische Nachbearbeitung 1074.6 Photogrammetrische Auswertung 107
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 101

4 LUFTBILDINTERPRETATION102
LUFTBILDMODELL
Die beiden in einer Fluglinie aufeinanderfol-genden Luftbilder überdecken sich zu 75%.Der Überdeckungsbereich ist somit stereo-skopisch auswertbar. So können beispielsweisedie Steilheit des Geländes oder die Wuchshöheder Vegetation in die Analyse miteinbezogenwerden.
ERSTBEGEHUNG
1 Die im Voraus bestimmten Stichprobenflächen(schwarze Linien) werden bei der Erstbege-hung im Feld verifiziert. Die Interpretin hältdie Resultate auf der Erstbegehungsfolie fest,welche hierzu über dem Luftbildabzug fixiertist (rote Einträge).
2 Typische Trockenvegetation (�).
3 Verworfene Fläche mit Abstreichcode analogder Feldkartierung (M, G, H).
12
3
3
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 102

1034 LUFTBILDINTERPRETATION
4.1 ALLGEMEINES
UmdieMöglichkeiten des Luftbildes aus-zuschöpfen, wird die stereoskopischeLuftbildinterpretation angewendet. Sieumfasst mehrere Arbeitsschritte, welcheder Feldkartierung sowohl vor- als auchnachgeschaltet sind und im Folgendenausführlich beschrieben werden. AlsGrundlage dienen CIR-Luftbilder imMass-stab 1:10’000 (Kap. 3.5.3), die grössten-teils für das Projekt speziell angefertigtwerden.
Diese neu geflogenen Bilder haben eineLängsüberdeckung von 75%, d. h. aufdem Folgebild sind 75% der letzten Auf-nahme ebenfalls abgebildet. Die Quer-überdeckung beträgt 25%. Dem Flug-programm liegt eine detaillierte Flugpla-nung zugrunde.
Die Erhebung nach Vorgehensvariante2 (Kap. 3.2.5) lässt sich in verschiedenePhasen unterteilen. Es sind dies: Erst-begehung, stereoskopische Flächenab-grenzung, Feldkartierung, stereoskopi-sche Nachbearbeitung, photogrammetri-sche Auswertung.
4.2 ERSTBEGEHUNG
Als Vorbereitung zur Erstbegehung wer-den die Luftbilder, welche ein zu bearbei-tendes Gebiet abdecken, von den Luft-bildinterpretinnen als Stereomodelle aus-geschieden und in einer Modellübersichterfasst. Ziel der Modellausscheidung istes, mit einer möglichst geringen AnzahlModelle (Kosten) eine einwandfreie stereo-skopische Sichtbarkeit des Gebietes zugewährleisten. Dabei wird ein optimalerBetrachtungswinkel angestrebt (“Gegen-hangblick”, Schattenwurf gegen Interpre-tin, zentrale Lage des Objektes u.a.). AlsGrundlage zur Modellausscheidung dientder transparente Kartierplot, welcherüber die entsprechende Landeskarte im
Maßstab 1:25’000 gelegt wird (Kap.3.5.1). Neben Angaben zu den abzusu-chenden Gebieten enthält er auch eineFlugübersicht mit sämtlichen Luftbildmit-telpunkten. Die Interpretinnen ergänzenden Plot durch Einzeichnen der Modell-grenzen und Unterstreichen der verwen-deten Luftbildmittelpunkte.
Die ausgeschiedenen Modelle werdenanschliessend von den Interpretinnenunter dem Stereoskop systematischnach potentieller Trockenvegetation ab-gesucht. Auf einer über das Luftbildgelegten Folie (“Erstbegehungsfolie”)werden hierbei stichprobenweise Flächenfestgelegt, welche die Interpretin bei derErstbegehung imGelände aufsuchen undverifizieren will. Neben typischen, leichtals Trockenvegetation ansprechbarenFlächen unterschiedlicher Exposition, solldas Augenmerk im Besonderen aufschwierige und unklare Flächen sowie aufVegetationsübergänge gerichtet werden.
Bei der Erstbegehung führt die InterpretinLuftbildabzüge imMaßstab 1:10’000mit,auf welchen die Erstbegehungsfolienfixiert sind. Die vorgängig bestimmtenStichprobenflächen werden im Feld ve-rifiziert und das Ergebnis auf der Folienotiert. Die Erstbegehung dient den Inter-pretinnen zum Kennenlernen der Vegeta-tion eines Gebietes. Das Vegetationsab-bild im Luftbild wird mit der Vegetationdraussen verglichen und verbunden.Neben den vorhandenen Vegetations-typen sollen auch Regelmässigkeiten inder Vegetationsverteilung, d. h. ihre Ab-hängigkeit von Topographie, Exposition,Bewirtschaftung usw. beachtet werden.
Die Erstbegehung ist äusserst wichtigzur richtigen Einschätzung der Vegetationeines Gebietes, da der gleiche Trocken-vegetationstyp je nach Gebiet, Expo-sition, Befliegungszeitpunkt, Film u. a. imLuftbild immer wieder anders aussehenkann.
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 103

4 LUFTBILDINTERPRETATION104
STEREOSKOPISCHEFLÄCHENABGRENZUNG
1 Abgrenzung von möglichen Teilobjekten aufeiner über dem Originalluftbild fixierten Folie.
2 Abgegrenzte Flächen sind in sich möglichsthomogen.
3 Unsichere, eventuell zu fette Fläche.Vollständigkeitshalber wird eine Abgrenzungvorgenommen, die später im Feldüberprüft wird.
4 Die stereoskopische Abgrenzung potentiellerTrockenvegetaton erfolgt durch Analogie-schlüsse, d. h. mit dem Wissen aus derErstbegehung bezügl. Farbe / Struktur vonTrockenvegetation auf dem Luftbild wirdvon den stichprobeweise verifizierten Flächenauf ein ganzes Gebiet geschlossen.
FELDKARTIERUNG
1 Das Gebiet muss nicht mehr abgesuchtwerden, es werden direkt die stereoskopischabgegrenzten Flächen angelaufen.
2 Grenzkorrekturen werden mit blauer Farbedirekt auf der Feldfolie eingezeichnet.
3 Die Teilobjekte werden mit der Teilobjekt-nummer beschriftet.
4 Flächen ohne Schlüsselvegetation werdenmit einem Abstreichcode versehen, der denVerwerfungsgrund bezeichnet.
4
4
4
4
12
3
1
2
3
4
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 104

1054 LUFTBILDINTERPRETATION
4.3 STEREOSKOPISCHEFLÄCHEN-ABGRENZUNG
Die bei der Erstbegehung gewonnenenKenntnisse über die Vegetation eines Ge-bietes ermöglicht es den Interpretinnen,die TWW-relevanten Flächen eines Ge-bietes auf dem Luftbild zu erkennen. Dasabzusuchende Gebiet kann somit ein-geschränkt und der Kartieraufwandreduziert werden. Bei der stereoskopi-schen Flächenabgrenzung werden po-tentielle Flächen mit Trockenvegetationabgegrenzt. Die Abgrenzung erfolgt vonHand mit Tuschestift auf einer über demOriginalluftbild fixierten Folie (Originalfolie).Soweit erkennbar, berücksichtigen dieInterpretinnen bei der Abgrenzung diesel-ben Grenzkriterien wie die Kartierper-sonen im Feld. Besonders wichtig bei derAbgrenzung ist die Einhaltung der Mini-malflächen-Anforderung sowie die Ho-mogenität der Flächen. Um bei der Luft-bildinterpretation möglichst alle TWW-relevanten Flächen zu erfassen, wird imZweifelsfall zugunsten einer Fläche ent-schieden. Abschliessend werden dieOriginalfolien nach folgendem Beispielbeschriftet (nur rechte Spalte):
Projekt/Kanton TWW / GRGebiet SafientalFluglinien-Key 1997 039 048Bildnummer Nr. 2494Flugdatum 16.7.1997Maßstab 1:10’000Interpretin cmArchiv-Nr. 1994.44.8
Von den Originalfolien werden nun Fo-lienkopien hergestellt, die sog. Feldfolien.Diese werden auf den bereits für die Erst-begehung verwendeten Luftbildabzügenfixiert und für die Feldkartierung desnächsten Jahres bereitgestellt. Nur inAusnahmefällen wird ein Gebiet im glei-chen Sommer sowohl erstbegangen alsauch kartiert.
4.4 FELDKARTIERUNG
Als Arbeitsgrundlage dienen der Kartier-person Luftbildabzüge mit aufgeklebtenFeldfolien. Zur Ausrüstung gehört – wiebei allen Vorgehensvarianten – die Feld-karte 1:25’000. Auf ihr zeichnet dieKartierperson neben den von ihr abzu-suchenden Gebieten bei Vorgehensva-riante 2 auch entsprechende Modell-grenzen und Luftbildmittelpunkte ein.
Die 25’000er Karte dient sowohl alsOrientierungshilfe als auch zur Bezeich-nung des Flurnamens. Bei der Kartierungnach Vorgehensvariante 2 läuft die Kar-tierperson nicht mehr das gesamte ab-zusuchende Gebiet ab, sondern suchtgezielt nur noch die von den Interpretin-nen abgegrenzten Flächen auf. Es kanndavon ausgegangen werden, dass dieLuftbildinterpretinnen das Gebiet unterdem Stereoskop flächig auf potentielleTrockenvegetation hin abgesucht haben.
Die Kartierperson überprüft den Perime-tervorschlag und zeichnet allfällige Grenz-korrekturen oder -Ergänzungen direkt aufder Feldfolie ein. Ebenso auf die Feldfoliegehören die Nummer der Kartierpersonund des jeweiligen Teilobjekts sowie dieLage der Vegetationsaufnahme (Kap.5.1.2). Flächen ohne Schlüsselvegetationwerden durchgestrichen und mit einemAbstreichcode versehen.
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 105

502-3
VOM LUFTBILD AUF DIE KARTE
Luftbildmodell bei derstereoskopischen Nachbearbeitung
Photogrammetrische Auswertung
Die entzerrten Grenzlinien liegen digital vorund können auf eine Karte beliebigen Massstabsgedruckt werden.
4 LUFTBILDINTERPRETATION106
502-5
x
x
x
x
x
x
x
502-2
502-7
502-6
502-8
502-4
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 106

1074 LUFTBILDINTERPRETATION
4.5 STEREOSKOPISCHENACHBEARBEITUNG
Nach der Feldkartierung gelangen dieLuftbildabzüge inklusive Feldfolien erneutzu den Interpretinnen. Ihre Aufgabe be-steht darin, die Grenzkorrekturen derKartierpersonen unter dem Stereoskopauf die Originalfolien zu übertragen. Ne-ben den Teilobjektgrenzen gehören auchdie Nummern der Kartierperson und derTeilobjekte auf die Folien.
4.6 PHOTO-GRAMMETRISCHEAUSWERTUNG
Der Photogrammeter erhält von denInterpretinnen die Stereomodelle mit denOriginalfolien. Bei der photogrammetri-schen Auswertung wird der zentral-perspektifisch verzerrte Landschaftsaus-schnitt eines Luftbildes in eine orthogo-nale Projektion überführt. Hierzu orientiertder Photogrammeter die Luftbilder imStereoauswertegerät mit Hilfe von Pass-punkten und den Kameradaten undrekonstruiert anschliessend deren ge-genseitige Lage während der Aufnahme.Die Bilder werden ins Landeskoordina-tensystem eingebunden. Mit einer drei-dimensional bewegbaren Messmarkewird nun den Teilobjektgrenzen nach-gefahren. Die Koordinaten der Messmar-ke werden dabei laufend aufgezeichnet.Als Resultat liegen die Teilobjektgrenzendigital in einer entzerrten, lage- undwinkeltreuen Form vor.
Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 107

Kapitel 4 deutsch def.:Kapitel 4 deutsch def. 23.1.2007 13:49 Page 108

1095 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE (Stefan Eggenberg)5.1 Testflächen 1115.1.1 Beschreibung der Vegetation 1115.1.2 Festlegung der Testfläche 1135.1.3 Messung des Mittelpunktes 1155.1.4 Aufnahme der Arten 1175.1.5 Vollständigkeit der Artenliste 1195.1.6 Bestimmung der Vegetation 1215.1.7 Indexschlüssel 1235.1.8 Vegetationsangabe auf dem Protokollblatt 1255.2 Seltene Arten 1275.3 Verbuschung 1295.3.1 Angabe der Verbuschung 1295.3.2 Hauptart Verbuschung 1315.4 Nutzung 1335.4.1 Allgemeines 1335.4.2 Beschreibung der Nutzungstypen 1355.4.3 Schwierige Nutzungsansprache 1375.5 Strukturelemente 1395.5.1 Strukturelemente als Lebensraum für Tiere 1395.5.2 Definition der Strukturelemente 1415.5.3 Beschreibung der Einschlüsse und Grenzelemente 1435.6 Vernetzung 1475.7 Weitere Parameter 1495.7.1 Das Protokollblatt 1495.7.2 Zeit- und Lageparameter 1515.7.3 Vergleich mit Kantonsobjekten 1535.8 Bemerkungen und Hinweise 155
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 109

BESCHREIBUNG DER VEGETATION
Die Karte zeigt die grobe Verteilung grössererHalbtrockenrasen nach Hegg et al. (1993).
1 Die Feinheit der Klassifikation muss diebesten Vegetationseinheiten sowohl für dastrockene Wallis wie für das nährstoffreicheMittelland bezeichnen können.
2 Die Klassifikation der Vegetation soll für Jura,Mittelland und Alpen dieselbe sein.
3 Die Klassifikation muss auch für diesubalpine Stufe gelten.
4 Die Klassifikation muss auch für dassubmediterran beeinflusste Genf gelten.
5 Die Klassifikation muss auch für das ostalpinbeeinflusste Bünden und Tessin gelten.
Karte aus Hegg et al. (1993)
KLASSE:
Ordnung:
Verband:
Verband:
Hierarchie der pflanzensoziologischenEinheiten am Beispiel der Trocken- undHalbtrockenrasen Mitteleuropas. Einheitenauf der Ebene von Verbänden dienen derKlassierung der Vegetation im TWW alsOrientierungshilfe. So leitet sich aus demMesobromion eine Definition für das MBund aus dem Stipo-Poion xerophilae eineDefinition für SP ab.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE110
1
1
2
2
2
5
5
4
3
FESTUCO-BROMETEA
Festucetalia valesiacae Brometalia erecti
Festucion valesiacae Xerobromion(Subkontinentale Steppenrasen) (Subatlantische Trockenrasen)
Stipo-Poion Mesobromion(Inneralpine Steppenrasen) (Halbtrockenrasen)
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 110

1115 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1 TESTFLÄCHEN
5.1.1 Beschreibungder Vegetation
Es existieren zahlreiche Ansätze in Theo-rie und Praxis, die für die Klassifikationund Beschreibung von Vegetation an-gewendet werden. Die Wahl der Klassifi-kationsmethode sollte sich an den Zielender Untersuchung orientieren.
Vegetationseinheiten im TWWFür die Erhebung einer Übersicht der Tro-ckenwiesen und -weiden der Schweizsind folgende Überlegungen von Belang:
• Die Klassifikation soll für die ganzeSchweiz und für alle Höhenstufen vonder kollinen bis zur subalpinen StufeGültigkeit haben.
• Die Vegetationseinheiten sollen so feinabgestuft sein, dass in jeder Regionder Schweiz die besonders wertvollenObjekte als solche erfasst werden.
• Die Vegetationseinheiten müssen imFeld ohne allzu aufwendige Erhe-bungsmethoden bestimmbar sein.
• Die Unterschiede der Einheiten sollenvermittelbar und mit Einheiten derpflanzensoziologischen Literatur ver-gleichbar sein.
• Die Klassifikation soll Einheiten liefern,die eine spätere Bewertung der Tro-ckenwiesen und -weiden erlauben.
In der vegetationskundlichen Praxis hates sich bewährt, Pflanzenarten als Haupt-merkmale der Vegetationsbeschreibungzu verwenden. Ist eine Klassifikation auf-grund von Arten einmal entwickelt, so ge-nügt es, das Vorhandensein von weni-gen, bestimmten Arten im Feld zu testen.Solche Testfragen nach dem Vorhanden-sein (Präsenz) oder “Abwesendsein”(Absenz) von bestimmten Arten werdenmeist in Vegetationsschlüsseln zusam-mengefasst. Als weiteres Merkmal kannauch die Deckung (Dominanz) von Artenoder Artengruppen hinzugezogen wer-den, um feinere Unterscheidungen bei
fliessenden Übergängen zu ermöglichen.Beide Merkmalstypen gelangen im Vege-tationsschlüssel zur Anwendung.
Beziehungenzur PflanzensoziologieBei der verwendeten Klassifikation ist be-wusst eine Annäherung an die Pflanzen-soziologie gewählt worden. Nach dem inMitteleuropa gebräuchlichen hierarchi-schen System von Pflanzengesellschaf-ten von Braun-Blanquet (Braun-Blanquet1964, Westhoff & Van der Maarel 1973,Oberdorfer 1977, Wilmanns 1989, Runge1990, Dierschke 1994) werden die Grund-einheiten, die Assoziationen, nach derGesamtartenliste von Vegetationsaufnah-men beurteilt. Assoziationen kommenmeist der Realität der Einzelbeständenoch sehr nahe. Für Vergleiche innerhalbeiner Region sind sie geeignet, nicht aberfür überregionale Arbeiten wie das TWW.Die in der Systemhierarchie nächst höhe-re Einheit ist der Verband, der floristischnoch über grosse Gebiete relativ einheit-lich ist und sich daher für unsere Klassifi-kation eignet. Verbände zeichnen sichauch durch wesentlich mehr Charakter-arten aus und es ist leichter, aus ihnen ei-nen Vegetationsschlüssel aufzubauen.Allerdings erfüllen die pflanzensoziologi-schen Verbände nicht alle für die Kartie-rung wünschenswerten Kriterien, wie sieoben genannt wurden. Es wurde daherauf der Basis der Verbände eine Untertei-lung vorgenommen, die es erlaubt, wich-tige Abstufungen und Übergänge zu be-schreiben.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 111

HOMOGENITÄT DER TESTFLÄCHE
DIE TESTFLÄCHE
Die Lage der Testfläche wird auf dem Luftbildabzug mit einem Kreuz markiert.
REPRÄSENTATIVITÄT DER TESTFLÄCHE
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE112
hohe Repräsentativität
schlechte Repräsentativität
inhomogene Testfläche
Die Testfläche ist kreisrund mit einem Radius von 3 m.Der Mittelpunkt wird mit einem GPS eingepeilt.
homogene Testfläche
Testfläche
3 m
GPS-Messung in der Mitte
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 112

1135 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.2 Festlegung der Testfläche
Die mutmassliche Teilobjektfläche wirdmeist von einem Vegetationstyp eindeu-tig dominiert. Um diese dominierendeVegetation zu beschreiben und zu doku-mentieren, wird in einem für den Vege-tationstyp repräsentativen und in sichmöglichst homogenen, kreisrunden Aus-schnitt mit 3 m Radius eine Artenliste er-stellt. Dieser Ausschnitt wird “Testfläche”genannt. Zum Einmessen des Mittel-punktes für das spätere Wiederfinden derTestfläche dient ein Satelliten-Naviga-tionsgerät (GPS); zusätzlich wird derMittelpunkt mit einem Kreuz auf demLuftbild markiert.
Repräsentativität
Maximale Repräsentativität der Testflächeist dann gegeben, wenn sich das Arten-spektrum in anderen Ausschnitten derdominierenden Vegetation kaum verän-dern würde. In der Realität ist dies kaumder Fall, aber es gilt, die Fläche so zuwählen, dass möglichst geringe Unter-schiede zu anderen Ausschnitten desVegetationstyps entstehen. Vegetation istnie völlig homogen und v.a. bei Weidenfinden wir oft eine kleinsträumige Ver-zahnung von unterschiedlichen Gesell-schaftsfragmenten. Für die spätere Beur-teilung der Artenliste ist es wichtig, dassder Grad an Repräsentativität abge-schätzt wird. Wir verwenden eine drei-teilige Skala:
Hohe Repräsentativität (9):Die Vegetation der Testfläche repräsen-tiert die dominierende Vegetation gut.Das Artenspektrum anderer Ausschnitteder dominierenden Vegetation ändert nurgeringfügig (mit flüchtigem Blick kaumerkennbar, bzw. max. 10 % Abweichung).
Mittlere Repräsentativität (5):Die dominierende Vegetation ist durch dieTestfläche genügend repräsentiert. DasArtenspektrum (inkl. Dominanzverteilungder Arten) einiger anderer Ausschnitte der
dominierenden Vegetation ist allerdingssichtbar verschieden.
Schlechte Repräsentativität (0):Die Vegetation ist durch die Testflächeungenügend repräsentiert. Es ist kaummöglich, eine Testfläche zu finden, ohnedass erhebliche, gut sichtbare Unter-schiede zu den meisten anderen Aus-schnitten der dominierenden Vegetationin Kauf genommen werden müssen.
Achtung:Bei kleinräumigen Mosaiken (Mosaikeaus Gesellschaftsfragmenten, die erheb-lich kleiner als die Testfläche sind) kann esdurchaus möglich sein, hohe Repräsen-tativität (der Mosaikzusammensetzung)zu finden.
Homogenität
Die Beurteilung der Homogenität beziehtsich nur auf den Inhalt der Testfläche. Esist dies ein qualitativer Aspekt der Testflä-che, der durch die Artenliste allein nichtwiedergegeben wird. Die Schätzung derHomogenität erleichtert die Interpretationdes Resultates für die Bewertung und fürdie spätere Wirkungskontrolle. Die Ho-mogenität ist ein Mass für die Verteilungder Arten. Wenn mehrere Arten in einemTeil der Testfläche gehäuft auftreten, dannist die Fläche nicht besonders homogen.Wir unterscheiden wieder drei Stufen:
Homogene Testfläche (9):Die Arten sind gleichmässig über dieganze Testfläche verteilt. Es ist keineerkennbare Inhomogenität vorhanden.
Teilweiseinhomogene Testfläche (5):Einzelne Arten kommen in Gruppen oderFlecken vor, die unregelmässig in derTestfläche verteilt sind.
Inhomogene Testfläche (0):Innerhalb der Testfläche sind Gradientenerkennbar, verursacht durch z.B. zuneh-mende Vernässung gegen eine Seite hin
oder durch einzelne Steinblöcke in derFläche. Dadurch sind fast keine Artengleichmässig über die Testfläche verteilt.
Achtung:Bei kleinräumigen Mosaiken (Mosaikeaus Gesellschaftsfragmenten, die erheb-lich kleiner als die Testfläche sind) kann esdurchaus möglich sein, hohe Homoge-nität (der Mosaikzusammensetzung) zufinden.
Spezialfälle
Bei grossen Teilobjekten, wie sie v.a. imINT-Gebiet vorkommen, ist es oft nichtmöglich, eine Vegetation von vornhereinals dominierend zu bezeichnen. In sol-chen Fällen ist es unsinnig, nach langemAblaufen des Teilobjektes zum dominie-renden Vegetationstyp zurückzukehren –die Testfläche kann dann ausnahmsweiseauch in einem nicht dominierenden Vege-tationstyp gelegt werden. Bei solchenSpezialfällen ist eine Bemerkung anzu-geben.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 113

P1: GPS-Empfänger im Feld (Rover)P2: Referenzstation (Basis)S1-S4: Satelliten
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE114
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 114

1155 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.3 Messung desMittelpunktes
Zweck
Eine möglichst genaue Einmessung desMittelpunktes der Testfläche soll es er-möglichen, den Ort der Aufnahme zu ei-nem späteren Zeitunkt, z.B. im Rahmender Wirkungskontrolle, wieder zu findenund auf Veränderungen zu prüfen.
Messverfahren
Die Einmessung des Mittelpunktes erfolgtmit dem GPS-Messverfahren (GlobalPositioning System). Bei diesem Verfah-ren werden Signale verwendet, die vonspeziellen Satelliten gesendet werden.Mit einem geeigneten Gerät (GPS-Em-pfänger) wird aus der Zeitdifferenz zwi-schen Aussendung und Empfang desSignals die Distanz zum Satelliten berech-net. Mit der gleichzeitigen Auswertungder Signale von mehreren Satellitenkann der GPS-Empfänger die Position inBezug auf das globale terrestrische Koor-dinatensystem (World Geodetic System,WGS 84) mit einer Genauigkeit von ±10 mberechnen.
Das GPS-System wurde vom US-Vertei-digungsministerium für die Streitkräfteentwickelt (1973 erste GPS-Satelliten;Vollausbau seit 1993 mit 24 Satelliten).Die Signale werden zur Zeit künstlich soverfälscht, dass eine direkte Positions-messung nur auf 50 -100 m Genauigkeitmöglich ist. Diese Abweichungen könnenmit einer exakt eingemessenen Emp-fangsstation (Referenzstation) ermitteltwerden und die Daten anderer GPS-Empfänger korrigiert werden. Man nenntdieses Vorgehen Differential GPS (DGPS).Die Korrektur kann im Echtzeit-Verfahrenüber Funk (mit eigener, lokaler Referenz-station) oder mit Korrekturdaten erfolgen,die über Radiosignale oder ein Mobilfunk-netz verbreitet werden. In der Schweizwerden zur Zeit zwei DGPS-Korrek-
turdienste über Radio angeboten: RDS(Radio Data System) über DRS 3 vomBundesamt für Landestopographie (SWI-POS) und AMDS (Amplituden Modulier-tes Daten System) über den Mittelwellen-sender Beromünster von der Firma “terraVermessungen”. Eine andere Möglichkeitbesteht darin, die Korrekturdaten bei derReferenzstation zu speichern und die Da-ten des GPS-Empfängers in einer Nach-beabeitung später zu korrigieren (sog.post-processing).
Messkriterien
Stärke des GPS-Signales:Der Signalempfang ist am besten beiklarem Himmel und “Sichtverbindung”mit den Satelliten. Bewölkung und v.a.Abdeckung der Empfangsantenne durchdie Vegetation beeinträchtigen den Emp-fang. Die Satelliten bewegen sich v.a. amSüdhimmel, was bei der Ausrichtung derAntenne zu beachten ist.
Anzahl Satelliten:Der GPS Empfänger muss die Signalevon mindestens vier Satelliten empfan-gen können (drei für die Positionsmes-sung, einer für andere Satellitendaten).
Lage der Satelliten:Eine optimale Verteilung der Satelliten istfür das Messresultat entscheidend. Dieaktuelle Verteilung wird als sog. PDOP-Wert vom Empfänger gemessen; er soll-te möglichst tief liegen. Beim Empfängerkann ein Filter für einen maximalen Werteingestellt werden.
Flach über dem Horizont stehende Satel-liten sollten für die Messung nicht ver-wendet werden. Der minimale Winkelkann beim GPS-Empfänger eingestelltwerden (Elevation-Mask).
Messdauer:Je länger an einem Punkt gemessen wird,um so genauer wird die Messung.
GPS-Gerät, Geräteeinstellungen,DGPS-Korrektur
Gerätetyp:Trimble GeoExplorer IIAntenne:im Gerät eingebautPDOP-Filter:<6Elevation-Mask:15°Messfrequenz:5 secMin. Anzahl Messungen:100DGPS-Korrektur:post-processingReferenzstationen:Bundesamt für Landestopographie(SWIPOS)Messresultat:Koordinaten CH 1903
Vorgehen bei der Messung
Der GPS-Empfänger wird möglichst oh-ne störende Abdeckung, leicht gegen Sü-den geneigt im Mittelpunkt der Testflächein Position gebracht. Die Messung wirdüber das im Empfänger vorbereiteteMenu gestartet (vgl. Anleitung). Die An-zahl Messungen sollte nicht unter 100liegen.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 115

ARTENLISTEN AUFDEM PROTOKOLLBLATT
Soziologische Gruppe AE1typische Arten der Fettwiesen(Arrhenatherion elatioris).
Die Art Dactylis glomerata (Knaulgras)ist in der Testfläche mit einer Deckungzwischen 5 - 25 % vertreten.
Die Art Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume)ist in der Testfläche mit wenigen Individuenvertreten.
Die Art Trisetum flavescens (Goldhafer) ist nurausserhalb der Testfläche, aber innerhalb desTeilobjektes vertreten.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE116
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 116

1175 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.4 Aufnahme der Arten
Der Inhalt der Testfläche wird mit der Auf-nahme der darin vorkommenden Artendokumentiert. Es werden sowohl diePräsenz (Vorkommen) als auch die Ab-undanz (Häufigkeit) bzw. Dominanz (De-ckung) der Arten festgehalten. Damit istdie Vegetation der Testfläche so beschrie-ben, dass sie mit dem Vegetationsschlüs-sel identifiziert werden kann und dass sieals Erstaufnahme für die spätere Umset-zung und Erfolgskontrolle dienen kann.
Für die Aufnahme im Feld ist eine guteKenntnis der Trockenwiesenarten nötig,auch in deren nichtblühenden Zustand.Die Aufnahme sollte möglichst vollständigsein (d.h. Erfassung aller vorkommendenhöheren Pflanzen und deren Deckungs-anteile), allerdings ist der durchschnittli-che Aufwand für die Aufnahme auf 20Minuten beschränkt.
Artenlisten aufdem Protokollblatt
Die Protokollblatt-Rückseite mit vorge-druckter Artenliste dient als Aufnahme-formular. Die für die Vegetationsschlüsselrelevanten Arten (sog. “Schlüsselarten”)sind in ihren soziologischen Zeigerarten-Gruppen zusammengestellt. So sind allecharakteristischen Arten der Blaugrashal-den unter der Gruppe SV (= Seslerionvariae, Verband der Blaugrashalde) auf-geführt. Die so gruppierten Arten könnendirekt für die Arbeit mit dem Vegetations-schlüssel verwendet werden. Innerhalbjeder soziologischen Gruppe sind die Ar-ten alphabetisch geordnet. Neben denArtenlisten sind leere Felder vorhanden, indenen die Deckung, bzw. das Vorkom-men der Arten notiert wird. Die Artenlistewird digital erfasst und es ist daher sehrwichtig, dass die richtigen Felder mit gutlesbaren Zahlen und Symbolen gefülltwerden. Für die Aufnahme der Testflächeist stets die rechte Spalte zu verwenden,bzw. die Spalte, die unmittelbar vor denArtnamen liegt.
Schätzung vonAbundanz und Dominanz
Als Skala für die Beschreibung der Art-vorkommen dient die international ver-wendete kombinierte Abundanz-Domi-nanz-Skala nach Braun-Blanquet, die fürjede Art eine Artmächtigkeit liefert. Bei derDurchführung dieser Schätzung ist zu-nächst festzustellen, ob die Art dominant(Deckung mehr als 50%), co-dominant(Deckung über 25%) oder bedeutend(Deckung über 5%) ist. Wenn dies nichtzutrifft, so muss beurteilt werden, obviele oder wenige Individuen vorhandensind. Als Grenzzahl zwischen “viel”und “wenig” gilt die Individuenzahl 50.Für nur vereinzelte Vorkommen sind zweiSymbole reserviert (+, r). Es ist daraufzu achten, dass das Symbol + nur beibis zu 5 Individuen vergeben wird!
Bei einer so durchgeführten Schätzungschleichen sich leicht systematische Feh-ler ein. Es besteht beispielsweise oft dieTendenz, dass blühende und auffälligePflanzen überschätzt werden. Insbeson-dere bei Gräsern ist die Deckungsschät-zung recht schwierig. Es ist daher amBeginn der Arbeiten an einem Tag odereiner Woche sinnvoll, wenn man sich Far-be, Struktur und Habitus von einzelnenidentifizierten Grasarten zunächst ausnächster Nähe einprägt.
Begleitarten
Während die Liste der Schlüsselartenvollständig erhoben werden muss undderen Artmächtigkeit möglichst genaubestimmt werden soll, sind die Begleitar-ten von etwas geringerer Bedeutung. Aufdem Protokollblatt sind die häufigstenBegleitarten ebenfalls vorgedruckt, eskann aber vorkommen, dass weitereArten in der Testfläche vorhanden sind.Für diese Arten können die unter denArtenlisten angefügten Felder zum Ein-tragen des Artnamens verwendet wer-den. Es sind Abkürzungen mit Gross-buchstaben für Gattungs- und Artnamen
zu verwenden. Die Buchstaben solltengut lesbar sein (Vorsicht bei D und O!).Für den Gattungsnamen stehen drei, fürden Artnamen fünf Felder zur Verfügung.Sollten diese Felder nicht genügen, sogelten bestimmte Regeln, die nebenanan Beispielen illustriert sind. Wenn beieinzelnen Pflanzen nur die Gattung an-gesprochen werden kann, so sind sieunter den zusätzlichen Arten mit “*SP[Gattungsname]” anzugeben (z.B.: *SPGALIU für Galium sp.)
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 117

SCHLÜSSELARTEN AUSSERHALBDER TESTFLÄCHE
Ausserhalb der Testfläche gefundeneSchlüsselart wird mit einem o in dermittleren Spalte notiert.
Die linke Spalte steht für Notizenzur freien Verfügung.
Die rechte Spalte sollte ausschliesslich fürdie Vegetation der Testfläche verwendet werden.Ist dies nicht der Fall, so ist eine andere Spalte
als “Referenzspalte GPS“ zu bezeichnen.
Die linke und mittlere Spalte stehenzur Dokumentation der weiterenVegetationstypen zur Verfügung.
Mit verschiedenen Zeichen(z.B. mit o oder x) kann eine Spalte
für mehrere Vegetationstypenverwendet werden.
DIF INT
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE118
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 118

1195 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.5 Vollständigkeitder Artenliste
Bei der Auswahl der Schlüsselarten wur-de darauf geachtet, dass sie nicht allzugrosse Bestimmungsschwierigkeiten bie-ten und dass die meisten in verschiedenenStadien (auch im Frühling oder nach derNutzung) erkennbar sind. Trotzdem istes aus phänologischen oder zeitlichenGründen nicht immer möglich, alle Artenzu identifizieren. Die Vollständigkeit derArtenliste wird daher angegeben. Wir ver-wenden eine dreiteilige Skala:
Fast vollständig,über 90% der Arten (9):In der gegebenen Zeit sind alle sichtbarenArten notiert worden, die mindestens mitder Deckung + auftreten. Möglicherweisesind noch einzelne Arten mit r vorhanden.
Nicht ganz vollständig,aber über 75% (5):Es gibt einige Arten, die nicht erkannt wur-den. Die Deckung dieser Arten ist zu kleinund/oder die Zeit reicht für eine genaueBestimmung nicht aus. Die fehlendenArten sollten aber keinen Einfluss auf dieBestimmung des Vegetationstyps haben.
Unvollständig, unter 75% (0):Die Vegetation ist geschnitten, stark ab-geweidet oder aus anderen Gründenschwierig zu beurteilen. Bei mehreren an-gegebenen Arten besteht eine Unsicher-heit. Evtl. sind auch einige Schlüsselartennicht erkennbar, so dass die Bestimmungdes Vegetationstyps unsicher oder garfehlerhaft ist.
Schlüsselartenausserhalb der Testfläche
Wenn ausserhalb der Testflächewäh-
rend dem Abschreiten des Teilobjekts
zusätzliche Schlüsselarten gefundenwer-
den, so sind diese in der mittleren Spalte
mit einem kleinen Kreis zu notieren. Alle
Arten, die der Bestimmung der Begleit-
vegetation dienen, müssen so festgehal-
DIF
ten werden. Im übrigen muss aber diese
Liste nicht vollständig sein, sie dient dem
besseren Zuordnen und Absichern der
verschiedenen Vegetationstypen.
Neben der durch die Testfläche doku-
mentierten Vegetation gibt es meist noch
weitere Vegetationstypen im gleichen
Teilobjekt. Um deren Schlüsselartenwäh-
rend dem Abschreiten des Teilobjektes
festzuhalten und zu dokumentieren, die-
nen die restlichen zwei Spalten in der Ar-
tenliste. Welche Symbole hier verwendet
werden, ist der Kartierperson freigestellt.
Vegetationsaufnahme
Im Gegensatz zur normalen Aufnahmeder Testfläche steht für eine vollständigeVegetationsaufnahme unbeschränkt Zeitzur Verfügung. Die genaue Vegetations-aufnahme wird dann durchgeführt, wennein Vegetationstyp nicht, schlecht odernur unsicher mit dem Vegetationsschlüs-sel beschrieben werden kann. Die Arten-liste auf der Rückseite des Protokollblat-tes dient dazu als Formular. Wenn bei derMethode INT mehr als eine Vegetations-aufnahme gemacht wird, ist eine Bemer-kung anzubringen (Feld “BemerkungVegetation” ankreuzen).
INT
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 119

HAUPTSCHLÜSSEL
Die Frage in diesem Kasten wird als erstegetestet: wenn in der Testfläche 6 Arten aus derGruppe AI zu finden sind, so erhält die Vegetationden Haupttyp AI.
Wenn die Frage aus dem vorangegangenenKasten noch keinen Haupttyp ergeben hat, sowird die Frage des nächsten Kastens getestet,hier: entweder die Testfläche enthält insgesamtmindestens 6 Arten aus den Gruppen XB,SP + CB oder die Arten der Gruppe SP deckenmindestens 10%. Bei beiden Bedingungen giltdie Voraussetzung, das die Arten der Gruppe AEnicht mehr als 5% decken.
Wenn bisher noch kein Haupttyp gefunden wurdeund in der Testfläche 6 Arten aus den GruppenMB und SV zu finden sind, so muss zuerst nochabgeklärt werden, ob die Arten der Gruppe AEin der Testfläche mehr als 25% decken …
…Wenn dies der Fall ist, so gilt der innereKasten,…
… doch auch hier müssen noch weitereTestfragen abgeklärt werden, z.B. ob dieGruppen AE und NS1 die Deckung von 50%überschreiten. In diesem Fall wird die Flächenicht aufgenommen, sofern es sich um eineWeide der höheren Lagen handelt.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE120
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 120

1215 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.6 Bestimmungder Vegetation
Idee der MerkmalskombinationFür die Bestimmung der Vegetation stehtim Projekt TWW ein Vegetationsschlüsselzur Verfügung, der sich in einen Haupt-und einen Indexschlüssel gliedert. Mit Hil-fe des Hauptschlüssels kann die Vegeta-tion einem pflanzensoziologischen Ver-band näherungsweise zugeordnet wer-den. Dieses Ergebnis kann dann mit Hilfedes Indexschlüssels präzisiert werden, in-dem auch die Anteile von bis zu zwei wei-teren Verbänden angegeben werdenkönnen. Wir erhalten so die Hauptzuord-nung, die wir Haupttyp nennen, und einepflanzensoziologische Variante diesesHaupttyps, die durch die beiden Indicesbeschrieben wird. Auf diese Weise könnenauch Übergänge zutreffend beschriebenund gewichtet werden. Gerade für diesubalpine Stufe, wo in Wiesen und Weidensehr viele Übergänge vorkommen, istdieses Vorgehen sehr angebracht.
Schreibregeln
• Die Vegetationstypen werden nicht miteiner Nummer bezeichnet, sondernmit zweistelligen Buchstabencodes.
• Der Haupttyp wird stets vorangestellt.• Es können bis maximal zwei Indices
angefügt werden.• Die Angabe eines Haupttyps ist obli-
gatorisch, die Angabe eines Index istfakultativ.
• Die Reihenfolge der beiden Indices istaustauschbar, ohne dass der Vege-tationstyp sich ändert. Im allgemeinensollte die Reihenfolge des Index-schlüssels eingehalten werden.
• Zum Schreiben der Codes sind – auchfür die Indices – stets Grossbuchsta-ben zu verwenden.
Hauptschlüssel
Mit dem Hauptschlüssel wird der Haupt-typ ermittelt. Es ist stets nur ein zwei-
buchstabiger Code dafür einzusetzen.Sobald innerhalb des Schlüssels eineSchlüsselfrage bejaht werden kann, wirdder der Frage zugeordnete Code alsHaupttyp verwendet und die Arbeit mitdem Hauptschlüssel ist abgeschlossen.
Die Reihenfolge der Abfragen ist wichtig.Im grafisch gestalteten Hauptschlüsselsind sie als Kästchen gestaltet, die teil-weise ineinander verschachtelt sind undso Kästchen 1. und 2. Ordnung bilden.Die Fragen in den Kästchen 1. Ordnungmüssen stets von oben nach untendurchgegangen werden. Ist eine Bedin-gung erfüllt, kann das Kästchen “betre-ten” werden. Jedem Kästchen 1. Ord-nung ist ein Code zugeordnet, der abernur verwendet werden kann, wenn dieBedingungen der Kästchen 2. Ordnungnicht erfüllt sind. Andernfalls wird derCode des verschachtelten Kästchensgenommen.
Der Hauptschlüssel ist so aufgebaut,dass als erstes seltene Gesellschaftenextremer Trockengebiete bestimmt wer-den: der halbruderale Trockenrasen (Agro-pyrion intermedii – AI), der subatlantischeTrockenrasen (Xerobromion – XB) undder inneralpine Steppenrasen (Stipo-Poion – SP).
Auch innerhalb der danach folgenden Ve-getationstypen der subalpinen Stufe wer-den zunächst die seltenen Vegetationsty-pen abgefragt. Die vier Verbände Bunt-schwingelhalde (Festucion variae – FV),Rostseggenhalde (Caricion ferrugineae –CF), Blaugrashalde (Seslerion variae – SV)und Borstgrasrasen (Nardion strictae –NS) haben erst in der alpinen Stufe ihreneigentlichen Verbreitungsschwerpunkt.Sie treten daher meist in der Durchmi-schung mit dem Mesobromion (MB) auf.
Bei schwacher oder aufgegebener Mäh-nutzung, insbesondere in halbschattigenLagen, entstehen oft staudenreiche,hochwüchsige Rasen. Sie werden hierden Saumgesellschaften (Origanietalia –OR) zugeordnet. Wenn eine Art dominiert
und den Aspekt bildet, so ist dies stetsals Bemerkung anzugeben. Die Laser-krauthalde wird speziell ausgeschieden(ORLA).
Es folgt der wohl am häufigsten verwen-dete Teil des Hauptschlüssels: die Halb-trockenrasen mit einer Unterscheidungnach “Fettanteilen”. Es gilt die Arten derHalbtrockenrasen (Mesobromion – MB)festzustellen und dann den Deckungsan-teil der Fettwiesenarten (Arrhenatherionelatioris – AE) zu schätzen.
Am Schluss folgen einige Spezialfälle:artenarme Rasen mit Bromus erectus,Brachypodium pinnatum, Festuca curvu-la oder Carex sempervirens.
Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist,so wird der Code XX verwendet, damitdas Protokollblatt direkt der Kartierleitungzugestellt wird. Das Feld Vegetationsauf-nahme wird mit “JA” angekreuzt und eskann eine Aufnahme ohne Zeitlimitedurchgeführt werden.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 121

INDEXSCHLÜSSEL
Zunächst werden im ersten Kasten alle 4 Fragengetestet. Die erste Frage, die zutrifft, liefert denentsprechenden Index.
Der Index AI darf nur vergeben werden, wennnicht bereits AI als Haupttyp zutrifft (nachHauptschlüssel).
Nachdem der erste Kasten abgehandelt ist,wird die gleiche Prozedur im nächsten Kastendurchgeführt. Theoretisch kann aus jedemKasten maximal ein Index vergeben werden,doch lässt die Bezeichnung der Vegetationstypennur bis zu zwei Indices zu.
Der Index AE darf nur vergeben werden,wenn nicht bereits AE oder FA als Haupttypenzutreffen (nach Hauptschlüssel).
Solange noch nicht zwei Indices vergeben sind,werden alle Kasten getestet.
Die Arten der Gruppe CD decken mehr alsdie Arten der Gruppe CN.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE122
Ausschluss
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 122

1235 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.7 Indexschlüssel
Der Indexschlüssel dient der Bestim-mung pflanzensoziologischer, ökologi-scher, struktureller und biogeographi-scher Zusatzangaben. Diese werden miteinem dem Haupttyp soziologisch ver-gleichbaren Code angegeben. Die insProtokoll einzutragende Bezeichnungenthält maximal zwei Indices.
Auch beim Indexschlüssel ist die Reihen-folge der Kästchen von oben nach untenwichtig, d.h. die oberen Kästchen habenPriorität. Aus jedem Kästchen kann nurein Index bestimmt werden, wobei dieReihenfolge der Fragen innerhalb derKästchen gleichzeitig eine Prioritätsab-folge ist. Für bestimmte Haupttypen gibtes ungültige Indices, d.h. der betreffendeIndex darf nur angehängt werden, wenndie neben dem Kästchen stehendenCodes nicht bereits als Haupttyp figu-rieren. Beispiele:
• Der Index AE darf nicht dem Haupt-typ MBFA angehängt werden.
• Der Index XB darf nicht dem Haupt-typ SP angehängt werden.
• Der Index SP darf nicht dem Haupt-typ SP angehängt werden.
Prioritäre Indices
Die Reihenfolge der abgefragten Ar-tengruppe ist entscheidend. Es werdenwie bereits im Hauptschlüssel zunächstseltene, ausserordentliche Einheiten ab-gefragt, die sich zudem gegenseitig aus-schliessen. Das sind die subkontinenta-len Steppenelemente (Cirsio-Brachypo-dion – CB), die südalpinen Kalkrasen(Caricion austroalpinae – CA), die süd-alpinen Goldschwingelrasen (Festucionpaniculatae – FP) und die halbruderalenTrockenrasen (Agropyrion intermedii - AI).Darauf wird als erstes der Hauptgradient(trocken, nährstoffarm - frisch, nährstoff-reich) nochmals genauer präzisiert, meistfür den Haupttyp MB. Eine Besonderheitist hier der Index SS, der nur für Be-
gleitvegetation vergeben werden kann.Es soll dadurch verhindert werden, dassFelsgrusflecken mit grossem Arbeits-aufwand als eigene Teilobjekte kartiertwerden müssen.
Eine weitere wichtige Angabe ist dieDifferenzierung zwischen artenreichenund artenarmen Varianten der subalpinenRasengesellschaften. Diese Angabe istfür Umsetzung und Bewertung wichtig.Die Reihenfolge innerhalb des Kästchensist dieselbe wie im Hauptschlüssel.
Weitere Indices
Die Übergänge der Trockengesellschaf-ten zu den Flachmooren bilden ökolo-gisch die wechselfeuchten Gesell-schaften. Der Boden ist hier zeitweiligtrocken, dann wieder stark durchfeuch-tet. Wir finden meist Zeigerarten ausbeiden ökologischen Gruppen. Eswird unterschieden, ob es sich um Über-gänge zu den Kalkflachmooren (Cariciondavallianae – CD), den Schwarzseggen-rieder (Caricion nigrae – CN) oder denPfeifengraswiesen (Molinion – MO) han-delt. In den tieferen Lagen kann dieWechselfeuchtigkeit der Vegetation durchdiese Indices stets angegeben werden,da der zweite Index meist noch zur Ver-fügung steht. In den höheren Lagendagegen ist dies nur noch selten möglich,da der Index für Wechselfeuchtigkeitnicht prioritär ist und der zweite Indexmeist schon vergeben ist.
Als zusätzliche Angabe können, wennnoch “Indexplätze” frei sind, strukturelleund ökologische Phänomene festgehal-ten werden. Das Vorkommen von Saum-arten (Origanietalia – OR) zeigt eine Unter-nutzung oder halbschattige Lage an.Kurzrasige Höhenformen der Halb-trockenrasen werden mit der Strukturan-gabe SC (= Sesleria und/oder Carexmontana und/oder Carex sempervirens)festgehalten. Versauerte, verhagerte oderübernutzte Rasen werden mit dem IndexVC (Violion caninae) dargestellt.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 123

VEGETATIONSANGABE
Mit einem blauen Kreuz ist die Testfläche desTeilobjektes 209-101 markiert.Sie ist in der dominierenden Vegetation XBOR
gesetzt worden.
Die Flecken mit reiner XB-Vegetation (rosa)sind am oberen Rand des Teilobjektes zu finden.Am westlichen Ende gibt es noch Flecken mitOR-Vegetation (rot). Dies ist eine typischeSituation mit Dominanz- und Begleitvegetationim Gebiet der DIF-Methode.
Methode INT
Die Summe der notierten Vegetationstypenkann kleiner sein als die totale Deckung derSchlüsselvegetation im Teilobjekt.
Situation mit 6 notierten Vegetationstypenim Gebiet der INT-Methode. Die weiterenVegetationstypen konnten nicht notiert werden.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE124
+
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 124

1255 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.1.8 Vegetationsangabeauf dem Protokollblatt
Vegetationsparameter im DIF
Da Vegetationsunterschiede nach derMethode DIF als Kriterium verwendetwerden, um Teilobjekte voneinander ab-zutrennen, ist grundsätzlich in jedem Teil-objekt nur ein Vegetationstyp anzutreffen.Meist treffen wir aber in den Teilobjek-ten auch Flecken oder Streifen andererSchlüsselvegetation an, die nicht gross-flächig genug sind, um ein eigenes Teil-objekt zu bilden. Diese Vegetation wird imTeilobjekt als Begleitvegetation integriert.Wir unterscheiden daher dominierendeVegetation und Begleitvegetation.
Dominierende VegetationBezeichnung der vorherrschenden Vege-tation im Teilobjekt. Die Codierung be-steht aus einer zweistelligen Hauptgesell-schaft und bis zu zwei Indices sowieeiner Deckungsschätzung. Um die Les-barkeit zu optimieren, werden stets nurGrossbuchstaben verwendet.
Die Deckung bezüglich der Teilobjekt-fläche wird so genau wie möglich ge-schätzt.
BegleitvegetationEs können maximal zwei weitere Vege-tationstypen angegeben werden, mit deranalogen Codierung und Deckungsan-gabe wie bei der dominierenden Vege-tation. Damit ist eine Biodiversität derTeilobjektfläche dokumentiert, die in dieBewertung einfliesst. Wenn viele Begleit-vegetationen vorliegen, sind die natur-schützerisch wertvollsten Vegetations-typen vorzuziehen. Aus pragmatischenGründen sollte die von jeder Begleitve-getation eingenommene Fläche nichtkleiner als 1 Are sein.
Summe der VegetationstypenDa innerhalb des Teilobjektes nochEinschlüsse vorkommen können, mussdie Summe der Vegetationstypen nicht100% ergeben! Im weiteren kann die
DIF
Summe der Vegetationstypen grössersein, als die Summe der protokolliertenVegetationstypen, da sie auch die nichtprotokollierten Begleitvegetationen bein-haltet. In diesem Falle muss eine Bemer-kung gemacht werden, mit Hinweisen aufweitere Vegetationstypen.
Vegetationsparameter im INT
Im Gegensatz zur Methode DIF ist hier dieVegetation kein Einheitsflächenkriterium,es wird daher nicht zwischen dominie-render und begleitender Vegetation un-terschieden. Es können bis zu 6 Vege-tationstypen ins Formular eingetragenwerden. Der erste eingetragene Vegeta-tionstyp (Vegetationstyp 1) sollte mit derTestfläche übereinstimmen. Andernfallsist eine Bemerkung anzubringen. Zujedem Vegetationstyp wird auch diegeschätzte Deckung, wenn möglich auf5% genau, angegeben und zum Fläch-entotal aufgerechnet.
Als Minimalfläche für die Berücksichti-gung eines Vegetationstyps werden auspragmatischen Gründen 10 Aren vorge-geben.
Wenn mehr als 6 Vegetationstypen imTeilobjekt vorgefunden werden, so istdie Summe aller Vegetationstypen INTgrösser als die Summe der 6 angegebe-nen Vegetationstypen. Es sollten wennmöglich die wertvollsten Vegetations-typen angegeben werden.
Vegetationsbeurteilungaus Distanz
Im Bereich beider Methoden ist es mög-lich, dass aus Sicherheitsgründen dasTeilobjekt nicht begangen werden kann.Laut dem ersten Schwellenkriterium istes in diesem Fall generell nicht erlaubt,das Teilobjekt aufzunehmen (Kap. 3.7.7).Mit genügender Erfahrung ist es aller-dings erlaubt, leicht erkennbare Vegeta-tionstypen allein mit Luftbild und An-
INT
schauung im Gelände auch aus Distanzzu beurteilen. Für kritische Gesellschaften(z.B. artenarme Nardeten) sollte nie eineVegetationsbeurteilung aus Distanz er-folgen.
Beispiele:FVFP: Goldschwingelrasen im TessinCFCF: Bunte Rostseggenhalden
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 125

NOTIEREN VON SELTENEN PFLANZENARTEN IM PROTOKOLLBLATT
BEISPIELE SELTENER PFLANZEN
NOTIEREN VON SELTENEN TIERARTEN ALS BEMERKUNG
Eine bemerkenswerte faunistische Beobachtung,die in der Teilobjektfläche oder in derenunmittelbaren Umgebung gemacht wurde,kann als Bemerkung zu den Strukturenangegeben werden.
Limodorum abortivum Geranium pratense Ajuga chamaepitys
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE126
seltene Arten
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 126

1275 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.2 SELTENE ARTEN
Selten gewordene Vegetationstypen wieFeucht- oder Trockenwiesen enthaltenseltene Arten. Mit dem Schutz dieserLebensräume wird indirekt auch einSchutz einzelner Arten erreicht. Es istdarum sinnvoll, Informationen über dasVorkommen von seltenen Arten zurBewertung und Umsetzung der Teilob-jekte zu sammeln. Dieses Vorgehen istaber mit einigen Schwierigkeiten verbun-den: Seltene Pflanzen wachsen nichtzwingend in der Testfläche; seltene Pflan-zen und Tiere werden leicht übersehen,sind nicht immer auffällig oder erkennbar,manche Pflanzen entwickeln nicht jedesJahr Blätter und Blüten. So ist zwar einfestgestelltes Vorkommen ein Hinweis fürdie Umsetzung. Wird aber eine Art wäh-rend der Feldarbeit nicht gesehen, so be-deutet dies noch lange nicht, dass sieauch wirklich im Teilobjekt fehlt. Es wäreviel zu aufwendig, das Teilobjekt mit zu-friedenstellender Zuverlässigkeit nachseltenen Arten abzusuchen. Die Informa-tion ist somit auch nicht konsistent ge-nug, um sie für die Bewertung zu ver-wenden.
Anm.: In der Bewertung wird anstelle der
seltenen Arten das floristische Potenzial
verwendet. (Kap. 8.5.1).
Seltene PflanzenTrotz dieser Einschränkung ist es sinn-voll, angetroffene seltene Arten zu notie-ren. Es gelten diejenigen Arten als selten,die in der Roten Liste nach Landolt (1991)für die jeweilige Region als selten (R), ge-fährdet (V), stark gefährdet (E) oder ge-schützt (A) angegeben sind. Es müssennur seltene Pflanzen zusätzlich notiertwerden, die ausserhalb der Testflächewachsen. Für sie ist ein Teil der Listen aufdem Protokollblatt reserviert. Die Namender gefundenen Pflanzen werden analogzu den zusätzlichen Begleitarten angege-ben (Kap. 5.1.4). Zusätzlich wird die Ab-undanz in zwei Stufen grob geschätzt:kleine, nur aus wenigen Individuen be-
stehende Populationen (+) werden vongut ausgebildeten Populationen (2) un-terschieden.
Merkblatt zum Vorkommenvon seltenen ArtenWelche Pflanzenarten in einem Kartierge-biet nach der Roten Liste als gefährdet,geschützt oder selten gelten, sind einemMerkblatt zu entnehmen.
Seltene TiereZum Erkennen von seltenen Tieren wer-den die Kartierleute nicht speziell aus-gebildet. Wenn aufgrund persönlichenWissens seltene, lebensraumtypischeTierarten beobachtet werden, so ist eineBemerkung bei den Einschlüssen anzu-geben.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 127

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE128
Verbuschungsgrad ca. 30 %Verbuschungsklasse C
Verbuschungsgrad ca. 10%Verbuschungsklasse B
Verbuschungsgrad < 3%Verbuschungsklasse A
Verbuschungsgrad über 50%wird nicht kartiert.
DIE VERBUSCHUNG IM LUFTBILD
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 128

1295 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.3 VERBUSCHUNG
5.3.1 Angabe der Verbuschung
In Trockenweiden und Brachen kann oftein randliches oder inselartiges Aufkom-men von jungen Gehölzen beobachtetwerden. Dies zeigt, wie stark die Weidenund Brachen dem natürlichen Prozess derWiederbewaldung ausgesetzt sind. Inter-essant ist dabei das Phänomen, dass ei-ne leichte Verbuschung zunächst die Ar-tenvielfalt fördert, dass bei zunehmenderVerdichtung (ca. ab 20% Deckung) dielichtliebenden Arten der Trockenweidenaber durch die kräftigere Konkurrenz starkzurückgehen. Aus der Sicht maximalerBiodiversität ist daher eine Durchsetzungder Weide mit Gehölzarten durchaus be-grüssenswert. Eine Verbuschung zwi-schen 3 und 20% gilt als optimal.
UnterschiedlicheVerbuschung abgrenzenIn der Umsetzung ist es möglicherweiseerwünscht, zu starke oder mangelndeVerbuschung durch Anreize zu verän-dern. Es ist daher sinnvoll, Flächen mitunterschiedlichem Verbuschungsgrad alsgetrennte Teilobjekte festzuhalten. Nachder Methode DIF ist Verbuschung einGrenzgebungskriterium. In der verein-fachten Methode INT werden hingegenFlächen mit unterschiedlichen Verbu-schungsgraden nicht abgegrenzt.
VerbuschungsgradSträucher im Teilobjekt werden dann alsVerbuschung angesprochen, wenn sienicht als geschlossene Fläche auftreten,sondern mehr oder weniger regelmässigüber mindestens einen Teil der Flächeverteilt sind. Die Verbuschung ist dann einTeil der Trockenwiesenvegetation und hatkeinen Flächenabzug zur Folge bzw. erwird nicht als Einschluss notiert. Der Gradder Verbuschung wird in drei Klassen(A, B, C) angegeben:A 0-3 %,B 3-20 %,C über 20 %
Folgende Holzgewächse werden in dieAbschätzung des Verbuschungsgradeseinbezogen:
• Baumarten (bis 5 m Wuchshöhe)• Straucharten (bis 5 m Wuchshöhe)• Grössere Zwergsträucher• Artengruppe ZS (nur, wenn die Arten in
der oberen Feldschicht vorkommen)
Strauchgruppen und Heckenals Einschluss angebenWenn die Holzarten grösser als 5 m sind,oder in abgrenzbaren Gruppen vorkom-men (und so eine “Innenfläche” bilden), sosind sie als Einschluss und nicht als Ver-buschung anzusprechen. Wenn keineeindeutige Unterscheidung zwischenechter Verbuschung und echtem Ge-büsch-Einschluss gemacht werden kann,so können die Sträucher sowohl alsVerbuschung wie auch als Einschluss an-gegeben werden.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 129

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE130
DIE WICHTIGSTEN VERBUSCHUNGSARTEN
Links: Feuchte Hänge der Nordalpenverbuschen mit Grünerle (Alnus viridis).
Rechts: Berberitze (Berberis vulgaris) ist nur introckenwarmen Gebieten häufig.
Links: Sehr aggressiv sind die Himbeere(Rubus idaeus) und andere Rubus-Arten.
Rechts: Im Umfeld von Fichtenwäldernsamt sich oft die Fichte (Picea abies) inWeiden an.
Links: Hundsrose (Rosa canina)und andere Rosa sp.
Rechts: Schwarzdorn (Prunus spinosa),mit unterirdischen Ausläufern.
Links: Die Espe (Populus tremula) ist einehäufige Verbuschungsart in den Inner- undSüdalpen.
Rechts: In den Südalpen häufigeVerbuschungsart: der Besenginster(Cytisus scoparius).
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 130

1315 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.3.2 Hauptart Verbuschung
Die verschiedenen Gehölze, die in Tro-ckenweiden und Brachen eindringen,sind unterschiedlich konkurrenzstark undaggressiv. Wenn die Verbuschung über3% beträgt (Verbuschungsgrad B oderC), sollte daher zusätzlich die wichtigsteVerbuschungsart notiert werden. Wennkeine Art dominiert, dann wird in das ent-sprechende Feld DI SP (= diverse Arten)notiert. Wenn die Arten vorwiegendZwergsträucher sind, dann wird ZZ ZZ(= Zwergsträucher, div. Arten) in das Feldeingetragen.
Eine Reihe von Gehölzarten ist auf einerAbkürzungsliste aufgeführt. Es gelten diefolgenden Codes:
AC SP Acer spec.AL VI Alnus viridisBE SP Betula spec.BE VU Berberis vulgarisCO AV Corylus avellanaCO SA Cornus sanguineaCR SP Crataegus spec.CY SC Cytisus scopariusFA SI Fagus silvaticaFR EX Fraxinus excelsiorHI RH Hippophae rhamnoidesIL AQ Ilex aquuifoliumJU SP Juniperus spec.LA DE Larix deciduaPI AB Picea abiesPI SP Pinus silvestris/mugoPO SP Populus spec.PO TR Populus tremulaPR SP Prunus spinosaRH SP Rhododendron spec.RO PS Robinia pseudoacaciaRO SP Rosa spec.RU SP Rubus spec.SA SP Salix spec.SO SP Sorbus spec.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 131

WEIDE
1 Hauptnutzungsform:Weide (Code E)Ergänzende Information zur Weide:Rinderweide (Code R)
2 Die Fläche scheint ungenutzt zu sein, könnteaber auch extensiv durch Schafe beweidetwerden.Es wird “Nutzung unsicher” protokolliertund eine Bemerkung angegeben.
WIESE
1 Die Fläche ist bei der Begehung schongemäht und eine spätere Begehung istdurch lange Anmarschwege ausgeschlossen.Die Fläche wird daher trotzdem kartiert und“nach Nutzung” wird protokolliert.
2 Umsetzungshinweise sind unbedingtfestzuhalten.Hier z.B. zunehmende Verbuschungund Verbrachung vomWaldrand her.
3 “Pufferzone notwendig” protokollieren,da aus benachbarten, intensiv bewirt-schafteten Flächen starker Nährstoffeintragzu erwarten ist.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE132
1
2
2
1
3
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 132

1335 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.4 NUTZUNG
5.4.1 Allgemeines
Die Nutzung ist nicht nur ein wichtigerHinweis für die Umsetzung. Sie spieltauch bei der Festlegung der Minimal-fläche, als Angabe für die Bewertung unddie Erfolgskontrolle eine Rolle. Deshalbwird die Nutzungsform so genau wiemöglich erfasst und gegebenenfallsdurch Bemerkungen ergänzt.
Die Nutzung kann in zwei Stufen ange-geben werden. Die erste, obligatorischanzugebende Stufe ist die “Haupt-nutzungsform”. Hier wird unterschiedenzwischen Wiesen, Weiden und Brachen.
Wenn die Nutzungsform noch etwasdetaillierter angegeben werden kann,stehen Codes zur Verfügung, um Ergän-zungen zur Hauptnutzungsform anzu-bringen. Wenn aber die Hauptnutzungnicht näher beschrieben werden kann, soist das Feld “Ergänzung” leer zu lassen.
Für den Eintrag in das Protokollblatt wer-den Buchstabencodes verwendet.
Nutzung unsicherDieses Feld wird angekreuzt, wenn dieNutzungszuordnung fraglich ist. In die-sem Fall sollte eine Bemerkung ange-bracht werden.
Nach Nutzung aufgenommenWenn die Aufnahme nach der erstenNutzung erfolgt, so ist “J” anzukreuzen.Das ist ein wichtiger Hinweis, dass dieErstellung der Artenliste und evtl. auchdas Bestimmen des Vegetationstyps mitUnsicherheiten verknüpft war.
UmsetzungshinweisEs ist für die Umsetzung äusserst hilf-reich, wenn schon während der Kar-tierungen Hinweise notiert werden, mitwelchen Massnahmen das Teilobjekterhalten oder verbessert werden kann.
In Form von Bemerkungen können bei-spielsweise folgende Hinweise notiertwerden: “Pufferzone notwendig”.Angeben, wenn zur Erhaltung der Ve-getation eine Pufferzone notwendig ist(meist am oberen Rand des Teilobjektes).Dies ist der Fall, wenn durch Einflüsse ausbenachbarten Flächen das Teilobjekt anWert verlieren könnte. Beispiele sind:benachbarte Düngung, Einsatz von Pes-tiziden, Beschattung, usw. Es ist auchwichtig anzugeben, bei welchen Grenz-abschnitten Pufferzonen notwendig sind.
“Verbuschungsgefahr im Rand-bereich”. Bei ungenügender Nutzungoder Pflege dringen oft Gehölze randlichin die Fläche ein.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 133

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE134
ERKENNEN VON NUTZUNGSTYPEN
Wiesen:
Links: Heuseile führen zuhochgelegenen Wiesenflächen.
Links: Tritte in der Grasnarbe weisenebenfalls auf Weidenutzung hin.
Rechts: In stark geneigten Hängenentstehen Viehtreppen.
Weiden:
Rechts: Kuhfladen und andere Kotspurensind wichtige Nutzungshinweise.
Links: Zäune können auf Trennungenzwischen Wiesen und Weiden hinweisen.
Rechts: Heuställe zeigen Wiesennutzungenin höheren Lagen an.
Links:Weiden haben meist eininhomogenes Vegetationsmosaik.
Rechts: Kuhfladen hinterlassen “Geilstellen”,verschmähte Grasflecken. Weiden sind oftmit typischen Weideunkräuter durchsetzt.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 134

1355 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.4.2 Beschreibungder Nutzungstypen
Für jedes Teilobjekt wird die Nutzung aufdem Protokollblatt notiert. Es wird zwi-schen Hauptnutzungstypen (Code I, E,B, A) und fakultativ anzugebenden Un-tertypen (Ergänzungen) unterschieden.Die vier Hauptnutzungstypen werden imFolgenden beschrieben.
Wiese oder Mähweide (Code: I)
Grünland gilt als Wiese oder Mähweide,wenn es regelmässig gemäht wird. DieAbstände der Mahd können auch grösserals ein Jahr sein, was insbesondere inden hohen Lagen oft der Fall ist. Hinweisefür Mähnutzung:
• Zäune gegen das Weideland• Heuseile• Heustadel• kleinere Parzellen• Zwergstraucharten nur im
Unterwuchs• keine oder nur ganz junge Sträucher
im Bestand• regelmässige,
homogene Vegetationsstruktur• Vegetation geschlossen, nicht lückig• ohne Hindernisse,
die eine Mahd verunmöglichen
Ergänzungen:
Wildheu (Code: W)Wiesennutzung ausserhalb der landwirt-schaftlichen Nutzfläche, d.h. oberhalbder Sömmerungslinie (Alpstufe).
Wiese mit Vorweide (Code: V)Aufgrund von Direktbeobachtungen vonTieren oder Weidespuren (s. unten) imWiesland kann auf eine Vorweide ge-schlossen werden. Eine Vorweidenut-zung ist meist nicht einfach und mitSicherheit zu erkennen.
Weide (Code: E)
Grünland, das regelmässig mit Tierenbestossen wird, aber nur gelegentlich zurPflege gemäht wird, ist als Weide zunotieren. Neben der Direktbeobachtungvon Tieren weisen folgende Spuren aufeine Weidenutzung hin:
• Weidezäune• Kotspuren, Kuhfladen• Weidetritte• Kuhtreppen im Hang• Gelände begehbar für Tiere• Alpställe• Vegetation unregelmässig strukturiert• typische Weidepflanzen
(Weidezeiger) vorhanden
Ergänzungen:
Rinderweide (Code: R)Die Weide wird vorwiegend durch Rinderbestossen. Entsprechend finden sichTrittspuren von Rindern und Kuhfladen.
Schafweide (Code: S)Die Weide wird nur von Schafen bestos-sen. Meist zu magere, zu steile oder zuabgelegene Standorte für Rinderweiden.Schafspuren vorhanden.
Pferdeweide (Code: P)Die Weide wird von Pferden bestossen.Die Vegetation ist sehr kurz und re-gelmässig abgeweidet. Hufspuren undPferdeäpfel vorhanden.
Brache (Code: B)
Nicht oder nicht mehr regelmässig ge-nutztes Grünland, das Spuren der Ver-brachung zeigt. Hier eingeschlossen istauch natürliches, nicht genutztes Grün-land wie Felsensteppen, Moor- und La-winenhang-Rasen.
Die fehlende Nutzung lässt sich an fol-genden Spuren ablesen:
• Aufwuchs von Sträuchern oderJungbäumen
• Brachezeiger• für Tiere kaum begehbares Gelände
(Felsen, Blockschutt)• keine Mäh- oder Weidespuren
Ergänzungen:
Ehemalige Wiese (Code: I)Frühere Mähnutzung ist in Erfahrung ge-bracht worden oder ist sehr wahrschein-lich. Spuren früherer Wiesennutzung sinderkennbar.
Ehemalige Weide (Code: E)Frühere Weidenutzung ist in Erfahrung ge-bracht worden oder ist sehr wahrschein-lich. Spuren früherer Weidenutzung sinderkennbar.
Ehemalige Kulturfläche (Code: K)Trockene, halbruderale Vegetation wächstauf ehemaligen Acker- oder Weinbauflä-chen.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 135

PROBLEMATISCHENUTZUNGSANSPRACHE
Vor allem in höheren Lagen, in schwerzugänglichem Gelände, stellt sich oft die Frage,ob die Grünflächen überhaupt noch genutztwerden. Verbrachende Flächen zeigen eineZunahme von grossen Doldenblütlern,Saumarten (Artengruppen OR1 und OR2)und eine mehr oder weniger rascheVerbuschung.
Ausfüllen des Protokollblattesbei Unsicherheiten
Im Zweifelsfalle ist die wahrscheinlichsteNutzung anzugeben.
Das Feld Nutzung unsicher wird angekreuzt.
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE136
I x
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 136

1375 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.4.3 SchwierigeNutzungsansprache
Andere Nutzung (Code: A)Die Nutzungsform lässt sich weder denWiesen, Mähweiden noch den Weidenzuordnen und ist auch nicht als Bracheanzusprechen. Wenn immer möglich soll-te mit einer Bemerkung Nutzung an-gegeben werden, um welche Form derNutzung es sich handelt und die Kartier-leitung sollte informiert werden.
ProblematischeNutzungsanspracheDas grösste Problem bei der Nutzungs-ansprache ist die Entscheidung überBrache oder Nutzung, insbesondereoberhalb der Sömmerungslinie, wo dieseEntscheidung nach der INT-Methodeüber Aufnehmen oder Verwerfen ent-scheidet. Weiden, v.a. solche für Schafe,kommen noch in den unglaublichstenSituationen vor und es ist wichtig, stetsnach Weidespuren Ausschau zu halten.Hinweise auf Nutzungsformen könnenaus verschiedenen Quellen gewonnenwerden:
• Vor dem Beginn der Kartierung in einerRegion sollten Lokalkennerinnen und-kenner mit einer Karte befragt werden(z.B. Ackerbaustellenleiter).
• Während der Kartierung angetroffeneLandwirte können Auskunft geben.
• In vielen Fällen lassen sich auch durchFarbänderungen im Gelände oder imLuftbild Nutzungsgrenzen erkennen.
Probleme bietet manchmal auch dieUnterscheidung von Wiesen und Weidenim Berggebiet. Im Zweifelsfall ist für dieintensivere Nutzungsform zu entscheiden(z.B. Mähweide statt Dauerweide).
Nutzungsanspracheunmöglich oder unsicher
• Wenn die Hauptnutzung selbst nichtnäher beschrieben werden kann, so istdas Feld Ergänzung leer zu lassen.
• Wenn auch die Hauptnutzung nichtsicher angesprochen werden kann, soist im Protokollblatt das Feld Nutzungunsicher anzukreuzen und es ist eineBemerkung anzubringen.
• Im Zweifelsfalle soll man sich für eineNutzung und gegen eine Brache ent-scheiden.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 137

GRÜNFLÄCHE MIT STRUKTUREN
Beispiele von Einschlüssen
1 Steinhaufen mit Brennesseln2 Felsflächen3 Vernässungen4 Kleiner Bachlauf ohne Ufervegetation5 Einzelbaum
Beispiele von Grenzelementen
6 Artenreiche Hecke7 Feldgehölz8 Trockenmauer9 Waldrand mit deutlichem Mantel
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE138
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 138

1395 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.5 STRUKTURELEMENTE
5.5.1 Strukturelemente alsLebensraum für Tiere
Das Projekt der Erstellung einer nationa-len Übersicht über die Lebensräume derTrockenwiesen sowie eines Inventars dertrockenen und wechselfeuchten Wiesenund Weiden basiert grundsätzlich auf derErhebung der Vegetation. FaunistischeAspekte können in der Phase der Erster-hebung nicht direkt erfasst werden. Dabekannt ist, dass die Trockenwiesen und-weiden ein wichtiges Habitat für ver-schiedene gefährdete Tierarten darstel-len, hat eine Expertengruppe mit Ver-tretern verschiedener Tiergruppen denAuftrag erhalten, eine Methode zur Erfas-sung des faunistischen Potenzials zu er-arbeiten. Unter Faunapotenzial wird dieMöglichkeit des Vorkommens von lebens-raumtypischen, seltenen, geschütztenoder gefährdeten Tierarten verstanden.
Methodischer AnsatzDas Faunapotenzial wird aufgrund vonStrukturen und Vernetzungen beschrie-ben. Struktur- und Vernetzungsaspektewerden einerseits quantitativ (Vielfalt anElementen, Ausdehnung der Einschlüsseund Grenzelemente), andererseits qua-litativ (Skizzen Lebensraumvernetzung)erfasst.
Die entlang der Grenzlinie des Teilobjek-tes vorkommenden Grenzelemente wer-den gemäss der auf dem Protokollblattaufgeführten Lebensräume quantitativ(anhand einer angepassten Braun-Blan-quet-Skala) erfasst. Die selektive Listeumfasst diejenigen Lebensräume, vondenen man aufgrund des heutigen Wis-sens annimmt, dass sie einen wichtigenpositiven Einfluss auf das Faunapotenzialhaben.
Analog zu den Grenzelementen werdenauch die Einschlüsse innerhalb der Teil-objekte erhoben. Durch das Erfassen derflächig auftretenden Fremdvegetation
und sonstiger Einschlüsse kann die beianderen Kartiermethoden verwendeteKategorie “Übriges” vermieden werden.
Bei der Bewertung tragen ausgewählteGrenzelemente und Einschlüsse mit ei-nem Bonussystem zur Aufwertung derObjekte bei. Dank dieser differenziertenErhebung kann zudem nach Abschlussder Kartierung auch eine Übersicht überdie Verbreitung und die Häufigkeit ein-zelner Grenzelemente und Einschlüsseerstellt werden.
Der qualitative Aspekt der Lebensraum-vernetzung in der Umgebung wird durchdie Angabe des Vernetzungstyps erfasst.
ErfassungsgenauigkeitZur Erfassung der Einschlüsse undGrenzelemente und damit auch desFaunapotenzials sind pro Teilobjekt rund10 Minuten vorgesehen.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 139

EINSCHLÜSSE
a Punktförmiger Einschluss (z.B. Einzelbaum)
b Unter dem Baum ist Schlüsselvegetation.Die Überdeckung wird doppelt gezählt,einmal als Vegetation, einmal als Einschluss.
c Flächiger Einschluss (z.B. Fettweide) mitca. 20% Deckungsanteil.
Erfassungsskala
GRENZELEMENTE
d Grenzelemente grenzen unmittelbar an dasTeilobjekt an.
e Bei unmittelbar am Teilobjekt liegendenWegen und Strassen wird der dahinter-liegende Lebensraum als Grenzelementbezeichnet.
f Flächige Grenzelemente müssen mindestens10 m der Grenzlinie einnehmen.
g Grenzelemente zwischen zwei Teilobjektenwerden in beiden Teilobjekten angegeben.
Erfassungsskala
Einschlüsse
1 vorhanden bis 5 %2 5 - 25 %3 25 - 50 %
Grenzelemente
1 10 m - 5 %2 5 - 25 %3 25 - 50 %4 50 - 75 %5 75 - 100 %
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE140
a
b
c
f
e
g
d
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 140

1415 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.5.2 Definition derStrukturelemente
Allgemeines zuden Einschlüssen
DefinitionEin Einschluss ist ein flächig oder punkt-förmig auftretendes Strukturelementinnerhalb der Teilobjektfläche. Dieses Ele-ment kann abiotisch (Gebäude, Trocken-mauer) oder biotisch (Baum, bestimmterVegetationstyp) sein. Wenn es sich um ei-nen Vegetationstyp handelt, so muss esFremdvegetation sein, d.h. dass der Typmit dem Vegetationsschlüssel nicht er-fasst wird.
MinimalgrösseFür die Minimalgrösse eines Einschlus-ses gibt es keine direkte Vorgabe. Ein-schlüsse müssen aber beim Abschreitendes Teilobjektes aus 20m Distanz sicht-bar sein, um das flächige Abschreiten zuvermeiden.
MaximalgrösseNach dem Schwellenschlüssel darf dieSumme aller Einschlüsse 75% der Flächenicht überschreiten. Zudem darf die Sum-me der Fremdvegetationsflächen nichtmehr als 50% der vegetationsbedecktenFläche betragen. Da es bei einzelnenBäumen oft eine Überdeckung derSchlüsselvegetation gibt, ist doppelt ge-zählte Deckung möglich. So kann auchdie Summe aller Einschlüsse und Schlüs-selvegetationen mehr als 100% betragen.
ErfassungsskalaEs gibt Einschlüsse, bei denen die Anga-be ihres Vorhandenseins genügt. Sie sindauf dem Protokollblatt bei Vorhandenseinanzukreuzen (diese Felder sind auf demProtokollblatt mit einem Punkt markiert).Die meisten Einschlüsse werden aberhalbquantitativ, mit einer dreistufigenSkala erfasst.
Allgemeines zuden Grenzelementen
DefinitionEin Grenzelement ist ein lineares oderflächiges Strukturelement, das unmittel-bar an das TWW-Teilobjekt angrenzt.Meist ist es ein Lebensraum wie Wald, dieFortsetzung des Grünlandes, ein Flussoder eine Hecke. Falls das unmittelbareGrenzelement ein Pfad, ein Weg oder ei-ne Strasse mit Naturbelag ist, wird derdahinterliegende Lebensraum als Grenz-element bezeichnet.
Wann wird ein Grenzelementnicht angegeben?Es werden nur Strukturelemente angege-ben, die in der vorgegebenen Liste aufdem Protokollblatt stehen. NamentlichAckerflächen, Kunstwiesen und Kunstra-sen werden nicht angegeben. Angren-zende Teilobjekte werden nicht als Grenz-element angegeben, da sie aus der Digi-talisierung der Perimeter abgeleitetwerden können. Oft muss aus einemGrenzelement der für Tiere effektiv vor-handene Lebensraum herausgelesenwerden.
Doppelte GrenzelementeIn Situationen, bei denen Elemente (z.B.Hecke, Trockenmauer etc.) zwischenzwei aneinandergrenzenden Teilobjektenliegen, werden die betreffenden Grenz-elemente bei beiden Teilobjekten ange-geben.
MinimallängeGrenzelemente müssen mindestens 10 mder Grenzlinie einnehmen. Ausnahme:Hecken werden immer erfasst, auchwenn sie senkrecht zur Grenzlinie stehen.
ErfassungsskalaDer Anteil des jeweiligen Grenzelementesan der Grenzlinie wird in Prozenten ge-mäss einer vorgegebenen fünfteiligenSkala angegeben, wobei 100% immerder gesamten Teilobjekt-Grenze (inkl. dergemeinsamen Grenze mit angrenzendenTeilobjekten) entspricht.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 141

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE142
Bach mit ausgeprägter Ufervegetation Bach ohne ausgeprägte Ufervegetation Unbewohntes Gebäude
Dauergrünland Humusreiche Ruderalvegetation Humusarme Ruderalvegetation
Schilfröhricht Kleinseggenried(anderer Flachmoortyp)
QuellaufstossVernässung
STRUKTURELEMENTE
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 142

1435 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
• Lückige Trittpflanzenfluren(Plantaginetea)
• Steinklee-Ruderalfluren(Dauco-Melilotion)
Anderer FlachmoortypUmfasst alle Flachmoortypen mit Aus-nahme von Filipendulion und Schilfröh-richten
• Zwischenmoore und Schlenken(Scheuchzerietalia)
• Grosseggenriede (Magnocaricion)• Pfeifengraswiesen (Molinion)• Kleinseggenriede (Caricion
davallianae und Caricion nigrae)• Nährstoffreiche Nasswiesen
(Calthion).
Fliessgewässer mitausgeprägter UfervegetationDie Ufervegetation bildet praktisch eindurchgehendes Band entlang der Was-serlinie. Wenn eine Trockenwiese an einGewässer mit Ufervegetation grenzt, dannist als Grenzelement nicht die Ufer-Hoch-staudenflur, sondern das Gewässer mitausgeprägter Ufervegetation aufzuführen.
Quellaufstoss, VernässungUmfasst Riesel- und Quellfluren oder Ver-nässungen mit zeitweisem Auftreten vonWasser an der Bodenoberfläche. Häufigsind hier kleinere oder grössere Binsen-bestände anzutreffen.
Natursteinmauer, Ruine,offener Lesesteinhaufen,DrahtschottergeflechtMassgebend ist das Vorkommen von be-sonnten Steinflächen für Reptilien. DieLesesteinhaufen dürfen deshalb nichtvöllig von Vegetation überdeckt sein.
Unbewohntes GebäudeGebäude, welches nur zeitweise genutztwird und nicht als Wohnraum dient (Stall,Heustadel, Geräteschuppen, etc.).
5.5.3 Beschreibung derEinschlüsse undGrenzelemente
Allgemeine AnleitungDie Erfassung der Einschlüsse undGrenzelemente verlangt ein systemati-sches Vorgehen und eine gewisse Dis-ziplin. Ein unsorgfältiges Ausfüllen odereigenmächtiges Vernachlässigen der Pa-rameter gefährdet die gesamte Arbeit aufdiesem Sektor. Beim Vorkommen vonmehreren Elementen am selben Ort sindDoppelnennungen möglich, z.B. Terrasseund Trockensteinmauer.
Dauergrünland“Dauergrünland” beinhaltet Dauergrün-land, welches nicht aus Trockenvegeta-tion gemäss Vegetationsschlüssel be-steht (z.B. artenreiche Fettwiese). Nichterfasst werden hier:
• Kunstwiesen bzw. Kunstweiden(angesätes Grünland in derFruchtfolge)
• Trockenwiesen und -weiden(d.h. andere Teilobjekte)
• Flachmoore, Streuwiesen(unter “Flachmoore” angeben).
Hochstauden undhumusreiche RuderalvegetationUmfasst sämtliche mesophilen Hochstau-denfluren (z.B. Artengruppen AD, OR2)und Ruderalgesellschaften auf humusrei-chem Untergrund (z.B. Artengruppe AV);sowohl kurzlebige Übergangsstadien, alsauch nährstoffreiche Dauergesellschaften.Für diesen Typ ist in erster Linie die Struk-tur der Hochstauden und nicht die Sozio-logie massgebend. Beispielsweise wirdeine Vegetation des Typs Filipenduliondieser Kategorie zugeordnet, und nichtder Kategorie der Flachmoortypen. An-dere Beispiele sind Brennnesselfluren,Aconitum-Bestände, Distelfluren.
Ruderalvegetation humusarmUmfasst Ruderalfluren auf trockenem,magerem Boden, oft mit zahlreichenHochstauden.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:52 Page 143

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE144
Einzelbäume Hochstammobstgarten Artenreiche Mittelhecke
Feldgehölz Waldrand ohne Mantel Waldrand mit Mantel und Saum
STRUKTURELEMENTE
Natursteinmauer Offener Lesesteinhaufen Rain
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 144

1455 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
Terrasse, RainBöschung, Feldrain, terrassiertes Gelän-de, Abwechseln von Rainen/Mauern undausgeebnetem Gelände, oftmals früherals Acker genutzt (Wallis, Tessin, Rheintal,Graubünden). Entscheidend sind sicht-bare Unterschiede zwischen Terrassen-kante bzw. Rainkante und den übrigenFlächen.
Hochstammobstgarten,Allee, Baumhain, Selve(Kastanienhain)Es müssen mindestens 10 Bäume in ei-ner Gruppe oder Linie vorhanden sein.Die Gruppe bzw. Linie muss nicht voll-ständig im Teilobjekt liegen.
BäumeDer Parameter “Bäume” ist ein wichtigerFaktor bei Waldweiden. Bäume als Struk-turelement unterscheiden sich von derVerbuschung durch ihre Höhe (> 5 m),von Baumhecke und Feldgehölz durcheine nicht geschlossene Bestandesstruk-tur (keine Waldvegetation).
HeckenWir unterscheiden zwischen artenarmenund artenreichen Hecken.
• arm: mindestens 90% der Ausdeh-nung wird von 1-3 Arten gebildet(in 10% der Länge können auch mehrArten vorkommen).
• reich: mehr als 3 Arten
FeldgehölzeFeldgehölze werden von Wäldern unter-schieden, wenn der Baumbestand eineBreite von weniger als 20 m aufweist undes damit möglich wird, “durch die Bäumehindurchzusehen“.
WaldrandWaldränder können nur als Grenzelemen-te aufgeführt werden, da innerhalb der Teil-objekte keine Waldflächen auftreten kön-nen. Für die Ansprache des Waldrandtyps(Nadel-, Laub-, Mischwald) sind die erstenbeiden Baumreihen massgebend.
• Nadelwald: Mehr als 80% der Bäumesind Nadelbäume.
• Laubwald: Mehr als 80% der Bäumesind Laubbäume.
• Mischwald: Weder Laub- noch Nadel-bäume machen mehr als 80% bzw.weniger als 20 % aus.
Waldrand mit deutlichausgeprägtem MantelDie Strauchschicht ist geschlossen undverdeckt bis in eine Höhe von mind. 3 mden Blick auf die erste Baumreihe. In dersubalpinen Stufe (Nadelwaldzone) gilt alsMantel nur, was aus mindestens zwei Ge-hölzarten besteht.
Waldrand mit deutlichausgeprägtem Mantel und SaumEin Saum ist vorhanden, wenn zwischenWaldmantel und dem Grünland ein Strei-fen sichtbar anderer Vegetation mit meisthochwüchsigen und grossblättrigenKräutern besteht. Die Saumvegetationmuss eine Breite von mindestens 1 maufweisen. Der Waldrand mit Mantel undSaum ist auch dann als Grenzelementanzugeben, wenn die Saumgesellschaftbereits bei den Vegetationsparameternals Begleitvegetation aufgeführt wurde(z.B. als MBOR)
Faunistische BeobachtungenWenn faunistische Beobachtungen ge-macht werden (z.B. seltene Tierarten), sosind diese unter Bemerkung Einschlüsseaufzuführen.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 145

5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE146
Grad 1: Die Kulturlandschaft ist ziemlich ausgeräumt, die meisten Flächensind intensiv bewirtschaftet. Das dichte Wegnetz und die Siedlungsnähewirken negativ auf die Vernetzung.
Grad 2: Die Kulturlandschaft ist von relativ intensiver Landwirtschaftgeprägt. Sie weist aber grössere, unter sich vernetzte Waldflächen auf undes hat keine grösseren Strassen und/oder Siedlungsflächen.
Grad 3: Neben relativ intensiven Kulturlandflächen besitzt die LandschaftWälder, Hecken und ein natürliches Gewässernetz. Es hat keine grösserenStrassen und Siedlungen. Die Kiesgrube wirkt sich eher positiv aus.
Grad 4: Die höchstens extensiv bewirtschafteten Flächen sind reichstrukturiert, von Felsen,Wäldern, Hecken und Einzelbäumen durchzogen.Ein natürliches Gewässernetz ist vorhanden.
BEISPIELE ZU DEN VIER VERNETZUNGSGRADEN IM LUFTBILD
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 146

1475 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.6 VERNETZUNG
Abschätzen desVernetzungsgradesFür die Beurteilung des Vernetzungsgra-des ist nicht das unmittelbare Umfeld desTeilobjektes wie bei den Grenzelementen,sondern dessen weiteres Umfeld mass-gebend. Als Richtgrösse gilt ein Umkreisvon 500 m.
Wir haben drei Grundlagen zum Ab-schätzen des Vernetzungsgrades:
• Luftbild• Karte• Gesichtsfeld (evtl. muss eine erhöhte
Stelle aufgesucht werden)
Vier VernetzungsgradeAuf dem Protokollblatt werden vier ver-schiedene Vernetzungsgrade zum An-kreuzen unterschieden. Sie sind zeichne-risch, als Musterlandschaften dargestellt,in denen sich das Teilobjekt befindenkönnte. Es wird die entsprechende Land-schaftstyp-Skizze angekreuzt. Es kannnur ein Typ angekreuzt werden.
Beschreibung zu den Skizzen:
Grad 1:Ausgeräumte LandschaftLandschaft ohne naturnahe Elemente,maximal ein isoliertes Vorkommen einesnaturnahen Elements im Umfeld.
Grad 2:Landschaft mit einzelnennaturnahen LebensräumenIsolierte naturnahe Lebensräume kom-men vor. Keine sichtbare Vernetzungdurch lineare Elemente.
Grad 3: Landschaftmit mittlerer VernetzungEs kommen mehrere naturnahe Lebens-raumtypen vor, die untereinander z.T. mit-einander verbunden sind. Lineare Vernet-zungselemente kommen vor (Hecken,Gewässer, Böschungen etc.).
Grad 4:Reich vernetzte LandschaftEs kommen mehrere naturnahe Lebens-raumtypen vor, die Verbindungen sindoptimal, resp. Distanzen zwischen denLebensräumen sind klein (<30m). DieTeilobjekte sind in ein Netz von anderennaturnahen Lebensräumen eingebettet.
Gleiche Werte innerhalb ObjektEs ist klar, dass in einer Landschaftskam-mer bzw. einem Landschaftstyp alle Teil-objekte den gleichen Lebensraumvernet-zungswert annehmen. Es ist daher nichtmöglich, dass die Teilobjekte desselbenObjektes verschiedene Vernetzungsgra-de aufweisen.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 147

MUSTER EINES PROTOKOLLBLATTS
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE148
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 148

1495 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.7 WEITEREPARAMETER
5.7.1 Das Protokollblatt
AllgemeinesFür jedes Teilobjekt ist ein Protokollblattauszufüllen. Mit diesem Formular wird derInhalt des Teilobjekts für Bewertung, Um-setzung und Wirkungskontrolle erfasst.Auf diese Weise sind die wichtigsten An-gaben zum Teilobjekt zusammengefasstund können später in die Datenbank ein-gegeben werden. Das Protokollblatt istein wichtiges Grundlagendokument derFeldarbeit.
Die zu erhebenden Parameter, welche dieQualität des Teilobjekts beschreiben, las-sen sich in sieben Gruppen gliedern:
• Zeit und Lage• Vegetation• Verbuschung• Nutzung• Kantonales Objekt• Einschlüsse und Grenzelemente• Vernetzung• Wirkungskontrolle• Artenliste
FeldtypenDie Resultate der Aufnahme eines Teilob-jekts werden in die dafür vorgesehenenFelder geschrieben. Es gibt verschiedeneFeldtypen.
• Normales alphanumerisches Feld• Obligatorisches Feld (immer ausfüllen)• Fakultatives, logisches Feld zum An-
kreuzen• Obligatorisches, logisches Feld zum
Ankreuzen. Wird dieses Feld nicht an-gekreuzt, so erscheint bei der Eingabeeine Fehlermeldung.
• Zusatzfelder, die nicht digital erfasstwerden.
Die grafische Gestaltung der Felder zeigt,um welchen Feldtyp es sich handelt. Fel-der für Buchstaben und Felder für Zahlen
sind nicht unterschieden. Zahlen werdenstets mit vorangestellten Nullen eingetra-gen.
LesbarkeitDas Protokollblatt muss sauber und gutleserlich ausgefüllt werden, da es von an-deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternweiterverarbeitet wird. Wenn witterungs-bedingt die Lesbarkeit und Kopierbarkeitdes Feldoriginals beeinträchtigt ist, solltedas Protokollblatt ins Reine geschriebenwerden.
Digitale Erfassung der DatenAm Ende des Kartiertages werden dieDaten des Protokollblattes in vorbereite-te Masken einer Datenbank auf demComputer eingegeben. Bei fehlendenoder falschen Angaben erscheinen be-reits während der Eingabe Warnungen,was die Fehlerquote der Daten entschei-dend minimieren sollte.
Der Weg des ProtokollblattesDie Protokollblätter werden zusammenmit den Wochenrapporten nach jederKartierwoche an die Materialflussstellegesandt. Dort erfolgt eine weitere Fehler-kontrolle und das Material wird anschlies-send archiviert. Die digitalen Daten gehendirekt an die Datenverarbeitung.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 149

DIE LUFTBILD-ARCHIVNUMMERN
Übersichtskarte der Schweiz mit der Einteilung der Landeskarten 1:25’000
LISTE DER KARTIERPERSONEN (Bearbeiterinnen und Bearbeiter)
BEISPIEL EINER TEILOBJEKTNUMMER
Kartierperson: Uwe SailerTeilobjekt im Kanton Uri Laufnummer für Teilobjektevon Uwe Sailer im Kanton UR
UR 306 - 122
101 Marie Garnier102 Gaby Volkart103 Raymond Delarze104 Pierre Vollenweider105 Laurent Gognat106 Christine Gaffiot107 Guido Maspoli108 Juliette Harding109 Jacques Perritaz110 Jean-Bruno Wettstein111 Colette Gremaud112 Yvan Matthey
113 Saskia Godat201 Michael Dipner202 Monika Martin203 Guido Masé204 Andres Klein205 Reto Lehmann206 Esther Bäumler207 Martin Camenisch208 Nicolas Dussex209 Luc Lienhard210 André Matjaz211 Ursula Ott
212 Georg Schmid213 Eva Styner214 René Gilgen215 Sarah Münch301 Stefan Eggenberg302 Christian Hedinger303 Res Hofmann304 Danièle Wenger305 Fredy Leutert306 Uwe Sailer307 Claudia Huber308 Mary Leibundgut
309 Marc Spahr310 Marie-Chr. Kamke311 Beat Fischer312 Adrian Möhl313 Brigitte Holzer314 Olivier Duckert315 Remo Wenger401 Pia Giorgetti402 Maddalena Tognola501 Cornelia Mayer502 Martin Urech
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE150
Unterteilung desKartenblattes “1225Gruyères” in 16 Teile
Weitere Unterteilungin 8 Abschnitte
1225.43.8Archivnummer
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 150

1515 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.7.2 Zeit- und Lageparameter
DatumDatum der Aufnahme: Tag, Monat, Jahr.Nullen auch notieren, z.B. 15 05 94.
KantonAutokennzeichen des betreffenden Kan-tons. Der Kanton ist auf den Protokoll-blättern bereits aufgedruckt. Falls diesnicht der Fall ist, müssen die richtigenProtokollblätter verlangt werden.
Bearbeiterin/BearbeiterPersönliche Nummer der Kartierperson.Die Zuteilung der Nummern ist auf einemMerkblatt festgehalten, das zu Beginn derKartierung verteilt wird.
TeilobjektnummerLaufnummer des Teilobjektes. Die ein-deutige Identifikation eines Teilobjektes istdurch die Kombination aus (a) Kantons-kürzel, (b) Nummer der Kartierperson und(c) Teilobjektnummer gewährleistet. DieTeilobjektnummer muss sowohl auf derVorder- als auch auf der Rückseite desProtokollblattes angegeben werden.Beim Notieren der Nummer (auch aufPlan oder Luftbild) sollen Bindestricheverwendet werden (z.B. 301-48)
Jede Kartierperson beginnt in jedemneuen Kanton mit 00001 und verwendetaufsteigende Nummern. Bei einer übermehrere Jahre dauernden Kartierung imgleichen Kanton muss darauf geachtetwerden, dass nicht die gleiche Teilobjekt-nummer zweimal verwendet wird.
GemeindeNummer aus dem Verzeichnis desBundesamtes für Statistik. AlphabetischeListen mit den entsprechenden Num-mern sind als Merkblatt für jeden Kantonvorhanden.
Achtung:Teilobjekte dürfen nicht von Gemeinde-grenzen durchschnitten werden.
KoordinatenKilometerkoordinaten des schweizeri-schen Koordinatennetzes. Für jedes Teil-objekt müssen die Koordinaten grobangegeben werden, um eine Lokalisier-barkeit und Überprüfbarkeit zu gewähr-leisten. Als Koordinate ist die linke untereEcke des Quadratkilometer-Feldes zuverwenden, in dem sich das Teilobjektbefindet. Auch für verworfene selektierteKantonsobjekte sind die Koordinaten an-zugeben, um eine spätere Kontrolle oderWiederbegehung zu ermöglichen.
FlurnameDer Flurname wird nach der Digitalisie-rung der Teilobjekte aus der Überschnei-dung mit der Landeskarte zugeordnetund in der Datenbank erfasst. Bis 1999wurde der Flurname durch die Kartier-person ins Formular eingetragen. Dabeiwar auf Gross-/Kleinschreibung und dieAkzentsetzung zu achten. Es wurde dernächstgelegene Flurname (evtl. mit Er-gänzungen wie “oberhalb von.....”, “west-lich von.....”) aus der LK25 entnommen.
Der Flurname ist dem Feldplan zu
entnehmen.
Strassen- oderBahnböschung (J/N)Wird als Vollzugshinweis angekreuzt.
0
GemeindenameDiese Angabe wird in der Datenbanknicht erfasst, sie dient der Orientierungder Kartierperson und der Kontrolle.
Plannummer
Das Feld wird mit einer Linie quer
durchgestrichen.
ImNormalfall sind die Pläne nach der
Quadranteneinteilung nach dem System
der Landestopographie nummeriert. Die
ersten vier Stellen bezeichnen die Num-
mer der Landeskarte 1:25’000, die zwei
weiteren Stellen bezeichnen den Qua-
dranten des 5’000er-Planes. Auf dem
Protokollblatt können bis zu vier Plan-
nummern angegeben werden. Wenn der
Plan nicht nach dem Raster der Landes-
topographie nummeriert ist, muss in das
zweite Feld ein “C” eingetragen werden,
anschliessend die 3-4-stellige Gemeinde-
nummer. Auf dem Plan ist die entspre-
chende Bezeichnung angegeben.
ExpositionWindrose nach Schema auf dem Proto-kollblatt (9 Positionen). Für die Expositionkann nur eine Position angekreuzt wer-den. Sie sollte normalerweise mit der Ex-position der Testfläche übereinstimmen.Die Exposition wird immer mit Hilfe desKompasses bestimmt. Flächen in ebenerLage (ohne Exposition) werden in derMitte der Windrose angekreuzt.
LuftbildDas Feld bezeichnet die Luftbild-Archiv-nummer (nicht Luftbildnummer!). JederLuftbildabzug trägt auf der Rückseiteeine Etikette, auf der die entsprechendeLuftbild-Archivnummer gross und fettaufgedruckt ist, z.B. 1225.43.8. DieseNummer wird auf dem Protokollblatt un-ter “LB-Arch.” angegeben. Die Luftbild-Teilnummer (bei geschnittenen Luftbil-dern) wird im Protokollblatt nicht erfasst.Pro Teilobjekt können auf dem Protokoll-blatt bis zu 4 Luftbild-Archivnummernaufgeführt werden. Fehlt das Luftbild, soist das Feld LB-Arch. durchzustreichen.
0
1 2 3
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 151

VERGLEICH DER GRENZLINIE TWW MITDER GRENZLINIE DER KANTONSOBJEKTE
Grenzlinie übernommen
Grenzlinie vergrössert
Grenzlinie verkleinert
Grenzlinie verändert
Grenzlinie verworfen
Grenzlinie verworfen
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE152
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 152

1535 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.7.3 Vergleich mitKantonsobjekten
Wenn in Regionen kartiert wird, wo be-reits ein kantonales Inventar der Tro-ckenstandorte existiert, so ist es sinnvoll,die Ergebnisse der TWW-Kartierung mitden Objekten aus dem Kantonsinventarzu vergleichen. Der Vergleich ist sicherzunächst aus methodischer Sicht span-nend, da die Perimeterabgrenzung injedem Kanton eigenen Regeln unterwor-fen wurde. Oft sind aber die Differenzen inder Abgrenzung derart gross, dass ihreAussage weit über den methodischenUnterschied hinausgeht: Wir erhalteneine erste Erfolgskontrolle.
GrundlagenAls Grundlage für den Vergleich mit denObjekten des Kantonsinventars werdenzu Beginn der Kartierung die Kartenko-pien der selektierten Kantonsobjekte ab-gegeben. Auf diesen Karten sollte dieNummer der Objekte eingetragen sein.Allenfalls ist es möglich, dass über einein der Karte eingetragene Feldnummerdie Inventarnummer in einer Liste nochnachgeschlagen werden muss.
IdentifikationDas Kantonsobjekt wird mit der Objekt-nummer aus dem kantonalen Inventaridentifiziert. Damit wird die Verbindungzum kantonalen Inventar ermöglicht. Diessind wichtige Informationen für die Um-setzung (z.B. bei Bereinigungsverfahren).
VergleichAuf dem Protokollblatt wird das Ergebnisdes Vergleichs von Bundesobjekt undKantonsobjekt erfasst.
Es gibt 3 Fälle und 5 Optionen; es ist je-weils nur eine Option anzukreuzen.
• Fall 1:Das Kantonsobjekt kommt mit nur einemder neuen Teilobjekte in Berührung. Diemöglichen Optionen lauten:
übernommen:Die neue Grenzlinie ist mit der Grenzliniedes kantonalen Objekts identisch.
vergrössert:Die neue Grenzlinie führt zu einer Ver-grösserung des kantonalen Objekts.
verkleinert:Die neue Grenzlinie führt zu einer Verklei-nerung des kantonalen Objekts.
• Fall 2:Das Kantonsobjekt kommt mit mehrerenTeilobjekten in Berührung. Die möglicheOption lautet:
verändert:Die neuen Grenzlinien führen zu einerVeränderung des kantonalen Objekts.
• Fall 3:Das Kantonsobjekt kommt mit keinemTeilobjekt in Berührung. Die möglicheOption lautet:
verworfen:Das Kantonsobjekt erfüllt die Bedingun-gen zur Aufnahme in die nationale Über-sicht nicht. Auf dem Protokollblatt müs-sen neben den Angaben zur Identifikationund den Koordinaten keine weiteren An-gaben gemacht werden. Das verworfeneKantonsobjekt muss auf dem Luftbild ab-gestrichen werden. In das Feld verworfenmuss der Grund der Ablehnung mit dementsprechenden Abstreich-Code (z.B. Goder P) eingetragen werden.
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 153

BEISPIEL EINES BEMERKUNGSFORMULARES
5 MERKMALE DER TEILOBJEKTE154
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 154

1555 MERKMALE DER TEILOBJEKTE
5.8 BEMERKUNGENUND HINWEISE
Bei der Feldaufnahme ist es erwünschtund teilweise sogar vorgeschrieben, dasszu den Resultaten der Aufnahme wichti-ge Bemerkungen angefügt werden. DieBemerkungen, die jede Kartierperson inihrer Muttersprache verfassen kann,werden auf einem speziell dafür vorgese-henen Formular erfasst. Bemerkungenpräzisieren und vervollständigen die An-gaben auf dem Protokollblatt, sie ent-halten aber auch Hinweise für die Um-setzung.
Schreibregeln zumBemerkungsformular
• Da die gleiche Teilobjekt-Laufnummervon mehreren Kartierpersonen und inmehreren Kantonen verwendet wer-den kann, sind zur eindeutigen Zu-ordnung der Bemerkungen zu denTeilobjekten von jeder Kartierperson injedem Kanton eigene Bemerkungsfor-mulare zu führen.
• Auf dem Bemerkungsformular wird dieTeilobjektnummer übertragen und dasentsprechende Bemerkungsfeld an-gekreuzt.
• Die eigentliche Bemerkung soll knappformuliert werden.
• Wertende Aussagen sind zu vermei-den, besser sind beschreibende Aus-sagen.
• Die Bemerkungsformulare werden zu-sammen mit den Protokollblätternnach jedem Kartiertag im Computererfasst.
• Die Erfassungsarbeiten im Feld undam Computer sind Teil der Kartierzeit.
• Zur späteren Bearbeitung der Formula-re ist es zudem hilfreich, wenn die Be-merkungsformulare durchnummeriertwerden. Dazu dient das Feld “Seite”.
Verweis auf dem ProtokollblattWenn eine Bemerkung angefügt wird, soist als Verweis das entsprechende Feldauf dem Protokollbatt anzukreuzen. Essind dies die logischen Felder mit zwin-
gender Ja/Nein-Beantwortung. Sie sindder Übersicht wegen an der rechtenSeite des Protokollblattes untereinanderangeordnet, so dass die Fragen syste-matisch durchgesehen werden können.
UmsetzungshinweisUmsetzungshinweise sind wertvolle An-gaben für die Kantonsvertreterinnen und-vertreter, die Verträge mit den Be-wirtschafterinnen und Bewirtschafternabschliessen oder andere Massnahmenausführen. Unter diesem Gesichtspunktsind die Hinweise nicht wertend, sondernmöglichst beschreibend zu formulieren.
VegetationsaufnahmeDas Feld Vegetationsaufnahme wirdbejaht, wenn für das Teilobjekt eine voll-ständige Vegetationsaufnahme gemachtwurde (Kap. 5.1.5 und 5.1.6). Bei einernormalen Aufnahme der Testfläche wirddas Feld “Nein” angekreuzt. Im Gegen-satz zur normalen Aufnahme der Testflä-che steht für eine Vegetationsaufnahmeunbeschränkt Zeit zur Verfügung. Diegenaue Vegetationsaufnahme wird danndurchgeführt, wenn ein Vegetatiostypnicht, schlecht oder nur unsicher mit demVegetationsschlüssel beschrieben wer-den kann. Die Artenliste auf der Rücksei-te des Protokollblattes dient dazu alsFormular. Wenn bei der Methode INTmehr als eine Vegetationsaufnahme ge-macht wird, ist eine zusätzliche Bemer-kungen anzubringen (Feld “BemerkungVegetation” ankreuzen).
Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 155

Kapitel 5 deutsch def.:Kapitel 5 deutsch def. 23.1.2007 13:53 Page 156

1576 SINGULARITÄTEN
6 SINGULARITÄTEN (Stefan Eggenberg)6.1 Definition von Singularitäten 1596.2 Typisierung der Singularitäten 1616.3 Aufnahme und Beschreibung der Singularitäten 1636.4 Behandlung der Singularitäten 1656.5 Bewertung und Klassierung der Singularitäten 167
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 157

ZULÄSSIGE LEBENSRÄUME
Lebensraumtypen nach Delarze et al. (1999).
Alpine Rasen werden nur behandelt, wenn einepotenzielle Bedrohung oder Beeinträchtigung vorhanden ist.4.3.2 Caricion firmae; 4.3.4 Elynion; 4.3.7 Caricion curvulae;4.5.1 Arrhenatherion; 4.5.2 Polygono-Trisetion; 4.5.3 Cynosurion;4.5.4 Poion alpinae
Trockene Fels- und Schuttgesellschaften sind nur dann zulässig,wenn eine potenzielle Bedrohung oder Beeinträchtigung vorhanden ist.3.3.1.5 Stipion calamagrostis; 3.3.2.3 Galeopsion segetum;3.4.1.2 Potentillion; 3.4.2.2 Androsacion vandellii; 3.4.2.3 Asplenionserpentini; 4.1.1 Alysso-Sedion; 4.1.2 Drabo-Seslerion;4.1.3 Sedo-Veronicion; 4.1.4 Sedo-Scleranthion;7.2.1 Centranto-Parietarion.
Wenn Trockenzeiger vorhanden sind können auch Staudenfluren undSaumgesellschaften beantragt werden, die keine Schlüsselvegetationenthalten. 5.1.2 Trifolion medii; 5.1.3 Convolvulion; 5.1.4 Petasitionofficinalis; 5.1.5 Aegopodion & Alliarion; 5.2.3 Calamagrostion;5.2.4 Adenostylion.
Gebüschgesllschaften und Heiden sind zulässig, wenn sie Trocken-zeiger haben, lückig sind und mindestens teilweise Schlüsselvegetationaufweisen.5.3.1 Sarothamnion; 5.3.2 Berberidion; 5.3.3 Pruno-Rubion;Calluno-Genistion; 5.4.2 Juniperion sabinae; 5.4.3 Ericion; 5.4.4 Juniperionnanae; 5.4.5 Rhododendro-Vaccinion; 5.4.6 Loiseleurio-Vaccinion.
Waldgesellschaften sind zulässig, wenn sie trocken und relativ offen sind.Trockenzeiger und fragmentarische Schlüsselvegetation muss vorhandensein. Der Antrag muss mit der eidgenössischen Forstdirektion und denkantonalen Forstverwaltungen abgesprochen werden.6.2.1 Cephalanthero-Fagenion; 6.3.3 Carpinion; 6.3.4 Quercionpubescenti-petraeae; 6.3.5 Orno-Ostryon; 6.3.6 Quercion robori-petraeae;6.3.7 Kastanienwald; 6.4.1 Molinio-Pinion, 6.4.2 Erico-Pinion sylvestris;6.4.3 Ononido-Pinion; 6.4.4 Dicrano-Pinion; 6.6.3 Larici-Pinetum cembrae;6.6.4 Lärchenwald; 6.6.5 Erico-Pinion mugi.
Ruderalgesellschaften sind nur dann zulässig, wenn es sich um trocken-warme Fluren handelt und wenn die Möglichkeit besteht und sinnvoll ist,die Dynamik, bzw. das Sukzessionsstadium über längere Zeit festzuhalten.7.1.2 Polygonion avicularis; 7.1.4 Sisymbrion; 7.1.5 Onopordion;7.1.6 Dauco-Melilotion; 8.2.1.2 Caucalidion; 8.2.3.2 Fumario-Euphorbion;8.2.3.4 Eragrostion.
6 SINGULARITÄTEN158
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 158

1596 SINGULARITÄTEN
6.1 DEFINITION VONSINGULARITÄTEN
Die starren Bestimmungen des Schwel-lenschlüssels zur Abgrenzung von Teilob-jekten in der Landschaft, die klare Fest-legung von Minimalflächen und das defi-nierte Bewertungssystem für Teilobjektelassen es nicht zu, dass alle wertvollenTrockenstandorte von potenziell nationa-ler Bedeutung in ihrer Bedeutung erfasstwerden können. Damit der Bund nach Art18a NHG alle trockenen, halbtrockenenund wechselfeuchten Wiesen und Wei-den von nationaler Bedeutung bezeich-nen kann, muss neben dem üblichenErfassungsverfahren zur Bildung einerÜbersicht zusätzlich ein Verfahren defi-niert werden, das den Ausnahmefällen,Sonderfällen, Spezialitäten gerecht wird.
Die Spezialfälle, die durch die Lücken derMethode fallen, deren Aufnahme in dieÜbersicht aber aus verschiedenen Grün-den wünschenswert wäre, werden Sin-gularitäten genannt. Die Anzahl Singula-ritäten ist ein vielfaches kleiner als die der“normalen” Teilobjekte. Die Singularitätensind aber im Verfahren aufwendiger(schätzungsweise 1% Singularitäten mit5% Aufwand).
SingularitätSingularitäten sind Teilobjekte oder Ob-jekte (also flächige Ausschnitte in derLandschaft), die aufgrund besondererEigenschaften nicht nach den systemati-schen Schwellenkriterien und Bewer-tungsverfahren des TWW-Projektes be-handelt werden.
Potenzielle SingularitätFläche, die gemäss Katalog der zulässi-gen Lebensräume für einen Antrag alsSingularität in Frage kommt.
Besondere Eigenschaften,SingularitätsmerkmaleEigenschaften, die das Teilobjekt oderObjekt besonders kennzeichnen undnicht durch die üblichen Kartierparameter
erfasst werden, können naturschützeri-scher, aber auch kulturhistorischer Natursein. Sie können auf der Ebene von Ein-zelindividuen (“Naturdenkmäler”), Popula-tionen, Ökosystemen und Landschaftenzum Ausdruck kommen. Die besonderenEigenschaften, die nicht ohnehin durch dieParameter des Kartierprotokolles erfasstsind, werden nach der Liste der Singulari-tätsmerkmale gegliedert.
Klassierung der SingularitätenAufgrund ihrer besonderen Eigenschaf-ten werden die Singularitäten bewertetund wie folgt klassiert:
• Singularitäten von nationalerBedeutung
• Singularitäten von nicht nationalerBedeutung
Zulässige LebensräumeWelche Lebensräume können als po-tenzielle TWW-Singularitäten angesehenwerden?
Grundsätzlich ist es möglich, sowohl fürFlächen mit Schlüsselvegetation (imSinne des Schwellenschlüssels der TWW-Kartierung) als auch für Flächen mitFremdvegetation Singularitäten zu defi-nieren. Bei Fremdvegetation müssen ge-wisse, definierte Bedingungen erfüllt sein,damit ein Antrag auf Singularität gestelltwerden kann. Die nebenstehende Abbil-dung definiert die ökologische Breite dermöglichen Lebensraumtypen, die für eineBewertung akzeptiert werden. Die mög-lichen Typen entwickeln sich auf mindes-tens zeitweise trockenen und magerenStandorten. Sie sind nach Formationenaufgeteilt und mit pflanzensoziologischenEinheiten etwas näher umschrieben.Grundsätzlich dürfen die beantragten Le-bensräume nicht bereits zu bestehendenBundesinventaren gehören.
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 159

BEISPIELE ZU DEN SINGULARITÄTSTYPEN
W-SingularitätNormales Teilobjekt, dessen Bedeutung mit dem normalenBewertungsverfahren aber zu wenig erkannt wird.
Beispiel:historischer Eichenhain in Bubendorf (BL).
M-SingularitätErfüllt alle Kriterien für nationale Übersicht TWW, ist jedoch zu klein.
Beispiel:letzte Standorte von Centaurea stoebe auf Eisenbahnbord (AG).
S-SingularitätDie Vegetationskriterien und Grössenkriterien sind erfüllt, aber andereKriterien des Schwellenschlüssels sind nicht erfüllt.
Beispiel:Kastanienselve mit seltener Trockenwiesenvegetation,Bäume decken mehr als 50% (TI).
X-SingularitätVegetation wird durch Schwellenschlüssel nicht erfasst.
Beispiel:trockenwarme Ruderalflur auf dem Waffenplatz Thun (BE).
6 SINGULARITÄTEN160
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 160

1616 SINGULARITÄTEN
6.2 TYPISIERUNG DERSINGULARITÄTEN
Es gibt verschiedene Gründe, weshalbfür einen bestimmten Landschafts-ausschnitt eine Beurteilung als Singula-rität angestrebt wird. Naturschützerischwertvolle Flächen können zu klein sein, zustark verbuscht oder eingewaldet, odersie sind schlicht kaum zugänglich. An-dere erfüllen zwar die Schwellenkriterien,ihr naturschützerischer oder kulturhisto-rischer Wert wird aber mit dem beste-henden Bewertungskonzept nicht oderzuwenig gewürdigt. Es ist sinnvoll, dieVielfalt der Singularitäten so zu typisieren,dass alle Singularitäten eines Typs diegleichen Spezialanforderungen an dieAbläufe im TWW-Projekt stellen.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich fol-gende Einteilung:
W-SingularitätW = “Werteprüfung erweitern”; Die Sin-gularität erfüllt alle Schwellenkriterieneinschliesslich der Minimalfläche. Sie wirdbei der Kartierung automatisch aufge-nommen. Der Wert wird aber mögli-cherweise durch die aufgenommenenDaten in der Bewertung zuwenig erkannt.Schwelle: nach Schwellenschlüssel. Häu-figkeit: eher selten.
M-SingularitätM = “Minimalfläche ist kein Kriterium”; DieSingularität erfüllt alle Schwellenkriterienbis auf die Minimalfläche. Bei knapp nichterreichter Minimalfläche werden die Sin-gularitäten während der Kartierung nochaufgenommen. Bei sehr kleinen Objektenwird aber bewusst eine M-Singularitätdefiniert. Schwelle: nach Schwellen-schlüssel. Häufigkeit: eher häufig.
S-SingularitätS = “Schwelle nicht erfüllt, aber Schlüs-selvegetation erfüllt”; Die Singularitäterfüllt zwar alle Vegetationskriterien desSchwellenschlüssels, besteht also ausSchlüsselvegetation, erfüllt aber die
allgemeinen Kriterien nicht. Dazu gehö-ren: Begehbarkeit, Deckung der Vege-tation < 25%, unbewirtschaftete INT-Fläche. Schwelle: nach “AbgrenzungFremdvegetation” und “Hauptkriterium”im Schwellenschlüssel. Häufigkeit: eherselten.
X-SingularitätXX ist die Bezeichnung für unbekannteVegetation (=Fremdvegetation). Die Sin-gularität muss keine Schwellenkriteriennach Schwellenschlüssel erfüllen. Siesetzt sich nicht primär aus Schlüssel-vegetation zusammen. Schwelle: Nachdem Katalog der zulässigen Lebens-räume. Häufigkeit: eher selten.
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 161

BEISPIEL EINES SINGULARITÄTENFORMULARES
6 SINGULARITÄTEN162
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 162

1636 SINGULARITÄTEN
6.3 AUFNAHME UNDBESCHREIBUNG DERSINGULARITÄTEN
Aufnahme von SingularitätenDie Merkmale von Singularitäten werdenauf der Ebene von Teilobjekten erhoben.Die Menge der Merkmale für eine Singu-larität kann grösser, aber auch kleiner seinals die Menge an Merkmalen, die übli-cherweise für ein Teilobjekt erhoben wer-den. Singularitäten werden beantragt mitMerkmalen aus:
a den üblichen Parametern aus der Kar-tierung (Vegetationstyp, Strukturele-mente, Vernetzung) und
b zusätzlichen Angaben aus einer vor-gegebenen Merkmalsliste, der Listeder Singularitätsmerkmale.
Es ist für einen Antrag zwingend, dassmindestens ein Merkmal aus der Gruppea) oder b) vorhanden ist. Die erstenPhasen der Bewertung orientieren sichausschliesslich an diesen beiden Merk-malsgruppen.
SingularitätsmerkmaleZu den Singularitätsmerkmalen gehörenEigenschaften, deren Seltenheit und/oderVielfalt mit den Parametern des Kartier-Protokollblattes nicht erfasst werden.Die Merkmale werden in sechs Gruppengegliedert:
• Seltene Flora: In der Singularitätbefinden sich seltene und gefährdetePflanzenarten.
• Seltene Fauna: In der Singularitätbefinden sich seltene und gefährdeteTierarten.
• Seltene Landschaft: Die Singula-rität ist prägend für ein seltenes Land-schaftselement.
• Seltene Nutzung: Die Nutzungs-form in der Singularität ist selten undvon kulturhistorischem Interesse.
• Vielfalt: Die Singularität zeichnet sichdurch besondere Vielfalt aus (floristisch,faunistisch, landschaftlich, nutzungs-mässig oder Kombination daraus).
• Zustand: Der Erhaltungszustand derSingularität ist gut, insbesondere auchder Zustand ihrer ausserordentlichenElemente.
Zu jeder Gruppe der Singularitätsmerk-male werden bei der Zusammenstellungder Dossiers Argumente gesammelt undaufgelistet. Jede Gruppe wird in den er-sten Phasen der Behandlung von Singu-laritäten einzeln bewertet.
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 163

ZUM INHALT EINES SINGULARITÄTEN-DOSSIERS
Beispiel: Schlosshügel Sargans (SG)
Obligatorische Daten
Antrag von: 308 Mary LeibundgutKanton: SG St. GallenRegion: 32 Nordalpen OstFläche: 29 aHöhe ü. M.: 510Singularitätstyp: M
Perimeter auf Karte (oder Luftbild)
Begründung des Antrages (vereinfacht)
z.B.: Luftbild mit Perimeter(wenn nicht bereits vorhanden).
Zusätzliche Daten (fakultativ)
z.B.: Erwähnung in anderen Inventaren(Ausschnitt aus dem KLN-Inventar).
z.B.: Vollständige Artenliste, Vegetationsaufnahme(Ausschnitt der Protokollblatt-Rückseite).
z.B.: Hinweise aus der Literatur(Zitat aus Braun-Blanquet 1961).
6 SINGULARITÄTEN164
Seltene Flora Stipa capillata, Lilium croceum, Asperula purpurea,
Potentilla pusilla, Medicago minima, u.a.
Spezielle Landschaft Burghügel mit kulturhistorischer Bedeutung,mitten im Siedlungsgebiet.
Vielfalt Grosse Vielfalt von verschiedenen Lebensräumen auf
kleinstem Raum. Fragmente von SP, XB, MB, OR, SV
und Kulturrelikten (Iris, Staphylea, Syringa).
Zustand Relativ stark verbuscht,
in Randbereichen ungepflegt, fett.
“(...) Exklaven der Wärmeflora an den Hängen bei Schloss Gutenberg im
Liechtensteinischen, am Kreidefelssporn bei Sargans und auf den warmen
Hügeln von Werdenberg;”
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 164

1656 SINGULARITÄTEN
6.4 BEHANDLUNG DERSINGULARITÄTEN
AntragstellungEs gibt zwei Wege, wie Anträge für po-tenzielle Singularitäten in die Übersichtgelangen können:
• Antrag durch KartierpersonWährend der Kartierung können Teil-objekte, die von der Kartierperson alsSingularitäten eingestuft werden, durchBeilage eines speziellen Formulars (Sin-gularitäten-Formular) bei der Kartierlei-tung als Antrag deponiert werden. Diebeantragte Singularität wird auf demLuftbild abgegrenzt, die Feldaufnahmewird soweit möglich durchgeführt und eswird, wenn möglich, ein Foto gemacht(Ausgangsmaterial für Zusammenstel-lung Dokumentation).
• Antrag an das BUWAL, meistdurch die kantonalen Fachstellen, aberauch direkt von Fachleuten, Lokalken-nerinnen und -kennern. Bei der erstenKontaktnahme mit einem Kanton wird dieFachstelle durch die Projektleitung überdas Konzept der Singularitätenbehand-lung informiert. Die kantonale Fachstellehat die Möglichkeit, Singularitäten anzu-melden, möglichst mit Lokalisierung undBegründung. Ausgewiesene Expertinnenund Experten zu den verschiedenenMerkmalsgruppen des Eigenschaftsras-ters können vom BUWAL aufgefordertwerden, Anträge an die Kartierleitung zustellen (z.B. CRSF, CSCF, Vogelwarte,SKEW). Dabei sollten die bestehendenExpertengruppen (Flora, Fauna) vor-rangig konsultiert werden. Wenn privatePersonen oder Organisationen Singula-ritäten anmelden wollen, so soll ihr Antragim Normalfall über die jeweilige kantona-le Fachstelle laufen (Behandlung wie einAntrag durch die Fachstelle).
Für die Anträge werden zwei verschie-dene Antragsformulare zur Verfügunggestellt, je eines für den jeweiligen An-tragsweg.
Alle Anträge werden vom Sekretariat derSingularitätenkommission gesammelt.
GültigkeitsprüfungMit Hilfe des Kataloges der zulässigenLebensraumtypen wird jeder Antrag vomSekretariat auf seine Gültigkeit hin über-prüft. Wenn Zweifel an der Gültigkeit vor-handen sind (z.B. bei einer Moorflächeoder einer Ruderalfläche), so wird diesbegründet und ans BUWAL weitergelei-tet. Gegebenenfalls wird mit den Antrag-stellern Rücksprache genommen. Dendefinitiven Entscheid über die Gültigkeitfällt das BUWAL.
DossiersDie Kartierleitung richtet ein Sekretariatfür die Entgegennahme und Weiterverar-beitung der Singularitätsanträge ein. Zujedem genehmigten Antrag wird ein eige-nes Dossier zusammengestellt, in demdie verschiedenen Formulare, Angaben,Notizen, Karten und weitere Materialiengesammelt und archiviert werden.
Die Daten zu einem Singularitätsantragkönnen entweder bereits vorhanden sein(z.B. aus der Literatur) oder sie müssendurch einen Kartierauftrag speziell einge-holt werden. Von den verschiedenen Sin-gularitäten können nicht gleichviel undnicht immer dieselben Daten zur Verfü-gung stehen. Der Informationsstand zuden einzelnen Anträgen wird unter-schiedlich sein und bleiben.
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 165

DIE WICHTIGSTEN PHASEN DER SINGULARITÄTENBEHANDLUNG UND -BEWERTUNG
6 SINGULARITÄTEN166
Kartierpersonen (direkt) Dritte (via BUWAL)Kantonale Fachstellen (via BUWAL)
Sammlung der AnträgeHerstellung der Dossiers
Sekretariat Singularitäten
Gültigkeitsprüfung
Singularitätenkommission
Klassierungsvorschlag(Bedeutung national oder nicht-national)
Singularitätenkommission
Entscheidbzw. Antrag z.H. des Departementes UVEK
BUWAL
Antragstellung
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 166

1676 SINGULARITÄTEN
6.5 BEWERTUNG UNDKLASSIERUNG DERSINGULARITÄTEN
BewertungGrundsätzlich wird die Bewertung derSingularitäten von den Mitgliedern derSingularitätenkommission vorgenommen.Es sind Entscheide von Expertinnen undExperten. Als Hilfe zur Entscheidungsfin-dung können semiquantitative Vorbewer-tungen dienen.
• Bewertung aufgrund der üblichenMerkmale im normalenTWW-Bewertungsverfahren.
• Bewertung der Singularitäts-merkmale.
Bewertung derSingularitätsmerkmaleDie 6 vorgegebenen Merkmalsgruppenwerden je einzeln “benotet”. Nach dieserSkala wird beispielsweise die Seltenheiteiner Tierart gewertet, der Beitrag desObjektes zu einer ausserordentlichenLandschaft, die Vielfalt an darin lebendenOrganismen oder die Einzigartigkeit einerübriggebliebenen Nutzungsform.
KlassierungUm den Klassierungsvorschlag “national/nicht-national” an das BUWAL fachlichmöglichst breit abzustützen, wird eineSingularitätenkommission ins Leben ge-rufen. Die Aufgabe ihrer Mitglieder be-steht darin,
• die Gültigkeit des Antragesfestzustellen,
• die Bewertung der Singularitäts-merkmale zu überprüfen,
• einen Klassierungsvorschlag zu-handen des BUWAL auszuarbeiten.
Jedes Mitglied der Kommission hat dieMöglichkeit, zu jedem Antrag Argumentedazuzufügen und die Bewertung ausden Singularitätsmerkmalen neu zu be-rechnen. Aus den damit vorliegendenSchlusswerten und Argumenten wird
jedes Mitglied eine Klassierung desObjektes vorschlagen. Es gibt die zweiMöglichkeiten:
• Singularität ist ein Objekt vonnationaler Bedeutung
• die Singularität ist kein Objektvon nationaler Bedeutung
SingularitätenkommissionDie Kommission besteht aus drei ständi-gen Mitgliedern mit Stimmrecht. Je nachThematik der Singularität können vorabzusätzliche Experten oder Expertinnenbefragt werden, diese haben jedoch keinStimmrecht, sie sollen nur argumentativeingreifen. Je nach Fall sind die betroffe-nen kantonalen Fachstellen mehrmalsanzuhören. Als Schlussentscheid überden Klassierungsvorschlag gilt der Mehr-heitsentscheid der ständigen Mitglieder.Normalerweise läuft die Meinungsbildungund -äusserung über den Korrespon-denzweg. Die Mitglieder der Kommissionwerden über das Schlussresultat in-formiert und können den Entscheid an-fechten und eine Kommissionssitzungzur Entscheidungsfindung verlangen.
Die Klassierungsvorschläge werden an-schliessend dem BUWAL zugesandt.
Entscheid durch das BUWALDas BUWAL erhält den Klassierungsvor-schlag mit einer Zusammenstellung derwichtigsten Argumente pro und contraden Entscheid über die Klassierung. DasBUWAL kann der Argumentation derKommission für die vorgeschlagene Klas-sierung folgen, oder aber das Dossier mitBegründung wieder an sie zurückgebenmit der Bitte, die Bewertung im Sinneseiner Argumente nochmals zu prüfen.Anschliessend werden die Singularitätengleich wie die übrigen klassierten Objek-te weiterbehandelt. D.h. die vorgeschla-gene Klassierung wird der kantonalenFachstelle unterbreitet und mit ihr disku-tiert und so weit wie möglich bereinigt.Am Schluss des Verfahrens steht die offi-zielle Vernehmlassung des Eidgenössi-schen Departementes für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK)bei den Kantonen zu allen von ihm alsnational bedeutend vorgeschlagenenObjekten, wozu auch ein Teil der Singu-laritäten gehören wird.
Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 167

Kapitel 6 deutsch def.:Kapitel 6 deutsch def. 23.1.2007 13:58 Page 168

1697 VEGETATION
7 VEGETATION (Stefan Eggenberg)7.1 Ökologie des Grünlandes 1717.1.1 Komponenten der Vegetation 1717.1.2 Ökogramme der Grünlandgesellschaften 1737.2 Klassifikation der Wiesen und Weiden 1757.3 Vegetationsgruppen 1777.3.1 Vegetationsgruppe AE 1797.3.2 Vegetationsgruppe MBAE 1817.3.3 Vegetationsgruppe MB 1837.3.4 Vegetationsgruppe MBXB 1857.3.5 Vegetationsgruppe XB 1877.3.6 Vegetationsgruppe MBSP 1897.3.7 Vegetationsgruppe SP 1917.3.8 Vegetationsgruppe CB 1937.3.9 Vegetationsgruppe LL 1957.3.10 Vegetationsgruppe OR 1977.3.11 Vegetationsgruppe AI 1997.3.12 Vegetationsgruppe SV 2017.3.13 Vegetationsgruppe CA 2037.3.14 Vegetationsgruppe CF 2057.3.15 Vegetationsgruppe NS 2077.3.16 Vegetationsgruppe FV 2097.3.17 Vegetationsgruppe FP 2117.3.18 Vegetationsgruppe LH 213
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:01 Page 169

GRÄSER ALS IDEALE PFLANZENDES GRÜNLANDES
Der Samen besitzt viel Stärke, was eine rascheKeimung ermöglicht.
Die Blüte ist angepasst an die Windbestäubung,die im offenen Grünland meist sehr erfolgreich ist.
Der Halm ist mit Festigungsgewebe durchzogenund dank einer hohlen Konstruktion besondersstabil.
An den Knoten ist Wachstumsgewebe(Meristem) vorhanden, aus dem sich die Pflanzenach Verbiss oder Mahd rasch erneuern kann.
Gräser können sich bestocken, d.h. Seitentriebebilden durch Bewurzelung eigenständige Pflanzen.
7 VEGETATION170
HORSTPFLANZEN(Hemikryptophyta caespitosa)
Festuca ovina
Sesleria caerulea
Carex humilis
Nardus stricta
ROSETTENPFLANZEN(Hemikryptophyta rosulata)
Bellis perennis
Viola hirta
Echium vulgare
Primula veris
SCHAFTPFLANZEN(Hemikryptophyta scaposa)
Hypericum perforatum
Onobrychis viciifolia
Thalictrum foetidum
Silene dioica
KRIECHSTAUDEN(Chamaephyta reptantia)
Thymus serpyllum
Saponaria ocymoides
Veronica spicata
Trifolium repens
HALBSTRÄUCHER(Chamaephyta suffrutescentia)
Helianthemum num.
Ononis repens
Fumana procumbens
Genista germanica
WICHTIGE WUCHSFORMEN IM GRÜNLAND
Die Blüten sind in meist rispenförmig ausgebrei-teten, für die Windbestäubung wirkungsvollenBlütenständen angeordnet.
Die Blattmorphologie ist vielgestaltig, an-passungsfähig. Durch Einrollen kann ein gutgeschützter Innenraum für den Gasaustauschhergestellt werden.
Anpassungsfähiger Wuchs: Horste mit gutgeschützten Überdauerungsknospen, Ausläuferfür rasche vegetative Besiedlung.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:01 Page 170

1717 VEGETATION
7.1 ÖKOLOGIE DESGRÜNLANDES
7.1.1 Komponentender Vegetation
Die blumenreichenWiesen im Berggebietscheinen für viele eine besonders natur-nahe Vegetation zu sein. Doch verdanktauch hier, wie überall sonst in derSchweiz unterhalb der Waldgrenze, dasGrünland seine Existenz der Tätigkeit desMenschen. Wirklich natürliche Grünland-flächen gab es einst nur in Waldlichtun-gen nachWaldbränden undWindwürfen,anMoorrändern, in Verlandungszonen anGewässern und an felsigen Hängen.
Werden die sich stets wieder ansamen-den Holzgewächse regelmässig vomMenschen weggeräumt, so entsteht eineDauergesellschaft, die sich in den meis-ten Fällen durch die Dominanz von gras-artigen Pflanzen auszeichnet.
WuchsformenAuf halbtrockenen bis feuchten Bödengelangt im gerodeten und genutztenGrünland die Wuchsform der Hemikryp-tophyten (Erdschürfepflanzen) zur Domi-nanz. Damit werden Pflanzen bezeichnet,die krautig sind, an der Basis nicht ver-holzen und ihre Erneuerungsknospen ander Erdoberfläche überwintern. Oft sindes Horst- oder Rosettenpflanzen, es fin-den sich aber auch kriechende und nurStengelblätter besitzende Pflanzen in denBeständen.
Die Hemikryptophyten wachsen meist sokräftig, dass einjährige Kräuter kaum auf-kommen können. Erst wenn die Boden-verhältnisse extrem trocken werden, bil-den sich Lücken zwischen den Horstenund Rosetten. Diese “Löcher” nutzendann kleine Zwergsträucher (= Chamae-phyten, z.B. Teucrium, Thymus, Artemi-sia, Helianthemum) und einjährige Früh-blüher (= frühlingsephemere Therophy-ten, z.B. Medicago, Arenaria, Alyssum,
Hornungia, Erophila). Trockenere undmagere Verhältnisse erlauben es auchden Zwiebel- und Knollenpflanzen(= Geophyten, z.B. Orchideen, Lilien,Narzissen), sich zu behaupten. Durchdie dauernde Störung durch Frass undSchnitt werden Pflanzen bevorzugt, diesich leicht regenerieren können. Hierhaben die Meister in dieser Fähigkeit, dieGräser, einen entscheidenden Selek-tionsvorteil.
GräserDie spezielle Morphologie und Physio-logie der Gräser und die daraus resul-tierende Anpassungsfähigkeit an dasGrünland illustrieren indirekt auch derenÖkologie. Gräser sind ausserordentlicherneuerungsfähig, sowohl vegetativ (durchErneuerungsknospen) als auch generativ(durch Samen). Sowohl einjährige wieausdauernde Arten besitzen zahllose Er-neuerungspunkte, die als Schosse, Ver-zweigungen, Ausläufer oder Rhizome zurKonkurrenzkraft beitragen. Gräser kön-nen viel Trockenheit ertragen, werden beitrockenem Wetter strohgelb und ergrü-nen rasch wieder bei feuchteren Verhält-nissen.
Im Allgemeinen besitzen Gräser kaumStrukturen oder Giftstoffe aus ihremStoff-wechsel, die sie vor Frass schützen undliefern daher für Menschen und Tiere einGrundnahrungsmittel erster Güte. Aller-dings ist in den letzten Jahren der Einflussvon Pilzen deutlicher geworden, von de-nen viele Grasarten befallen werden unddie Giftstoffe ausscheiden können. Bei al-len Gräsern bildet die einzelne Blüte nureinen Samen, der aber mit viel Nährstof-fen versorgt, als sogenannte Karyopseverbreitet wird. Diese keimt leicht undrasch und macht Gräser zu Schnellstar-tern in Pioniersituationen.
Nach der Keimung gelangen Gräserrasch wieder zu Blüte und Fruchtbildung,bereit, sich zu behaupten und weiter zuverbreiten. Als Horstpflanzen mit festem,tiefreichendem Wurzelwerk können sie
Hänge stabilisieren und tiefliegende Nähr-stoff- und Wasserquellen erschliessen.Durch ihre Anpassungsfähigkeit haben esdie Gräser geschafft, unter fast allen Be-dingungen in der Vegetation vertreten zusein. Im mitteleuropäischen Grünland,das durch seine regelmässige Störung(Mahd und Frass) gekennzeichnet ist, ge-langen sie regelmässig zur Dominanz. Je-der Grünlandtyp hat seine am besten an-gepassten Grasarten und so lässt sichumgekehrt anhand der Graszusammen-setzung die Pflanzengesellschaft mit de-ren Ökologie am besten beschreiben.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:01 Page 171

Verteilung der Gesellschaftentieferer Lagen im Ökogramm
AE ArrhenatherionCD Caricion davallianaeCN Caricion nigraeFA Festuco-AgrostionMB MesobromionMO MolinionSP Stipo-PoionXB Xerobromion
Verteilung der Gesellschaftenhöherer Lagen im Ökogramm
CD Caricion davallianaeCF Caricion ferrugineaeCN Caricion nigraeFV Festucion variaeNS Nardion strictaeSV Seslerion variae
Typische Arten für die jeweiligeNutzungsform im Ökogramm
7 VEGETATION172
MB
AE
FA
CD / CN MO
XB / SP
SV
CF
CD
FV
CN
NS
Cynosurus cristatus
Lolium perenne
Brachypodium pinnatum
Deschampsia caespitosaRanunculus repens
Holcus lanatusArrhenatherum elatius
Sanguisorba officinalis
Cytisus scoparius
Clinopodium vulgare
Cirsium acaule
Cirsium eriophorum
Carlina acaulis
Securigera varia
Filipendula ulmaria
Gentiana asclepiadea
Heracleum sphondylium
Poa pratensis
Senecio jacobaea
Trifolium dubium
Trisetum flavescens Urtica dioica
Vaccinium spp.
Verbascum lychnitisTragopogon pratensis
Rhinanthus alectorolophus
Geranium sanguineum
Trifolium medium
Eupatorium cannabinum
Phragmites australis
Saponaria officinalis
Symphytum officinale
Anthericum ramosumOphrys spp.Orchis spp.
Campanula patula
Leontodon autumnalis
Agropyron repens
sehr trocken
trocken
frisch
feucht
nass
sehr mager mager mässig fett fett
sehr trocken
trocken
frisch
feucht
nass
sehr sauer sauer neutral alkalisch
sehr trocken
trocken
frisch
feucht
nass
Wiesen Weiden Brachen
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 172

1737 VEGETATION
7.1.2 Ökogramme derGrünlandgesellschaften
Es gibt viele verschiedene Faktoren, dieihren Einfluss auf die Artenzusammenset-zung des Grünlandes geltend machen.Neben der Nutzungsform (Wiese, Weide)und -intensität (intensiv, extensiv) sind eszunächst Bodeneigenschaften wie Was-serhaushalt, Nährstoffgehalt, Reaktion(Säuregehalt), die wiederum von der Dün-gung, aber auch vom Muttergesteinbeeinflusst werden. Als weitere Faktoren-gruppe wirkt das Lokalklima, am deut-lichsten bei der Veränderung der Pflan-zendecke mit der Meereshöhe.
Für eine Zusammenschau der Wirkungökologisch wichtiger Faktoren eignensich Ökogramme, wie sie in Ellenberg(1996) verwendet werden. Da die pflan-zensoziologischen Verbände für Grün-landgesellschaften besonders deutlichmit den ökologischen Faktoren korrelie-ren, werden diese zur Darstellung in denÖkogrammen verwendet.
Beschreibungen der angegebenen Ver-bände können der einschlägigen Literatur(z.B. Delarze et al. 1999) oder den weiterhinten ausgeführten Darstellungen derVegetationsgruppen des TWW-Projektesentnommen werden.
Der HauptgradientFür die ökologische Differenzierung dermageren und trockenen Grünlandgesell-schaften spielt der Übergang von nas-sen, feuchten, frischen zu trockenen undsehr trockenen Bodenverhältnissen dievorrangige Rolle. Wir nennen ihn deshalbim Folgenden den “Hauptgradienten”. Al-le auf der gegenüberliegenden Seite dar-gestellten Ökogramme weisen diesenHauptgradienten in der y-Achse auf. ZurInterpretation der Grafiken dient er alsOrientierungshilfe. Selbst feuchte odergar nasse Grünlandgesellschaften habenfür TWW eine Bedeutung. Unter wech-selfeuchten Verhältnissen kommen oftPflanzen von trockenen und nassen Ra-
sen zusammen in Mischbeständen vor.Solche Übergangsgesellschaften sollenexplizit im Rahmen des TWW-Projektesberücksichtigt werden.
Gesellschaftender tieferen LagenDie Zusammenhänge zwischen Vegeta-tion und Ökologie können sehr gut ent-lang des Nährstoffgradienten dargestelltwerden, da in den tiefen Lagen dieGegensätze zwischen mageren undnährstoffreichen Böden am grössten sindund die geologischen Abhängigkeiten inden Hintergrund treten.
Die beiden dargestellten GradientenFeuchtigkeit und Nährstoffe sind teilweisevoneinander abhängig. Böden mit opti-maler Feuchtigkeitsversorgung sind inder Regel relativ nährstoffreich.
Gesellschaftender höheren LagenIm Gebirge ist die Flora der magerenWie-sen und Weiden stark vom Säuregehaltdes Bodens abhängig. Dabei ist meistdas Ausgangsgestein von entscheiden-der Bedeutung. Kalkgesteine liefern basi-sche Böden, Silikatgesteine (Sandstein,Gneiss, Granit) fördern versauerte Böden.Im Übergang zwischen den beidenGegensätzen, dort wo auch floristischeÜbergänge stattfinden, die eine Vegeta-tionsansprache erschweren, befinden wiruns meist auf tonhaltigen Sedimentge-steinen (z.B. Flysch, Bündner Schiefer,Verrucano).
Das nebenstehende Ökogramm mit denGesellschaften der höheren Lagen zeigtdie vier Haupttypen FV, SV, NS und CFund ihre Abhängigkeit vom Feuchtigkeits-und Reaktionsgradienten.
Art und Intensität der NutzungDie Intensität der Nutzung verläuft weit-gehend parallel zum Nährstoffgehalt desBodens. Nur nährstoffreiche Böden eig-nen sich für intensive Nutzungsformen.Unabhängig davon, ob das Grünland ge-mäht oder beweidet wird, sind sich die
Pflanzengesellschaften auf vergleichba-ren Böden relativ ähnlich. Es gibt abertrotzdemPflanzen, die der jeweiligen Nut-zungsform besonders gut angepasstsind: Pflanzen, die den Schnitt gut ertra-gen, oder die sich durch Dornen oder Gif-te gegen die Beweidung wehren. Diesenutzungsspezifischen Unterschiede sindim dritten Ökogramm dargestellt.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 173

7 VEGETATION174
Weitere typische Arten der Halbtrocken- und Trockenrasen
Briza media Daucus carota Ononis repens Sedum albumCarex montana Euphorbia cyparissias Plantago media Silene nutansCirsium acaule Galium verum Primula veris Thymus serpyllum
Klasse: Festuco-Brometea (Soziologische Charakterarten der Halbtrocken- und Trockenrasen)
Anthyllis vulneraria Centaurea scabiosa s.str. Linum catharticum Stachys rectaAsperula cynanchica Coronilla minima Pimpinella saxifraga Teucrium chamaedrysArtemisia campestris Dianthus carthusianorum Prunella grandiflora Teucrium montanumBrachypodium pinnatum Helianthemum nummularium Salvia pratensis Veronica spicataCarlina vulgaris Koeleria macrantha Sanguisorba minor
Ordnung: Brometalia erecti (Subatlantische Halbtrocken- und Trockenrasen)
Anacamptis pyramidalis Euphrasia stricta Scabiosa columbaria Ononis spinosaBromus erectus Koeleria pyramidata Himanthoglossum hircinum Polygala vulgarisCarex caryophyllea Potentilla neumanniana Hippocrepis comosa Trifolium montanum
Ordnung: Festucetalia valesiacae (Subkontinentale Halbtrocken- und Trockenrasen)
Achillea tomentosa Euphorbia seguieriana Oxytropis pilosa Scorzonera austriacaAstragalus onobrychis Festuca valesiaca Potentilla pusilla Stipa capillataCarex liparocarpos Onosma helvetica Scabiosa triandra Stipa pennata
Verband:Mesobromion
Aceras anthropophorumCarlina acaulisEuphorbia verrucosaFestuca guestfalicaGentiana germanicaOnobrychis viciifoliaOrobanche teucriiOphrys spp.Orchis militarisOrchis ustulataRanunculus bulbosus
Verband:Stipo-Poion
Artemisia vallesiacaCentaurea vallesiacaEphedra helveticaFestuca rupicolaPoa perconcinnaPulsatilla montana
Verband:Cirsio-Brachypodion
Adonis vernalisDanthonia alpinaHypochoeris maculataOnobrychis arenariaThesium linophyllonVeronica austriaca
Verband:Diplachnion
Bromus condensatusCentaurea gaudiniiCentaurea transalpinaCleistogenes serotinaDianthus seguieriFestuca ticinensisHeteropogon contortusKnautia transalpina
Verband:Xerobromion
Fumana procumbensGlobularia bisnagaricaKoeleria vallesianaLeontodon incanusLinum tenuifoliumOrobanche teucriiTrinia glauca
Verband:Koelerio-Phleion
Dactylorhiza sambucinaDianthus deltoidesSilene viscaria
Einheiten nach dem pflan-zensoziologischen System(Klasse, Ordnung, Verband)mit den entsprechendenKennarten. Dazu farbigmarkiert die Gruppierungder Arten nach TWW:
MesobromionXerobromionStipo-PoionCirsio-Brachypodion
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 174

1757 VEGETATION
7. 2 Klassifikation der Wiesenund Weiden imTWW-Projekt
Damit Vegetation kartiert und bewertetwerden kann, muss sie in mehr oderweniger natürliche Einheiten klassiertwerden. Ein Vegetationsschlüssel gibtAuskunft über die Regeln, die bei derKlassifizierung berücksichtigt werdenmüssen. Es hat sich allgemein als sehrbrauchbar erwiesen, wenn das Vorhan-densein bzw. die Deckung bestimmterArten (Zeigerarten) dazu dienen, die Ve-getation zu klassifizieren. Die verschiede-nen Ansätze zur Klassifikation von Wie-sen und Weiden unterscheiden sichprimär durch die Zusammensetzung sol-cher Zeigerartengruppen.
Beispiele von Kartierschlüsseln für Wie-sen undWeiden finden sich bei Dietl et al.1981, ANL 1981, Werner 1994, Schu-bert et al. 1995.
Verwendete ArtengruppenWährend beispielsweise der Vegetations-schlüssel nach ANL (1981) mit Arten-gruppen arbeitet, die aufgrund von Zei-gerwerten der Arten zusammengestelltwurden, baut der im TWW verwendeteSchlüssel auf pflanzensoziologischeGrundlagen auf. Eine Klassifikation derVegetation Mitteleuropas aufgrund vonÄhnlichkeiten in der jeweiligen Artenzu-sammensetzung ist weitgehend etabliertund in der Naturschutzpraxis allgemeinakzeptiert. Es ist daher nicht zuletztwegen der Vergleichbarkeit mit anderenKlassifikationen (z.B. CORINE-Biotopes)naheliegend, sich das pflanzensoziologi-sche Wissen zunutze zu machen.
PflanzensoziologischeGrundlagenwerkeFür die Zusammenstellung geeigneter Ar-tengruppen und Schlüsselkriterien ste-hen heute für Mitteleuropa mehrereGrundlagenwerke zur Verfügung. Die fol-gende Literaturliste gibt die wichtigstenWerke an, die für die TWW-Klassifikation
konsultiert wurden:Braun-Blanquet, 1961: Die inneralpineTrockenvegetation.Ellenberg, 1996: Die Vegetation Mitteleu-ropas mit den Alpen.Mucina, Grabherr & Ellmauer, 1993: DiePflanzengesellschaften Österreichs.Oberdorfer, 1978: Süddeutsche Pflan-zengesellschaften.Royer, 1987: Synthèse eurosibérienne,phytosociologique et phytogéographiquede la classe des Festuco-Brometea.Theurillat, 1994: The higher vegetationunits of the Alps.Wilmanns, 1984: Ökologische Pflanzen-soziologie.Zoller, 1954: Die Typen der Bromus ere-ctus -Wiesen des Schweizer Juras.
Der Verband als BasiseinheitEines der erklärten Ziele des TWW-Pro-jektes ist die Verwendung von Einheiten,die in der ganzen Schweiz gültig sind undüberall gleich definiert werden. Solchenüberregionalen Einheiten entsprechen impflanzensoziologischen System die “Ver-bände”. Die Kennarten dieser Verbändedienen als Kern der im TWW verwende-ten Artengruppen. Aufgrund von aufwen-digen Testkartierungen und den Erfah-rungen, die während der eigentlichenKartierung gesammelt werden, sind lau-fend zusätzliche geeignete Arten denursprünglichen Kennarten hinzugefügtworden. Die Arbeit erfolgt heute mit 26Artengruppen, die im Schnitt 10-20 Artenaufweisen. Gegenüber der Pflanzenso-ziologie ist die Definition der Kennarten-gruppen viel freier. Auch die Bestimmungder Vegetationseinheiten durch die kla-ren, eindeutigen undmöglichst einfachenRegeln eines Vegetationsschlüssels er-geben nicht Klassierungen im strengensoziologischen Sinn. Im Gegensatz zurPflanzensoziologie, die typische Verge-sellschaftungen unter verschiedenenökologischen Bedingungen herausarbei-tet, müssen bei einer Kartierung auchÜbergangsgesellschaften zugeordnetwerden können. Die TWW-Einheiten sindimmer weiter gefasst als die entspre-chenden Verbände, sie lehnen sich aber
klar an diese an und haben letztlich eineähnliche floristische Zusammensetzungund eine ähnliche Ökologie.
VegetationsschlüsselDie Vegetation im Gelände wird floristischanalysiert. Die Anteile jeder Artengruppewerden notiert und anhand dieser Antei-le wird die Vegetation einer “Klasse”, ei-nem Vegetationstyp zugeordnet. Der Ve-getationsschlüssel regelt, wie die Anteileder Artengruppen gewichtet werden. Alsallgemeine Grundregel gilt: für die Zuord-nung zu einem Vegetationstyp braucht es6 Arten aus der entsprechenden Arten-gruppe.
ÜbergangsgesellschaftenIn der Realität besteht die Vegetation sehroft aus Übergängen zwischen verschie-denen soziologischen Verbänden. Durchden im Kapitel 5.1.6 vorgestellten “mo-dularen” Schlüssel wird diesem Problemweitgehend Rechnung getragen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 175

7 VEGETATION176
1. Der Vegetationstyp hat CA im Index Gruppe CA Caricion austroalpinaeSüdalpine Blaugrashalde
2. Der Vegetationstyp hat CB im Index Gruppe CB Cirsio-BrachypodionSubkontinentaler Trockenrasen
3. Der Vegetationstyp hat FP im Index Gruppe FP Festucion paniculataeGoldschwingelhalde
4. Der Vegetationstyp hat LL (oder BE, BP) im Index Gruppe LL “low diversity - low altitude”artenarme Trockenrasen der tieferen Lagen
5. Der Vegetationstyp enthält AI Gruppe AI Agropyrion intermediiHalbruderaler Trockenrasen
6. Der Haupttyp ist SP Gruppe SP Stipo-PoionSteppenartiger Trockenrasen
7. Der Vegetationstyp hat SP im Index Gruppe MBSP Übergang Mesobromion/Stipo-PoionSteppenartiger Halbtrockenrasen
8. Der Haupttyp ist XB Gruppe XB XerobromionSubatlantischer Trockenrasen
9. Der Vegetationstyp hat XB im Index Gruppe MBXB Übergang Mesobromion/XerobromionTrockener Halbtrockenrasen
10. Der Haupttyp ist CF, FV, NS oder SV und im Index steht weder CF, FV, NS noch SV Gruppe LH “low diversity - high altitude”artenarme Trockenrasen der höheren Lagen
11. Der Vegetationstyp enthält CF Gruppe CF Caricion ferrugineaeRostseggenhalde
12. Der Haupttyp ist AE oder FA Gruppe AE Arrhenatherion elatiorisTrockene, artenreiche Fettwiese
13. Der Vegetationstyp enthält FV Gruppe FV Festucion variaeBuntschwingelhalde
14. Der Vegetationstyp enthält SV Gruppe SV Seslerion variaeBlaugrashalde
15. Der Vegetationstyp enthält NS Gruppe NS Nardion strictaeBorstgrasrasen
16. Der Haupttyp ist OR Gruppe OR OriganetaliaTrockene Saumgesellschaft
17. Der Haupttyp ist MB, mit AE oder FA im Index Gruppe MBAE Übergang Mesobromion/ArrhentherionNährstoffreicher Halbtrockenrasen
18. Der Haupttyp ist MB Gruppe MB MesobromionEchter Halbtrockenrasen
GRUPPENSCHLÜSSEL VG18Die Schlüsselfragen werden von oben nach unten geprüft, bis eine Zuordnung gefunden wird.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 176

1777 VEGETATION
7.3 VEGETATIONS-GRUPPEN
BegriffeVegetationstyp: Einheit, die aufgrunddes TWW-Vegetationsschlüssels einerTestfläche bzw. einem Teilobjekt zuge-ordnet wird (vgl. Kap. 5.1.6.)Vegetationsgruppe: Einheit ausmehre-ren, ökologisch-soziologisch verwandtenVegetationstypen.Gruppenschlüssel: Regeln zur Bildungvon Vegetationsgruppen aus Vegeta-tionstypen.
Anzahl VegetationstypenEs war eines der methodischen Ziele, ei-nen Vegetationsschlüssel zu konstruie-ren, der für die ganze Schweiz bis zurWaldgrenze Geltung haben soll und mitdem auf die während der Kartierung neuauftauchenden Phänomene und Vegeta-tionsübergänge flexibel reagiert werdenkann. Das Ergebnis ist ein relativ “offener”Schlüssel, mit dem aufgrund der Anteileverschiedener Artengruppen Vegeta-tionstypen zusammengebaut werden.Aufgrund dieses offenen “modularen” Ve-getationsschlüssels sind durch verschie-dene Kombinationen theoretisch rund3000 Vegetationstypen möglich. In derArbeitspraxis sind allerdings bisher nuretwa 250 verschiedene Vegetationstypenvorgekommen und es kommen in denkünftigen Kartierjahren wohl höchstensnoch 10-20 neue Typen dazu.
Die bisherigen Vorkommen lassen sichgrob analysieren: wenn wir nur Vegeta-tionstypen berücksichtigen, die bishermindestens 10 mal bestimmt wurden, sokommen gerade noch 60 verschiedeneVegetationstypen vor. Mit den 23 häufig-sten Vegetationstypen lassen sich 75%der kartierten Fläche beschreiben.
Bildung von VegetationsgruppenMit demmodularen Vegetationsschlüsselentstehen viele Vegetationstypen, dieuntereinander ökologisch und soziolo-gisch verwandt sind. So unterscheiden
sich ein MBAE und ein MBAESC nur durchWuchshöhe und Ertragsleistung. Floris-tisch sind sie aber relativ ähnlich. Durchdas Zusammenfassen ähnlicher Vegeta-tionstypen, die eine informative, relativdetaillierte Basis der Zuordnung liefern,lassen sich je nach Bedürfnis unter-schiedliche Gruppen generalisieren. Bis-her existieren drei verschiedene Grup-penschlüssel.
Gruppenschlüssel VG18(Bewertung)Die für das TWW-Projekt wichtigste Ge-neralisierung ist die Einteilung der Vege-tationstypen in 18 Gruppen. Diese Grup-pen bilden die Basis für die Bewertungder Objekte, d.h. für jede der 18 Vegeta-tionsgruppen existiert ein Vegetations-wert, der im Bewertungsverfahren ver-wendet wird (vgl. Kap. 8).
Gruppenschlüssel VG15(Kartographie)Für eine gute Lesbarkeit von Kartenbraucht es eine möglichst einfache, kur-ze Legende. Anderseits soll möglichst vielInformation in der Karte ersichtlich wer-den. Der optimale Kompromiss ist derGruppenschlüssel VG15, der gegenüberdem Schlüssel VG18 auf einige Einheitenverzichtet. So wird beispielsweise diesüdalpine Blaugrashalde (CA) nicht vonden übrigen Blaugrashalden (SV) unter-schieden, da der Unterschied eindeutigaus ihrer Lokalisierung herausgelesenwerden kann.
Gruppenschlüssel VG24(CORINE)Auf internationalem, europäischem Ni-veau wurde von der Europäischen Unionmit den CORINE-Biotopes eine Liste vonLebensraumtypen geschaffen, die eben-falls auf pflanzensoziologischer Basis be-ruht. Es ist daher ohne weiteres möglich,aus den im TWW-Schlüssel feiner einge-teilten Einheiten Gruppen zu bilden, dieden CORINE-Einheiten entsprechen. Derdafür konstruierte Schlüssel VG24 liefertdie Generalisierung zu diesen Einheiten.
Beschreibung der18 VegetationsgruppenAuf der gegenüberliegenden Seite ist derSchlüssel VG18 dargestellt, wie er in derBewertung zur Anwendung gelangt. Aufden folgenden Seiten wird jede der 18 Ve-getationsgruppen dargestellt und kurzdiskutiert. Erste Resultate aus der Kartie-rung 1995-2000 werden in die Darstel-lung miteinbezogen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 177

7 VEGETATION178
ARTENGRUPPE AE1(Arrhenatherion)
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Carum carvi
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea s.l.
Festuca pratensis s.l.
Galium album
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Knautia arvensis
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Phleum pratense
Pimpinella major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Taraxacum officinale
Trifolium repens/thalii
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys
ARTENGRUPPE AE2(Festuco-Agrostion)
Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra aggr.
ARTENGRUPPE AE3(Polygono-Trisetion)
Alchemilla vulgaris
Campanula rhomboidalis
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsii
Crepis aurea
Geranium sylvaticum
Ligusticum mutellina
Myosotis sylvatica
Peucedanum ostruthium
Phleum alpinum aggr.
Poa alpina
Polygonum bistorta
Ranunculus tuberosus
Silene dioica
Trollius europaeus
AEMB mit Knautia arvensis, Galium album; bei Disentis (GR).
Bewässerte Fettwiese im Wallis mit starkemAuftreten von Doldenblütlern, v.a.Pastinaca sativa.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Arrhenatherum elatius ist das dominante Grasder Fettwiesen tieferer Lagen.
Trisetum flavescens ist das dominante Gras derFettwiesen höherer Lagen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 178

1797 VEGETATION
7.3.1 Vegetationsgruppe AE
Trockene, artenreicheFettwiese oder -weideAE: abgeleitet vonArrhenatheretalia elatioris
Aussehen und VerbreitungMehrere verschiedene Grünlandgesell-schaften aus den bearbeiteten Höhenla-gen werden dieser Gruppe zugeordnet.Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie einenhohen Deckungsanteil an Nährstoffzei-gern haben. Die Vegetationsgruppe imGrenzbereich der Aufnahmeschwelle istin ihrem Aussehen und den übrigen öko-logischen Faktoren relativ heterogen.
Durch die günstigen Feuchtigkeits- undNährstoffverhältnisse im Boden sind dieBeständemeist dicht- und hochwüchsig.Oft finden wir einen mehrschichtigen Auf-bau mit “Obergräsern”, “Untergräsern”und Kräutern in verschiedenen Schich-ten. Die bodennahen Schichten bleibendurch den dichten Wuchs relativ feuchtund kühl. Die Gruppe AE findet sich in al-len Regionen und Höhenlagen. In denRegionen Wallis, Graubünden sowie imSömmerungsgebiet des Jura werden kei-ne “AE-Weiden” kartiert.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein(z.B. mindestens 6 Arten aus der Arten-gruppe MB) und der Deckungsanteil derArtengruppen AE1, AE2 und AE3 über-steigt 25%.
Artengruppe AE1: Fettzeiger der tieferenLagen (Kennarten des Arrhenatherionelatioris).
Artengruppe AE2: Zeiger halbfetter Frisch-wiesen (Kennarten des Festuco-Agros-tion).
Artengruppe AE3: Fettzeiger der höherenLagen (Kennarten des Polygono-Trise-tion).
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Arrhenatheretalia
(4.5)
Ellenberg 1996: . Arrhenatheretalia (5.42)
Oberdorfer 1978: . . . . . Arrhenatheretalia
Mucina et al. 1993: . . . Arrhenatheretalia
CORINE: . . . . Mesophile grasslands (38)
Alle zur Vegetationsgruppe AE gehören-den Bestände sind den Arrhenatheretaliazuzuordnen. Umgekehrt fasst diese Ord-nung die gesamte FettwiesenvegetationMitteleuropas zusammen, während un-sere Einheit nur diejenige berücksichtigt,die über eine gewisse Anzahl vontrockenzeigenden Arten verfügt. Einigedavon bezeichnet Oberdorfer (1994) alsArrhenatheretum brometosum erecti.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 75%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 10%
Wie die meisten anderen Gruppen findenwir auch die AE-Bestände vorwiegend insüdlichen Expositionen, doch es sindauch auffällig viele Objekte an Osthängenzu finden. Weit mehr als die Hälfte derObjekte mit dominanter AE-Vegetationliegen unter 1000 m. Nur wenige AE-Teil-objekte kommen im Sömmerungsgebietvor, allerdings sind für Weiden im Söm-merungsgebiet die Bedingungen derSchlüsselschwelle strenger.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 13%
Der Anteil an der Objektfläche, vor allemaber der Anteil Nennungen ist über-durchschnittlich. Die Vegetationsgruppeist relativ häufig.
Der naturschützerische Wert dieser“Halbfettwiesen und -weiden” wird imVergleich zu den übrigen Einheiten als ge-ring eingestuft, trotz der meist sehr arten-reichen Bestände. Sie sind aber nur inAusnahmefällen Refugien für seltene odergefährdete Arten und in vielen Fällen istdie Artenzusammensetzung relativ trivial.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Die AEMB-Objekte sind meist mässig ge-düngte, wenig intensive Wiesen, diezweimal jährlich gemäht werden. Auchbei den Weiden finden wir meist einemässig intensive Nutzung.
VegetationstypenDie wichtigsten Vegetationstypen sind:
AEMB (75%) – typischer Vegetationstypfür die Gruppe, oft dominiert von Ar-rhenatherum, Dactylis, Galium album,Holcus lanatus, Trisetum flavescens oderFestuca rubra.
AEMBOR (10%) – mit Saumarten, v.a.Cruciata glabra, Fragaria vesca, Gera-nium pyrenaicum, Luzula sylvatica, Trifo-lium medium.
AEMBSC (10%) –mit starker Deckung vonCarex montana.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 179

7 VEGETATION180
ARTENGRUPPE MB1
Anthyllis vulneraria
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulis
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis viciifolia
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr.
Trifolium montanum
ARTENGRUPPE MB2
(diese Arten werden nur zu
MB gezählt, wenn Bromuserectus mind. 5% deckt.)
Briza media
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans
Wiese mit MBAE-Vegetation im Kandertal (BE). Aspekt mit Leucanthemum vulgare.
Frühlingsaspekt von MBAE mit Primula veris.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
In nahezu allen Höhenstufen ist Briza media inhalbfetten Weiden besonders häufig.
Centaurea scabiosa, im Mittelland eher selten,kann in den inneralpinen Tälern mit seiner Unterartssp. alpestris im MBAE zur Dominanz gelangen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 180

1817 VEGETATION
7.3.2 Vegetationsgruppe MBAE
NährstoffreicherHalbtrockenrasenÜbergang Fettwiesen – Halbtrockenra-sen. MB: abgeleitet von Mesobromion,AE: abgeleitet von Arrhenatheretalia ela-tioris
Aussehen und VerbreitungInnerhalb der Halbtrockenrasen der kolli-nen und montanen Stufe steht die Grup-pe MBAE für die etwas nährstoffreicherenVarianten. Sie beinhalten nur beschränktArten aus den subalpinen Regionen undwerden in den meisten Fällen von derAufrechten Trespe (Bromus erectus) undder Fiederzwenke (Brachypodium pinna-tum) dominiert. Daneben finden wir alsBeigräser auch nährstoffzeigende Artenwie das Knaulgras (Dactylis glomerata),den Flaumhafer (Helictotrichon pubes-cens) oder den Rotschwingel (Festucarubra). Im Unterschied zur Gruppe AEMBdominieren aber stets die Kennarten derHalbtrockenrasen.
Die Gruppe ist in der ganzen Schweiz ver-breitet, insbesondere in den trockenwar-men Regionen.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein.Die Vegetation enthält mindestens 6 Ar-ten aus der Artengruppe MB und die De-ckung der fettzeigenden Arten (Arten-gruppen AE1-3) liegt zwischen 5% und25%. Zudem sind die Arten der subalpi-nen Grünlandgesellschaften (Artengrup-pen SV, FV, CF, NS, CA) und der Spezial-gesellschaften CB (VegetationsgruppeCB) und AI (Vegetationsgruppe AI) kaumvertreten.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996:. . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)
Die MBAE-Gesellschaften sind mit derDominanz der typischen Gräser aus demMesobromion klar diesem zuzuordnen.Allerdings handelt es sich nur um nähr-stoffreichere Varianten, die als solchenicht pflanzensoziologisch beschriebensind.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 74%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 10%
Die Bestände sind nicht zwingend anSüdexpositionen gebunden. Aber sie be-vorzugen die Wärme und längere Ve-getationsdauer der tieferen Lagen. Um1000 m gibt es oft einen Grasartenwech-sel von Bromus erectus zu Helictotrichonpubescens oder zu Sesleria caerulea. Inletzterem Falle wird dann aber die Vege-tation der Gruppe SV zugeordnet.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 11%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 24%
MBAE ist die häufigste Vegetationsgrup-pe, sowohl bezüglich ihrer Fläche, alsauch bezüglich der Anzahl Teilobjekte mitdominanter MBAE-Vegetation. Da es sichvorwiegend um Teilobjekte in tieferen La-gen handelt, ist der Flächenanteil im Ver-hältnis geringer. Der naturschützerischeWert ist nur wenig höher als derjenige derGruppe AE.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Die Vegetationsgruppe verteilt sich fastgleichmässig auf Wiesen und Weiden.Brachen mit MBAE sind eher selten.
VegetationstypenDie wichtigsten Vegetationstypen sind:
MBAE (63%) – (typischer) Halbtrockenra-sen mit Fettzeigern; häufigster Vegeta-tionstyp überhaupt.
MBAESC (23%) – Halbtrockenrasen mitFettzeigern, kurzrasige Höhenvariantemitviel Carex montana.
MBAEOR (10%) – Halbtrockenrasen mitFettzeigern und Saumarten.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 181

7 VEGETATION182
ARTENGRUPPE MB1
Anthyllis vulneraria
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulis
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis viciifolia
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr.
Trifolium montanum
ARTENGRUPPE MB2
(diese Arten werden nur zu
MB gezählt, wenn Bromus
erectus mind. 5% deckt.)
Briza media
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans
Typische MB-Wiese im Laufental (BL).
Niederwüchsiges, echtes Mesobromion inhöheren Lagen. Dominierende Arten sind Carexmontana und Trifolium montanum; Kiental (BE).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Bromus erectus, die typische, namensgebendeHauptart des Mesobromion.
Zu einem rechten Mesobromion gehörtSalvia pratensis, die Wiesensalbei.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 182

1837 VEGETATION
7.3.3 Vegetationsgruppe MB
Echter HalbtrockenrasenMB: abgeleitet von Mesobromion
Aussehen und VerbreitungDie eigentlichen, echten Halbtrockenra-sen oderMesobrometen, werden hier et-was enger gefasst als in mancher Litera-tur. Dadurch können feinere Abstufungenim (zeitlichen und räumlichen) Übergangvon trockenen, mageren zu nährstoffrei-chen Vegetationstypen definiert werden.Echte Halbtrockenrasen in unserem Sin-ne haben höchstens noch eine sehrschwache Präsenz von Fettarten undsind meist dominiert von Bromus erectusoder Brachypodium pinnatum, derenHalme weit über die eher niederwüchsigeVegetationsschicht hinausragen. Meistsind die Bestände krautreich und bunt.
Die Gruppe ist in der ganzen Schweiz ver-breitet, ist aber im Mittelland und in denNordalpen bereits sehr selten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein.Die Vegetation enthält mindestens 6 Ar-ten aus der Artengruppe MB und die Ar-tengruppe AE deckt höchstens 5%. Zu-dem sind die Arten der subalpinen Grün-landgesellschaften (Artengruppen SV, FV,CF, NS, CA) und der Spezialgesellschaf-ten CB (Vegetationsgruppe CB) und AI(Vegetationsgruppe AI) kaum vertreten.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)
Die Mesobrometen sind 1938 erstmalsvon Braun-Blanquet und Moor als eigen-ständiger Verband zwischen den Fettwie-sen und den Trockenrasen beschriebenworden. Charakterarten sind Onobrychisviciifolia, Cirsium acaule, Ranunculus bul-bosus, Ononis repens, Orchis morio undandere Orchideen. Im Allgemeinen wer-
den innerhalb des Verbandes die Wiesen(Onobrychido-Brometum, Mesobrome-tum) und Weiden (Carlino-Brometum,Gentiano-Koelerietum) unterschieden.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . .80%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . .4%
Gegenüber nährstoffreicheren Vegeta-tionsgruppen ist die Südlage noch aus-geprägter und die Teilobjekte sind im All-gemeinen tiefer gelegen. Nur in wenigenAusnahmefällen finden wir die Gruppe imSömmerungsgebiet. Die Gruppe konzen-triert sich bereits auf wärmere und tro-ckenere Situationen.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 10%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 23%
MB ist eine der häufigsten Vegetations-gruppen. Zusammenmit der ähnlich häu-figen MBAE-Gruppe umfasst sie fast dieHälfte aller Teilobjekte und auch der Flä-chenanteil beider Gruppen ist sehr gross.
In der Bewertung wird von einem hohenNaturschutzwert der VegetationsgruppeMB ausgegangen. Dieser hoheWert wirdallerdings durch die Häufigkeit der Nen-nungen leicht gemindert (vgl. Kapitel 8,Bewertung).
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
Entsprechend der Konzentration in dentieferen Lagen finden wir vorwiegendMB-Teilobjekte mit Wiesennutzung.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sind:
MB (54%) – (typischer) echter Halbtro-ckenrasen.
MBSC (25%) – Halbtrockenrasen, kurzra-sige Höhenvariante, meist dominiert vonCarex montana.
MBOR (10%) – Halbtrockenrasen mitSaumarten.
MBVC (4%) – saure Halbtrockenrasen. MitLuzula campestris, Genista sagittalis, Ga-lium pumilum.
Spezielle Vegetationstypen sind z.B.:MBMO, MBCD (6%) – WechselfeuchteHalbtrockenrasen, mit Carex flacca, Mo-linia, Succisa.
MBSS (0.5%) – Pionierhafte Halbtrocken-rasen, mit Rumex acetosella, Potentillaargentea, Silene rupestris, Sedum rupes-tre, Sedum acre, u.a.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 183

7 VEGETATION184
ARTENGRUPPE XB
Allium sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster linosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinii
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echium vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularia bisnagarica
Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris
Im MBXB dominieren noch immer die Arten des Mesobromion, aber der Vegetationsschluss ist wenigerdicht, in den Lücken siedeln Arten wie Sempervivum tectorum; bei Sumvitg (GR).
Ebenfalls typisch: der kleine ZwergstrauchTeucrium montanum.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Im trockenen Mesobromion ist Dianthuscarthusianorum häufig.
Stachys recta ist eine der ersten Trockenrasenar-ten, die in die Halbtrockenrasen eindringen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 184

1857 VEGETATION
7.3.4 Vegetationsgruppe MBXB
Trockener HalbtrockenrasenMB: abgeleitet von Mesobromion, XB:abgeleitet von Xerobromion
Aussehen und VerbreitungMit MBXB haben wir eine weitere Gruppevon Übergangsgesellschaften in der Rei-he von nährstoffreicheren zu trockenenVegetationstypen. Die Rasen dieser Grup-pe beherbergen bereits Arten der echtenTrockenrasen (XB), sind aber in ihremAussehen und in der Struktur den Halb-trockenrasen noch nahestehend. Es do-minieren Bromus erectus oder Brachy-podium pinnatum, die noch immer einerelativ dichte Grasnarbe aufbauen. Offe-ner Boden ist nur vereinzelt zu sehen. DieArten der Fettwiesen treten deutlich zu-rück, können aber noch immer vertretensein. Die Gruppe findet sich v.a. entlangdes Jura-Südfusses, in den inneralpinenTälern und im Südtessin.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein.Fettwiesenarten decken nicht mehr als10% und es finden sich zwischen 3-5Kennarten der subatlantischen Trocken-rasen (XB) und kaum Kennarten der sub-kontinentalen Trockenrasen (SP, CB). InHalbtrockenrasen eindringende (konkur-renzkräftigste) Vertreter der ArtengruppeXB sind meist Artemisia campestris, As-perula cynanchica, Carex humilis, Echiumvulgare, Globularia bisnagarica, Stachysrecta und Teucrium chamaedrys. Rasen,die zusätzlich Arten der Blaugrashalde(SV) besitzen, werden auch der GruppeMBXB zugerechnet.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)
Die Bestände der MBXB-Gruppe sindnach der Literatur demMesobromion zu-zuordnen. Sie können keiner Assoziation
zugeordnet werden, da sie speziell dieÜbergänge zwischen Mesobromion undXerobromion beschreiben.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 91%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Noch stärker als die vorherigen Gruppenkonzentrieren sich die Bestände dieserGruppe auf südexponierte Hänge der tie-feren Lagen. Oberhalb der Sömmerungs-linie ist bisher keine dominante Vegetationdieser Gruppe gefunden worden.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 1,7%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 1,6%
Die Gruppe umfasst seltene Vegetations-typen mit hohem Naturschutzwert. Inden meisten Regionen des Mittellandes,der Nordalpen und des Juras stellen siedie wertvollsten, trockensten, in denregenreichen Klimata noch möglichenRasen dar. Die meisten Beschreibungenstammen allerdings aus den KantonenGR und TI.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Bisher sind nur Weiden dieses Typs ge-funden worden. Offenbar sind vor allembei dieser Nutzung durch kleinsträumigeMosaike Übergänge zwischen Trocken-und Halbtrockenrasen möglich. Als Be-gleitvegetation tritt MBXB allerdings auchin Wiesen auf. MBXB kann denn auch alstypische Begleitvegetation angesehenwerden.
VegetationstypenDie Gruppe umfasst hauptsächlich vierverschiedene Vegetationstypen:
MBXB (70%) – (typischer) trockener Halb-trockenrasen.
MBXBSC (16%) – trockener Halbtrocken-rasen, kurzrasige Höhenvariante , oft do-miniert von Carex montana.
MBXBOR (10%) – trockener Halbtrocken-rasen mit Saumarten. charakteristischezusätzliche Arten sind: Vincetoxicum hi-rundinaria, Origanum vulgare, Hypericumperforatum, Peucedanum oreoselinum,Polygonatum odoratum.
MBXBSV (4%) – trockene Halbtrockenra-sen mit Arten der Blaugrashalde , cha-rakteristische zusätzliche Arten sind: Phy-teuma orbiculare, Sesleria varia, Carexsempervirens, Carduus defloratus, Arabisciliata.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 185

7 VEGETATION186
ARTENGRUPPE XB
Allium sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster linosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinii
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echium vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularia bisnagarica
Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris
Subatlantische Trockenrasen können sich in Trockengebieten auf Auenschotterböden etablieren;bei Chancy (GE).
Auch an trockenen, felsigen Südhängen bildensich Xerobromion-Trockenrasen, wie hier amMonte Caslano (TI).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Botriochloa ischaemum ist eine relativunbekannte Trockenrasenart, weil sie erstspät blüht.
Fehlt in fast keinem echten Trockenrasen:Veronica spicata.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 186

1877 VEGETATION
7.3.5 Vegetationsgruppe XB
Subatlantischer TrockenrasenXB: abgeleitet von Xerobromion
Aussehen und VerbreitungAls echte Trockenrasen vermögen dieBestände der XB-Gruppe keine geschlos-sene Grasnarbe mehr auszubilden. DieVerhältnisse sind zu trocken. Die zeitwei-lig hohe Trockenheit wird massgeblichdurch ungünstige Bodenverhältnisse ver-ursacht. Subatlantische Trockenrasen fin-den wir an extrem trocken-warmen, felsi-gen oder kiesigen Standorten, häufig anKalkhängen oder auf Schotterterrassenin Auen. Neben den auffälligen dünnenHorsten von Bromus erectus finden wirverschiedene submediterrane Zwerg-sträucher wie Teucrium chamaedrys,Teucrium montanum, Fumana procum-bens, hingegen kaum Orchideen. Als ty-pische Gesellschaft des westlichen (sub-atlantischen) Mitteleuropas steht es me-diterranen Vegetationstypen relativ nahe.In der Schweiz finden wir die überall sel-tene Gruppe in den Regionen Genf,Unterwallis, Rheintal, Südtessin und ent-lang des Jura-Südfusses.
DefinitionDer Schwellenschlüssel muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegen Felsund Schutt. Die Vegetation enthält min-destens 6 Vertreter der Trockenrasen (Ar-tengruppen XB, SP, CB), wobei die Ar-tengruppen CB und SP kaum vertretensind (höchstens 1 Art aus CB, höchstens2 Arten aus SP).
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . Xerobromion (4.2.2)
Ellenberg 1996: . . . . Xerobromion (5.321)
Oberdorfer 1978: . . . . . . . . Xerobromion
Mucina et al. 1993: . . (fehlt in Österreich)
CORINE: . . . . . . . . subatl. dry calcareous
grasslands (34.33)
Die Xerobrometen treten sehr oft in Ver-zahnung mit Fels- und Felsgrusgesell-schaften (Alysso-Sedion) auf und sind oftin Kontakt mit Gesellschaften des Meso-
bromion. Während das Xerobromion inder Schweiz nur noch marginal vorhan-den ist, werden in Frankreich und West-deutschland verschiedene Assoziationenunterschieden (z.B. Xerobrometum, Tri-nio-Caricetum humilis).
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 96%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Fast alle bisher gefundenen Bestände derGruppe XBwaren in südlicher Exposition.Xerobromion-Bestände auf Auenschot-tern treten anteilsmässig stark zurückund sind als Ausnahme zu betrachten. Daim Kanton GR an felsigen Standorten dieGesellschaft relativ hoch steigen kann, istder Anteil der Tieflagen erstaunlich ge-ring. Bis über die Sömmerungslinie steigtdas XB hingegen nie.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 1,2%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 3,5%
Das Xerobromion ist eine seltene Gesell-schaft und tritt meist kleinflächig auf, oftals Begleitvegetation von Mesobromion-Beständen bei Felsaufstössen und auftrockenen Rippen. Aufgrund der Beher-bergung zahlreicher seltener Tier- undPflanzenarten ist der Naturschutzwertsehr hoch.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Die Xerobromion-Bestände werden alshalbnatürliche Dauergesellschaften an-gesehen, die auch ohne regelmässigeNutzung waldfrei bleiben. Der Weide-druck früherer Zeiten hat die ursprüngli-
che, natürliche Fläche wohl stark ausge-dehnt. In den noch heute genutzten Be-ständen ist die Gefahr der Nutzungsauf-gabe und der damit verbundenen Verbu-schung jedoch auch in der XB-Gruppevorhanden.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sind:
XB (75%) – typische Form, mit Bromuserectus oder Carex humilis als “Haupt-gräser”, daneben mit Koeleria macran-tha, Melica ciliata. Hohe Stetigkeit besit-zen Artemisia campestris, Asperula cyn-anchica, Globularia bisnagarica, Stachysrecta und Teucrium chamaedrys.
XBOR (13%) – mit Saumarten, v.a. Medi-cago falcata, Origanum, Peucedanum,Laserpitium latifolium, Seseli libanotis,Veronica teucrium.
XBSC, XBSV (10%) – entspricht dem Ses-lerio-Xerobrometum der soziologischenLiteratur.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 187

7 VEGETATION188
ARTENGRUPPE SP
Achillea setacea
Achillea tomentosa
Artemisia vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex liparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr.
Hieracium peletierianum
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
Odontites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molinerii
Poa perconcinna
Potentilla pusilla
Pulsatilla halleri
Pulsatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata
Stipa pennata
Veronica dillenii
Ein Mesobromion mit Steppenarten. Bromus erectus mit Festuca valesiaca undGalium verum; bei Nax (VS).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Festuca valesiaca ist eine der ersten Trocken-rasenarten, die in die Halbtrockenraseneindringt.
Im Saum von MBSP-Weiden findet sich manchmal die Orchidee Limodorum abortivum.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 188

1897 VEGETATION
7.3.6 Vegetationsgruppe MBSP
Steppenartiger HalbtrockenrasenMB: abgeleitet von Mesobromion, SP:abgeleitet Stipo-Poion
Aussehen und VerbreitungDie Gruppe MBSP fasst Übergangsge-sellschaften zwischen steppenartigenHalbtrocken- und Trockenrasen zusam-men. Die Kennarten der Trockenvegeta-tion stammen aus dem inneralpinen Sti-po-Poion, das als eigene Vegetations-gruppe (SP) beschrieben wird. Nach derZusammensetzung und Deckung der Ar-ten sind die Gesellschaften noch klar demMesobromion zuzuordnen und auch imAussehen bemerken wir die geschlosse-ne, wenn auch niederwüchsige Grasnar-be. Vermutlich ist die VegetationsgruppeMBSP fast ausschliesslich imWallis und inden inneralpinen Talschaften des Grau-bündens zu finden.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenFels- und Schuttvegetation. Zu den Artendes Mesobromion (mindestens 6 Vertre-ter) gesellen sich vereinzelt extremere Tro-ckenzeiger (Artengruppen XB, SP). DieArtengruppe SP ist dabei mit 2-5 Artenoder mit einer Deckung von 5-25% ver-treten. Arten aus CB oder AI sind kaumvorhanden.
Aus der Artengruppe SP finden wir amehesten Festuca valesiaca, Carex liparo-carpos, Phleum phleoides, Potentilla pu-silla, Pulsatilla montana.
Aus der Artengruppe MB sind haupt-sächlich Bromus erectus, Carex caryo-phyllea, Dianthus carthusianorum, Ga-lium verum, Hieracium pilosella, Pim-pinella saxifraga, Salvia pratensis,Sanguisorba minor, Scabiosa columba-ria, Thymus serpyllum (meist mit denKleinarten T. praecox und T. oeniponta-nus), Trifolium montanum vertreten.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)
Als Übergangsgesellschaft ist das MBSP
in der pflanzensoziologischen Literaturnicht in einem eigenständigen Syntaxongefasst.
Am nächsten kommt wohl das vonBraun-Blanquet beschriebene Gentiano-Centaureetum alpestris (Braun-Blanquet1976) mit Gentiana cruciata, Koeleria er-iostachya und Centaurea scabiosa ssp.alpestris als regionale Kennarten. Hiersind die Arten des Mesobromion starkvertreten.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 75%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
In den inneralpinen Tälern können wir dieGesellschaften der MBSP-Gruppe in fastallen Höhenlagen antreffen, bis über diehier fast an der Waldgrenze gelegeneSömmerungslinie steigen sie allerdingsnicht. Die Bestände sind nicht besondersstark an Südhänge gebunden.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 0,2%
Bisher (vor der Bearbeitung des Wallis)wurden die Gesellschaften der MBSP-Gruppe nur sehr selten gefunden und dieZahlen sind daher noch wenig aussage-kräftig. Die Gruppe umfasst seltene Ve-getationstypen mit hohem Naturschutz-wert.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Die wenigen kartierten MBSP-Vegeta-tionstypen wurden bisher nur in Weidengefunden. Es ist aber zu vermuten, dasssie auch in anderen Nutzungstypen an-zutreffen sind.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 189

7 VEGETATION190
ARTENGRUPPE SP
Achillea setacea
Achillea tomentosa
Artemisia vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex liparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr.
Hieracium peletierianum
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
Odontites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molinerii
Poa perconcinna
Potentilla pusilla
Pulsatilla halleri
Pulsatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata
Stipa pennata aggr.
Veronica dillenii
Steppenartige Weiderasen mit Stipa pennata bei St. Martin (VS).
Steppenartiger Rasen bei Ramosch imUnterengadin (GR) mit Festuca rupicola alsdominierende Grasart.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Die beiden Stipa-Arten Stipa capillata (links) und Stipa pennata (rechts) sind kennzeichnendfür inneralpine Steppenrasen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 190

1917 VEGETATION
7.3.7 Vegetationsgruppe SP
Steppenartiger TrockenrasenSP: abgeleitet von Stipo-Poion
Aussehen und VerbreitungIn grossen inneralpinen Tälern bildet sichdurch die Trockenheit im Regenschattenhoher Gebirgskämme ein Trockenrasenmit steppenhaftem Aussehen und mitosteuropäischen und mediterranen Flo-renelementen.
Die Zentren inneralpiner Trockenvegeta-tion liegen imMittelwallis, in Mittelbündenund im Unterengadin/Münstertal. In denBeständen dominieren borstenblättrigeHorstgräser der Gattungen Festuca, Sti-pa und Koeleria. Nur noch wenige, spe-zialisierte Kräuter können in der extremenSommertrockenheit und Winterkälte dieZwischenräume besiedeln. Im zeitigenFrühjahr nutzen annuelle Ephemeren dieverbleibenden nackten Zwischenräumefür ihr Gedeihen aus.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenFels- und Schuttvegetation. Es müssenmindestens 6 Trockenrasenarten (Arten-gruppen SP, XB, CB) vertreten sein. Zu-sätzlich müssen entweder mindestens 3Steppenarten (Artengruppen SP, CB) vor-kommen oder 1-2 Steppenarten deckenzusammen mehr als 10% der Vegeta-tionsfläche.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . Stipo-Poion (4.2.1.1)
Ellenberg 1996: Festucion valesiacae
(5.42)
Oberdorfer 1978: Stipo-Poion xerophilae
Mucina et al. 1993: Stipo-Poion xerophilae
CORINE: Western/eastern inner Alpine
grasslands (34.313 und 34.314)
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 85%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Die Vegetationsgruppe ist stark an tiefereLagen und südliche Exposition gebun-den. Oberhalb der Sömmerungslinie istsie bisher nicht gefunden worden.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 1,2%
Solange dasWallis und das Unterengadinnoch nicht bearbeitet sind, bleiben so-wohl Flächen-, als auch Nennungsantei-le gering. In den Kantonen SG und GRist die Vegetationsgruppe bisher nurschwach vertreten. Alle Vegetationstypender Gruppe sind als naturschützerischsehr wertvoll zu bezeichnen, da sie einegrosse Vielfalt an seltenen Tier- und Pflan-zenarten aufweisen.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Durch ihre trockenheitsbedingte, schwa-che Produktivität sind SP-Trockenrasenfast ausschliesslich Brachen oder äus-serst extensiv genutzte Kleinviehweiden.
VegetationstypenHäufige Vegetationstypen sind bisher(ohne Wallis):
SP (75%) – typischer Steppenrasen, do-miniert von Festuca valesiaca, Festucarupicola oder Stipa pennata, manchmalauch von Bromus erectus; mit vielen Be-gleitern aus den Gruppen SP und XB.
SPAI (25%) – Steppenrasen mit Ruderal-zeigern, Übergang zum AI, mit Artemisiaabsinthium, Convolvulus arvensis, Ono-nis natrix, Tragopogon dubius.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 191

7 VEGETATION192
ARTENGRUPPE CB
Adonis vernalis
Astragalus depressus
Astragalus exscapus
Danthonia alpina
Gentiana cruciata
Gladiolus imbricatus
Hieracium cymosum
Hypochaeris maculata
Inula hirta
Onobrychis arenaria
Oxytropis halleri s.l.
Potentilla alba
Potentilla heptaphylla
Selaginella helvetica
Seseli annuum
Silene coronaria
Thesium bavarum
Thesium linophyllon
Veronica prostrata
Vicia lutea
Subkontinentale Halbtrockenrasen am Monte Caslano (TI) mit Chrysopogon gryllus, Inula hirta,Thesium linophyllon und Potentilla alba.
Trockene Weide mit Adonis vernalis bei Nax (VS).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Das osteuropäische Thesium bavarum findetsich im Saum von Halbtrockenrasen undFöhrenwäldern.
Auch für Inula hirta liegt das Hauptverbreitungs-gebiet in Osteuropa.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 192

1937 VEGETATION
7.3.8 Vegetationsgruppe CB
Subkontinentaler TrockenrasenCB: abgeleitet von Cirsio-Brachypodion
Aussehen und VerbreitungDie Vegetation der CB-Gruppe ist meistdichter und etwas üppiger als diejenigeder XB- oder SP-Gruppe. Allerdings kön-nen die Bestände, die in dieser Gruppezusammengefasst sind, sehr unterschie-dlich aussehen. Sie sind gegenüber derohnehin schon schwachen pflanzenso-ziologischen Definition des Cirsio-Bra-chypodion nochmals weiter gefasst. Siealle vereint das Vorhandensein von sub-kontinentalen, osteuropäischen Arten,die teilweise in der Schweiz ihre westlich-sten Vorposten haben. Aus der Sicht desSchutzes der Biodiversität ist die Vegeta-tionsgruppe CB eine wichtige Einheit mitseltenen östlichen Flora-Elementen inRandpopulationen. Die hauptsächlichenVorkommen von CB-Vegetationstypensind im östlichen Tafeljura (Kanton SH),dem Rheintal, in den Südalpentälern undim Wallis zu erwarten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere in der Abgrenzung gegenFels-, Ruderal- und Schuttvegetation. DieVegetation enthält in einer Testflächemin-destens zwei Arten aus der ArtengruppeCB oder eine Art aus CB deckt mehr als5% der Vegetationsfläche.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Cirsio-Brachypodion
(4.2.1.2)
Ellenberg 1996: Cirsio-Brachypodion
(5.312)
Oberdorfer 1978: . . Cirsio-Brachypodion
Mucina et al. 1993:Cirsio-Brachypodion
pinnati
CORINE: . . Mesophile Central European
steppic grasslands (34.3122)
Obschon durch die Steppenarten denmitteleuropäischen Steppengesellschaf-ten (Festucetalia valesiacae) nahe, wirdder Verband heute eher den halbtrocke-
nen Brometalia zugeordnet. Das Cirsio-Brachypodion steht also dem Mesobro-mion recht nahe.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 94%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Die wenigen bisherigen Aufnahmen zei-gen eine starke Bindung an Südexposi-tionen und an tiefere Lagen. Bisher wur-den fast nur aus dem Kanton TI Bestän-de gemeldet, es ist aber zu erwarten,dass sie auch in den Kantonen GR undVS noch gefunden werden.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 0,4%
Anzahl Nennungen absolut . . . . . . . . . 18
Die Vegetationsgruppe ist insgesamt sehrselten. Sie ist naturschützerisch als be-sonders wertvoll zu gewichten.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Aufgrund der wenigen Daten kann ge-schlossen werden, dass es sich bei derCB-Gruppe vorwiegend umWiesen oderBrachen handelt. Die Weidenutzungscheint die Populationen der seltenenCB-Arten nicht zu begünstigen.
VegetationstypenDie wichtigsten Vegetationstypen sind:
MBCB (30%) – subkontinentaler Halbtro-ckenrasen: die mehr oder weniger typi-sche Form.
MBXBCB (10%) – Übergang vom subkon-tinentalen Halbtrockenrasen zum Tro-ckenrasen.
XBCB (60%) – subkontinentaler Trocken-rasen.
Die Bestände enthalten fast immer Saum-arten (Artengruppe OR), seltener auchWechselfeuchtezeiger (ArtengruppeMO).
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 193

7 VEGETATION194
HÄUFIGDOMINIERENDEGRASARTEN
Agropyron intermedium
Agropyron pungens
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Festuca valesiaca
Melica transsilvanica
Phleum phleoides
Stipa capillata
Stipa pennata
Trockene Brache mit Bromus erectus als dominierende Grasart; bei Lamboing (BE).
AILL ist ein artenarmer, halbruderaler Rasen mitAgropyron intermedium; bei Vernamiège (VS).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Das ausläufertreibende Brachypodium pinnatumist eine häufige Art halbtrockener Brachen.
SPLL ist meist ein lückiger, artenarmer Steppen-rasen mit Festuca valesiaca; bei Nax (VS).
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 194

1957 VEGETATION
7.3.9 Vegetationsgruppe LL
Artenarmer Trockenrasender tieferen LagenLL: abgeleitet von “low diversity,low altitude”
Aussehen und VerbreitungAlle Trockenrasen der tieferen Lagen, dienicht über genügend Zeigerarten verfü-gen, um einer der artenreichen Vegeta-tionstypen zugeordnet zu werden, sindim Vegetationsschlüssel speziell aufge-führt. Er unterscheidet in Abhängigkeitder dominanten Gräser mehrere Typen,die hier in der Gruppe LL zusammenge-fasst werden. Gemeinsames Merkmal al-ler Bestände dieser Gruppe ist die domi-nante Deckung von meist nur einer Gras-art. Die Grasfluren können hoch- oderniederwüchsig sein, Halbtrocken- oderTrockenrasen bilden. Sie sind krautarmund durch ihre Blütenarmut etwas eintö-nig. Bei horstigen Gräsern (Bromus ere-ctus, Festuca spp.) siedeln sichFrühjahrsannuelle in den Lücken zwi-schen den Horsten an. Ausläufertreiben-de Gräser wie Brachypodium oder Agro-pyron bilden hingegen einen dichten Filz,in dem sich andere Arten kaum ansiedelnkönnen.
Artenarme Trockenrasen sind in allen Re-gionen der Schweiz anzutreffen.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegen dieFettwiesen (AE deckt weniger als 50%)und Hochstauden- und Ruderalarten(z.B.Calamagrostis spp.,Bromus inermisoder Bromus sterilis decken weniger als50%). Die Zahl der Zeigerarten für Tro-ckenvegetation ist zu klein, denn aus kei-ner der Artengruppen AI, XB, SP, CB, MBsind 6 Arten vorhanden. Hingegen bede-cken AI (v.a. Agropyron intermedium)oder SP (v.a. Festuca valesiaca s.l.) oderMB (v.a. Bromus erectus, Festuca ovinaund Brachypodium pinnatum) mehr als25% der Vegetationsdecke.
PflanzensoziologieDie Bestände der LL-Gruppe sind nichtdirekt mit einer pflanzensoziologischenEinheit zu korrelieren. Sie stammen vielm-ehr von verschiedenen Verbänden, wiedem Mesobromion, dem Xerobromion,Stipo-Poion, usw. und sind in den jewei-ligen Verbänden als verarmte oder arten-arme Varianten anzusehen. Bei Delarze etal. werden sie unter “4.6. Grasbrachen”zusammengefasst.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 63%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Artenarme, trockene Grasgesellschaftensind in allen Expositionen zu finden, siesteigen aber selten über 1000 m an, dasie ab dieser Höhe bald durch subalpineartenarme Grasgesellschaften abgelöstwerden.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 7%
Beurteilt nach der Anzahl von Teilobjektensind solche bracheartige Grasfluren rela-tiv verbreitet. Durch die noch zu bearbei-tenden grossen Gebiete von GR und VS,in denen in den letzten Jahrzehntengrossflächig Extensivierungen stattfan-den, dürfte der Anteil sogar noch anstei-gen. Der Naturschutzwert ist gegenüberanderen Vegetationsgruppen vermindert.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 195

7 VEGETATION196
In eine vergandende Fläche dringen Saumarten ein. Vincetoxicum hirundinaria bei Pontirone (TI).
Trockene Hochstaudenfluren werden oft vonArten der Gattung Laserpitium dominiert undbilden ein ORLA.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Geranium sanguineum ist namensgebende Artder trockenen Saumgesellschaften Mittel-europas.
In inneralpinen Tälern ist Trifolium alpestre einehäufige Saumart.
ARTENGRUPPE OR1Anthericum ramosumAquilegia atrataAquilegia vulgarisAstragalus glycyphyllosAstragalus penduliflorusBupleurum falcatumCampanula rapunculoidesCentaurea triumfettiiCirsium erisithalesCruciata glabraCytisus nigricansDigitalis sp.Geranium sanguineumHypericum montanumHypericum perforatumLaserpitium latifoliumLaserpitium silerLathyrus sylvestrisLilium bulbiferum s.l.Lilium martagonMedicago falcataMelittis melissophyllumOriganum vulgarePeucedanum cervariaPeucedanum oreoselinumPeucedanum verticillarePolygonatum odoratumPotentilla rupestrisRosa pimpinellifoliaSecurigera variaSeseli libanotisSeseli montanumTanacetum corymbosumThalictrum foetidumThalictrum minus
Trifolium alpestreTrifolium rubensVeronica teucriumVincetoxicum hirundinariaViola hirta
ARTENGRUPPE OR2Aegopodium podagrariaAlliaria petiolataAnemone nemorosaAposeris foetidaChaerophyllum aureumClinopodium vulgareCruciata laevipesEupatorium cannabinumFragaria vescaGalium aparineGeranium pyrenaicumGeranium robertianumGeum urbanumGlechoma hederaceaImpatiens noli-tangereImpatiens parvifloraLamium sp.Lapsana communisLuzula silvatica aggr.Mycelis muralisPotentilla reptansRubus fruticosus aggr.Rubus idaeusSambucus ebulusSolidago virgaureaTrifolium mediumVicia craccaVicia sepium
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 196

1977 VEGETATION
7.3.10 Vegetationsgruppe OR
Trockene SaumgesellschaftOR: abgeleitet von Origanetalia
Aussehen und VerbreitungSaumgesellschaften können oft grössereFlächen einnehmen, insbesondere inWaldlichtungen, bei extensiverWeidenut-zung oder bei Brachen. CharakteristischeArten wie Hypericum perforatum oderVincetoxicum hirundinaria, die regelmäs-sigen Schnitt nicht vertragen, breiten sichaus.
In schattigen Lagen dringen auch Wald-rand- und Waldpflanzen vor. Wird dieNutzung vollständig aufgegeben, danndringen auf frischen und feuchten Bödenrasch Gehölzarten ein und die Flächenverbuschen. Je trockener die Bodenver-hältnisse sind, desto länger kann sich ei-ne Krautgesellschaft halten.
Viele der hier zusammengefassten Be-stände sind denn auch Dauergesell-schaften, in denen typische Saumartendominieren. Die Vegetation ist dicht undhochwüchsig. Viele Pflanzen sind an derBasis verholzt. Sehr auffällig ist die häufi-ge Dominanz der Doldenblütler (Apia-ceae), v.a. aus den Gattungen Peuceda-num und Laserpitium, die mit ihrer spätenBlütezeit den Sommeraspekt der trocke-nen Saumgesellschaften bilden.
Die Gruppe ist in allen Regionen vertre-ten. Während sie im intensiv genutztenMittelland selten ist, finden wir sie v.a. imAlpenraum ziemlich häufig.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenme-sophile (frisch-feuchte) Saumgesellschaf-ten (dominiert von der Artengruppe OR2).Auch fehlen die typischen Arten derGruppen XB, SP und CB und in den hö-heren Lagen die Arten der Gruppen FV,CF, SV, NS. Dagegen dominieren die Ar-ten der Artengruppe OR1.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Geranion sanguinei
(5.1.1)
Ellenberg 1996: Geranion sanguinei
(6.112)
Oberdorfer 1978: . . . Geranion sanguinei
Mucina et al. 1993: . Geranion sanguinei
CORINE: . . . . . Xero-thermophile fringes
(34.41)
Als Zeigerarten für Saumgesellschaftendienen sowohl trockenheitsertragende,als auch mesophile Halbschattenpflan-zen. Sie sind soziologisch der OrdnungOriganetalia zugeordnet und teilen sich indie beiden Verbände Geranion sanguinei(trockene Gesellschaften) und Trifolionmedii (frisch-feuchte Gesellschaften). Al-le in der OR-Gruppe zusammengefas-sten Bestände stehen dem Geranionsanguinei nahe. Ein spezieller Vegeta-tionstyp ist das ORLA, eine von Laserpi-tium-Arten dominierte hochstaudenartigeGesellschaft. Soziologisch wird sie alsBupleuro-Laserpitietum auch dem Gera-nion zugeordnet, besitzt aber im Alpen-raum zahlreiche Übergänge zum Sesle-rion und Caricion ferrugineae.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 85%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 15%
Nur deutlich südexponierte Bestände er-füllen die Schlüsselschwelle, in feuchtererLage dominieren rasch Arten aus derGruppe OR2. Die OR-Gruppe kommt inallen Höhenlagen vor.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 2%
Eine grössere Fläche bedecken OR-Ge-sellschaften wohl nur im Sömmerungs-gebiet, wo sie aber nur kartiert werden,wenn eine Nutzung erfolgt. Im Allgemei-nen ist die Gruppe eher selten und erhältgegenüber den Trockenwiesen einen ver-minderten naturschützerischen Wert.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Am ehesten sind die hochwüchsigen Be-stände bei extensiver Wiesennutzung inGrenzlagen oder bei Brachen in steilenHängen anzutreffen.Nur selten sind sie be-weidet und auch dann nur sehr extensiv.
VegetationstypenDie wichtigsten Vegetationstypen sindbisher:
ORLA (35%) – montan-subalpine, trocke-ne Hochstaudengesellschaft, dominiertvon Laserpitium latifolium oder Laserpi-tium siler.
ORAE (30%) – trockene Saumgesellschaftmit Fettzeigern, v.a.Galium album, Knau-tia arvensis, Agrostis capillaris, Arrhena-therum.
ORAELA (25%) – wie ORLA, aber mit Fett-zeigern.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 197

7 VEGETATION198
ARTENGRUPPE AI
Agropyron intermedium
Agropyron pungens
Anchusa officinalis
Artemisia absinthium
Asparagus officinalis
Ballota nigra
Bromus squarrosus
Bromus tectorum
Bunias orientalis
Camelina microcarpa
Chondrilla juncea
Convolvulus arvensis
Descurainia sophia
Diplotaxis tenuifolia
Isatis tinctoria
Melampyrum arvense
Melica transsilvanica
Muscari comosum
Nepeta sp.
Ononis natrix
Onopordum acanthium
Poa angustifolia
Poa compressa
Reseda lutea
Scorzonera laciniata
Sisymbrium strictissimum
Tragopogon dubius
Turritis glabra
Verbascum lychnitis
Vicia onobrychioides
Halbruderaler Trockenrasen mit Agropyronintermedium und Convolvulus arvensis; beiSaillon (VS).
Zwischen den Wermutstauden wächstMelampyrum arvensis ssp. schinzii.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Für den oft silbergrauen Anblick der Gesellschaftist der Wermut (Artemisia absinthium) mitverant-wortlich.
Im Frühsommer gibt Vicia onobrychioides derGesellschaft einen blauvioletten Überzug.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 198

1997 VEGETATION
7.3.11 Vegetationsgruppe AI
Halbruderaler TrockenrasenAI: abgeleitet von Artemisio-Agropyrionintermedii
Aussehen und VerbreitungIn den inneralpinen Trockentälern findenwir eine Gesellschaft, die sich ökologischzwischen den steppenartigen Trockenra-sen (Stipo-Poion, SP) und den ruderalenQueckenrasen (Agropyretalia repentis)ansiedelt. Sie hat pionierhaften Charakter,erschliesst rasch die aufgelassenenÄcker oder offene Stellen im extrem tro-ckenen Grünland (Erdanrisse, Weidetrit-te). Hier zeigt sich die typische Eigen-schaft der Queckenrasen, mit ihren Aus-läufern auch grössere Erdflächen raschzu überziehen. Zu den Kennarten von SPund Agropyretalia gesellen sich stets tro-ckenheitsertragende Ruderalarten, die ih-ren Schwerpunkt in den Onopordetalia(xerotherme zweijährige Ruderalgesell-schaften) haben. Auch in trockenwarmenGebieten ausserhalb der Inneralpen kön-nen sich halbruderale Trockenrasen ein-stellen, die eine floristisch ähnliche Zu-sammensetzung besitzen. So sind AI-Ge-sellschaften auch in GE, BS, SH, TI undentlang dem Jura-Südfuss vorhanden.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenü-ber Ruderalgesellschaften (ArtengruppeAV deckt maximal 50%). Die Vegetationenthält mindestens 3 Arten aus der Grup-peAI und kaumArten aus derGruppeCB.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . . . . . . . Convolvulo-
Agropyrion (4.6.1)
Ellenberg 1996: . . . . Artemisio absinthii-
Elymion (3.552)
Oberdorfer 1978: Artemisio-Agropyrion
intermedii
Mucina et al. 1993: Agropyro-Artemi-
sietum und Convolvulo-Agropyrion
CORINE: . . . . . ruderal communities (87)
Halbruderale Trockenrasen werden so-ziologisch unterschiedlich aufgefasst. Un-seren Beständen am nächsten kommtdas in Mucina at al. (1993) angegebeneAgropyro-Artemisietum, das dort demStipo-Poion untergeordnet wird. Mit un-serer Definition der Artengruppe werdenaber auch Gesellschaften des Convolvu-lo-Agropyrion erfasst.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . 100%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . 0%
Halbruderale Trockenflächen finden wirnur in südlicher Exposition und in tieferenLagen.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 1%
Anzahl Nennungen absolut . . . . . . . . . 16
Bisher (vor der Kartierung des VS) wur-den Gesellschaften der AI-Gruppe seltengefunden. Da die Hauptverbreitung inden noch nicht kartierten Regionen En-gadin und VS liegt, werden sich die Zah-len noch ändern. Der artenreiche halbru-derale Trockenrasen gilt als naturschüt-zerisch überdurchschnittlich wertvoll.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Aus den bisherigen Zahlen kann bereitsgeschlossen werden, dass die Gesell-schaft nur ausnahmsweise gemäht wird.Manchmal werden die AI-Flächen exten-siv mit Schafen beweidet, meist aber lie-gen sie brach.
VegetationstypenDie wichtigsten Vegetationstypen sindbisher:
AI (25%) – echter halbruderaler Trocken-rasen mit mindestens 6 Arten aus der Ar-tengruppe. Häufig dominierende Artensind Agropyron intermedium, Convolvu-lus arvensis, Artemisia absinthium.
SPAI (50%) – Übergänge zum Steppen-rasen, Arten der Gruppe SP dominieren,v.a. Festuca valesiaca.
MBAI (25%) – Übergänge zum Halbtro-ckenrasen, Arten der Gruppe MB domi-nieren, v.a. Bromus erectus.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 199

7 VEGETATION200
ARTENGRUPPE SV1
Acinos alpinus
Arabis ciliata
Bupleurum ranunculoides
Carduus defloratus s.l.
Coronilla vaginalis
Daphne striata
Dryas octopetala
Erica carnea
Gentiana verna
Globularia cordifolia
Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides
Helianthemum alpestre
Hieracium villosum
Kernera saxatilis
Oxytropis campestris
Phyteuma orbiculare
Potentilla crantzii
Primula auricula
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sedum atratum
Sedum dasyphyllum
Sesleria caerulea
Thesium alpinum
Subalpine SVSV-Weide mit Sesleria caerulea und Onobrychis montana; Lukmanierpass (TI).
Auf Kalkfelsen, wie hier an der Ruine Haldenstein(GR) dringen Blaugras-Bestände bis in tiefereLagen herab.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Blütenstiel von Carduus defloratus. Als Spalier-Zwergstrauch kann Dryas octopetalagrössere Flächen überwachsen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 200

2017 VEGETATION
7.3.12 Vegetationsgruppe SV
BlaugrashaldeSV: abgeleitet von Seslerion variae
Aussehen und VorkommenDas hauptsächliche Vorkommen derBlaugrashalden liegt an sonnigen, tro-ckenen Kalkhalden in der alpinen Stufe.Doch die Gesellschaft steigt regelmässigin die subalpine oder sogar bis in diemontane Stufe herab, bleibt aber aufflachgründigen Rendzina-Böden. Sie istsowohl in den Kalkalpen wie auch im Ju-ra verbreitet und durchmischt sich in tie-feren Lagen mit dem Mesobromion undin seltenen Fällen auch mit dem Xerobro-mion.
Die Vegetation wird durch horstwüchsigeGräser und Seggen aufgebaut und er-scheint dadurch an den Hängen oft trep-pig oder girlandenförmig. Zwischen denHorsten entstehen Mikrohabitate, in de-nen sich Kraut- und Zwergsträuchlein an-siedeln (insbesondere Fabaceen), und dieso zum Artenreichtum der typischen Be-stände beitragen. In tieferen Lagen wer-den felsige Blaugrashalden durch Laser-pitium-Arten durchdrungen und werdendann dem ORLA zugeordnet.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenSchutt und Fels. Die Vegetation enthältmindestens 6 Arten aus den Artengrup-pen MB und SV, davon mindestens 4 ausder Artengruppe SV. Die ArtengruppenXB, SP, CB, AI, SV2 sind kaum vertretenund die Vegetation kann nicht bereits derGruppe FV bzw. CF zugeordnet werden.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . . . . Seslerion (4.3.1)
Ellenberg 1996: Seslerion albicantis
(4.711)
Oberdorfer 1978: . . . Seslerion albicantis
Mucina et al. 1993: . Seslerion caeruleae
CORINE: Blue moorgrass slopes (36.431)
Die zentrale Assoziation des Verbandesist das klassische Seslerio-Caricetumsempervirentis, das bereits in den 20er-Jahren von Braun-Blanquet beschriebenwurde. Hier sindCarex sempervirens undSesleria caerulea dominant und werdenregelmässig von Arten wie Helianthe-mum, Anthyllis, Thymus und Hieraciumbegleitet. In tieferen Lagen und ausser-halb der Alpen wird das Seslerion arten-ärmer undwird als Laserpitio-Seslerietumbeschrieben. Zusätzliche typische Artensind hier Anthericum ramosum, Carexhumilis, Thlaspi montanum, Laserpitiumlatifolium.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 75%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 55%
Obschon SV-Vegetation vorwiegendSüdhänge in höheren Lagen besiedelt, sokommt doch eine stattliche Anzahl Be-stände bis unter 1000 m vor, hier aller-dings fast nur in Südhängen. Der Haupt-anteil der Vegetationsgruppe liegt imSömmerungsgebiet.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 15%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . 19%
Sowohl gemessen an der Fläche als auchan der Anzahl Nennungen ist die SV-Gruppe häufig bis sehr häufig. Ihr wirddurch diemeist hohe Artenzahl und durchdas regelmässige Vorkommen seltenerArten ein überdurchschnittlicher Natur-schutzwert zugeordnet.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Typische Blaugrashalden werden meistvon Kleinvieh beweidet. Unter den nochdieser Vegetationsgruppe zugeordnetenÜbergängen zu den Halbtrockenrasen(MBSV, MBAESV) sind aber oft auch Wie-sen anzutreffen. Brachen sind selten, dasie im Sömmerungsgebiet nicht aufge-nommen werden.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sindbisher:
SVSV –typisches Seslerion, dominiert vonSesleria.
SVAESV – Blaugrashalde mit Fettzeigern,meist mit Trollius, Festuca rubra, Ligusti-cum mutellina.
MBSV, MBAESV – Übergänge zu Halbtro-ckenrasen; von Bromus oder Brachypo-dium dominierte Rasen mit Gentiana ver-na, Carduus defloratus, Scabiosa lucida,Phyteuma orbiculare, Sesleria caerulea.
AEMBSV – Übergang zu Fettwiesen, mitTrollius, Chaerophyllum villarsii, Dactylis,Galium album.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 201

7 VEGETATION202
ARTENGRUPPE SV2
Aquilegia einseleana
Carex austroalpina
Centaurea rhaetica
Cytisus emeriflorus
Fourraea alpina
Horminum pyrenaicum
Knautia transalpina
Pedicularis gyroflexa
Stachys alopecuros
Südalpine Blaugrashalde mit Carex austroalpina; Denti della Vecchia (TI).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Eine wichtige Kennart der bündnerischenCA-Bestände ist Horminum pyrenaicum.
An den Denti della Vecchia finden wir noch ausgedehntere Bestände der südalpinen Blaugrashalde.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 202

2037 VEGETATION
7.3.13 Vegetationsgruppe CA
Südalpine BlaugrashaldeCA: abgeleitet vonCaricion austroalpinae
Aussehen und VerbreitungDurch die günstige geographische Lagewährend der letzten Eiszeit konnten inden Südalpen zahlreiche Florenelementeüberdauern und sich weiterentwickeln.Grundsätzlich ähnlich aufgebaut wie dienördlichen Blaugrashalden zeichnen sichdie südlichen Blaugrashalden durch hö-heren Artenreichtum und das Vorkom-men von südalpinen Endemiten aus. DieGesellschaft besiedelt Kalkhänge von dermontanen bis zur alpinen Stufe und hatihre grösste Ausdehnung in der subalpi-nen Stufe. Die südlichen Randketten derAlpen stehen heute unter submediterra-nem Klimaeinfluss. Die Kalkdecken derSüdalpen erreichen die Schweiz nur imsüdlichen Tessin. Südostalpine Kalke, dieim Gebiet des Münstertales und desOfenpasses bis in die Schweiz vordrin-gen, haben ähnliche Florenelemente undwerden hier der CA-Gruppe zugeordnet.Die schweizerischen Vorkommen ent-sprechen somit dem nordwestlichen Are-alrand der Gesellschaft und sind dahererwartungsgemäss relativ verarmt ansüdalpinen Arten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenSchutt und Fels. Die Vegetation enthältmindestens zwei Kennarten der südalpi-nen Blaugrashalde (Artengruppe SV2).
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Ellenberg 1996: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Oberdorfer 1978: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Mucina et al. 1993: Caricion austroalpinae
CORINE: . . . . . . . . Southern rusty sedge
grasslands (36.413)
Durch sein kleines Areal am Rande dergeographischen Abdeckung der mittel-europäischen pflanzensoziologischenÜbersichtswerke ist der Verband kaum
abgehandelt worden. Selbst Delarze etal. (1999) erwähnen den Verband nicht.Sutter (1962) hat bei der Originalbe-schreibung des Verbandes vier Assozia-tionen zusammengefasst.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . 100%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . 100%
Bisher wurde die CA-Vegetationsgrup-pe nur in steilen Südhängen zwischen1250 - 1500 m angetroffen.
Häufigkeit und BewertungAnzahl Nennungen bisher . . . . . . . . . . . 3
Vegetationstypen mit CA-Arten sind sehrselten und besitzen durch ihren Arten-reichtum und ihre biogeographische Be-deutung einen sehr hohen Naturschutz-wert.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66%
Die steilen Kalkhänge werden kaum ge-nutzt. Die Brachen in der INT-Region sindals Singularitäten aufgenommen worden.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 203

7 VEGETATION204
ARTENGRUPPE CF
Allium victorialis
Anemone narcissiflora
Astrantia major
Calamagrostis varia
Campanula thyrsoides
Carex ferruginea
Centaurea montana
Crepis bocconei
Festuca pulchella
Globularia nudicaulis
Gnaphalium norvegicum
Heracleum elegans
Hypericum maculatum
Lathyrus occidentalis
Onobrychis montana
Pedicularis foliosa
Phleum hirsutum
Pulsatilla alpina
Traunsteinera globosa
Trifolium badium
Trockene Rostseggenhalde mit Onobrychis montana und Helianthemum grandiflorum;im Schanfigg (GR).
In der Innerschweiz werden noch immer zahlrei-che Rostseggenhalden als Wildheu gemäht, wiehier am Stanserhorn.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Pulsatilla alpina und Traunsteinera globosa sindtypische Arten der Rostseggenhalde.
Gemähte Rostseggenhalde mit Centaurea mon-tana Stanserhorn (NW).
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 204

2057 VEGETATION
7.3.14 Vegetationsgruppe CF
RostseggenhaldeCF: abgeleitet von Caricion ferrugineae
Aussehen und VerbreitungAuf den tiefgründigen Böden von Kalk-und Flyschhängen in der subalpinen Stu-fe prägen langhalmige, graminoide Artendie Vegetation. Solche Bestände, die vonCarex ferruginea, Festuca violacea, Cala-magrostis varia und Phleum hirsutum do-miniert werden, sind hier zur Vegetations-gruppe CF zusammengefasst. Mit die-sem breiten Ansatz umfasst die GruppeVegetationstypen mit recht unterschied-lichen floristischen Zusammensetzungen.Die Begleitflora ist oft sehr artenreich undblumig, mit fein- und grossblättrigen Ar-ten. Die Pflanzen sind in den steilen Hän-gen Lawinendruck und Erosionsbewe-gungen ausgesetzt, sind aber währendder Vegetationsperiode gut durchfeuch-tet. Entlang von Lawinenrunsen undWildbächen können CF-Gesellschaftenbis in die montane Stufe hinabdringen.
Die Hauptvorkommen der Gruppe liegenin den Nordalpen und im Kanton GR. ImJura, imWallis und im Tessin ist sie selten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegensubalpine Fettwiesen, Hangmoore (Moor-schlüssel) und Gebüsche (v.a. mit Alnusviridis). Die Vegetation wird vonCarex fer-ruginea dominiert oder es finden sich aufeiner Testfläche 6 Arten aus der Arten-gruppe CF. Arten aus den Gruppe FV1und FV2 sind kaum vorhanden.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999:Caricion ferrugineae
(4.3.3)
Ellenberg 1996: Caricion ferrugineae
(4.712)
Oberdorfer 1978: . . Caricion ferrugineae
Mucina et al. 1993: . Caricion ferrugineae
Calamagrostion variae
CORINE: . . . . . . . . Northern rusty sedge
grasslands (36.412)
Violet fescue swards (36.414)
Jura summital swards (36.416)
Die hochrasigen, mesophilen Kalkhang-fluren der mittel- und südeuropäischenGebirge werden soziologisch im VerbandCaricion ferrugineae zusammengefasst.Er steht, v.a. bei seinen trockeneren Vari-anten, floristisch dem Seslerion nahe. ImAllgemeinen werden auch die Violett-schwingelrasen (Festuco-Trifolietum tha-lii) hier eingeschlossen. Im Jura ist die Ge-sellschaft nur fragmentarisch ausgebildetund wird manchmal als Calamagrostionvariae gefasst. Dieser Verband wird hiernicht abgetrennt.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 60%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 85%
Die CF-Vegetationsgruppe umfasst typi-sche Gesellschaften der subalpinen Stu-fe und fand sich bisher kaum in tieferenLagen. Die Exposition ist viel wenigerstreng nach Süden gerichtet als bei an-deren Vegetationsgruppen.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . 10%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 4%
Obschon die Häufigkeit nach Anzahl rela-tiv bescheiden ist, nimmt die Vegeta-tionsgruppe eine beachtliche Fläche ein.Dies weist darauf hin, dass die Teilobjek-te mit CF-Vegetation überdurchschnitt-lich gross sind. Durch ihren Reichtum anspezifisch alpinen Arten wird der Natur-schutzwert als leicht überdurchschnittlicheingeschätzt.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Da im Sömmerungsgebiet keine Brachenaufgenommen werden, ist deren Anteilentsprechend klein. Die Mehrzahl dernoch genutzten Flächen mit CF-Vegeta-tion sind Bergwiesen. Steile Hänge mitder besonderen Nutzungsform der Wild-heuwiesen sind meist von der CF-Vege-tationsgruppe dominiert.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sind bis-her:
CFCF (25%) – typische artenreiche Rost-seggenhalde.
CFAECF (35%) – artenreiche, fette Rost-seggenhalde, oft mit Trollius, Festuca ru-bra, Ligusticum mutellina.
MBCF, MBAECF (35%) – tiefergelegeneÜbergänge zu Halbtrockenrasen, meistdominiert von Bromus, Brachypodiumoder Carex montana.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 205

7 VEGETATION206
ARTENGRUPPE NS1
Avenella flexuosa
Carex fritschii
Carex leporina
Nardus stricta
ARTENGRUPPE NS2
Antennaria dioica
Arnica montana
Astrantia minor
Campanula barbata
Crepis conyzifolia
Gentiana punctata
Gentiana purpurea
Geum montanum
Hieracium lactucella
Hypochaeris uniflora
Leontodon helveticus
Meum athamanticum
Nigritella rhellicani
Potentilla aurea
Pseudorchis albida
Ranunculus villarsii
Sempervivum montanum
Trifolium alpinum
Viola lutea
Frühlingsaspekt einer NSNS-Weide mit blühendem Pulsatilla alpina ssp. apiifolia.
Der Alpenklee Trifolium alpinum in einemartenreichen NS-Bestand.
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Das Borstgras Nardus stricta ist die typische,namensgebende Art der Gesellschaft.
In den Südalpen ist Carex fritschii eine wichtigeKennart der Borstgrasrasen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 206

2077 VEGETATION
7.3.15 Vegetationsgruppe NS
Artenreicher BorstgrasrasenNS: abgeleitet von Nardion strictae
Aussehen und VerbreitungMagere Wiesen und Weiden der subalpi-nen Stufe werden, besonders in silikatrei-chen Gebieten, über weite Strecken vomBorstgras (Nardus stricta) dominiert. Dadie Art besonders im fortgeschrittenenEntwicklungsstadium kaummehr gefres-sen wird, kann sie rasch zur Dominanzgelangen und dichte Bestände aufbauen,die kaum mehr Begleitarten aufweisen.Je nach Art der Nutzung und der Boden-verhältnisse können sich aber auch sehrartenreiche Bestände ausbilden. Solcheartenreiche Pflanzengesellschaften sindin der Vegetationsgruppe NS zusam-mengefasst. Günstig für den Artenreich-tum in Borstgrasrasen erweisen sichfolgende Voraussetzungen: kalkreichesMuttergestein, flachgründige Böden,Mähnutzung, Bewässerung, extensiveBeweidung, Kalkdüngung.
Gemähte Nardeten sind hochwüchsigerund blumenreicher und weisen eher dashier verlangte Artenspektrum auf. VieleArten der Borstgrasrasen kommen auchin den Festucion variae-Gesellschaften(FV) vor, umgekehrt sind die Nardion-Gesellschaften negativ gekennzeichnet,indem die charakteristischen FV-Artenfehlen.
Die NS-Gruppe ist in allen Regionen derAlpen häufig anzutreffen. Im Jura ist sieselten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenZwergstrauchheiden (Artengruppe ZSdeckt weniger als 25%).
In der Vegetation sind 8 Arten aus denArtengruppen NS, SS und FV vertretenoder es wachsen 6 Arten aus MB undNardus stricta deckt mehr als 10%. Zu-dem sind aus keiner anderen subalpinen
Artengruppe (FV, SV oder CF) mehr als 6Arten in der Testfläche vorhanden.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: . . . . . Nardion (4.3.5)
Ellenberg 1996: . . . . . Eu-Nardion (5.111)
Oberdorfer 1978: . . . . . . . . . . . . . Nardion
Mucina et al. 1993: . . . . Nardion strictae
CORINE: . . . . . Mat grass swards (36.31)
Das klassische Nardetum der mitteleuro-päischen Gebirge ist recht einheitlich undwird in einer Assoziation, dem Geo-Nar-detum strictae gefasst. In den tieferen La-gen mischt sich das Gebirgs-Nardetummit den Borstgrasheiden des Flachlan-des, die als Violion caninae (subatlan-tisch) oder als Nardo-Agrostion (subkon-tinental) bezeichnet werden.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 70%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 25%
Die artenreichen, genutzten Borstgras-rasen sind schwerpunktmässig in derMaiensässstufe zu finden. Sie sind nichtso stark an Südhänge gebunden wie an-dere Trockengesellschaften.
Häufigkeit und Bewertung
Anteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 4%
Artenreiche Borstgrasrasen sind anteils-mässig relativ selten und nehmen, v.a. alsWiesen, eine geringe Fläche ein. Nur ar-tenreiche Bestände werden in der Be-wertung als naturschützerisch wertvollbezeichnet.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Erwartungsgemäss sind im bisherigenVerlauf der Kartierung die artenreichenNS-Vegetationstypen vor allem in ge-mähten Borstgrasrasen gefunden wor-den.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sindbisher:
NSNS (35%) – typische artenreiche Borst-grasrasen.
NSAENS (25%) – artenreiche Borstgras-rasen mit Fettzeigern, v.a. Ligusticum,Phleum alpinum, Poa alpina, Trollius.
MBNS, MBAENS (25%) – artenreiche Borst-grasrasen der tieferen Lagen, Übergängezu den Halbtrockenrasen, mitBromus er-ectus, Brachypodium pinnatum, Carexmontana.
AEMBNS, FAMBNS (10%) – magere Fett-wiesen mit Arten der Borstgrasrasen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 207

7 VEGETATION208
ARTENGRUPPE FV1
Festuca paniculata
Festuca varia aggr.
Poa violacea
ARTENGRUPPE FV2
Anthyllis vulneraria ssp. valesiaca
Bupleurum stellatum
Centaurea nervosa
Helictotrichon pratense
Hieracium hoppeanum
Koeleria hirsuta
Laserpitium halleri
Pedicularis tuberosa
Phyteuma betonicifolium
Potentilla grandiflora
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia
Veronica fruticans
ARTENGRUPPE FV3
Aster alpinus
Biscutella laevigata
Dianthus superbus
Senecio doronicum
Von Festuca varia dominierter Bestand oberhalb von Airolo (TI).
Ein anderer FV-Wiesentyp wird durch die Domi-nanz von Poa violacea geprägt; Münster (VS).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Centaurea nervosa (links) und Laserpitium halleri (rechts) gehören zu den artenreichenFV-Gesellschaften.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 208

2097 VEGETATION
7.3.16 Vegetationsgruppe FV
Artenreiche BuntschwingelhaldeFV: abgeleitet von Festucion variae
Aussehen und VerbreitungIm Silikatgebiet der Zentral- und Süd-alpen werden sonnige Hänge in der sub-alpinen und alpinen Stufe von Horstgrä-sern und -seggen besiedelt, die typischfür den Verband Festucion variae sind.Dominante Arten sind Festuca varia s.l.,Festuca curvula, Poa violacea, Carexsempervirens, Helictotrichon pratense.
Die Horste dieser Arten prägen das Aus-sehen der Gesellschaften, je nach Domi-nanz mit gelblichen, sattgrünen odergräulichen Farbtönen. Zwischen denHorsten siedeln typische, säure- oder tro-ckenzeigende Kräuter. Übergänge gibtes gegen das weniger trockene undweniger steile Nardion, aber auch gegenKalktrockenrasen, mit denen das Festu-cion variae nicht wenige Trockenpflanzengemeinsam hat.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegen Felsund Fettweiden. Die oben genanntengrasartigen Pflanzen (Artengruppe FV1)bedecken mindestens 10% der Vegeta-tion oder in einer Testfläche finden wir 6Kennarten der Buntschwingelhalde, wo-bei einige Arten der Gruppe SS mitge-zählt werden dürfen.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Festucion variae
(4.3.6)
Theurillat et al. 1994: . . Festucion variae
Ellenberg 1996: . Festucion variae (5.114)
Oberdorfer 1978: . . . . . . Festucion variae
Mucina et al. 1993: . . . . Festucion variae
CORINE: . . . . . . . Subalpine thermophile
silicious grasslands (36.33)
Entsprechend den verschiedenen Domi-nanzverhältnissen der Grasartigen sindmehrere Assoziationen unterschiedenworden. Das eigentliche steile, felsige
Festucetum variaewird von Festuca acu-minata geprägt. Braun-Blanquet (1969)bezeichnet Engadiner Silikat-Mähwiesenmit Laserpitio-Avenetum pratensis, Bi-schof (1984) diejenigen der Zentralalpenmit Polygala-Poetum violaceae.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . 85%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . 25%
Die Gesellschaften der FV-Gruppe sindstark südexponiert und waren bisher aus-schliesslich in den höheren Lagen zu fin-den.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 4%
Sowohl bezüglich der kartierten Fläche,als auch der Anzahl Teilobjekte ist die Ge-sellschaft eher selten. Fast alle Teilobjek-te stammen aus den Kantonen TI undGR. Da die Vegetationsgruppe nur Be-stände umfasst, die einen gewissenArtenreichtum aufweisen, erhält sie ein-en leicht überdurchschnittlichen Natur-schutzwert.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Die zweifellos zahlreichen ungenutztenBuntschwingelhalden oberhalb der Söm-merungslinie werden hier nicht erfasst.Die Wiesennutzung ist noch erstaunlichverbreitet, beschränkt sich allerdings vorallem auf die Kantone UR und GR. Im TIfinden wir vorwiegend Weiden und Bra-chen.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sindbisher:
FVFV (5%) – typische artenreiche Bunt-schwingelhalden.
FVAEFV, MBAEFV (50%) – artenreicheBuntschwingelhalde mit (mehr oder we-niger) Fettzeigern.
NSFV, NSAEFV (20%) – artenreiche Bunt-schwingelhalde, Übergang zu Nardion-Gesellschaften. Zeigerarten für FV sindHieracium hoppeanum, Phyteuma beto-nicifolium, Pulsatilla apiifolia, Dianthussuperbus.
AEMBFV (10%) – Fettwiesen mit Arten derBuntschwingelhalde.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 209

TYPISCHE ARTEN
Festuca paniculata
Avenella flexuosa
Nardus stricta
Carex sempervirens
Poa violacea
Anthoxantum odoratum
Phyteuma betonicifolium
Silene rupestris
7 VEGETATION210
Dichte Festuca paniculata - Bestände auf der Alpe di Gesero (TI).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Die einzige Kennart Festuca paniculata. Dasmächtige Gras zeichnet sich durch grannenloseÄhrchen und dichte Horste aus.
Ein häufiger Begleiter der Goldschwingelrasen istdas Gras Anthoxanthum odoratum.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 210

2117 VEGETATION
7.3.17 Vegetationsgruppe FP
GoldschwingelhaldeFP: abgeleitet von “Festuca paniculata-Gesellschaft”
Aussehen und VerbreitungEntlang der Südabdachung der Alpen fin-den wir eine besondere Ausprägung desFestucion variae: die Goldschwingelhal-de. Hier übernimmt mit dem grossenGoldschwingel (Festuca paniculata) einweiteres Horstgras die Dominanz und bil-det hochwüchsige, graue Hangrasen, dievon weitem erkennbar sind. Neben demGoldschwingel sind auch Nardus stricta,Poa violacea und Avenella flexuosa starkvertreten.
In den Südwestalpen und den Südost-alpen ist die Gesellschaft stärker vertretenund besitzt als Weide grössere Bedeu-tung. Unsere Tessiner Bestände liegenam Rande des Areals, sind selten undwerden kaum genutzt. Ausser demGold-schwingel besitzen sie keine weiterenKennarten.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegen Felsund Fettweiden. Festuca paniculata (Syn.Festuca spadicea) bedeckt mindestens5% der Vegetationsfläche. FP wird nur alsIndex vergeben; als Haupttyp kommenv.a. NS und FV in Frage.
PflanzensoziologieDelarze et al. 1999: Festucion variae
(4.3.6)
Theurillat et al.: . . . . . . . Festucion variae
Oberdorfer 1987: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Ellenberg 1996: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Mucina et al. 1993: . . . . Festucion variae
(Hypochoerido-Festucetum paniculatae)
CORINE: Festuca paniculata swards
(36.331)
Braun-Blanquet beschrieb 1972 einenVerband Festucion spadiceae in denSüdwestalpen, dessen Existenz nicht ge-sichert ist. Heute werden die Festuca pa-
niculata-Bestände meist dem Festucionvariae zugeordnet (z.B. dasHypochoeridouniflorae-Festucetum paniculatae derOstalpen).
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . . . . . -
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . . . . . -
Bisher wurden keine Teilobjekte aufge-nommen.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Anteil nach Anzahl Nennungen. . . . . . 0%
Bisher wurden keine Teilobjekte aufge-nommen.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Bisher wurden keine Teilobjekte aufge-nommen.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 211

7 VEGETATION212
HÄUFIG DOMINIERENDEARTEN IN LH-VEGETATIONSTYPEN
Avenella flexuosa
Calamagrostis varia
Carex ferruginea
Carex fritschii
Carex leporina
Carex sempervirens
Festuca varia aggr.
Festuca curvula
Nardus stricta
Poa violacea
Sesleria caerulea
Artenarme Blaugrashalde mit dominanter Sesleria caerulea; Wetterlatte (BE).
Artenarme Buntschwingelhalde in steinigemHang, mit Festuca acuminata, Arolla (VS).
Potenzielle Verbreitung in den Hauptregionen der Schweiz(schwarz: häufig, dunkelgrau: verbreitet, hellgrau: selten, weiss: kaum vorhanden).
Artenarme Rostseggenhalde mit Carex ferrugi-nea; Waldhaus (SG).
Artenarmer Borstgrasrasen mit Nardus strictaund Agrostis rupestris; Kiental (BE).
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 212

2137 VEGETATION
7.3.18 Vegetationsgruppe LH
Artenarmer Trockenrasenhöherer LagenLH: abgeleitet von “low diversity – highaltitudes”)
Aussehen und VerbreitungAnalog zu den artenarmen Trockenrasender tieferen Lagen (vgl. Vegetationsgrup-pe LL) gibt es auch grasdominierte, ar-tenarme Bestände in der subalpinen Stu-fe. Nach ihrer dominanten Art (z.B. Nar-dus stricta, Sesleria caerulea, Poaviolacea usw.) wird der Vegetationstypentsprechend zugeordnet: NS, SV, CFoder FV. Den Vegetationstypen fehlen je-doch die Indizes NS, SV, CF oder FV, die aufartenreiche Bestände hindeuten würden.Die künstliche Gruppe hat das gemein-same Merkmal der Dominanz von meisteiner einzigen Grasart, die der Vegetationauch das entsprechende, eintönige Aus-sehen verleiht. Die Kräuter können ausverschiedenen Gründen fehlen (z.B.Überweidung, Verbrachung). Meist tref-fen wir artenarme Bestände in wenigersteilen und weniger trockenen Lagen an;die dominierenden Gräser können mitihren Horsten die Vegetationsflächeschliessen und Ansamungen stark behin-dern.
Die Gruppe kommt in allen Regionen derAlpen und des Juras vor.
DefinitionDie Schlüsselschwelle muss erfüllt sein,insbesondere die Abgrenzung gegenFettwiesen und -weiden. Die Vegetationkann aufgrund der dominanten Arteneinem Haupttyp der subalpinen Stufe zu-geordnet werden (NS, SV, CF, FV), es sindjedoch weniger als 8 Zeiger von subalpi-nen Trockenrasen vorhanden und eskann somit kein subalpiner Index (NS, SV,CF, FV) vergeben werden.
Bezeichnende dominante Arten: Carexferruginea, Carex sempervirens, Festucavaria s.l., Nardus stricta, Poa violacea,Sesleria caerulea.
PflanzensoziologieDie künstlich geschaffene Vegetations-gruppe kann nicht direkt einer pflanzen-soziologischen Einheit zugeordnet wer-den. Es handelt sich bei den LH-Bestän-den um artenarme Vegetation aus denVerbänden Seslerion variae, Nardion stri-ctae, Caricion ferrugineae, Festucion va-riae.
Die bisherigen Ergebnisse der TWW-Kar-tierung können wie folgt ausgewertetwerden (Stand 2000; 5210 Teilobjekte =100%):
Höhenlage und ExpositionAnteil Teilobjekte
in südlicher Exposition . . . . . . . . . . .55%
unter 1000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5%
im Sömmerungsgebiet . . . . . . . . . . .60%
Die Grasgesellschaften sind nicht an süd-liche Exposition gebunden und sind vor-wiegend oberhalb der Sömmerungslinieanzutreffen, wo sie trotz der vereinfa-chenden Methode INT auskartiert wer-den.
Häufigkeit und BewertungAnteil nach Fläche . . . . . . . . . . . . . . . 4%
Anteil nach Anzahl Nennungen . . . . . 3%
Die Vegetationsgruppe ist nicht häufig.Sie wird entsprechend ihrer Armut an Ar-ten mit einem viel tieferen Naturschutz-wert versehen, als die entsprechendenartenreichen Vegetationstypen.
NutzungWiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Brachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Relativ oft werden die grasreichen Be-stände gemäht. Brachen sind im Söm-merungsgebiet nicht kartiert worden. Siesind anteilsmässig daher stark unterver-treten.
VegetationstypenDie häufigsten Vegetationstypen sindbisher:
CF, CFAE (40%) – artenarme Rostseggen-halden, teilweise mit grossen Anteilen anFettzeigern. Carex ferruginea dominiert,aber es hat nur wenige Arten aus derGruppe CF2.
NS, NSAE (30%) – artenarme Borstgras-rasen, teilweise mit Fettwiesenarten.Nardus dominiert, aber es hat nur weni-ge Arten aus der Gruppe NS2.
SV, SVAE (25%) – artenarme Blaugras-halden, teilweise mit Fettwiesenarten.Sesleria dominiert, aber es hat nur weni-ge Arten aus SV.
Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 213

Kapitel 7 deutsch def.:Kapitel 7 deutsch def. 23.1.2007 14:02 Page 214

8 BEWERTUNG (Thomas Dalang)8.1 Grundsätzliches 2178.2 Ablauf der Bewertung in zwei Phasen 2198.3 Elemente der Nutzwertanalyse 2218.4 Bewertung der Vegetationstypen 2238.5 Bewertung der Objekte 2258.5.1 Kriterium Vegetation 2258.5.2 Kriterium Vegetationskundliche Diversität 2278.5.3 Kriterium Floristisches Potential 2278.5.4 Kriterium Strukturelemente 2298.5.5 Kriterium Aggregierungsgrad 2318.5.6 Kriterium Vernetzung 2318.6 Klassieren der Objekte 233
2158 BEWERTUNG
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 215

STELLUNG DER BEWERTUNGIM GESAMTPROJEKT
Informationslieferanten: die Wertvorstellungendes Naturschutzes (links) und die Felddaten(rechts).
Die Bewertungsverfahren werden auf dieDaten angewendet.
Die Informationsbezügerinnen und -bezügerbenutzen die klassierten Daten (Erläuterungenzur Karte vgl. S. 232).
8 BEWERTUNG216
Bewertungsverfahren Datenbank
Bewertung der Daten
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 216

2178 BEWERTUNG
8 BEWERTUNG
Die Objekte von nationaler Bedeutunggemäss Artikel 18a NHGwerden aus denkartierten Trockenwiesen- und -weiden-objekten ausgewählt. In diesem Kapitelwird das dazu benutzte Selektionsverfah-ren beschrieben. Das Verfahren soll einegut nachvollziehbare Bewertung der Ob-jekte aus Sicht des Naturschutzes liefern:Diejenigen Objekte werden hoch bewer-tet, die für TWW-typische Pflanzen- undTierarten gute bis sehr gute Lebensbe-dingungen bieten. Auf der Grundlage derWerte und der räumlichen Verteilung derObjekte wird die Klasse der national be-deutenden Objekte berechnet. Das Ver-fahren orientiert sich an den Grundsätzender Nutzwertanalyse.
Die vorliegende Beschreibung kann nichtalle Details ausleuchten. Die zur Illustra-tion aufgeführten Daten sind als Beispie-le aufzufassen.
Auf die Ziele der Bewertung wird im Kap.2.3.3 näher eingegangen.
8.1 GRUNDSÄTZLICHES
Zweck der Bewertung ist, die erfasstenTrockenwiesen- und -weideflächen nachden Kriterien des Naturschutzes in die fol-genden vier Wertklassen einzuteilen:
• Objekte von nationaler Bedeu-tung. Es ist geplant, die Objekte die-ser Klasse in ein Bundesinventar ge-mäss demBundesgesetz über den Na-tur- und Heimatschutz aufzunehmen.
• Objekte von potenziell nationa-ler Bedeutung. Diese Klasse hateinen vorläufigen Charakter. Sie sollso lange existieren, als die Felderhe-bungen noch nicht für die ganzeSchweiz abgeschlossen sind. In derAbschlussphase des Projektes wirdden Objekten dieser Klasse nationale
oder nicht nationale Bedeutung zuge-sprochen.
• Objekte ohne nationale Bedeu-tung. Die Objekte dieser Klasse erfül-len zwar die Aufnahmekriterien desInventars. Sie werden aber als zuwenig wertvoll erachtet, um sie insBundesinventar aufzunehmen.
• Zu kleine Objekte. Die Objektedieser Klasse wurden zwar aus irgend-welchen Gründen aufgenommen, bei-spielsweise im Rahmen eines kanto-nalen Anschlussprojektes, weil sieeine Singularität darstellen oder weilihre tatsächliche Grösse im Feld über-schätzt wurde. Sie erfüllen aber dieStandard-Erfassungskriterien nicht.
WertvorstellungenDieWertvorstellungen des Naturschutzeswurden im Laufe der Vorarbeiten zur Be-wertung ergründet. Die wichtigste Quelledafür war das Expertenwissen der Pro-jektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Zuspeziellen Fragen, vor allem im zoologi-schen Bereich, wurde ein Fachausschusskonsultiert. Die projektbegleitenden Gre-mien äusserten sich vor allem zur Wich-tigkeit der verschiedenen Wertvorstel-lungen. Weil zu Beginn der nationalenKartierung bereits für viele Kantone Vor-läuferinventare und methodische Vorar-beiten bestanden, steht die Wertdebattebereits auf einem hohen Stand. Die na-tionale Bewertung ist bestrebt, die beste-henden Wertungsideen in ihr Verfahreneinzubinden.
UmsetzungDie Umsetzung dieser Wertvorstellungenin ein Bewertungsverfahren, das sich aufdie Felddaten und auf Daten aus anderenQuellen stützt, ist das Thema dieses Ka-pitels. Das Bewertungsverfahren musstevor allem folgenden Anforderungen ge-recht werden:
• Die Wertvorstellungen müssen so gutals möglich in das Bewertungsverfah-ren “übersetzt” werden.
• Das Verfahren soll relativ einfach sein.• Das Verfahren soll es ermöglichen,
neue Erkenntnisse zu berücksichtigen.• Das Bewertungsverfahren soll so ein-
gerichtet werden, dass sich Teilre-sultate berechnen lassen, sobald einKanton fertig kartiert ist.
• Das Verfahren soll so aufgebaut sein,dass die Leitungsgremien, die nichtmit allen Details vertraut sind, die wich-tigsten Aspekte diskutieren können.
NutzwertanalyseDer methodische Ansatz der Nutzwerta-nalyse (Kap. 8.3) wird den genannten An-forderungen weitgehend gerecht.
Als Vorteil dieser Methode sind zu nen-nen:
• Die Nutzwertanalyse ist modular auf-gebaut. Das bedeutet, dass die ein-zelnen Module ausgetauscht werdenkönnen, ohne das Gesamtverfahrenzu beeinträchtigen.
• Die Nahtstellen der Module zum Ge-samtsystem sind durch das KonzeptZielerfüllungsgrad standardisiert.
• Das Konzept der Gewichte erlaubt es,die Wichtigkeit der Module auf ein-fache Weise gegeneinander abzuwä-gen.
• Die einzelnen Bewertungsmodule sindeinander ähnlich: Insbesondere ent-hält jedes Modul eine Präferenzfunk-tion, welche erlaubt, innerhalb jedesModuls die naturschützerische Be-deutung der Messwerte zu diskutierenund festzulegen.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 217

PHASE 1
Vorbearbeitung
Nutzwertanalyse
Bereinigung
PHASE 2
DER GENERELLE ABLAUF VON BEWERTUNG UND KLASSIERUNG
8 BEWERTUNG218
Alle Objekte einer Kantonsgruppe
Singularitäten zu kleine Objekte
zu kleine Objekte
zu kleine ObjekteObjekte
von nationalerBedeutung
Objektevon nationalerBedeutung
Objekteohne nationaleBedeutung
Objekteohne nationaleBedeutung
Objekteohne nationaleBedeutung
Objektevon potenziell
nationaler Bedeutung
Objektevon potenziell
nationaler Bedeutung
Objektevon nationalerBedeutung
zu bearbeitende Objekte
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 218

2198 BEWERTUNG
8.2 ABLAUF DERBEWERTUNGIN ZWEI PHASEN
Zwei Phasen
Wegen der langen Projektdauer erfolgtdie Bewertung in zwei Phasen. In der er-sten Phase werden die Daten der einzel-nen Kantone weitgehend unabhängigvoneinander bewertet. Sobald alle Kan-tone bewertet sind – etwa 2007 – wird inder zweiten Phase eine gesamtschwei-zerische Bewertung vorgenommen.
Das Ziel der ersten Phase ist es, für jedenKanton einige Objekte von nationaler Be-deutung, die Objekte von potenziell na-tionaler Bedeutung, einige Objekte ohnenationale Bedeutung, die Objekte, wel-che die Schwellenkriterien nicht erfüllenund die Singularitäten zu bezeichnen. DieSingularitäten werden einem gesonder-ten Bewertungsverfahren unterworfen(Kap. 6.5). In der ersten Phase werdenimmer Gruppen von Kantonen gemein-sam bearbeitet, grundsätzlich eine Grup-pe pro Jahr. Dies wirkt sich vor allem aufdie Bewertung der Vegetationstypen aus.
Das Ziel der zweiten Phase ist es, alle Ob-jekte von potenziell nationaler Bedeutungder ersten Phase auf die beiden Klassender Objekte von nationaler Bedeutungund ohne nationale Bedeutung aufzutei-len.Weil die zweite Phase erst gegen Pro-jektende in Angriff genommen wird, sinddie Details zur Zeit noch nicht genau fest-gelegt. Grundsätzlich lässt sich bereitsheute sagen, dass die beiden Phasenrecht ähnlich ablaufen werden.
Drei Bewertungsschritte
Die erste Phase setzt sich aus drei Schrit-ten zusammen.
1. Schritt: VorbearbeitungObjekte, welche die Schwellenkriteriennicht erfüllen, werden ausgeschieden,insbesondere jene Objekte, die kleiner alsdie Minimalfläche sind. Die Singularitäts-objekte werden ausgewählt und einerFachkommission zur Beurteilung überge-ben. Das Singularitätenverfahren wird hiernicht behandelt (vgl. aber Kap. 6).
2. Schritt: NutzwertanalyseIm zweiten Schritt werden die Objekte,über die nicht bereits im ersten Schrittentschieden wurde, nach den Grundsät-zen der Nutzwertanalyse weiter bearbei-tet. Drei Teilschritte lassen sich unter-scheiden:
• Zuerst werden die Vegetationstypenbewertet,
• dann werden die Objekte einer Be-wertung unterzogen, und abschlies-send
• werden die Objekte den drei Klassen– Objekte von nationaler Bedeutung,– Objekte von potenziell nationalerBedeutung,
– Objekte ohne nationale Bedeutungzugeordnet.
Das Kapitel 8 beschreibt vor allem diesenzweiten Schritt.
3. Schritt: BereinigungDie Klassierung, die aus den beiden erstenSchritten resultiert, ist als Vorschlag auf-zufassen. Er wird den Kantonen unterbrei-tet und nötigenfalls modifiziert. Auf diesenSchritt wird hier nicht eingegangen.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 219

Kriterium Zielerfüllungsgrad Gewicht Produkt
Seltenheit 16% 1/4 0,040 4,0%
Schutzwürdigkeit 60% 1/2 0,300 30,0%
Repräsentativität 70% 1/4 0,175 17.5%
Wert des Vegetationstyps 0,515 (51,5%)
DIE DREI TEILSCHRITTEDER NUTZWERTANALYSE
8 BEWERTUNG220
Bewertungseinheitenund Gesamtheit
Aus einer biogeografischen Regionalle Vegetationstypen.
Aus einem Kanton alle TWW-Objekte, welche die Schwellen-kriterien erfüllen.
Aus einem Kanton alle möglichenKombinationen von TWW-Objekten.
Bewertungskriterien
• Objektqualität
• Objektanzahl• Gesamtfläche• Räumliche Verteilung
Bewertung derVegetationstypen
Bewertung der Objekte Klassierung der Objekte
Indikatoren (Beispiel) geschätzter Flächenanteileines Vegetationstyps an derTeilobjektfläche
geschätzter prozentualer Anteilder artenreichen Baumhecke ander Teilobjektgrenze
Höhenlage der typischsten Stelleeines Teilobjektes
Berechnen der Zielerträge (vgl. die detaillierten Beschreibungen in Kap. 8.4 ff.)
Umrechnen inZielerfüllungsgrade(Beispiel)
Gewichten derZielerfüllungsgrade(Beispiel)
PräferenzfunktionZielerfüllungsgrad
60%
100%
Zielertrag 6 ha 10 ha
• Vegetationswert• Vegetatioskundliche
Diversität
• Floristisches Potenzial• Strukturelemente• Aggregierungsgrad• Vernetzungsgrad
• Seltenheit• Schutzwürdigkeit• Repräsentativität
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 220

2218 BEWERTUNG
8.3 ELEMENTE DERNUTZWERTANALYSE
Die Nutzwertanalyse (Zangenmeister,1970) bildet den Methodenhintergrunddes Bewertungsverfahrens. Charakteris-tische Merkmale der Nutzwertanalysesind:
• die Definition der Bewertungseinheiten,• das Festlegen der Bewertungskrite-
rien,• das Definieren von Indikatoren,• das Berechnen der Zielerträge,• das Umrechnen der Zielerträge in Zie-
lerfüllungsgrade mit Hilfe der Präfe-renzfunktion,
• das Gewichten der Zielerfüllungsgradeund
• das Zusammenfassen der Zielerfül-lungsgrade zu einem Gesamtzielerfül-lungsgrad.
Die Nutzwertanalyse ist bei der TWW-Be-wertung in ein Verfahren eingebettet, daszusätzliche Methodenelemente enthält(Kap 8.2). Die eigentliche Nutzwertana-lyse erfolgt in drei Teilschritten:
• Zuerst werden die Vegetationstypenbewertet (Kap. 8.4). Das Resultat die-ser Bewertung wird für
• die Bewertung der Objekte (Kap. 8.5)benutzt. Die Objektwerte werden fürdie
• Klassierung der Objekte, (Kap. 8.6)verwendet.
ZielertragDer Zielertrag ist der Messwert, den eineBewertungseinheit bezüglich eines Krite-riums einnimmt. Der Zielertrag wird mitHilfe der Präferenzfunktion in den Zieler-füllungsgrad umgerechnet.
Beispiel: Ein bestimmtes TWW-Objektliefert für das Bewertungskriterium Aggre-gierungsgrad den “Ertrag” 10 Hektaren.
PräferenzfunktionDie Präferenzfunktion drückt aus, wel-chen Wert man den verschiedenen mö-glichen Zielerträgen eines Kriteriumszuordnen will. Diese Werte werden Ziel-erfüllungsgrade genannt.
Beispiel: Für das BewertungskriteriumAggregierungsgrad wird allen Zielerträ-gen von mindestens 10 ha der Zielerfül-lungsgrad 100% zugeordnet.
ZielerfüllungsgradDer Zielerfüllungsgrad ist der Grad, zudem eine Bewertungseinheit die idealeAusprägung eines Kriteriums erreicht(“erfüllt”). Der Zielerfüllungsgrad beträgteins (100%), wenn das Ideal erreicht wirdund beträgt null (0%) wenn das Ideal sehrschlecht erreicht wird. Der Zielerfüllungs-grad wird mit Hilfe der Präferenzfunktionaus dem Zielertrag berechnet.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 221

Kriterium Zielerfüllungsgrad Gewicht Produkt
Seltenheit 16% 1/4 0,040 4,0%Schutzwürdigkeit 60% 1/2 0,300 30,0%Repräsentativität 70% 1/4 0,175 17,5%
Wert des Vegetationstyps 0,515 (51,5%)
ABB. 1: BERECHNUNG DER SELTENHEIT EINES HAUPTTYPS
Der Vegetationstyp MBSC (kurzrasige Höhenvariante des Halbtrockenrasens) gehörtzur Vegetationsgruppe MB (echte Halbtrockenrasen). Im biogeographischen RaumJura wurden bis Herbst 1998 244,4 ha Trockenwiesen und -weiden aufgenommen,davon gehören 118.7 ha der Vegetationsgruppe MB an. Die Häufigkeit des MB beträgt118,7/244,4 = 49%. Der Zielerfüllungsgrad ist eine logarithmische Funktion derHäufigkeit, hier 16%.
Diese Transformation erwies sich als zweckmässig, da sie das Wertempfindender Fachleute gut wiedergibt.
ABB. 2: SCHUTZWÜRDIGKEITDER VEGETATIONSTYPEN
Die Schutzwürdigkeit des VegetationstypsMBMO berechnet sich aus der Schutzwürdigkeitder Vegetationsgruppe MB (0,6) und demKorrekturwert für den Zusatzindex MO (+0,1).Dies ergibt als Zielerfüllungsgrad für dieSchutzwürdigkeit 0,7 (70%).
ABB. 3: BERECHNUNG DES WERTESEINER VEGETATIONSGRUPPE
Echter Halbtrockenrasen MB im Jura
Häufigkeit Zielerfüllungsgrad
1% 100%2% 85%5% 65%
10% 50%25% 30%50% 15%75% 6%
100% 0%
8 BEWERTUNG222
AE
0,0 1,00,80,60,40,2
MO
MBAE
OR
MB
MO
XB
SVOR
Vegetationsgruppe
Zusatzindizes
Schutzwürdigkeit
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 222

2238 BEWERTUNG
8.4 BEWERTUNG DERVEGETATIONSTYPEN
Bei der Erfassung der Teilobjekte werdenVegetationstypen auf dem Protokollblattnotiert (vgl. Kap. 5.1). Ein Vegetationstypbesteht aus einem Haupttyp, z.B. MB(Mesobromion) und bis zu zwei Zusatz-indizes, die spezielle soziologische oderökologische Ausprägungen des Haupt-typs bezeichnen (z.B. OR für Saumarten).
Die Bewertung der Vegetationstypenbezieht sich auf die biogeographischenRegionen (Kap. 3.3.3) und nicht auf dasGebiet der einzelnen Kantone. Solangeeine biogeographische Region nicht voll-ständig erfasst ist, kann die Seltenheit derVegetationstypen nicht definitiv berech-net werden.
Um den Schätzfehler möglichst gering zuhalten, werden die Kantone gruppen-weise bearbeitet. Weil mit jeder neu be-arbeiteten Kantonsgruppe neue Daten fürdie einzelnen Regionen verfügbar wer-den, muss dieser Schritt immer wiederneu durchgeführt werden. Dadurch wirddie Bewertung der Vegetationstypen mitjedem neuen Kanton präziser. Allerdingswerden die Bewertungen der bereits be-arbeiteten Kantone nicht mehr revidiert.
Zur Bewertung der Vegetationstypenwerden drei Kriterien benutzt:
1. SeltenheitSeltene Vegetationstypen werden alswertvoller erachtet als häufige. Weil dasim TWW-Projekt benutzte Vegetations-gliederungssystem zu differenziert ist, umdie Seltenheit genügend sicher zu mes-sen, wurden ähnliche Vegetationstypenzu Vegetationsgruppen (vgl. Kap. 7.3)zusammengefasst. Die für eine Vegeta-tionsgruppe berechnete Seltenheit gilt füralle ihr zugeordneten Vegetationstypen.Die Seltenheit der Vegetationsgruppenwird für jede biogeographische Regioneinzeln berechnet (Abbildung 1).
2. SchutzwürdigkeitDie Schutzwürdigkeit wird grundsätzlichfür die Vegetationsgruppe festgelegt. Da-zu werden der botanische und der zoolo-gische Artenreichtum sowie das Vorkom-men seltener Arten berücksichtigt. Weildie Schutzwürdigkeit der einzelnen Vege-tationstypen von jener der Vegetations-gruppen abweichen kann, werden fürverschiedene Zusatzindizes (z.B. MO fürWechselfeuchte) Korrekturwerte festge-legt (Abbildung 2).
Die Zielerfüllungsgrade werden durchExpertenurteil festgelegt. Eine Differen-zierung zwischen Zielertrag und Zielerfül-lungsgrad erübrigt sich, da im Experten-urteil bereits beide Aspekte berücksich-tigt werden können.
3. RepräsentativitätVegetationstypen, die für eine biogeogra-phische Region besonders repräsentativsind, werden hoch bewertet. Erst ausdem schweizerischen Überblick herauslässt sich in akzeptabler Qualität messen,wie repräsentativ ein Vegetationstyp ist.Das Kriterium wird deshalb erst in derzweiten Phase (der gesamtschweizeri-schen Bewertung) wirksam benutzt. Inder ersten Phase (der Bewertung vonKantonsgruppen) werden vereinfachte,grobe Schätzwerte verwendet.
Diese drei Teilbewertungen werden zumVegetationsgruppenwert zusammenge-fasst (Abbildung 3).
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 223

Kriterien Zielerfüllungsgrad Gewicht Produkt
Vegetation 77% 3/8 (9/24) 0,289Vegetationskundliche Diversität 31% 1/12 (2/24) 0,026Floristisches Potenzial 36% 1/8 (3/24) 0,045Strukturelemente 30% 1/6 (4/24) 0,050Aggregierungsgrad 98% 1/6 (4/24) 0,163Vernetzungsgrad 67% 1/12 (2/24) 0,056
Objektwert 1 (24/24) (63%) 0,629
Vernetzungsgrad
Vegetationskundliche Diversität
Floristisches Potenzial
Strukturelemente
Aggregierungsgrad
Vegetation
Für ein fiktives Objekt ist grafisch undtabellarisch dargestellt, wie sich der Objektwertaus den Werten für die sechs Kriterienzusammensetzt: Für jedes Kriterium ist derZielerfüllungsgrad auf der Abszisse und dasGewicht auf der Ordinate dargestellt.Verwandelt man die sechs Blöcke in einflächengleiches Rechteck, so entsprichtdessen Breite dem Objektwert.
8 BEWERTUNG224
BERECHNUNGDES WERTES EINES OBJEKTES
Objektwert
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2/24
2/24
3/24
4/24
4/24
9/24
Gewicht
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 224

2258 BEWERTUNG
8.5 BEWERTUNGDER OBJEKTE
Der zweite und der dritte Teilschritt (Ob-jektbewertung und Klassierung, Kap. 8.2)der Nutzwertanalyse werden für jedenKanton separat durchgeführt. Im zweitenTeilschritt wird für jeden Kanton der Wertder erhobenen Objekte bestimmt. Dazuwerden sechs Kriterien benutzt:
1. VegetationGrundlage des Kriteriums sind die imProtokollblatt angegebenen Vegetations-typen. Diejenigen Vegetationstypen sindbesonders wertvoll, die für die biogeo-graphische Region selten sind, die ausSicht des Artenschutzes wichtig sind unddie besonders repräsentativ sind (vgl.Kap. 8.4).
2. VegetationskundlicheDiversitätDie Bewertung der Vegetation unter-schätzt den Wert von mehreren unter-schiedlichen, aber im selben Objekt lie-genden Vegetationstypen. Dieser vor al-lem aus faunistischer Sicht wichtigeZusatzwert wird durch den Diversitäts-wert korrigiert.
3. Floristisches PotenzialDie beiden oben beschriebenen Kriterienberücksichtigen das Vorkommen selte-ner Arten nur indirekt über die Vegeta-tionstypen. Da es zu aufwändig ist, die ineinem Objekt vorkommenden seltenenArten auf reproduzierbare Weise zu er-fassen, werden die Daten aus dem Ver-breitungsatlas der Farn- und Blütenpflan-zen vonWelten und Sutter (1982) benutzt,um das floristische Potenzial eines Ob-jektes zu schätzen.
4. StrukturelementeWertvolle Objekte sollen zoologisch be-deutsame Strukturelemente in optimalerMenge aufweisen. Dieses Kriterium stütztsich auf die 64 für jedes Teilobjekt auf-genommenen Strukturelemente (Grenz-elemente, Einschlusselemente, Verbu-
schungsgrad) sowie auf die zoologischeBedeutung, die ihnen die ExpertengruppeFauna zumisst (Kap. 5.3 und Kap. 5.5).Die erfassten Strukturelemente werdenzu fünf ökologischen Gruppen zusam-mengefasst: Bäume/Sträucher, Nass-standorte, Boden/Fels, Zwergsträucher,andere Fluren. Die fünf Gruppen werdeneinzeln bewertet und anschliessend zumStukturelement-Wert zusammengefasst.
5. AggregierungsgradDieses Kriterium versucht, die “biologischrelevante” Fläche zu erfassen. Dazu wirdzusätzlich zur Fläche des zu bewertendenObjektes die Fläche der benachbartenObjekte im Umkreis eines Kilometersberücksichtigt.
6. VernetzungsgradGut vernetzte Objekte haben einen grös-serenWert als schlecht vernetzte. Im Feldwird der Vernetzungsgrad anhand vonSkizzen und Erläuterungen festgestellt(Kap. 5.6). Die Felddaten werden direkt inden Zielerfüllungsgrad umgerechnet.
Die sechs Kriterien werden zum Objekt-Gesamtwert zusammengefasst. Damitwerden die naturschützerisch wichtigen,mit vertretbarem Aufwand erfassbarenAspekte der TWW-Objekte bewertet: bo-tanische, zoologische und auf die Land-schaft bezogene Aspekte. Die den ein-zelnen Kriterien zugeordneten Gewichtespiegeln primär deren naturschützerischeBedeutung.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 225

ABB. 1: KRITERIUM VEGETATION
ABB. 2: KRITERIUM VEGETATIONSKUNDLICHE DIVERSITÄT
Vegetationstyp Wert des Vegetationstyps Flächenanteil am Objekt Gewicht Produkt aus Wert und Gewicht
Halbtrockenrasen mit Saumarten (MBOR) 0,566 45% 50% 0,2830Echter Halbtrockenrasen (MB) 0,515 45% 50% 0,2575nicht TWW-Vegetation 10% - -
Summe 100% 100% Zielertrag = 0,5400
Zielerfüllungsgrad = 0,54/0,7 = 0,77 (77%)
ABB. 3:KRITERIUM FLORISTISCHES POTENZIAL
Die Karte zeigt die floristischen Kartierflächennach Welten & Sutter (1982) in der Umgebungdes Neuenburgersees. Je dunkler eine Flächeist, desto höher ist die Artenzahl.
In der floristischen Kartierfläche Val-de-Ruz(Pfeil) wurden 47 seltene, für Trockenwiesenund -weiden typische Pflanzenarten gefunden.Weil die Kartierfläche vermutlich durchschnittlichgut bearbeitet ist, wird diese Zahl nicht korrigiert.Für Kartierflächen mit mindestens 130 Artenwird der Zielerfüllungsgrad auf 100% gesetzt.Ein Objekt in der Kartierfläche Val-de-Ruz kommtsomit auf einen Zielerfüllungsgrad von 36%.
8 BEWERTUNG226
Objekt für die Berech-nung der Diver-sität benutzteFlächenanteile
“virtuelle”Flächenanteilegemäss Shannon-Weaver-Transfor-mation
Zielerfüllungsgraddes Diversitätskri-teriums in Prozentdes Vegetations-Zielerfüllungs-grades
Flächenanteile derVegetationstypen
Nr. 1 50% MB 85% MB 14% MB50% MBOR 15% OR 28% OR 40,9%
Nr. 2 50% MB 50% MB 35% MB50% OR 50% OR 35% OR 69,3%
Flächenanteil
trans
form
ierte
rFläch
enan
teil
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 226

2278 BEWERTUNG
8.5.1 Kriterium Vegetation
Hoch bewertet werden Objekte, die einengrossen Flächenanteil an Vegetationsty-pen haben, welche gemäss der Vegeta-tionstypen-Bewertung (Kap. 8.4) wertvollsind.
Der Zielertrag ist als gewichtete Summeder Vegetationstypen-Werte definiert. AlsGewicht wird der Flächenanteil der Ve-getationstypen an dem mit Schlüsselve-getation bedeckten Teil des Objektesgewählt (Abb. 1).
Die Präferenzfunktion ist so eingerichtet,dass bei einem Zielertrag von 0,7 (z.B.MBXB Trockenrasen mit Trockenzeigern)der maximal mögliche Zielerfüllungsgrad(100%) erreicht wird.
8.5.2 KriteriumVegetationskundlicheDiversität
Um die Diversität im Bewertungsverfah-ren zu berücksichtigen, werden mit Hilfeder Shannon-Weaver-Transformation dieFlächen der in einem Objekt seltenen Ve-getationstypen “virtuell” vergrössert unddie Flächen der häufigen Typen verklei-nert. Die Kurve (Abb. 2, rechts) zeigt dieFunktionsweise der Shannon-Weaver-Transformation. Die Pfeile verweisen aufdie in der Tabelle benutzten Umrechnun-gen. Objekte mit stark unterschiedlichenVegetationstypen sollen eine höhere Di-versität erhalten als Objekte mit einanderähnlichen Vegetationstypen. Um dieseBedingung zu erfüllen werden die Vege-tationstypen in ihre “Komponenten” zer-legt. Beispielsweise wird der Vegeta-tionstyp MBOR (Halbrockenrasen mitSaumarten) zu 70% dem MB (Halb-trockenrasen) und zu 30% dem OR(Saumgesellschaft) zugerechnet.
Abbildung 2 zeigt an zwei Beispielen, wiedie Diversität berechnet wird. Auf die De-tails kann hier nicht eingegangen werdenObjekt Nr. 1 besteht aus zwei relativ ähn-
lichen Vegetationstypen (MB und MBOR).Der Zielerfüllungsgrad des Diversitätskri-teriums ist deshalb gering, er beträgt nur41% des Vegetationskriterium-Zielerfül-lungsgrades. Objekt Nr. 2, das aus zweistark unterschiedlichen Vegetationstypenbesteht, hat einen viel höheren Zielerfül-lungsgrad.
Der Zielerfüllungsgrad von 100%wird bei-spielsweise von drei stark unterschied-lichen, wertvollen Vegetationstypen er-reicht, die mit gleichen Flächenanteilen ineinem Objekt vorkommen.
8.5.3 KriteriumFloristisches Potenzial
Für jede Kartierfläche aus dem Verbrei-tungsatlas der Farn- und Blütenpflanzender Schweiz (Welten & Sutter, 1982) wur-de nach den ökologischen Zeigerwerten(Landolt, 1977), der Roten Liste (Landolt,1991) und einem Korrekturverfahren, dasdie unterschiedliche Bearbeitungsinten-sität der Kartierflächen ausgleicht (Wohl-gemuth, 1996), die Anzahl seltener, in derRegion vorkommender für Trockenwie-sen und -weiden typischen Arten be-stimmt. Diese Anzahl bildet den Zieler-trag für das Kriterium Floristisches Po-tenzial. Denmaximalen Zielerfüllungsgraderreicht ein Objekt, das in einer der dreis-sig artenreichsten Kartierflächen derSchweiz liegt. (Abb. 3)
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 227

Strukturelemente
Typ Ausprägung (1) Zeg (2) Gewicht gewichteter Zeg
Fliessgewässer mit Ufer-vegetation als Grenzelement + 67% 1/10 0,0667
Quelle als Einschluss + 100% 1/10 0,1000
Gruppe Nassstandorte Zielertrag = 0,1667
Mischwaldrand mit Mantel 2 100% 3/40 0,0750
Verbuschung C 67% 1/16 0,0417
Gruppe Bäume und Sträucher Zielertrag = 0,1167
Zielertrag = Zielerfüllungsgrad des Strukturelement-Kriteriums 0,3019(30%)
8 BEWERTUNG228
ABB. 1: SITUATION ZU UNTENSTEHENDEM BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DEN WERTDER STRUKTURELEMENTE
ABB. 2: BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DEN WERT DER STRUKTURELEMENTE
Gruppe
optimaler Zeg (4) Gewicht gewichteterZeg (3) Zeg
0,3 0,5556 1/3 0,1852
0,25 0,4667 1/4 0,1167
(1) + bedeutet bei Grenzelementen 10 m bis 5%, bei Einschlüssenvorhanden bis 5%. 2 bedeutet beim Waldrand 5-25% der Grenzlinie.C bedeutet bei der Verbuschung über 20%.
(2) Der Zielerfüllungsgrad (Zeg) des einzelnen Strukturelementes.(3) Optimaler Zielertrag, für den der Zielerfüllungsgrad 100% wird.(4) Zielerfüllungsgrad der Gruppe.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 228

2298 BEWERTUNG
8.5.4 KriteriumStrukturelemente
Zweistufiges VorgehenWeil die ökologische Bedeutung der er-hobenen Strukturelemente einander zumTeil sehr ähnlich ist, würde eine Gleich-behandlung aller Elemente dazu führen,dass sehr differenziert erfasste Elemente(z.B. Bäume und Sträucher) eine viel zugrosse Bedeutung erhielten. Deshalbwerden ähnliche Strukturelemente zuGruppen zusammengefasst.
In einem zweistufigen Vorgehen werdenzuerst die fünf Gruppen einzeln bewertet.Dann werden die Werte der einzelnenGruppen zu einem Gesamtwert zu-sammengefasst.
Fünf GruppenDie fünf Gruppen sind:• Bäume und Sträucher• Nassstandorte• nackter Boden und Fels• Zwergsträucher• andere Fluren
Bewerten der einzelnen GruppenBeispielsweise kommt in einem bestimm-ten Objekt aus der Strukturelementgrup-pe Nassstandorte das Strukturelement“Quelle als Einschluss” mit der Ausprä-gung “plus” vor (“plus” bedeutet: “vor-handen, aber höchstens 5%der Fläche”).Da dies als eine optimale Menge für die-ses Strukturelement erachtet wird, be-kommt es den Zielerfüllungsgrad 100%.Das Strukturelement “Quelle als Ein-schluss” hat innerhalb der Nassstand-ort-Gruppe dasGewicht von einemZehn-tel. Der gewichtete Zielerfüllungsgrad be-trägt somit 0,1. Zusammen mit demanderen Nassstandort-Element (Fliess-gewässer mit Ufervegetation als Grenz-element) ergibt sich als Zielertrag fürNassstandorte die Summe der gewichte-ten Strukturelement-Zielerfüllungsgrade:0,1667 (Abb. 2).
Für die Gruppe Nassstandorte wird 0,3als idealer Zielertrag betrachtet. Somit
beträgt der Zielerfüllungsgrad für Nass-standorte 0,1667/0,3 = 0,5556.
GesamtbewertungFür die Berechnung des Strukturelement-Wertes hat die Nassstandortgruppe einGewicht von einem Drittel. Der gewichte-te Zielerfüllungsgrad für Nassstandortebeträgt somit 0,1852.
Der Zielerfüllungsgrad für das Struktur-element-Kriterium ist die Summe der fünfgewichteten Gruppen-Zielerfüllungsgra-de. Im Beispiel der Abbildung 2 kommennur zwei Gruppen (Nassstandorte sowieBäume/Sträucher) vor. Der Strukture-lement-Zielerfüllungsertrag der beidenGruppen beträgt 0,3019 (30,2%).
Maximaler ZielerfüllungsgradDer maximale Zielerfüllungsgrad wird er-reicht, wenn jede der fünf Gruppen denmaximalen Zielerfüllungsgrad erreicht.Beispielsweise wird dies für die Nass-standorte erreicht, wenn ein Fliessge-wässer und ein stehendes Gewässer mitUfervegetation dasObjekt begrenzen undeine Quelle oder Vernässung im Objekt-innern vorkommt. In der Gruppe Bäumeund Sträucher ergeben ein Mischwald-rand mit Saum, eine artenreiche Heckeund ein paar Obstbäume den maximalenZielerfüllungsgrad.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 229

8 BEWERTUNG230
A
B
C
250 m
6,25 ha
ABB. 1: BERECHNUNG DES AGGREGIERUNGSGRADES
Fläche innerhalb der Zone Gewicht gewichtete Fläche
innerste Zone 5 ha 1 5,00 ha
zweite Zone 7 ha 1/2 3,50 ha
dritte Zone 3 ha 1/4 0,75 ha
äusserste Zone 4 ha 1/8 0,50 ha
Zielertrag 9,75 ha
Zielerfüllungsgrad = 9,75 ha / 10 ha = 0,975 (97,5%)
ABB. 2: ZIELERFÜLLUNGSGRAD DER VERNETZUNG
0% 33,3% 66,7% 100%
Massstab
innerste Zone
zweite Zone
dritte Zone
äusserste Zone
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 230

2318 BEWERTUNG
8.5.5 KriteriumAggregierungsgrad
Objekte, die genügend gross sind oder ineiner TWW-reichen Umgebung liegen,sollen hoch bewertet werden.
Dazu werden die Objektperimeter mit ei-nem fixen 250-m-Raster verschnittenund die Flächen der in den einzelnen Ras-terzellen liegenden Objektteile berechnet.Je näher eine Rasterzelle beim zu bewer-tenden Objekt liegt, desto stärker wird dieTrockenwiesenfläche in der Rasterzellegewichtet.
Der Zielertrag ist die Summe der gewich-teten Trockenwiesenfläche der näherenUmgebung des zu bewertenden Objek-tes (Abbildung 1). Ein Zielertrag von 10 haoder mehr wird als ideal erachtet und er-gibt einen Zielerfüllungsgrad von 100%.
8.5.6 Kriterium Vernetzung
Gut vernetzte Objekte sollen hoch bewer-tet werden.
Im Feld wird der Vernetzungsgrad an-hand von Skizzen und Erläuterungenfestgestellt. Der Zielerfüllungsgrad wirddirekt aus der Skizze abgelesen (Abb. 2).
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 231

Kriterium ObjektanzahlDer Kanton BL besitzt 81 Inventarobjekte.Der Soll-Anteil für die Klasse der national be-deutenden Objekte beträgt 25% (20,25 Objekte)20 Objekten wird nationale Bedeutung zuge-sprochen. Das Klassierungsziel wird optimalerreicht.
Kriterium GesamtflächeDie 20 als national bedeutend selektioniertenObjekte des Kantons BL haben eine Gesamt-fläche von 128,9 ha. Das sind genau 50% derFlächen aller Inventarobjekte.Das Klassierungs-ziel ist, 50% der Fläche auszuwählen. DiesesZiel wird exakt erreicht.
8 BEWERTUNG232
KLASSIERUNG DER OBJEKTE DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT (BL)
Klassierungsziel ObjektqualitätVergleicht man die 20 besten Objekte desKantons mit den 20 selektionierten Objekten,so stellt man fest, dass 18 der Objekte (90%)übereinstimmen. Das Klassierungsziel wirdrecht gut erreicht.
Klassierungsziel ObjektverteilungVier der 81 Objekte liegen in der biogeografi-schen Region Mittelland (Kap. 3.3.3).Diese Region umklammert den Jura von Ostenher und umfasst auch den tiefer gelegenennördlichen Teil des Kantons BL.Würde man sich nur auf die Objektqualitätstützen, so würden die tiefen Lagen zu wenigberücksichtigt. Deshalb wurden zwei Objekteder höheren Lagen (um 1000 m) gegen zweiObjekte der tieferen Lagen (400-500 m)ausgetauscht, wobei eher grössere Tieflagen-objekte gewählt wurden. Das Klassierungszielwird recht gut erreicht.
grosse Ziffern:Objekte von nationaler Bedeutung
mittlere Ziffern:Objekte von potentiell nationaler Bedeutung
kleine Ziffern:Objekte ohne nationale Bedeutung
Biogeografische RegionMittelland
Biogeografische RegionJura
ausgetauschte Objekte
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 232

2338 BEWERTUNG
8.6 KLASSIERENDER OBJEKTE
Aus der Gesamtheit der Objekte einesKantons werden jene Objektmengen ge-sucht, welche die Klassierungsziele ambesten erreichen.
Objekte, die die Schwellenkriterien nichterfüllen, die z.B. zu klein sind, werdenzum vornherein von der Klassierung aus-geschlossen, respektive einer beson-deren Klasse zugeteilt.
Zwei Klassierungszielesollen erreicht werden:1) Die Klasse der Objekte von nationaler
Bedeutung soll gebildet werden, und2) die Klasse, welche die Objekte von na-
tionaler Bedeutung und von potenziellnationaler Bedeutung umfasst, sollfestgelegt werden. Damit lassen sichdie beiden anderen Klassen einfachermitteln.
Vier Kriterien werden für die beiden Klas-sierungsziele benutzt:
1. ObjektqualitätDie ausgewählte Objektmenge soll, ge-messen an der Objektqualität (Kap. 8.5),die besten Objekte enthalten. Dies ist daswichtigste Kriterium. Die Objektqualitätsoll die Selektion aber nicht ausschliess-lich bestimmen, sondern gegen die an-deren Kriterien abgewogen werden.
2. Objektanzahl25% der Objekte sollen nationale Bedeu-tung erhalten. 75% der Objekte solleninsgesamt in die beiden Klassen nationalbedeutende Objekte und potenziell na-tional bedeutende Objekte gelangen.Auch dieses Kriterium soll nicht uneinge-schränkt gelten. In gewissen Fällen wirddie Anzahl Objekte verändert, um da-durch eine bessere Selektion zu erzielen.
3. Gesamtfläche50% der Fläche der aufgenommenenTrockenwiesen und -weiden soll nationa-le Bedeutung erhalten. 90% der Fläche
soll insgesamt in den beiden Klassen na-tional bedeutende Objekte und potenziellnational bedeutende Objekte vertretensein.
4. Räumliche VerteilungFür jede biogeographische Region undjede Höhenstufe sollen 25% (bzw. 75%)der Objekte aus der Referenzmenge na-tionale (bzw. nationale und potenziell na-tionale) Bedeutung erhalten. Mit diesemKriterium soll eine repräsentative Vertei-lung erreicht werden. Dadurch wird dieDiversität auf regionalem Niveau erhöht.
In der vertikalen Verteilung werden 200-m-Höhenstufen benutzt. Beispielsweiseerstreckt sich im Kanton Freiburg dieHöhenstufe 3 von 900 m - 1099 m. Ob-jekte, deren Höhenquote in der mittlerenHälfte der Stufe liegt (950 m - 1049 m)werden ganz der entsprechenden Hö-henstufe zugerechnet. Objekte mit Hö-henquoten im Randbereich (900 m -949 m, bzw. 1050 m - 1099 m) werdenhalb der Stufe 3 und halb der benach-barten tiefer bzw. höher gelegenen Stufezugeordnet. Durch dieses Verfahren wirdder unerwünschte Einfluss von scharfdefinierten Grenzen gemildert.
Zusammenfassenzum Objektmengen-WertGrundsätzlich werden alle in einem Kan-ton vorkommenden Objektkombinatio-nen gemäss den vier Kriterien bewertetund zu Mengenwerten zusammenge-fasst. Praktisch wird mit Hilfe von geneti-schen Algorithmen (Michalewicz, 1996)eine zweckmässige Auswahl von Kombi-nationen getestet. Diejenigen Objekt-kombinationen, die bezüglich der beidenKlassierungsziele die besten Mengen-werte haben, werden für die Bildung derdrei Klassen verwendet.
Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 233

Kapitel 8 deutsch def.:Kapitel 8 deutsch def. 23.1.2007 14:08 Page 234

235
Literaturverzeichnis 236
Glossar 238
Abkürzungen 244
Vegetationsschlüssel 1-3 245
Publikationsliste 248
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 235

ANL (1981):Halbtrocken- und Trockenrasen
der Schweiz. Vorschlag zur gesamtschwei-
zerischen Kartierung ausgewählter Gebiete.
Bundesamt für Forstwesen. 66 S. (unveröf-
fentlicht).
Baur, B., K. Ewald, B. Freyer, A. Ehr-
hardt, A., (1997): Ökologischer Ausgleich
und Biodiversität. Basel, Birkhäuser.
Bierhals, E. (1988): CIR-Luftbilder für die
flächendeckende Biotopkartierung. Informa-
tionsdienst Naturschutz Niedersachsen 5:
78-108.
Bischof, N. (1984): Pflanzensoziologische
Untersuchungen von Sukzessionen aus ge-
mähten Magerrasen in der subalpinen Stufe
der Zentralalpen. Beitr. zur Geobotanischen
Landesaufnahme 60.
Braun-Blanquet, J. (1949): Übersicht der
Pflanzengesellschaften Rätiens III. Vegetatio 1:
285-316.
Braun-Blanquet, J. (1961): Die inner-
alpine Trockenvegetation. Von der Provence
bis zur Steiermark. Stuttgart, Gustav Fischer.
Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzenso-
ziologie. Grundzüge der Vegetationskunde.
631 S.
Braun-Blanquet, J. (1969): Die Pflanzen-
gesellschaften der Rhätischen Alpen im Rah-
men ihrer Gesamtverbreitung. Chur, Selbst-
verlag.
Braun-Blanquet, J. (1972): L’alliance du
Festucion spadiceae des Alpes sud-occiden-
tales. Bull. Soc. bot. Fr. 119: 591-602
Braun-Blanquet, J. (1975): Fragmenta
phytosociologica Raetica II. Jahresbericht der
Naturforschenden Gesellschaft Graubündens
N.F. 46: 72-87.
Braun-Blanquet, J. (1976): Fragmenta
phytosociologica Raetica III, IV und VII. Veröff.
Geobotan. Inst. ETH, Stiftung Rübel. 58
Braun-Blanquet, J., M. Moor (1938):
Prodromus der Pflanzengesellschaften. Pro-
drome des Groupements végétaux. Fasz. 5
(Verband des Bromion erecti). Montpellier.
Braun Blanquet, J., H. Pallmann, et al.
(1954): Pflanzensoziologische und boden-
kundliche Untersuchungen im schweizeri-
schen Nationalpark und seinen Nachbarge-
bieten. Liestal.
Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Be-
deutung BLN (1977): EDMZ, Bern
Cerabolini, B. (1997): Aspetti floristici e
fitosociologici delle praterie insubriche. Qua-
derni del Parco Monte Barro 4: 15-35.
Dalang, T. (1993): Wo steht die Inven-
tarisierung der Trockenstandorte? Informa-
tionsblatt Forschungsbereich Landschaft WSL
16: 3-4.
Delarze, R. (1986): Approche biocénoti-
que des pelouses steppiques valaisannes.
Lausanne, Université Lausanne: 175.
Delarze, R., Y. Gonseth, P. Galland
(1998): Guide des milieux naturels de Suisse
Écologie - Menaces - Espèces caractéristi-
ques. delachaux et niestlé, Lausanne. 413 S.
Delarze, R., Y. Gonseth, P. Galland,
(1999): Lebensräume der Schweiz. Ökologie
- Gefährdung - Kennarten. Ott Verlag, Thun.
413 S.
Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie:
Grundlagen und Methoden. UTB für Wissen-
schaft: Grosse Reihe.
Dietl, W., P. Berger (1979):Die Kartierung
des Pflanzenstandortes und der futterbau-
lichen Nutzungseignung von Naturwiesen. Zü-
rich, Eidg. Forschungsanstalt für Landwirt-
schaftlichen Pflanzenbau.
Duelli, P. (1994): Rote Listen der gefährde-
ten Tierarten in der Schweiz. BUWAL, 97 S.
Duelli, P. (1994): Listes rouges des espè-
ces animales menacées de Suisse. OFEFP,
97 p.
Duelli, P. (1994): Lista rossa degli animali
minacciati della Svizzera. UFAFP, 97 p.
Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleu-
ropas mit den Alpen in ökologischer, dynami-
scher und historischer Sicht. Stuttgart, Ulmer.
European Commission Directorate
General XI (1991): CORINE biotopes
manual a method to identify and describe
consistently sites of major importance for na-
ture conservation. 3 vol.
Gepp, J. (1986): Trockenrasen in Österreich
als schutzwürdige Refugien wärmeliebender
Tierarten.
Gonseth, Y. (1994):Rote Liste der Tagfalter
der Schweiz. In: Duelli, P.: Rote Listen der ge-
fährdeten Tierarten in der Schweiz. BUWAL,
97 S.
Gonseth, Y. (1994): Liste rouge des Lépi-
doptères de la Suisse. Duelli, P.: Listes rouges
des espèces animales menacées de Suisse.
OFEFP, 97 p.
Gonseth, Y. (1994): Lista rossa dei Lepi-
doptera della Svizzera. Duelli, P.: Lista rossa
degli animali minacciati della Svizzera.
UFAFP, 97 p.
Gonseth, Y., G. Mulhauser, (1996): Bio-
indication et surfaces de compensation écolo-
gique. OFEFP, Cahier de l’environnement. 261,
135 p.
Gonseth Y., Wohlgemuth T., Sanson-
nens B., Buttler A., (2001, in Vorberei-
tung: Die biogeografischen Regionen der
Schweiz. Erläuterungen und Einteilungsstan-
dard. Umwelt-Materialien. BUWAL, Bern.
Gonseth Y., Wohlgemuth T., Sanson-
nens B., Buttler A., (2001, en prépara-
tion): Les régions biogéographiques de la
Suisse - Explications et division standard.
Cahier de l’environnement. OFEFP, Berne.
LITERATURVERZEICHNIS236
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 236

237LITERATURVERZEICHNIS
Gutersohn, H. (1973): Naturräumliche
Gliederung. Atlas der Schweiz. Landestopo-
graphie, Bern.
Gutersohn, H. (1973): Régions naturelles.
Atlas de la Suisse, service topographique
fédéral, Berne.
Gutersohn, H. (1973): Regioni naturali.
Atlante della Svizzera, STF, Berna.
Hegg, O., C. Béguin, H. Zoller (1993):
Atlas schutzwürdiger Vegetationstypen der
Schweiz. BUWAL, Bern.
Hegg, O., C. Béguin, H. Zoller (1993):
Atlas de la végétation à protéger en Suisse.
OFEFP, Berne.
Inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d’importance
nationale IFP (1977): OFIM, Berne.
Inventario federale dei paesaggi, siti
e monumenti naturali d’importanza
nazionale IFP (1977): UFMS, Berna.
Landolt, E. (1977): Ökologische Zeiger-
werte zur Schweizer Flora. Zürich.
Landolt, E. (1991): Gefährdung der Farn-
und Blütenpflanzen in der Schweiz mit ge-
samtschweizerischen und regionalen roten
Listen. Bern, BUWAL.
Landolt, E. (1991): Plantes vasculaires
menacées en Suisse. Listes rouges nationale
et régionales. OFEFP, Berne.
Marschall, F. (1947): Die Goldhaferwiese
(Trisetetum flavescentis) der Schweiz. Eine
soziologisch-ökologische Studie. Beitr. geo-
bot. Landesaufnahme 26, 168 S.
Mucina, L., G. Grabherr, T. Ellmauer
(1993): Die Pflanzengesellschaften Öster-
reichs. Stuttgart, Gustav Fischer.
Oberdorfer, E. (1977-83): Süddeutsche
Pflanzengesellschaften. Stuttgart, Gustav
Fischer.
Royer, J.-M. (1987): Les pelouses des
Festuco-Brometea d’un exemple régional à
une vision eurosibérienne: étude phytosocio-
logique et phytogéographique. Besançon,
Franche-Comté.
Runge, F. (1990): Die Pflanzengesellschaf-
ten Mitteleuropas. 309 S. Münster.
Schubert, R., W. Hilbig, S. Klotz (1995):
Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften
Mittel und Nordostdeutschlands. Fischer, Je-
na, 403 S.
Sutter, R. (1967): Das Caricion austro-
alpinae - ein neuer insubrisch-südalpiner Ses-
lerietalia-Verband. Mitt. Ostalpin-Dinar. Pflan-
zensoz. Arbeitsgemeinschaft 2: 18-22.
Theurillat, J.-P., D. Aeschimann, et al.
(1994): The higher vegetation units of the
Alps. Colloques Phytosociologiques 23:
189-239.
Welten, M., R. Sutter (1982): Verbrei-
tungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der
Schweiz. Basel, Birkhäuser.
Welten, M., R. Sutter (1982): Atlas de
distribution des ptéridophytes et des phanéro-
games de la Suisse. Basel, Birkhäuser.
Welten, M., R. Sutter (1982): Atlante
della distributione delle pteridophyte e fanero-
game della Svizzera. Basel, Birkhäuser.
Westhoff, V., E. Van der Maarel (1973):
The Braun-Blanquet approach. Ordination and
classification of communities. R. H. Whittaker.
Den Haag, Junk. 5: 617-737.
Wilmanns, O. (1989): Ökologische Pflan-
zensoziologie. Heidelberg, Quelle & Meyer.
Wohlgemuth, T. (1996): Ein floristischer
Ansatz zur biogeographischen Gliederung der
Schweiz. Botanica Helvetica 106(2): 227-260.
Wohlgemuth, T. (1998): Modelling floristic
species richness on the regional scale: a case
study in Switzerland. Biodivers. Conserv. 7:
159-177.
Wolkinger, F., S. Plank (1981): The
Grasslands of Europe. Nature and Environ-
ment. C. o. Europe. Strasbourg. Series 21.
Zangenmeister, C. (1990): Nutzwertana-
lyse in der Systemtechnik. Eine Methodik zur
multidimensionalen Bewertung und Auswahl
von Projektalternativen.Wittemann, München.
370 S.
Zoller, H. (1954): Die Typen der Bromus
erectus-Wiesen des Schweizer Juras. Ihre
Abhängigkeit von Standortsbedingungen und
wirtschaftlichen Einflüssen und ihre Beziehun-
gen zur ursprünglichen Vegetation. Beiträge z.
geobot. Landesaufn. d. Schweiz 33: 309 S.
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 237

Am Ende jeder Begriffserklärung stehen die
zugehörigen Kapitel in Klammern.
abstreichen: Kennzeichnen von Fremd-
vegetation in abzusuchenden Gebieten oder
am Rand von Objekten durch eine Schräg-
schraffur. Abgestrichen wird direkt auf dem
Luftbildabzug, bzw. auf der darüberliegenden
Feldfolie (3.5.3).
Abundanz: Anzahl Individuen einer Pflanzen-
art bezogen auf eine Testfläche (5.1.4).
Abzusuchendes Gebiet: Von regionalen
Expertinnen und Experten definierter Land-
schaftsausschnitt, für den eine grosse Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass Schlüsselvegeta-
tion in ausreichend grossen Flächen vor-
kommt. Abzusuchende Gebiete dienen der
Vorbereitung der Kartierung, werden mit Luft-
bildern vorinterpretiert oder direkt durch die
Kartierleute begangen (3.4.2).
aggregieren: 1. Begriff aus dem Bewer-
tungsverfahren für TWW-Objekte. Für jede
Bewertungseinheit und jedes Bewertungskri-
terium werden die Teil-Zielerfüllungsgrade be-
rechnet. Diese werden zum Gesamt-Zielerfül-
lungsgrad der Bewertungseinheit aggregiert.
Dazu werden die Teil-Zielerfüllungsgrade ge-
wichtet (d.h. mit einer Zahl, demGewicht, mul-
tipliziert). Dann werden die so gewichteten
Zielerfüllungsgrade zusammengezählt. Die bei
einer bestimmten Aggregation benutzten
Gewichte ergeben zusammengezählt eins (8).
2. Begriff aus dem Selektionsverfahren zur
Auswahl von Kantonsobjekten für die Kartie-
rung. Ausgewählt werden die besten Kan-
tonsobjekte aus einem Aggregat (hier eine
Gruppe mehr oder weniger nahe beieinander-
liegender Kantonsobjekte). Isolierte Kantons-
objekte werden durch die Selektion aggregier-
ter Objekte tendenziell bevorzugt (3.4.3).
alpin: � Höhenstufen
ANL-Methode: In den 80er und frühen 90er-
Jahren wurden in einigen Kantonen Trocken-
raseninventare erstellt, deren Kartiermethode
sich mehr oder weniger stark an die Empfeh-
lungen des Bundes anlehnten. Die Empfeh-
lungen zur Inventarisierung der halbtrockenen
und trockenen Rasen der Schweiz wurden im
Auftrag des Bundes von der Firma ANL, Aarau,
1981 erarbeitet. Nach der ANL-Methode wird
die Vegetation nach dem Vorhandensein von
Zeigerartengruppen eingeteilt, die Zeigerwerte
wie Feuchtigkeit, Bodenreaktion und Stick-
stoffgehalt repräsentieren (3.2.1).
Archivnummer: 1. Alle in der Kartierung
verwendeten Luftbildabzüge erhalten eine Ar-
chivnummer, die einen Teil einer Landeskarte
bezeichnet. Luftbildabzüge sind so mit Hilfe
der Blatteinteilung der Landeskarte rasch auf-
zufinden (5.7.2). 2. Die Originalluftbilder sind
mit einer Archivnummer identifizierbar, die sich
aus der betreffenden Fluglinie ableitet (3.5.2).
Artengruppe: Pflanzenarten, die charakte-
ristisch für eine bestimmte Vegetationseinheit
sind, werden zu Artengruppen zusammenge-
fasst. Im TWW-Projekt enthalten die Arten-
gruppen Kennarten der jeweiligen pflanzen-
soziologischen Verbände; so gibt es z.B. eine
Artengruppe FV, die das Festucion variae cha-
rakterisiert (7.2).
Artmächtigkeit: Die A. ist ein zu schätzen-
des Mass für das Vorkommen einer Pflanzen-
sippe bezogen auf eine Grundfläche. Bei der A.
werden Schätzungen von Abundanz und Do-
minanz kombiniert (5.1.4).
Assoziation: Grundeinheit der Pflanzensozio-
logie. Die A. ist ein durch Charakter- und Diffe-
renzialarten beschriebener Vegetationstyp von
bestimmter floristischer Zusammensetzung und
relativ einheitlichem Aussehen. Im Gegensatz
zum konkreten Bestand ist die Assoziation eine
Abstraktion, die eine Reihe ähnlicher Bestände
zusammenfassend charakterisiert (5.1.1).
Begleitart: Pflanzenarten, die nicht einer Ar-
tengruppe zugeordnet werden können, wer-
den im TWW-Projekt Begleitarten genannt
(Gegensatz: Schlüsselart) (5.1.4).
Begleitvegetation: Nach der DIF-Methode
können neben der dominierenden Vegetation
eines Teilobjektes maximal zwei weitere Vege-
tationstypen angegeben werden, die selbst zu
kleinflächig sind, um ein eigenes Teilobjekt zu
bilden (5.1.8).
Bemerkungen: Information über ein Teilob-
jekt, die nicht allein durch die Parameter fest-
gehalten werden kann. B. werden auf ein se-
parates Formular, das Bemerkungsblatt ge-
schrieben. B. können angegeben werden zu
folgenden Aspekten des Teilobjektes: Lage,
GPS, Vegetation, Verbuschung, Umsetzung,
Nutzung, Vernetzung, Einschlüsse und Grenz-
elemente (5.8).
Bemerkungsformular: Formular für die
Kartierung, auf dem Bemerkungen zu den im
Protokollblatt erhobenen Informationen ange-
bracht werden können (5.8).
Bestand: Konkreter, im Gelände beobachte-
ter Vegetationsausschnitt, bzw. konkrete Ver-
gesellschaftung von Pflanzen.
Bewertungseinheit: Das zu bewertende
Ding. Im TWW-Bewertungsverfahren werden
drei verschiedene Bewertungseinheiten be-
handelt: 1. Vegetationstypen, 2. Objekte und
3. Objektmengen (8.2).
Bewertungsregion: � Region
Biotop: Lebensraum von Pflanzen und Tieren
bzw. unbelebter Teil einer Lebensgemein-
schaft.
Brache: Fläche, die nicht oder nicht mehr ge-
nutzt wird. Merkmale der Verbrachung sind
meist fehlende Mäh- und Weidespuren sowie
das Aufkommen von Sträuchern und Jung-
bäumen (5.4.2).
CIR-Luftbild: Der Color-Infrarot-Film erfasst
neben dem sichtbaren Spektralbereich (400-
700 nm) auch die Strahlen des nahen Infraro-
tes (700-880 nm), welche von Pflanzen be-
sonders reflektiert werden und so verschiede-
ne Vegetationstypen in unterschiedlichen
Rottönen erscheinen lassen (3.5.3).
DIF-Methode: Abkürzung für Differentialme-
thode. Bei dieser “normalen” Kartiermethode
werden im Gegensatz zur gröberen INT-Me-
thode die Grenzen zwischen den Teilobjekten
unter anderem aufgrund der dominanten Ve-
getation gezogen. Weitere Grenzgebungskri-
terien der DIF-Methode sind grosse Unter-
GLOSSAR238
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 238

239GLOSSAR
schiede im Auftreten von Einschlüssen oder
markante Veränderungen des Verbuschungs-
grades (3.2.3).
Dauerweide: Fläche, die ausschliesslich be-
weidet und nur gelegentlich gepflegt (geputzt)
wird (vgl. Mähweide) (5.4.2).
Deckungsgrad: Mass für die horizontale
Ausdehnung einer Pflanzensippe in Bezug auf
eine Grundfläche. Es beschreibt den wirklichen
Flächenanteil bei senkrechter Projektion. Im
TWW-Projekt wird der Deckungsgrad von
Pflanzen in der Testfläche geschätzt. Zur mög-
lichst genauen Erfassung des D. ist eine senk-
rechte Betrachtung des Bestandes notwen-
dig. Hochwüchsiges Grünland ist schwieriger
zu schätzen als kurzrasiges (5.1.4).
Dominanz: Deckungsgrad einer Pflanze bzw.
aller Individuen einer Sippe in einer Schicht. Der
Deckungsgrad wird in % angegeben (5.1.4).
dominante oder dominierende Vege-
tation: Bezeichnung der flächenmässig vor-
herrschenden Vegetation in einem Teilobjekt.
Eichung: Austausch von verschiedenen Kar-
tierlösungen am gleichen Objekt im Gelände
durch mehrere Kartierpersonen. E. dienen
dem Angleichen der Methodeninterpretation,
der Verhinderung von subjektiven Abweichun-
gen von der Methode und der Besprechung
von Kartierproblemen (3.8.3).
Einheitsfläche: Fläche im Gelände, die be-
züglich bestimmte Kriterien (z.B. Vegetations-
typ, Gemeindezugehörigkeit) einheitlich ist.
Vgl. auch Grenzkriterien (3.7.1).
Einschluss: Ein Einschluss ist ein flächig
oder punktförmig auftretendes Phänomen
innerhalb des Teilobjekts, das mit dem Vege-
tationsschlüssel nicht erfasst wird. Für die
Minimalgrösse gibt es keine direkte Vorgabe.
Einschlüsse müssen aber beim Abschreiten
des Teilobjektes aus 20 m Distanz sichtbar
sein (5.5.2).
Erstbegehung: Arbeitsschritt bei der Vorge-
hensvariante 2. Bei der Erstbegehung verifi-
ziert die Luftbildinterpretin vorgängig bestimm-
te Stichprobenflächen im Feld und verbindet
so das Vegetationsabbild im Luftbild mit der
Vegetation draussen. Die Erstbegehung erhöht
die Qualität der nachfolgenden steresokopi-
schen Luftbildinterpretation und Abgrenzung
potentieller TWW (4.2).
Feldfolie: Kopie der Originalfolie. Die Feldfo-
lie wird in der Vorgehensvariante 2 auf dem
entsprechenden Luftbildabzug fixiert und dient
als Arbeitsfläche für die Feldkartierung (3.5.2).
Feldkartierung: Kartierung durch Bege-
hung des Geländes.
Felsensteppe: Bezeichnung für die extre-
men Trockenhänge in den Inneralpen, die auf-
fallend viele Pflanzen beherbergen, die typisch
für die osteuropäischen Steppengebiete sind.
Grossflächig sind die Felsensteppen v.a. im
Wallis. Steppenelemente werden mit den Ar-
tengruppen SP, AI oder CB erfasst (7.3.7).
Floristische Kartierfläche: Im Verbrei-
tungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der
Schweiz (Welten & Sutter, 1982) wurden land-
schaftlich relativ einheitliche Flächen von 60
bis 100 km2 festgelegt. Für diese Kartierflä-
chen wurden möglichst vollständige Pflanzen-
artenlisten aufgenommen. Die Kartierflächen
werden für die Berechnung des floristischen
Potenzials benutzt (3.3.2).
Fluktuation: Veränderung in der Vegetation
von Jahr zu Jahr, ohne dass eine gerichtete
Entwicklung von einem Vegetationstyp zu ei-
nem anderen feststellbar ist (vgl. Sukzession)
(3.8.1).
Fremdvegetation: Vegetation, die im Ge-
gensatz zur Schlüsselvegetation die Anforde-
rungen des Schwellenschlüssels nicht erfüllt,
weil sie z.B. zu fett, zu nass, zu stark bewaldet,
usw. ist (3.7.6).
Genauigkeitsuntersuchungen:Während
der Kartiersaison werden ausgewählte Objek-
te von mehreren Personen unabhängig von-
einander bearbeitet. Der Vergleich ihrer Resul-
tate erlaubt Rückschlüsse über die Fehleran-
fälligkeit der Methode (3.8.5 ).
Genetische Algorithmen: Genetische Al-
gorithmen benützen Analogien zu natürlichen
genetischen Evolutionssystemen, um Opti-
mierungsprobleme mit Hilfe von Computern
zu lösen. Genetische Algorithmen haben den
Vorteil, dass sie fehlertolerant und einfach zu
handhaben sind. Genetische Algorithmen lie-
fern gute, aber nicht unbedingt die beste Lö-
sung. (Michalewicz, 1996) (8.6).
Geomorphologische Grenze: Grenzzie-
hung, die sich an Formen des Geländes orien-
tiert. Beispiele: Graben, Verflachungen, Fels-
bänder, etc. (3.7.4).
Gewichtete Summe: Begriff aus dem Be-
wertungsverfahren. Beispiel: DasMittel von 10
und 20 ist 15. Wird der erste Summand mit
60%, der zweite mit 40% gewichtet, so beträgt
die gewichtete Summe 60% von 10 plus 40%
von 20, also 6 plus 8 gleich 14 (8.5.1).
Gewichtung: Die Bedeutung eines Kriteri-
ums für das durch die Aggregierung bestimm-
te übergeordnete Kriterium. Beispiel: Das flo-
ristische Potenzial wird für den Objekt-Ge-
samtwert mit 12,5% gewichtet.
Grenzelement: Strukturelemente, die un-
mittelbar an das TWW-Teilobjekt angrenzen.
Falls das unmittelbare Grenzelement ein Pfad,
ein Weg oder eine Strasse mit Naturbelag ist,
wird der dahinterliegende Lebensraum als
Grenzelement bezeichnet. Angrenzende Teil-
objekte gelten nicht als Grenzelemente, da sie
aus der Digitalisierung der Perimeter abgeleitet
werden können. Minimallänge: 10 m Grenz-
linie. Ausnahme: Hecken werden immer er-
fasst, auch wenn sie senkrecht zur Grenzlinie
stehen (5.5.2).
Grenzkriterien: Die Kriterien, die für die Ab-
grenzung der Einheitsflächen verwendet wer-
den, nennt man Grenzkriterien. Innerhalb der
Einheitsfläche, also dem Teilobjekt, müssen die
Grenzkriterien überall denselben Wert anneh-
men, andernfalls wird eine Grenze gezogen.
Typische Grenzkriterien sind z.B. dominieren-
der Vegetationstyp, Verbuschungsgrad, Ge-
meindezugehörigkeit, usw. Für die Methoden
DIF und INT ist der Katalog der Grenzkriterien
verschieden (3.7.1).
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 239

Hauptschlüssel: Zweiter Teil des TWW-Ve-
getationsschlüssels. Der H. dient der Ermitt-
lung des Haupttyps der Vegetation (5.1.6 ).
Haupttyp: Teil des Vegetationstyps. Der H.
wird durch die ersten beiden Buchstaben des
Vegetationstyps angegeben. Er definiert meist
die grobe Zugehörigkeit des Vegetationstyps
zu einer Vegetationsgruppe bzw. zu einem Ver-
band. Beispiel: der Vegetationstyp SPAIOR
weist den Haupttyp SP auf (5.1.6).
Höhenklassen: Für die Festlegung von Mini-
malflächen werden im Allgemeinen drei Höhen-
klassen verwendet. Obere Höhenklassen ha-
ben grössere Minimalflächen als untere. Bei-
spiel: Für die Nordalpen gelten die Klassen (1)
bis 700 m, (2) 700 m bis Sömmerungslinie (ca.
1200 m), (3) oberhalb Sömmerungslinie (3.6.2).
Höhenstufen: Durch die zunehmende
Verkürzung der Vegetationszeit mit der Mee-
reshöhe ergibt sich eine mehr oder weniger
deutliche Stufung der Vegetation. Die in Mittel-
europa am häufigsten verwendeten Bezeich-
nungen für diese Stufen sind: kollin (Wein-
baustufe) – montan (Buchenstufe) – subalpin
(Fichtenstufe) – alpin (oberhalb Waldgrenze).
Homogenität: 1. (Vegetationskunde allge-
mein) H. ist ein Mass für die Regelhaftigkeit der
Verteilung von Pflanzenarten und Strukturele-
menten in einem Bestand. 2. (TWW) H. wird
als Mass zur Beschreibung der Testfläche ver-
wendet. Dabei wird die Testfläche mit einer
dreistufigen Skala beurteilt. Bei einer wenig ho-
mogenen (inhomogenen) Testfläche sind Gra-
dienten erkennbar und fast keine Arten sind
gleichmässig über die ganze Testfläche verteilt
(5.1.2).
Index: Teil des Vegetationstyps. Ein Vegeta-
tionstyp kann neben dem Haupttyp maximal
zwei Indizes aufweisen, die je durch einen
zweibuchstabigen Code dem Haupttyp hint-
angestellt werden. Die Indizes präzisieren den
Haupttyp in ökologischer-pflanzensoziologi-
scher Hinsicht. Der Index einer Vegetation wird
durch den Indexschlüssel bestimmt (5.1.7).
Indexschlüssel:Dritter Teil des TWW-Vege-
tationsschlüssels. Der I. dient der Ermittlung
der Indizes. Für einen Vegetationstyp können
maximal zwei Indizes bestimmt werden (5.1.7).
Infrarot-Luftbild: � CIR-Luftbild
Inneralpen, inneralpin: Regionen zwi-
schen den beiden grossen Hauptkämmen der
Alpen: Wallis, Urserental, Bedretto, Bündner
Oberland, Mittelbünden, Engadin.
INT-Methode: Abkürzung für Integralmetho-
de. Im Gegensatz zur feineren DIF-Methode
wird der Vegetationstyp grundsätzlich nicht zur
Abgrenzung von Teilobjekten verwendet (Aus-
nahme: Vegetationsgruppen AE und OR). Der
Verbuschungsgrad und die Einschlüsse sind
ebenfalls keine Grenzgebungskriterien. Die
INT-Methode kommt oberhalb der Sömme-
rungslinie im Jura und in den Alpen zum Ein-
satz (3.2.3).
Kantonale Inventare, Kantonsinven-
tare: Seit der Publikation zur Kartierung von
Halbtrocken- und Trockenrasen in der Schweiz
(ANL 1981) sind in zahlreichen Kantonen Tro-
ckenwieseninventare erstellt und umgesetzt
worden (3.4.3).
Kantonale Übersichtspläne: siehe Über-
sichtspläne.
Kantonsobjekt:Objekt aus einem kantona-
len Inventar. Ausgewählte, selektierte Kan-
tonsobjekte werden in vielen Kantonen als
Kartiervorgabe verwendet (3.4.3).
Kartiererleichterung: Es gibt Situationen,
in denen ein Auskartieren der Vegetation nach
der DIF-Methode unverhältnismässig aufwen-
dig wird (Mosaiksituationen, kleinparzellige Si-
tuationen, etc.). In solchen Fällen ist es mög-
lich, Vegetationsmosaike zu einem Teilobjekt
zusammenzufassen (3.7.3).
Kartiergebiet:Gesamtheit aller Ausschnitte
in der Landschaft, die aufgrund des potenziel-
len Vorhandenseins von Trockenvegetation vor-
interpretiert (vgl. Luftbildinterpretation) und ab-
gesucht werden (vgl. Abzusuchendes Gebiet).
Kartierplot: Transparente Auflagefolie zu je-
der Landeskarte im Massstab 1:25 000. Auf
dieser Folie sind alle für die Kartierplanung re-
levanten Informationen aufgedruckt, z.B. ab-
zusuchende Gebiete, Gemeindegrenzen,
Regionengrenzen, Sömmerungslinie, Luftbild-
mittelpunkte, etc. (3.5.1).
Kartierregion: � Region
kollin: � Höhenstufen
Längsüberdeckung (bei Luftbildern):
Überlappungsbereich der Luftbilder innerhalb
einer Fluglinie. D. h. bei einer Längsüberde-
ckung von beispielsweise 75% sind auf dem
Folgebild 75% des Landschaftsausschnittes
der letzten Aufnahme ebenfalls abgebildet. Der
überlappende Bereich kann somit stereosko-
pisch ausgewertet werden (4.1).
Luftbild: (vgl. Originalluftbild) Wenn nicht ge-
nauer angegeben, wird unter Luftbild das Ori-
ginalluftbild verstanden und nicht der Luftbild-
abzug (3.5.2).
Luftbildabzug: Papierabzug des Original-
luftbildes (3.5.2).
Luftbildarchiv, Luftbild-Archivnummer:
Die Luftbildabzüge des TWW-Projektes werden
zentral archiviert. Die Archivnummer leitet sich
aus der Landeskartennummer und deren Un-
terteilungen ab.
Luftbildfolie: � Originalfolie und Feldfolie
(3.5.2).
Luftbildinterpretation: Visuelle Betrach-
tung von Originalluftbildern unter dem Ste-
reoskop, bei der aufgrund von Erfahrung –
unterstützt durch die stichprobenweise Erst-
begehung – Rückschlüsse auf die Verbreitung
von TWW in einem Gebiet gezogen werden.
Dabei werden auf der über dem Luftbild fixier-
ten Originalfolie potenzielle TWW-Objekte ab-
gegrenzt, welche in der nachfolgenden Feld-
kartierung überprüft und korrigiert werden (4).
Luftbildnummer: Setzt sich aus Flugjahr,
Auftragsnummer, Flugliniennummer und ei-
gentlicher Bildnummer zusammen. Z.B. “1997
039 201 3456”. Vgl. auch Luftbild-Archivnum-
mer (3.5.2).
GLOSSAR240
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 240

241GLOSSAR
Luftbildtypen: Im TWW-Projekt kommen
neben Color-Infrarot-Luftbildern Schwarzweiss-
oder Farb-Luftbilder zum Einsatz. Die Bilder
werden in ihrer ursprünglichen Form (zentral-
perspektivisch verzerrt) oder als Orthophotos
(entzerrt) eingesetzt. Der Mindestmassstab
beträgt jeweils 1:10 000 (3.5.3).
Mähweide: Fläche, die abwechslungsweise
beweidet und gemäht wird. Das Mähen der
Weiden wirkt bestandesverbessernd. Flächen,
die nur gelegentlich beweidet und in erster Li-
nie gemäht werden, nennt man auch “Wie-
senweiden” (5.4.2).
Methodenvarianten: Die Kartiermethode
des Projektes TWW wird in zwei leicht unter-
schiedlichen Varianten angewendet. Die Vari-
ante DIF ist genauer, aber zeitlich aufwendiger
als die Variante INT (3.2.3).
Minimalbreite: Aus pragmatischen Grün-
den der Darstellung und Handhabungmüssen
schmale Objekte eine minimale Breite von 5 m
(DIF-Methode) bzw. 10 m (INT-Methode) auf-
weisen. Abgegrenzte Teilobjekte innerhalb von
Objekten sollten nicht schmaler als 20 m sein
(3.6.3).
Minimalfläche: Wichtige Schwelle für die
Aufnahme von Objekten und Teilobjekten. Da-
mit Trockenbiotope überhaupt potenziell na-
tionale Bedeutung erlangen, ist eine gewisse
minimale Flächengrösse notwendig. Diese Mi-
nimalfläche für Objekte kann von Region zu
Region verschieden sein und berücksichtigt
die Grösse der Trockenwiesenflächen der kan-
tonalen Inventare (3.6.2).
Mitlauf-Teilobjekte:Bei der Kartierung von
selektierten Kantonsobjekten werden aus-
gehend von den Teilobjekten, die das Kan-
tonsobjekt abdecken noch weitere, direkt
angrenzende Teilobjekte aufgenommen, bis
die Schlüsselschwelle (Objektgrenze) erreicht
wird. Zusammen mit den Mitlauf-Teilobjekten
kann das kartierte Objekt weit grösser sein, als
das ursprüngliche Kantonsobjekt (3.4.3).
Modellausscheidung: Arbeitsschritt der
Vorgehensvariante 2. Die Luftbilder werden
hier für die spätere stereoskopische Betrach-
tung vorbereitet. Luftbilder werden paarweise
so zu Modellen zusammengestellt, dass einer-
seits möglichst wenige Modelle entstehen
(Kosten optimieren) und anderseits die zu be-
trachtenden Objekte einwandfrei und in mög-
lichst günstigem Betrachtungswinkel zu bear-
beiten sind (4.1).
montan: � Höhenstufen
Nachbearbeitung:Nach der Feldkartierung
gelangen die Luftbildabzüge inklusive Feldfo-
lien in die Nachbearbeitung. Hier werden die
Grenzkorrekturen der Kartierpersonen unter
dem Stereoskop auf die Originalfolien übertra-
gen (4.5).
Nutzung: Form des regelmässigen, flächigen
anthropogenen Einflusses auf eine Fläche.
Nutzung ist ein Grenzkriterium und ein Para-
meter. Die wichtigsten Nutzungsformen sind
Mähnutzung (Wiesen) und Weidenutzung
(Weide). Die “Nicht-Nutzung” (Brache) wird
ebenfalls als Nutzungsform behandelt (5.4.1).
Obergrenze: Teilobjekte werden nur bis zur
aktuellen Waldgrenze aufgenommen. Diese
liegt in den meisten Fällen ca. 200 m unter der
potenziellen Waldgrenze. In der Kartierung
wird die durch den Verbreitungsatlas von Wel-
ten & Suter (1982) definierte Linie zwischen
Tal- und Bergflächen verwendet (3.7.7).
Objekt: Im TWW-Projekt wird mit demBegriff
Objekt eine zusammenhängende Trockenra-
senfläche bezeichnet. Alle zusammenhängen-
den TWW-Teilobjekte werden zu einem TWW-
Objekt zusammengefasst. An ein Objekt grenzt
stets Fremdvegetation an. Für die Objekte wird
im Gelände keine Information erhoben. Aller-
dings muss die Fläche des Objekts abge-
schätzt werden, da die Minimalfläche der Ob-
jekte eine wichtige Steuergrösse für die Kar-
tierung ist. Die Minimalfläche für Objekte ist für
verschiedene Regionen und Höhenstufen
unterschiedlich. Im einfachsten Fall besteht
das Objekt aus nur einem Teilobjekt und seine
Fläche ist identisch mit der Fläche des Teilob-
jektes. Während Teilobjekte die wichtigste Ein-
heit für die Kartierung und Umsetzung sind, ist
das TWW-Objekt die Grundeinheit für die Be-
wertung (3.6.1).
Objektmenge: Beispielsweise die Gesamt-
heit aller Objekte eines Kantons. Die Klassie-
rung der Objekte stützt sich auf die Bewertung
von Teilmengen dieser Gesamtheit (8.6).
Originalfolie:Über das Originalluftbild fixier-
te Folie, auf der die Ergebnisse der Luftbildin-
terpretation eingezeichnet werden (4.3).
Originalluftbild: Diapositiv einer senkrech-
ten Geländeaufnahme aus der Luft. Das Origi-
nalluftbild ist nicht geländetreu, sondern zen-
tralperspektivisch verzerrt. Jeweils zwei neben-
einander liegende Bilder werden als Modell für
die stereoskopische Luftbildinterpretation ver-
wendet. Bei der Feldkartierung werden aus-
schliesslich Papierabzüge der Originalluftbilder
eingesetzt (3.5.2).
Orthophoto: Ein mit Hilfe eines digitalen
Höhenmodelles entzerrtes Luftbild, das die
geometrischen Eigenschaften einer Karte auf-
weist. Auf ein Orthophoto eingezeichnete Ob-
jekte sind somit flächen- und lagetreu.
Parameter (der Teilobjekte): Zu erfassende
Eigenschaften eines Teilobjektes. Beispiele von
Parametern: Gemeindezugehörigkeit, Höhe
ü. M., Vegetationstypen, Verbuschungsgrad,
Nutzung, etc. (3.5.3).
Perimeter: Grenzlinie einer Fläche.
Pflanzengesellschaft: Regelmässig wie-
derkehrende Vergesellschaftung von Pflanzen-
arten; P. ist ein allgemeiner, neutraler Begriff für
Vegetationstypen ohne genauere Zuordnung
zu einer definierten Vegetationseinheit.
Pflanzensoziologie: Spezialgebiet der
Pflanzenökologie, das sich mit dem Aufbau
und der Abgrenzung von Pflanzengesellschaf-
ten beschäftigt und dabei die floristische Zu-
sammensetzung der Gesellschaft in den Vor-
dergrund rückt. Dazu gehört auch die Analyse
der Faktoren, die zu den verschiedenen Pflan-
zengesellschaften führen oder diese verändern
(5.1.1).
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 241

Phänologie: Veränderung von Pflanzen und
Tieren im Laufe eines Jahres, wie Knospung,
Blühzeitpunkt, Zeit der Fruchtbildung, Paa-
rungszeit, Zeit des Fellwechsels, etc. (3.8.1).
photogrammetrische Auswertung: Der
zentralperspektifisch verzerrte Landschafts-
ausschnitt eines Originalluftbildes wird in eine
orthogonale Projektion überführt. Die auf dem
Luftbild eingezeichneten Teilobjektgrenzen
werden so vom Photogrammeter in eine digi-
tale, lage- und winkeltreue Form gebracht
(4.6).
Plot: � Kartierplot
Protokollblatt: Wichtigstes Formular der
Feldkartierung zum Eintragen der wichtigsten
Parameter (Inhalte) der Teilobjekte, wie Vege-
tation, Einschlüsse, Nutzung, etc. (5.7.1).
Region: Naturräumlich relativ einheitlicher
Teil der Schweiz. Regionengrenzen sind nicht
zwingend mit Kantonsgrenzen identisch. Im
TWW-Projekt werden verschiedene Regionen-
grenzen verwendet: 1. Biogeographische Re-
gionen: Aufgrund einer Analyse des Verbrei-
tungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der
Schweiz (Welten & Sutter, 1982) entwickelte
Wohlgemuth (1996) eine Klassierung, die dann
vom Centre Suisse de Cartographie de la Fau-
ne im Auftrag des BUWAL überarbeitet wurde.
Sechs Regionen werden unterschieden: Jura,
Mittelland, Nordalpen,Wallis, Graubünden und
Südalpen (Gonseth et al.). 2. Kartierregionen:
Regionalisierung der Schweiz aufgrund der na-
turräumlichen Gliederung von Guterssohn
(1973) und der botanischen Gliederung nach
Landolt (1991). Diese Einteilung ist für die De-
finition der Minimalflächen massgebend (3.3).
Repräsentativität: Mass zur Beurteilung
der Testfläche mit einer dreiteiligen Skala. Bei
hoher R. ist die dominierende Vegetation des
Teilobjektes durch die Testfläche sehr gut re-
präsentiert. Bei schlechter R. ist die dominie-
rende Vegetation des Teilobjektes durch die
Testfläche nur teilweise repräsentiert (5.1.2).
Schlüsselart: Pflanzenarten, die einer defi-
nierten Artengruppe zugeordnet werden kön-
nen und damit einen Einfluss auf die Beurtei-
lung der Vegetation durch den Vegetations-
schlüssel haben (Gegensatz: Begleitart) (5.1.4).
Schlüsselschwelle: Zur Abgrenzung der
vom TWW-Projekt anerkannten Trockenvege-
tation (Schlüsselvegetation) von der Fremd-
vegetation ist ein Kriterienkatalog notwendig,
der die Grenzziehung definiert. Die Gesamtheit
der Kriterien, die gleichzeitig erfüllt sein müs-
sen und in einem Schlüssel erfasst sind, wird
Schlüsselschwelle genannt (3.7.6).
Schlüsselvegetation: Vegetation, die im
Gegensatz zur Fremdvegetation die Anforde-
rungen der Schlüsselschwelle erfüllt. Darunter
fallen die Trocken- und Halbtrockenrasen,
wechseltrockene Wiesen und Weiden, Step-
penrasen, trockene Säume und halbruderale
Trockenrasen. In höheren Lagen werden zu-
dem Rostseggen-, Buntschwingel- und Blau-
grashalden und artenreiche Borstgrasrasen,
als Schlüsselvegetation anerkannt (3.7.6).
Schwellenschlüssel: Der erste der drei
TWW-Vegetationsschlüssel. Der Schwellen-
schlüssel enthält eine Anzahl von Kriterien, die
eine Abgrenzung des zu kartierenden vom
nicht zu kartierenden Gelände erlauben. Mit
Hilfe des Schwellenschlüssels werden die
Grenzen der Teilobjekte ermittelt (3.7.6).
Selektierte (Kantons-)Objekte: In Kan-
tonen mit bestehendem und nicht veraltetem
Inventar der Trockenstandorte werden die be-
reits kartierten Gebiete nicht erneut abge-
sucht. Nach einem computergestützten Be-
wertungsverfahren wurden in der WSL die
kantonalen Objekte für jeden Kanton rangiert
und die wertvollsten (rund 30%) für die Über-
sicht der Trockenwiesen und -weiden der
Schweiz vorgeschlagen. Um diese selektierten
Kantonsobjekte im Bewertungsverfahren mit
den übrigen kartierten Teilobjekten vergleichen
zu können, müssen dieselben Informationen
zur Verfügung stehen. Es werden daher alle se-
lektierten Kantonsobjekte nochmals aufge-
sucht und neu kartiert (3.4.3).
Singularitätenformular: Formular für die
Kartierung zum Festhalten von zusätzlicher In-
formation zu einer kartierten Singularität (6.4 ).
Sömmerungslinie: Grenze zwischen der
Ganzjahresbewirtschaftung und der Alpnut-
zung. Genaue Definition gemäss Landwirt-
schaftlicher Begriffsverordnung. Diese Grenz-
linie wird als Methodengrenze zwischen DIF-
Methode und INT-Methode verwendet (3.2.3).
Soziologische Artengruppen: Gruppen
von Pflanzenarten, die aufgrund von Erkennt-
nissen aus der Pflanzensoziologie zusammen-
gestellt wurden (7.2).
Standort: Summe aller Umweltfaktoren, de-
nen eine Pflanzengesellschaft ausgesetzt ist.
Stereoskop: Gerät zum dreidimensionalen
Betrachten von Stereomodellen, d. h. von zwei
sich inhaltlich überlappenden Bildern. Bei die-
sem Vorgang entsteht durch die Verschmel-
zung der beiden Einzelbilder, welche dieselben
Objekte aus unterschiedlichem Blickwinkel
aufweisen, ein dreidimensionaler Bildeindruck.
Strukturelement:Biotische oder abiotische
Elemente innerhalb eines Teilobjektes (oder in
dessen unmittelbaren Umgebung), die Auswir-
kungen auf die strukturelle Vielfalt des Teilob-
jektes haben und somit den Lebensraum für
die Fauna massgeblich mitprägen. Das Struk-
turelement ist entweder ein Einschluss oder
ein Grenzelement (5.5.1).
subalpin: � Höhenstufen
Sukzession: Veränderungen der Vegetation
von Jahr zu Jahr, bei der eine Entwicklung von
einem Vegetationstyp zu einem anderen ohne
Zutun des Menschen feststellbar ist (3.8.1).
Teilobjekt: Im TWW-Projekt wird mit dem
Begriff Teilobjekt eine zusammenhängende
Trockenrasenfläche bezeichnet, in der be-
stimmte Eigenschaften (z.B. Vegetationstyp,
Nutzung, Verbuschungsgrad) einheitlich sind
(Einheitsfläche). Das TWW-Teilobjekt ist die
Grundeinheit der Kartierung und Umsetzung.
Jedes Teilobjekt wird während der Kartierung
auf dem Luftbildabzug mit einem Perimeter
festgehalten und mit einem Protokollblatt in-
haltlich beschrieben. Im Gelände werden nur
auf der Ebene von Teilobjekten Daten aufge-
nommen. Teilobjekte müssen eine vorgegebe-
GLOSSAR242
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 242

243GLOSSAR
neMinimalfläche aufweisen, die regional unter-
schiedlich sein kann. Aneinander grenzende
Teilobjekte werden zu Objekten zusammenge-
fasst, die ebenfalls eine Minimalfläche aufwei-
sen müssen (3.6.1).
Testfläche: Ausgewählter, repräsentativer
Flächenausschnitt eines Teilobjektes, in dem
die vollständige Artenliste mit Deckungsanga-
ben erhoben wird. Aufgrund dieser Liste kann
der Vegetationstyp des Teilobjektes bestimmt
werden. Das Zentrum der Testfläche wird mit
einem GPS eingepeilt, damit in späteren
Jahren die Aufnahme für eine Erfolgskontrolle
wiederholt werden kann. Die Testfläche ist
stets ein Kreis mit einem Radius von 3 m
(5.1.2).
Testkartierung: Kartierung im ersten Pro-
jektjahr (Testphase) zur Entwicklung der Kar-
tiermethode (3.2.2).
Trockenrasen: 1. Allgemeine Bezeichnung
eines von mindestens zeitweiliger Trockenheit
und durch die Dominanz von grasartigen
Pflanzen geprägten Vegetationstyps ohne ge-
naue Zuordnung zu einer Vegetationseinheit.
2. Vegetationstypen mit bestimmten, an ex-
treme Trockenheit besonders angepassten
Zeigerpflanzen. Sie werden meist als Xerobro-
mion (subatlantischer Trockenrasen), Stipo-
Poion (steppenartiger Trockenrasen) oder
Agropyrion intermedii (halbruderaler Trocken-
rasen) bezeichnet (7).
Trockenwiese: Allgemeine Bezeichnung ei-
ner von mindestens zeitweiliger Trockenheit
geprägten Wiese ohne genaue Zuordnung zu
einer Vegetationseinheit.
Übersichtspläne: Pläne der kantonalen Ver-
messungsämter, meist imMassstab 1:10 000,
teilweise auch im Massstab 1:5000. Auf die
Übersichtspläne werden die Kartierresultate
übertragen, entweder von Hand (Vorgehens-
variante 0) oder digital durch den Computer
(übrige Vorgehensvarianten) (3.5.1).
Vegetationsaufnahme: Erhebung einer
vollständigen Liste von Pflanzenarten in einer
vorgegebenen Fläche. Für jede Art wird zu-
sätzlich ihre Artmächtigkeit bezüglich dieser
Fläche geschätzt. Für die V. in der Testfläche ist
für die Kartierleute im TWW-Projekt eine Zeit-
limite von ca. 10-15 Min. vorgegeben (5.1.4).
Vegetationseinheiten:Allgemeine, neutra-
le Bezeichnung eines Ausschnittes aus der Ve-
getation mit einer bestimmten Zusammenset-
zung von Pflanzenarten. Die im TWW-Projekt
verwendete Klassifikation der Vegetation lehnt
sich an die mitteleuropäische Pflanzensoziolo-
gie an. Die durch die Klassifikation definierten
Vegetationseinheiten gelten einheitlich für die
ganze Schweiz, auf allen Höhenstufen (5.1.6).
Vegetationstyp: Allgemeine, neutrale Be-
zeichnung eines Ausschnittes aus der Vegeta-
tion mit einer bestimmten Zusammensetzung
von Pflanzenarten. Im Projekt TWW werden
die durch den Vegetationsschlüssel ermittelten
Einheiten als Vegetationstypen bezeichnet.
Vgl. auch Vegetationseinheiten (5.1.6).
Verband: In der Pflanzensoziologie bezeich-
net der V. eine Zusammenfassung ähnlicher
Assoziationen. V. sindmeist floristisch gut cha-
rakterisiert und über grössere Gebiete einheit-
lich ausgebildet. Sie eignen sich daher gut als
Basis für Einheiten bei grossräumigen Erhe-
bungen wie dem TWW-Projekt (5.1.1).
Verbuschung: Natürliches Einwachsen von
Gehölzarten unterschiedlicher Grösse in das
Grasland. Ein mittlerer Verbuschungsgrad för-
dert im Allgemeinen die biologische Vielfalt
einer Fläche (5.3.1).
Vernetzung: Einbettung des Objektes in der
Landschaft unter dem Aspekt des Kontaktes
(Vielfalt und Qualität) zu anderen Lebensräu-
men. Im Projekt TWW werden bei der Felder-
hebung vier Qualitätststufen der Vernetzung
(Vernetzungsgrade) angegeben (5.6).
Vorgehensvariante: Definition verschiede-
ner Vorgehensweisen, wie Trockenwiesenflä-
chen erfasst und in eine entzerrte, kartogra-
fisch darstellbare Form gebracht werden. Das
TWW-Projekt kennt vier verschiedene Vorge-
hensvarianten (Varianten 0, 1, 2, 3) (3.2.4).
Wildheu: Gemähtes Grünland in der Alpstu-
fe, also oberhalb der Sömmerungslinie. Im
Normalfall sind diese Flächen abgelegen und
steil; sie werden nicht gedüngt und oft nur alle
2-3 Jahre genutzt (halb- bzw. drittelschürig)
(5.4.2).
Zwergsträucher: Kleingehölze (bis ca. 50
cm hoch) mit vollständig verholzter Spross-
achse. Beispiele: Rhododendron ferrugineum,
Juniperus sabina, Calluna vulgaris (3.7.7).
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 243

AE: Abkürzung für Arrhenatheretalia elatioris =Vegetationsordnung der Fettwiesen und -wei-den, benannt nach dem Glatthafer (Arrhena-therum elatius).
AEMB: Abkürzung für wenig intensive, trocke-ne und artenreiche Fettwiesen oder -weidenmit einzelnen Kennarten aus den Halbtrocken-rasen (Mesobromion, MB). Solche Vegeta-tionstypen liegen im Grenzbereich des Vege-tationsschlüssels.
AI: Abkürzung für Agropyron intermedii = Ve-getationsverband der halbruderalen Trocken-rasen, benannt nach der oft dominierendenMittleren Quecke (Agropyron intermedium).
ANL: Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft fürNaturschutz und Landespflege, Umweltbera-tungsbüro in Aarau.
AV: Abkürzung für Artemisietea vulgaris = Ve-getationsklasse der mehrjährigen Ruderalve-getation, benannt nach dem Gemeinen Bei-fuss (Artemisia vulgaris).
BLN: Abkürzung für Bundesinventar derLandschaften von nationaler Bedeutung.
BUWAL: Bundesamt für Umwelt, Wald undLandschaft.
CA: Abkürzung für Caricion austroalpinae =Vegetationsverband der südalpinen Blaugras-halden, benannt nach der Südalpen-Segge(Carex austroalpina), einer nahen Verwandtender Rostsegge, die aber für die südalpinenBlaugrashalden charakteristisch ist.
CB: Abkürzung für Cirsio-Brachypodion = Ve-getationsverband der subkontinentalen Tro-ckenrasen, benannt nach der in der Schweiznicht vorkommenden Ungarischen Distel (Cir-sium pannonicum). In der Schweiz kommt die-se Vegetationseinheit nur rudimentär vor.
CD: Abkürzung für Caricion davallianae = Ve-getationsverband der Kalkflachmoore, be-nannt nach der hier typischen Davalls Segge(Carex davalliana).
CF: Abkürzung für Caricion ferrugineae = Ve-getationsverband der Rostseggenhalden, be-nannt nach der Rost-Segge (Carex ferruginea).
CN: Abkürzung für Caricion nigrae = Verbandder bodensauren Braunseggenmoore, be-
nannt nach der Braunsegge (Carex nigra).
CIR: Abkürzung für Color-Infrarot (-Luftbild).
DHM: Abkürzung für Digitales Höhenmodell.
DIF: Abkürzung für Differentialmethode.
DZV: Abkürzung für Direktzahlungsverord-nung des Bundes.
FA: Abkürzung für Festuco-Agrostion = Vege-tationsverband der frischen, halbfetten Wie-sen und Weiden, benannt nach dem Rot-Schwingel (Festuca rubra) und dem Haar-Straussgras (Agrostis capillaris), die solcheWiesen oft dominieren.
FFH: Abkürzung für Flora-Fauna-Habitats-richlinie der EU
FV: Abkürzung für Festucion variae = Vegeta-tionsverband der Buntschwingelhalden, be-nannt nach demBuntschwingel (Festuca varia).
GIS: Abkürzung für Geographisches Informa-tionssystem.
GPS: Abkürzung für Geographic PositioningSystem. Ein GPS ist ein Gerät, das mit einerAntenne ausgestattet ist, die Peilsignale vonSatelliten empfangen kann. So kann dank denverschiedenen Signalen von mehreren Satelli-ten die genaue Position auf der Erdoberflächeermittelt werden.
INT: Abkürzung für Integralmethode.
LK25: Abkürzung für die Landeskarte derEidgenössischen Landestopographie imMassstab 1:25 000.
LKS: Abkürzung für LandschaftskonzeptSchweiz
LwG: Abkürzung für Bundesgesetz über dieLandwirtschaft.
MB: Abkürzung für Mesobromion = Vegeta-tionsverband der Halbtrockenrasen, benanntnach meso = “halb” und der Aufrechten Tres-pe (Bromus erectus).
Mo: Abkürzung für Molinion caeruleae = Ve-getationsverband der Pfeifengraswiesen, be-nannt nach dem Pfeifengras (Molinia caerulea).Der in Vegetationstypen vorkommende Index
kennzeichnet wechselfeuchte, mässig nähr-stoffreiche Vegetation.
NHG: Abkürzung für das Bundesgesetz überden Natur- und Heimatschutz.
NS: Abkürzung für Nardion strictae = Vegeta-tionsverband der subalpinen Borstgrasrasen,benannt nach dem hier dominanten Borstgras(Nardus stricta).
OR: Abkürzung für Origanetalia = Vegeta-tionsordnung der halbschattigen Saumgesell-schaften, benannt nach demWilden Dost (Ori-ganum vulgare). Die Gruppe der OR-Kennar-ten wird in zwei Untergruppen getrennt: OR1= Arten der trockenen, nährstoffarmen Säume,OR2 = Arten der mesophilen (gemässigten),nährstoffreicheren Säume.
SP: Abkürzung für Stipo-Poion = Vegetations-verband der inneralpinen, steppenartigen Tro-ckenrasen, benannt nach dem Pfriemengras(Stipa capillata) und dem Niedlichen Rispen-gras (Poa perconcinna) im Wallis bzw. nachdem Trocken- Rispengras (Poa molinieri) inGraubünden.
SV: Abkürzung für Seslerion variae = Vegeta-tionsverband der Blaugrashalden, benanntnach dem Blaugras (Sesleria varia).
TWW: Abkürzung für Trockenwiesen und-weiden der Schweiz.
VC: Abkürzung für Violion caninae = Vegeta-tionsverband der bodensauren Heiderasen tie-ferer Lagen, benannt nach demHundsveilchen(Viola canina). Der in Vegetationstypen vor-kommende Index VC kennzeichnet boden-saure Verhältnisse.
WSL: Eidgenössische Forschungsanstalt fürWald, Schnee und Landschaft.
XB: Abkürzung für Xerobromion = Vegeta-tionsverband der subatlantischen Trockenra-sen, benannt nach xero= “trocken” und derAufrechten Trespe (Bromus erectus). In derSchweiz ist das Xerobromion nur rudimentärund nur in den tieferen Lagen vertreten.
ZS: Abkürzung für eine definierte Gruppe vonsubalpinen Zwergsträuchern. Wenn die ZS-Arten mit einer Deckung von über 25% imBestand vorkommen, so gilt die Vegetation alsFremdvegetation.
ABKÜRZUNGEN244
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 244

Fremdveg.
Schlüsselveg.
Hauptkriterien
Abgrenzung gegenüber
Fettwiesen und
artenarmen Mager-
wiesen
Gruppe NS1 :Nardus stricta
Carex leporina
Avenella flexuosa
Carex fritschii
Baumschicht wird ab Wuchshöhe von 5 m gerechnet. Das Grenzkriterium kann auf
dem Luftbild abgeschätzt werden.Baumschicht max. 50%
Zwergsträucher (ZS) +Cytisus scopariusmax. 25%
Deckung der Flachmoorarten oder derArten aus MO max. 50% bzw. max. 9Flachmoorarten
Allgemeine Abgrenzungen
Die Fläche ist begehbar
Die Schlüsselvegetation deckt mind. 25%
relativ zur ganzen Teilobjektfläche
Fläche ist bewirtschaftet
Die Fläche ist beweidet oder wird gemäht oder die Nutzung ist erst kürzlich aufgege-
ben worden. Hinweise auf längerfristig nicht genutzte Flächen ergeben Baum- und
Zwergstrauchaufwüchse. Im Zweifelsfall kartieren. INT = gilt nur für Integralmethode
(oberh. Sömmerungslinie)
Abgrenzung Fremdvegetation
Deckung mesophiler Saumarten (OR2),Ruderalarten (AV) und Hochstauden (AD)zusammen max. 50%
Gruppe OR2Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Aposeris foetida
Chaerophyllum aureum
Clinopodium vulgare
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
Fragaria vesca
Galium aparine
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens sp.
Lamium sp.
Lapsana communis
Luzula silvatica
Mycelis muralis
Potentilla reptans
Rubus sp.
Sambucus ebulus
Solidago virgaurea
Vicia cracca/sepium
Gruppe AVAgropyron repens
Arctium sp.
Artemisia vulgaris
Bromus inermis
Bromus sterilis
Chenopodium sp.
Cirsium arvense
Cirsium spinosissimum
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Equisetum arvense
Erigeron annuus
Galeopsis tetrahit
Lactuca serriola
Medicago sativa
Melilotus sp.
Oenothera sp.
Pastinaca sativa
Picris hieracioides
Plantago major
Poa annua / supina
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Senecio alpinus
Solidago canadensis
Sonchus sp.
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Urtica dioica
Gruppe ADAconitum sp
Adenostyles alliaria
Agrostis schraderiana
Aruncus dioicus
Athyrium sp.
Calamagrostis arundin.
Calamagrostis epigeios
Calamagrostis villosa
Cicerbita sp.
Cirsium helenioides
Dryopteris sp.
Epilobium alpestre
Epilobium angustifolium
Gentiana lutea
Prenanthes purpurea
Pteridium aquilinum
Ranunculus aconitifolius
Stemmacantha scariosa
Saxifraga rotundifolia
Senecio ovatus
Veratrum album
aber:als schmaler Rand des Teilobjektes ist
auch ein mesophiler Saum erlaubt
Die Schlüsselvegetation deckt mind. 50%
relat. zur vegetationsbedeckten Fläche
INT
Gruppe ZS (bei Wiesen müssen die Arten in der oberen Feldschicht wachsen!)
Arctostaphylos uva-ursi
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Rhododendron ferrugineum
Juniperus communis s.l.
Juniperus sabina
Diese Grenzdefinition stimmt spiegelbildlich mit der Schwellendefinition des Flach-
moorschlüssels überein. Für die Liste der Flachmoorarten vgl. Merkblatt über den
Flachmoorschlüssel.
In Weiden deckt AE+NS1 max. 50 % In INT-Regionen darf der Anteil der Fettwiesenarten (inkl. Nardus) an
der Weidevegetation 50% nicht übersteigen
Deckung von AE+OR2+ MB2+NS1 max.50%oder 6 Arten aus MB*+SV
oder 6 Arten aus NS2oder 6 Arten aus CF
INT
Anleitung: Mit dem Schwellenschlüssel werden die Abgrenzungen (der Perimeter) des Teilobjektes gegenüber Fremd-
vegetation ermittelt. Alle Bedingungen in den untenstehenden 9 Kästen müssen für den gesamten Inhalt des Teilobjektes
erfüllt sein.Ausnahmen: (a) mesophile Randsäume und Hochstaudensäume dürfen als Randerscheinung im Teilobjekt integriertwerden (vgl. Technische Anleitung) und (b) im Hauptkriterium-Kästchen muss nur eine der Bedingungen erfüllt sein.
Felsen und steile Grashänge, deren Begehung gefährlich ist, werden nicht aufgenom-
men, aber ggf. mit entsprechendem Code im Luftbild markiert. Für einzelne Vegetations-
typen ist Aufnahme aus Distanz möglich, vgl. Technische Anleitung
Vegetationsschlüssel: 1. Schwellenschlüssel
1
Bei folgenden Spezialfällen müssen 6
Arten aus MB/NS2/CF vorhanden sein:
- Moosschicht > 10% und AE+OR+Moosschicht zus. über 50%
- Rhinanthus alectorolophus über 20%
Der Anteil an Fremdvegetation (d.h. Moore, Ruderalvegetation,
artenarme Fettwiesen, usw.) darf 50% der Vegetation nicht
überschreiten. Anm.: Schlüsselvegetation = die Schwellen-
kriterien erfüllende Vegetation.
Der Anteil an Fremdvegetation plus die vegetationsfreie Flä-
che dürfen zusammen 75% nicht überschreiten (Abgrenzung
gegenüber Fels und Schutt)
*MB2 kann nur gezählt werden, wenn Bromus erectus mind. 5% decktDie Artengruppen AE, OR, MB2 und MB sind in den Artenlisten aufgeführt.
123456789123456789123456789123456789123456789
Fels, Schutt
Die Fläche liegt unterhalb der Waldgrenze(für Mähnutzung gilt keine Obergrenze)
Die generelle Obergrenze liegt ca. 200m unterhalb der
potentiellen Waldgrenze, was in vielen Fällen der aktuellen
Waldgrenze entspricht.
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 245

Carex sempervirens > 25 % Rasen mit dominanter immergrüner Segge(dem Festucion variae oder dem Seslerion
zugehörig).
Vegetationsaufnahme machen und der Kartierleitung melden!
AEMB
6 Arten aus MB/SV AE > 25%
Spezialfälle
Halbtrockene Vegetation,
Anleitung: Mit dem Hauptschlüssel wird der Haupttyp ermittelt. Die Reihenfolge der Kästchen ist wichtig: die Bedingungs-
kästchen werden von oben nach unten abgehandelt, bei verschachtelten Kästchen hat jeweils das innerste Priorität, die
Bedingung des äusseren Kästchens muss aber erfüllt sein. Sobald eine Bedingung erfüllt ist, wird der entsprechende Code
des Kästchens (z.B. AI oder AEMB) übernommen und die Bestimmung der Hauptvegetation ist beendet.
Abkürzungen: AI > 25% = AI deckt mind. 25% ; XB/SP = es gelten Arten aus beiden Gruppen zusammen.
Extreme Trockenrasentypen
Gruppen XB und SP −> Artenliste
auf einer kreisförmigen Testfläche mit 3 m Radius gilt:
HalbtrockenrasenGruppen MB (=MB1+MB2) und AE
(=AE1+AE2+AE3) −>Artenliste
>Keine Bedingung erfüllt
MB
Bromus erectus und Brachypodium pinnatum
decken mehr als 25%
Spezialfälle:
2
Artenarme, grasdominierteRasenWenn ungenutzt (Brachen) nur
bei Methode DIF aufzunehmen
(−>Kasten 4,Schwellenschlüssel)
SV
FV3 Arten aus FV
4 Arten aus SV
Vegetationsaufnahme
machen!
in folgendem Fällen nicht
aufnehmen:
− Weiden im INT-Bereich
− Weiden mit mind. 3 Arten aus AE3
AE + NS1 > 50%
AE2 > 25% FAMB
Gruppe AE3 −>Artenliste Gruppe NS1 :Nardus stricta
Carex leporina
Avenella flexuosa
Carex fritschii
Gruppe FV1:Festuca paniculata
Festuca varia
Poa violacea
Grossflächige Saumgesellschaften(v.a. Lichtungen). Gruppe OR (=OR1+OR2)
−>Artenliste
6 Arten aus AI Halbruderale Trockenrasen
Gruppe AI −> Artenliste
6 Arten aus XB/SP/CB
und AE deckt
nicht mehr als 5%
Tro
cken
veg
eta
tio
n h
öh
ere
r Lag
en
6 Arten aus NSoder Nardus > 10%
6 Arten aus SV/MB,wobei mind. 4 aus SVoder Sesleria > 10%
Silikat- TrockenrasenGruppe FV =FV1/FV2/FV3
−> Artenliste
Rostseggenhalden
Gruppe CF −> Artenliste
BlaugrashaldenGruppen SV und MB
−>Artenliste
BorstgrasrasenNS=NS1+NS2,
-> Artenliste
AI
OR decktmindestens 25%
Laserpitium latif. +
Laserpitium siler > 10%ORLA
XB3 Arten aus SP/CB
oder SP > 10% SP
6 Arten aus FV/SS, wobei
mind. 3 aus FV1/FV2
oder FV1 > 10% FV
AE > 25%
MBFV
-> Kasten AEMB
extr
em
e T
rocke
nve
g.
6 Arten aus CF oder
Carex ferruginea > 10% MBCFCF
SV
NS
OR
6 aus MB, davon 2 graminoid
Graminoide ArtenArten der Familien
Poaceae oder
Cyperaceae
MB = MB1 + MB2
Vegetationsschlüssel: 2. Hauptschlüssel
AE > 25%
MBSV
AE > 25%
MBNS
-> Kasten AEMB
-> Kasten AEMB
6 aus MB, davon
2 graminoid
6 aus MB, davon 2 graminoid
6 aus MB, davon 2 graminoid
AILL
SPLL
MBLL
AI deckt mindestens 25%
SP deckt mindestens 25%
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 246

Anleitung: Schlüssel zur Bestimmung ökologischer, struktureller und biogeographischer Zusatzangaben. Zum Code des
Haupttyps (Hauptschlüssel) können 1-2 Indices hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Kästchen von oben nach unten
ist wichtig, d.h. die oberen Kästchen haben Priorität. Aus jedem Kästchen kann nur ein Index bestimmt werden, wobei die
Reihenfolge der Fragen innerhalb der Kästchen gleichzeitig eine Prioritätsabfolge ist. Für bestimmte Haupttypen gibt esungültige Indices, d.h. der betreffende Index darf nur angehängt werden, wenn die neben dem Kästchen stehenden
Codes nicht bereits in der Haupttypen-Bezeichnung integriert sind. Beispiel: der Index AE darf dem Haupttyp MBFA nichtangehängt werden.
Hauptgradient
Spezialeinheiten
Artenreichtum artenreiche Silikatrasen
1. mind. 8 Arten aus NS/FV/SS/MBwobei mind. 3 aus FV ..................................................... FV
4. mind. 8 Arten aus NS/FV/SS .......................................... NS artenreiche Borstgrasrasen
Wechselfeuchte
2. mind. 8 Arten aus CF/SVwobei mind. 4 aus CF .................................................... CF
3. mind. 8 Arten aus SV/MB/FV3wobei mind. 4 aus SV .................................................... SV
artenreiche Rostseggenhalden
artenreiche Blaugrashalden
3. mind. 4 Arten aus MO/CD/CN
oder MO > 25% ............................................................. MO
1. mind. 4 Arten aus MO/CD/CNund CD > CN bzw. CD > MO ......................................... CD
2. mind. 4 Arten aus MO/CD/CN und CN > MO
oder Carex nigra > 10% ................................................. CN
allgemeine Wechselfeuchtepfl.
saure wechselfeuchte Rasen
wechselfeuchte Kalkrasen
mit Saumarten1. mind. 4 Arten aus OR oder OR > 10% .......................... OR
2. Sesleria + Carex montana+ Carex sempervirens > 5%.......................................... SC
OR
4. mind. 3 Arten aus AI oder AI mind. 5% .......................... AI
3. Festuca paniculata vorhanden ...................................... FP
2. mind. 2 Arten aus SV2 oder SV2 mind 5% .................... CA
1. mind. 2 Arten aus CB oder CB mind. 5% ...................... CB
ausgeschlossene Haupttypen- und Nebentypen-Codes¬¬¬¬¬
mit halbruderalen Trockenpfl.
südalp. Goldschwingelrasen
mit südalpinenKalkarten
mit subkontinentalen Arten
AI
3
mit Steppenarten
4. Arten aus AE2 >10% ..................................................... FA
3. mind. 3 Arten aus XB/SP/SS und AE max. 10% ........... SS
5. Arten aus AE > 5% ........................................................ AE
mit Felsgruspflanzen
AE, FA mit Frischezeigern
AE, FA mit Fettzeigern
SP, XB
SP, XB
1. mind. 3 Arten aus SP/XB/CB
davon mind. 2 aus SP/CB oder 1 Art aus SP > 5%und AE max. 10% .......................................................... SP
2. mind. 3 Arten aus XB/SP und AE max. 10% ................. XB SP, XB mit mediterranen Trockenpfl.
Öko
l. E
rgän
zun
gen
3. mind. 4 Arten aus NS/FV/VC/SS.................................... VC FV, NS versauerte Rasen
NS,SV
CF,FVkurzrasige Kalkrasen
Vegetationsschlüssel: 3. Indexschlüssel
Mehrfachnennungen möglich!
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 247

PUBLIKATIONSLISTE248
SCHRIFTENREIHE UMWELT - CAHIERS DE L’ENVIRONNEMENT
Natur/LandschaftNature/paysage
SRU-322-F Impact de la privatisation sur l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de la LPN. Fr. 10.00Avis de droit de J.-B. Zufferey. 2001. 56 p. BUWAL
SRU-281-D Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Voll versionen. 1997. ca. 300 S. Fr. 35.00SRU-281-F Idées spécifiques pour la nature et le paysage. 1e série textes intégraux.
EDMZ 310.131
SRU-280-D Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Zusammenfassungen. 1997. ca. 30 S. Fr. 0.00SRU-280-F Idées spécifiques pour la nature et le paysage. 1e série, résumés.
EDMZ 310.130
SRU-223-D Massnahmen im Sinne von Art. 18 NHG sowie ihre Durchsetzung und Sicherung gegenüber Dritten. Fr. 10.00 1994. 57 S.BUWAL
SRU-202-D Zum Verhältnis zwischen Forstwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz. Juli 1993. 212 S. Fr. 25.00BUWAL
SRU-176-F La nature aux mains des paysans. Aménagement du territoire agricole. Mars 1992. 97 p. Fr. 10.00BUWAL
SRU-175-D Holznutzung im Einklang mit Natur- und Umweltschutz. März 1992. 101 S. Fr. 10.00BUWAL
Natur/Landschaft - LandschaftNature/paysage - Paysage
SRU-306-D Nationale Prioritäten des ökologischen Ausgleichs im landwirtschaftlichen Talgebiet. Schlussbericht. Fr. 20.001998. 162 S.
SRU-306-F Priorités nationales de la compensation écologique dans la zone agricole de plaine. Rapport final.1998. 160 p.BUWAL
SRU-261-D Bioindikation und ökologische Ausgleichsflächen. Übersetzung der 1996 erschienenen Fr. 20.00französischen Fassung. 2000. 123 S.
SRU-261-F Bioindication et surfaces de compensation écologique. 1996. 135 p. Fr. 0.00BUWAL
SRU-246-D Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S. Fr. 15.00SRU-246-F Prairies maigres tessinoises en mutation.SRU-246-I Prati magri ticinesi tra passato e futuro.
BUWAL
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 248

249PUBLIKATIONSLISTE
Natur/Landschaft - SchutzgebieteNature/paysage - Zones protégées
SRU-321-D Rechtliche Möglichkeiten der Sicherung von Grossschutzgebieten. 2000. 38 S. Fr. 7.00BUWAL
SRU-305-D Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen als Auengebiete. Technischer Bericht. 1999. Fr. 15.00 Ca. 150 S.
SRU-305-F Marges proglaciaires et plaines alluviales alpines en tant que zones alluviales. Rapport technique. 1999. Ca. 150 p.BUWAL
SRU-268-D Ramsar-Bericht Schweiz. Eine Standortbestimmung zur Umsetzung des Übereinkommens über Fr. 20.00Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung.1996. 112 S.
SRU-268-F Rapport Ramsar Suisse. Bilan de l’application de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eaux.BUWAL
SRU-246-D Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S. Fr. 15.00SRU-246-F Prairies maigres tessinoises en mutation.SRU-246-I Prati magri ticinesi tra passato e futuro.
BUWAL
SRU-233-D Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Schlussbericht. 1994. 75 S. Fr. 10.00SRU-233-F Inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale. Rapport final.
BUWAL
SRU-216-D Begrünte Dächer. Oekologische Nischen und Ausgleichsflächen im Siedlungsraum unter Fr. 8.00besonderer Berücksichtigung der Extensivbegrünung. 1995. 57 S.
SRU-216-F Toits végétalisés. Niches écologiques et surfaces de compensation dans les zones d’habitation sous l’angle particulier de la végétalisation extensive.BUWAL
SRU-213-D Pufferzonen für Moorbiotope. Literaturrecherche. 1994. 27 S. Fr. 0.00SRU-213-F Zones-tampon pour les marais. Recherche bibliographique.
BUWAL
SRU-199-D Kartierung der Auengebiete von nationaler Bedeutung. Bericht. Juni 1993. ca. 200 S. Fr. 60.00(Anhang: Vegetationskarten. Fr. 500.00)
SRU-199-F Cartographie des zones alluviales d’importance nationale. Rapport.(Annexe: Cartes de la végétation. Fr. 500.00)
SRU-199-I Cartografia delle zone alluvionali d’importanza nazionale. Rapporto. (Appendice: Carte della vegetazione. Fr. 500.00)BUWAL
SRU-168-D Inventar der Moorlandschaften von besonderer Bedeutung und von nationaler Bedeutung. Fr. 0.00Februar 1992. 221 S.
SRU-168-F Inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale. 1992.BUWAL
SRU-167-D Goldruten-Probleme in Naturschutzgebieten. März 1992. 22 S. Fr. 5.00SRU-167-F Verges d’or. Problèmes dans les réserves naturelles.
BUWAL
SRU-126-D Rechtsfragen zum Schutzobjekt Biotope und insbesondere Ufervegetation gemäss NHG und Fr. 5.00angrenzenden Gesetzen. August 1990. 42 S.BUWAL
Ende deutsch def.:Ende deutsch def. 23.1.2007 13:23 Page 249