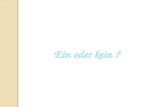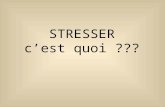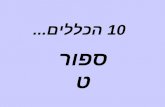Kein einheitlicher Erfüllungsort beim Krankenhausaufnahmevertrag
Click here to load reader
Transcript of Kein einheitlicher Erfüllungsort beim Krankenhausaufnahmevertrag

besprochen haben. Sie haben mangels entsprechenden Hin-weises auch keinen zweifel an seiner Sachkunde gehabt. Schließlich spricht der umstand, dass der erblasser sich erst im Anschluss an die unterzeichnung der urkunde mit der Schmerztherapie einverstanden erklärte, ebenfalls für sein Vertrauen darauf, dass nunmehr alles geregelt sei.
Der Senat geht ferner davon aus, dass die errichtung ei-nes wirksamen testaments bei einer Ablehnung der testa-mentserrichtung oder einem entsprechenden Risikohinweis durch J. noch möglich gewesen wäre. zwar ist der Bekl. zuzugeben, dass am 6. 12. 2008 ein eigenhändiges testa-ment aufgrund des Gesundheitszustandes des Patienten nicht mehr hätte errichtet werden können. In Betracht ge-kommen wäre jedoch die Abfassung eines formwirksamen nottestaments oder eines notariellen testaments. Dafür, dass es hierzu gekommen wäre, spricht der deutlich zum Ausdruck gekommene Wunsch des erblassers, die Kl. als seine langjährige lebensgefährtin finanziell abzusichern, sowie der umstand, dass keine anderweitigen nahen Ange-hörigen zu bedenken waren. Den Willen zur finanziellen Absicherung der Kl. hat der erblasser mehrfach geäußert und letztlich mit dem am 6. 12. 2006 geäußerten Wunsch zur testamentserrichtung sowie mit der unterzeichnung der urkunde dokumentiert. Der umstand, dass der erblas-ser diesen Wunsch zuvor nicht mit hinreichendem nach-druck verfolgt hatte, führt zu keiner anderen Beurteilung der Kausalität. Hintergrund war vielmehr – was unstreitig ist –, dass der Patient bis zu dem letzten eindringlichen Ge-spräch mit den ärzten und der Kl. am 6. 12. 2006 stets von seiner Genesung ausging. Aus diesem Grund hatte er der testamentserrichtung lange zeit nur untergeordnete Be-deutung beigemessen und diese fragen generell verdrängt. So haben sowohl die Kl. als auch J. übereinstimmend ge-schildert, dass der Patient noch im november 2006 von ei-ner künftigen Heirat nach seiner entlassung aus dem Kran-kenhaus gesprochen habe. Der erblasser habe einfach einen anderen „zeitplan“ gehabt und seine Situation nicht zutref-fend realisiert. Angesichts des am 6. 12. 2006 geführten ein-dringlichen Gesprächs mit den ihn behandelnden ärzten hat sich diese einstellung allerdings ersichtlich geändert, da er anderenfalls nicht um die errichtung des testaments gebeten hätte. er hat daher zu diesem zeitpunkt den ernst der lage unzweifelhaft erkannt und seine Angelegenhei-ten regeln wollen. Dabei bestehen keine Anhaltspunkte, dass er sich nicht mehr an einen notar oder Rechtsanwalt gewandt hätte, falls ihm dieses erfordernis von J. deutlich gemacht worden wäre. Vielmehr spricht der umstand, dass er sich erstmals nach unterzeichnung des testaments auf die Schmerztherapie eingelassen hat, dafür, dass er zu-nächst alles erforderliche unternehmen wollte, um seine langjährige lebensgefährtin finanziell abzusichern. Auch eine gegen die Hinzuziehung sprechende besondere Ab-neigung gegen die Berufsgruppe der Rechtsanwälte und notare – wie es die Bekl. behauptet hat – hat sich nach dem ergebnis der Beweisaufnahme nicht bestätigt. Weder J. noch X. haben dies in der form bestätigt. Der Senat ist überdies davon überzeugt, dass die Hinzuziehung eines notars oder Rechtsanwalts auch noch rechtzeitig möglich gewesen wäre und zur errichtung eines wirksamen nota-riellen testaments oder nottestaments geführt hätte. zum einen gibt es in essen zahlreiche, auch größere Kanzlei-en, die bei einem entsprechenden notfall mit einem nur geringen Vorlauf entsprechend tätig werden können. zum anderen hätte man die Schmerztherapie nach den Angaben der zeugin X. auch noch hinauszögern können. Die zeu-gin hat insoweit bekundet, dass der Patient am Vormittag des 6. 12. 2006 noch bei Bewusstsein gewesen sei und seine Angelegenheiten habe regeln können und wollen. er habe zwar Schmerzen gehabt, habe die Schmerztherapie mit Morphium aber ohnehin erst zu einem späten zeitpunkt seiner Krankheit akzeptiert und vorher lediglich Schmerz-
tabletten eingenommen. Die zeugin hat ferner bestätigt, dass der Patient zunächst seine Angelegenheiten im zusam-menhang mit der testamentserrichtung habe regeln wollen und bewusst erst im Anschluss daran mit der therapie ein-verstanden gewesen sei. Vor diesem Hintergrund steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der erblasser trotz seiner schon länger bestehenden Schmerzen mit dem Beginn der Schmerztherapie noch weiter gewartet hätte, wenn ihm die fehlende Sachkunde des J. und das damit verbundene Risi-ko für seine lebensgefährtin bekannt gewesen wäre. es ist davon auszugehen, dass er in diesem fall darauf bestanden hätte, zuvor die erbeinsetzung seiner lebensgefährtin in anderer Weise noch sicherzustellen. Da ein solches Abwar-ten nach dem ergebnis der Beweisaufnahme auch möglich gewesen wäre, wäre er noch zu einer wirksamen erbeinset-zung der Kl. in der lage gewesen. Hiervon ist der erblasser im Vertrauen auf die Wirksamkeit der von J. am 6. 12. 2006 errichteten urkunde abgehalten worden. Kausalität liegt daher vor.
Die Kl. hat danach einen Schadensersatzanspruch. Die-ser besteht zumindest in Höhe des ausgeurteilten Betrages. Die Kl. hat mit Schriftsatz sowohl die nachlasswerte als auch die nachlassverbindlichkeiten dargelegt, ohne dass diese Angaben von der Bekl. konkret bestritten worden sind. Danach kommt sie auf einen nachlass von geschätzt über 512.000,00 €. Auch bei Berücksichtigung eines für diese nachlasshöhe geltenden erbschaftssteuersatzes von 29 % – selbst bei Berücksichtigung des nächst höheren erb-schaftssteuersatzes von 35 % – und einem freibetrag von nur 5.200,00 € ist der hier geltend gemachte teilbetrag in Höhe von 78.931,37 € in jedem fall berechtigt. Soweit die Bekl. einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht geltend macht, kann dem nicht gefolgt werden. Die Kl. ist nämlich – entgegen der Auffassung der Bekl. – mangels erbenstellung nicht befugt, über die Konten zu verfügen.
[…]Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine zulassung der
Revision liegen nicht vor. Die Sache hat weder grundsätz-liche Bedeutung noch ist die zulassung der Revision zur fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitli-chen Rechtsprechung erforderlich.
DOI: 10.1007/s00350-011-3053-6
Kein einheitlicher Erfüllungsort beim Krankenhausaufnahmevertrag
ZPO § 29; BGB § 269
§ 29 ZPO gibt dem Krankenhausträger keinen inter-nationalen Gerichtsstand am Klinikort für den Hono-raranspruch.KG, Urt. v. 5. 5. 2011 – 20 U 251/10 (LG Berlin) (nicht rechtskräftig)
Problemstellung: Der Ort, an dem Klage erhoben werden kann, spielt eine wichtige Rolle für die Rechts-durchsetzung. Gerade bei Sachverhalten mit grenzüber-schreitendem Bezug kann es für den Kläger von im-menser Bedeutung sein, vor welchem Gericht er seine Ansprüche geltend machen kann. Muss er einen auslän-dischen Beklagten an dessen Wohnsitz verklagen, wird er unter umständen eher auf einen Prozess verzichten als im eigenen land, schon auf Grund von Reisekosten und Sprachproblemen – ganz zu schweigen vom frem-
Bearbeitet von Professor Dr. iur. Christof Kerwer und Wiss. Mitarb. nikola Voit, lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und zivilprozessrecht, Julius-Maximilians-universität Würzburg, Juristische fakultät, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg, Deutschland
Rechtsprechung MedR (2011) 29: 815–820 815

den Prozessrecht. Doch auch innerhalb des landes sind Kläger oftmals bestrebt, den Prozess möglichst am eige-nen Wohnort bzw. Sitz zu bestreiten, um sich so einen „Heimvorteil“ zu sichern.
für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis ge-stattet es § 29 zPO, den Rechtsstreit an dem Ort zu füh-ren, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Handelt es sich dabei um einen gegenseitigen Vertrag, ist der erfüllungsort grundsätzlich für jede der im Ge-genseitigkeitsverhältnis stehenden Pflichten getrennt zu ermitteln. Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit allerdings dazu tendiert, bei gegenseitigen Verträgen ei-nen einheitlichen erfüllungsort anzunehmen. Dieser soll sich dort befinden, wo die leistung zu erbringen ist, die dem Vertrag das wesentliche Gepräge gibt. Im ergebnis führt dies dazu, dass der Vertragspartner, der die vertragscharakteristische leistung erbringt, den Ver-gütungsanspruch an seinem Sitz einklagen kann.
In jüngerer zeit lässt sich in der Rechtsprechung jedoch eine gegenläufige tendenz feststellen. Infolge wachsender Kritik an der bisherigen Judikatur betonen die Gerichte wieder stärker, dass der erfüllungsort für jede vertragliche Pflicht gesondert zu bestimmen ist. Beispielhaft dafür steht der Beschluss des BGH vom 11. 11. 2003 (BGH, nJW 2004, 54), in dem der BGH einen einheitlichen erfüllungsort für Anwaltsverträge verneint hat. er hat den Rechtsanwälten damit das Pri-vileg genommen, Gebührenforderungen immer am Ort des Kanzleisitzes einklagen zu können. Später hat der BGH diese Rechtsprechung auf Steuerberatungsverträ-ge erstreckt. Weitere Vertragsarten könnten folgen. Die entwicklung hierzu ist noch nicht abgeschlossen.
In der vorliegenden entscheidung hatte das KG nun darüber zu befinden, ob es bei einem Krankenhausauf-nahmevertrag einen gemeinsamen erfüllungsort gibt und der Krankenhausträger eine Honorarklage daher am Klinikort anhängig machen kann. Im einklang mit der neueren Rechtsprechung hat das KG diese frage ver-neint.
Zum Sachverhalt: Die Kl. verlangt die Bezahlung von statio-nären Behandlungskosten. Der Bekl. ist Serbe und war ausweislich des Krankenhausaufnahmevertrages zu diesem zeitpunkt in Belgrad wohnhaft. nach Rechnungsstellung hat die Kl. den Bekl. vor dem lG Berlin, also am Klinikort, in Anspruch genommen. Das lG hat die Klage abgewiesen, weil kein (internationaler) Gerichtsstand in Berlin begründet sei. Auch über § 269 BGB werde kein Gerichtsstand am Kliniksitz begründet. Die Kl. verfolgt mit der Berufung ihren erstinstanzlichen Antrag weiter.
Aus den Gründen: II. Die Klage ist unzulässig, da die deutschen Gerichte international nicht zuständig sind.
1. Da die zuständigkeitsfragen i[m] Rechtsverkehr mit Serbien weder durch internationales noch binationales Ab-kommen geregelt sind, richtet sich die internationale zu-ständigkeit deutscher Gerichte nach der örtlichen zustän-digkeit (§§ 12 ff. zPO).
2. Da der Bekl. unstreitig keinen Wohnsitz im Bereich der örtlichen zuständigkeit des lG Berlin besitzt oder zum zeitpunkt des Abschlusses des Behandlungsvertrages be-saß, kann sich eine örtliche zuständigkeit nur nach den Regelungen des § 29 zPO i. V. mit §§ 269, 270 Abs. 4 BGB ergeben, wenn erfüllungsort für die leistungspflicht des Bekl. im mit der Kl. geschlossenen Behandlungsvertrag, d. h. für die Geldleistungspflicht, der Sitz der Kl. ist.
3. Gemäß § 29 Abs. 1 zPO ist für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Die Vorschrift verweist auf die Regelung des materiellen Rechts. Da der Krankenhausaufnahmevertrag in Deutschland mit einem deutschen träger geschlossen wurde, der Schwerpunkt des
Vertrages demnach in Deutschland liegt, ist anzuwenden-des Recht deutsches BGB (Art. 28 Abs. 2 eGBGB, der auf den Vertragsschluss 2005 noch Anwendung findet). Danach hat die leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur zeit der entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte, sofern nicht ein anderer Ort von den Parteien bestimmt oder aus den umständen, insbeson-dere der natur des Rechtsverhältnisses zu entnehmen ist (§ 269 Abs. 1 BGB). Bei gegenseitigen Verträgen besteht danach im Allgemeinen kein einheitlicher leistungsort; dieser muss grundsätzlich für jede Verpflichtung geson-dert bestimmt werden (BGH, urt. v. 9. 3. 1995 – IX zR 134/94 –, WM 1995, 833, 834; BGH, urt. v. 4. 3. 2003 – IX zR 101/03 –, nJW-RR 2004, 932).
[4] Im zweifel ist schon aus dem Grundsatz des Verbrau-cherschutzes, der sowohl das deutsche als auch das europä-ische zivilrecht prägt, leistungsort der jeweilige Wohn-sitz des Schuldners. Da die Kl. eine davon abweichende Vereinbarung nicht behauptet hat – insbesondere ist die Vereinbarung des Gerichtsstandes der Kl. im Aufnahme-vertrag v. 19. 4. 2005 in dieser form wegen Verstoßes ge-gen § 307 BGB unwirksam (vgl. Palandt-Grüneberg, § 307, Rdnr. 107 m. w. n.) und beinhaltet als Gerichtsstandsver-einbarung keine (nach § 29 Abs. 2 zPO hier unzulässige) vertragliche Vereinbarung des erfüllungsorts –, käme ein anderer Ort nur in Betracht, wenn er sich aus der natur des Schuldverhältnisses herleiten ließe.
a) Die streitige leistungspflicht ist nicht von einer Be-schaffenheit, die es als sachgerecht und deshalb im mut-maßlichen Willen der Parteien liegend erscheinen lassen könnte, sie nicht an dem in § 269 Abs. 1 BGB genann-ten Wohnsitz des Bekl. zu erfüllen. Der Bekl. schuldet im falle der sachlichen Berechtigung der geltend gemachten forderung lediglich Geld. Insoweit besteht anders als etwa bei einer Verpflichtung, die auf Übergabe eines Grund-stücks, auf Auflassung desselben oder auf Herstellung eines Werks an einer bestimmten Stelle gerichtet ist, keine be-stimmte örtliche Präferenz. Das steht in einklang mit § 270 BGB, nach dessen Abs. 4 bei Geldschulden die Vorschrift über den leistungsort unberührt bleibt (BGH, [Beschl.] v. 11. 11. 2003 – X ARz 91/03 –, BGHz 157, 20 ff.).
b) Auch das Schuldverhältnis der Parteien weist keine Besonderheiten auf, die allein einen bestimmten anderen leistungsort als den jeweiligen Wohnsitz eines Beklagten umständegerecht sein lassen.
aa) In frage steht nach dem behaupteten Inhalt des Kran-kenhausaufnahmevertrags – wie auch durch die Abrech-nungen deutlich wird – ein Schuldverhältnis, das einerseits auf ärztliche und pflegerische Behandlung durch die An-gestellten der Kl., des Krankenhausträgers, andererseits auf zahlung von fallpauschalen nach dem KHeG gerichtet ist. Da weitere einzelheiten, etwa über das zustandekommen des Vertrags der Parteien, nicht vorgetragen oder sonstwie ersichtlich sind, kommt insoweit nur die typisierende Be-wertung eines solchen Schuldverhältnisses in Betracht. Sie ergibt zwar, dass dieses sein Gepräge durch die leistungs-pflicht der Kl. erhielt, weil es sich hierdurch um einen von anderen Vertragstypen verschiedenen Vertrag handelt. es ist auch der Krankenhausbehandlung immanent, dass der Schwerpunkt dieses Vertragsverhältnisses dort lag, wo die Angestellten der Kl. ihre nachgefragte tätigkeit ent-falteten. Allein das verleiht dem Schuldverhältnis jedoch keine natur, die es rechtfertigte oder gar erforderte, dass der Bekl. als Patient seine Verpflichtung nicht wirksam an [seinem] jeweiligen in § 269 Abs. 1 BGB genannten Wohnsitz erfüllen können [soll] (vgl. BGH, [Beschl.] v. 11. 11. 2003 – X ARz 91/03 –, BGHz 157, 20 ff.; Kerwer, jurisPK-BGB [2010], § 269, Rdnr. 18). So hat der BGH in seiner Rechtsprechung zu Handelsvertreterverhältnissen zwar bei der frage, welches materielle Recht nach dem hy-pothetischen Parteiwillen anzuwenden ist, auf den Schwer-
Rechtsprechung816 MedR (2011) 29: 815–820

punkt des Schuldverhältnisses abgestellt (vgl. BGHz 53, 332, 337). Diese Rechtsprechung ist jedoch nicht auf die Bestimmung des erfüllungsorts übertragen worden (BGH, urt. v. 22. 10. 1987 – I zR 224/855 –, nJW 1988, 966, 967). Sie führte auch praktisch bei jedem Vertragstyp zu einem einheitlichen leistungsort für beide Vertragspartei-en, was mit der Regelung des § 269 Abs. 1 BGB unverein-bar ist (BGH, [Beschl.] v. 11. 11. 2003 – X ARz 91/03 –, BGHz 157, 20 ff.; vgl. BGH, Beschl. v. 5. 12. 1985 – I AzR 737/85 –, nJW 1986, 935).
bb) ein solcher erfüllungsort kann deshalb nur ange-nommen werden, wenn weitere umstände festgestellt werden können, wie sie beispielsweise beim klassischen la-dengeschäft des täglichen lebens bestehen (vgl. BGH, urt. v. 2. 10. 2002 – VIII zR 163/01 –, MDR 2003, 402), bei dem üblicherweise die beiderseitigen leistungspflichten so-gleich an Ort und Stelle erledigt werden, oder regelmäßig bei einem Bauwerksvertrag vorliegen, weil auch der Be-steller am Ort des Bauwerks mit dessen Abnahme eine sei-ner Hauptpflichten erfüllen muss und es interessengerecht ist, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung dort durch-geführt werden kann, wo aufgrund der räumlichen nähe zum Bauwerk eine Beweisaufnahme (z. B. über das Auf-maß oder über behauptete Mängel) regelmäßig wesentlich einfacher und kostengünstiger geschehen kann als an dem auswärtigen Wohnsitz des Auftraggebers (BGH, Beschl. v. 5. 12. 1985 – I AzR 737/85 –, nJW 1986, 935).
cc) Solche zusätzlichen umstände sind jedoch im fal-le eines Krankenhausaufnahmevertrags regelmäßig nicht feststellbar (ebenso OlG zweibrücken, urt. v. 27. 2. 2007 – 5 u 58/06 –, juris).
(a) Dem klassischen ladengeschäft des täglichen lebens ist der Krankenhausaufnahmevertrag nicht vergleichbar, weil regelmäßig der Abschluss des Vertrags nicht zur gleichzei-tigen erfüllung der gegenseitigen leistungen führt. Gerade bei geplanten eingriffen erledigen die Krankenhausange-stellten ihre Pflichten nicht sofort, sondern zum geplanten (späteren) zeitpunkt; auch der Patient erledigt das hierzu erforderliche regelmäßig erst später, da die entstehung des zahlungsanspruchs bei Krankenhausbehandlung [von] nicht gesetzlich versicherte[n] Patienten die Rechnungs-legung zwingend voraussetzt – ohne Rechnungslegung kann der Patient schon mangels entsprechender einsicht in das medizinische Behandlungsgeschehen nicht wissen, was er bezahlen muss. Daher ist es völlig unüblich, dass ein Patient (anders als beim ladengeschäft) die erbrachten ärztlichen und pflegerischen leistungen sofort bezahlt. Angesichts dessen kann auch die tatsache, dass geplante eingriffe bei Selbstzahlern bzw. Privatversicherten oft von einer Vorschusszahlung (§ 8 Abs. 7 KHeG) abhängig ge-macht werden, einem Krankenhausaufnahmevertrag nicht das Gepräge eines in bar abzuwickelnden Vertrags verlei-hen. Im Rahmen der Vertragsfreiheit kann letztlich jede Vertragsdurchführung von der zahlung eines Vorschusses abhängig gemacht werden, so dass eine etwaige Vorschuss-pflicht nicht gerade den Krankenhausaufnahmevertrag sei-ner natur nach kennzeichnet (vergleichbar zum Anwalts-vertrag BGH, [Beschl.] v. 11. 11. 2003 – X ARz 91/03 –, BGHz 157, 20 ff.).
(b) Auch eine Parallele zum Bauwerksvertrag, die wie bei diesem einen vom Wohnsitz des Auftraggebers abwei-chenden erfüllungsort interessengerecht sein lassen könn-te, besteht nicht (Prechtel, MDR 2003, 667, 668). Der Krankenhausaufnahmevertrag beinhaltet im Wesentlichen ärztliche leistungen, die per se keinen Werkvertragscha-rakter haben, sondern Dienstleistungen sind. es fehlt inso-fern entgegen der bisher wohl überwiegenden Meinung der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte der (insbesondere bei Mängeln zutage tretende) Bezug zum Ort der leistung des Auftragnehmers. Dass die pflegerischen und ärztli-chen leistungen de[s] Krankenhauses nur am Kranken-
hausort vorgenommen werden können (OlG Celle, urt. v. 27. 11. 2006 – I u 74/06 –, MDR 2007, 604; BayOblG, Beschl. v. 23. 12. 2004 – 1 z AR 184/04 –, MDR 2005, 677; vgl. zum zahnarzt OlG Düsseldorf, urt. v. 3. 6. 2004 – 8 u 110/03 –, MedR 2005, 723; und Beschl. v. 14. 7. 2004 – 18 u 110/03 –, juris), ist insoweit kein solcher „zusätzlicher umstand“ (vgl. oben, sub 3. b) aa) die zitierte BGH-Rspr.; a. A. Bittner, in: Staudinger, BGB, § 269, Rdnr. 50 (Bearb. 2009); Krüger, in: MüKo/BGB, Bd. 2, 5. Aufl. 2007, § 269, Rdnr. 30, beide unter Berufung auf OlG Celle, Beschl. v. 14. 8. 1989 – 1 W 23/89 –, nJW 1990, 771; Jauernig, BGB, 13. Aufl. 2009, § 269, Rdnr. 8, unter Berufung auf das BayOblG und OlG Celle). Auch der angestellte An-lageberater der Bank erbringt seine Beratungsleistung am Sitz der Bank, die Bank erbringt ihre Dienstleistungen an ihrem Sitz, ohne dass dadurch ersichtlich gefordert würde, der Kunde habe sein entgelt hierfür am Sitz der Bank zu entrichten. Jeder Dienstleister, der zur erbringung seiner Dienstleistungen auf ein bestimmtes örtlich gebundenes Instrumentarium angewiesen ist (Hochleistungsrechner für Programmierer, Versuchsanordnungen für Physiker etc.), erbringt seine leistung an dem Ort, an dem sich sein „Handwerkszeug“ befindet, ohne dass dies ersichtlich Auswirkungen auf den Honoraranspruch hat (vgl. Kerwer, jurisPK-BGB, § 269, Rdnr. 18).
(c) Die kostengünstige und sachgerechte Beurteilung der leistungen der ärzte des Krankenhausträgers bei einwen-dungen gegen den Honoraranspruch aus Aufklärungs- und Behandlungsfehlern ist regelmäßig nicht davon abhängig, dass sie durch das für den Klinikort zuständige Gericht er-folgt. Auch die Überlegung der Gefahr des Verlustes von Patientenunterlagen bei Versendung an „weit entfernte Orte“ (OlG Celle, urt. v. 27. 11. 2006 – I u 74/06 –, MDR 2007, 604) ist nicht geeignet, eine besondere Ortsgebun-denheit des Krankenhausaufnahmevertrages zu begründen. Denn zum einen obliegt es der Parteiherrschaft des beklag-ten Patienten, ob er durch einwendung von Aufklärungs- und Behandlungsfehlern – die sich auf die Berechtigung des Honorarzahlungsanspruchs sowieso nur in seltenen fällen direkt auswirken! – diese „Gefahr“ auf sich nehmen möchte. zum anderen ist gerade angesichts der von der Kl., einer namhaften universitätsklinik, in Haftungsprozessen stets vehement vertretenen notwendigkeit der „Ortsferne“ des auszuwählenden Gutachters diese Versendungsgefahr jedem Arzthaftungsprozess immanent, so dass es widersin-nig erscheint, dieses Argument dazu heranzuziehen, eine leistungspflicht des Patienten am Klinikort zu begründen. ebenso geht das Argument fehl, ggf. müssten bei Arzthaf-tungseinwand ärzte zur Aufklärung oder zum Behand-lungsablauf befragt werden, was am Klinikort weniger aufwändig sei; denn angesichts der zunehmenden Mobi-lität der ärzteschaft im Klinikdienst spricht gerade keine Vermutung dafür, diese würden sich Jahre später noch am Klinikstandort im Dienst befinden.
(d) Auch nicht überzeugend ist das Argument (OlG Karlsruhe, urt. v. 9. 12. 2009 – 13 u 126/09 –, MedR 2010, 508 [zit. nach juris]), wegen des Kontraktionszwangs könne sich der Krankenhausträger seine Vertragspartner nicht aussuchen und es sei ihm unzumutbar, seine forde-rungen vor verschiedenen Gerichten einklagen zu müssen. Angesichts der tatsache, dass in der Bundesrepublik 90 % der Patienten gesetzlich versichert sind, ist die Gefahr der Prozessstreuung im nationalen Bereich insoweit nicht so erheblich und für ein Krankenhaus mit (ggf. internationa-lem) Renommee und einzugsbereich im Hinblick auf die mit dieser Anziehungskraft auch verbundenen einnahme-möglichkeiten (da die von weither anreisenden Patienten im zweifel Privatzahler sein werden) hinzunehmen. Insbe-sondere für selbstzahlende Patienten mit Gerichtsstand im Inland ist kein Grund ersichtlich, warum diese nicht vor ihren Wohnsitzgerichten verklagt werden sollten.
Rechtsprechung MedR (2011) 29: 815–820 817

(e) Dem kann nicht mit erfolg entgegengehalten werden, dass bei einem ausländischen Patienten und Geltung deut-schen Rechts der erfüllungsort im Ausland liegt und der Klinikträger Rechtsschutz im Ausland suchen muss. Denn das ist kein im Rahmen des § 269 Abs. 1 BGB maßgebli-cher Gesichtspunkt, weil der ausländische leistungsort auf den (hinzunehmenden) Gegebenheiten des Vertragspart-ners beruht und deshalb die natur des Schuldverhältnisses unberührt lässt (BGH, [Beschl.] v. 11. 11. 2003 – X ARz 91/03 –, BGHz 157, 20 ff.). Dass die mit einer Klage im Ausland einhergehenden nachteile durch Vereinbarung eines inländischen erfüllungsorts nicht vermeidbar sind, hat hingegen seinen Grund in der in § 29 Abs. 2 zPO ge-troffenen gesetzgeberischen entscheidung, die Wirkung einer Vereinbarung über den erfüllungsort zu beschrän-ken, wenn sie nicht von Angehörigen bestimmter Perso-nengruppen getroffen wird.
(f ) zudem sind die von Klägerseite geltend gemachten wirtschaftlichen nachteile bei einem zwang zur Suche von Rechtsschutz im Ausland bei „Behandlungstourismus“ weitgehend abstellbar, da sich die Kl. entgegen ihrer An-sicht vor einer Verweisung auf ausländische Gerichte selbst-tätig schützen kann. Denn gerade für die von ihr wiederholt angeführten „heranreisenden“ Patienten ohne inländischen Gerichtsstand ermöglicht § 38 Abs. 2 zPO eine inländische Gerichtsstandsvereinbarung an ihrem Sitz.
(aa) So lassen Art. 17 euGVÜ, Art. 17 lugÜ und Art. 23 euGVVO im jeweiligen Anwendungsbereich internatio-nale Gerichtsstandsvereinbarungen auch unter nichtkauf-leuten zu.
(bb) Ob und in welchem umfang der durch § 38 Abs. 2 zPO bereitgestellte Schutz inländischer Verbraucher im in-ternationalen Rechtsverkehr beibehalten bleiben soll, rich-tet sich allein nach dem in anwendbaren völkerrechtlichen Verträgen zur zuständigkeit im zivilprozess zum Ausdruck gekommenen Willen der beteiligten Staaten. Diesen steht es frei, die zulässigkeit internationaler Gerichtsstandsver-einbarungen gegenüber dem jeweiligen Staat anders als in den oben genannten Übereinkommen zu regeln (BGH, Beschl. v. 14. 4. 2005 – IX zB 175/03 –, nJW-RR 2005, 929).
(cc) Wenn die zulässigkeit von Gerichtsstandsvereinba-rungen im bi-nationalen Verhältnis weder durch Staatsver-trag noch durch andere supranationale Regelungen (wie für die eu-Staatsbürger in Art. 23 euGVVO) abschließend normiert wird, gilt grundsätzlich die lex fori, im erkennt-nisverfahren also das im Staat des angerufenen Gerichts an-zuwendende Recht. Dabei ist § 38 zPO doppelfunktional, betrifft also sowohl die inländische örtliche als auch die internationale zuständigkeit (BGHz 59, 23, 29; BGH, urt. v. 26. 1. 1976 – V zR 75/76 –, WM 1979, 445, 446; BGH, Beschl. v. 14. 4. 2005, a. a. O.).
(dd) unter nichtkaufleuten kann eine Gerichtsstands-vereinbarung nur dann wirksam werden, wenn mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichts-stand im Inland hat. Dies wäre hier im vorliegenden Streit-fall sowohl im zeitpunkt der Vereinbarung als auch bei Klageerhebung der fall, wie sich aus dem Krankenhaus-aufnahmevertrag und der Klageschrift ergibt. Daher kann dahingestellt bleiben, ob auf den zeitpunkt der Vereinba-rung (Bork, in: Stein/Jonas, zPO, § 38, Rdnr. 24) oder denjenigen der Klageerhebung (Baumbach/lauterbach/Albers/Hartmann, zPO, § 38, Rdnr. 21; Vollkommer, in: zöller, zPO, § 38, Rdnr. 5) abzustellen ist (BGH, Beschl. v. 14. 4. 2005, a. a. O.).
(ee) Die Kl. könnte die weiteren Voraussetzungen einer wirksamen Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Abs. 2 zPO (Vereinbarung schriftlich, § 38 Abs. 2 S. 2 zPO; Ver-einbarung des allgemeinen Gerichtsstands der inländischen Partei – i. e. der Kl. –, § 38 Abs. 2 S. 3 zPO) sogar durch entsprechende AGB regeln. zwar verstoßen Gerichtsstands-
vereinbarungen mit inländischen nichtkaufleuten in AGB grds. gegen § 307 BGB (vgl. Palandt-Grüneberg, § 307, Rdnr. 107 m. w. n.); eine Gerichtsstandsvereinbarung mit einem Verbraucher ohne inländischen Gerichtsstand wird von § 38 Abs. 2 zPO jedoch ausdrücklich gestattet, so dass keine Abweichung vo[m] gesetzlichen leitbild vorliegt.
(g) Angesichts dessen ist es auch bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht erforderlich, allein wegen der wirtschaftlich eher unbedeutenden kleinen Gruppe von selbstzahlenden Patienten ohne inländischen Wohnsitz, die bewusstlos, also nicht kontraktionsfähig, beim Klinikträger eingeliefert werden, für alle Patienten einen erfüllungs-ort für die zahlungspflicht am Klinikort zu konstituieren, zudem gerade bei diesen Patienten das Argument des „Be-handlungstourismus“, vor dem der Klinikträger zu schüt-zen sei, nicht greift, da sie ersichtlich nicht extra für eine Krankenhausbehandlung eingereist sind.
[…]
Anmerkung
Christof Kerwer und Nikola Voit
Das KG verneint für Krankenhausaufnahmeverträge einen einheitlichen erfüllungsort am Sitz der Klinik und zwingt den Krankenhausträger damit, seinen Honoraranspruch am Wohnsitz des Patienten einzuklagen. Die entscheidung fügt sich ein in die allgemeine tendenz der neueren Recht-sprechung, den erfüllungsort für die vertraglichen Pflich-ten aus gegenseitigen Verträgen getrennt voneinander zu ermitteln. nachdem die Gerichte früher dazu tendierten, den Ort, an dem die vertragscharakteristische leistung zu erbringen ist, als gemeinsamen erfüllungsort für die bei-derseitigen Verpflichtungen anzusehen, ist momentan eine gegenläufige entwicklung erkennbar. Sie zeigt sich unter anderem daran, dass der BGH für Anwaltsverträge 1 und Steuerberatungsverträge 2 einen einheitlichen leistungsort verneint hat. Dies hat zur folge, dass Honoraransprüche von Rechtsanwälten und Steuerberatern nicht mehr ohne weiteres am Ort der Kanzlei geltend gemacht werden können.
Ob dies auch für Krankenhausaufnahmeverträge gilt, ist bisher nicht höchstrichterlich entschieden. In der instanz-gerichtlichen Judikatur und im Schrifttum lässt sich aber auch insoweit ein Anschauungswandel feststellen. Wäh-rend man lange den Klinikort als gemeinsamen leistungs-ort für die beiderseitigen Pflichten ansah, gewinnt derzeit die Auffassung an Boden, dass das vom Patienten geschul-dete Honorar für die ärztlichen leistungen nicht am Sitz des Krankenhauses, sondern am Wohnsitz des Patienten zu entrichten ist 3. Dass sich das Meinungsbild insoweit im umbruch befindet, wird gerade an der Rechtsprechung des KG deutlich. noch im november 2009 hatte der erken-nende Senat nämlich einen gemeinsamen erfüllungsort am Sitz der Klinik angenommen 4. Diese Auffassung hat er nun (stillschweigend) aufgegeben.
Professor Dr. iur. Christof Kerwer und Wiss. Mitarb. nikola Voit, lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und zivilprozessrecht, Julius-Maximilians-universität Würzburg, Juristische fakultät, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg, Deutschland
Rechtsprechung818 MedR (2011) 29: 815–820
1) Grundlegend BGHz 157, 20 = nJW 2004, 54; bestätigend BGH, nJW-RR 2004, 932.
2) BGH, DStR 2007, 1099.3) Vgl. etwa lG Osnabrück, nJW-RR 2003, 789; lG Mainz, nJW
2003, 1612; lG Magdeburg, nJW-RR 2008, 1591; lG Hagen, MDR 2009, 675; Balthasar, JuS 2004, 571; Prechtel, MDR 2006, 246; Lensing, MedR 2009, 676.
4) KG, urt. v. 30. 11. 2009 – 20 u 113/09 –, juris.

Im konkreten fall hing von der frage des erfüllungsorts die internationale zuständigkeit der deutschen Gerichte ab. Da der Beklagte beim Abschluss des Krankenhausaufnah-mevertrages in Belgrad wohnte und der Beklagtenwohnsitz demnach nicht in einem Mitgliedstaat der eu lag, war die euGVVO nicht anwendbar (vgl. Art. 4 Abs. 1 euGVVO). Daher richtete sich die internationale zuständigkeit nach den Vorschriften der zPO über die örtliche zuständigkeit, die insoweit doppelfunktional ausgelegt werden. Diese ge-hen im Grundsatz davon aus, dass der Schuldner an seinem Wohnsitz zu verklagen ist (§§ 12, 13 zPO). Das entspricht der am Gerechtigkeitsgedanken orientierten prozessualen lastenverteilung: Da es in der Hand des Klägers liegt, ob und wann er den Schuldner in Anspruch nimmt, muss er diesem zum Prozess an dessen Wohnsitz folgen. etwas an-deres gilt nur dann, wenn das Prozessrecht ihm einen beson-deren Gerichtsstand wie etwa den Gerichtsstand des erfül-lungsortes (§ 29 zPO) zur Verfügung stellt. Dieser erlaubt es für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis, an dem Ort Klage zu erheben, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Wie der erfüllungsort zu ermitteln ist, richtet sich nach materiellem Recht, hier nach deutschem Recht. Dies ergab sich wegen der zeitlichen lage des falles noch aus Art. 28 eGBGB, der darauf abstellte, zu welchem Recht der Vertrag die engste Verbindung aufweist. Heute würde Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom-I-VO für Verträge zwischen einer deutschen Klinik und einem ausländischen Patienten zum selben ergebnis führen, da es insoweit darauf ankommt, wo der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
entscheidend für die frage, ob das angerufene lG Berlin international zuständig ist, war daher § 269 BGB. Danach hat die leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur zeit der entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte, sofern nicht ein anderer Ort be-stimmt ist oder sich aus den umständen, insbesondere aus der natur des Schuldverhältnisses, entnehmen lässt. Im zweifel führt § 269 BGB somit ebenfalls zum Wohnsitz des Schuldners, so dass sich der besondere Gerichtsstand des erfüllungsorts häufig mit dem allgemeinen Gerichtsstand deckt. Die Gretchenfrage ist allerdings, ob sich aus den umständen etwas anderes entnehmen lässt. Da es bei der eingeklagten Honorarforderung um einen Geldanspruch geht, ist ihre erfüllung an jedem Ort denkbar, so dass die Beschaffenheit der leistung keinen Aufschluss über den leistungsort gibt. Das KG musste sich daher die frage stel-len, ob die „natur“ des Krankenhausaufnahmevertrages eine erfüllung der Honorarforderung am Sitz der Klinik gebietet. Diese frage hat das Gericht zu Recht verneint.
An den entscheidungsgründen fällt auf, dass das KG sich in der gesamten Argumentation sehr eng am Beschluss des BGH zum erfüllungsort bei Anwaltsverträgen hält 5. Das Gericht übernimmt ganze Passagen wörtlich aus dieser entscheidung und überträgt sie auf den Krankenhausaufnahmevertrag. Offensichtlich hält der Senat die Interessenlage bei beiden Verträgen für weitestgehend vergleichbar. In seiner früheren entscheidung aus dem Jahr 2009 6 hatte er dagegen noch auf den strikten Ortsbezug des Behandlungsvertrages abgestellt. Dieser ist beim Krankenhausaufnahmevertrag in der tat stär-ker als beim Anwaltsvertrag, da die Heilbehandlung des Pati-enten und dessen Aufnahme und unterbringung schon we-gen der erforderlichen medizinischen Ausstattung nur in der Klinik selbst erbracht werden können. Der Anwaltsvertrag hat seinen Schwerpunkt dagegen nicht notwendig am Kanz-leisitz; vielmehr kann ein erheblicher teil der geschuldeten tätigkeit bei Gerichten und Behörden sowie bei auswärti-gen Vertragsverhandlungen zu erbringen sein. Auf diesen unterschied kommt es jedoch nicht entscheidend an. Denn der Ortsbezug betrifft nur die leistungspflicht des Kranken-hausträgers und sagt für sich genommen nichts darüber aus, wo der Patient seine zahlungspflicht zu erfüllen hat. Inso-weit hat der BGH klargestellt, dass es für einen gemeinsamen
erfüllungsort nicht ausreicht, wenn der Vertrag am Ort der vertragscharakteristischen leistung seinen Schwerpunkt hat. Vielmehr müssen weitere umstände hinzutreten, die einen gemeinsamen erfüllungsort rechtfertigen.
Wie das KG in der vorliegenden entscheidung ausführ-lich darlegt, sind solche weiteren umstände beim Kranken-hausaufnahmevertrag nicht ersichtlich. Sie liegen etwa beim ladengeschäft des täglichen lebens vor, wo die beidersei-tigen leistungspflichten üblicherweise sogleich an Ort und Stelle erledigt werden. Dasselbe gilt für Beherbergungsver-träge und für Kfz-Reparaturverträge, bei denen der Kun-de ebenfalls gewöhnlich im Hotel oder in der Werkstatt bezahlt. Seinen Grund hat dies vornehmlich darin, dass ein Pfandrecht erlischt, wenn der Gast abreist oder der Besteller sein Kfz abholt. Bei Krankenhausbehandlungen ist es dage-gen nicht nur unüblich, sondern in der Regel auch gar nicht möglich, dass der Patient die erbrachten leistungen sofort bezahlt, da er vor Rechnungslegung gar nicht wissen kann, was er bezahlen muss. Auch zusätzliche umstände, wie sie beim Bauvertrag einen einheitlichen erfüllungsort begrün-den, sind beim Krankenhausaufnahmevertrag nicht gege-ben. Insbesondere gibt es hier keine Hauptleistungspflicht, die der Patient am Klinikort zu erfüllen hätte, wie das beim Bauvertrag für die Abnahmepflicht gilt. zwar erhält der Pa-tient in der Klinik die ärztlichen leistungen und wirkt bei der Behandlung mit, doch stellt dies keine Abnahme dar 7, da es schon am werkvertraglichen Charakter fehlt.
Auch besteht beim Krankenhausaufnahmevertrag kein besonderes Interesse daran, eine gerichtliche Auseinander-setzung gerade am Klinikort zu führen 8. Während dies beim Bauvertrag interessengerecht erscheint, da aufgrund der räumlichen nähe zum Bauwerk eine Beweisaufnahme (z. B. über behauptete Mängel) regelmäßig einfacher und kosten-günstiger erfolgen kann als am auswärtigen Wohnsitz des Auftraggebers, greift dieses Argument beim Krankenhaus-aufnahmevertrag nicht. Denn hier ist eine Honorarklage nicht typischerweise damit verbunden, dass der Patient Auf-klärungs- oder Behandlungsfehler einwendet. und selbst wenn dies der fall sein sollte, verringern sich die Kosten durch eine Klage am Klinikort nicht erheblich. Denn Ob-jekt der Beweisaufnahme wird in den wenigsten fällen das Krankenhaus sein, sondern in der Regel der Patient, und dieser kann an jedem beliebigen Ort untersucht werden 9. zudem ist in Haftungsfällen häufig ein ortsfremder Gutach-ter gewünscht, so dass ohnehin Reisekosten entstehen. Auch das Argument, die Gefahr des Verlusts von Patientenakten erhöhe sich durch Versendung an ein auswärtiges Gericht, verfängt nicht. Denn dies kann auch bei einer Versendung innerhalb derselben Stadt oder an einen auswärtigen Gutach-ter geschehen und gehört zum allgemeinen lebensrisiko.
Insgesamt ist der entscheidung des KG deshalb darin zu-zustimmen, dass es für den Honoraranspruch des Kranken-hausträgers keinen erfüllungsort und damit auch keinen besonderen Gerichtsstand am Sitz der Klinik gibt. eine Ho-norarklage muss folglich am Wohnsitz des Patienten anhän-gig gemacht werden. Soweit es um deutsche Patienten geht, lässt sich dies auch nicht privatautonom ändern, da weder Vereinbarungen über den Gerichtsstand (vgl. § 38 Abs. 1, 3 zPO) noch über den erfüllungsort (vgl. § 29 Abs. 2 zPO) wirksam getroffen werden können. Anders sieht es aus, wenn – wie im fall des KG – der Vertrag mit einem aus-ländischen Patienten geschlossen wird. Hier kann der Kli-nikträger eine Gerichtsstandsvereinbarung treffen und sich auf diese Weise davor schützen, Rechtsschutz im Ausland
Rechtsprechung MedR (2011) 29: 815–820 819
5) BGHz 157, 20 = nJW 2004, 54.6) KG, urt. v. 30. 11. 2009 – 20 u 113/09 –, juris.7) So aber OlG Düsseldorf, MedR 2005, 723. 8) A. M. Hauser, MedR 2006, 332, 336. 9) Sonnentag, MedR 2005, 702, 705.

suchen zu müssen. Das KG begründet dies mit § 38 Abs. 2 zPO. Indessen wird diese Vorschrift hier durch Art. 23 eu-GVVO verdrängt 10, der bereits dann anwendbar ist, wenn eine der Parteien ihren (Wohn-)Sitz in einem Mitgliedstaat hat 11. Bei Kliniken mit Sitz in Deutschland findet Art. 23 euGVVO folglich immer Anwendung und erlaubt den Abschluss von Gerichtsstandsvereinbarungen mit ausländi-schen Patienten. Auf § 38 Abs. 2 zPO kann und muss inso-weit nicht zurückgegriffen werden. Der Abschluss solcher Gerichtsstandsvereinbarungen ist den deutschen Kranken-häusern zu empfehlen, um eine Rechtsverfolgung im Aus-land zu vermeiden. Die Vereinbarung kann auch in AGB erfolgen. Anders als inländische Gerichtsstandsklauseln im nichtkaufmännischen Verkehr verstoßen sie nicht gegen § 307 BGB, da sie von § 23 euGVVO ausdrücklich gestattet sind und daher nicht vom gesetzlichen leitbild abweichen.
Im praktischen ergebnis führt die entscheidung zu ei-ner Verschiebung der prozessualen lasten: Sollte sie in der Revisionsinstanz bestätigt werden 12, büßen die Kliniken das Privileg ein, Honorarforderungen stets an ihrem Sitz einklagen zu können. zugleich wird die Stellung der Pa-tienten verbessert. Dies ist zu begrüßen, da die Annahme eines einheitlichen erfüllungsortes am Klinikort einer in-neren Rechtfertigung entbehrt. Allzu gravierende ände-rungen ergeben sich daraus für die Krankenhäuser ohne-hin nicht, da sie sich vor Rechtsstreitigkeiten im Ausland durch Gerichtsstandsvereinbarungen (auch in AGB) schüt-zen können. Gegenüber inländischen Patienten müssen sie sich allerdings darauf einstellen, dass sie Honorarklagen künftig an deren Wohnsitz führen müssen. zu begrüßen ist schließlich auch, dass der BGH die Gelegenheit erhält, die internationale zuständigkeit und mit ihr die frage nach dem erfüllungsort beim Krankenhausaufnahmever-trag höchstrichterlich zu klären. Durch eine Bestätigung der entscheidung des KG könnte er seine Judikatur zum erfüllungsort bei Anwalts- und Steuerberatungsverträgen konsequent fortführen.
Keine Verwertung des Gutachtens einer ärztlichen Schlichtungsstelle als Zeugen- oder Sachverständigenbeweis
BGB §§ 249, 253, 611, 823, 831; ZPO §§ 138, 286, 301, 406, 538
Das von einer ärztlichen Schlichtungsstelle erstell-te Gutachten kann im späteren Haftpflichtprozess nur als Urkundenbeweis berücksichtigt werden. Die Fest-stellungen und Schlussfolgerungen des Gutachters sind wie die Ausführungen eines Privatgutachters zu prü-fen und zu würdigen. Zur Urteilsgrundlage dürfen sie nicht gemacht werden, wenn sie auf ungesicherter oder gar der OP-Dokumentation widersprechender Tatsa-chengrundlage beruhen.OLG Koblenz, Urt. v. 24. 7. 2009 – 5 U 510/09 (LG Trier)
eingesandt von RiOlG ernst Weller, Koblenz, Deutschland;bearbeitet von Rechtsanwältin Claudia Achterfeld, Wiss. Mitarb., universität zu Köln, Institut für Medizinrecht, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Deutschland
Problemstellung: Im Arzthaftungsprozess verfügt der tatrichter in der Regel nicht über die erforderlichen medizinischen fachkenntnisse und erfahrungen zur Aufklärung des medizinischen Sachverhaltes, so dass das Gericht einen Sachverständigen einzuschalten hat. Die entscheidung des OlG Koblenz beschäftigt sich mit den fragen, inwieweit das Gutachten einer ärztlichen Schlichtungsstelle im Prozess berücksichtigt werden kann und ob dessen erstatter im anschließenden Ge-richtsverfahren als Sachverständiger in derselben Sache herangezogen werden darf.
Zum Sachverhalt: Die Kl. begehrt von dem Bekl. materiellen und immateriellen Schadensersatz wegen einer behaupteten feh-lerhaften ärztlichen Behandlung. Das lG hat der Klage mit einem teil- und teilgrundurteil teilweise stattgegeben, teilweise hat es sie abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Berufung des Bekl., mit der er seinen Vortrag wiederholt und vertieft. er macht insbesondere geltend, dass das lG dem gerichtlichen Gutachter ohne hinreichende Begründung nicht folge und stattdessen sein urteil auf die Aussage eines Privatgut-achters stütze. Dabei habe sich das Gericht auch nicht dargelegte eige-ne Sachkunde angemaßt. Dies sei formell und materiell fehlerhaft. es habe zwingend ein „Obergutachten“ eingeholt werden müssen.
Der Senat hat die Parteien darauf hingewiesen, dass er von einem unzulässigen teilurteil ausgehe, das darüber hinaus an einem erheb-lichen Verfahrensfehler leide, weshalb eine zurückverweisung nach § 538 Abs. 2 nrn. 1 und 7 zPO beabsichtigt sei.
Aus den Gründen: II. Das angefochtene urteil des lG trier mit dem zugrunde liegenden Verfahren war aufzu-heben und – zum teil auf Antrag des Bekl. – nach § 538 Abs. 2 nrn. 1 und 7 zPO an das lG zurückzuverweisen. Ausreichend ist insoweit auch ein Hilfsantrag (OlG Kob-lenz, MDR 2007, 1411= OlGR 2007, 722; OlG frankfurt a. M., OlGR 2003, 388; Heßler, in: zöller, zPO, 27. Aufl. 2009, § 538, Rdnr. 56).
es handelt sich bei der angefochtenen entscheidung um ein unzulässiges teilurteil, da über die Haftung dem Grun-de nach nicht einheitlich, sondern nur über den immateri-ellen Schadensersatz entschieden wurde. Die Klage wurde hinsichtlich des materiellen Schadensersatzes nicht voll-umfänglich abgewiesen, da die entscheidung über die au-ßergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten als teil des ma-teriellen Schadensersatzanspruches ausdrücklich als nicht entscheidungsreif angesehen wurden. Das urteil ist danach aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen, § 538 Abs. 2 S. 1 nr. 7, S. 3 zPO.
Das Verfahren leidet darüber hinaus an einem weiteren wesentlichen Mangel. Das erstinstanzliche Gericht hat seine entscheidung auf das Gutachten des vorgerichtlich tätigen Prof. Dr. t. H. sowie dessen Bekundungen in der münd-lichen Verhandlung gestützt. Dabei hat es übersehen, dass es insoweit nicht auf die allein zulässigen zivilprozessualen Beweismittel zurückgegriffen hat.
zwar wird davon auszugehen sein, dass das Gutachten des Schlichtungsausschusses zur Begutachtung ärztlicher Behandlungen bei der landesärztekammer Rheinland-Pfalz nicht als reines Parteigutachten anzusehen ist. Der Schlichtungsausschuss ist nämlich nach seinem Statut wei-sungsunabhängig und zur Objektivität verpflichtet. Gleich-wohl handelt es sich nicht um ein gerichtliches Sachver-ständigengutachten. es konnte deshalb nur als urkunde im Prozess verwertet werden und als solches das ergebnis des gerichtlich eingeholten Gutachtens in zweifel ziehen, nicht aber seinerseits Beweis erbringen (v. Strachwitz=Helmstatt, in: ehlers/Broglie [Hrsg.], Arzthaftungsrecht, 4. Aufl. 2008, Rdnr. 686). Vielmehr wäre die einholung eines „Obergutachtens“ erforderlich gewesen. Das Gutachten einer Schlichtungsstelle ist in dieser Hinsicht nicht anders zu behandeln [als] ein Privatgutachten. Dies ergibt sich
Rechtsprechung820 MedR (2011) 29: 820–822
10) Vgl. Geimer, in: Zöller, zPO, 28. Aufl. 2010, Art. 23 euGVVO, Rdnr. 4.
11) Stadler, in: Musielak (Hrsg.), zPO, 8. Aufl. 2011, Art. 23 euGV-VO, Rdnrn. 1, 2. Das gilt auch dann, wenn die euGVVO – wie hier – bei der Bestimmung der internationalen zuständigkeit nicht gilt.
12) Die Revision ist eingelegt und wird beim BGH unter dem Az. III zR 114/11 geführt.