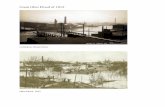In Copyright - Non-Commercial Use Permitted Rights ...20803/eth-20803-02.pdf · The Journal of the...
Transcript of In Copyright - Non-Commercial Use Permitted Rights ...20803/eth-20803-02.pdf · The Journal of the...
Research Collection
Doctoral Thesis
Studie zur Prüfung der medizinisch verwendeten Teere
Author(s): Gensler-Koch, Constantia
Publication Date: 1930
Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000092444
Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For moreinformation please consult the Terms of use.
ETH Library
Studie zur Prüfung
der medizinisch verwendeten Teere
Von der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
in Zürich
zur Erlangung der
Würfle eines Doktors der NaturwissenschaiieD
genehmigte
Nr. 623 Promotionsarbeit
vorgelegt von
Constantia Genslcr-Koch, Apothekerin
aus Sa m ad en (Graubünden)
Referent: Vlerr Prof. Dr. R. Eder
Korreferent: Herr Prof. Dr. P. Schläpfer
Weida i. Thflr. 1930
Druck von Thomas & Hubert
Spezialdruckerei für Dissertationen
Meinem hochverehrten Lehrer,
Herrn Prof. Dr. Robert Eder,
möchte ich herzlich danken für die zahlreichen Ratschläge und
Anregungen bei dieser Arbeit.
i
Inhaltsübersicht.Seite
Abkürzungen 9
Einleitung 11
Beschaffenheits- und Reinheits-Normen 13
Zusammensetzung und Konzentration der wichtigsten quali¬tativen Reagenzien 14
I. Ichthyol und Ersatzmittel desselben 17
1. Einleitung 17
2. Qualitative Prüfungen 22
3. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit 24
4. Spezifisches Gewicht 24
5. Verbrennungsrückstand 25
6. Trockenrückstand 25
7. Gesamtammoniak 27
8. Ammoniumsulfat z29
9. Gesamtschwefel 32
10. Sulfid-Schwefel 35
11. Analysenergebnisse bei Handelsmustern 35
12. Normierung der Gehaltsforderungen 36
13. Untersuchungsmethoden der offiziellen Arzneibücher 39
II. Steinkohlenteer 41
A. Über die Arten und die Zusammensetzung des Steinkohlenteers 41
B. Wichtigste Untersuchungsmethoden des Steinkohlenteers 46
1. Qualitative Prüfungen 47
2. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit 48
3. Spezifisches Gewicht 48
4. Verbrennungsrückstand 49
5. Wassergehalt 49
6. Freier Kohlenstoff 51
7. Bestimmung der sauren Bestandteile (Kreosote im Rohteer) 54
8. Probedestillation 54
9- Bestimmung der Kreosote und des Naphthalins 56
C. Untersuchung von Handelsmustern 62
D. Normierung der Gehaltsforderungen für den medizinisch verwen¬
deten Rohteer 64
— 8 —
Seite
III. Holzteere 67
A. Nadelholzteer 71
1. Sinnenprüfung • 74
2. Verdunstungsrückstand 74
3. Prüfung des Teerwassers 75
4. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin 77
5. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit 78
6. Spezifisches Gewicht 81
7. Verbrennungsrückstand 81
8. Bestimmung der Gesamtsäure 81
9. Probedestillation 82
10. Zusammenfassung 86
B. Wachholderteer 861. Sinnenprüfung 982. Prüfung des Teerwassers 983. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit 1014. Reaktion nach Hirschsohn-Pe'pin 1035. Spezifisches Gewicht 1036. Verbrennungsrückstand 1047. Bestimmung der Gesamtsäure
•. . . .
1048. Probedestillation 1059. Reaktionen der Destillate 106
10. Prüfung auf Buchenteeröle 10711. Abscheidung von 1-Cadinendichlorhydrat 10812. Drehungsvermögen des von den natronlaugelöslichen Anteilen
befreiten, mit Wasserdampf destillierten Kadeöles 10913. Zusammenfassung 110
C. Birkenteer 110
1. Sinnenprüfung 1162. Prüfung des Teerwassers 116
3. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit 1204. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin 1215. Spezifisches Gewicht 1226. Verbrennungsrückstand 1227. Bestimmung der Gesamtsäure 1238. Probedestillation
. 123
9. Reaktionen der Destillate 125
10. Prüfung auf Buchenteeröle 12511. Bestimmung des Unverseifbaren 12512. Bestimmung des Verseifbaren 126
13. Bestimmung der bei 100° flüchtigen Anteile 12714. Zusammenfassung 128
Häufig wiederkehrende Abkürzungen.
Helv. IV = Pharmacopoea Helvetica ed. IV. 1907.
Gall = Codex medicamentarius gallicus. Pharmacopée
française 1908.
Gall. (Suppl. 1920) • . .
= Supplément au Codex medicamentarius gallicus1920.
Gall. (Nouv. Suppl. 1926) = Nouveau Supplément au Codex medicamentarius
gallicus 1926.
D. A. B. 5 = Deutsches Arzneibuch, 5. Ausgabe 1910.
D. A. B. 6 •.
= Deutsches Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926.
Ü. S. A. IX = Pharmacopoeia of the united States IX 1916.
Ü. S. A. X = Pharmacopoeia of the United States X 1926.
Brit = The British Pharmacopoeia, 1914.
Nederl. IV = Nederlandsche Pharmacopée 4de uitgave 1905.
Nederl. V = Nederlandsche Pharmacopée 5de uitgave 1926.
Belg = Pharmacopoea Belgica ed. III. 1906.
Hung = Pharmacopoea Hungarica 1909.
Svenska = Pharmacopoea Svecica ed. X. 1925.
Ital = Farmacopea Ufficiale del Regno d'ltalia ed. V. 1929.
Brit. Pharm. Cod = British Pharmaceutical Codex 1923.
Nat. Form •= The National Formulary ed. IV. 1921.
Rem = New and Nonofficial Remedies 1929, American
Medical Association, Chicago.
Lunge-Köhler . . . .
= Lunge-Köhler, Die Industrie des Steinkohlen¬
teers und des Ammoniaks, V. Auflage, Bd. I.
Lunge-Berl = Lunge-Berl, Chemisch-Technische Untersu¬
chungsmethoden, VII. Auflage, III. Bd.
Holde = Holde, D., Kohlenwasserstofföle und Fette,
VI. Auflage, 1924.
A. Ph. A. Committee . .
= Report of committee on unofficial standards
(Geo. M. Beringer, Chairman). The Journal
of the American Pharmaceutical Association
II, 248 (1913).
Einleitung.
Bei der Neubearbeitung der Schweizerischen Pharmakopoe
ergab sich die Notwendigkeit, neue Prüfungsvorschriften für die
offiziellen Teere, zu welchen wir auch das Ammonium sulfo-
bituminosum (Ichthyol) zählen, aufzustellen. Auf Vorschlag von
Herrn Prof. Dr. Eder unternahm ich es, an Hand verschiedener
Handelsmuster Prüfungsmethoden auszuarbeiten und Normen
aufzustellen, die für Pharmakopoe-Zwecke Verwendung finden
könnten.
Dabei sollte es sich weniger darum handeln, völlig neue Prüfungs¬
verfahren aufzufinden, als vielmehr die Methoden der Technik
sowie die Vorschriften der neuern Pharmakopoen und anderweitige
Vorschläge zur Reinheitsprüfung der Teere kritisch zu bearbeiten
und danach Prüfungsmethoden aufzustellen, die für das Apotheken¬
laboratorium in Betracht kommen könnten.
Während über das Ichthyol und seine Ersatzmittel ziemlich
eingehende Arbeiten bestehen und die Literatur des Steinkohlen¬
teers fast unbegrenzt ist, finden sich über die Prüfung der Holzteere
in der Literatur nur spärliche Angaben, die meistens für alle Holz¬
teere Gültigkeit haben. Es wurde hier versucht, die für die
einzelnen Teere charakteristischen Prüfungen herauszuschälen,
welche gestatten, Fälschungen auf möglichst einfache Weise auf¬
zudecken.
Allgemeine Bemerkungen über die Beschaffen-
heits- und Reinheitsnormen.
In Übereinstimmung mit den Allgemeinen Bestimmungen der
neuen Schweizerischen Pharmakopoe (fielv. V) haben wir in unserer
Arbeit nachstehende Normen adoptiert:
1. Genau wägen heißt, das Gewicht auf der analytischen Wage
mit vier Dezimalen des Grammgewichtes ermitteln.
2. Tropfen wurden gemäß den Bestimmungen des Brüsseler
Übereinkommens (P. I.) mit einem Normaltropfenzähler (kreis¬
runde Abtropffläche von 3 mm Durchmesser) abgezählt, bei dem
20 freifallende Tropfen destilliertes Wasser von 15° lg wiegen.
3. Temperatur. Wo keine andere Temperatur vorgeschrieben
ist, gilt die gewöhnliche Temperatur von 15—25°.
4. Wasser. Unter Wasser ist stets destilliertes Wasser zuverstehen.
5. Reagensgläser. Wir verwendeten zur Beurteilung der Prüfung
Reagensgläser, die eine innere Weite von ca. 11 mm besitzen.
6. Zeitdauer. Wenn bei den Reaktionen keine besondere
Angabe über die Zeitdauer der Beobachtung gemacht wird, gilt
die Beurteilung sofort nach Ausführung der Prüfung.
Zusammensetzung und Konzentration der
wichtigsten qualitativen Reagenzien.
FormelMolekular¬
gewichtAquivalent-gewicht
Gewählte Bezeichnungen und Konzen¬tration der Reagenzien.
HCl
H2S04 ....
NaOH
BaCI,, + 2H80
FeCU + 6 H20
K2Cr307 . . .
KCN
AgNOs
36,47
98,08
40,01
244,30
270,32
294,20
65,108
169,89
36,47
49,04
40,01
122,15
90,1
49,033
65,108
169,89
Konzentrierte
Säuren:
Essigsäure
Salpetersäure
Salzsäure
Schwefelsäure
Verdünnte Säuren:ca. 2 n
Salzsäure
Schwefelsäure
Verdünnte Alkalien:ca. 2n
Natronlauge
Salze: ca. n
Bariumchlorid
Eisenchlorid
Kaliumbichromat
Kaliumcyanid
Salze: 0,1 n
Silbernitrat
SpezifischesGewicht:
1,055-1,060(98-100 °/0)
ca. 1,40(65°/o)
1,18-1,19(ca. 37°/o)
1,839-1,84(95-99 °/0)
Grammim Liter:
73,0
98,0
80,0
122,0
90,0
49,0
65,0
17,0
Weitere in dieser Arbeit benützte Reagenzien, die nach den Vorschriftendes Entwurfes der Ph. Helv. V angefertigt wurden :
Barytwasser: Löse 5,9 g Bariumhydroxyd in frisch ausgekochtem Wasserzu 100 ccm.
Bromwasser: Schüttle 2 ccm Brom mit 100 ccm Wasser.
— 15 —
Fehlingsche Lösung:I. Löse 34,639 g kristallisiertes, nicht verwittertes Kupfersulfat
in Wasser zu 500 ccm.
II. Löse 173 g Kalium-Natrium-tartaricum + 50 g Natrium hydricumin Wasser zu 500 ccm.
Silbernitrat, ammoniakalisches: Silbernitrat wird tropfenweise mit verdünntem
Ammoniak versetzt, bis der entstehende Niederschlag sich eben
wieder gelöst hat.
Bromphenolblau: Löse 0,04 g Tetrabromphenolsulfonphthalein in 20 ccm
Spiritus + Wasser zu 100 ccm.
Bromthymolblau: Löse 0,04 g Dibromthymolsulfonphthalein in 20 ccm Spiri¬tus + Wasser zu 100 ccm.
Methylorange: Löse 0,02 g des Natriumsalzes der p-Dimethylaminoazobenzol-p-sulfosäure in Wasser zu 100 ccm.
Methylrot: Löse 0,05 g p-Dimethylaminoazobenzol-o-carbonsäure in 75 ccm
Spiritus + Wasser zu 100 ccm.
Phenolphthalein: Löse 1 g Phenolphthalein in Spiritus zu 100 ccm.
Thymolblau: Löse 0,1g Thymolsulfonphthalein in Spiritus zu 100 ccm.
Andere Reagenzien:
Cresolrot: Löse 0,04 g Cresolrot in 20 ccm Spiritus + Wasser zu 100 ccm.
Kupferazetat: 1 °/0 ige Lösung.
Diazobenzolsulfosäure: l°/oige Lösung.
Kaliumchlorat (festes) KCIO3.
Kaliumhydroxyd (festes) KOH.
Magnesiumoxyd MgO.
I. Ichthyol und Ersatzmittel desselben.
1. Einleitung.
Seit alten Zeiten wurde in der Nähe von Seefeld im Tirol
aus dem das Karwendelgebirge durchziehenden schwefelhaltigen,
bituminösen Schiefer auf höchst einfache Weise ein teerartiges
Rohöl hergestellt, das sich im Tirol und in den anstoßenden
Gebieten als Volksheilmittel großer Beliebtheit erfreute.
Zu allgemeiner Würdigung gelangte dieses öl aber erst, als
sich R. Schröter1 um das Jahr 1880 eingehend mit seiner Dar¬
stellung und Untersuchung beschäftigte. Es gelang ihm, das
Rohöl durch Sulfurierung wasserlöslich zu machen, die erhaltene
Sulfosäure durch Aussalzen zu isolieren und ein Ammonium- bzw.
Natriumsalz herzustellen. Schröter nannte dieses neue Präparat
in Anlehnung an die Fischabdrücke, die der Seefelder Schiefer
aufweist, Ichthyol oder ichthyolsulfosaures Ammonium bzw.
Natrium2.
Die therapeutischen Eigenschaften dieser Substanz wurden von
P. G. Unna untersucht3. Nach gründlicher klinischer Prüfung
erklärte er das Ichthyol als wertvolles Antirheumaticum und
Antiekzematosum. Bald wurde es auch bei innern Krankheiten
angewandt und fand große Verbreitung und Wertschätzung.
Die fabrikmäßige Darstellung des neuen Heilmittels ging an
die im Jahre 1884 in Hamburg gegründete Ichthyolgesellschaft
Cordes, Hermanni & Co. über.
Um die Zusammensetzung des Ichthyols aufzuklären, veranlaßte
Unna E. Baumann und C.Schotten4, eine eingehende chemische
1 Monatshefte für praktische Dermatologie I, 333 (1882).2D.R.P. 35216.
3 Monatshefte für praktische Dermatologie 1, 338 (1882).4 Ebenda 11, 257 (1883).
Gensler - Koch. 2
— 18 —
Untersuchung des Ichthyols und des Ichthyolrohöles vorzunehmen.
Die Elementaranalyse des Rohöles ergab folgende Zusammen¬
setzung: C = 77,94 •/„, fi = 10,5 %,, S = 10,72 °/0, N = 1,1%.Spezifisches Gewicht: 0,865.
Die von Schröter dargestellte Ichthyolsulfosäure soll nach
Baumann und Schotten außer dem Schwefel der Sulfogruppenoch einen Teil des Schwefels in unmittelbarer Bindung mit dem
Kohlenstoff enthalten, nach Art der Bindung des Schwefels in
Merkaptanen oder organischen Sulfiden. Da die Sulfosäuren
geringe oder keine Wirkung auf den tierischen Organismus aus¬
üben, kann nach Baumann und Schotten1 als therapeutischerWertmesser für das Ichthyol nur der unmittelbar an den Kohlen¬stoff gebundene sogenannte Sulfid-Schwefel in Betracht kommen.
Das Natriumsalz der Ichthyolsulfosäure ergab nach vollständigerTrocknung bei der Analyse folgende Werte: C = 55,05 %»H = 6,06%, S = 15,27%, O = 15,83%, Na = 7,78%.
In der Annahme, daß das sulfurierte Produkt eine einheitliche
Verbindung sei, stellten Baumann und Schotten für die
Ichthyolsulfosäure die Formel auf: C28H3t(S(S08H)2.Daß aber die Ichthyolsufosäure kein einheitlicher chemischer
Körper ist, wurde später durch die Untersuchungen von
O. fiel mers2 bewiesen. Er verfolgte die Wirkung verschiedener
organischer Lösungsmittel auf die Ichthyolsulfosäure und kam zu
folgendem Ergebnis:Durch Behandlung mit absolutem Alkohol können zuerst die
sulfosäuren Salze ausgezogen werden, während die neutralen sulfon-
artigen Verbindungen zurückbleiben. Diese von Helmers als
Sulfone bezeichneten Körper, eine grünschwarze, stark schwefel¬
haltige Masse, gewinnt man durch Extraktion mit Chloroform oder
Benzol. Den Rückstand bilden die anorganischen Absättigungssalze.Die Sulfone sind wasserunlöslich. Sie werden im Ichthyol aber durch
die konzentrierte, wässerige Lösung der sulfosäuren Salze in
Lösung gehalten. Doch sind weder die sulfosäuren Salze noch
die Sulfone einheitliche Verbindungen. Ein Teil der Sulfosäurenbildet mit Erdalkalien und Schwermetallen wasserlösliche, ein
1Monatshefte für praktische Dermatologie II, 257 (1883).
2Ber. 27 (R), 914 (1892). — D.R.P. 76128.
— 19 —
anderer Teil wasserunlösliche Salze1. Die Sulfone setzen sich
aus verschiedenen Körpern zusammen, die sich durch den Siede¬
punkt, das spezifische Gewicht und den Schwefelgehalt vonein¬
ander unterscheiden2.
Den umfassenden Untersuchungen von H. Scheibler8 ist es
zu verdanken, daß die chemische Zusammensetzung der Ichthyol¬rohöle weiter aufgeklärt wurde. Das durch mehrfache Vorbehand¬
lung (Destillation mit Natronkalk, Extraktion mit verdünnter
Salzsäure, nachfolgende Behandlung mit Athylmagnesiumchlorid,Destillation über Natrium) gereinigte Rohöl zeigte die gleicheWirksamkeit wie das Ichthyol. Der fest gebundene Schwefel
tritt erst nach Sprengung des Moleküls mit Metallen in Ver¬
bindung. Scheibler konnte nachweisen, daß die Ichthyolrohöleoft bis zur Hälfte Homologe des Thiophens als typische Schwefel¬
körper enthalten. Bei der Sulfurierung liefern diese KörperMono- und Disulfosäuren.
Damit findet die Vermutung von S. Fränkel4, daß die Schwefel¬
körper des Ichthyols Abkömmlinge des Thiophens sein könnten,
ihre Bestätigung. Nach S. Fränkel8 verleiht dieser zyklisch
gebundene Schwefel der Substanz den hohen therapeutischen
Wert, die antiseptischen, resorptionsfördernden Eigenschaften.
Es ist leicht verständlich, daß sich dem Ichthyol, welches
seinen Platz in der Therapie bis zum heutigen Tag behauptet
hat, bald eine große Anzahl von Ersatzmitteln beigesellte. Aus
anderen schwefelhaltigen Schiefern, wie sie außer im Tirol noch
im Tessin (bei Meride), in Oberitalien (z. B. in der Toscana6) und
in Südfrankreich vorkommen, werden durch trockene Destillation,
Sulfurierung und Neutralisation mit Ammoniak ichthyolähnliche
Präparate gewonnen. In Rohölen, die ärmer an sulfidisch ge¬
bundenem Schwefel als das Ichthyolrohöl sind, reichert man den
Schwefelgehalt oft noch künstlich an, da das öl, vermöge seiner
1 C. 1900, II, 462. — D.R.P. 112630.
2Dermatologische Studien 20, 308 (1910).
3 Archiv der Pharmazie 258, 70 (1920).4 S. Fränkel, Arzneimittelsynthese, 3. Auflage, 68 (1912).6Ebenda, 6. Auflage, 124 (1927).
6 Gazz. Chim. ital. 39, II, 575 (1910).
2*
— 20 —
Doppelbindungen, noch Schwefel aufnehmen kann1. Nach
S. Fränkel2 erweisen sich aber solche künstlich geschwefeltenPräparate therapeutisch oft weniger wirksam, da durch Eintritt
des Schwefels der so wichtige ungesättigte Charakter der Substanz
verloren geht.
Solange das Ichthyol den Markt allein beherrschte, stellten die
Arzneibücher zu dessen Beurteilung in der Hauptsache nur quali¬tative Prüfungsvorschriften auf; quantitative Angaben wurden
höchstens über Trockensubstanz und Verbrennungsrückstandgemacht. Als dann aber viele dem Ichthyol mehr oder minder
gleichwertige Ersatzmittel in den Handel gebracht wurden, wurde
es zur Notwendigkeit, auch quantitative Methoden zusammen¬
zustellen, nach welchen minderwertige Ersatzmittel erkannt und
vom Gebrauch ausgeschaltet werden konpten.Die wichtigste Aufgabe würde darin bestehen, den Gehalt an
organisch gebundenem Schwefel, sogenanntem Sulfid-Schwefel,von dessen Gegenwart ja der therapeutische Erfolg eines Präpa¬rates nach heutigen Anschauungen im wesentlichen abhängensoll, zu bestimmen. Da der Gesamtschwefel-Gehalt sich aber
aus dem Schwefel des Ammoniumsulfates, dem der Sulfogruppeund dem Sulfid-Schwefel zusammensetzt, so wird eine direkte
Bestimmung des letzteren von vornherein erschwert. Versuche
in diesem Sinne wurden von 0. Hei mers1 angestellt. Er suchte
durch trockene Destillation der Präparate die ursprünglichenSchwefelöle wieder zurückzugewinnen und im Destillat, das also
nur mehr sulfidischen Schwefel enthalten sollte, den Schwefelgehaltzu bestimmen. Der Sulfid-Schwefel wird aber auf diese Weise
nicht quantitativ abdestilliert, und die Bestimmung kommt für
analytische Zwecke nicht in Betracht.
Über eine direkte Bestimmung des als Sulfat und des in sul-
fonischer Bindung vorhandenen Schwefels berichtet H. v.Hayek3.Er fällte die schwach mit Salzsäure angesäuerte Lösung des
Ichthyols mit Bariumchlorid und glühte den Niederschlag nach
dem Auswaschen. Nach seiner Ansicht fällt die Ichthyolsulfo-
1 0. Helmers, Dermatologische Studien 20, 308 (1910,).2
S. Fränkel, Arzneimittelsynthese, 6. Auflage, 623 (1927).sPharm. Ztg. 52, 952 (1907).
— 21 —
säure quantitativ als ichthyolsulfosaures Barium aus, und die
beim Glühen verbleibende Menge Bariumsulfat soll dem im Sulfat
und dem in der Sulfonsäure vorhandenen Schwefel entsprechen.
Doch gelingt auf diese Weise, wieH. Beckurts und H. Frerichs1
nachweisen konnten, die quantitative Abspaltung des Sulfon-
Schwefels nicht, und wir sind heute noch auf die indirekte Be¬
stimmung sowohl des Sulfid- als auch des Sulfon-Schwefels
angewiesen, wie sie von R. Thal2, dem wir eine gründliche
Untersuchung über das Ichthyol und einige Ersatzmittel verdanken,
empfohlen wurde.
Da das Ichthyol und seine Ersatzpräparate in der Hauptsache
wässerige Lösungen von Ammoniumsalzen organischer Sulfon-
säuren, von Sulfonen bzw. nach neueren Anschauungen Thiophen-
derivaten und von Ammoniumsulfat darstellen, so müssen sich
die quantitativen Prüfungen auf die Bestimmung der Trocken¬
substanz, auf den Gehalt an Gesamtammoniak, Gesamtschwefel
und Ammoniumsulfat erstrecken. Aus dem Gehalt an Gesamt¬
ammoniak, Gesamtschwefel und Ammoniumsulfat ergibt sich
nach R. Thal die mittelbare Bewertung des Sulfon- und Sulfid-
Schwefels auf folgende Weise:
Von dem gefundenen Gehalt an Gesamtammoniak wird die
im Ammoniumsulfat vorhandene Menge Ammoniak abgezogen.
Der verbleibende Rest ist an die Sulfogruppe gebunden und wird
als Sulfon-Ammoniak bezeichnet. Da auf 17 Teile Ammoniak
32 Teile Schwefel der Sulfosäuregruppe entfallen, kann auf diese
Weise der Gehalt an Sulfon-Schwefel festgestellt werden. Die
Menge des Sulfid-Schwefels ergibt sich hierauf durch Subtraktion
des Sulfat-Schwefels und des Sulfon-Schwefels von der Menge
des Gesamtschwefels.
Vergleichende Untersuchungen von Ichthyol und Ersatzmitteln
wurden von verschiedenen Autoren vorgenommen. Außer R.Thal2
beschäftigte sich auch H.v. Hayek3 mit der Prüfung verschiedener
Muster Ichthyol und Ichthynat Heyden. Eine Zusammenfassung
der bereits bekannten Arbeitsmethoden und neue Resultate
1 Archiv der Pharmazie 250, 478 (1912).2Apoth. Ztg. 21, 431 (1906).
3 Pharm. Ztg. 52, 952 (1907).
— 22 -
verdankt man den Untersuchungen von H. Beckurts undH. Frerichs1.
Im nachfolgenden wurden die von diesen Verfassern ange¬wandten Methoden, die Prüfungsvorschriften der neueren Phar¬
makopoen sowie in neuerer Zeit veröffentlichte Vorschläge zur
Bewertung des Ichthyols und seiner Ersatzmittel kritisch unter¬
sucht und für Pharmakopöe-Normen sich eignende Methoden
zusammengestellt.
2. Qualitative Prüfungen.
Qualitative Prüfungen für Ichthyol und seine Ersatzmittel können
folgendermaßen formuliert werden:
1. Die Präparate sind in dünner Schicht braune, in dicker Schicht
schwarze, sirupdicke, teerartige Flüssigkeiten von charak¬
teristischem, empyreumatischem Geruch.
2. 1 g muß sich in 9 ccm Wasser zu einer klaren, braunen Flüssig¬keit lösen. Diese Lösung (Stammlösung) muß gegen Lackmus
neutral reagieren.
Die von uns untersuchten Handelsmuster entsprachen mit einer
einzigen Ausnahme dieser Forderung (siehe Seite 35).Die Reaktion der wässerigen Flüssigkeit soll nach Gall. (Nouv.
Suppl. 1926) sowie nach einer Mitteilung der Ichthyolgesellschaft2neutral sein. Schwach saure Reaktion geben an: Ergänzungs¬buch zum D.A.B. 1897, Hung. 1909, Ital.1929, A.Ph.A. Committee8,Rem.* (für Hirathiol5 und Ichthynat Heyden).
3. Erwärmt man 3 ccm der Stammlösung mit 3 ccm verdünnter
Natronlauge, so entwickelt sich Ammoniak. Wird die Mischungeingedampft, der Verdampfungsrückstand verkohlt und mit
verdünnter Salzsäure versetzt, so entweicht Schwefelwasserstoff.
Bei den von uns untersuchten Handelsmustern fiel die Prüfungüberall positiv aus.
1 Archiv der Pharmazie 250, 478 (1912).2
Privatmitteilung der Ichthyolgesellschaft.3Journ. Am. Pharm. Ass. II, 250 (1913).
*New and Nonofficial Remedies 398 (1929).
6 Ammonii sulphoichthyolicum (Hirasawa, Chem.Ind.Comp.Tokyo,Japan).
— 23 —
Die Prüfung findet sich in ähnlicher Form in: Ergänzungsbuch
zum D. A. B. 1897, Hung. 1909, Belg. 1906, Gall. (Nouv. Suppl.
1926), Ital. 1929, A.Ph.A. Committee, Rem. 1929 fürriirathiol und
Ichthynat.
4. Versetzt man 3 ccm der Stammlösung mit 1 ccm konzentrierter
Salpetersäure, so fällt eine dunkle, harzartige Masse aus. Die
überstehende Flüssigkeit wird abgegossen und abfiltriert.
2 ccm des Filtrates dürfen auf Zusatz von 4 Tropfen Silber¬
nitrat weder eine Fällung noch eine Trübung zeigen (Chlorid).
Die nach dem Abgießen der überstehenden Flüssigkeit zurück¬
bleibende harzartige Masse löst sich in 10 ccm Wasser wieder
beinahe vollständig.
Die von uns untersuchten Handelsmuster entsprachen alle diesen
Anforderungen (siehe Seite 35).
Das Ausfällen der Ichthyolsulfosäure geschieht mit konzen¬
trierter Salzsäure im Ergänzungsbuch zum D. A.B. 1897, Belg. 1906,
Ital. 1929, A. Ph. A. Committee. Rem. 1929 (für Hirathiol und Ich¬
thynat). Die Ichthyolsulfosäure wird auch ausgefällt durch Säuren,
Salzlösungen, Alkalien, Alkalijodide, Alkaloidsalze: A.Ph.A. Com¬
mittee, Gall. (Nouv. Suppl. 1926), Rem. 1929.
5. 5 dg der Präparate müssen sich in einer Mischung von 10 ccm
Chloroform + 5 ccm absolutem Alkohol völlig oder bis auf einen
kleinen Rückstand von weißen oder schwach bräunlichen
Kristallen (Ammoniumsulfat) lösen.
Diese Prüfung eignet sich gut zur Erkennung eines zu großen
Gehaltes von Ammoniumsulfat und anderen unlöslichen Verun¬
reinigungen, da die Sulfosäuren in absolutem Alkohol, die Sulfone
in Chloroform löslich sind.
Die von uns untersuchten Handelsmuster entsprachen obiger
Prüfung.Auch folgende Prüfung läßt einen zu hohen Gehalt an Am¬
moniumsulfat erkennen:
6. Streicht man einige Tropfen der Präparate mit Hilfe eines
Glasstabes auf einer Glasplatte zu einer dünnen Schicht aus
und läßt während einer Stunde bei gewöhnlicher Temperatur
- 24 —
trocknen, so muß ein glänzend brauner, klarer, nicht körnigerFirnis entstehen.
Von den von uns untersuchten Handelsmustern zeigte eines
einen körnigen Ausstrich (siehe Seite 35).
3. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit.
Ichthyol und seine Ersatzpräparate sollen sich in jedem Ver¬
hältnis klar mischen mit Wasser und Glycerin. Sie sind nur
teilweise löslich in Alkohol, Äther und Benzin. 1 g löst sich bei¬
nahe vollständig in einer Mischung von 10 ccm Weingeist +10 ccm
Äther.
Die von uns untersuchten Handelsmuster entsprachen diesen
Anforderungen.Diese Angaben finden sich in: Ergänzungsbuch zum D.A.B.1897,
Belg. 1906, Hung. 1909, Ital. 1929, A. Ph. A. Committee, Brit. Pharm.
Cod. 1923, Rem. (für Ichthynat).Die Präparate sind gut mischbar mit Schweinefett und Vase¬
lin, schlecht mit fetten ölen und Paraffinöl.
A. Ph. A. Committee gibt Mischbarkeit mit Glycerin, ölen und
Fetten an, Brit. Pharm. Cod. mit Glycerin und ölen; nach Gall.
(Nouv. Suppl. 1926) sind die Präparate mischbar mit Schweinefett,Lanolin und Vaselin, nicht aber mit fetten ölen und Paraffinöl.
Ital. 1929 gibt Mischbarkeit mit ölen und Vaselin an. Nach
Untersuchungen von 3. Hostmann1 ist entgegen manchen An¬
gaben das Ichthyol mit fetten ölen nicht mischbar.
4. Spezifisches Gewicht.
Das spezifische Gewicht des Ichthyols und seiner Ersatz¬
präparate muß zwischen 1,12 und 1,17 liegen.Nach Gall. (Nouv. Suppl. 1926) ist es größer als 1,00. Die Mit¬
teilungen von Thal, Hayek, Beckurts und Frerichs enthalten
keine Angaben über das spezifische Gewicht der untersuchten
Präparate.
1 Journ. Am. Pharm. Ass. IV, 1490 (1915).
— 25 —
Das spezifische Gewicht der von uns untersuchten Handels¬
muster schwankte zwischen 1,126 und 1,169.
Es wird zweckmäßig in folgender Weise bestimmt1:
In ein Wägegläschen von ca. 27 mm Durchmesser und
ca. 76 mm Höhe wird in den mit flachem Boden versehenen,
eingeschliffenen Glasstopfen am Rande eine von oben nach
unten durchgehende Kerbe von ca. 2 mm Breite und Tiefe ein¬
gefeilt. Man bestimmt ein für allemal das Eigengewicht des
Gläschens (a) und sein Gewicht nach Füllung mit Wasser von
15° (b). In das trockene Gläschen wird dann etwa bis zu
zwei Drittel der Höhe von der Substanz hineingegossen und
das Glas mit abgenommenem Stopfen eine Stunde lang in
heißes Wasser gestellt. Nun läßt man in einem größeren
Gefäß mit Wasser von 15° erkalten und wägt das Glas + Sub¬
stanz (c). Hierauf füllt man mit Wasser von 15° auf, setzt
den Stopfen auf, entfernt das aus der Kerbe des Stopfens aus¬
tretende Wasser, trocknet außen ab und wägt wieder (d). Das
gesuchte spezifische Gewicht ist dann:,_ ,
c~,a,tt.
° b + c— (a + d)
5. Verbrennungsrückstand.
Der Verbrennungsrückstand, bestimmt mit ca. 1 g Substanz,
darf höchstens 0,1 % betragen.
Die bei den von uns untersuchten Handelsmustern gefundenen
Verbrennungsrückstände liegen zwischen 0,03 und 0,24% (siehe
Seite 35).A. Ph. A. Committee begrenzt den Verbrennungsrückstand mit
höchstens 0,1%» Rem- für Ichthynat mit 0,5 °/0, Ergänzungsbuch
zum D. A. B. 1897 fordert, daß nach dem Verbrennen kein Rück¬
stand verbleibe, Belg. 1906 und Gall. (Nouv. Suppl. 1926) fordern
kein „résidu appréciable", Ital. 1929 kein „residuo apprezzabile".
6. Trockenrückstand.
Zur Bestimmung des Trockenrückstandes werden in der Literatur
folgende Vorschläge gemacht:
1
Lunge, Z. angew. Ch. 7, 449 (1894).
- 26 —
Nach R. Thal1 werden gegen 4 g der Präparate in gewogenem, verschlie߬
barem, mit Glasstab versehenem Trockengläschen auf dem Wasserbade mög¬lichst unter öfterm Rühren eingetrocknet und darauf im Trockenschrank bei
100° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.Nach H.v.Hayek2 darf das Trocknen nur bei einer Temperatur von 110°,
maximal von 120° durchgeführt werden; bei höhern Temperaturen beginntunter neuerlichem Gewichtsverlust trockene Destillation.
Nach H. Beckurts und H. Frerichs" wurde die Bestimmung in derWeise
ausgeführt, daß in flachen Porzellanschalen ca. 5 g des Präparates in einem
Wassertrockenschrank solange getrocknet wurden, bis ein mehrstündigesTrocknen einen Gewichtsverlust von nicht mehr als 0,2 °/0 ergab. Von einem
Trocknen bis zur Gewichtskonstanz wurde deswegen Abstand genommen,weil beim Trocknen außer Wasser auch andere flüchtige Verbindungen all¬mählich entweichen.
Gall. (Nouv. Suppl. 1926) schreibt vor: 1 g Ichthyolammonium wird ineiner Porzellanschale auf dem Wasserbad getrocknet, bis der Gewichtsverlustzwischen zwei aufeinanderfolgenden Wägungen 0,2 °/0 nicht überschreitet.
Nach Mitteilung der Saurolgesellschaft* werden 3—4 g Saurol mit
einer innerten Substanz (Bimsstein, Glas oder kalzinierter Sand) im Hei߬luftschrank unter umrühren mit einem kleinen Glasstab (um Aufblähen und
Verspritzen zu vermeiden) während 8 Stunden getrocknet.
Die Prüfung dieser verschiedenen Vorschriften ergab folgendesResultat:
Es ist zweckmäßig, das Ichthyol in weiten, verschließbaren
Wägegläschen abzuwägen, da die Substanz in offener Porzellan¬
schale während der Wägung an Gewicht verliert. Von einem
Trocknen bis zur Gewichtskonstanz muß hingegen abgesehenwerden, weil sich bei einer Temperatur von 103—105° außer
Wasser auch noch andere Verbindungen verflüchtigen. Die Dauer
des Trocknens bei dieser Temperatur kann jedoch so eingeschränktwerden, daß zwei im Intervall von 1 Stunde aufeinander¬
folgende Wägungen keinen größern Gewichtsunterschied als
0,1 °/o aufweisen. Das Zufügen einer inerten Substanz ist
unnötig, da beim Trocknen auf dem Wasserbad unter Um¬
rühren mit einem Glasstäbchen kein Aufblähen oder Verspritzeneintritt. Auf Grund unserer Erfahrungen schlagen wir folgendeMethode vor:
1
Apoth. Ztg. 21, 431 (1906).2Pharm. Ztg. 52, 952 (1907).
3Archiv der Pharmazie 250, 478 (1912).
4
Privatmitteilung.
— 27 —
Zirka 3 g Substanz, genau gewogen, werden in einem verschlie߬
baren, weithalsigen, mit Glasstäbchen versehenen Wägeglas
während 6 Stunden auf dem Wasserbad unter häufigem Um¬
rühren erhitzt. Sodann wird bei einer Temperatur von 103—105°
im Trockenschrank solange weiter getrocknet, bis zwei im Intervall
von 1 Stunde aufeinanderfolgende Wägungen keinen größeren
Gewichtsunterschied als 0,1% aufweisen. Der Trockenrückstand
muß mindestens 50°/o betragen.
Die von uns untersuchten Handelsmuster wiesen einen Trocken¬
rückstand von 53,81 — 56,48% auf.
Die in der Literatur angegebenen Werte über den Gehalt an
Trockenrückstand beim Ichthyol und seinen Ersatzmitteln
schwanken nach den von ti Beckurts und ti. Frerichs ge¬
machten Angaben zwischen 37,7 und 62,5%, liegen aber beim
Ichthyol selbst in viel engeren Grenzen, zwischen 52 und 57%-
Ergänzungsbuch zum D. A. B. 1897 fordert mindestens 50%,
Belg. 1906 ca. 55%, Gall. (Nouv. Suppl. 1926) 50 — 55%,
Brit. Pharm. Cod. 1923 50%, A.Ph.A. Committee 53%, Rem. für
Hirathiol 53,5%, für Ichthynat mindestens 53%. Nach Mitteilung
der Ichthyolgesellschaft und der Gesellschaft für Chemische
Industrie in Basel1 sollen mindestens 50% gefordert werden.
7. Gesamtammoniak.
Für die Bestimmung des Gesamtammoniaks sind in der Literatur
folgende Methoden vorgeschlagen worden:
Nach R. Thal2 wird zu einer Lösung von 5 g der Präparate in etwa
150 ccm Wasser eine abgemessene, überschüssige Menge 0,5 n-Lauge zugefügt
und die Flüssigkeit gegen 8/4 Stunden lang im Sieden erhalten. Nach dem
Erkalten wird mit Wasser auf ca. 300 ccm verdünnt, mit einigen Tropfen
Fluoresceinlösung (aus 0,4 g Fluorescein, 50 g Alkohol und 30 g Wasser)
versetzt und der Überschuß der Lauge mit 0,5 n-Säure zurücktitriert. Aus
der verbrauchten Menge Lauge wird der Ammoniakgehalt berechnet.
Hayek3 und die meisten andern Autoren benützen im Prinzip das Kjehl-
dahlsche Verfahren.
1 Privatmitteilung'
Apoth. Ztg. 21, 431 (1906).3 Pharm. Ztg. 52, 952 (1907).
— 28 —
So lösen Beckurts und Frerichs 5 g der Präparate in ca. 150 ccm
Wasser und unterwerfen nach Zusatz von 10 ccm 50°/oiger Natronlauge und
einigen Körnchen Zink der Destillation. Das Destillat wird unter Benutzungeines Kühlers in einer überschüssigen Menge 0,5 n-Salzsäure aufgefangen.Darauf wird mit 0,5 n-Lauge unter Verwendung von Methylorange als In¬
dikator der Säureüberschuß zurücktitriert.
Nach Reports of A. Ph. A. Committee1 versetzt man 5— 6 g Ichthyol mit
25 ccm Kalilauge (ca. 6 °/0 ig) und 100 ccm Wasser, destilliert die Flüssigkeitbis kein Ammoniak mehr übergeht und sammelt das Destillat in 15 ccm
n-Schwefelsäure, zu welcher ein Tropfen Methylorange zugegeben wurde.Der Überschuß an Schwefelsäure wird mit 0,1 n-Kalilauge zurücktitriert.
Die gleiche Methode wird von Rem. auch zur Bestimmung des Gesamt¬
ammoniaks in Hirathiol und Ichthynat angewandt.Die Ichthyolgesellschaft2 empfiehlt folgendes Verfahren: Eine Lösung von
5 g des Präparates in ca. 200 ccm Wasser wird mit 2 g Magnesiumoxydversetzt und dann der Destillation unterworfen. Das Destillat wird in
0,5 n-Schwefelsäure aufgefangen und der Säureüberschuß mit 0,5 n-Laugeunter Verwendung von Methylorange als Indikator zurücktitriert.
Zu diesen Methoden ist folgendes zu bemerken:
Es ist nach unsern Erfahrungen vorteilhafter, den Gehalt an
Gesamtammoniak nur mit 1—1,5 g Substanz zu bestimmen, da
bei größeren Mengen infolge starken Schäumens während der
Destillation zu große Destillierkolben verwendet werden müssen.
Bei Verwendung von 1—1,5 g genügen zum Auffangen des
Destillates 50 ccm 0,1 n-Salzsäure. Zur Austreibung des Am¬
moniaks eignet sich Magnesiumoxyd besser als Natronlauge, da
sowohl das Schäumen wie auch unregelmäßiges Sieden während
der Destillation stark vermindert wird. Vergleichende Unter¬
suchungen desselben Präparates mit Natronlauge und Magnesium-oxyd behandelt lieferten uns übereinstimmende Werte.
Für die Bestimmmung des Gesamtammoniaks ist folgendeArbeitsweise zu empfehlen:
Zirka 1 — 1,5 g Substanz (genau gewogen) werden mit dem
Wägegläschen in einen Erlenmeyerkolben von ca. 600 ccm Inhalt
gebracht, in 200 ccm Wasser unter häufigem Umschwenken ge¬
löst, mit 2 g Magnesiumoxyd versetzt und unter Benutzung eines
gut wirkenden Kühlers während ll/2 Stunden der Destillation
unterworfen. Das Destillat wird durch einen mit dem Kühler
1 Journ. Am. Pharm. Ass. II, 250 (1913).2
Privatmitteilung.
— 29 —
verbundenen Vorstoß in 50 ccm 0,1 n-Salzsäure aufgefangen.Nach Zusatz von 2—3 Tropfen Methylorange wird der Säure¬
überschuß mit 0,1 n-Natronlauge bis zur Gelbfärbung zurücktitriert.
1 ccm 0,1 n-HCl = 0,001703 g NH3.
Der Gehalt an Gesamtammoniak muß mindestens 1,2% und
darf höchstens 4,2% betragen.Wir ermittelten bei den von uns untersuchten Handelsmustern
2,45—3,82°/o Gesamtammoniak (siehe Seite 35).
Nach den bei Beckurts und Frerichs angeführten Unter¬
suchungen schwankt der Gehalt an Gesamtammoniak beim Ichthyolund seinen Ersatzmitteln zwischen 1,38—5,11% >
hält sich aberauch
hier wieder beim Ichthyol in sehr engen Grenzen von 2,90—3,50%.Gall. (Nouv.Suppl. 1926) verlangt keine Bestimmung des Gehaltes
an Gesamtammoniak, A. Ph. A. Committee fordert 2,9 — 3,4%,
Rem. gibt für fiirathiol 3,18% an,iürlchthynat zwischen 3 und 5%.
Nach einer Mitteilung der Ichthyolgesellschaft und der Gesell¬
schaft für Chemische Industrie in Basel1 soll sich der Gehalt an
Gesamtammoniak im Ichthyol und Isarol zwischen 2,5 und 3,5%halten.
8. Ammoniumsulfat.
Zur Bestimmung des Ammoniumsulfates im Ichthyol nnd seinen
Ersatzpräparaten gibt die Literatur folgende Methoden an:
Nach R. Thal2 werden ca. 5 g der Präparate in 250 ccm Wasser gelöst,
die Lösung wird in einen 500 ccm Kolben gebracht, mit 80 ccm einer aus
gleichen Gewichtsteilen Hühnereiweiß und Wasser bestehenden Eiweißlösung
versetzt, dann 5 ccm 25 °/0 ige Salzsäure zugesetzt und mit Wasser auf
500 ccm gebracht. Nach gehörigem Durchschütteln wird vom voluminösen
Niederschlag abfiltriert und in 200 ccm des Filtrates die Schwefelsäure in
der Kälte durch langsames Zutröpfeln von Chlorbariumlösung gefällt. Die
erhaltene Menge Bariumsulfat wird in Ammoniumsulfat umgerechnet.
Beckurts und Frerichs3 haben die Methode nur wenig modifiziert: Zu
einer Auflösung von nicht mehr als 4 g Substanz in ca. 300 ccm Wasser
wird das mit etwa 100 ccm Wasser verrührte Eiweiß von einem mittelgroßen
Ei gegeben. Nach Zusatz von 5 ccm 25°/0iger HCl wird auf 500 ccm auf-
1Privatmitteilung.
2
Apoth. Ztg. 21, 431 (1906).3 Archiv der Pharmazie 250, 478 (1912).
— 30 -
gefüllt und nach dem Umschütteln filtriert. In 200 ccm des Filtrates wird
die Schwefelsäure als Bariumsulfat gefällt und bestimmt.
Das Verfahren von Beckurts und Frerichs ist von Gall. (Nouv. Suppl.1926) übernommen worden.
Nach A. Ph. A. Committee werden 5—6 g Substanz in einem Becherglasmit 50 ccm Wasser verdünnt, 10 ccm einer 10°/oigen Eiweißlösung zugegeben,unter jeweiligem Schütteln fünfmal je 5 ccm 10%ige Salzsäure dazugegebenund die Mischung auf 500 ccm gebracht. Man filtriert durch ein trockenes
Filter, erhitzt 200 ccm des Filtrates zum Sieden, gibt 10 ccm Bariumchlorid¬
lösung (ca. n) dazu und läßt 24 Stunden stehen. Der Niederschlag wird ge¬
sammelt, geglüht und gewogen.
Zur Bestimmung des Ammoniumsulfates in Hirathiol und lchthynat wird
von Rem. ebenfalls obige Methode angewandt.Nach Mitteilung der Ichthyolgesellschaft1 versetzt man die wässerige Lösung
von 5 g des Präparates mit 40 ccm 10°/oiger Albuminlösung und 5 ccm Salz¬
säure (1,124), füllt mit Wasser auf 500 ccm, mischt, filtriert und bestimmt
in 200 ccm des Filtrates die Schwefelsäure und berechnet als Ammoniumsulfat.
Hayek8 löst ca. 5 g Ichthyol in 20 ccm Wasser, fällt die Ichthyolsulfo-säure durch 20 ccm konzentrierte Salzsäure, filtriert und wäscht mit Salz¬säure (2 Teile HCl konz., 1 Teil Wasser); im Filtrat wird die Schwefelsäureals Bariumsulfat bestimmt und dieses auf Ammoniumsulfat umgerechnet.
C. de Groot3 benützt zum Fällen der Ichthyolsulfosäure Kochsalz; 2 gSubstanz werden in 18 g Wasser aufgelöst und 6 g Natriumchlorid zugefügt.Man erwärmt, so daß die abgeschiedene Sulfosäure zusammenballt, gießt die
Flüssigkeit in einen Meßkolben von 50 ccm und spült die zurückbleibendeMasse einige Male mit konzentrierter Natriumchloridlösung nach; die ver¬
einigten Flüssigkeiten werden im Meßkolben auf 50 ccm verdünnt, nachSchütteln mit kalzinierter Infusorienerde wird filtriert und im Filtrat dasAmmoniumsulfat mit Bariumchloridlösung gefällt. Das Behandeln mit In-
• fusorienerde ist nach de Groot notwendig, da die Filtrate sonst nicht farblos,sondern hellgelb bis gelbbraun gefärbt sind.
Nach Mitteilung der Saurolgesellschaft1 kann das Ammoniumsulfat auchwie folgt bestimmt werden: 5—6 g des Präparates werden in einem Becher¬
glas mit einer Mischung von gleichen Teilen Alkohol und Äther versetzt.Man bringt die Mischung samt dem entstandenen Niederschlag auf eintariertes Filter und wäscht solange mit der Alkohol-Athermischung, bis die
Waschflüssigkeit farblos durchläuft und der auf dem Filter zurückbleibende
Niederschlag ein grauweißes Aussehen hat. Man trocknet Filter und Niederschlagund wägt. Der Niederschlag der in Äther-Weingeist unlöslichen Substanzenbesteht zur Hauptsache aus Ammoniumsulfat nebst Spuren von Eisen.
Die Methode der Saurolgesellschaft liefert nach unseren Er¬
fahrungen nur ungenaue Werte. Die übrigen Methoden unter-
1Privatmitteilung.
2Pharm. Ztg. 52, 952 (1907).
3 Pharm. Weekblaad Nr. 45 (1900).
— 31 -
scheiden sich durch die Art und Weise wie die Ichthyolsulfosäure
abgeschieden wird. Sie wird ausgefällt durch Eiweißlösung oder
durch konzentrierte Salzsäure oder durch konzentrierte Natrium¬
chloridlösung. Die Methoden von Hayek (Salzsäure) und deGroot
(Natriumchlorid) liefern viel stärker gefärbte Filtrate und stärker
gefärbtes Bariumsulfat als die Methoden, die Eiweißlösung zum
Ausfällen benützen. Eine zu große Menge Salzsäure im Filtrat
erhöht außerdem die Löslichkeit geringer Mengen gefällten Barium¬
sulfates. Andererseits muß zu hohe Konzentration von Alkali¬
salzen (NaCl) wegen Okklusion durch das Bariumsulfat vermieden
werden. Der Nachteil bei der Verwendung von frischem fiühner-
eiweiß liegt darin, daß das Filtrat, vor der Fällung mit Barium¬
chlorid zum Sieden erhitzt, stark schäumt und daß diese Schaum¬
bildung auch beim Abfiltrieren des gefällten Bariumsulfates noch
störend wirkt. Verwendet man aber statt frischen Hühnereiweißes
eine 10°/oige- Lösung von getrocknetem Eiweiß, so ist die Schaum¬
bildung nur gering, und die Abtrennung des Bariumsulfates gehtschneller vor sich.
Wir empfehlen zur Bestimmung des Ammoniumsulfates die
amerikanische Vorschrift in der folgenden, etwas modifizierten
Form:
Zirka 3 g Substanz (genau gewogen) werden mit dem Wäge¬
glas in ein Becherglas von ca. 400 ccm Inhalt gebracht und in
ca. 200 ccm Wasser gelöst. Die Lösung wird unter Nachspülenmit Wasser quantitativ in einen Meßkolben von 500 ccm Inhalt
übergeführt, mit 20 ccm einer 10%'gen Eiweißlösung gemischt,hierauf unter jeweiligem Umschütteln dreimal mit je 10 ccm ver¬
dünnter Salzsäure versetzt und mit Wasser bis zur Marke auf¬
gefüllt. Nach gehörigem Durchschütteln wird die Lösung durch
ein trockenes Faltenfilter gegossen. 200 ccm des Filtrates werden
in einem Becherglas zum Sieden erhitzt, mit 10 ccm Barium¬
chloridlösung (ca. n) versetzt und während 24 Stunden in der
Wärme stehen gelassen. Dann wird das abgeschiedene Barium¬
sulfat in einem Porzellan-Filtertiegel gesammelt, mit heißem
Wasser gewaschen, bis im Filtrat Chlorid nicht mehr nachweisbar
ist, getrocknet, geglüht und gewogen. Das Bariumsulfat wird
- 32 —
nach folgender Gleichung umgerechnet in Prozente Ammonium¬
sulfat, Sulfat-Ammoniak und Sulfat-Schwefel:
233,46 g BaS04 = 132,14 g (NHJaS04 =
34,06 g Sulfat-NH3 = 32,06 g Sulfat-S.
Der Gehalt an Ammoniumsulfat darf nicht mehr als 7% be¬
tragen, entsprechend 1,8% Sulfat-NH3 und 1,7% Sulfat-S.
Wir ermittelten bei den von uns untersuchten Präparaten
2,54-8,16% Ammoniumsulfat = 0,655— 2,10% Sulfat-NH3 =
0,616—1,98% Sulfat-S (siehe Seite 35).Auch Beckurts und Frerichs fanden für den Gehalt an
Ammoniumsulfat ziemlich weite Grenzen, nämlich von 1,93%bis 12,94%, beim Ichthyol zwischen 5,72% und 6,77%.
Gall. (Nouv.Suppl. 1926) fordert 1,25—1,50% Sulfat-S (ent¬sprechend 5,15—6,18% Ammoniumsulfat), A. Ph. A. Committee
fordert 5,7—6,2%, Rem. gibt für tiirathiol 6,16%, für Ichthynat5,0—7,0% an. Nach Mitteilung der Ichthyolgesellschaft1 ent¬
hält das Ichthyol rund 6% Ammoniumsulfat.
9. Gesamtschwefel.
Die gewöhnlich angewandte Methode zur Bestimmung des
Schwefels in organischen Verbindungen ist diejenige von Carius,bei welcher die Substanz während mehrerer Stunden mit rauchender
Salpetersäure im Bombenrohr auf 300° erhitzt wird. Hinters¬
kirch2 fand, daß die Resultate nach dieser Methode beim Ichthyoloft zu niedrig ausfallen, da die Sulfosäuren durch Salpetersäurenur schwierig quantitativ oxydiert werden. Er arbeitete dann ein
eigenes Verfahren aus, bei welchem die Oxydation mit Natrium¬
superoxyd ausgeführt wird. Beckurts und Frerichs nahmen
eine gründliche Prüfung dieser Methoden vor, fanden die Methode
nach Carius bei Innehaltung gewisser Vorschriften wohl brauch¬
bar, die Methode von Hinterskirch aber für die Praxis nicht
geeignet. Helmers3 ist der Ansicht, daß manche Differenzen,
1
Privatmitteilung.2
Z. anal. Ch. 46, 241 (1907).3
Dermatologische Studien 20, 308 (1910).
- 33 -
die von verschiedenen Analytikern im Schwefelgehalt derselben
Präparate gefunden wurden, auf die angewandte Methode der
Schwefelbestimmung zurückzuführen seien, da verschiedene oder
unzuverlässige Methoden oft ungleiche Resultate bedingen.Um die Benützung eines Bombenofens zu umgehen, prüften
Beckurts und Frerichs auch die von Thal angewandte Methode
und geben nachfolgende verbesserte Ausführungsform an:
Zirka 0,5 g Substanz werden dreimal mit je 10 ccm rauchender Salpetersäure
abgedampft. Der dickliche Rückstand wird mit 5 g einer Mischung aus
4 Teilen wasserfreier Soda und 3 Teilen Salpeter verrieben. Die Mischung
wird möglichst vollständig in einen geräumigen Nickeltiegel gebracht und
die Schale mehrere Male mit einigen Tropfen Wasser nachgespült. Nach dem
Trocknen wird die Masse vorsichtig geschmolzen, die Schmelze mit heißem
Wasser aufgenommen und filtriert. Im Filtrat wird nach dem Ansäuern mit
Salzsäure die Schwefelsäure als Bariumsulfat gefällt.
Einfacher und für unsere Zwecke geeigneter erwies sich die
Methode der Gesamtschwefel-Bestimmung in Ichthyolpräparatennach A. Ph. A. Committee. Die Oxydation der organischen Substanz
wird hier mit Kaliumchlorat, konzentrierter Salpetersäure und
konzentrierter Salzsäure vollzogen. Die Methode lautet folgender¬
maßen:
0,5—1,0 g Substanz werden in einem Kjehldahl mit 20 ccm Wasser ver¬
dünnt, 5 g Kaliumchlorat und 30 ccm konzentrierte Salpetersäure dazu¬
gegeben und auf 5 ccm verdampft, dann 25 ccm konzentrierte Salzsäure
zugefügt, auf 5 ccm verdampft, nochmals 25 ccm konzentrierte Salzsäure
zugefügt und wieder auf 5 ccm verdampft, dann 100 ccm Wasser zugefügt,
zum Sieden erhitzt, mit 10 ccm Bariumchloridlösung (ca. n) versetzt und
24 Stunden stehen gelassen. Der Niederschlag wird gesammelt und geglüht.
Von der Ichthyolgesellschaft1 wird folgende Ausführungsform
dieser Methode empfohlen:
Etwa 1 g des Präparates wird mit 30 ccm Salpetersäure (spezifischesGewicht 1,40) und 5 g Kaliumchlorat in einem Jenaer Rundkolben von etwa
300 ccm Inhalt über kleiner Flamme erhitzt, bis die Flüssigkeit verdampft
ist; dann wird der eingetrocknete Rückstand im Kolben geschmolzen und
die Schmelze mit Salzsäure wiederholt abgeraucht. Der Rückstand wird in
Wasser gelöst, die Salzsäurelösung filtriert, im Filtrat die Schwefelsäure als
Bariumsulfat bestimmt und hieraus der Schwefel berechnet.
Nach dieser Vorschrift wird zur Oxydation mit Salpetersäure
und Kaliumchlorat kein Wasser gegeben. Wir stellten nach beiden
1Privatmitteilung.
Gensler-Koch. 3
— 34 —
Methoden Versuche an. Die Analysenresultate wiesen gute Über¬
einstimmung auf. Es zeigte sich aber, daß die Oxydation der
Substanz ohne Zugabe von Wasser bedeutend schneller vor sich
ging. Wir wählten deshalb für alle Untersuchungen folgendeArbeitsweise:
Zirka 0,8 g Substanz (genau gewogen) werden mit dem Wäge¬
glas in einen ca. 300 ccm fassenden Rundkolben aus widerstands¬
fähigem Glase gebracht, mit 30 ccm konzentrierter Salpetersäure
Übergossen und mit 5 g festem Kaliumchlorat versetzt. Die
Mischung wird während 3— 4 Stunden unter dem Abzug auf
dem Drahtnetz über kleiner Flamme erhitzt, bis noch ca. 5 ccm
Flüssigkeit übrig bleiben. Dann gibt man zweimal je 25 ccm
konzentrierte Salzsäure zu und verdampft jeweils wieder bis auf
ca. 5 ccm. Der Rückstand wird in heißem Wasser gelöst, die
Lösung quantitativ in ein Becherglas von ca. 600 ccm Inhalt über¬
geführt, zum Sieden erhitzt, mit 10 ccm Bariumchloridlösung(ca. n) versetzt und während 24 Stunden in der Wärme stehen
gelassen. Dann wird das abgeschiedene Bariumsulfat in einem
Porzellan-Filtertiegel gesammelt, mit heißem Wasser gewaschen,bis im Filtrat Chlorid nicht mehr nachweisbar ist, getrocknet,geglüht und gewogen. Das Bariumsulfat wird in Prozente Ge¬
samtschwefel umgerechnet:
233,46 g BaS04 = 32,06 g S.
Der Gehalt an Gesamtschwefel muß mindestens 7,25 % betragen.
Wir ermittelten bei den von uns untersuchten Handelsmustern
Gesamtschwefel-Gehalte von 7,17—10,32% (siehe Seite 35).
Der Gesamtschwefel-Gehalt der von Beckurts und Frerichs
analysierten Präparate schwankt noch innerhalb weiterer Grenzen,
von 5,3-11,3 °/0.
Gall. (Nouv. Suppl. 1926) fordert 8-10%, A. Ph. A. Comittee
mindestens 10%, Rem. gibt für Hirathiol einen Gehalt von
10,23% an- für Ichthynat 8—10%. Nach Privatmitteilung der
Ichthyolgesellschaft und der Gesellschaft für Chemische Industrie
in Basel wird der Gesamtschwefel-Gehalt für Ichthyol und Isarol
mit mindestens 10% angegeben.
— 35 -
10. Sulfid-Schwefel.
Der prozentische Gehalt an Sulfid-Schwefel kann aus den er¬
mittelten prozentualen Mengen Gesamtschwefel, Sulfat-Schwefel
und Sulfon-Schwefel nach folgender Gleichung berechnet werden:
Sulfid-S = Gesamt-S —[Sulfat-S+ Sulfon-S].
Wie nachfolgend ausgeführt wird, glauben wir, daß ein Gehalt
an Sulfid-Schwefel von mindestens 5°/0 gefordert werden darf.
11. Analysenergebnisse bei Handelsmustern.
Die uns zur Prüfung vorliegenden Handelsmuster waren:
A = Ichthyol Hamburg (Originalpräparat), Cordes, Hermanni & Co.,
Hamburg.B = Saurolo prima \
„ . ... . „ . ,. ö.. . . .. .,
„ „ . . \ S. A. Miniere Scisti Bituminosi, Mende.
C = Saurolo corrente )
D = Ichthyosulfate Codex Français (Soc. Française de sulfonation,
Paris).E = Isarol „Ciba".
Die nach den von uns im vorstehenden empfohlenen Methoden
erzielten Analysenergebnisse sind aus folgender Tabelle zu ersehen:
Tabelle I.
B
Reaktion
Chlorid
Chloroform-Alkohol
Aufstrich
d 15°/15°Trockenrückstand ...
in Prozenten
Verbrennungsrückstand in Prozenten
Gesamt-NH3 in Prozenten
Ammoniumsulfat ....in Prozenten
Sulfat -NH8 in Prozenten
Sulfat-S in Prozenten
Gesamt-S in Prozenten
Sulfon-NHa in Prozenten
Sulfon-S in Prozenten
Sulfid-S in Prozenten
= bedeutet entsprechend den Forderungen,— negativer Ausfall der Reaktion.
1,14055,67
0,06
2,95
5,82
1,50
1,41
9,99
1,45
2,72
5,87
1,126
53,81
0,04
2,45
2,61
0,67
0,63
7,17
1,777
3,345
3,20
1,140 1,169 1,145
56,48 55,82 56,43
0,24 0,15 0,03
3,65 3,82 2,80
8,16 7,20 2,54
2,10 1,856 0,655
1,98 1,746 0,616
7,97 10,32 10,06
1,55 1,964 2,145
2,918 3,69 4,04
3,08 4,88 5,41
*) schwach sauer.
*) Aufstrich körnig.
3'
— 36 —
Die Berechnung geschah nach folgender Aufstellung:1. 132,14 g (NHJ,S04 = 34,06 g Sulfat-NH, = 32,06 g Sulfat-S.
2. Gesamt-NH3 — Sulfat-NH8 = Sulfon-NH3.3. 17,03 g Sulfon-Nfi3 = 32,06 g Sulfon-S.
4. Gesamt-S —(Sulfat-S + Sulfon-S) = Sulfid-S.
In Prozenten der Trockensubstanz ergeben sich folgende Werte:
Tabelle!!.
Verbrennungsrückstand 0,107 0,078 0,424 0,26 0,053Gesamt-NH8 5,30 4,55 6,46 6,84 4,96Ammoniumsulfat 10,46 4,85 14,44 12,90 4,50Sulfat-NHa 2,69 1,25 3,72 3,32 1,15Sulfat-S 2,53 1,17 3,50 3,12 1,09Gesamt-S 17,95 13,32 14,11 18,48 17,82Sulfon-NH3 2,61 3,30 2,74 3,51 3,81Sulfon-S 4,88 6,21 5,17 6,61 7,15Sulfid-S I 10,54 5,95 5,45 8,75 9,58
In Prozenten der organischen Trockensubstanz:
Tabelle III.
1 A B C D E
17,23 12,77 12,46 17,68 17,54
5,46 6,54 6,07 7,61 7,50Sulfid-S 11,78 6,25 6,41 10,06 10,04Sulfon-NHs 2,91 3,74 3,22 4,05 3,99
12. Normierung der Gehaltsforderungen.
Vorstehende Analysenresultate zeigen, daß es schwierig ist,Pharmakopöenormen aufzustellen, die das Ichthyol und guteErsatzpräparate, welche aber unter sich wieder beträchtliche
Schwankungen in der Zusammensetzung aufweisen können, vor
unzulänglichen Nachahmungen schützen.
Da, wie aus vorangegangenen Ausführungen ersichtlich ist, der
Gehalt an Sulfid-Schwefel für den therapeutischen Wert eines
— 37 —
Präparates ausschlaggebend ist, dieser aber im Ichthyol selbst
bis jetzt am höchsten gefunden wurde, so muß das Original¬
präparat als Richtlinie für die Beurteilung der Ersatzmittel dienen.
Für Pharmakopöezwecke dürfte es sich empfehlen, für den Gehalt
an Sulfid-Schwefel gewisse Toleranzgrenzen zu gewähren. Daß
der Minimalgehalt nicht zu tief unter dem Normalgehalt des
Originalpräparates stehen darf, versteht sich von selbst.
Der Sulfid-Schwefel wird aus dem Gehalt an Gesamtschwefel
durch Subtraktion des Sulfon- und Sulfat-Schwefels ermittelt.
Sulfon- und Sulfat-Schwefel können aber weitgehenden Schwan¬
kungen unterworfen sein, je nachdem ein Präparat mehr oder
weniger weitgehend sulfuriert und von den anorganischen Salzen
(Ammoniumsulfat) mehr oder weniger befreit wurde, ohne daß
der Gehalt an Sulfid-Schwefel dadurch beeinflußt würde. Ein
hoher Gehalt an Gesamtschwefel sagt daher noch nichts aus
über den Gehalt eines Präparates an Sulfid-Schwefel. Außerdem
wäre es denkbar, daß ein Präparat, das gar kein Ammonium¬
sulfat enthielte, wohl einen verhältnismäßig niedrigen Gesamt¬
schwefel-Gehalt aufwiese, im Gehalt an Sulfid-Schwefel aber
dennoch befriedigen könnte. (Vgl. Gehalt an Ammoniumsulfat
beim Isarol.) Das Ammoniumsulfat ist wohl als ein für die
therapeutische Wirkung nicht wesentlicher Bestandteil zu be¬
trachten. Es erscheint nur als ein von der Darstellung her¬
rührendes Nebenprodukt, das an sich auch vollständig fehlen darf.
Nach dieser Überlegung erübrigt sich die Festsetzung eines
Mindestgehaltes an Ammoniumsulfat, nicht aber die Angabe eines
oberen Grenzwertes. Das Ichthyol enthält rund 6 °/0 Ammonium¬
sulfat. Daß aber ein zu hoher Gehalt den Heilwert eines Präparates
ungünstig beeinflussen kann, ist sehr gut möglich. Die körnige
Beschaffenheit der Ausstrichprobe von Saurolo corrente hängt
wohl mit dem hohen Gehalt an Ammoniumsulfat (8,16 °/0) zu¬
sammen. Der Höchstgehalt eines Präparates an Ammoniumsulfat
sollte darum unseres Erachtens nicht über 7°/0 betragen.
Um den Gehalt eines Präparates an Gesamtammoniak zu be¬
grenzen, kann man von folgender Überlegung ausgehen:
Der Gehalt an Ammoniumsulfat soll zwischen 0,0 und 7 °/0
liegen, entsprechend einem Gehalt an Sulfat-Ammoniak von 0,0
— 38 —
bis 1,8%. Die Menge an Sulfon-Ammoniak schwankt nach
unseren Untersuchungen von 1,45—2,15%. Mit zulässiger Er¬
weiterung nach unten und oben ergäbe sich 1,2—2,4%. D'e
Grenzwerte eines Gehaltes an Gesamtammoniak würden sich
demnach auf 1,2 und 4,2 °/0 stellen. Erstere Zahl würde dem
Minimum von Sulfon-Ammoniak entsprechen bei vollständigerAbwesenheit von Sulfat-Ammoniak; die obere Grenze von 4,2 °/0
entspricht der Summe der Höchstwerte von 2,4 °/0 Sulfon-
Ammoniak + 1,8 °/0 Sulfat-Ammoniak.
Wir haben also folgende Verhältnisse:
Gesamt-NH3 = Sulfon-NH3 + Sulfat-NHS
Gefunden. . . 2,45—3,82% 1,45—2,15 °/0 0,67—2,10°/«
Zulässig .... 1,2 —4,2% 1,2 —2,4 °/0 0,0 —1,8%.
Es könnten somit folgende Forderungen für Ichthyol und seine
Ersatzmittel aufgestellt werden:
Ammoniumsulfat: Höchstens 7°/o) d.h. höchstens soviel, wie
1,8 % Sulfat-NHa entspricht.Sulfat-S: Höchstens 1,7%, d.h. höchstens soviel, wie 1,8%
Sulfat-NHg entspricht.Sulfon-S: Mindestens 2,25%, d.h. mindestens soviel wie 1,2%
Sulfon-NH3 entspricht.Gesamt-S: Der Mindestgehalt ergibt sich aus folgender Auf¬
stellung:
Mindestgehalt an Sulfid-S = 5%
Mindestgehalt an Sulfat-S = 0%Mindestgehalt an Sulfon-S = 2,25%
Mindestgehalt an Gesamt-S = 7,25%.Unseres Erachtens sollte von Ersatzpräparaten des Ichthyols
ein Mindestgehalt von 5% an Sulfid-Schwefel gefordert werden.
Von den von uns untersuchten Handelsmustern entspricht diesen
Forderungen nur das Isaroi. Die Zusammensetzung des Isarols
hat sich nach früheren Analysen (Thal, Beckurts und Frerichs)verbessert. Beckurts und Frerichs geben nur 3,25% Sulfid-
Schwefel im Isarol an und 5,16% Ammoniumsulfat, Thal sogar
12,94% Ammoniumsulfat. Der Sulfon-Schwefel betrug nach
Beckurts und Frerichs 2,98%, der Gesamtschwefel 7,49%.
— 39 —
Das Ichthyosulfate Codex kommt in den Gehalten obigen
Präparaten nahe, nur enthält es nach unseren Normen zuviel
Ammoniumsulfat. Es entspricht den Anforderungen von Gall.
(Nouv. Suppl. 1926) in bezug auf Gesamtschwefel-Gehalt und
Gehalt an Sulfon-S +Sulfid-S, weist aber mit 1,746 einen zu
hohen Prozentgehalt an Sulfat-Schwefel auf.
Die von uns untersuchten, als Sauroio prima und Saurolo
corrente bezeichneten Muster entsprechen den Anforderungen,
die an ein dem Ichthyol in den Gehalten (speziell demjenigen
an Sulfid-Schwefel) nahe kommendes Ersatzmittel gestellt werden
müssen, nicht.
13. Untersuchungsmethoden der offiziellen Arzneibücher.
Wenn wir einen Überblick über die Prüfungsmethoden der
verschiedenen Pharmakopoen werfen und sie mit den von uns
im vorhergehenden aufgestellten Forderungen vergleichen, so
können wir feststellen, daß in keiner der Pharmakopoen ein
vollständiger Untersuchungsgang zur Charakterisierung des
Ichthyols und seiner Ersatzmittel zu finden ist. Vor allem werden
in keiner Pharmakopoe Forderungen aufgestellt hinsichtlich
Mindestgehalt an Sulfid-Schwefel und Methoden zu dessen Be¬
stimmung angegeben.Die Prüfungsvorschriften sind in den älteren Pharmakopoen
ganz kurz gehalten. Sie beschränken sich im Ergänzungsbuch
zum D. A. B. 1897, Belg. 1906 und Hung. 1909 auf die gewöhn¬
lichen qualitativen Prüfungen (Ausfällen der Ichthyolsulfosäure
mit Salzsäure, Nachweis von Ammoniak und Schwefelwasserstoff)
und die Angabe des Gehaltes an Trockenrückstand. Ergänzungs¬
buch zum D. A. B. 1897 und Belg. 1906 machen noch Angaben
über den Verbrennungsrückstand.Von den neueren Pharmakopoen hält sich Ital. 1929 ungefähr
auf gleicher Stufe.
Umfassendere Prüfungsvorschriften stellt Gall. (Nouv. Suppl. 1926)
auf. Wir finden dort außer den qualitativen Prüfungen noch
Methoden zur Bestimmung der Trockensubstanz, des Ammonium¬
sulfates und des Gesamtschwefels. Sie läßt dann das Ammonium-
— 40 —
sulfat in Sulfat-Schwefel umrechnen und fordert von diesem
einen Gehalt von 1,25—1,50 70 (entsprechend 5,15—6,18 °/0Ammoniumsulfat). Unseres Erachtens ist es überflüssig, einen
Minimalgehalt an Ammoniumsulfat zu fordern, da dieser Körper,wie wir schon früher angeführt haben, wohl nicht als ein für
die therapeutische Wirkung wesentlicher Bestandteil des Ichthyolszu betrachten ist. Gall. (Nouv. Suppl. 1926) läßt dann den Sulfat-
Schwefel vom Gesamtschwefel abziehen. Die Differenz ergibtdie Summe von Sulfid-S + Sulfon-S (soufre en combinaison
organique et soufre en combinaison sulfonique). Diese soll nach
Gall. 6,75—8,50% betragen. Gall, hätte unseres Erachtens noch
einen Schritt weitergehen und nicht nur die Summe von Sulfon-
und Sulfid-Schwefel normieren, sondern eine Minimalforderungfür den Sulfid-Schwefel aufstellen sollen, der nach heutigen An¬
schauungen wesentlich ist für den therapeutischen Wert des
Präparates. Da, wie unsere Analysen zeigen, auch der Gehalt an
Sulfon-Schwefel erheblich variieren kann (wir fanden 2,72—4,04 °/o)>so gibt die Summe von Sulfon-Schwefel + Sulfid-Schwefel noch
kein klares Bild über den Gehalt an Sulfid-Schwefel. Um letzteren
zu bestimmen, wird man am besten, dem Beispiel von Thal
folgend, den Gehalt an Gesamt-Ammoniak ermitteln und durch
Subtraktion des Sulfat-Ammoniaks den Sulfon-Ammoniak und
aus diesem den Sulfon-Schwefel berechnen, der dann von der
Summe des Sulfon-S + Sulfid-S abgezogen, den Gehalt an Sulfid-
Schwefel ergibt.Auf diesem Prinzip ist der Untersuchungsgang des Ichthyols
aufgebaut, den wir in den Reports of A. Ph. A. Committee1 finden.
Es werden dort genaue Vorschriften zur Bestimmung der Trocken¬
substanz, des Gesamtammoniaks, des Gesamtschwefels und des
Ammoniumsulfates gegeben, und der Mindestgehalt an Sulfid-
Schwefel im Ichthyol wird mit 5,5 % normiert.
Diese Prüfungen hat Rem. in fast unveränderter Form über¬
nommen. Der Gehalt an Sulfid-Schwefel im Hirathiol wird mit
5,73 °/o, derjenige im Ichthynat mit mindestens 5% angegeben.Wir erachten es demnach als zweckmäßig, wenn auf Grund
der in dieser Arbeit gemachten Untersuchungen auch die Pharma-
1 Journ. Am. Pharm. Ass. II, 250 (1913).
- 41 —
kopöen in Zukunft den Höchstgehalt an Sulfat-Schwefel und den
Mindestgehalt an Sulfid-Schwefel im Ichthyol und seinen Ersatz¬
mitteln normieren.
II. Steinkohlenteer.
Pix Lithanthracis.
A. Über die Arten und die Zusammensetzung
des Steinkohlenteers.
Unter Steinkohlenteer verstand man bis vor ungefähr 50 Jahren
den durch trockene Destillation der Steinkohle bei hoher Tem¬
peratur (ca. 1000 — 1100°) als Nebenprodukt der Leuchtgas¬
fabrikation anfallenden Teer. Die Bezeichnungen „Steinkohlen¬
teer" und „Gasteer" waren damals gleichbedeutend. Der Teer
schwankte nur wenig in seiner Zusammensetzung und wies nach
G. Kraemer1 folgende Bestandteile auf:
Benzol und Homologe 2,50 °/0
Phenole und Homologe 2,00 °/0
Pyridin- und Chinolinbasen 0,25 °/0
Naphthalin (Acenaphthen) 6,00 °/0
Schwere öle 20,00 °/0
Anthracen, Phenanthren 2,00 °/0
Asphalt (lösliche Bestandteile des Pechs) 38,00 °/0
Kohle (unlösliche Bestandteile des Pechs) 24,00 °/0
Wasser 4,00 °/0
Gase (Verlust bei der Destillation) .... 1,25 °/0.
Heute kennen wir außer dem Gasteer vor allem noch den
Kokereiteer, der dem Leuchtgasteer am ähnlichsten ist, ferner
noch eine Anzahl in anderen Betrieben gewonnene teerähnliche
Erzeugnisse, die sich durch die Art ihrer Gewinnung wie auch
durch ihre Zusammensetzung vom ursprünglichen Gasteer wesent¬
lich unterscheiden.
Lange Zeit hielt man es für unmöglich, durch die trockene
Destillation der Steinkohlen bei der Koksfabrikation ein dem
1 Lunge-Köhler, Die Industrie des Steinkohlenteers und des Ammoniaks,
V. Auflage, I. Bd., S. 220.
— 42 —
Gasteer gleichwertiges Produkt zu erzeugen, ohne dabei die
Qualität des Kokses zu beeinträchtigen. Erst als vom Jahre 1881
an die Koksofenanlagen große Verbesserungen erfuhren, zeigte es
sich, daß, unbeschadet der Qualität des Kokses, Teere erhalten
werden können, die in der fabrikmäßigen Ausnutzung ihrer
Destillationsprodukte dem Gasteer mindestens gleichwertig sind.
Die Teerproduktion aus der Kokereiindustrie übertrifft heute die¬
jenige der Leuchtgasfabrikation um ein Vielfaches. In Deutschland
entstammen z.B. ca. 80% der Steinkohlenteere den Destillations¬
kokereien, während nur etwa 20% auf die Leuchtgasindustrieentfallen '.
Ein weiterer aus Steinkohlen erzeugter Teer wird in großemMaße bei der schottischen Eisenindustrie als Nebenprodukt er¬
halten, wo die Hochöfen statt mit Koks mit einer geeignetenSteinkohle gespeist werden. Dieser Hochofenteer unterscheidet
sich aber durch seinen Mangel an aromatischen Kohlenwasser¬stoffen und seinen großen Gehalt an Paraffinen vom Leuchtgas¬teer. Der Hochofenteer ist für kontinentale Ausnutzung nicht
von Bedeutung.Einige Ähnlichkeit mit dem Leuchtgasteer kann der als Neben¬
produkt bei der Erzeugung von carburiertem Wassergas, der
sogenannte Wassergasteer, und der durch Zersetzung von Kohlen¬
wasserstoffdämpfen bei hoherTemperatursich bildende sogenannteölgasteer aufweisen.
Die Eigenschaften eines Steinkohlenteers sind in hohem Maßevon der bei der Destillation angewandten Temperatur abhängig2.Bei niedriger Temperatur (ca. 500°) enthält der Teer vorwiegendKohlenwasserstoffe der Paraffinreihe und der Athylenreihe. Sauer¬
stoffhaltige Benzolderivate bilden sich auch, doch sind es haupt¬sächlich solche, die noch aliphatische (Methyl-)Gruppen teils im
Benzolkern selbst (Kresol), teils den Hydroxylwasserstoff ersetzend
(Gajacol, Kreosol) tragen.Wird die Destillation der Steinkohlen aber bei hoher Temperatur
vollzogen, so finden sich im Teer wesentlich andere Körper vor.
Die Glieder der Paraffinreihe verschwinden fast völlig, es ent-
1R. Weißgerber, Chemische Technologie des Steinkohlenteers, S.30 (1923).
2
Lunge-Köhler, Steinkohlenteer, V. Auflage, S. 40.
— 43 —
stehen aus ihnen teils kohlenstoffreichere, teils wasserstoffreichere
Verbindungen. Letztere treten als Gase auf (CH4, H2). Der
dadurch freiwerdende Kohlenstoff lagert sich z. T. schon in den
Retorten ab, ein anderer Teil findet sich in feinster Verteilung
im Teer vor und bedingt dessen schwarze Farbe. Ein weiterer
Teil des Kohlenstoffs wird zur Bildung von kohlenstoffreichen,
aromatischen Verbindungen verwendet. Durch die hohe Tempe¬
ratur wird das Zustandekommen von Molekularkondensationen
begünstigt, wodurch Naphthalin, Anthracen, Phenanthren usw. ent¬
stehen. Sauerstoffhaltige Verbindungen bilden sich auch hier,
sie sind aber vorwiegend als gewöhnliches Phenol vorhanden,
während die methylierten Derivate mehr zurücktreten. Der Einfluß
der Temperatur bei der Destillation der Steinkohlen wurde durch
die grundlegenden Arbeiten von E. Born stein1 erwiesen. Er
erhielt bei einer Temperatur bis zu 450° Teere, die sich durch
hohen Gehalt an Phenolen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen,
durch fast gänzliche Abwesenheit aromatischer Kohlenwasserstoffe,
Anthracen und Naphthalin auszeichneten. Diese bei niedrigen
Destillationstemperaturen erhaltenen Teere werden als Tief¬
temperaturteere oder Urteere bezeichnet.
So finden wir also außer dem früher allein bekannten Leucht¬
gasteer heute noch die Kokerei-, Hochofen-, Wasser- und ölgas-
teere, sowie die Tieftemperaturteere als wichtige Rohmaterialien
für die Industrie vor.
Der Leuchtgasteer fand seiner antiseptischen Eigenschaften
wegen schon früh Aufnahme in die verschiedenen Pharmakopoen.
Trotzdem in neuerer Zeit der Kokereiteer dem Gasteer als gleich¬
wertig erklärt wurde, ist für medizinische Zwecke der Leuchtgas¬
teer beibehalten worden.
Der Leuchtgasteer ist aber heute auch nicht mehr das Produkt
von bestimmt umrissenerZusammensetzung wie vor20—30Jahren.
Verbesserte Ofensysteme sind auch bei der Leuchtgasfabrikation
eingeführt worden und sind im Begriffe, die alten Anlagen
langsam zu verdrängen. Ursprünglich bediente man sich zur
Destillation der Steinkohlen für die Leuchtgasfabrikation aus-
1 3. Gasbel. 49, 627/30 und 667/71 (1906).
— 44 —
schließlich der Horizontalretortenöfen. Diese werden nicht voll¬
ständig mit Kohle gefüllt, die Destillationsgase überhitzen sich
an den heißen Retortenwänden und spalten dort Wasserstoff ab,während der Kohlenstoff als feiner Ruß zurückbleibt. HoherGehalt an sogenanntem freiem Kohlenstoff und hohes spezifischesGewicht kennzeichnen die Horizontalretortenteere. Sie enthaltenviel eingeschlossenes Wasser, liefern reichlich Naphthalin und Pech,aber wenig Leicht- und Mittelöle.
Die Schwierigkeit der Beschickung und Entleerung der Hori¬
zontalretorten rief vielen Neuerungen, die über den Schrägretorten¬ofen zum Vertikalretortenofen und Kammerofen führten. Bei diesen
neueren Ofensystemen werden die Entgasungsräume vollständiggefüllt, und der Gehalt an freiem Kohlenstoff und Naphthalinverringert sich dementsprechend. Ein zu hoher Gehalt eines
Leuchtgasteeres an freiem Kohlenstoff muß demnach als Ver¬
unreinigung angesehen werden, deren Vermeidung nach neueren
Entgasungsverfahren möglich ist. Nachfolgende Tabelle nach
Constam und Schläpfer gibt den Gehalt an freiem Kohlenstofffür Teere aus verschiedenen Ofensystemen1:
Horizontalretortenteer 9,3—27,6 °/oSchrägretortenteer 10,0 —19,3%Vertikalretortenteer 1,1— 5,7 °/0Kammerofenteer 2,3— 3,0 °/oKokereiteer 2,2—10,3 °/0Wassergasteer 0,0— 4,0 °/0Ölgasteer 0,0— 4,1 %
Vertikal- und Kammerofenteere sind spezifisch leichter, enthalten
weniger freien Kohlenstoff und weniger Wasser, liefern mehr
Leicht- und Mittelöle, weniger Naphthalin und den geringerenDestillationsrückstand als Horizontalretortenteere. Die Teere aus
Schrägretortenöfen nehmen, was ihre Zusammensetzung anbetrifft,eine Mittelstellung ein zwischen Horizontalretorten- und Kammer¬ofenteeren. Folgende Tabelle zeigt den Unterschied eines Gasteeres,der bei Verwendung derselben Kohle aus einem Horizontal- bzw.
einem Vertikalretortenofen gewonnen wurde2:
1
Holde, S. 406.2
Holde, S. 407.
— 45 —
Vertikalofen Horizontalofen
Spezifisches Gewicht
Freier Kohlenstoff . .
Wasser
Leichtöl
Mittelöl
Schweröl
Anthracenöl
Pech
Verlust
ca. 1,1
2-4 °/o
2,17 °/o
5,85 °/o
12,32 °/o
11.95 °/o
15.96 °/o
49,75 °/o
2,00 °/o
ca. 1,2
ca. 20 °/o
3,5 °/„
3,1 °/o
7,68 °/0
10,15 °/o
11,54 °/o
62,00 °/o
2,03 %
Die Kokereiteere sind arm an leicht flüchtigen Kohlenwasser¬
stoffen, meist dickflüssiger und schwerer als Vertikal- und Kammer¬
ofenteere, der Gehalt an freiem Kohlenstoff ist aber nicht höher
als in diesen Teeren. Folgende Tabelle gibt die durchschnittliche
Zusammensetzung von Kokereiteeren des Ruhrgebietes wieder1:
Spezifisches Gewicht 1,145—1,191
Wasser 2,69 °/0
Leichtöl 1,38 °/0
Mittelöl 3,46 °/0
Schweröl 9,93°/0Anthracenöl 24,76 °/0
Pech 56,44 °/o
Verlust l,34°/o
Vom Braunkohlenteer unterscheidet sich der Leuchtgasteer in
erster Linie durch das spezifische Gewicht; es ist beim Gasteer
höher, liegt beim Braunkohlenteer niedriger als 1,00. Das Aus¬
sehen des Braunkohlenteers ist salbenartig, Leuchtgasteer ist
dickflüssig. Freier Kohlenstoff findet sich im Braunkohlenteer
nur in Spuren, ebenso Anthracen; Naphthalin kommt nur in
geringen Mengen von 0,1—0,2% vor. Die ersten bei einer
Probedestillation übergehenden Anteile reagieren beim Braun¬
kohlenteer sauer, beim Steinkohlenteer alkalisch. Durch diese
Eigenschaft unterscheidet sich der Steinkohlenteer auch von den
Holzteeren.
1Holde, S. 408.
— 46 —
Je nach der Verwendung des Ofensystems oder des Ent¬
gasungsverfahrens kann die Zusammensetzung des Leuchtgas¬teeres sehr variieren. Die jetzigen Prüfungsvorschriften der
Pharmakopoen tragen diesen Umständen aber zu wenig Rechnung.Sie schreiben meist nur qualitative Prüfungen vor, die wohl eine
Unterscheidung des Gasteeres vom Holzteer ermöglichen, über
die Gewinnung und Zusammensetzung des Teeres aber im Un¬
klaren lassen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn für den für
medizinische Zwecke verwendeten Steinkohlenteer in den amt¬
lichen Arzneibüchern genauere Prüfungsvorschriften angegebenund Normen für die Gehalte aufgestellt werden könnten. Es
würde so der Medizin für die therapeutische Verwendung ein
hinsichtlich der Zusammensetzung etwas besser definiertes Produkt
zugeführt und die Erfahrungen, die bei der therapeutischen Ver¬
wendung des Teeres gemacht werden, würden weniger beeinflußt
durch allzu große Variabilität in der Zusammensetzung der zur
Verwendung kommenden Teerprodukte.
B. Wichtigste Untersuehungsmethoden des
Steinkohlenteers.
An Hand der in der Technik gebräuchlichen Untersuchungs¬methoden kann die Gewinnungsart eines Teeres meist ohne großeSchwierigkeit erkannt werden.
Der technische Untersuchungsgang umfaßt in der Regel folgendePrüfungen: Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Wasser¬
gehaltes und des Gehaltes an freiem Kohlenstoff, Ausführungeiner Probedestillation mit Bestimmung des Naphthalins und der
Kreosote (saure öle) in den Destillaten.
Für pharmazeutische Zwecke können noch einige qualitativePrüfungen und Proben der Löslichkeit bzw. Mischbarkeit benützt
werden; von quantitativen Methoden kommen allermindestens
diejenigen zur Bestimmung des Verbrennungsrückstandes, des
Wassergehaltes und des Gehaltes an freiem Kohlenstoff in
Betracht.
— 47 —
1. Qualitative Prüfungen.
Die qualitativen Prüfungen für einen offizineilen Steinkohlen¬
teer können folgendermaßen formuliert werden:
1. Steinkohlenteer bildet eine in dünner Schicht braune, in dicker
Schicht schwarze, an der Luft allmählich erhärtende, zähflüssigeMasse von naphthalinähnlichem Geruch und brennendem
Geschmack.
In ähnlicher Weise wird der Teer charakterisiert in: Brit. 1914,
Helv. IV und Gall. Nach Nederl. V ist Steinkohlenteer auch in
dünner Schicht undurchscheinend.
Nach unseren Untersuchungen war ein Teer in dünner Schicht
um so undurchsichtiger, je mehr freien Kohlenstoff er enthielt.
2. Tropft man Steinkohlenteer in ein mit Wasser von 15° ge¬
fülltes Becherglas, so sinkt der Teer unter und ballt sich zu¬
sammen.
Helv. IV, D. A. B. 6, Brit. und Gall, nennen diese Eigenschaft.
3. Wird 1 ccm Teer mit 9 ccm Wasser kräftig geschüttelt und die
Flüssigkeit abfiltriert, so weist das Filtrat naphthalinartigenGeruch auf. Es muß neutral oder höchstens sehr schwach
alkalisch reagieren.
Nach Nederl. V muß das Filtrat alkalisch reagieren, nach Helv. IV
schwach alkalische Reaktion aufweisen. Nach D. A. B. 6 darf es
Lackmuspapier höchstens schwach bläuen. D. A. B. 6 verwendet
auf 1 Teil Teer 9 Teile Wasser, Nederl. V schreibt auf 1 Teil Teer
20 Teile Wasser vor, Gall, und Helv. IV geben keine Verhält¬
nisse an.
Im Teerwasser können Phenole durch folgende Prüfungen nach¬
gewiesen werden:
a) mit FeCls (0,1 n): 5 ccm Teerwasser nehmen auf Zusatz einiger
Tropfen FeCI8-Lösung eine grünliche, sofort in schmutzigbraun
übergehende Färbung an.
b) mit Bromwasser: 3 ccm Teerwasser geben mit einigen Tropfen
Bromwasser versetzt eine weiße Trübung.
Diese Prüfung findet sich in Nederl. V.
— 48 —
Als weitere Prüfung auf Phenole kann die Diazoreaktion nach
Graefe benützt werden:
2 ccm Teer werden mit 30 ccm n-NaOfi aufgekocht und filtriert.
Werden 5 ccm des Filtrates nach dem Erkalten mit 2 ccm einer
1 %'gen wässerigen Lösung von Diazobenzolsulfosäure versetzt,so muß sich die Flüssigkeit sofort rot färben.
4. Wird 1 Tropfen Teer mit 5 ccm Weingeist geschüttelt und
die Lösung filtriert, so zeigt das gelbe Filtrat stark moosgrüneFluoreszenz und läßt, auf dem Uhrglas freiwillig verdunstet,einen feinen Belag zurück.
2. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit.
Steinkohlenteer ist nur teilweise mischbar mit Alkohol, Äther
und Benzin. Die Löslichkeit in Benzol und Chloroform richtet
sich nach seinem Gehalt an freiem Kohlenstoff.
Nach Helv. IV ist Steinkohlenteer teilweise löslich in Weingeist,Äther und Benzin, zum größten Teil in Benzol und Chloroform.
Nach D. A. B. 6 ist er in Benzol und Chloroform fast völlig, in
absolutem Alkohol oder Äther nur teilweise löslich. Gall, gibtLöslichkeit in den gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln an.
NachNederl. V ist Steinkohlenteer nur teilweise löslich in Spiritus,nach Brit. fast ganz in Benzol und Chloroform, nur teilweise in
90 %igem Alkohol und Äther.
3. Spezifisches Gewicht.
Das spezifische Gewicht das Steinkohlenteers muß zwischen
1,15 und 1,20 liegen. Die Bestimmung kann in gleicher Weise
wie beim Ichthyol erfolgen (siehe Seite 25).Nach Nederl. V soll das spezifische Gewicht zwischen 1,15 und
1,25 liegen. In den andern Pharmakopoen finden sich keine
genauen Angaben darüber.
Da nach Köhler1 das spezifische Gewicht eines Teeres haupt¬sächlich von seinem Gehalt an freiem Kohlenstoff abhängt, können
1
Lunge-Köhler, S. 506.
— 49 —
durch seine Begrenzung nach oben kohlenstoffreichere Teere aus¬
geschlossen werden.
4. Verbrennungsrückstand.
Der Verbrennungsrückstand, bestimmt mit 1 g Substanz, darf
höchstens 0,1 % betragen. Beim Erhitzen entzündet sich der Teer
und verbrennt mit stark rußender Flamme.
Nach Helv. IV darf nach dem Glühen nur eine geringe Menge
Asche, nach Nederl. V nach fortgesetztem Erhitzen nahezu kein
Rückstand verbleiben. Nat. Form. 1916 läßt merkwürdigerweise
einen Verbrennungsrückstand bis 2% zu-
5. Wassergehalt.
Eine unerläßliche Prüfung zur Beurteilung eines Teeres ist die
Bestimmung seines Wassergehaltes. Bei Gas- und Kokereiteeren
wird in der Technik ein Wassergehalt von 5 % zugelassen. Für
medizinischen Gebrauch sollte der Wassergehalt eines Teeres
möglichst eingeschränkt werden, da das Wasser, das Ammoniak
enthält, Reizwirkungen auf die Haut ausüben kann.
Kommentar zu Nederl. V schreibt vor, daß der Steinkohlenteer zur
Entfernung des Ammoniakwassers während 3 Stunden in offener
Schale auf 50 °zu erwärmen ist. Brit. schreibt unter der Bezeichnung
Pix praeparata einen Teer vor, der vor Gebrauch während einer
Stunde unter häufigem Umrühren auf 50" erwärmt werden muß.
Helv. IV, Gall., D. A. B. 6 verwenden den wasserhaltigen Rohteer.
Eine quantitative Bestimmung des Wassergehaltes findet sich
unseres Wissens in keiner der Pharmakopoen.
Unseres Erachtens sollte ein für arzneilichen Gebrauch be¬
stimmter Teer nicht mehr als 1% Wasser enthalten. Wünschens¬
wert wäre die Verwendung destillierter Teere, die vom Wasser
und von den niedrig siedenden Anteilen (Benzol) befreit sind.
Der Wassergehalt der destillierten Teere soll nach P. Schläpfer1
1 °/o nie übersteigen, normalerweise soll er nur Spuren Wasser
enthalten.
1 Bulletin der Gas- und Wasserfachmänner 7, 130 (1927).
Gensler - Koch. 4
50 —
Die Technik bedient sich zur Wasserbestimmung in Teeren ver¬
schiedener Methoden, von welchen sich für unsere Zwecke aber
nur wenige eignen. Meistens wird der Wassergehalt eines Teeres
bei der Probedestillation mitbestimmt, indem das mit dem Leichtöl
übergegangene Wasser in Meßzylindern aufgefangen wird. Eine
rasch auszuführende Methode zur Wasserbestimmung, die auch
genaue Werte liefert, wird von Marcusson1 angegeben:
100 g, bei wasserreichen Teeren entsprechend weniger, werden unter Vor¬
legung eines graduierten Zylinders, der unten eng ausgezogen ist, im Sand¬oder Ölbad mit 100 ccm Xylol, das vorher durch Schütteln mit Wasser
gesättigt wurde, im Kolben unter Zugabe von Bimssteinstückchen destilliert,bis etwa 80— 90 ccm übergegangen sind und das Destillat klar abläuft;sonst destilliert man, mit 50 ccm Xylol weiter. Die Menge des Wassers wird
nach dem Ausspülen des innern Kühlrohres mit Xylol und Abstoßen der an
der obern Wandung des Zylinders haftenden Wassertropfen mit einem Glas¬stab nach kurzem Erwärmen der Vorlage und Wiederabkühlen auf Zimmer¬wärme direkt abgelesen.
Diese Arbeitsweise beruht darauf, das Wasser durch Erwärmenmit Xylol abzutreiben3. Da das Wasser in Xylol praktisch un¬
löslich ist, trennen sich die beiden Flüssigkeiten nach der Kon¬densation der Dämpfe voneinander, so daß das abgetriebeneWasser in einem geeigneten Meßgefäß direkt abgelesen werden
kann. Da das Xylol bei ca. 130° siedet, wird nur das vor¬
gebildete Wasser ausgetrieben, Zersetzungswasser entsteht noch
nicht. Das Verfahren von Marcusson wurde von Schläpfer2in folgender Weise abgeändert und verbessert:
30—40 g des gut durchgeschüttelten Teeres werden auf 0,1g genau ineinen mit Siedesteinchen beschickten Jenaerkolben von 500 ccm Inhalt ab¬
gewogen und mit 200 ccm Xylol durchmischt. Man stellt den Kolben in einSandbad und destilliert durch einen senkrecht stehenden Kühler, bis 150 ccm
übergegangen sind. Das Destillat wird in speziellen, im untern Teil engausgezogenen und mit Einteilung in Vso ccm versehenen Meßröhren auf¬
gefangen. Die übergehenden 150 ccm Xylol reichen vollkommen aus, um alle
Wassertröpfchen, die im Kühlrohr sich absetzen können, in das Meßrohr
hinunterzuspülen. Das übergegangene Xylol ist milchig getrübt. Zur Klärungwird das Meßgefäß nach Beendigung der Destillation in heißes Wasser
gehängt. Absolut notwendig ist dies nicht, da die Löslichkeit des Wassersin Xylol sehr klein ist und die Verluste durch das im Xylol verbleibendeWasser sehr gering sind. An den Wänden des Meßgefäßes allfällig hängen-
1
Lunge-Berl, S. 200.2
Bulletin der Gas- und Wasserfachmänner 7, 130 (1927).
— 51 —
gebliebene Wassertröpfchen können leicht mit einem unten mit Gummischlauch
versehenen Glasstab oder, wenn sich solche im engen Meßrohr befinden,
mit einem ausgezogenen Glasstab nach unten befördert werden. Die Ab¬
lesung erfolgt nach '/* stündigem Stehenlassen der Meßgefäße.
Die Methode ist mit einer einzigen Einschränkung allgemein
brauchbar. Enthalten die zu prüfenden Substanzen nämlich
wasserlösliche, mit dem Xylol sich verflüchtigende Anteile, so
lösen sich diese im Wasser und der gefundene Wassergehalt wird
zu hoch. Das ist z. B. bei Holzteeren, welche Aceton, Methyl¬alkohol und Essigsäure enthalten können, der Fall. Für Pharma-
kopöezwecke eignet die Xylolmethode sich ihrer Einfachheit und
Genauigkeit halber sehr gut.
6. Preier Kohlenstoff.
Zur Charakterisierung eines Teeres ebenfalls wichtig ist die
Bestimmung seines Gehaltes an sogenanntem „freien Kohlen¬
stoff". Hierbei werden unter „freiem Kohlenstoff die schwarzen,
unlöslichen Massen verstanden, welche bei der Behandlung des
Teeres mit Lösungsmitteln zurückbleiben1. Diese unlöslichen
Rückstände bestehen indessen keineswegs aus reinem Kohlen¬
stoff, sondern ihre Art und Menge ist völlig von der Natur des
angewandten Extraktionsmittels abhängig. Zur Bestimmung des
sogenannten freien Kohlenstoffs stehen verschiedene Methoden
zur Verfügung:
1. Arbeitsweise der Abteilung für Technische Chemie und Brennstoffe der
Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Zürich8.
Zirka 1 g Teer wird in ein kleines Zentrifugengläschen genau ein¬
gewogen, mit ca. 5 ccm warmem Benzol überschichtet und die Suspension
zentrifugiert. Die Extraktion und nachfolgende Abschleuderung des
Schlammes wird so oft wiederholt, bis die überstehende Lösung fast
farblos erscheint. Der Rückstand wird bei 110° getrocknet und gewogen.
2. Nach Hodurek8.
Er unterscheidet zwischen dem eigentlichen „freien Kohlenstoff" „C l"
und den bituminösen Stoffen „C II", welche zusammen mit dem freien
1 A. Spilker, Kokerei- und Teerprodukte der Steinkohle, IV. Auflage,
S. 89 (1923).2Privatmitteilung.
8Mitteilung des Instituts für Kohlevergasung, Wien 1, 9, 19, 28 (1919).
4*
— 52 —
Kohlenstoff beim Zusatz bestimmter Lösungsmittel ausfallen. C II
ist schmelzbar und zeigt beim Wiederfestwerden große Bindekraft; für
Brikettierungszwecke ist deshalb die Kenntnis des Gehaltes an C II wichtig.Das zur genauem Wertbestimmung und Kennzeichnung eines Teeres
dienende Verfahren ist folgendes: 5 g Rohteer werden mit 200 ccm Benzol
zum Kochen erhitzt und auf ein getrocknetes, gewogenes Filter gegeben.Der Filterrückstand wird mit 100 ccm heißem Benzol nachgewaschen,getrocknet und gewogen = C I + C II.
5 g filtrierter Teer (auf dem Filter bleibt C I), in gleicher Weise mit
200 ccm Benzol behandelt und filtriert, geben als Filterrückstand C II.
Die Differenz (C I + C II) — C II = freier Kohlenstoff.
3. Nach Köhler1.
10 g Teer werden mit einer Mischung von je 25 g Eisessig und Toluol
am Rückflußkühler zum Sieden erhitzt und die Flüssigkeit durch zwei
ineinandergeschobene, gewogene Filter filtriert. Man wäscht mit heißem
Toluol solange nach, bis dieses farblos abläuft und wägt die bei 120°bis zur Gewichtskonstanz getrockneten Filter zurück. Die Gewichts¬
differenz gibt den Gehalt an freiem Kohlenstoff bzw. unlöslichen bitumi¬
nösen Stoffen.
4. Nach Kraemer und Spilker2.Man erwärmt in einem Schälchen 1 g des Teers mit 5 g Anilin und
gießt die dünnflüssige Masse auf einen unglasierten, gebrannten Porzellan¬
teller, welcher die löslichen Bestandteile des Teers samt dem Anilin auf¬
saugt und den ungelösten freien Kohlenstoff als blätterige Masse zurück¬
läßt. Der Rückstand im Schälchen wird mit 2 g Pyridin nachgespült,welches gleichzeitig das schwerfluchtige Anilin aus dem Kohlenstoffkuchenentfernt. Dieser wird ohne Verlust mittels eines kleinen Holzspatels auf
ein tariertes Uhrglas gebracht und nach mehrstündigem Trocknen im
Wasserbadschrank gewogen.
Diese Arbeitsweise gilt als die für die Praxis bequemste Methode.
Etwa 80 °/o des s0 gefundenen Kohlenstoffs scheinen, wie Glüh¬
versuche im geschlossenen Röhrchen zeigen, aus reinem amorphemKohlenstoff zu bestehen. Der Rest dürfte als hochmolekulare
Kohlenwasserstoffe anzusprechen sein3.
Weißgerber4 kritisiert die Anilin-Pyridin-Methode; denn auch
nach seinen Versuchen enthält der so erhaltene Kohlenstoff noch
immer einige Prozente schwerlöslicher aber flüchtiger Substanzen.
Nach einer von ihm abgeänderten Vorschrift soll es gelingen, den
1
Dinglers Polyt. Journ. 270, 233 (1888).4
Musspratts Chemie, 4. Auflage, 8, S. 3.3
Spilker, Kokerei- und Teerprodukte der Steinkohle, IV. Auflage, S. 89 (1923).4 R. Wei ßger be r, Chemische Technologie des Steinkohlenteers,S.39 (1923).
— 53 —
Gehalt an unzweifelhaft vorhandenem freiem, amorphem Kohlen¬
stoff zu bestimmen:
1—2 g Rohteer werden im Erlenmeyer-Kolben mit 50 ccm technischem
wasserfreiem Pyridin zwei Stunden unter Rückfluß gekocht, worauf man den
noch heißen Kolbeninhalt durch ein getrocknetes, tariertes Filter durchsaugt,den auf diesem gesammelten Kohlenstoff mit etwa 100 ccm heißem Pyridin
sorgfältig auswäscht und schließlich die dem Niederschlag noch anhaftenden
Basen durch Nachwaschen mit etwa 50 ccm heißem Wasser möglichst ent¬
fernt. Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei dem Filter zuzuwenden, das
aus gehärtetem Papier bestehen soll und dessen Poren gegenüber dem meist
äußerst fein verteilten Kohlenstoff völlig undurchlässig sein müssen. Es
wird vor dem Gebrauch vier Stunden im Wasserbadschrank getrocknet, hierauf
noch etwa zwei Stunden im Exsikkator aufbewahrt und im geschlossenen
Wägegläschen gewogen. In der gleichen Weise verfährt man mit dem
beschickten Filter.
Wir stellten mit dem uns von der A.-G. vormals B. Siegfried
in Zofingen besorgten Teer des Zofinger Gaswerkes nach obigen
Methoden vergleichendeVersuche an. Die Analysenresultate stellten
sich wie folgt:freier C:
Nach der Zentrifugiermethode 21,91 °/0
Nach Köhler 24,23°/0
Nach Hodurek C I + C 11 22,86 °/0
Nach der Anilin-Pyridin-Methode .... 22,76°/0
Nach Weißgerber 21,10°/0.
Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich ist, erhielten wir
nach der Methode von Weißgerber das niedrigste Resultat;
daraus kann man schließen, daß die hochmolekularen Kohlen¬
wasserstoffe zum größten Teil herausgelöst worden sind. Die
Zentrifugiermethode ist leicht ausführbar. Beim Arbeiten nach
Köhler macht sich trotz Zugabe von Siedesteinchen fortwährend
starkes Stoßen bemerkbar. Die Anilin-Pyridin-Methode würde
wohl noch höhere Resultate geliefert haben, wenn der Kohlen¬
stoff quantitativ vom Porzellanteller entfernt werden könnte, was
aber unmöglich war. Für die Untersuchung der Handelsmuster
bedienten wir uns in der Folge immer der Methode von Wei߬
gerber, die sich auch für Pharmakopöezwecke gut eignet. Für
arzneilichen Gebrauch sollten unseres Erachtens Teere mit hohem
Kohlenstoffgehalt nicht zugelassen werden, da der Kohlenstoff
— 54 —
eine Verunreinigung des Teeres bildet. Die höchst zulässigeMenge an freiem Kohlenstoff könnte auf 5 °/o angesetzt werden.
Eine quantitative Bestimmung des Gehaltes an freiem Kohlen¬
stoff findet sich in keiner der Pharmakopoen.
7. Bestimmung der sauren Bestandteile (Kreosote) im
Rohteer.
Um für die Phenolbestimmung im Steinkohlenteer eine Probe¬
destillation zu umgehen, wurde nach der von Holde1 angegebenenArbeitsweise versucht, den Gehalt an Kreosoten direkt im Roh¬
teer zu bestimmen. Der Teer wurde zuerst durch mehrmaligesAusschütteln mit verdünnter, ca. 10°/0'ger Salzsäure von den
Basen befreit. Der so vorbehandelte Teer wurde sodann mit
2—5%iger Natronlauge so lange ausgeschüttelt, bis eine Probe
des Extraktes beim Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure
klar blieb.
Nach unsern Erfahrungen müssen aber bei dieser Methode
zwecks völliger Extraktion der Phenole die Ausschüttelungs-flüssigkeiten in so großen Mengen angewandt werden, daß ein
rationelles Arbeiten für unsere Zwecke nicht mehr möglich er¬
scheint. Zudem gestaltet sich die Trennung der Ausschüttelungs-flüssigkeit vom Teer höchst unbequem, so daß von diesem Ver¬
fahren abgesehen werden mußte.
8. Probedestillation.
Zur Ausführung der Probedestillationen wurde uns von Herrn
Prof. Dr. Schläpfer in dankenswerterweise der von ihm ver¬
besserte und für vergleichende Teerdestillationen ausprobierteApparat zur Verfügung gestellt2.
Die Destillation in einer Jenaer Glasretorte, die von uns auch
versucht wurde, ist wegen Feuergefahr nicht zu empfehlen. In
der Technik werden zur Probedestillation nur Apparate von
1
Holde, S. 368.2
Bulletin der Gas- und Wasserfachmänner 7, 132 (1927).
— 55 —
größeren Dimensionen, die dementsprechend größere Mengen Teer
beanspruchen, verwendet.
Zu der Ausführung einer Probedestillation in oben angegebenem
Apparat sei noch folgendes bemerkt1:
Um die Gefahr des Überschäumens möglichst auszuschalten,
wandten wir bei der Probedestillation aller Teere zunächst nur
die elektrische Innenheizung mit Heizwiderstand an. Von ca. 120°
an wurde dann auch noch die Außenheizung zu Hilfe genommen.
100 g der Teere wurden jeweils auf einer Schalenwage in die
Blase eingewogen, nachdem das Gewicht der leeren Blase 4- Deckel
+ Siederohr + Thermometer ermittelt worden war. Während der
Destillation wurde die Temperatur so reguliert, daß das Destillat
mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 Tropfen pro Sekunde ablief.
Nach dem Abnehmen der Leichtölfraktion wurde das Kühlwasser
abgestellt. Im Kühlmantel abgeschiedene feste Destillate werden
mit der Flamme geschmolzen und mit der jeweiligen Fraktion
vereinigt. Die Destillate wurden in kleinen, tarierten Becher¬
gläsern aufgefangen und gewogen. Fadenkorrekturen für das
Thermometer wurden nicht vorgenommen, da die Fraktionen
immer bei derselben Temperatur abgenommen wurden und die
Untersuchungen nur Vergleichsresultate liefern sollten. Das von
uns benützte Thermometer wurde so in die Apparatur eingesetzt,
daß der Quecksilberbehälter sich in der Mitte der kugelförmigen
Erweiterung des Siedegefäßes befand. Die Skalenlänge pro Grad
betrug 0,77 mm. Das Abflußrohr des Siedegefäßes befand sich
ungefähr in der Höhe von 0° der Thermometerskala.
Die Fraktionen wurden wie in der Großtechnik abgegrenzt:
bis 170° das Leichtöl
von 170° bis 230° das Mittelöl
von 230° bis 270° das Schweröl
von 270° bis 350° das Anthracenöl.
Die Menge des Rückstandes, das Pech, wird durch Differenz-
wägung ermittelt. Zur Bestimmung des Gewichtes der Leicht¬
ölfraktion wird der vorher bestimmte prozentuale Wassergehalt
vom Gesamtgewicht der Fraktion abgezogen.
1 Bulletin der Gas- und Wasserfachmänner 7, 132 (1927).
— 56 —
Die Destillation des Steinkohlenteers ergibt nach Weißgerberim Durchschnitt folgende Werte1:
Leichtöl 1 — 2°/oMittelöl 8—10°/oSchweröl 6 —10°/0Anthracenöl 16— 20°/oPech ca. 55 °/o
Gesamtdestillat ca. 40°/0.
Die Menge der einzelnen Fraktionen sowie der Gehalt an Pech
lassen über die Herkunft des Teeres Schlüsse ziehen. Wie schon
erwähnt wurde, enthalten Horizontalretortenteere weniger Leicht-
und Mittelöl und mehr Pech, während das Verhältnis bei Vertikal¬
retorten- und Kammerofenteeren gerade umgekehrt ist. Schräg¬retortenteere liegen in ihrem Verhalten ungefähr in der Mitte.
Die Kokereiteere enthalten weniger Leicht- und Mittelöle, dagegenmehr Anthracenöle.
9. Bestimmung der Kreosote und des Naphthalins.
Außer der Feststellung der Mengenverhältnisse der einzelnen
Fraktionen ermöglicht die Probedestillation noch die Bestimmungder sauren Bestandteile (Kreosote) und diejenige des Naphthalinsin den Destillaten.
Bevor zur Bestimmung des Gehaltes an Kreosoten geschrittenwerden kann, muß das im Mittel- und Schweröl ausgeschiedeneNaphthalin entfernt bzw. bestimmt werden. Das kann geschehendurch Abpressen und Trocknen nach folgender von Weißgerber2angegebenen Methode:
Das Rohöl (Mittel- und Schweröl) wird durch Einstellen der Gefäße in
kaltes Wasser auf 15° abgekühlt. Das ausgeschiedene Naphthalin wird hierauf
mit der Saugpumpe schnell vom öl getrennt und durch Aufstreichen auf
einen porösen Tonteller von 150 mm Durchmesser von den letzten Resten ölbefreit. Nach zwei Stunden wird das Naphthalin mit einem Spatel abgenommenund gewogen.
Diese Methode gibt jedoch nur Näherungswerte für den Naph¬thalingehalt. Genaue Werte erhält man nach Schläpfer und
1
Weißgerber, Chemische Technologie des Steinkohlenteers, S. 136 (1923).a
Ebenda, S. 97.
— 57 —
Flachs1 bei Anwendung der von ihnen ausgearbeiteten Pikrat¬
methode. Die Methode wird bei Teeren folgendermaßen aus¬
geführt:
Der Teer wird vorerst destilliert und dann in den gesammelten Fraktionen
bis 300° oder 350° die Naphthalinbestimmung vorgenommen. 0,2 — 0,5 g
des Öles werden in das Naphthalinbestimmungsgefäß A2
genau eingewogen.
Es ist darauf zu achten, daß man eine gute Durchschnittsprobe des zu unter¬
suchenden Öles erhält, öle mit festen Bestandteilen oder dickflüssige Produkte
sollen vor der Einwage solange erwärmt werden (50°), bis alle festen Körper
gelöst sind. Das Aufwärmen soll in geschlossenen Gefäßen geschehen. Man
verwendet vorteilhaft gewöhnliche Glasflaschen. Aus diesen Glasflaschen gibt
man eine Durchschnittsprobe in kleine Standgläser, aus welchen die Proben
mit Hilfe von ausgezogenen Glasröhrchen in das Naphthalinbestimmungsgefäß
eingewogen werden. Zu diesen eingewogenen ölmengen gibt man 5 ccm
einer 2 n-KMn04-Lösung8, dann läßt man 5 Minuten stehen und fügt hierauf
5 ccm 50°/0ige Phosphorsäure zur Bindung der basischen Bestandteile und
eventuell vorhandenen Ammoniaks zu. In das Waschgefäß B gibt man 10 ccm
einer Kalilauge 1:1 für die Zurückhaltung der Phenole. Hierauf gibt man
50 ccm einer ca. 0,05 n-Pikrinsäurelösung4 in das Absorptionsgefäß. In
das nachgeschaltete Absorptionsgefäß gibt man 15 ccm der nämlichen Lösung.
Dann werden die beiden Gefäße mit den Glasschliffen verbunden und in das
Wasserbad eingesetzt.Handelt es sich um die Bestimmung eines naphthalinreichen Öles, so ist
das Hauptabsorptionsgefäß in dem Widerstandsofen auf 40— 50° anzuwärmen.
Im allgemeinen ist es besser, wenn man die Pikrinsäurelösung immer vor¬
wärmt, da man selten weiß, ob das öl viel oder wenig Naphthalin enthält.
Das Wasserbad wird durch den Temperaturregler auf 70° gehalten. Diese
Temperatur soll nicht überschritten werden, da sonst die Gefahr besteht, daß
beim Durchleiten des Luft- oder Gasstromes Anthracen mit übergeht.
Die Gefäße A und B müssen vollständig ins Wasserbad versenkt werden.
Der Luftstrom wird mit einer Geschwindigkeit von 20 —25 Liter pro Stunde
durchgeleitet. Die Durchleitungsdauer beträgt eine halbe Stunde. Diese
Zeit soll weder über- noch unterschritten werden.
Ist der Versuch beendigt, so wird der ausgeschiedene Pikratniederschlag
sorgfältig mit 0,05 n-Pikrinsäurelösung auf eine Jenaer Glasnutsche (3 G 3/5—7)
gespült, die Gefäße nochmals mit dem Filtrat sauber nachgewaschen, damit
das Pikrat quantitativ auf die Nutsche gelangt. Dann saugt man mit Hilfe
einer Wasserstrahlpumpe scharf ab, damit keine Pikrinsäure am Pikrat haften
bleibt. Der Nutschenhals und der obere Rand werden mit Wasser leicht
1Bulletin der Gas- und Wasserfachmänner 8, Nr. 8, 9, 10 und 11 (1928).
2 Ebenda 8, 252—253 (1928).3 In einem Liter heißem, destilliertem Wasser werden 63,2 g KMn04 gelöst.
Nach dem Erkalten scheidet sich aus dieser Lösung stets etwas kristallisiertes
Permanganat ab.
4 Man löst 12 g Pikrinsäure in 200 ccm heißem, destilliertem Wasser und
füllt auf einen Liter auf.
— 58 —
gespült, da daran immer Spuren von Pikrinsäure haften bleiben. Es istdarauf zu achten, daß dieses Spülwasser nicht mit dem Nutschenboden in
i Berührung kommt, weil sonst das Naphthalinpikrat zersetzt werden könnte.Hierauf gibt man die saubere Nutsche in ein Becherglas mit 100 ccm destil¬liertem Wasser und kocht bis das Pikrat vollständig zersetzt ist. Dann nimmtman die Nutsche aus dem Becherglas, spritzt sie mit destilliertem Wasser
sorgfältig ab und gibt dieses Wasser in das Becherglas. Der Inhalt des Becher¬
glases wird nun in einen Erlenmeyerkolben gespült, unter dem Wasserhahnauf Zimmertemperatur abgekühlt und hierauf mit 25 ccm Jodlösung versetzt1.Dann titriert man mit 0,02n-Na2S203. Die Berechnung des Naphthalins er¬
folgt nach der Formel:x = (a_y). 0>00256.
x = Gramm Naphthalin,a = verbrauchte Kubikzentimeter 0,02 n-Na2S2Os,y = verbrauchte Kubikzentimeter 0,02 n - Na2S203 für 25 ccm Jodlösung.
Die Jodlösung ist vor dem Gebrauche mit der gleichen Na2S203-Lösung genaueinzustellen.
Schläpfer und Flachs glaubten anfänglich, eine Proportio¬nalität zwischen dem Gehalt der Teere an freiem Kohlenstoffund an Naphthalin finden zu können. Das war aber nicht der
Fall. Es konnte nur konstatiert werden, daß ein Teer mit viel
freiem Kohlenstoff gewöhnlich auch mehr Naphthalin enthält
als ein solcher mit wenig freiem Kohlenstoff. Wir fanden das bei
unseren Untersuchungen bestätigt. Wie Tabelle Seite 63 zeigt,entsprechen den Teeren aus älteren Ofensystemen (Zofingen,St. Gallen) mit 21,10% bzw. 13,45 % freiem Kohlenstoff 34,0%bzw. 33,90% Naphthalin im Mittel- und Schweröl, während in den
Teeren aus neueren Ofensystemen (Luzern, Baden) mit 4,05 %bzw. 1,91% freiem Kohlenstoff 22,2% bzw. 24,9% Naphthalinim Mittel- und Schweröl gefunden wurde.
Die Bestimmung der Kreosote oder „sauren öle" geschiehtmit dem vom Naphthalin befreiten öl.
Von den Pharmakopoen gibt nur Gall, eine Angabe über die
Bestimmung der Kreosote im Steinkohlenteer; ihr Gehalt kann
ermittelt werden durch Ausschüttelung der von 160—220u über¬
gehenden Anteile mit Natronlauge. Gall, empfiehlt, wasserreicheTeere vor der Destillation in einer Schale auf 160° zu erhitzen.
130 g KJ03 + 120 g KJ + 1000 g H20. Der Titer der Lösung ist öfters
zu kontrollieren.
— 59 —
Ob aber bei solchem Vorgehen nicht auch Kreosote sich ver¬
flüchtigen, ist fraglich.Alle Verfahren, deren sich die Technik zur Bestimmung des
Kreosotgehaltes in den Destillaten bedient, beruhen auf dem Ver¬
halten der Kreosote gegen Natronlauge. Eine einheitliche Vorschrift
für die Stärke der anzuwendenden Lauge besteht aber nicht.
Bei Verwendung von starker Lauge von 38° Bé. (32,47%).der sogenannten Zwischenschichtsbestimmung im Kreosotrohre,
bilden sich nach dem Schütteln der öle mit der Lauge drei
Schichten; unten die überschüssige konzentrierte Lauge, in der
Mitte die Kreosotnatriumschicht, nach deren Volumen der Gehalt
an „sauren ölen" bestimmt wird, und oben das nicht ange¬
griffene öl.
Verdünnter Lauge von 13° Bé. bedient man sich bei der
Differenzmethode *:
100 ccm öl werden mit 100 ccm 9 °/0 iger Natronlauge (d = 1,1) geschüttelt.
Je 1 ccm Zunahme der Laugenschicht wird mit l°/0 als saure öle in Rechnung
gestellt. Zur genauem Bestimmung wird die Lauge vom öl getrennt, auf
dem Wasserbad eingedampft, bis auf Zusatz von Wasser keine Trübung mehr
erfolgt, nach dem Erkalten mit Salzsäure angesäuert und mit Kochsalz aus¬
gesalzen. Das Volumen der ausgeschiedenen Phenole wird gemessen und
für jeden Kubikzentimeter 1 °/0 in Rechnung gestellt. Das Mittel aus beiden
Bestimmungen gilt als wahrer Gehalt an sauren Ölen.
Ein Übelstand dieser beiden Methoden besteht aber darin, daß
die Natronlauge nicht nur Kreosote aus dem öl herauslöst, sondern
auch Nichtkreosote in sich aufnimmt, die dann das Resultat er¬
höhen. Durch das Klardampfen auf dem Wasserbad, welches die
Differenzmethode für genauere Bestimmungen vorschreibt, werden
freilich bei Leicht- und Mittelölen die Nichtkreosote verjagt, nicht
aber beim Carbolöl, wo die mitgelösten Nichtkreosote auf dem
Wasserbad nicht mehr flüchtig sind, sondern mit Wasserdampf
auf dem Sandbad ausgeblasen werden müssen.
Um ein Mitübergehen von Nichtkreosoten in die Kreosotnatrium¬
schicht möglichst zu vermeiden, wird zur Verbesserung der
Differenzmethode ein Verdünnen des Öles mit leichten Kohlen¬
wasserstoffen (Benzol, Xylol) empfohlen. Die Zugabe von Kohlen-
1Holde, S. 417 (1924).
— 60 —
Wasserstoffen erleichtert bei viskosen ölen auch die Mischbarkeitmit Lauge und führt eine schärfere Trennung der Schichten herbei.
Eine gravimetrische Methode sucht das Klardampfen zu ver¬
meiden, indem durch Ausäthern der Kreosotnatronlauge die Nicht-
kreosote entfernt werden. Die Kreosotlauge wird hierauf durch
Säure zersetzt, die sauren öle werden in Äther aufgenommen,auf dem Wasserbad vom Äther befreit und zur Wägung gebracht.Daß aber bei diesem Eindampfen in offener Schale sich außer
dem Äther auch Kreosote verflüchtigen können, ist unzweifelhaft.Der Fehler wird dadurch einigermaßen aufgewogen, daß die Kreosotedie Fähigkeit haben, Lösungsmittel zurückzuhalten.
Aus allen diesen Methoden ist zu ersehen, daß sie nicht un¬
bedingt genaue Resultate liefern. Einer gründlichen Untersuchungvon Lazar1 verdankt man sowohl die Vorschrift für eine ver¬
besserte Differenzmethode als auch für eine genaue gravimetrischeMethode.
Bei Untersuchungen von Urteerdestillaten, die einen weit höheren
Kreosotgehalt aufweisen als die fiochtemperaturteere, fiel ihm der
große Unterschied in den Resultaten, je nachdem er mit starker
oder schwacher Lauge arbeitete, auf. Sie waren am höchstennach der Zwischenschichtsbestimmung mit konzentrierter Lauge,am niedrigsten nach der gravimetrischen Methode. Lazar stellte
weiter fest, daß bei der Differenzmethode die Kreosotnatron¬
lösungen jeder Stärke nicht nur Nichtkreosote aus den ölen
mitlösen, sondern sogar gewisse Mengen des zur Verdünnung an¬
gewandten Lösungsmittels festhalten. Bei der Zwischenschichts¬
bestimmung scheinen die Kreosotnatronsalze ganz besonders die
Eigenschaft zu haben, gewisse ölbestandteile, die keine Kreosote
sind, an sich zu reißen. Wahrscheinlich sind es diese Substanzen,welche ihrerseits wieder das Benzol oder Xylol festhalten. Wirddie Kreosotnatronlauge nämlich der Destillation unterworfen, so
können im Destillat leicht kleinere oder größere Mengen Ver¬
dünnungsmittel (Benzol, Xylol) nachgewiesen werden. Lazar
schlägt darum zur Verbesserung der Differenzmethode vor, die
Konzentration der Lauge nicht über 5% zu wählen und nach
Ablesung der Volumzunahme der Laugenschicht diese im Scheide-
1 Chem. Ztg. 45, 197 (1921).
— 61 —
trichter vom ungelösten öl abzutrennen und der Destillation zu
unterwerfen, bis außer dem Verdünnugsmittel noch 3 ccm Wasser
übergegangen sind. Das Destillat wird in unten eng ausgezogenen
Meßgefäßen, wie sie zur Wasserbestimmung verwendet werden,
aufgefangen, und die Menge des überdestillierten Verdünnungs¬
mittels vom ersten Ablesungsergebnis abgezogen.DurchVersuche zeigte Lazar weiter, daß bei der gravimetrischen
Methode das Ausäthern der Kreosotnatronschicht zwecks Ent¬
fernung der Nichtkreosote vorsichtig zu geschehen hat, um Ver¬
luste an Phenol-Kresol- Na- Salzen, die in schwachen Laugen
immer z. T. dissoziiert sind, zu vermeiden. Ferner soll das Ab¬
dampfen der ätherischen Kreosotlösung nicht mehr in einer offenen
Schale, sondern in einem Kölbchen geschehen. Die von Lazar
empfohlene gravimetrische Methode lautet nun folgendermaßen:
Man ermittelt durch eine Differenzbestimmung den ungefähren Kreosot¬
gehalt des zu untersuchenden Öles, wägt sodann in einen Scheidetrichter
25 g öl, auf 0,1 g genau ab, extrahiert dreimal mit je der berechneten Menge
5 °/o iger Natronlauge, zieht die vereinigten Laugen mit wenig Äther zweimal
aus, zersetzt dann die ölfreie Kreosotnatronlauge mit verdünnter Schwefel¬
säure und entzieht sodann der Flüssigkeit die reinen Kreosote durch zwei- bis
dreimaliges Ausäthern. Die vereinigten Ätherextrakte werden mit Na2S04 sicc.
getrocknet. Man tariert ein Siedekölbchen von 50 ccm Inhalt auf 0,1 g
genau, setzt einen Tropftrichter mit gut abdichtendem Kork auf und filtriert
die ätherische Lösung in den Trichter. Man läßt nun die Lösung in den
Kolben einfließen, indem man immer schon auf dem Wasserbad unter guter
Kühlung den Äther abdestilliert, Filter und Tropftrichter werden mit Äther
nachgespült. — Wenn auf dem Wasserbad nichts mehr übergeht, entfernt
man den Kühler und schiebt über das Ansatzrohr des Kölbchens ein Reagens¬
glas, das man mit einer kleinen Drahtschlinge am Kolbenhals befestigt. Den
Tropftrichter ersetzt man nun durch ein Thermometer, das anfangs so weit
heruntergeschoben wird, daß es in die Flüssigkeit eintaucht. Man erhitzt
nun ganz allmählich mit kleinem Flämmchen, bis die Temperatur der Flüssig¬
keit auf 150° gestiegen ist; dann zieht man das Thermometer in die gewöhn¬
liche Destillierstellung und kann es nun durch weiteres vorsichtiges Erhitzen
ohne Verlust an Kreosot dahin bringen, daß die Kreosotdämpfe allmählich
bis an die Thermometerkugel steigen und die letzten Reste von Lösungsmittel
vor sich hintreiben. Dann entfernt man die Flamme, läßt abkühlen und wägt.
Das mittlere Molekulargewicht der Kreosote nimmt Lazar zu
120 an. 100 ccm 5°/0ige Natronlauge können daher 15 g Kreosote
binden. Für unsere Untersuchungen wählten wir die oben an¬
gegebene gravimetrische Methode. Glaszylinder von 200 ccm
Inhalt mit genauer Einteilung in 1j2 ccm, wie sie Lazar zur Aus-
— 62 —
führung der Differenzmethode vorschreibt, standen uns nicht zur
Verfügung.Wir bestimmten auf diese Weise den Gehalt an Kreosoten in
der Gesamtmenge von Leicht-, Mittel- und Schweröl.
Um die Menge der zur Ausschüttelung der Kreosote not¬
wendigen Lauge einigermaßen festzustellen, rechneten wir mit
einem Maximalgehalt von 30 % Kreosoten in den ölen. 10 göle erfordern somit 20 ccm 5% ige Natronlauge zur einmaligenAusschüttelung. Die Methode von Lazar gestaltet sich für unsere
Untersuchungen folgendermaßen:Das vom Naphthalin befreite Mittel- und Schweröl wird mit
dem vom Wasser abgetrennten Leichtöl möglichst quantitativ in
einen Scheidetrichter gebracht und auf 0,1 g genau gewogen. Die
vereinigten öle werden dreimal je mit der berechneten Menge5°/0iger Natronlauge kräftig geschüttelt. Die Kreosotlauge wird
in einem zweiten Scheidetrichter zweimal mit je 20 ccm Äther
zur Entfernung der Nichtkreosote ausgezogen, mit verdünnter
Schwefelsäure bis zur sauren Reaktion versetzt und hierauf
zweimal mit je 50 ccm und zweimal mit je 25 ccm Äther extrahiert.
Die weitere Behandlung der Lösung geschieht genau nach vor¬
stehender Methode.
C. Untersuchung von Handelsmustern.
Nach den hier ausgewählten Arbeitsmethoden gelingt es leicht,den Wert eines Teeres abzuschätzen und seine Herkunft fest¬
zustellen.
Es lagen uns zur Untersuchung fünf verschiedene Steinkohlen¬
teere vor. Vier davon stammten aus schweizerischen Gaswerkenmit durchweg verschiedenen Ofensystemen (Zofingen, St. Gallen,Luzern, Baden).Wir verdanken den Leitungen dieser Gaswerke die Überlassung
des Materials sowie die Mitteilungen über die in diesen Werken
in Betrieb stehenden Ofensysteme.Zofingen arbeitet mit Horizontalretorten älteren Systems.In StGallen finden ausschließlich Schrägretorten Verwendung.
Der Teer, der uns von dort zugeschickt wurde, wurde bezeichnet
— 63 —
als anormal stark wasserhaltig. Normalerweise soll er nicht mehr
als 5 °/0 Wasser enthalten. Der Teer wurde vor der Untersuchung
vom überstehenden Wasser, das ungefähr 10% des Teergewichtes
ausmachte, abgetrennt.Das Gaswerk Luzern arbeitet mit Horizontalkleinkammeröfen
neuen Systems, die vollständig mit Kohle gefüllt werden.
Die Stadt Baden verwendet Vertikalkammeröfen.
Der fünfte untersuchte Teer war ein Kokereiteer und wurde
uns aus der Anlage „Neumühl" bei Düsseldorf in dankens¬
werterweise zur Verfügung gestellt1.Wir benützten zur Wasserbestimmung die Methode von
Schläpfer, zur Bestimmung des freien Kohlenstoffs die Methode
von Weißgerber, für die Probedestillation die Methode von
Schläpfer, zur approximativen Bestimmung des Naphthalins die
Methode von Weißgerber, zur Bestimmung der Kreosote die
Methode von Lazar.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Analysenergebnisse der Unter¬
suchungen.ö Herkunft der Teere.
1. 2. 3. 4.
Zofingen St. Gallen Luzern Baden
1,217 1,182 1,151 1,145
3,05 5,30 1,05 2,77
21,10 13,45 4,05 1,91
0,05 0,11 0,03 0,09
1,7 1,5 2,0 2,1
6,1 6,1 10,2 10,0
8,9 11,0 10,7 8,8
12,6 14,9 15,7 16,3
32,4 38,8 39,7 40,0
66,0 60,3 59,1 58,5
1,6 0,9 1,2 1,5
34,0 33,9 22,2 24,9
5,1 5,8 4,6 4,7
20,40 19,4 17,9 19,6
5.
Kokereiteer
Spez. Gewicht 15° /15°°/o Wasser
°/o freier C
°/o Asche
°/o Mittelöl . .
°/o Schweröl. •
°/o Anthracenöl
in¬
klusive tiaO
°/o Pech
°/o Verlust
°/o Naphthalin in Mittel-
und Schweröl ....
°/o Naphthalin im Teer*
°/o Kreosote in Leicht-,Mittel- und Schweröl
1,165
3,57
2,81
0,15
0,6
3,2
11,1
21,5
40,0
58,8
1,2
34,7
4,9
19,1
1 Durch die freundliche Vermittlung von Herrn Prof. Dr. E. Ott, dem wir
auch an dieser Stelle für die mannigfachen Auskünfte, durch welche er diese
Arbeit gefördert hat, bestens danken möchten.
2 Berechnet aus dem Naphthalingehalt des Mittel- und Schweröls.
- 64 —
Zu den qualitativen Prüfungen dieser Teere ist folgendes zu
bemerken:
Alle Teere zeigten nach Schütteln von 1 Tropfen Teer mit 5 ccm
Weingeist ein gelbes Filtrat von schöner moosgrüner Fluoreszenz.
Das Filtrat, auf dem Uhrglas verdunstet, ließ einen feinen Belagzurück.
Die Farbe des Teerwassers war bei Teer 1 und 2 rötlich, bei
Teer 3, 4 und 5 gelb bis gelbbraun. Das Teerwasser der Teere 1,2 und 4 reagierte alkalisch, dasjenige der Teere 3 und 5 neutral.
Der pH des Teerwassers war bei Teer 1, 2 und 4 über 8,8;mit Thymolblau konnte die Färbung nicht mehr identifiziert werden ;bei Teerwasser 3 betrug der pH ca. 8,0, bei Teerwasser 5 ca. 7,4.
Die Analysenergebnisse geben die Eigenschaften der unter¬
suchten Teere gut wieder:
Die Teere aus Öfen älteren Systems (Zofingen und St. Gallen)zeigen hohes spezifisches Gewicht, hohen Kohlenstoffgehalt, ver¬
hältnismäßig weniger Leicht- und Mittelöle, höheren Naphthalin¬gehalt und höheren Pechrückstand.
Die Teere aus Öfen neueren Systems (Baden und Luzern)weisen niedrigeres spezifisches Gewicht auf, kleinern Gehalt an
freiem Kohlenstoff und mehr Leicht- und Mittelöle.
Der Kokereiteer zeigt wieder ein etwas höheres spezifischesGewicht. Sein Kohlenstoffgehalt ist aber nicht höher als bei
guten Gasteeren. Die Fraktionen von Leicht- und Mittelölen sind
etwas kleiner, die Ausbeute an Anthracenöl dafür bedeutend größer.
D. Normierung der Gehaltsforderungen für
den medizinisch verwendeten Steinkohlenteer.
Es bietet gewisse Schwierigkeiten, die Menge der einzelnen
Bestandteile eines so komplizierten Stoffgemisches wie des Stein¬
kohlenteers zu normieren ohne genauere Kenntnis der Wirkungs¬weise und des therapeutischen Wertes der einzelnen Komponenten.
Der Steinkohlenteer besitzt antiseptische Eigenschaften und ver¬
dankt dieselben seinem Gehalt an Phenolen und Kresolen. Ein
wichtiger Anteil an der therapeutischen Wirkung soll bei der Ver-
— 65 —
wendung des Steinkohlenteers in der Dermatologie diesen Stoffen
zukommen. Sie besitzen nach K. Fürst1 anästhesierende und
juckstillende Eigenschaften. Zugleich sind sie ein starkes Gift
gegen Hautparasiten.Den Kohlenwasserstoffen der Benzol-Naphthalin-Anthracen-
Phenanthren-Reihe soll die Heilwirkung bei Dermatosen zu¬
kommen. Die Methylnaphthaline besitzen nach Vieth2 ein hohes
Durchdringungsvermögen für die Haut und härten sie beim
Einreiben.
Daneben kommen dem Steinkohlenteer noch Wirkungen auf
die Haut zu, die in ihrem Wesen noch ganz unklar sind.
Der Steinkohlenteer kann aber auch unerwünschte Wirkungen
äußern. Bei Behandlung großer Körperflächen mit Teer sind oft
Vergiftungserscheinungen beobachtet worden, die auf Phenole
zurückgeführt werden. Außerdem kann der Teer örtliche Reizungen
auf der Haut erzeugen, die sowohl durch die Atzwirkung der Phenole
und Kresole, als auch durch die Verstopfung der Ausführungsgänge
der Talgdrüsen durch die klebrigen Pechbestandteile verursacht
sein können und im einen Fall Entzündungserscheinungen, im
anderen die Teerakne hervorrufen. Einen weiteren giftigen Be¬
standteil des Steinkohlenteers bilden die Pyridinbasen.
Bei der Normierung der Gehaltsforderungen ist vorgenannten
Eigenschaften soweit wie möglich Rechnung zu tragen.
Eine der wichtigsten Forderungen liegt unseres Erachtens darin,
den Gehalt an freiem Kohlenstoff möglichst einzuschränken.
Er gilt als Verunreinigung des Teeres und wird in den neueren
Ofensystemen nur mehr in kleiner Menge gebildet. Es dürfte
im wesentlichen der sogenannte freie Kohlenstoff sein, den man
unter den klebrigen Pechbestandteilen zu verstehen hat, welche
nach Fürst das Eindringen der flüssigen Teerbestandteile in die
Haut verhindern und ihre Ausführungsgänge verstopfen. Die
Normierung seines Gehaltes auf maximal 5°/0 scheint uns demnach
1 K. Fürst, Grundriß der Arzneimittellehre für die Behandlung von Haut¬
krankheiten, S. 105 (G. Thieme, Leipzig 1928).2 Vieth, Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teers und die
Darstellung des Anthrasols, Therapie der Gegenwart 1903.
Oensler-Koch. 5
— 66 -
berechtigt. Diese Forderung kann von Teeren aus neueren Ofen¬
systemen leicht erfüllt werden. Die Analysen der Teere von
Luzern und Baden aus neuern Ofensystemen ergaben 4,05 °/0bezw. 1,91 % freien Kohlenstoff. In der Literatur wird der Gehalt
an freiem Kohlenstoff aus Vertikalretorten mit 1,1 —5,7%. der¬
jenige aus Kammeröfen mit 2,3— 3°/0 angegeben.Obiger Forderung an freiem Kohlenstoff entsprechend kann
auch das spezifische Gewicht normiert werden. Nederl. V gibtdas spezifische Gewicht eines Steinkohlenteers mit 1,15—1,25 an.
Hohes spezifisches Gewicht kommt aber nur den Teeren mit
hohem Kohlenstoffgehalt aus älteren Ofensystemen zu. Da wir diese
Teere für arzneilichen Gebrauch ausschließen, schlagen wir vor,das spezifische Gewicht auf 1,15—1,20 festzusetzen.
Es ergibt sich weiter die Notwendigkeit, den Gehalt an Wasser
im Steinkohlenteer zu normieren. Da das Wasser, wie schon
erwähnt, Ammoniak, der Reizwirkungen auf die Haut ausüben
kann, und daneben noch die giftigen Pyridinbasen enthält, erscheint
es vorteilhaft, seine Menge in dem für den arzneilichen Gebrauch
bestimmten Steinkohlenteer auf ein Minimum zu beschränken.
Es ist wünschenswert, hauptsächlich destillierte Teere zu ver¬
wenden, die nur mehr Spuren von Wasser enthalten. Wir schlagendeshalb vor, den zulässigen Maximalgehalt an Wasser im Stein¬
kohlenteer auf 1% zu normieren. Wie uns die Analyse des
Teeres von Luzern zeigt, können dieserForderung auch undestillierte
Teere aus neueren Ofensystemen genügen.Der Aschengehalt des Steinkohlenteers kann mit maximal
0,1% normiert werden.
Eine weitere Aufgabe besteht darin, den Mindestgehalt an
Kreosoten im Steinkohlenteer festzusetzen.
Da den Kreosoten, wie vorher angegeben, antiseptische und
therapeutische Eigenschaften zukommen, erscheint eine Gehalts¬
forderung angezeigt. Die Normierung stößt aber bei der Ver¬
schiedenheit der einzelnen Teere auf Schwierigkeiten, und wir
müssen die Grenzen hier weiter fassen. Auf Grund unserer
Untersuchungen könnte jedoch gefordert werden, daß der Gehalt
an Kreosoten in der Gesamtmenge von Leicht-, Mittel- und
Schweröl nicht weniger als 15% betragen darf.
— 67 —
Auch dem Naphthalin kommen Heilwirkungen zu. Unseres
Erachtens erübrigt es sich jedoch, eine Bestimmung des Naphthalins
und eine Normierung des Gehaltes für Pharmakopöezwecke ins
Auge zu fassen. Einerseits deswegen, weil die Methode von Wei߬
gerber ungenau, die genaue Methode von Schläpfer und Flachs
hingegen ziemlich umständlich ist und andererseits deswegen,
weil einem niederen Gehalt an freiem Kohlenstoff (maximal 5%)»
wie er für den medizinisch verwendeten Teer zweckmäßig er¬
scheint, auch ein relativ niederer Naphthalingehalt entspricht.
Auf .Grund vorstehender Ausführungen erscheint es möglich,
Forderungen und Gehaltsnormen für den für arzneiliche Zwecke
bestimmten Steinkohlenteer aufzustellen, durch welche dieses so
außerordentlich komplizierte und in seiner Zusammensetzung
variierende Produkt wenigstens in bezug auf einige, für die
Wirkung wesentliche Hauptbestandteile normiert wird.
III. Holzteere.
Die Holzteere werden bei der Darstellung der Holzkohle durch
trockene Destillation des Holzes zusammen mit dem Holzessig
als flüssige Nebenprodukte gewonnen.
Die Industrie der Holzverkohlung teilt sich in zwei Gebiete,
in das der Laubholzverkohlung und in das der Nadelholzver-
kohlung. Je nach Anwendung dieser verschiedenen Holzarten
werden verschiedene Teere erhalten, die wieder eine verschiedene
technische Verwendung finden. Als Rohmaterial für die Laub¬
holzverkohlung eignen sich vor allem Buche, Birke, Eiche und
Ahorn. Daneben finden aber noch eine Reihe anderer Holzarten
Verwendung, wie Platane, Ulme, Erle, Esche, Pappel, Linde usw.
sowie Holzabfälle der verschiedensten Betriebe. Von Nadelhölzern
werden in Europa hauptsächlich Pinusarten, P.maritima, P.Pinaster,
P. sylvestris, ferner Abietineen, wie A. pectinata und A. grandis
und die Lärche. Larix decidua, herangezogen, während Nord¬
amerika die dort heimischen Nadelhölzer, besonders Pinus Strobus
und Larix Americana verarbeitet.
Das Holz beider Gruppen besteht in der Hauptsache aus Wasser,
5*
— 68 —
Cellulose und Lignin. Auf der Einlagerung des Lignins aus den
kolloiden Substanzen der Zellsäfte in dieCellulosemembran beruht
die Verholzung. DasLignin steht chemisch wahrscheinlich den Gerb¬
stoffen nahe. Seine Zusammensetzung ist nicht restlos aufgeklärt.Bei langsamem Erwärmen des Holzes unter Luftabschluß (bis
ca. 280°) erhält man zuerst ein wässeriges Destillat, dem sich
bald Essigsäure beimischt. Dabei bildet sich aus der Cellulose
nur Essigsäure, während das Lignin Methylalkohol, Aceton und
Essigsäure liefert. Bei größerer Hitzeeinwirkung (bis ca. 400°,der Endtemperatur derHolzverkohlung) erfahren die Cellulose und
das Lignin weitgehende Aufspaltungen. Wasserstoff und Sauer¬stoff des Cellulosemoleküls spalten sich ab und vereinigen sich
teils miteinander, teils mit dem Kohlenstoff; diese Verbindungengehen wieder Kondensationen ein, so daß am Ende der Destillationeine große Anzahl chemischer Körper vorliegt, deren Zusammen¬
setzung restlos aufzuklären bis heute noch nicht gelungen ist.
In den Holzteeren sind im Gegensatz zum Steinkohlenteer viel
saure Verbindungen vertreten, so daß das Teerwasser saure Re¬
aktion zeigt. Ferner finden sich aliphatische Alkohole, Aldehydeund Ketone vor, ferner Phenole und leichte Kohlenwasserstoffe,während nach H. Abraham1 Schwefel, Naphthalin und Paraffine
gänzlich fehlen.
Die Gewinnung der Holzkohle war früher allgemein das Ziel
der trockenen Holzdestillation, die lange Zeiten hindurch in sehr
primitiver Weise in Gruben im Walde ausgeführt wurde. Dieanderen Destillationsprodukte, Gase, Holzessig und Teer wurdennicht aufgearbeitet und gingen verloren. Eine Wendung trat erst
gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein, als man sich näher für
die industrielle Ausnützung der Nebenprodukte zu interessieren
begann. Die Grubendestillation wurde durch die Meiler ersetzt,und diese wurden später durch Öfen abgelöst. Parallel mit den
Erfolgen in der Steinkohlenindustrie konstruierte man auch für
die Holzdestillation Retortenöfen, die aus einer größeren Anzahl
Retorten von kleinem Fassungsvermögen bestanden. Dieses
System wurde erst verlassen, als in Amerika und Schweden
Verkohlungsapparate aufkamen, die die Verkohlung großer Holz-
1 H. Abraham, Asphalt and Allied Substances, 1920, siehe Holde, S. 447.
- 69 -
mengen auf einmal gestatten. In dem Maße, als um die Mitte
des letzten Jahrhunderts die wissenschaftliche Forschung fort-
schritt, wurde auch in die chemische Zusammensetzung der bei
Holzdestillation sich bildenden Produkte mehr Licht gebracht.Aus dem Holzessig konnten reine Essigsäure und Methylalkohol
gewonnen werden, wobei hauptsächlich die Essigsäure, dank der
durch die Teerfarbenindustrie neu erstandenen Absatzgebiete,immer genügend Nachfrage fand. Da die Laubhölzer viel mehr
rohen Holzessig liefern als die Nadelhölzer, wandte man der
technischen Vervollkommnung der Laubholzdestillation bald das
größere Interesse zu.
Das zweite flüssige Produkt der Holzdestillation bildet der
Holzteer. Man bezeichnet damit diejenigen Substanzen, die sich,
in Dampfform durch die heißen Gase mitgerissen, in den Kühl¬
rohren gemeinsam mit dem Holzessig kondensieren und sich
beim Lagern meist unterhalb des Holzessigs als schwarzbraune,
dicke Flüssigkeit absondern. Bei der gemeinsamen Kondensation
von Holzessig und Holzteer werden vom Holzessig manche Teer¬
bestandteile aufgelöst, während der Holzteer imstande ist, kleinere
oder größere Mengen Essigsäure in sich aufzunehmen. Der sich
vom Holzessig in der Ruhelage abscheidende Teer wird Absetz¬
teer genannt. Um den Holzessig von den in ihm gelösten Teer¬
bestandteilen zu trennen, wird er destilliert und die in der
Destillationsblase zurückbleibende teerige Masse wird Blasenteer
genannt. Er ist in seinen Eigenschaften vom Absetzteer wesentlich
verschieden. Eine Übersicht über die Zusammensetzung der
Absetz- und Blasenteere von Laub- und Nadelholz gibt folgendeTabelle : Laubholzteer Nadelholzteer (Kienteer)
Absetzteer
Essigsäure . . . 2,0 °/o
Holzgeist . . . . 0,6 °/„Wasser
. . . . . 18,0 °/oLeichtöle . . . . 5,0 °/oSchweröle . . . 10,0 °/o
Holzteerpech . . 62,0 °/oGase usw. . . . 2,4 °/o
1 M. Klar, Technologie der Holzverkohlung, S. 57 (1923).
Blasenteer
Essigsäure . . . 8,0 °/0Wasser 32,0 °/0
Hartpech und
Gase 60,0 °/o
Absetzteer
Holzessig .... 12,0 °/0
Terpene 30,0 °/0Nadelholzteer . 58,0 °/0
— 70 —
Die Nadelhölzer enthalten außer Wasser, Cellulose und Ligninnoch Terpentinöl und harzige Substanzen, meist Anhydride der
Abietinsäuren. Manche Nadelhölzer weisen einen Gehalt an
Terpentin und Harz auf, der bis 20% vom Holzgewicht aus¬
machen kann. Deshalb richtete man in der Technik das Augen¬merk darauf, diese Substanzen auf dem Wege der Destillation
zu gewinnen und ein dem amerikanischen Terpentinöl möglichstnahekommendes Ersatzmittel herzustellen.
Bei der Destillation von harzreichem Nadelholz bilden sich drei
teils aufeinander folgende, teilweise aber auch nebeneinander
verlaufende Prozesse1:
1. Die Verflüchtigung des fertig gebildet vorhandenen Terpen¬tinöles durch die aus dem Wassergehalt des Holzes sich
entwickelnden Wasserdämpfe.2. Die trockene Destillation der Cellulose und des Lignins, wodurch
Essigsäure, Holzgeist, Teer und Holzkohle entstehen.
3. Die trockene Destillation des im Nadelholz enthaltenen Harzes,wodurch Harzessenz und Harzöle entstehen, die sich den aus
1 resp. 2 erhaltenen Produkten beimischen.
In kleineren Retorten ist es nicht gut möglich, die terpentin¬artigen Destillate gesondert aufzufangen. Das gelingt nur mit
Retorten von großem Füllraum. Doch bilden sich auch hier
gleich zu Anfang der Destillation Produkte, die von einer Zer¬
setzung des Harzes herrühren, die in der Technik unter dem
Namen Pinoline bekannt sind. Diese Produkte mischen sich
samt den im weiteren Verlauf der Destillation entstehenden Harz¬
ölen dem ersten Destillat bei, so daß bei diesem Prozeß nie von
der Gewinnung eines reinen Terpentinöles gesprochen werden
kann. Vielmehr ist es immer mehr oder weniger mit Pinolin
und Harzölen verunreinigt und wird als rohes Kienöl oder auch
als deutsches oder russisches Terpentinöl bezeichnet.
In kleineren Destillationsbetrieben fällt die Destillation des
Terpentinöls, der Cellulose und des Lignins, sowie der Harzöle
mehr oder weniger zusammen, und es bildet sich ein Teer, der
bei geringem Gehalt eines Nadelholzes an Terpentin und Harzen
1 M. Klar, a. a. 0., S. 57.
— 71 —
dem Laubholzteer nahezu gleichkommt. Ein harz- und terpentin¬
reicher Nadelholzteer schwimmt auf Holzessig; die im Handel
befindlichen Teere weisen diese Eigenschaft aber selten auf, da
sie von diesen Anteilen durch Destillation befreit worden sind.
Nadelholzteer wird als solcher vielfach verwendet als Anstrichs¬
mittel für Schiffe, Holzgeräte und Taue. In Amerika, Rußland,
Finnland und Schweden wird Nadelholz oft zum Zwecke der
Teergewinnung verkohlt, während Laubholzteer immer noch als
ein wenig erwünschtes Nebenprodukt gilt. Ausnahmen bilden
der Buchenholz- und der Birkenholzteer.
Zu arzneilichem Gebrauche wurde der Nadelholzteer schon
lange verwendet und fand deshalb Aufnahme in die verschiedenen
Pharmakopoen. Neben ihm gelangte der aus Südfrankreich
stammende Wachholderteer (Oleum cadinum) und der in Nord¬
rußland hergestellte Birkenholzteer (Oleum Rusci) zu großer
Bedeutung. Die Holzteere wirken resorptionsanregend bei chronisch
entzündlichen Zuständen, keimwidrig und jucklindernd.
Diese drei Holzteere sollen auch in der Editio V. der Schwei¬
zerischen Pharmakopoe wieder Aufnahme finden. Zu ihrer Unter¬
scheidung und Charakterisierung geben uns die Methoden der
Technik keinen Aufschluß. In den Pharmakopoen finden wir
wohl Prüfungsvorschriften, die sich aber bei kritischer Betrachtung
oft als unzulänglich erweisen und für alle Holzteerarten gelten.
Wir sind deshalb bei der Auswahl charakteristischer Prüfungs¬
methoden auf wenige Mitteilungen von Autoren aus pharma¬
zeutischen Kreisen angewiesen, von denen nur die Arbeiten über
das Oleum cadinum größeren Umfang angenommen haben. Wir
haben im nachfolgenden versucht, das zur Charakterisierung und
Prüfung bei diesen Teeren Brauchbare zu sichten.
A. Nadelholzteer.
Pix liquida, Pix Abietinarum.
Die Prüfung des Nadelholzteeres geschieht nach Klar1 in der
Technik meist durch äußere Beurteilung und begnügt sich oft in
1 M. Klar, a. a. 0., S. 396.
— 72 —
der Unterscheidung des Nadelholzteeres vom Laubholzteer. Für
die Beurteilung des Nadelholzteeres praktisch wichtig ist die
Ausstrichprobe auf einem glattgehobelten, möglichst weißen Stück
Holz. Je heller der Ausstrich ausfällt und je weniger derselbe
von Wasser weggelöst wird, um st) höher gilt der Wert des
Teeres. Destillationsproben mit dem Nadelholzteer anzustellen,hat nach Klar so gut wie gar keinen Zweck, da an denselben
in der Technik bestimmte Ansprüche in bezug auf das Vor¬
handensein gewisser Siedefraktionen überhaupt nicht gestelltwerden. Guter Nadelholzteer soll einen harzigen Geruch besitzen.
Er soll in dünnen Schichten das Licht mit braungelber Farbe
durchlassen.
Holde1 gibt folgende Prüfungen für Nadelholzteer an: Echter
Nadelholzteer ist in dünner Schicht goldgelb bis orange gefärbt,hat harzartigklebrige Beschaffenheit und darf beim Trocknen
möglichst nicht nachdunkeln. Guter Nadelholzteer soll auf Holz¬
essig schwimmen, was durch den Gehalt an spezifisch leichtem
Terpentinöl und leichtem Harzöl bedingt wird. Wenig Kienöl
enthaltende Nadelholzteere sind spezifisch schwerer als Wasser.
Die Destillate bis 200° sind z. T. wässerig und sauer reagierendund riechen ebenso wie die bis 300° siedenden Destillate nach
Holzteer. Diese haben in den öligen Anteilen ein spezifischesGewicht größer als 1,0, lösen sich nicht ganz in Normalbenzin
auf, färben wie Harzöl Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,62)rot und geben infolge ihres Harzgehaltes scharf die Morawski sehe
Reaktion. Die über 300° siedenden Destillate haben ebenfalls
ein spezifisches Gewicht größer als 1,0 und lösen sich im gleichenVolum Normalbenzin fast ganz auf. Der wässerige Auszug des
Teeres ist gelblich und reagiert sauer. Der Teer läßt sich zum
Unterschied vom Buchenholzteer mit Fetten, z. B. Schweineschmalz
zusammen schmelzen.
Massy2 kritisiert die Prüfungen von Gall. Sie sind zu weit
gefaßt und gelten für alle Holzteere. Er schlägt für die Prüfungvon Pix liquida folgende Änderungen vor:
1Holde, S. 448.
2Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 9, 27 (1929).
— 73 —
Als Identitätsprüfung müßte die Reaktion nach Hirschsohn-
Pépin dienen, die sich in Gall, beim Nachweis von Nadelholz¬
teer im Oleum cadinum findet. Es müßte eine Prüfung auf
Verunreinigungen gemacht werden, die sich im Nadelholzteer
normalerweise nur in geringen Mengen vorfinden sollen. Nach
Erwärmung des Teeres auf dem Wasserbad muß er ohne Rück¬
stand durch Gaze, deren Feinheit anzugeben wäre, kolierbar sein.
Der Gehalt des Teeres an Wasser sollte 5 % nicht überschreiten
(nach Massy können bis 45% und sogar noch mehr Wasser
im Teer vorkommen). Ebenso sollte die Gesamtsäure, als Essig¬
säure berechnet, 2 g in 100 ccm Teer nicht überschreiten.
Vorstehende Prüfungsmethoden und Vorschläge wurden samt
den nachfolgend besprochenen, in den verschiedenen Pharma¬
kopoen angewandten Vorschriften an Hand von zwei Mustern
Pix liquida kritisch geprüft. Das eine, das uns durch die Firma
A. G. vormals B. Siegfried in Zofingen zugestellt wurde, stammte
aus Norwegen, das andere, ebenfalls von dieser Firma bezogene,
war als französische Pix liquida „des Landes" bezeichnet.
Zu Vergleichsproben wurde ein uns gleichfalls von obiger
Firma besorgter authentischer Buchenholzteer (Oleum Fagi) benützt.
In den Pharmakopoen wird Pix liquida verschieden definiert:
tielv. IV fordert den durch trockene Destillation der Stämme und
Zweige von Abietineen gewonnenen Teer, D. A. B. 5 und 6 den
durch trockene Destillation des Holzes verschiedener Bäume aus
der Familie der Pinaceen, vornehmlich Pinus sylvestris Linné
und Larix sibirica Ledebour gewonnenen Teer. Nederl. IV und V
verlangen den durch trockene Destillation von Stämmen und
Zweigen harzenthaltender Sorten aus der Gruppe der Abietineen
erzeugten Teer. Nach Brit. ist Pix liquida das Produkt der
trockenen Destillation des Holzes von P. sylvestris Linné und
andern Pinusarten, nach U.S.A. IX und X ist Pix liquida bzw.
Pix pini der durch trockene Destillation des Holzes von P. palustris
Miller und andern Pinusarten gewonnene Teer. Gall, versteht
unter Holzteer (goudron végétal, goudron de pin, goudron de
Norvège) das durch pyrogene Zersetzung aus den Stämmen und
Wurzeln mehrerer Pinusarten und das aus den bei der Ver¬
arbeitung dieser Pflanzen entstehenden Rückständen gewonnene
— 74 —
Produkt. Neben goudron végétal führt Gall, auch noch einen
goudron végétal purifié, der durch gelindes Erhitzen des Holz¬
teeres auf dem Wasserbad und nachheriges Filtrieren durch ein
Tuch erhalten wird.
Von Prüfungen des Holzteeres kommen hauptsächlich die
folgenden in Betracht:
1. Sinnenprüfung.
Nadelholzteer bildet in dicker Schicht eine schwarzbraune, in
dünner Schicht eine orange-gelb bis hellbraune Flüssigkeit von
dicklicher Beschaffenheit.
Der Ausstrich zeigt oft körnige Ausscheidungen, die bei mikro¬
skopischer Betrachtung sich als helle Kristallbruchstücke erweisen.
Ein Teer mit wenig Kristallausscheidungen ist für arzneilichen
Gebrauch vorzuziehen.
Nach Beuttner1 bestehen die kristallinischen Ausscheidungenaus Brenzkatechin, nach Schoorl2 aus Brenzkatechin und Harz¬
säuren.
Körnige Beschaffenheit des Nadelholzteeres lassen zu: Helv. IV,D. A. B. 5 und 6, Svenska und Gall., U. S. A. IX und X verlangennicht kristallinische Teere.
Von den von uns untersuchten Teeren enthielt Pix liquida„des Landes" sehr große Mengen kristallinische Ausscheidungen,während der Norwegerteer fast frei von solchen war. Die Farbeder beiden Teere war im übrigen gleich und entsprechend obigerBeschreibung.
Der von uns untersuchte Buchenholzteer zeigte in dünner
Schicht auf einer Glasplatte ausgestrichen braune Farbe, wie das
auch in der Literatur als charakteristisch für den Buchenholzteer
angegeben ist.
2. Verdunstungsrückstand.
1 g Nadelholzteer gibt mit 5 ccm Weingeist geschüttelt ein
orangegelbes Filtrat, das nur schwache Fluoreszenz zeigt und
1Kommentar zu Helv. ed. IV. (Zürich 1909).
2Commentaar op de Nederlandsche Pharmacopée V. Uitgave. (Utrecht 1929).
— 75 —
nach freiwilligem Verdunsten auf dem Uhrglas einen braunen
Lack zurückläßt (Unterschied von Steinkohlenteer).
3. Prüfung des Teerwassers.
5 g Nadelholzteer werden mit 95 ccm Wasser während 10 Minuten
kräftig geschüttelt. Das gelbliche Filtrat reagiert sauer.
Der pH unseres Norwegerteers betrug 3,4, der des französischen
Teers 3,6.
D. A. B. 5 und 6 und Svenska lassen das Teerwasser im Ver¬
hältnis 1:10 bereiten, Nederl. IV und V im Verhältnis 1:20. Nach
Kommentar zu D.A.B. 6 deutet blauschwarze Färbung des Filtrates
auf Braunkohlenteer.
Das Teerwasser wird nach den Vorschriften der Pharmakopoen
mit folgenden Reagenzien geprüft:
Eisenchloridlösung (ca. 0,1 n): 5 ccm des Teerwassers
werden mit einem Tropfen FeCl3-Lösung versetzt. Die Flüssig¬
keit färbt sich beim Einfall des Tropfens grünlich, welche Farbe
dann sofort in rotbraun übergeht.Wir haben die Reaktion bei unseren Teeren mit n-, 0,1 n- und
0,01 n-Eisenchloridlösung ausgeführt. Die Konzentration 0,1 n
erwies sich als die geeignetste und wurde auch für die späteren
Versuche beibehalten.
tielv. IV und D. A. B. 5 verwenden 30°/oige FeCl3-Lösung,
D.A.B. 6, Nederl. V, U.S.A. IX und X ca. n-FeCl3-Lösung. Nach
Brit. färbt sich das Teerwasser mit sehr stark verdünnter
FeCl3-Lösung rot.
Kalkwasser: 3 ccm Teerwasser + 3 ccm Kalkwasser geben
beim Vermischen ohne zu schütteln gelbe Färbung; beim Schütteln
in einem bis zur Hälfte gefüllten Reagensglas wird die Färbung
schön rotbraun, geht aber bald in hellbraun über.
Nach Kommentar zu fielv. IV löst Kalkwasser Phenole und
andere Teeranteile, und die gelbgefärbte Lösung wird durch
Oxydation an der Luft dunkler gefärbt.
Diese Reaktion findet sich in D. A. B. 5 und 6, in Nederl. IV
und V.
— 76 —
Broinwasser: 5 ccm Teerwasser geben mit einigen TropfenBromwasser eine weiße Trübung.
Diese Reaktion findet sich in Nederl. V, aber nicht bei Pix
liquida, sondern bei Oleum cadinum.
Ammoniakalische Silbernitratlösung: 5 ccm ammonia-
kalische Silbernitratlösung werden durch einige Tropfen Teerwassersofort in der Kälte reduziert.
Diese Prüfung findet sich in Svenska.
Die andern Pharmakopoen benutzen diese und die folgendeReaktion nicht bei Pix liquida sondern bei Oleum cadinum undOleum Rusci. Sie sind aber für diese öle nicht charakteristisch.
Fehlingsche Lösung: 3 ccm Fehlingsche Lösung werden durch6 ccm Teerwasser in der Hitze reduziert.
Anilinacetat1: 5 ccm Teerwasser werden durch 2 ccm Anilin-acetat innerhalb wenigerMinuten mehr oder weniger rosarot gefärbt.
Diese Probe kann auch auf folgende Weise ausgeführt werden:auf einen Streifen Filtrierpapier, der mit einigen Tropfen Teerwasserbenetzt wurde,werden einigeTropfen Anilinacetat gebracht. Es machtsich bald eine deutliche Rotfärbung des Filtrierpapieres geltend.
Das Anilinacetat wird nach Vorschrift Pépins auf folgende Art bereitet:10 ccm Anilin + 10 ccm Eisessig + 80 ccm Wasser werden mit Tierkohleaufgekocht und dann filtriert.
Kaliumbichromatlösung (ca. n): 5 ccm Teerwasser nehmendurch Zugabe von 5 Tropfen Kaliumbichromatlösung zuerst eine
geibe, nach einigen Minuten braun werdende Färbung an.
Diese Reaktion findet sich in verschiedenen Pharmakopoen,aber nicht bei Pix liquida, sondern bei Oleum cadinum undOleum Rusci. Sie ist aber nicht charakteristisch für diese öle(siehe Seite 100, 119).
Bei unsern Handelsmustern war die Mischung von Teerwasserund Kaliumbichromatlösung nach 3—5 Minuten dunkel undtrübe geworden.
Kaliumcyanidlösung(ca.n):3ccmTeerwasser nehmen auf Zu¬satz von 1—2 Tropfen Kaliumcyanidlösung eine gelbe Färbung an.
1Journ. d. Pharm, et Chim. (VI) 24, 252 (1906).
— 77 —
Über diese Reaktion soll bei Oleum Rusci noch ausführlicher
gesprochen werden (siehe Seite 120).
Alle hier angeführten Reaktionen des Teerwassers fielen mit
den von uns untersuchten Teeren positiv aus. Die Reaktionen
sind aber unseres Erachtens für Pix liquida nicht charakteristisch,
sondern gelten auch für andere Holzteere, z. B. für Oleum cadinum
und in der Mehrzahl auch für Oleum Rusci.
Ein vergleichshalber hergestelltes Buchenholzteerwasser ver¬
hielt sich, auf gleiche Weise behandelt, folgendermaßen:Das Teerwasser war gelblich gefärbt. pH = 2,6. Kalkwasser
ergab keine rötlichbraune, sondern nur schwach gelbliche Färbung.Bei allen anderen Reaktionen verhielt sich das Buchenholzteer¬
wasser gleich wie Nadelholzteerwasser, nur verliefen die Re¬
aktionen mit Kaliumbichromat und die Reduktionsproben rascher.
4. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.
Nach E. Hirschsohn1 färbt sich der Petrolätherauszug des
Nadelholzteers mit einer l%'gen Kupferacetatlösung grünlich,während Buchenholzteer keine Färbung gibt. Pépin verbesserte
die Reaktion und faßte sie genauer:
1 ccm Teer wird mit 15 ccm Petroläther in einem Erlenmeyer stark ge¬
schüttelt und die Petrolätherlösung abfiltriert. 10 ccm dieser Lösung werden
mit 10 ccm einer 50/0igen Kupferacetatlösung vermischt und gut durch¬
geschüttelt. Nach Trennung der Schichten werden 5 ccm der Petroläther-
schicht mit Äther verdünnt und filtriert. Eine intensiv grüne Farbe der
ätherischen Lösung zeigt das Vorhandensein von Nadelholzteer an.
Die Reaktion wurde von uns in der von Pépin angegebenenModifikation geprüft unter Anwendung von 5 % 'ger. 1 % igerund 0,1 °/o iger Kupferacetatlösung.
Der Norwegerteer gab bei Verwendung von 5%iger Kupfer¬
acetatlösung einen dunkelgrünen, etwas braunstichigen Petrol¬
ätherauszug, mit l°/0iger Kupferacetatlösung war er deutlich grün,
mit 0,1% iger Kupferacetatlösung schön hellgrün. Bei dieser
großen Verdünnung ist aber eine Zugabe von Äther zum Petrol¬
ätherauszug nicht mehr nötig. Unseres Erachtens eignet sich
1 Pharmazeutische Zeitschrift für Rußland 213 (1877), siehe bei Holde,
S. 449.
- 78 -
die l°/oige Kupferacetatlösung am besten. Sie zeigte auch schöne
Resultate bei der Untersuchung des französischen Teeres, der
die Petrolätherschicht intensiv grün färbte.
Wir führten die Reaktion nach Hirschsohn-Pépin auf
Nadelholzteer in folgender Weise aus:
1 ccm Teer wird in einem mit Glasstöpsel verschlossenen
Erlenmeyer mit 15 ccm Petroläther kräftig geschüttelt. 10 ccm
des gelben Filtrates werden hierauf mit 10 ccm einer l°/oigen
Kupferacetatlösung in einem kleinen Scheidetrichter gut durch¬
geschüttelt. Nach Trennung der Schichten wird die Kupfer¬
acetatlösung abgelassen, 5 ccm der Petrolätherschicht werden
mittels einer Pipette herausgehoben und in einem kleinen Me߬
zylinder mit 10 ccm Äther verdünnt. Die Mischung muß eine
intensiv grüne Farbe annehmen.
Die Reaktion nachriirschsohn-Pépin ist, wie auch M.Massy1es für die Neufassung der Gall, vorschlägt, als Identitätsprüfungauf Nadelholzteer sehr zweckmäßig. Die Reaktion eignet sich
auch zur Unterscheidung des Nadelholzteeres vom Buchenholz¬
teer, dessen Petrolätherauszug, mit Kupferacetatlösung behandelt,nur schwache Gelbfärbung gibt.Nach Pépin soll die grüne Farbe des Petrolätherauszuges von
petrolätherlöslichen Verbindungen des Kupfers mit den im Nadel¬
holzteer vorhandenen Harzsäuren herrühren.
5. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit.
Die Angaben der Literatur und der Pharmakopoen über die
Löslichkeit von Nadelholzteer in den verschiedenen organischenLösungsmitteln weichen voneinander ab.
Nach Hirschsohn2 ist Tannenteer vollkommen löslich in
Essigsäure 95 %> löslich in Terpentinöl, Chloroform, absolutem
Äther und Anilin.
Nach Helv. IV löst sich Nadelholzteer vollständig in absolutem
Alkohol und Äther, in Terpentinöl nur zum Teil. D. A. B. 5 und 6
verlangen völlige Löslichkeit in absolutem Alkohol. Nach Nederl. IV
1Journ. d. Pharm, et. Chim. (VIII) 9, 27 (1929).
2Siehe bei Holde, S. 449.
- 79 —
und V löst sich der Teer völlig in absolutem Alkohol und großen¬teils in Terpentinöl auf. Nach Kommentar zu Nederl. V löst sich
der Teer nicht nur in absolutem Alkohol, sondern auch in Spiritus
von 90 und 95 Volumprozent auf. Die Löslichkeit in Terpentinölsoll eine spezifische Eigenschaft des Nadelholzteeres sein, bedingtdurch seinen höhern Gehalt an Terpenen und Harzsäuren. Ein
Teil löst sich fast vollständig in 10 Teilen Terpentinöl. Es bleiben
nur wenig dunkelbraune Teile mehr zurück. Wird aber ein Teil
Laubholzteer mit 10 Teilen Terpentinöl geschüttelt, so färbt sich
das Lösungsmittel wohl dunkelbraun, doch bleibt der Teer fast
in unverminderter Menge ungelöst zurück. Im Gegensatz zu
diesen Angaben des Kommentars zu Nederl. V gibt Kommentar
zu D. A„ B. 6 an, daß die frühere Angabe, daß Holzteer in Ter¬
pentinöl z. T. löslich sei, nicht charakteristisch sei. Gall, gibtleichte Löslichkeit in Alkohol und Äther an. Nach U. S. A. IX
und X ist der Teer löslich in Alkohol, Äther, Chloroform, Eis¬
essig. Brit. fordert vollkommene Löslichkeit des Teeres im
lOfachen Volumen Alkohol 95 Volumprozent.Wir prüften das Verhalten der von uns untersuchten Nadel¬
holzteere gegenüber folgenden Lösungsmitteln (im Verhältnis
1 ccm zu 9 ccm), wobei wir das Resultat sofort und nach 18 Stunden
beobachteten.
Norwegerteer || Pix des Landes
sofort nach 18 Stunden sofort nach 18 Stunden
Alkohol absolut.
Alkohol 95°/o .
Äther
Aceton
Chloroform.. .
Terpentinöl. . .
=
— *
— *
ca. 1 cm Bodensatz
— *
— *1
1
m
1
m
1
1
1
+
+
II
+11
+
+
+ flockige Ausscheidungen
» «
flockige Ausscheidungen
flockige Ausscheidungen
» »
= bedeutet: löslich.
— bedeutet: unvollkommen löslich.
=* bedeutet: abgesehen von einem feinen, unbedeutenden Bodenbelag ist
die Lösung klar.
-+ bedeutet: der Teer löst sich scheinbar auf, doch scheidet sich bald ein
flockiger Niederschlag aus.
— 80 -
Zum Vergleich seien die Löslichkeitsverhältnisse (1:10) des
Buchenholzteeres noch angeführt:
sofort nach 18 Stunden
Alkohol absolutus
Alkohol 95 °/oÄther
Anilin
wenig löslich
flockige Ausscheidungen
starke Ausscheidungen
Chloroform
Terpentinöl —
= bedeutet: löslich. — bedeutet: unvollkommen löslich.
E. Hirschsohn1 gibt an, daß der Buchenholzteer in Essig¬säure vollkommen löslich, in Terpentinöl wenig löslich, in Chloro¬
form und in absolutem Äther zum Teil löslich sei.
Nach diesen Befunden scheint uns die Prüfung gegenüber
Weingeist 95 Volumprozent und Terpentinöl am meisten charak¬
teristisch zu sein, und wir schlagen vor, für Pharmakopöezweckedie Forderung aufzustellen: je 1 ccm Holzteer muß sich in je9 ccm Weingeist 95 Volumprozent und Terpentinöl sofort lösen.
Nach 12 stündigem Stehen darf höchstens ein sehr geringerfeiner Bodenbelag im Reagensglas sein.
Der von uns geprüfte Nadelholzteer „des Landes" zeigt gegen¬
über den meisten Lösungsmitteln ein abnormes Verhalten, welches
speziell auch im Widerspruch steht mit den Forderungen der
Pharmakopoen hinsichtlich der Löslichkeit in Alkohol.
Nach Holde und nach Kommentar zu Nederl. V läßt sich der
Nadelholzteer zum Unterschied vom Buchenholzteer mit Fetten,
z. B. Schweineschmalz, zusammen schmelzen. Nach U.S.A. IX
und X, Gall, und Svenska soll der Nadelholzteer mischbar sein
mit fetten und flüchtigen ölen.
Wir fanden die von uns untersuchten Nadelholzteere mischbar
mit geschmolzenem Schweinefett, den Buchenholzteer dagegennicht. Vollkommene Mischbarkeit mit fetten ölen konnte von
uns nicht festgestellt werden.
1 Siehe bei Holde, S. 449.
— 81 —
6. Spezifisches Gewicht.
Läßt man Nadelholzteer in ein mit Wasser von 15° gefülltes
Becherglas tropfen, so sinkt er darin unter. Das spezifische
Gewicht des Nadelholzteeres muß größer sein als 1,00.
Nach Helv. IV, D. A. B. 5 und 6, ü. S. A. IX und X und Brit.
soll Nadelholzteer im Wasser untersinken. Kommentar zu
Helv. IV und Kommentar zu D. A. B. 6 sehen darin einen Unter¬
schied von Braunkohlen- und Torfteeren. Auch nach Nederl. IV
und V soll das spezifische Gewicht höher sein als 1,00.
Wir fanden als spezifisches Gewicht beim Norwegerteer 1,0889,
beim französischen Teer 1,0829. Es wurde in der beim Ichthyol
beschriebenen Weise bestimmt.
7. Verbrennungsrückstand.
Der Verbrennungsrückstand, bestimmt mit ca. 1 g Substanz
(genau gewogen), darf höchstens 0,25% betragen.
Diese Forderung entspricht U. S. A. X; Helv. IV, D. A. B. 5 und 6,
Nederl. IV und V und Brit. begrenzen die zulässige Menge nicht.
Der Verbrennungsrückstand in den von uns untersuchten
Teeren belief sich beim Norwegerteer auf 0,23%, bei franzö¬
sischen Teer auf 0,14%.
8. Bestimmung der Gesamtsäure.
Pépin beschreibt seine Methode zur Säurebestimmung im
Nadelholzteer und Oleum cadinum folgendermaßen:
10 ccm Teer werden in einem graduierten Schüttelzylinder mit 20 ccm
Wasser gut geschüttelt, die Mischung eine Stunde der Ruhe überlassen und
durch ein mit Wasser benetztes Filter in einen Kolben von 250 ccm Inhalt
filtriert. Die Ausschüttelungen werden solange wiederholt, bis 250 ccm Filtrat
gewonnen sind. In 200 ccm des Filtrates wird die Essigsäure durch Baryt¬
wasser von bekanntem Gehalt titriert und als Essigsäure berechnet. Da der
Farbumschlag mit Hilfe verschiedener Indikatoren in dem gefärbten Filtrat
nur schlecht zu sehen war, verfolgte Pépin das Ende der Titration durch
Tüpfeln auf blaues Lackmuspapier.
Die Methode ist auch wegen ihrer Dauer unbefriedigend.
Bunbury1 gibt für die Bestimmung der Säure im Holzteer
folgende Methode an:
1Bunbury-Elsner, Die trockene Destillation des Holzes, S. 319 (1925).
Gensler-Koch. g
— 82 —
Man wägt in einen Rundkolben 100 g Teer ein, verbindet den Kolben mit
einem Kühler und einer Dampfzuführung und destilliert drei Fraktionen von
je 100 ccm ab. Das Destillat wird titriert mit n-NaOH.
Da es sich in unserm Falle immer um Teere handelt, die des
größten Anteils an Essigsäure schon beraubt sind, so arbeiteten
wir für unsere Zwecke folgende Methode aus, die die im Teer
noch vorhandene Säure möglichst quantitativ zur Bestimmungbringt und die eine durch die fast vollständige Farblosigkeitdes Filtrates bedingte, bequeme Titration gestattet. Die Gesamt¬
säure wird als Essigsäure berechnet.
In einem mit Siedesteinchen versehenen Rundkolben von 500 ccm
Inhalt werden ca. 10 g Teer auf 0,1 g genau eingewogen und
30 ccm Wasser zugesetzt. Der Kolben wird angewärmt und die
Mischung sodann der Wasserdampfdestillation unterworfen. Es
werden durch ein befeuchtetes Filter in einem Meßkolben 500 ccm
Destillat aufgefangen. Das Filter dient zur Zurückhaltung des
ätherischen Öles.
100 ccm des Destillates (= 2 g Teer) werden mit einigenTropfen Phenolphthaleinlösung versetzt und mit 0,1 n-NaOH titriert.
1 ccm 0,ln-NaOH = 0,006 g Essigsäure.
Die gefundene Menge Essigsäure mit 50 multipliziert ergibtden Prozentgehalt des Teeres an Säure, berechnet als Essigsäure.Pépin fand nach seiner Methode in einem Nadelholzteer 1,55%
Essigsäure.Der Gehalt an Essigsäure unserer untersuchten Handelsmuster
betrug im Norwegerteer 0,92%) im französischen Teer 1,54%-Nach obigen Resultaten können wir demVorschlag vonM.Massy,
es solle die Gesamtsäure eines Nadelholzteeres 2 g in 100 ccm
Teer nicht überschreiten, zustimmen.
Der Gehalt an Gesamtsäure in dem von uns nach obigerMethode untersuchten Buchenholzteer betrug 3,19%.
9. Probedestillation.
Da für die Wasserbestimmung in den Holzteeren die beim
Steinkohlenteer angewandte Xylolmethode aus den dort an¬
geführten Gründen nicht in Frage kommt, verbanden wir die
— 83 —
Ermittlung des Wassergehaltes der Holzteere mit der Probe¬
destillation, wobei wir uns darüber klar sind, daß durch dieses
Verfahren nur ganz approximative Werte erhalten werden können.
Die als Wasser angesehene Fraktion enthält auch noch Essig¬säure und eventuell andere wasserlösliche Stoffe.
Um Vergleichsresultate mit den spätem Untersuchungen des
Oleum cadinum zu besitzen, begrenzten wir auch für den Nadel¬
holzteer die Fraktionen in der für das Oleum cadinum empfohlenenWeise, und zwar:
die erste Fraktion....
bis 150°,die zweite Fraktion.
. . . von 150—200°,die dritte Fraktion .... von 200— 250°,die vierte Fraktion
.... von 250— 300°.
50 g Teer werden auf 0,1 g genau in einen mit Siedesteinchen
versehenen, tarierten Siedekolben von 200 ccm Inhalt eingewogen.Der Siedekolben wird mit einem Liebigschen Kühler verbunden
und das Thermometer in gewöhnliche Destillierstellung gebracht
(Quecksilberbehälter direkt unterhalb des seitlichen Abflußrohres,welches ca. 10 cm über der Basis des Kolbens angebracht war).Fadenkorrekturen wurden wie beim Steinkohlenteer keine an¬
gebracht, da die Untersuchungen nur Vergleichsresultate liefern
sollten. (Die Länge des Thermometers von der Basis des Queck¬
silberbehälters bis zum Punkt 360° betrug 36 cm.) Der Kolben
wird auf dem Drahtnetz unter dem Abzug langsam erhitzt. Um
eine regelmäßige Erhitzung zu erreichen, umwickelt man den
Kolben zweckmäßig mit Asbestpapier. Nach Abnahme der ersten
Fraktion wird das Kühlwasser abgestellt.Die erste Fraktion wird in einem kleinen, tarierten Meßzylinder
von 10 ccm Inhalt, die andern in tarierten Bechergläsern auf¬
gefangen.
Von 80—120° machte sich während der Destillation des
Wassers starkes Stoßen bemerkbar. Von 200° an begann ein
scharf riechendes, klares öl zu destillieren.
Folgende Tabelle gibt die Mengen der mit unsern Handels¬
mustern von Nadelholzteer und Buchenholzteer erhaltenen Siede¬
fraktionen an:
6*
- 84 —
bis
150°*)
Ol/o
ccm
wässerigenDestillates
pro 100 gTeer
150
bis
200°
/o
200
bis
250°
/o
250
bis
300°
/o
150
bis
300°
/o
Rück¬
stand
Ol/o
Ver¬
lust
/o
Norwegischer Teer
Französischer Teer
Buchenholzteer. .
1,50
3,40
14,20
1,0
2,70
13,40
1,30
1,20
4,0
24,40
15,20
26,0
15,30
7,80
12,40
41,0
24,20
42,40
56,0
70,20
41,0
1,50
2,20
2,40
*) Diese Fraktion bestand in der Hauptsache aus einem wässerigen Destillat,welches von einer kleineren Menge eines gelblichen Öles bedeckt war. Die
zweite Kolonne gibt die Menge des wässerigen Destillates an.
Pépin gibt den Wassergehalt der von ihm untersuchten Kade-
öle und Nadelholzteere zwischen 1,2 und 2,8% an- Die von uns
untersuchten Handelsmuster hielten sich auch in den von Pépin
angegebenen Grenzen.
Nach Pépin beträgt die Menge der zwischen 150° und 300°
erhaltenen Destillationsprodukte nur etwa 15%. Die von uns
untersuchten Nadelholzteere ergaben beträchtlich höhere Werte.
Der Vorschlag von M. Massy, daß sich der Wassergehalt eines
offizineilen Nadelholzteeres auf nicht mehr als 5 % belaufen
dürfe, ist auf alle Fälle erfüllbar. Der maximale Wassergehaltkönnte für Pharmakopoen auch mit 3,5 oder 4,0% begrenzt werden.
Mit den von 250—300° übergehenden Anteilen wurden noch
folgende, bei Holde1 angegebene Prüfungen angestellt:
1. mit Schwefelsäure, spezifisches Gewicht 1,62.1 ccm Schwefelsäure wird durch einen Tropfen des Destillates gelbrot,
orange und schließlich schön rot gefärbt.2. Reaktion nach Storch-Morawski auf Harzsäuren:
1 Tropfen des Destillates wird in 1 ccm Essigsäureanhydrid unter
Verreiben mit einem Glasstab kalt gelöst und mit 1 Tropfen Schwefel¬
säure (spezifisches Gewicht 1,53) versetzt. Es treten intensive rote bis
rotviolette Färbungen auf.
Diese Reaktionen fielen sowohl bei den von uns untersuchten
zwei Mustern von Nadelholzteer wie auch mit dem Buchenholz¬
teer positiv aus. Die Reaktionen erlauben also keine Unter¬
scheidung dieser zwei Teerarten.
1Holde, S. 449.
— 85 —
Anschließend soll noch von einer Reaktion berichtet werden,
welche für die über 200° siedenden schweren Buchenteeröle
charakteristisch ist. Bordas und Touplain1 fanden, daß die
über 200° siedenden schweren Buchenteeröle in alkoholischer
Lösung mit Baryt- oder Kalkwasser eine schöne blaue Färbung
geben. Nach Pastrovich2 kommt diese Reaktion dem bei
240° siedenden, in den Buchenteerölen enthaltenen Coerulignol
C9HI0(OH)(OCri3) = 4-Oxy-3-methoxy-l-propylbenzol zu.
Verfasser geben an, daß wegen der hohen Empfindlichkeit der
Reaktion diese sonst ziemlich wertlosen Abfallprodukte zur
Denaturierung von Alkohol herbeigezogen werden können.
Wir lösten einige Tropfen der beim Buchenholzteer erhaltenen
Fraktion 200—250° in ca. 5 ccm Alkohol und gaben dann
2 — 3 ccm Kalkwasser dazu. Beim Vermischen trat keine Blau¬
färbung ein. Auch nach heftigem Umschütteln war keine
Änderung zu konstatieren. Wurde hingegen statt Kalkwasser
Barytwasser zur alkoholischen Lösung gegeben, so bildete sich
beim Buchenholzteer unter dem Meniskus ein breiter tiefblauer
Ring, der beim Umschütteln aber sofort wieder verschwand.
Bei den beiden Nadelholzteerölen bildeten sich schmale, grün¬
blaue Ringe, die durch Umschütteln ebenfalls wieder ver¬
schwanden. Oleum cadinum gab nur ganz schwache Reaktion,
während die Birkenteeröle keine Färbung zeigten. Kommentar
zu Nederl. V berichtet über eine vorkommende Verunreinigung
des Kreosotes, die aus Buchenholzteer herrührt und aus dem
Dimethyläther des Pyrogallols entstanden sein kann. Es ist das
Cöerulignon von der Formel: Clefil606.Es kristallisiert in stahlblauen Nadeln und kann im Kreosot
nachgewiesen werden durch die blauen Färbungen, die die Petrol-
ätherlösungen von Kreosot mit Barytwasser geben.
Wir konnten die Reaktion auf folgende Weise erhalten: Drei
Tropfen Buchenteeröl der Fraktion 200 — 250° werden in 3 ccm
Petroläther aufgelöst, mit 3 ccm Barytwasser versetzt und die
Mischung stark geschüttelt. Es tritt eine schöne stahlblaue
Färbung ein, die bald in graublau übergeht. Die Schichten
1 C. 1923, IV, 127.
2 Monatshefte für Chemie 4, 188.
— 86 -
trennen sich nur langsam. Die Petrolätherschicht bleibt bläulich,während die Barytwasserschicht, die einen flockigen Niederschlagenthält, graugrüne Farbe annimmt.
Mit den von 200—250° übergehenden Destillaten des Nadel¬
holzteeres verlief die Reaktion folgendermaßen: Nach dem
Schütteln hatte die Reaktion grünblaue Farbe angenommen; nach
Trennung der Schichten, die sehr rasch erfolgte, enthielt die
untere Schicht einen braunen, flockigen Niederschlag, die Petrol¬
ätherschicht war gelbgrün gefärbt. Der französische Teer zeigtedasselbe Verhalten, nur waren die Färbungen etwas schwächer.
Die Reaktion kann zur Unterscheidung des Nadelholzteeres
vom Buchenholzteer dienen. Über ihre Anwendung bei den
Destillaten von Oleum cadinum und Oleum Rusci soll späterdie Rede sein.
10. Zusammenfassung.
Auf Grund vorstehender Untersuchungen dürften sich für die
Prüfung des Nadelholzteeres besonders folgende Methoden
empfehlen:
1. Reaktion nach fiirschsohn-Pépin.2. Löslichkeit in Weingeist und Terpentinöl und Mischbarkeit
mit geschmolzenem Schweinefett.
3. Spezifisches Gewicht.
4. Gesamtsäure.
5. Destillationsprobe.
B. Waehholderteer.
Oleum cadinum, Oleum Juniperi empyreumaticum,Pix Oxycedri.
Die Unmöglichkeit, sich von der Echtheit eines Kadeöles durch
erprobte Prüfungsvorschriften zu überzeugen, veranlaßte einigeAutoren Ende des letzten Jahrhunderts, sich näher mit dem
Studium dieses Teeröles abzugeben.
— 87 —
Die ersten Untersuchungen unternahm Hirschsohn1. Er
prüfte das Verhalten des Kadeöles gegen verschiedene Lösungs¬
mittel, entdeckte die Färbung des Petrolätherauszuges mit Kupfer-
acetatlösung, die heute als Hirschsohnsche Reaktion bekannt
ist, und untersuchte die Reaktionen des Teerwassers mit Kalk¬
wasser, Ferrichlorid, Ammoniak und Anilinsalzsäure.
In ähnlicher Weise beschäftigten sich auch M. Schulz2 und
P. Adam8 mit dem Kadeöl. Die Befunde von Adam standen
aber in solchem Widerspruch mit denen von Hirschsohn und
Schulz, daß der Autor die pessimistische Schlußfolgerung zog,
man möge das früher so geschätzte Arzneimittel ruhig aus dem
Arzneischatz streichen, da ein echtes Kadeöl nicht aufzutreiben
sei und charakteristische Reaktionen zu seiner Identifizierung
fehlen.
Die chemische Zusammensetzung des Öles aufzuklären unter¬
nahmen Troeger und Feldmann*, sowie Cathélineau und
Hauser8. Erstere isolierten aus dem Kadeöl eine kleine Menge
Cadinen und ein anderes Sesquiterpen. Cathélineau und
Hauser mußten sich mit der Isolierung von Körpergruppen be¬
gnügen, die sie durch Behandlung des Öles mit verschiedenen
Lösungsmitteln gewonnen hatten. So lichteten auch diese Arbeiten
das Dunkel nicht, das über dem Kadeöl lag.
Das Scheitern all dieser Versuche lag aber hauptsächlich daran,
daß die Verfasser gezwungen waren, mit den im Handel befind¬
lichen ölen zu arbeiten, über deren Herkunft die Verkäufer selbst
sehr im Zweifel waren. Aus spätem Analysenergebnissen kann
man ersehen, daß die öle oft mit Nadelholzteer verfälscht waren;
Hirsch söhn gab z. B. die Grünfärbung des Petrolätherauszuges
mit Kupferacetatlösung, die später als Identitätsreaktion für den
Nadelholzteer erkannt wurde, als charakteristisches Kennzeichen
für Kadeöl an.
1 Journ. d. Pharm, et Chim. (V) 24, 49 (1906).2 Ebenda S. 50.
s Bull. Soc. Chim. (3) 19, 580 (1898).4 Arch. Pharm. (3) 236, 692 (1898).6 Bull. Soc. Chim. (3) 19, 577 (1898); (3) 21, 378 (1899); (3) 23, 557 (1900);
(3) 25, 247 (1901).
— 88 —
Pépin1 zog aus diesen Tatsachen den Schluß, daß die erste
Aufgabe zur Aufklärung der Eigenschaften des Kadeöles darin
bestehe, sich an Ort und Stelle über die zur Darstellung des
Öles verwendete Wachholderart und die Fabrikation des Öles
selbst genau zu unterrichten.
Das Teeröl wird als das Produkt der trockenen Destillation
des Holzes von Juniperus oxycedrus bezeichnet, der in Süd¬
frankreich und in den Karpathen heimisch ist. Pépin beschreibt
den J. oxycedrus als wildwachsenden, kleinen Strauch, leicht
erkennbar an seinen haselnußgroßen orangeroten Früchten. Eine
fabrikmäßige Ausbeutung der Pflanze wird in den Départementsdu Var et du Gard betrieben. Sie gedeiht dort in genügenderMenge, so daß eine Anpflanzung und spezielle Kultur nicht nötigist. Die Sträucher werden geschnitten und je nach ihrem Quer¬schnitt in „cades gras" und „cades maigres" eingeteilt. „Cade"soll die provenzalische Bezeichnung für Wachholder sein, und
die Benennung des Teeröles als Oleum cadinum hat Eingang in
die meisten Pharmakopoen gefunden. Zur Destillation werden
nur die „cades gras" verwendet, während die „cades maigres"als Brennmaterial dienen. Vor der Destillation wird das Holz
von der Rinde befreit; das Kernholz und die untern Teile des
Strauches sollen den größten Ertrag an Teeröl liefern.
Die Destillation wird in kleinern Betrieben auf einfache Weise
durchgeführt. Das Holz wird zerkleinert und in einen gu߬eisernen Kessel geschichtet, der über eine mit Steinfließen aus¬
geschlagene konkave Öffnung gestülpt und festgekittet wird. Am
untern Teil der Öffnung befindet sich ein Ablaufrohr für die
Destillate. Um den Kessel wird ein starkes Feuer angezündet,das solange erhalten wird, als noch Destillat abfließt. Diese
Art der Bereitung wird Destillatio per descensum genannt. Die
Ausbeute an öl beträgt ungefähr 10% des verbrauchten Holzes;die Dauer der Destillation und die Stärke des Feuers scheint
auf das Produkt wenig Einfluß zu haben, wohl aber der Zer¬
kleinerungsgrad des Holzes. Grobgespaltenes Holz liefert wenigergute Ausbeuten.
1 Journ. d. Pharm, et Chim. (VI) 24, 49, 248 (1906).
- 89 —
Das Destillationsprodukt wird 15— 20 Tage der Ruhe über¬
lassen. Es trennt sich während dieser Zeit scharf in drei
Schichten: die unterste Schicht wird von den schweren Teer¬
destillaten gebildet, die mittlere Schicht von den wässerigen
Produkten, während das wahre Kadeöl auf der wässerigen Flüssig¬
keit schwimmt.
Trotzdem auf diese Weise hergestellte öle wohl immer gewisse
Schwankungen in der Zusammensetzung aufweisen werden, so
sollte es doch möglich sein, gewisse, für alle echten öle geltenden
charakteristischen Prüfungsmethoden aufzufinden.
Pépin führte mit von ihm teils selbst hergestellten ölen, sowie
mit ölen unsicherer Herkunft nach den von den frühern Ver¬
fassern vorgeschlagenen Methoden Vergleichsuntersuchungen aus.
Er machte darauf aufmerksam, daß auch qualitativen Prüfungen
nur dann ein Vergleichswert zukommen kann, wenn genaue An¬
gaben über die Arbeitsweise, die Menge und Konzentration der
Reagenzien gemacht werden; leider geben die frühern Unter¬
suchungen in dieser Hinsicht nur mangelhaften Aufschluß.
Die Ergebnisse der Untersuchungen von Pépin sollen im
folgenden kurz zusammengefaßt werden:
Die Reaktion von Hirschsohn wurde von Pépin in der
bei Pix liquida beschriebenen Weise abgeändert. Er konstatierte,
wie schon erwähnt, daß der Petrolätherauszug echter Kadeöle
durch Kupferacetlösung nie grün, sondern immer nur schwach
gelbbraun gefärbt wird. Eine Grünfärbung zeigt unweigerlich
eine Verfälschung mit Pix liquida an, und zwar ist die Reaktion
nach Ansicht von Pépin empfindlich genug, um noch einen
Zusatz von 10% Nadelholzteer zum Kadeöl zu erkennen, die
kleinste Menge, die für eine sich lohnende Verfälschung in
Betracht kommt.
Ein von Pépin untersuchtes, als echt angegebenes öl be¬
friedigte bei dieser Probe nicht. Es stellte sich heraus, daß dieses
öl nicht nur mit Holz von J. oxycedrus, sondern auch mit Holz
von drei andern Juniperusarten hergestellt worden war.
Das spezifische Gewicht eines Kadeöls muß nach Pépin
immer kleiner als eins sein; denn das echte Kadeöl bildet ja
die oberste Schicht des Destillationsproduktes. Für einen Schnell-
— 90 —
versuch genügt es, einige Tropfen Kadeöl in ein mit Wasser
gefülltes, konisches Glas fallen zu lassen. Die Tropfen, die beim
Einfallen bis in die Mitte des Wassers sinken, müssen von dort
wieder an die Oberfläche steigen. Pépin fand in allen echten
Kadeölen das spezifische Gewicht kleiner als eins.
Den Säuregehalt der verschiedenen öle bestimmte Pépinauf die bei Pix liquida angegebene Weise. Der Säuregehalt kann
als Unterscheidungsmerkmal des Kadeöles von Pix liquida nicht
in Betracht kommen. Pépin fand bei echten ölen einen Säure¬
gehalt (berechnet als Essigsäure) zwischen 0,930—1,210 g für
100 ccm öl, bei einem Muster Nadelholzteer einen Gehalt von
1,555 g in 100 ccm Teer. Er begrenzt den Säuregehalt eines
echten Kadeöles mit höchstens 1,5 g in 100 ccm. (Vom Fälscher
kann übrigens ein zu hoher Säuregehalt durch Waschen des
Produktes leicht entfernt werden.)Reaktionen des Teerwassers. Pépin stellte das Teer¬
wasser her durch Schütteln von 10 ccm Kadeöl mit 250 ccm Wasser.1. mit Ammoniak: 5 ccm Teerwasser geben mit einem Tropfen
Ammoniak eine gelbe Färbung, die nach Zugabe mehrerer TropfenReagens in braun übergeht.
2. mit Kalkwasser: die Reaktion ist dieselbe wie für Ammoniak.3. mit Ferrichloridlösung: 5 ccm Teerwasser werden mit
6 Tropfen Ferrichloridlösung 1:1000 versetzt. Die Mischungfärbt sich braun mit rötlichen und grünlichen Tönen.
4. mit Anilinacetat: auf Furfurol. Pépin prüfte auch dieseReaktion nach. Es herrschte unter den verschiedenen Autoren
großer Widerspruch, da die einen das echte Kadeöl frei von
Furfurol gefunden haben wollten und diese Eigenschaft als
Kennzeichen eines echten Öles ansprachen, andere hatten sowohlbei Kadeölen wie bei Pix liquida Furfurol nachgewiesen.Hirschsohn gab zu 5 ccm Teerwasser 2—3 Tropfen Anilin;
nach Umschütteln säuerte er mit 4 —6 Tropfen Salzsäure an und
zog mit Chloroform aus.
Er erhielt bei Kadeöl sowie bei Nadelholzteeren rötliche Fär¬
bungen, die Furfurol anzeigen.Adam versetzte 5 ccm Teerwasser (1:10) mit 3 Tropfen Anilin
und 6 Tropfen Salzsäure.
— 91 —
Verschiedene ölmuster gaben keine oder nur gelbliche Fär¬
bungen, die auf Zusatz von Chloroform intensiver gelb wurden.
Kauffeisen1 erhielt mit Kadeöl nur gelbe, mit Nadelholzteer
stark rote Färbungen, wenn er Teerwasser mit 3—4 Tropfen
Anilin schüttelte und erst nachher mit irgendeiner Säure ansäuerte.
Pépin wies nach, daß für das gleiche öl keine Färbung ein¬
tritt, wenn man nach dem Anilinzusatz ohne Umschütteln sofort
ansäuert, daß aber Rotfärbung eintritt, wenn vor dem Ansäuern
stark umgeschüttelt wird. Um diese Widersprüche zu vermeiden,
stellte Pépin die schon bei Pix liquida erwähnte Anilinacetat-
lösung her.
10 ccm Anilin + 10 cctn Eisessig + 80 ccm Wasser werden mit Tierkohle
aufgekocht und filtriert-
5 ccm Teerwasser wurden mit 2 ccm dieser Lösung versetzt.
Die Mischung färbte sich in kurzer Zeit sowohl bei echten als
bei gefälschten ölen wie auch bei Nadelholzteer mehr oder
weniger rötlich.
5. mit Kaliumbichromatlösung: auf Brenzkatechin.
5 ccm Teerwasser wurden mit 2 ccm einer Lösung von Kalium-
bichromat 1:5 versetzt. Alle Proben ergaben braune Verfärbung
der Flüssigkeit. Der Wert dieser Reaktion, die nach Kauffeisen
bei einem echten Kadeöl negativ ausfallen muß, ist deshalb
zweifelhaft.
Destillationsprobe: Pépin destillierte 250 ccm Kadeöl in
einem mit Asbestpapier umwickelten Destillierkolben von 500 ccm
Inhalt. Alle echten öle zeigten dieselben charakteristischen Merk¬
male: bei ca. 100° trat starkes Stoßen ein, das anhielt, bis alles
Wasser übergegangen war. Das Thermometer stieg hierauf
schnell bis ca. 250°; bei dieser Temperatur destillierte ein zuerst
fast farbloses, dann zitronengelb gefärbtes öl in großer Menge,
das gegen 300u eine dunkelgrüne Farbe annahm. Proben von
Nadelholzteer lieferten Pépin viel weniger Destillat zwischen
250° und 300°, und der im Kolben verbleibende Rückstand war
viel größer. Alle echten Kadeöle ergaben zwischen 150—300°
mindestens 65% Destillat, Nadelholzteer aber nur 15 %•
1 Siehe bei Pépin, Journ. de Pharm, et Chim. (VI) 24, 52 (1906).
— 92 —
Pépin stellte also für echte Kadeöle folgende Forderungen auf:
1. Das spezifische Gewicht eines Kadeöles muß kleiner sein als 1,0.2. Die Hirschsohn sehe Reaktion mit Petroläther und Kupfer-
acetatlösung darf nur eine braune, nicht aber eine grüneFärbung geben.
3. Die Gesamtsäure, als Essigsäure berechnet, darf 1,5 g in
100 cem Kadeöl nicht überschreiten.
4. Das zwischen 150—300"übergehende Destillat muß mindestens
65% der Einwage betragen.
Durch die Untersuchungen Pépins war es also gelungen, ein
echtes Kadeöl von gewöhnlichem Nadelholzteer zu unterscheiden.Da aber in Südfrankreich wie auch in Marokko außer dem Holz
von Juniperus oxycedrus noch andere Juniperusarten zwecks
Gewinnung von Teer der Destillation unterworfen werden, mußten
noch Unterscheidungsmerkmale zwischen den Teeren dieser nahe
verwandten Hölzer gefunden werden, um die Echtheit eines Kade¬öles, das nur aus der trockenen Destillation von Juniperus oxy¬cedrus herrühren darf, zu garantieren. In weitgehendem Maße
widmeten sich R. Huerre in Frankreich und M. Massy in
Marokko diesen Versuchen, und wir können heute, gestützt aufdie Ergebnisse dieser Arbeiten, mit Sicherheit die meisten Teere,die aus andern Juniperusarten oder ihnen verwandten Pflanzen
gewonnen worden sind, erkennen. Da die Verfasser die Teeröle
meistens selbst herstellten und große Sorgfalt darauf verwendeten,ausschließlich Holz einer Stammpflanze zu verarbeiten, so kommt
ihren Untersuchungsergebnissen um so größere Bedeutung zu.
R. Huerre begann seine Untersuchungen mit dem ätherischenöl des Holzes von J. oxycedrus. Er charakterisiert es folgender¬maßen1:
Die Ausbeute an ätherischem öl von 1 kg Holz beträgt ca. 30 g.
Spezifisches Gewicht: 0,925. Drehungsvermögen: —31,42°. Dasöl destilliert vollständig zwischen 260—300°. Durch die Links¬
drehung und die Siedeverhältnisse schloß Huerre auf einen
Gehalt an I-Cadinen im ätherischen öl, das im Oleum cadinum
1Journ. d. Pharm, et Chim. (VII) 12, 273 (1915) und (VII) 23, 81 (1921).
— 93 —
nachgewiesen worden war. Er erhielt durch verschiedene Ver¬
suche das Dichlorhydrat, das Dibromhydrat und das Dijodhydrat
des 1-Cadinens und stellte fest, daß das ätherische öl des Holzes
von J. oxycedrus durchschnittlich ca. 21% 1-Cadinen enthält.
Weitere Versuche1 zeigten, daß das ätherische öl bei der
trockenen Destillation des Holzes ohne Verlust ins pyrogene öl
übergeht. Es dient der Auflösung spezifisch schwererer Teer¬
anteile, die bei der trockenen Destillation aus den Holzelementen
entstehen. Das im ätherischen öl enthaltene 1-Cadinen wird
durch die Hitzeeinwirkung bei der trockenen Destillation nur
zum Teil zerstört. 75—80% des im ätherischen öl enthaltenen
1-Cadinens finden sich im Teeröl wieder vor.
Huerre bereitete ein Kadeöl aus Holz, dem er zuerst durch
Wasserdampfdestination das ätherische öl entzogen hatte2. Auch
stellte er die Teeröle aus Holz von 3. virginiana und Cedrus
Libani her. Die Prüfung dieser drei öle ergab, daß sie vom
echten Kadeöl weder durch die Reaktionen nach Pépin, noch
durch die Destillationsergebnisse unterschieden werden konnten
und somit unbehelligt dem echten Kadeöl unterschoben werden
können.
Analysen anderer als Kadeöle ausgegebener Produkte führten
Huerre dazu, die Ersatzmittel für Kadeöl in drei Gruppen ein¬
zuteilen3.
1. Leichtes Nadelholzteeröl.
2. Produkte, die als „huile de Cade vétérinaire" verkauft werden.
3. öle von andern Coniferen, ausgenommen die Pinusarten.
Das leichte Nadelholzteeröl unterscheidet sich in der Destil¬
lationsprobe nicht vom echten Kadeöl, gibt aber bei der Hirsch-
sohnschen Reaktion starke Grünfärbung und kann so identifiziert
werden.
Für Veterinären Gebrauch untersuchte Kadeöle gaben bei der
Hirschsohnschen Reaktion keine Grünfärbung und genügten
den Anforderungen, die Pépin an die Menge des Gesamtdestillates
von 150—300° stellte. Huerre konnte feststellen, daß es nicht
1 Journ. d. Pharm, et Chim. (VII) 23, 441 (1921).2 Journ. d. Pharm, et Chim. (VII) 19, 33, 65 (1919).
3 Bull. Sc. Pharm. 28, 299 (1921).
— 94 —
genügt, dasMinimum der Destillationsprodukte zwischen 150—300°
festzusetzen, vielmehr muß die Menge der einzelnen Fraktionennäher bestimmt werden. Ein echtes Kadeöl destilliert zu min¬
destens 50% zwischen 250—300". Durch das abweichendeVerhalten konnten Veterinäre öle, die zum großen Teil weit unter
dieser Temperatur destillierten, als gefälscht erkannt werden.Es gibt aber noch Ersatzmittel, wie die schon erwähnten öle
von 3. virginiana und Cedrus Libani, die auch der verschärften
Destillationsprobe sowie allen von Pépin angegebenen For¬
derungen genügen und durch diese Prüfungen als Fälschungennicht erkannt werden können.
Von M. Massy1 wurden zur selben Zeit zwei in Marokko in
den Handel gebrachte Teeröle untersucht. Das eine wird be¬zeichnet als Cedernteer, das andere als Thujateer; sie werden inMarokko „Lerz" und „Arar" genannt. Eine weitere Untersuchungvon M. Massy2 erstreckte sich auf verschiedene Muster desTeeröles von Cedrus atlantica. Der als „Lerz" bezeichnete Teerund die Muster von Cedrus atlantica waren nach dem Unter¬
suchungsgange von Pépin sowie nach der verschärften Destil¬
lationsprobe vom echten Kadeöl nicht zu unterscheiden.Huerre gelang es dann8, aus der Fraktion 250—300° eines
echten Kadeöles durch Behandlung mit Eisessig, der mit trockenemSalzsäuregas gesättigt worden war, Kristalle von 1-Cadinen-
dichlorhydrat abzuscheiden. Hingegen erhielt er mit den ölenvon Cedrus Libani und 3. virginiana unter gleichen Versuchs¬
bedingungen keine Kristalle.
Er vereinfachte die Reaktion, indem er den in Sodalösung un¬
löslichen Teil des Kadeöles mit durch Chlorwasserstoffgas ge¬sättigtem Eisessig in bestimmten Verhältnissen mischte und derRuhe überließ. Huerre4 stellte das 1-Cadinendichlorhydratfolgendermaßen dar:
25 ccm Kadeöl werden in einem Scheidetrichter mit 25 g einer NaOH-Lösung (enthaltend 10 g Natronlauge, 30°/0ig, + 25 g Wasser) gemischt und
13oum. d. Pharm, et Chim. (VII) 21, 433 (1920).
2 Journ. d. Pharm, et Chim. (VII) 24, 294 (1921).3
Bull. Sc. Pharm. 28, 508 (1921).4 Bull. Sc. Pharm. 28, 509 (1921).
— 95 —
während einer Stunde einige Male kräftig durchgeschüttelt. Nach 6 Stunden
wird die Alkalilauge abgelassen, die überstehende Schicht solange mit je25 ccm Wasser gewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr alkalisch reagiert.Dann gibt man 25 ccm Äther zu, trocknet die ätherische Lösung mit ent¬
wässertem Natriumsulfat, destilliert den Äther ab und wägt den Rückstand.
5 g des Rückstandes werden langsam, unter Verhütung eines Temperatur¬
anstieges zu 15 g mit Chlorwasserstoffgas gesättigtem Eisessig gegeben (in
eine Glasstöpselflasche). Man schüttelt gut durch und läßt 12 Stunden stehen.
Dann gießt man die Mischung, auch wenn sich schon Kristalle gebildet haben
sollten, in eine weite Kristallisierschale und kühlt während einigen Tagen.Nach eingetretener Kristallisation nutscht man die Kristalle ab und wägt
sie nachher.
Das Gewicht der rohen Kristalle kann natürlich keinen An¬
haltspunkt über den Gehalt eines Öles an 1-Cadinen geben.Huerre1 erhielt von je 25 ccm verschiedener öle Ausbeuten von
0,21 — 0,40 g Rohkristallen von 1-Cadinendichlorhydrat.Huerre erhielt auch bei dieser Versuchsanordnung nur mit
echtem Kadeöl Kristalle von 1-Cadinendichlorhydrat. Keine
Kristallbildung gaben: leichtes Nadelholzteeröl, ein als „huile de
Cade vétérinaire" bezeichnetes öl, ein aus kleinen Zweigen und
Blättern von Thuja occidentalis hergestelltes Teeröl, die öle von
3. virginiana und Cedrus Libani sowie das öl von Cedrus atlantica,
obschon dasselbe r-Cadinen enthält und Kristallbildung von
r-Cadinendichlorhydrat hätte möglich sein können.
Von einem einzigen echten Kadeöl konnte Huerre keine
Kristalle erhalten. Dieses öl stammte aber aus einem Holz, das
überaus arm an ätherischem öl gewesen und überdies sehr lange
aufbewahrt worden war. Es ist somit auf diese Weise auch
möglich, ein Kadeöl, das aus Holz, dem das ätherische öl ent¬
zogen wurc-e, herrührt, als gefälscht zu erkennen, da ein solches
öl auch keine Kristalle von 1-Cadinendichlorhydrat liefern würde.
Huerre schließt aus diesen Untersuchungen, daß ein öl, das
unter den angegebenen Bedingungen Kristalle von 1-Cadinen¬
dichlorhydrat bildet und die Forderungen von Pépin erfüllt sowie
der verschärften Destillationsprobe genügt, als echtes Kadeöl an¬
gesehen werden muß.
Bei der Untersuchung des marokkanischen Teeres von Cedrus
atlantica bestimmte Massy das Drehvermögen des ätherischen
1Bull. Sc. Pharm. 28, 509 (1921).
— 96 —
Öles, das mit Wasserdampf aus den in Natronlauge unlöslichen
Anteilen des Teeröles gewonnen worden war1.
Er dehnte später diese Untersuchungen auch auf Teeröle von
3. oxycedrus, 3. phoenicea und 3. thurifera aus2.
Massy arbeitete nach folgender Methode3:
50 ccm Teeröl werden mit 25 ccm 5°/oiger Natronlauge gemischt und der
Wasserdampfdestillation unterworfen. Der Kolben wird im Ölbad auf ca. 120°
erhitzt. Seine Flüssigkeitsmenge soll konstant bleiben. Die Destillations¬
produkte werden durch ein feuchtes Filter in einem Meßzylinder aufgefangen.Nachdem 500 ccm Wasser übergegangen sind, wird das Filter gewechselt.Die Destillation wird beendigt, sobald 1500 ccm Wasser übergegangen sind.
Das ätherische öl, das sich im Filter gesammelt hat, fängt man nach Ab¬
laufen des Wassers und Durchstoßen des Filters in einem kleinen Meßzylinderauf. Ist es zu stark gefärbt oder in ungenügender Menge vorhanden, so
wird es für die Untersuchung im Polarimeter mit Chloroform verdünnt, indem
man den Verdünnungsgrad berücksichtigt.
In einer frühern Mitteilung hatte Massy4 noch mehr Fraktionen
abgenommen und zwar nach Ablauf von 100, 300, 700 und
1400 ccm Wasser.
Huerre6 bemerkt zu der Methode von Massy, daß es zweck¬
mäßiger sei, das öl zuerst von den in Natronlauge löslichen
Anteilen zu befreien und es erst dann der Wasserdampfdestillationzu unterwerfen, da die Einwirkung der heißen Natronlauge währendder Wasserdampfdestillation das Rotationsvermögen des 1-Cadinens
schädigen könne.
Die fiauptresultate der polarimetrischen Untersuchungen von
Massy und Huerre sind die folgenden:Sieben echte Kadeöle, untersucht von Huerre6, wiesen Links¬
drehungen von —5,2° bis — 29,2° auf. Das aus kleinen Zweigenund Blättern von Thuja occidentalis hergestellte öl zeigte eine
schwache Linksdrehung von —4,3°7; doch destillierte es anders
1Journ. d. Pharm, et Chim. (VII) 24, 297 (1921).
2Bull. Sc. Pharm. 29, 625 (1922); Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 4,64(1926).
3Bull. Sc. Pharm. 29, 622 (1922).
4 Journ. d Pharm, et Chim. (VII) 24, 297 (1921).5Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 7, 66 (1928).
6 Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 3, 317 (1926).' Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 3, 201 (1926).
— 97 —
als Kadeöl und gab keine Kristalle von 1-Cadinendichlorhydrat.Ein Birkenteeröl zeigte +2,6° und +4,8° \
Vier Proben eines Öles von Cedrus atlantica zeigten nach
Massy Rechtsdrehungen von +20° bis +45°. Fünf Proben
von ölen von 3. oxycedrus zeigten Linksdrehungen von —5,4°
bis —12,6 °2.
Ebenfalls Linksdrehungen wiesen öle von 3. phoenicea und
3. thurifera auf3. 3. phoenicea gibt nach Pépin eine positive
Reaktion nach Hirschsohn und kann dadurch erkannt werden4.
Massy und Huerre sind darüber einig, daß ein echtes Kadeöl
immer linksdrehend ist5. Die Linksdrehung beruht auf dem
Gehalt an 1-Cadinen. Für reines 1-Cadinen wurde bestimmt
[af£>= -98,56«.
Nach all den vorausgegangenen Ausführungen kämen demnach
für eine einwandfreie Charakterisierung des Kadeöles besonders
folgende Prüfungen in Betracht:
1. Bestimmung des spezifischen Gewichtes.
2. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.
3. Destillationsprobe mit Abnahme der Fraktionen von 150—200°,
von 200— 250°. von 250—300°.
4. Abscheidung von 1-Cadinendichlorhydrat aus den in Natron¬
lauge unlöslichen Anteilen mit durch Chlorwasserstoffgas
gesättigtem Eisessig.5. Optische Drehung des von den natronlaugelöslichen Anteilen
befreiten, mit Wasserdampf destillierten Kadeöles.
Wir überprüften die nach vorliegenden Ausführungen sich er¬
gebenden Untersuchungsmethoden sowie die Prüfungsvorschriften
der verschiedenen Pharmakopoen an Hand zweier Handelsmuster
Kadeöl. Das eine wurde uns von Schimmel & Co. in Leipzig
geliefert und als unzweifelhaft echtes, aus Südfrankreich stam-
1 Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 3, 317 (1926).2 Bull. Sc. Pharm. 29, 625 (1922).J Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII) 4, 64 (1926).4 Bull. Sc. Pharm. 28, 509 (1921).6 Bull. Sc. Pharm. 29, 625 (1922); Huerre, Journ. d. Pharm, et Chim. (VIII)
3, 317 (1926).6Liebigs Annalen 271, 303 (1892).
Qensler-Koch. 7
— 98 —
mendes Oleum cadinum verum D. A. B. 6 erklärt. Das zweite
Muster, Oleum cadinum Helv. IV, übersandte uns die Firma
A.-G. vormals B. Siegfried in Zofingen und bezeichnete es als
ein technisches Großprodukt aus der Provence.
Ein echtes Kadeöl muß durch trockene Destillation des Holzes
von Juniperus oxycedrus L gewonnen worden sein.
Ergänzungsbuch zum D. A. B. 5 läßt neben J. oxycedrus L
auch andere Juniperusarten zu, ebenso D. A. B. 6, was nicht ver¬
ständlich ist. Nederl. IV und V, ü. S. A. IX und X, Gall. (Suppl. 1920),Brit. und Ital. geben nur J. oxycedrus L als Ausgangsmaterial an.
1. Sinnenprüfung.
Das Kadeöl bildet in dicker Schicht eine schwarzbraune, in
dünner Schicht eine gelbe Flüssigkeit von sirupähnlicher Be¬
schaffenheit, rauchigem Geruch und scharfem Geschmack.
Diese Angaben finden sich auch in Helv. IV, Ergänzungsbuchzum D. A. B. 5, im D. A. B. 6, in Nederl. IV und V, Gall. (Suppl. 1920),U.S.A. IX und X und Brit.
Von unsern Mustern zeigte das Oleum cadinum Helv. IV eine
dickflüssigere Beschaffenheit, und der Ausstrich auf einer Glas¬
platte war bedeutend klebriger als beim Oleum cadinum D. A. B. 6.
Es war von stark harzartigem Geruch, während derjenige des
Oleum cadinum D. A. B. 6 rein rauchig war.
2. Prüfung des Teerwassers.
5 ccm öl werden mit 95 ccm Wasser während 10 Minuten
kräftig geschüttelt. Das gelbliche Filtrat rötet blaues Lackmus.
Von den von uns untersuchten Proben zeigte das Teerwasser
von Oleum cadinum D.A.B. 6 einen pH von 4,8—5,0, dasjenigevon Oleum cadinum Helv. IV einen pH von 3,8.
D. A. B. 6 läßt das Teerwasser von 2 g Teer mit 25 ccm Wasser
bereiten, ü. S. A. IX und X von 1 Teil öl mit 20 Teilen warmem
Wasser, Nederl. V aus 1 Tropfen Teer mit 5 ccm Wasser, Gall.
(Suppl. 1920) und Helv. IVgeben keine genauen Konzentrationen an.
Das Teerwasser wird nach den Vorschriften der Pharmakopoenmit folgenden Reagenzien geprüft:
— 99 —
Eisenchloridlösung (0,1 n): 5 ccm Teerwasser werden mit
1 Tropfen Eisenchloridlösung versetzt. Es tritt eine grünliche
Färbung ein, die rasch in braunrot übergeht.
Diese Reaktion wird in den verschiedenen Pharmakopoen ver¬
schieden gehandhabt, und dementsprechend werden auch ver¬
schiedene Färbungen konstatiert. D. A. B. 6 läßt 10 ccm Teer¬
wasser mit 3 Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung 1 + 9
(ca. 0.1 n) versetzen und gibt rötlichbraune Färbung der Flüssigkeit
an, Helv. IV erhält mit Eisenchloridlösung 1:1000 eine braun¬
rote Färbung. U. S. A. IX und X benutzen ebenfalls eine Lösung
1:1000 und geben rote Färbung der Flüssigkeit an. L. Rosen-
thaler1 bemerkt zu der Prüfung des D. A. B. 6, daß das Teer¬
wasser mit sehr wenig Eisenchloridlösung eine schmutziggrüne
Färbung gebe, die erst bei weiterm Zusatz des Reagens ins
Rötlichbraune übergehe, ti. Thoms und F. Unger2 bestätigen
diese Wahrnehmung Rosenthalers.
Wir stellten bei Anwendung von n-, 0,1 n- und 0,01n-Eisen-
chloridlösung zuerst immer eine schmutziggrüne Färbung fest,
die rasch verschwand und ins Rotbraune überging. Wesentliche
Bedeutung kommt den verschiedenen Färbungen nicht zu. Wie
wir schon bei Pix liquida festgestellt haben, unterscheiden sich
die Färbungen des Teerwassers von Pix liquida und Oleum cadinum
mit Eisenchloridlösung nicht voneinander, und somit könnte diese
Prüfung für Oleum cadinum ausgeschaltet werden. Sie findet
sich z. B. auch in Nederl. V nicht.
Kalkwasser: 3 ccm Teerwasser + 3 ccm Kalkwasser geben
in einem nur zur Hälfte gefüllten Reagensglas stark geschüttelt
eine rotbraune Färbung.
Diese Reaktion wird in keiner Pharmakopoe für Oleum cadinum
angegeben, wohl aber für Pix liquida; sie wird aber auch mit
Oleum cadinum erhalten. Sie fällt jedoch abweichend aus mit
Buchenholzteer (siehe Seite 77).
1 Pharm. Ztg. 7, 1540 (1926).2 Archiv der Pharmazie 264, 615 (1926)
7*
— 100 —
Bromwasser: 5 ccm Teerwasser werden durch einige TropfenBromwasser weißlich getrübt (Phenole).
Diese Prüfung erwähnt Nederl. V.
Ammoniakalische Silbernitratlösung: 5 ccm ammonia-
kalisches Silbernitrat werden durch einige Tropfen Teerwasser
in der Kälte sofort reduziert.
Diese Prüfung findet sich in Helv. IV, D. A. B. 6, ü. S. A. IX
und X, Ital. und Svenska. In Nederl. V fehlt sie.
Fehlingsche Lösung: 3 ccm Fehlingsche Lösung werden
durch 6 ccm Teerwasser in der Hitze reduziert.
Es verwenden diese Prüfung: Helv. IV, U.S.A. IX und X und
Ital. Nicht aufgeführt wird sie in: Nederl. IV und V, Ergänzungs-buch zu D.A.B. 5, D.A.B. 6, Gall. (Suppl. 1920) und Svenska.
Anilinacetat1: 5 ccm Teerwasser werden durch 2 ccm Anilin-
acetat innerhalb weniger Minuten mehr oder weniger rosarot
gefärbt. Die Färbung entsteht auch, wenn man auf einen mit
Teerwasser benetzten Filtrierpapierstreifen einige Tropfen Anilin¬
acetat bringt (Nadelholzteer gibt die gleichen Färbungen).Die Rosafärbung trat bei dem von uns untersuchten Oleum
cadinum D. A. B. 6 schwächer, beim Oleum cadinum Helv. IV
stärker auf als bei den Nadelholzteeren. Die Intensität der Färbungkann aber wohl nicht als charakteristisches Unterscheidungs¬merkmal dienen.
Kaliumbichromatlösung (ca. n): 5 ccm Teerwasser nehmen
durch Zugabe von 5 Tropfen Kaliumbichromatlösung zuerst eine
gelbe, nach einigen Minuten unter Trübung der Lösung dunkel¬
braun werdende Färbung an. Helv. IV verwendet diese Reaktion
zur Unterscheidung des Oleum cadinum vom Oleum Rusci, bei
welchem die Mischung sofort dunkelbraun und trübe werden
soll. D. A. B. 6 führt die Prüfung ebenfalls an. Sie ist aber
keineswegs charakteristisch. Die Zeitdauer bis zur Dunkel¬
färbung gestattet keinen eindeutigen Schluß auf die Herkunft
eines Teeres.
1 Journ. d. Pharm, et Chim. (VI) 24, 252 (1906).
— 101 —
Die Dunkelfärbung trat bei unserm Oleum cadinum D. A. B. 6
etwas schneller, beim Oleum cadinum Helv. IV etwas langsamer
ein als bei den untersuchten Nadelholzteeren.
Kaliumcyanidlösung (ca. n): 3 ccm Teerwasser nehmen auf
Zusatz von 1—2 Tropfen Kaliumcyanidlösung eine gelbe Farbe
an. Über diese Reaktion soll bei Oleum Rusci noch ausführ¬
licher gesprochen werden (siehe Seite 120).
Vergleicht man den Ausfall der angegebenen Prüfungen des
Teerwassers mit denen des Nadelholzteeres (siehe Seite 75), so
sieht man, daß keine dieser Reaktionen für Oleum cadinum charak¬
teristisch ist. Sie können darum bis auf die Probe mit Kalk¬
wasser und diejenige mit Bromwasser unbedenklich gestrichen
werden.
Die Prüfung mit Kalkwasser unterscheidet den Nadelholzteer
und das Oleum cadinum vom Buchenholzteer, die Reaktion mit
Bromwasser ist eine qualitative Prüfung auf Phenole.
3. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit.
Oleum cadinum löst sich im Verhältnis 1:10 klar in Alkohol
absol., Spiritus, Chloroform, Eisessig, Aceton und Anilin und
zum großen Teil in Äther. Die Lösung in Alkohol absol., Spiritus,
Eisessig und Äther gibt nach einiger Zeit flockige Ausscheidungen.
Helv. IV fordert klare Lösung mit 3 oder mehr Teilen Äther,
Amylalkohol und Chloroform, trübe Lösung mit Petroläther und
Schwefelkohlenstoff. D.A.B. 6 gibt völlige,Löslichkeit in Äther
und Chloroform, beschränkte Löslichkeit in Petroläther und
Weingeist an. Die ätherische Lösung zeigt meist nach kurzer
Zeit flockige Ausscheidungen. Nach Nederl. V löst sich Kadeöl
in Alkohol absol., Äther, Schwefelkohlenstoff, Anilin und zu 9/,0
in Petroläther. Mit dem vierfachen Volum Spiritus entsteht eine
trübe Mischung, die beim Erwärmen heller wird, nach dem
Erkalten die Hälfte des Öles aber wieder ausscheidet. Gall.
(Suppl. 1920) gibt völlige Löslichkeit in Äther, Eisessig, Benzol
und Chloroform, beschränkte Löslichkeit in Alkohol von 90% an-
Nach ü. S. A. IX und X ist das Öl z. T. löslich in Alkohol oder
Petrolbenzin, ganz im dreifachen Volum Äther, in allen Propor-
— 102 —
tionen mit Amylalkohol, Chloroform, Eisessig oder Terpentinöl.Nach Brit. völlig in Äther und Chloroform, z. T. in kaltem, ganz
in heißem Alkohol von 90 %, nach Svenska ganz in Äther,Chloroform, Benzol, z. T. in Schwefelkohlenstoff und Alkohol.
Nach Ital. völlig in Äther, Chloroform, Alkohol absol., trübe mit
Benzin, Schwefelkohlenstoff.
Wir untersuchten das Verhalten der beiden Handelsmuster
gegenüber folgenden Lösungsmitteln im Verhältnis 1:10.
Oleum cadinum D. A. B. 6 Oleum cadinum Helv. IV
sofort nach 18 Stunden sofort nach 18 Stunden
Alkohol absolut.
Alkohol 95°/o .
Äther
Aceton
Chloroform . . .
Terpentinöl. . .
Amylalkohol . .
Schwefelkohlen¬stoff
fast vollkommen
fast vollkommen
| flockigerI Bodensatz
M
Bodensatz
1 flockige(Ausscheidungen
Bodensatz
=
etwas Bodensatz
» »
| flockigerl Bodensatz
Bodensatz
1 starke
(Ausscheidungen
wenige Flocken
Ausscheidungen
= bedeutet vollkommen löslich. — bedeutet unvollkommen löslich.
Wie später zu ersehen ist, kann aus den Löslichkeitsforderungenkein Schluß auf die Echtheit eines Öles gezogen werden. Stark
gefälschte Produkte können den Löslichkeitsforderungen ebenfalls
genügen. Es sollte darum in einer Pharmakopoe vermieden
werden, allzuviele Lösungsmittel anzugeben und Beschränkungauf wenige vorgezogen werden.
Unseres Erachtens könnte man sich damit begnügen, das Ver¬
halten gegenüber Weingeist 95volumprozentig und Terpentinölanzugeben, wobei die verschiedenen Holzteere immerhin gewisseUnterschiede zeigen.
Mischbarkeit: Oleum cadinum ist mischbar mit Vaselin,Fetten und fetten ölen.
- 103 —
4. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.
lccmTeer wird in einem mit Glasstöpsel verschlossenen Erlen¬
meyer mit 15 ccm Petroläther kräftig geschüttelt. 10 ccm des
gelbbraunen Filtrates werden hierauf mit 10 ccm einer l%igen
Kupferacetatlösung in einem kleinen Scheidetrichter gut durch¬
geschüttelt. Nach Trennung der Schichten wird die Kupferacetat¬
lösung abgelassen, 5 ccm der Petrolätherschicht werden mittels
einer Pipette herausgehoben und in einem kleinen Meßzylinder
mit 10 ccm Äther verdünnt. Die Petrolätherschicht darf nur
eine gelblichbraune, nicht aber eine grüne Farbe annehmen (Nadel¬
holzteer und Teer von Juniperus phoenicea).
U.S. A IX und X benutzen eine Kupferacetatlösung 1:100 und
verdünnen die abgetrennte Petrolätherschicht mit gleichem Volum
Äther. D. A. B. 6 hat diese Prüfung merkwürdigerweise nicht auf¬
genommen. Brit. und Nederl. V übernehmen die Verhältnisse von
Pépin (siehe bei Nadelholzteer). Kommentar zu Nederl. V gibt
Grünfärbung der Petrolätherlösung auch bei Anwesenheit des
Teeröls von Cedrus Libani, Cedrus atlantica, 3. virginiana und
3. phoenicea an. Nach den Untersuchungen von Hu erre und
Massy zeigt aber von diesen Teeren nur derjenige von 3.phoenicea
Grünfärbung.
Von den von uns untersuchten Produkten gab Oleum cadinum
D.A.B.6 bei der Reaktion nach tiirschsohn-Pépin nur schwach
gelbbraune Färbung, das Oleum cadinum fielv. IV intensiv grüne
Farbe. Dieses muß demnach als nicht einwandfrei angesehen
werden.
5. Spezifisches Gewicht.
Läßt man Oleum cadinum in ein mit Wasser von 15° gefülltes
Becherglas tropfen, so sollen die Tropfen sich an der Oberfläche
des Wassers sammeln.
Nach fielv. IV liegt es zwischen 0,990—1,05, nach Nederl. IV
zwischen 0,98—1,00, nach Nederl. V zwischen 0,98 — 1,05. Gall.
(Suppl. 1920) verlangt das spezifische Gewicht kleiner als 1,0;
U. S. A. IX und X zwischen 0,98—1,05 bei 25°, Brit. 0,990, Svenska
in der Regel unter 1,0 und Ital. zwischen 0,99—1,05. D.A.B. 6
— 104 —
hat das spezifische Gewicht nicht begrenzt. Nach Untersuchungenvon H.Thoms und F.Unger1 schwankte das spezifische Gewicht
von Kadeölen zwischen 0,974—1,07.Unser Oleum cadinum D. A. B. 6 zeigte ein spezifisches Gewicht
von 0,998, Oleum cadinum Helv. IV ein solches von 1,041.Wir sind der Meinung, daß die von den Pharmakopoen meist
angenommene obere Grenze von 1,05 zu hoch ist. Nach den
einläßlichen Untersuchungen von Pépin muß das spezifischeGewicht eines echten Kadeöles kleiner sein als 1,0.
6. Verbrennungsrückstand.
Der Verbrennungsrückstand, bestimmt mit ca. 1 g Substanz
(genau gewogen), darf höchstens 0,25% betragen.In den Pharmakopoen finden sich hierüber keine Angaben.
Unser Oleum cadinum D. A. B. 6 gab 0,3%, Oleum cadinum
Helv. IV 0,12% Verbrennungsrückstand.
7. Bestimmung der Gesamtsäure.
In einen mit Siedesteinchen versehenen Rundkolben von 500 ccmInhalt werden ca. 10 g Teer auf 0,1 g genau eingewogen und
30 ccm Wasser zugesetzt. Der Kolben wird angewärmt und die
Mischung sodann der Wasserdampfdestillation unterworfen. Eswerden durch ein befeuchtetes Filter in einem Meßkolben 500 ccm
Destillat aufgefangen. Das Filter dient zur Zurückhaltung des
ätherischen Öles.
100 ccm des Destillates (=2 g Teer) werden mit einigen TropfenPhenolphthaleinlösung versetzt und mit 0,ln-NaOH titriert.
1 ccm 0,1 n-NaOH = 0,006 g Essigsäure.
Die gefundene Menge Essigsäure, mit 50 multipliziert, ergibtden Prozentgehalt des Teeres an Säure, berechnet als Essigsäure.
Der Gehalt an Gesamtsäure, berechnet als Essigsäure, im Oleumcadinum soll nicht über 1,5% betragen.Kommentar zu Nederl. V gibt an, daß die Gesamtsäure, als
1 Archiv der Pharmazie 264, 615 (1926).
— 105 —
Essigsäure berechnet, ungefähr 1% ausmache. Die Pharma¬
kopoen bestimmen den Gehalt an Essigsäure nicht.
Unser Oleum cadinum D. A. B. 6 enthielt 0,66%) Oleum
cadinum Helv. IV, 0,62 % Gesamtsäure.
8. Probedestillation.
50 g Kadeöl werden auf 0,1g genau in einen mit Siedesteinchen
versehenen tarierten Siedekolben von 200 ccm Inhalt eingewogen.
Der Siedekolben wird mit einem Kühlmantel versehen und das
Thermometer in gewöhnliche Destillierstellung gebracht. Der
Kolben wird auf dem Drahtnetz unter dem Abzug langsam
erhitzt. Um eine regelmäßige Erhitzung zu erreichen, umwickelt
man den Kolben zweckmäßig mit Asbestpapier. Nach Abnahme
der ersten Fraktion wird das Kühlwasser abgestellt. Die erste
Fraktion wird in einem kleinen tarierten Meßzylinder von 10 ccm
Inhalt, die andern in tarierten Bechergläsern aufgefangen.
Es werden vier Fraktionen abgenommen:
die erste Fraktion bis 150°
die zweite Fraktion von 150—200°
die dritte Fraktion • von 200 —250°
die vierte Fraktion von 250— 300°.
Das bei 250° übergehende Destillat ist von zitronengelber Farbe,
die bei weiterem Fortgang der Destillation ins Grüne und in der
Nähe von 300° endlich ins Grünschwarze übergeht. Das Destillat
des Nadelholzteers ist zuerst auch gelb, nimmt aber gegen 300°
eher eine bräunliche Farbe an.
D. A. B. 6 verlangt, daß von 100 ccm Kadeöl bei der Destillation
bis 300° mindestens 50 ccm übergehen müssen. Nach Nederl. V
muß das öl zu Dreiviertel zwischen 150° und 300° destillieren,
davon die Hauptmenge zwischen 260° und 300° und unter 150°
in der Regel nicht mehr als 2%> Nederl. IV forderte sogar,
daß Dreiviertel des Öles zwischen 250° und 275° destillieren
sollen, eine Angabe, die auch für echte öle zu hoch ist. Ital. verlangt,
daß zwischen 150° und 300° 65% des Öles überdestillieren.
Die von uns untersuchten Handelsmuster lieferten folgende
Resultate:
— 106 —
bis
150"*
/o
ccm
wässerigenDestillates
pro 100 gTeer
150"bis
200"
°/10
200"bis
250"
«/10
250"bis
300"
0/10
150"
bis
300"
°/10
Rück¬
stand
°/10
Ver¬
lust
°/o
Oleum cadinum
D. A. B. 6
Helv. IV
1,2
6,0
1,0
5,5
0,2
1,8
7,4
9,6
69,0
15,6
76,6
27,0
11,0
65,2
0,4
1,8
* Diese Fraktion bestand in der Hauptsache aus einem wässerigen Destillat,welches von einer kleinern Menge eines gelblichen Öles bedeckt war. Diezweite Kolonne gibt die Menge des wässerigen Destillates an.
Unseres Erachtens können für Kadeöl folgende Forderungenaufgestellt werden:
1. Unter 150° dürfen höchstens 2°/n übergehen.2. Zwischen 250" und 300" müssen mindestens 50°/0 übergehen,
wie auch schon von Huerre gefordert worden ist.
3. Zwischen 150" und 300° müssen mindens 75"/0 übergehen;diese auch von Nederl. V aufgestellte Forderung fanden wir bei
unserm Oleum cadinum D. A. B. 6 erfüllt. Das Oleum cadinumHelv. IV entspricht in keiner Weise obigen drei ersten An¬
forderungen und muß demnach als ein falsches Kadeöl be¬
zeichnet werden.
4. Das bei ca. 250° übergehende Destillat muß zitronengelb sein,welche Farbe gegen 300° ins Grüne übergeht.
Von den von uns untersuchten Mustern zeigte Oleum cadinumD. A. B. 6 genau die beschriebene Färbung der Destillate, währendbei Oleum cadinum Helv. IV bei 250" wohl eine Gelbfärbung,gegen 300" aber nur eine sehr schwache Grünfärbung auftrat.Dieses Verhalten deutet darauf hin, daß letzteres Muster von
Oleum cadinum höchstens geringe Mengen echtes Kadeöl enthält.
9. Reaktionen der Destillate.
1. 1 ccm Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,62) wird durcheinen Tropfen der Fraktion 250— 300° zuerst orange, dann rot
gefärbt.
— 107 —
Diese bei Holde angegebene Reaktion für Nadelholzteer fällt
auch mit Kadeöl und Birkenteer positiv aus und kann daher nicht
zur Unterscheidung dieser Teere benützt werden.
2. Wir versuchten weiter, die Storch-Morawskische Reaktion
auf Harzsäuren (siehe Seite 84) auch auf Kadeöl anzuwenden
und erhielten folgenden Befund:
Ein Tropfen der Fraktion 250— 300° wird in 1 ccm Essigsäure¬
anhydrid unter Verreiben mit dem Glasstab kalt gelöst und mit
einem Tropfen Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,53) versetzt.
Es tritt eine grüne, sofort intensiv blaugrün werdende Färbung
ein, die bald verblaßt.
Wallach1 gibt eine ähnliche Reaktion des Cadinens an: Ver¬
setzt man die Lösung in viel Eisessig nach und nach mit einigen
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure, so färbt sich die Lösung
nach dem Umschütteln zuerst intensiv grün, dann indigoblau
und beim Erwärmen rot.
Nadelholzteer gibt bei der Storch-Morawskischen Reaktion
keine grüne, sondern rote bis rotviolette Färbungen. Die Reaktion
erscheint daher sehr geeignet zur Unterscheidung des Kadeöls
vom Nadelholzteer.
Von den von uns untersuchten Mustern zeigte nur das Oleum
cadinum D. A. .B 6 die grüne Färbung; Oleum cadinum Helv. IV
verhielt sich wie Nadelholzteer und zeigte eine rotviolette Färbung.
10. Prüfung auf Buchenteeröle.
Wir versuchten, die von Bordas und Touplain aufgefundenen
und für Buchenteeröle charakteristischen Farbreaktionen des
Coerulignols bzw. Coerulignons auch auf Kadeöl anzuwenden.
Das Ergebnis ist das folgende:
3 Tropfen der Fraktion 200—250° des Kadeöls werden in
3 ccm Petroläther gelöst und mit 3 ccm Barytwasser tüchtig
geschüttelt. Es darf keine stahlblaue Färbung eintreten. Nach
Trennung der Schichten muß die untere Schicht hellbraun, die
obere schwach gelblich sein.
1
Liebigs Annalen 28, 87 (1887).
— 108 —
Buchenteeröle geben eine schöne stahlblaue Färbung, die baldin graublau übergeht. Nach Trennung der Schichten bleibt diePetrolätherschicht bläulich, während die Barytwasserschicht, dieeinen flockigen Niederschlag enthält, graugrüne Farbe annimmt.
Die Reaktion ist brauchbar zur Unterscheidung des Kadeölsvon Buchenteerölen.
11. Abscheidung von 1-Cadinendichlorhydrat.
Wir verfuhren nach der Vorschrift von fiuerre mit kleinen
Änderungen auf folgende Weise:
50 ccm öl +10Ö ccm NaOfi 2 n werden in einem graduiertenScheidetrichter abgemessen und während einer halben Stundeöfters stark durchgeschüttelt. Dann läßt man stehen, bis sich dieSchichten getrennt haben. Die Phenolatiauge wird abgelassen, die
überstehende Schicht im Scheidetrichter so oft mit je 50—100 ccm
Wasser gewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr alkalisch
reagiert. Der in Natronlauge unlösliche, gewaschene Anteil wirdin Äther aufgenommen, mit entwässertem Natriumsulfat getrocknet,vom Äther abdestilliert und gewogen.
5 g des Rückstandes1 werden in einer Glasstöpselflasche von
20 ccm Inhalt mit 15 ccm Eisessig, der mit trockenem Chlor¬
wasserstoffgas gesättigt wurde, unter Vermeidung einer Erwärmungvermischt und 12 Stunden der Ruhe überlassen. Dann gießtman die Mischung, auch wenn sich schon Kristalle gebildet haben
sollten, in eine geräumige Kristallisierschale und stellt während
einigen Tagen in die Kälte.
Die ausgeschiedenen Kristalle werden abgenutscht und durchwiederholte Kristallisation aus heißem Essigester gereinigt. Der
Schmelzpunkt der Kristalle soll zwischen 117° und 119° liegen.Der in Natronlauge unlösliche Rückstand unseres Oleum cadinum
D. A. B. 6 betrug für 50 ccm öl 29,5 g. Es lieferte uns nach drei
Tagen im Eisschrank schöne Kristallnadeln. Der Schmelzpunktder gereinigten Substanz lag bei 117,5° (korrigiert 118,8°). Derin Natronlauge unlösliche Rückstand unseres Oleum cadinum
1Der Rest dieses Rückstandes wurde nach Wasserdampfdestillation zur
Bestimmung des Drehungsvermögens benützt.
— 109 —
Helv. IV betrug für 50 ccm öl 24,5 g. Er unterschied sich im
Geruch vom Rückstand des andern Öles. 5 g dieses Rückstandes
färbten sich auf Zusatz des mit Chlorwasserstoffgas gesättigten
Eisessigs tiefrot, während die Mischung von Oleum cadinum
D. A. B. 6 braune Farbe annahm. Oleum cadinum Helv. IV zeigte
auch nach vierzehntägigem Stehen im Eisschrank keinerlei Kristall¬
bildung. Der Gehalt an echtem öl in diesem gefälschten öl muß
demnach sehr gering sein.
12. Drehungsvermögen des von den natronlaugelöslichenAnteilen befreiten, mit Wasserdampf destillierten Kadeöls.
Wir wandten die Methode von Massy an. Doch umgingen
wir, um das Rotationsvermögen des 1-Cadinens nicht zu schädigen,
die Behandlung des Öles mit Natronlauge in der flitze, wie sie
Massy in seiner Versuchsanordnung beschreibt. Wir verwendeten
für die Wasserdampfdestillation das von den natronlaugelöslichen
Anteilen befreite Kadeöl, soweit es nicht zur Abscheidung des
1-Cadinendichlorhydrates verwendet worden war.
Die Flüssigkeit wird der Wasserdampfdestillation unterworfen
und das Destillat durch ein befeuchtetes Filter in einem ge¬
räumigen Meßzylinder aufgefangen. Das Filter hält das ätherische
öl zurück. Es wird destilliert, bis 1,5 Liter Destillat übergegangen
sind. Dann wird der Trichter entfernt und das Filter über einem
tarierten Kölbchen durchstoßen. Die Menge des so erhaltenen
ätherischen Öles wurde gewogen.
2 g des ätherischen Öles (genau gewogen) werden mit Essig¬
ester auf 20 ccm verdünnt. Hierauf wird im 2 dm-Rohr die
optische Drehung bestimmt.
Der von Phenolen befreite Anteil eines echten Kadeöles muß
linksdrehend sein.
Unseres Erachtens könnte gefordert werden, daß [a]^00 mindestens
—4° betragen muß. Huerre fand bei sieben echten ölen —5,2°
bis -29,2°; Massy bei fünf ölen -5,4U bis -12,6°.
23 g unseres von Phenolen befreiten und mit Wasserdampf
destillierten Oleum cadinum D.A. B. 6 gaben bei der Destillation
von 1,5 Liter Wasser 12,30 g ätherisches öl. [a]^° = —4,4°. Das
— 110 —
ätherische öl, das bei Fortsetzung der Destillation aus einem
weitern halben Liter aufgefangen wurde, wog 2,4 g und war
dunkler gefärbt. Es war stärker linksdrehend, [a]p° = —7,92°.Massy machte die nämlichen Beobachtungen bei der Be¬
stimmung der optischen Drehung einiger Muster Kadeöl.Unser Oleum cadinum Helv. IV lieferte von 18,4 g des von
Phenolen befreiten und mit Wasserdampf destillierten Kadeölsnur 4,1 g ätherisches öl im Destillat bis zu 1,5 Liter. Bei Fort¬
setzung der Destillation wurde aus einem weitern halben LiterDestillat noch 0,4 g ätherisches öl gewonnen. Die optischeDrehung der ersten ölfraktion war +15,94°. Daß es sich beimOleum cadinum Helv. IV um ein gefälschtes öl handelte, trat
somit auch hier klar zutage.
13. Zusammenfassung.Aus unsern vorstehenden Untersuchungen ergibt sich, daß es
heute möglich ist, unter Benützung der von verschiedenenForschern ausgebildeten Methoden, deren zweckmäßige Auswahlund Ausführung in vorstehendem dargelegt worden ist, ein echtes
Kadeöl zu unterscheiden von gefälschten Produkten. Außer demNadelholzteer und dem leichten Nadelholzteeröl können Teeröle
von verwandten Juniperusarten wie 3. virginiana und phoeniceaund Cedernteeröle von Cedrus Libani und atlantica sowie Thujaoccidentalis erkannt werden.
Besonders wertvoll erscheinen die folgenden Methoden:1. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.2. Destillationsprobe.3. Abscheidung von Kristallen des 1-Cadinendichlorhydrates.4. Bestimmung des Drehvermögens des von den natronlauge¬
löslichen Anteilen befreiten, mit Wasserdampf destilliertenKadeöles.
C. Birkenteer.
Oleum Rusci, Oleum Betulae empyreumaticum, Pix Betulae.
Die hauptsächlich im Norden Rußlands in größern Beständenvorkommende Weißbirke, Betula alba L., wird in gewissen Bezirken
- Ill —
Rußlands und Polens, hauptsächlich in den Gouvernements
Kostroma1 und Wiatka2 zwecks Gewinnung des Teeres der
trockenen Destillation unterworfen. Bei der Bereitung des Birken¬
teers wird nach Spon8 auf folgende Weise verfahren:
Zur Destillation verwendet man die Rinde von 30—50 Jahre
alten Bäumen. Sie werden aber nicht gefällt, und auch die
Rinde wird nur teilweise abgeschält, so daß die Bäume in ihrem
Wachstum nicht behindert werden und die Rinde sich wieder
nachbilden kann.
Die abgeschälte Rinde wird in eine eiserne Retorte gefüllt,
deren gut schließender Deckel mit eisernem Ausflußrohr versehen
ist. Die Retorte wird nun verkehrt auf einen ähnlichen eisernen
Behälter gestülpt. Die Ränder werden mit Ton gut verkittet, das
Ganze rings mit einem Feuer umgeben und der Destillation
überlassen. Im untern Gefäß hat sich nach Beendigung der
Destillation ein dünnes, auf dem Holzessig schwimmendes öl
abgesondert. Nach P. Mac Ewan4 sollen zur trockenen Destillation
hauptsächlich die Rinde, zuweilen aber auch Wurzeln und Zweige
verwendet werden.
Das Birkenteeröl wird in Rußland vornehmlich zur Fabrikation
des sogenannten Juchtenleders verwendet. Das Geheimnis der
Juchtenlederfabrikation soll lediglich im Bestreichen des Leders
mit Birkenteer bestehen. Der dem gegerbten Leder eigentümlicheGeruch gibt, mit dem des Birkenteers vereinigt, den bekannten
Juchtengeruch5. Nach Traubenberg8 ist nur das Birkenrinden-
teeröl für die Lederfabrikation verwendbar. Schimmel7 berichtet
über zwei verschiedene Sorten Birkenteeröl. Die eine Qualität
stellt das rohe öl dar, wie es aus der Birke gewonnen wird, die
zweite Qualität das rektifizierte öl, das aus dem Gouvernement
Minsk stammt. Für die Lederfabrikation, für Seifen und überall
1Pharm. Journ. 85, 5 (1910).
2 Schimmel, Berichte, Oktober 1893, S. 7.
8Spon, Encyclopaedia, S. 1417—1418.
4 Pharm. Journ. 14, 381 (1883-1884).6 Schimmel, Berichte, April 1894, S.U.
6 Chem. Ztg. 47, 786 (1923).7 Schimmel, Berichte, April 1891, S. 6.
- 112 —
da, wo die intensive Farbe nicht stört, soll das rohe öl an¬
gewendet werden.
Die für Birkenteeröl noch gebräuchlichen Namen sind1 Oleum
Betulae albae, Oleum Betulae pyrligneum, Oleum betulineum,Oleum lithuanicum, Oleum muscoviticum, Oleum russicum, Oleum
Rusci und Oleum Brusci. Die beiden letztern Namen sind nach
P. MacEwan durch Korruption aus Brzoza, dem polnischen Wort
für Birke, entstanden, während Greenish2 annimmt, daß das
Wort Rusci durch Zusammenziehen von „Russici" gebildet ist.
Neben der industriellen Bedeutung gewann der Teer aber bei
der russischen Landbevölkerung auch als Hausmittel gegen die
verschiedensten Erkrankungen große Verbreitung. Er wurde
bald über die Landesgrenzen hinaus bekannt, als auch Ärztedurch seine Anwendung bei verschiedenen Hautkrankheiten sehr
gute Erfolge erzielten.
In der Folge entstanden auch in Deutschland und Holland
Destillationsanlagen und bald begegnete man im Handel einer
deutschen und einer holländischen Varietät des Birkenholzteeres.
P. MacEwan unternahm vergleichende Untersuchungen eines
deutschen, holländischen und russischen Musters. Die drei ver¬
schiedenen öle unterschieden sich im Aussehen und spezifischenGewicht nicht sonderlich. Sie waren alle von braunschwarzer
Farbe, ihr spezifisches Gewicht war kleiner als 1,0. Das mit
Teer geschüttelte Wasser zeigte nach Versetzen mit Eisenchlorid¬
lösung keine charakteristischen Farbunterschiede, doch nahm
allein das Wasser des russischen Musters mit einer Lösung von
Kaliumcyanid eine Rosafärbung an, während die andern Produkte
keine Veränderung zeigten.MacEwan3 bestimmte weiter die Menge der verseifbaren und
unverseifbaren Bestandteile der drei Teeröle. Hier zeichnete
sich das russische öl durch seinen hohen Gehalt (64%) an
unverseifbaren Substanzen aus, die den charakteristischen Geruchdes ursprünglichen Öles beibehielten, während holländisches und
deutsches Produkt viel weniger Unverseifbares enthielten (36%.1
Schimmel, Berichte, Oktober 1910, S. 20.2Pharm. Journ. 14, 381 (1883).
3 Pharm. Journ. 15, 769 (1885).
- 113 -
16%)- Die verseifbaren Anteile betrugen beim russischen öl 16%.beim deutschen 19,84% und beim holländischen 10,0%-
Ein großer Unterschied zeigt sich auch in der Menge der
bei 100° flüchtigen Anteile. Sie betrug beim russischen Teer
ca. 19%. beim deutschen 64% und beim holländischen 53%.Schimmel1 gibt den Gehalt an flüchtigen Anteilen im Birken-
teeröl zu ungefähr 18% an- Der verseifbare Anteil aller öle
besaß den charakteristischen Birkenteergeruch nicht mehr. Dieser
sogenannte Juchtengeruch des Teeres rührt her vom Pyrobetulin,das aus dem in der weißen Rinde sich zu 10—12% vorfindenden
Betulin, einem geruch- und geschmacklosen Körper, beim Er¬
hitzen über 258° gebildet wird.
P. MacEwan3 schloß aus den großen Unterschieden, die die
drei öle bei der Analyse zeigten, daß das deutsche und hollän¬
dische öl entweder nicht von der Weißbirke stammen oder auf
eine ganz andere Art gewonnen worden sein müssen.
Für den medizinischen Gebrauch kommt nur das russische öl
in Frage, da es wirksamer sein soll als das in Deutschland und
Holland gewonnene8. ,
Ben nett4 berichtet über ein nach den Prinzipien von Mac Ewan
in den Laboratorien von Wright, Laymann und Umney unter¬
suchtes Birkenteeröl, das die nämlichen Eigenschaften aufwies,
wje das von MacEwan untersuchte echte öl.
Folgende Tabelle zeigt die Resultate dieser Untersuchungen:
Herkunft SpezifischesGewicht
Unverseif-
bares
/o
Verseif¬
bares
/o
Flüchtigesbei 100°,Unlösliches
/o
MacEwan. . . .
W., L. und ü.. .
russisch
deutsch
holländisch
?
0,955
0,967
0,941
0,944
64,47
16,12
36,54
75,7
16,57
19,84
10,62
9,3
18,96
64,04
52,84
15,0
1 Schimmel, Berichte, April 1890, S. 7.
2a. a. 0.
3 Schimmel, Berichte, Oktober 1910, S. 19.
4 Pharm. Journ. 85, 4 (1910).
Gensler-Koch. 8
— 114 —
Später beschäftigte sich G. Grasser1 mit Untersuchungen über
die Inhaltsstoffe der Birke, wobei er hauptsächlich die Bestand¬
teile der Birkenblätter erforschte. Es sind dies vor allem ein
Harz, Gerbstoffe der Pyrokatechingruppe und indifferente Farb¬
stoffe. Betulin und Glykoside sind abwesend. Der Harzstoff
erzeugt bei der trockenen Destillation auch juchtenartig riechende
Stoffe. Ebenso finden sich diese Stoffe im Stammholz der Birke.
Traubenberg2 stellte Unterscheidungsmerkmale auf zwischen
dem Birkenteer und Birkenrindenteer. Er konstatierte, daß nur
der Birkenrindenteer spezifisch leichter ist als Wasser, während
beim Birkenteer das spezifische Gewicht zu 1,153 und 1,079gefunden wurde. Mit Eisenchlorid gibt grüne Färbung nur das
Teerwasser des Rindenteers, dasjenige des Birkenteers färbt sich
braun. Birkenrindenteer zeigt größeren Gehalt an öligen Destil¬
laten und nur 6 % Phenole, weshalb nur der Rindenteer zum
Schmieren des Leders gebraucht wird; Birkenteer weist in den
von 150—200° übergehenden Destillaten einen Gehalt von 19°/0Phenolen auf.
Nach Traubenberg ist der Rindenteer hauptsächlich ein
Zerlegungsprodukt des Betulins, des weißen Stoffes der Birken¬
rinde, der zur Steringruppe gehört und dessen Molekül vier
hydroaromatische Ringe enthält.
Durch die große Nachfrage, die das russische Birkenteeröl bald
auch im Ausland fand, wurde seiner Verfälschung Vorschub
geleistet. Nach dem Kriege war es fast unmöglich, unverfälschtes
öl zu bekommen. Es wurde meist schon an Ort und Stelle der
Fabrikation mit Tannenteer verfälscht3. Auch war die Einfuhr¬
möglichkeit eine Zeitlang ganz unterbunden, so daß die Fälschungenorme Ausmaße annahm.
Aus dieser Zeit stammt eine Mitteilung von J. Pritzker und
R. Jungkunz4, die eine Reihe als Juchtenfette und öle bezeich¬
nete Produkte, sowie Birkenteeröl vergleichend untersuchten.
Leider waren sie nicht in der Lage, völlig einwandfreies Ver-
1 C. 1912, I, 269.ä Chem. Ztg. 47, 786 (1923).3Holde, S. 449.
4 S. A. Z. 59, 146, 162 (1921).
— 115 —
gleichsmaterial zu beschaffen, noch konnten sie an Hand der
bekannten und von den Pharmakopoen aufgestellten Prüfungs¬
vorschriften genügende Merkmale zur Unterscheidung echter öle
von gefälschten Produkten finden. Sie analysierten die ver¬
schiedenen Handelsprodukte nach einem von ihnen zur Prüfung
von Lederfetten ausgearbeiteten Untersuchungsgange. Da zur
Verfälschung des Birkenteeröles meist Nadelholzteer oder Harz¬
öle Verwendung finden, diese sich aber durch hohe Refraktions¬
zahlen im Zeiß'sehen Butterrefraktometer auszeichnen, sowie stark
positive Reaktion nach Storch-Morawski aufweisen, finden es
die Verfasser angezeigt, Juchtenfette und -öle auch auf ihr Ver¬
halten im Zeiß'schen Butterrefraktometer und bei der Storch-
Morawski sehen Reaktion zu untersuchen.
Die verschiedenen Pharmakopoen machen abweichende Angaben
über die Gewinnung des Birkenteeres und speziell auch über die
Verwendung der verschiedenen Teile des Baumes zur trockenen
Destillation.
Nach Hager1 gedeiht Betula verrucosa Ehrhart bis zum 65. Grad,
Betula pubescens Ehrhart bis zum 71. Grad nördlicher Breite.
Beide Arten wurden früher unter dem Namen Betula alba L zu¬
sammengezogen.
Helv. IV fordert den aus dem Holz von Betula verrucosa Ehrhart
und B. pubescens Ehrhart durch trockene Destillation erhaltenen
Teer, Ergänzungsbuch zum D. A. B. 5 und D. A. B. 6 den aus der
Rinde und den Zweigen von Betula verrucosa Ehrhart und Betula
pubescens Ehrhart durch trockene Destillation gewonnenen Teer.
Im Brit. Pharm. Cod. wird Oleum Rusci beschrieben als Teeröl,
das durch trockene Destillation aus der Rinde und dem Holze von
Betula alba L hergestellt wurde. Nederl. IV und Nat. Form, be¬
schreiben das rektifizierte Teeröl. Nat. Form, verlangt seine
Herstellung durch trockene Destillation und nachherige Rekti¬
fikation mit Dampf aus der Rinde und dem Holze von Betula
alba L. Nach Nederl. IV soll es das rektifizierte öl von dem aus
den Stämmen der Betula alba L. gewonnenen Teer darstellen.
1Hager, Handbuch der Pharmazeutischen Praxis (1925), S. 668.
8*
— 116 —
Nederl. V, Gall., Ü. S. A. IX und X und Brit, haben das OleumRusci nicht aufgenommen.Um ein möglichst gleichmäßiges Teeröl zu erhalten, für dessen
Prüfung gewisse Forderungen aufrecht erhalten werden können,erscheint es zweckmäßig, ein Oleum Rusci zu verlangen, das nur
aus der Rinde der Birke hergestellt worden ist.
Wir benützten zur kritischen Prüfung der von den verschiedenenVerfassern angewandten Methoden sowie derjenigen der Pharma-
kopöevorschriften zwei Muster von Oleum Rusci. Das eine wurdeuns von Schimmel & Co. in Leipzig als Oleum Rusci crudum
geliefert, das andere wurde von der Firma A.G. vormals B.Siegfriedin Zofingen bezogen und von ihr als technisches Großproduktaus Rußland bezeichnet.
Nach den Ergebnissen unserer Untersuchungen wurden folgendePrüfungsmethoden aufgestellt:
1. Sinnenprüfung.Das öl bildet in dicker Schicht eine schwarzbraune, in dünner
Schicht eine braune, etwas grünstichige, sirupartige Flüssigkeitvon brennend scharfem Geschmack und charakteristischem Geruch.
Helv. IV nennt das öl dickflüssig, braun, klar und in dünnerSchicht rotbraun, Ergänzungsbuch zum D. A. B. 5 und D. A. B. 6eine rotbraune bis schwarzbraune, dickliche, in dünner Schicht
durchsichtige Flüssigkeit von durchdringendem Geruch. Svenskakennzeichnet es als braunschwarze, dicke, in dünner Schicht
durchsichtige Flüssigkeit von eigenartigem Geruch und brennen¬dem Geschmack.
2. Prüfung des Teerwassers.
5 ccm öl werden mit 95 ccm Wasser während 10 Minuten
kräftig geschüttelt. Das nur schwach gelb gefärbte Filtratreagiert sauer.
Helv. IV läßt das Teerwasser durch Erwärmen von Birkenteermit 4 Teilen Wasser herstellen. Das Filtrat soll fast farblossein, brenzlichen Geruch und saure Reaktion aufweisen. D.A. B. 6läßt 2 g Teeröl mit 25 ccm Wasser schütteln. Das gelblicheFiltrat soll Lackmus röten. Nach Svenska soll das Teerwasser
— 117 —
von 1 Teil Teeröl in 20 Teilen Wasser ein braungelbes, sauer
reagierendes Filtrat geben. Brit. Pharm. Cod. gibt keine genauen
Verhältnisse an.
DasTeerwasser des von uns untersuchten Oleum Rusci Schimmel
zeigte einen pH von 4,8, dasjenige des Produktes von Siegfriedden pH von 5,0. Sie röteten Lackmus nur schwach.
Das Teerwasser wird nach den Vorschriften der Pharmakopoenmit folgenden Reagenzien geprüft:
Eisenchloridlösung (0,1 n): 5 ccm Teerwasser sollen mit
1 Tropfen 0,1 n-Eisenchloridlösung eine beständige Grünfärbung
geben.In bezug auf diese Reaktion gehen die Angaben der ver¬
schiedenen Pharmakopoen weit auseinander, weil, wie Trauben¬
berg1 nachgewiesen hat, nur der Birkenrindenteer mit Eisen¬
chloridlösung bleibende Grünfärbung gibt, der Birkenholzteer
aber Braunfärbung. Je nachdem nun ein Birkenrindenteer mehr
oder weniger Birkenholzteer untermischt enthält, werden auch
die Färbungen von beständigem Grün bis zu sofortigem Umschlagder erst grünlichen Färbung ins Braune wechseln. Die bleibende
Grünfärbung des Teerwassers durch Eisenchloridlösung wird zur
Unterscheidung des Oleum Rusci von Oleum cadinum und Pix
liquida herangezogen. Dies ist aber nur möglich, wenn eine
Pharmakopoe ausdrücklich nur den aus der Birkenrinde her¬
gestellten Teer zuläßt.
Helv. IV fordert Grünfärbung des Teerwassers mit Eisenchlorid¬
lösung 1:1000. Nach Kommentar Helv. IV erlaubt diese Grün¬
färbung eine Unterscheidung von Oleum cadinum und Pix liquida,die mit Eisenchloridlösung eine braune oder braunrote Färbung
geben. D. A. B. 6 läßt 10 ccm Teerwasser mit 3 Tropfen Eisen¬
chloridlösung 1 + 9 versetzen und gibt rötlichbraune Färbung
des Teerwassers an. L. Rosenthaler2 kritisiert diese Angabe
und stellt mit wenig Eisenchloridlösung eine grüne, mit mehr
Reagens eine braune Färbung fest und empfiehlt, da die grüne
Färbung charakteristischer sei, beide Angaben zu vereinigen.
1a. a. O.
2 Pharm. Ztg. 7, 1540 (1926).
— 118 —
Biechele-Brieger1 übernimmt denn auch die Forderung, daß
das Teerwasser mit ganz wenig Eisenchloridlösung zuerst eine
grüne Färbung annehmen müsse. H. Thoms und F. Unger2konnten nach Befunden eigener Untersuchungen immer nur bräun¬
liche Färbungen konstatieren. Pharmakopoea Austriaca fordert
mit Eisenchloridlösung 1:1000 bleibende Grünfärbung des Teer¬
wassers, ebenso Nederl. IV für Oleum Rusci depuratum. Nach
Svenska färbt sich das Teerwasser durch 1 Tropfen Eisen¬
chloridlösung 0,5 n braungrün, welche Farbe schnell in braun
übergeht. Nat. Form, läßt zu 4 ccm Teerwasser (1:5) 1 TropfenEisenchloridlösung zufügen und gibt als Unterschied zu Oleum
cadinum grüne Färbung der Flüssigkeit an, die braun und trübe
wird. Brit. Pharm. Cod. fordert mit Spuren Eisenchloridlösunggrüne Färbung. Hager8 gibt ebenfalls grüne Färbung des Teer¬
wassers durch sehr verdünnte Eisenchloridlösung an zum Unter¬
schied vom Tannen- und Wachholderteer.
Wir stellten beim Oleum Rusci Schimmel eine bleibende, schöne
Grünfärbung fest. Die Grünfärbung bei Oleum Rusci Siegfriedwar nicht so beständig, sondern ging nach ungefähr 5 Minuten
ins Gelblichbraune über, was auf Anwesenheit von Birkenholzteer
schließen ließ.
Kalkwasser: 3 ccm Teerwasser geben, mit 3 ccm Kalkwasserin einem nur zur Hälfte gefüllten Reagensglas stark geschüttelt,eine rotbraune Färbung.
Diese Reaktion wird in keiner der Pharmakopoen für Oleum
Rusci angegeben, wohl aber für Pix liquida. Sie wird aber auch
bei Oleum Rusci und Oleum cadinum erhalten, fällt jedoch ab¬
weichend aus mit Buchenholzteer.
Diese Prüfung fiel bei den von uns untersuchten Mustern
stärker aus als bei Pix liquida und Oleum cadinum, indem das
Teerwasser schon durch die Zugabe des Kalkwassers ohne
Schütteln eine rotbraune Färbung annahm, während das Teer¬
wasser bei den andern Teeren auf Zugabe von Kalkwasser ohne
vorheriges Schütteln nur gelbe Farbe zeigte.
1Anleitung zur Prüfung der Arzneimittel des D. A. B. 6, 15. Auflage, S. 562.
2 Archiv d. Pharmazie 264, 614 (1926).3Hager, Handbuch der Pharmazeutischen Praxis 1925, S. 668.
— 119 —
Bromwasser: 5 ccm Teerwasser werden durch einige Tropfen
Bromwasser weißlich getrübt (Phenole).Diese Prüfung findet sich in Nederl. IV für Oleum Rusci de-
puratum.
Ammoniakalisches Silbernitrat: 5 ccm ammoniakalisches
Silbernitrat werden durch einige Tropfen Teerwasser sofort in
der Kälte reduziert.
Diese Prüfung erwähnen Helv. IV, D. A. B. 6 und Svenska.
Fehlingsche Lösung: 3 ccm Fehlingsche Lösung werden
durch 6 ccm Teerwasser in der Hitze reduziert.
Diese Prüfung findet sich in Helv. IV. Sie ist aber neben der
Reduktionsprobe durch ammoniakalisches Silbernitrat hier wie
auch bei den voranbesprochenen Teeren überflüssig.
Anilinacetat: 5 ccm Teerwasser dürfen nach Zugabe von
2 ccm Anilinacetatlösung keine Rosafärbung annehmen. Ebenso
darf ein mit Teerwasser benetzter Filtrierpapierstreifen, dem man
einige Tropfen Anilinacetatlösung zusetzt, keine Rosafärbung an¬
nehmen.
Brit. Pharm. Cod. faßt diese Forderung so: 5 ccm des Teer¬
wassers 1:10 geben mit 2—3 Tropfen Anilin und ungefähr
5 Tropfen Salzsäure eine gelbbraune Mischung. Bei Verfälschung
des Birkenteeres mit Tannen- oder anderen Teeren tritt Rot¬
färbung ein.
Wir erhielten weder beim Oleum Rusci Schimmel noch beim
Produkt von Siegfried eine Rosafärbung, so daß dieser Reaktion
ein Wert zur Unterscheidung des Birkenteeres vom Nadelholzteer
beigemessen werden kann.
Kaliumbichromatlösung(ca. n): 5 ccm Teerwasser nehmen
auf Zugabe von 5 Tropfen Kaliumbichromatlösung zuerst eine
gelbe, nach einigen Minuten unter Trübung der Lösung dunkel¬
braun werdende Färbung an.
Helv. IV gibt diese Reaktion zur Unterscheidung von Oleum
cadinum an, indem das Teerwasser von Oleum Rusci schnell
bis zur Undurchsichtigkeit getrübt werden soll, während das¬
jenige von Oleum cadinum erst allmählich nachdunkeln soll.
- 120 —
Nach D. A. B. 6 und Nat. Form, soll das Teerwasser durch Kalium-bichromatlösung braun und bald bis zur Ündurchsichtigkeitgetrübt werden. Brit. Pharm. Cod. und Svenska führen dieseReaktion nicht an.
Unsere Muster zeigten beide die Reaktion, die sich aber von
andern Teeren nicht wesentlich unterschied und somit nicht
charakteristisch ist.
Kaliumcyanidlösung (ca. n): 3 ccm Teerwasser nehmenauf Zusatz von 1— 2 Tropfen Kaliumcyanidlösung eine Rosa¬
färbung an.
Diese Reaktion gibt, wie früher erwähnt, MacEwan bekanntzur Unterscheidung des deutschen und holländischen vom echtenrussischen Birkenteer. Brit. Pharm. Cod. nimmt sie in folgenderForm auf: Das Teerwasser gibt mit einigen Tropfen Kalium¬cyanidlösung 10:100 eine Rosafärbung, die durch Zugabe von
Ammoniak deutlicher wird.
Bei den von uns untersuchten Mustern trat die Rosafärbungziemlich intensiv auf, nachherige Zugabe von Ammoniak hatteauf die Reaktion keinen Einfluß mehr.
Vergleicht man den Ausfall der angegebenen Prüfungen diesesTeerwassers mit denen, des Nadelholzteeres und des Kadeöles.so sieht man, daß für das Birkenteeröl als charakteristischeReaktionen nur diejenigen mit Eisenchlorid, Anilinacetat und
Kaliumcyanid, sowie die Bromwasserreaktion (als qualitativerNachweis für Phenole) in Betracht kommen können. Die andern
Prüfungen, die allen drei Holzteeren gemeinsam sind, könnenunbedenklich gestrichen werden.
3. Löslichkeit bzw. Mischbarkeit.
1 ccm Oleum Rusci soll sich in je 9 ccm Chloroform, Eisessig,Anilin und Aceton vollständig oder bis auf einen geringen Teillösen.
Die braune Mischung von 2 Tropfen Oleum Rusci mit 5 ccm
Weingeist zeigt starke blaue Fluoreszenz.Der Birkenrindenteer ist mit ölen und Fetten mischbar.
— 121 —
Helv. IV fordert klare Lösung mit dem dreifachen Volum Amyl¬
alkohol, Chloroform, Eisessig, Alkohol absol., Alkohol 95 Volum¬
prozent, trübe mischbar ist das öl mit Äther, Terpentinöl, Petrol-
äther und Schwefelkohlenstoff. D. A. B. 6 verlangt völlige Lös¬
lichkeit in Alkohol abs., fast völlige in Chloroform, beschränkte
Löslichkeit in Äther. Svenska gibt völlige Löslichkeit des Teeres
in Chloroform, beschränkte in Spiritus, Äther und Schwefel¬
kohlenstoff an. Nach Brit. Pharm. Cod. ist der Teer löslich in
Chloroform, teilweise löslich in Alkohol.
Wir untersuchten die beiden Handelsmuster mit folgenden
Lösungsmitteln im Verhältnis 1:10.
Oleum Rusci Schimmel Oleum Rusci Siegfried
sofort nach 18 Stunden sofort nach 18 Stunden
Alkohol absolut.
Alkohol 95°/o .
Aceton
Chloroform. . .
Terpentinöl. . .
Amylalkohol . .
Schwefelkohlen¬
stoff
=
Bodensatz
»
etwas Bodensatz
oben Ausscheidungen
etwas Bodensatz
fast klar
flockige Ausscheidungen
oben Ausscheidungen
etwas Bodensatz
» »
=
starker Bodensatz
» w
etwas„
oben Ausscheidungenetwas Bodensatz
oben Ausscheidungen
flockige Ausscheidungen
oben Ausscheidungen
Ausscheidungen
= bedeutet fast vollkommen löslich.
— bedeutet unvollkommen löslich.
4. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.
1 ccm Teer wird in einem mit Glasstöpsel verschlossenen
Erlenmeyer mit 15 ccm Petroläther kräftig geschüttelt. 10 ccm des
hellbraunen Filtrates werden hierauf mit 10 ccm einer l°/0igen
Kupferacetatlösung in einem kleinen Scheidetrichter gut durch¬
geschüttelt. Nach Trennung der Schichten wird die Kupferacetat¬
lösung abgelassen, 5 ccm der Petrolätherschicht werden mittels
einer Pipette herausgehoben und in einem kleinen Meßzylinder
mit 10 ccm Äther verdünnt. Die Petrolätherschicht darf nur eine
gelbe, nicht aber eine grüne Farbe annehmen (Pix liquida).
— 122 —
Die beiden von uns untersuchten Muster entsprachen dieser
Forderung. Diese Reaktion wird nur im Brit. Pharm. Cod. an¬
geführt. Sie lautet: wenn 1 Teil Teeröl mit 20 Teilen Petroläther
geschüttelt wird, so darf das Filtrat, mit einer Kupferacetatlösung1:1000 geschüttelt, keine grüne Farbe annehmen (Abwesenheit vonTannenteer).
5. Spezifisches Gewicht.
Läßt man einige Tropfen Birkenrindenteer in ein mit Wasser
von 15° gefülltes Becherglas fallen, so sollen die Tropfen sich
an der Oberfläche des Wassers ansammeln. Das spezifischeGewicht des Teeres soll kleiner sein als 1,0.
Die Pharmakopoen unterscheiden sich auch hier in den An¬
gaben; da nach Traubenberg1 nur das spezifische Gewicht des
Rindenteeres unter 1,0 liegt, Birkenholzteer aber ein höheres
spezifisches Gewicht aufweist, so hängt letzteres von der Zu¬
sammensetzung eines Teeres wesentlich ab.
D. A. B. 6 hat das spezifische Gewicht nicht begrenzt, da ein¬
deutige Werte nicht festgestellt werden konnten. H. Thoms und
F. Unger1 berichten, daß bei untersuchten Handelsmustern das
spezifische Gewicht immer unter 1,0 gefunden wurde. Nach
Helv. IV liegt das spezifische Gewicht zwischen 0,926 —1,05,nach Brit. Pharm. Cod. zwischen 0,926—0,955 bei 20°, Hager1gibt ebenfalls Grenzen von 0,926— 0,955 bei 20° an, während
Svenska sagt, daß das spezifische Gewicht gewöhnlich höher als
1,0 sei.
Wir fanden bei unsern Handelsmustern für Oleum Rusci
Schimmel ein spezifisches Gewicht von 0,942, für Oleum Rusci
Siegfried ein solches von 0,9896. Auch hier weist das höhere
spezifische Gewicht von Oleum Rusci Siegfried auf die Anwesen¬
heit von Birkenholzteer hin.
6. Verbrennungsrückstand.
Der Verbrennungsrückstand, bestimmt mit ca. 1 g Substanz
(genau gewogen), darf höchstens 0,25% betragen.
1a. a. 0.
— 123 —
In den verschiedenen Pharmakopoen findet sich keine Be¬
grenzung des Verbrennungsrückstandes.Wir fanden bei Oleum Rusci Schimmel 0,15 °/0, bei Oleum
Rusci Siegfried 0,45%) was wohl etwas zu hoch sein dürfte.
7. Bestimmung der Gesamtsäure.
In einen mit Siedesteinchen versehenen Rundkolben von 500 ccm
Inhalt werden ca. 10 g Teer auf 0,1 g genau eingewogen und
30 ccm Wasser zugesetzt. Der Kolben wird angewärmt und die
Mischung sodann der Wasserdampfdestillation unterworfen. Es
werden durch ein befeuchtetes Filter in einem Meßkolben 500 ccm
Destillat aufgefangen. Das Filter dient zur Zurückhaltung des
ätherischen Öles.
100 ccm des Destillates (= 2 g Teer) werden mit einigen Tropfen
Phenolphthaleinlösung versetzt und mit 0,ln-NaOH titriert.
1 ccm O,ln-Na0fi = 0,006 g Essigsäure.
Die gefundene Menge Essigsäure mit 50 multipliziert ergibt
den Prozentgehalt des Teeres an Säure, berechnet als Essigsäure.
Der Gehalt an Gesamtsäure, berechnet als Essigsäure, im Oleum
Rusci soll nicht über 1,5 °/0 betragen.
Der Säuregehalt im Oleum Rusci Schimmel betrug 0,648 °/<>)
derjenige im Oleum Rusci Siegfried 0,39 °/0.
8. Probedestillation.
50 g Teer werden auf 0,1 g genau in einen mit Siedesteinchen
versehenen, tarierten Siedekolben von 200 ccm Inhalt eingewogen.
Der Siedekolben wird mit einem Kühlmantel versehen und das
Thermometer in gewöhnliche Destillierstellung gebracht. Der
Kolben wird auf dem Drahtnetz unter dem Abzug langsam er¬
hitzt. Um eine regelmäßige Erhitzung zu erreichen, umwickelt
man den Kolben zweckmäßig mit Asbestpapier. Nach Abnahme
der ersten Fraktion wird das Kühlwasser abgestellt. Die erste
Fraktion wird in einem kleinen tarierten Meßzylinder von 10 ccm
Inhalt, die andern in tarierten Bechergläsern aufgefangen.
— 124 —
Es werden vier Fraktionen abgenommen:die erste Fraktion bis 150°,die zweite Fraktion von 150—200°,die dritte Fraktion von 200—250°,die vierte Fraktion von 250 — 300°.
Die zwischen 250° und 300° siedenden Anteile weisen starkeFluoreszenz auf. Sie erscheinen im durchfallenden Licht indicker Schicht rot, im gefüllten Reagensglas bei auffallendemLicht grün.Wir konnten diese Beobachtung bei den von uns untersuchten
Handelsmustern bestätigen.Die Menge der abgenommenen Fraktionen ist aus folgender
Tabelle zu entnehmen:
bis
150°*)
0!10
ccm
wässerigenDestillates
pro 100 gTeer
150
bis
200°
/o
200
bis
250°
°/10
250
bis
300°
°/
10
150
bis
300°
/o
Rück¬
stand
/o
Ver¬
lust
°/o
Oleum Rusci Schimmel
Oleum Rusci Siegfried
1,2
5,0
0,8
3,35
2,5
1,42
10,0
3,0
26,0
33,3
38,5
37,82
59,0
54,52
1,3
2,64
*) Diese Fraktion bestand in der Hauptsache aus einem wässerigen Destillat,welches von einer Weinen Menge öl bedeckt war. Die zweite Kolonne gibtdie Menge des wässerigen Destillates an.
Bei Kadeöl war es möglich, bestimmte Forderungen über die
Mengen einzelner Fraktionen aufzustellen, da bereits eingehendeUntersuchungen über die Fraktionierung dieses Teeres vorliegen.Beim Birkenteer liegen die Verhältnisse anders. Über Fraktio¬
nierungen ist, soweit uns bekannt, in der Literatur nichts zu
finden. Um zu erfahren, welche Mengen der einzelnen Frak¬tionen bei Birkenteer als charakteristisch angesehen bzw. gefordertwerden könnten, müssen vorerst eine größere Zahl authentischerMuster untersucht und fraktioniert destilliert werden. Wir haltenuns nicht für berechtigt, auf Grund der Untersuchung von nur
zwei Handelsmustern Vorschläge zu machen für eine Beurteilungdes Birkenteers an Hand der fraktionierten Destillation. Eskönnte höchstens gefordert werden, daß unter 150° nicht mehrals 2% übergehen dürfen.
— 125 —
9. Reaktionen der Destillate.
1. 1 ccm Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,62) wird durch
einen Tropfen der Fraktion 250— 300° orange und dann rot
gefärbt.Diese bei Holde für Nadelholzteer angegebene Reaktion fällt
auch mit Birkenteer wie mit Kadeöl positiv aus und kann daher
nicht zur Unterscheidung dieser Teere benützt werden.
2. Wir versuchten die Store h-Morawski sehe Reaktion auf
Harzsäuren auch auf Birkenteer anzuwenden und erhielten
folgenden Befund:
1 Tropfen der Fraktion 250—300° wird in 1 ccm Essigsäure¬anhydrid unter Verreiben mit dem Glasstab kalt gelöst und mit
1 Tropfen Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,53) versetzt.
Die Färbung soll nicht das für Nadelholzteer charakteristische
intensive Violettrot zeigen, sondern braun sein.
Die von uns untersuchten Handelsmuster genügten obiger An¬
forderung.
10. Prüfung auf Buchenteeröle.
Wir versuchten auch hier, die von Bordas und Touplain
aufgefundenen Reaktionen auf Buchenteeröle anzuwenden. Das
Ergebnis ist das folgende:3 Tropfen öl der Fraktion 200—250° werden in 3 ccm Petrol-
äther gelöst und mit 3 ccm Barytwasser tüchtig geschüttelt. Es
darf keine stahlblaue Färbung eintreten (Buchenteeröl). Nach
Trennung der Schichten muß die untere Schicht rötlichbraune,die Petrolätherschicht gelbliche Farbe aufweisen.
11. Bestimmung des Unverseifbaren.
Als ein sehr wichtiges Kennzeichen eines echten Birkenteers
beschreibt MacEwan dessen großen Gehaltan Unverseifbarem.
Wir benützten zu dieser Bestimmung die Vorschrift des Ent¬
wurfes von Helv. V, die folgendermaßen lautet:
Zur Bestimmung des Unverseifbaren werden ca. 5 g Substanz (genaugewogen) mit 20 ccm Weingeist und 4 g Kaliumhydroxyd wahrend
'
einer
Stunde am Rückflußkühler in einem Kolben aus gegen Alkali widerstands¬
fähigem Glase gekocht. Die entstandene Seifenlösung wird in einen Scheide-
— 126 —
trichter gegossen und der Kolben mit 40 ccm heißem Wasser nachgespült.Die vereinigten Lösungen werden nach dem Erkalten zuerst mit 100 ccm,
dann noch mit 50 ccm Äther je eine Minute lang kräftig geschüttelt. Die
vereinigten Ätherauszüge werden nach dreimaligem Schütteln mit 5 ccm
Wasser in ein genau gewogenes Kötbchen gebracht. Nach dem Abdestillieren
des Äthers auf dem Wasserbad wird der Rückstand bei 103— 105° bis zur
Gewichtskonstanz getrocknet und hernach gewogen.
Da aber das Trocknen bis zu konstantem Gewicht der flüchtigenBestandteile halber hier nicht ausgeführt werden kann, setzten
wir das Trocknen bei 103 —105° solange fort, bis das Gewicht
des Rückstandes nach zwei im Intervall von einer halben Stunde
vorgenommenen Wägungen höchstens noch 2 mg abnahm.
Zum Vergleich machten wir auch Bestimmungen mit den beiden
von uns untersuchten Mustern Nadelholzteer. Die ätherische
Lösung des Unverseifbaren der beiden Birkenteere fluoreszierte
stark blau. Vom Äther abgedampft bildete das Ünverseifbare
eine dunkelbraune, ölige Flüssigkeit vom charakteristischen Geruch
des ursprünglichen Teeres. Die ätherische Lösung der unverseif¬
baren Anteile der beiden Nadelholzteere war rotbraun und am Rande
grün fluoreszierend. Der Rückstand wies harzigen Geruch auf.
Die Ergebnisse waren folgende:ünverseifbares des Oleum Rusci Schimmel 73,12 °/0
„ Siegfried 68,62 °/0
„der Pix liquida Norw 32,81 °/0
n » » » »des Landes" 26,24 °/0Mac Evan erhielt bei echtem Oleum Rusci 64,47 °/0Labor. W., L. und U 75,7 °/0.
Unsere Befunde bestätigen die Konstatierung von MacEwan,daß das Oleum Rusci einen großen Gehalt an Unverseifbarem
besitzt.
Es könnte auf Grund der vorliegenden Untersuchungen die
Forderung aufgestellt werden, daß ein echtes Oleum Rusci nicht
unter 60% ünverseifbare Anteile enthalten darf.
12. Bestimmung des Verseifbaren.
Der in KOH lösliche Anteil wurde samt den Waschwässern
mit 2n-Schwefelsäure angesäuert, das erste Mal mit 50 ccm,
— 127 —
das zweite und dritte Mal mit je 25 ccm Äther ausgeäthert und
das Verseifbare in der beim Steinkohlenteer von La za rangegebenenWeise quantitativ bestimmt.
Die Werte waren folgende:
Verseifbares Oleum Rusci Schimmel 18,62 °/0
„ Siegfried 10,26 °/0
Pix liquida Norw 57,63 °/0
„ „ n „des Landes" 61,02 °/0.
Unter Berücksichtigung der von Traubenberg gemachten
Konstatierung hinsichtlich des Vorkommens von Phenolen läßt
sich aus den für die beiden Birkenteere gefundenen Zahlen eben¬
falls der Schluß ziehen, daß das Oleum Rusci Schimmel eher
einem Birkenrindenteer entspricht, während Oleum Rusci Siegfried
dem höhern Gehalt an Verseifbarem nach auch Birkenholzteer
enthält.
13. Bestimmung der bei 100° flüchtigen Anteile.
Es wurden noch Vergleiche gezogen zwischen den bei 100°
flüchtigen Substanzen der Birkenteere und der Nadelholzteere.
Wie erwähnt wurde, berichtet MacEwan über seine verschie¬
denen Ergebnisse mit echtem russischem Teer und den deutschen
und holländischen Sorten.
Von jedem Teer wurden ca. 3 g (genau gewogen) in ein weites
Wägegläschen gebracht. Die Wägegläschen wurden auf ein
siedendes Wasserbad gestellt und achtmal jeweils 15 Minuten
darauf gelassen und nach dem Abkühlenlassen gewogen. Dann
wurden sie noch viermal je 15 Minuten in den Trockenschrank
bei 103—105° gebracht und nach dem Abkühlenlassen gewogen.
Die Gewichtsabnahme ging bei allen Teeren ungefähr in gleicher
Weise vor sich.
Die Mengen der flüchtigen Stoffe nach insgesamt dreistündigem
Erhitzen ist aus folgender Tabelle zu ersehen:
Oleum Rusci Schimmel 16,72 °/o
„ Siegfried 14,16 °/0
Pix liquida Norw 17,03 °/0
„ „ „des Landes" 12,86 °/0.
— 128 —
Wie unsere Versuche zeigen, konnten bei den beiden von uns
untersuchten Mustern von Birkenteer keine großen Unterschiede
hinsichtlich Gehalt an flüchtigen Stoffen im Vergleich zu den
Nadelholzteeren konstatiert werden.
Schimmel gibt den Gehalt an flüchtigen Anteilen im Birken-
teeröl zu ungefähr 18% an» was mit unserm Befund beim
Oleum Rusci Schimmel gut übereinstimmt.
14. Zusammenfassung.
Auf Grund vorstehender Untersuchungen dürften sich für die
Prüfung des Birkenteeres besonders folgende Methoden empfehlen:1. Prüfung des Teerwassers mit FeCl3-Lösung, Anilinacetat und
Kaliumcyanidlösung.2. Reaktion nach Hirschsohn-Pépin.3. Spezifisches Gewicht.
4. Bestimmung der unter 150° flüchtigen Anteile.
5. Bestimmung des Unverseifbaren.
Lebenslauf.
Ich wurde am 30. August 1896 in Chur geboren und besuchte
an diesem Ort vom Herbst 1903 bis Sommer 1909 die städtische
Volksschule und vom Herbst 1909 bis zur Erlangung des Reife¬
zeugnisses im Juli 1916 die humanistische Abteilung des Kan¬
tonalen Gymnasiums. Im Oktober 1916 begann ich mit dem
Studium der Medizin in Genf, wo ich im Oktober 1917 die
naturwissenschaftliche Prüfung bestand. Im Sommersemester 1918
begann ich am selben Ort das Studium der Pharmazie, wo ich
auch im Oktober 1919 die pharmazeutische naturwissenschaft¬
liche Prüfung ablegte. Die pharmazeutische Assistentenprüfung
bestand ich im Frühjahr 1927 in Zürich. Nach Absolvierung der
fachwissenschaftlichen Studien am Pharmazeutischen Institut der
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich bestand ich
im Herbstl928 die pharmazeutische Fachprüfung. VomJanuarl929
bis Sommer 1930 führte ich am Pharmazeutischen Institut der
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich die vorliegende
Arbeit aus, wobei ich vom 15. Januar bis 15. April 1929 zugleich
als Assistentin für die Neubearbeitung der Pharmacopoea Helvetica
angestellt war.
Zürich, im Juni 1930.
Constantia Gensler-Koch.