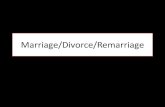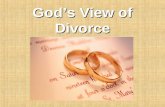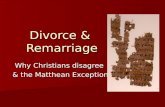Folgen von Scheidungen für Kinder und Jugendlicheffffffff-c0e5-c48a...Coping with divorce, single...
Transcript of Folgen von Scheidungen für Kinder und Jugendlicheffffffff-c0e5-c48a...Coping with divorce, single...

Zürcher Fachhochschule
Folgen von Scheidungen für Kinder und Jugendliche Tagung an der Universität Zürich, 23. August 2013 Scheidung – Ursachen und Folgen
Prof. Dr. Beate Schwarz
1

Zürcher Fachhochschule
Scheidungs- Stress-Bewältigungs-Modell nach Amato (2000)
2
Prozess der
Ehelösung • Elternkonflikte
• Ehequalität
Stressoren
• verschlechterte
Erziehung
• Verringerter Kontakt
zu einem Elternteil
• Konflikte Eltern
• Finanzielle
Einbussen
• Weitere
Lebensereignisse
Negative
Entwicklungsfolgen
• psycho-sozial
• Verhalten
• Gesundheit
• Leistungen
Kurzfristige Krise
oder chronischer
Stress?
Protektionsfaktoren • Individuelle Ressourcen
• Soziale Ressourcen
• Strukturelle Ressourcen
Vorscheidungs-
Phase

Zürcher Fachhochschule
• Es gibt keine spezifischen Scheidungsfolgen
• Im historischen Vergleich kaum Hinweise auf verringerte Probleme in jüngster Zeit
(Amato, 2001; Gähler & Garriga, 2012), d.h. Scheidungsfolgen hängen kaum ab
- von der allgemeinen Scheidungsrate
- Wertewandel
• Keine deutlichen Geschlechtsunterschiede in den Scheidungsfolgen (Amato, 2001)
Folgen der Scheidung
3

Zürcher Fachhochschule
• Eher Manifestationen in alterstypischen, in dem Alter sensiblen Bereichen (Amato,
2000; Schmidt-Denter 2005)
- Säuglinge/Kleinkinder: hohe Abhängigkeit bei der Befriedigung ihrer basalen
Bedürfnisse (Pflege, Sicherheit Bindung), Trennungsabläufe können schwer vermittelt
werden => Ängstlichkeit; Bindungsunsicherheit; aber sehr geringer Kenntnisstand (Leon,
2003)
- Kindergarten, Einschulung: Trennungsabläufe werden wahrgenommen, aber noch nicht
gut verstanden, wenig eigene Bewältigungsstrategien, kindlicher Egozentrismus =>
Schuldgefühle; Regression; Schulprobleme (Wallerstein & Kelly, 1980)
- Schulalter: realistischeres Verstehen, mehr Bewältigungsressourcen, emotional
verunsichert => Selbstwertprobleme, Loyalitätskonflikte; Schulprobleme (Buchanan et al.,
1996)
- Jugendliche: realistische Wahrnehmung, eigenständige Bewältigung möglich, können
Beistand leisten => zu grosse Verantwortungsübernahme; Loyalitätskonflikte aber auch
Ablösung; Zukunftssorgen (Finanzen, eigene Partnerschaft); jugendliches
Problemverhalten (u.a. Koerner, et al., 2011)
Altersunterschiede?
4

Zürcher Fachhochschule
Es gibt vermutlich kein Alter, in dem eine Scheidung unmittelbar weniger
folgenreich für die Kinder ist als zu anderen Zeiten
• Aber: Nur Scheidungen vor dem Alter von 5 Jahren hatten langfristige Auswirkungen
auf Verhaltensprobleme (internalisierende und externalisierende) bis in die frühe
Adoleszenz (Ryan & Claessens, 2013)
• Unklar woran dies liegt
• Grössere Sensibilität kleinerer Kinder für familiäre Belastungen?
Besonderes Augenmerk auf frühe Umbrüche in Familien
5

Zürcher Fachhochschule
• Unmittelbar nach der Trennung deutliche Probleme bei vielen Kindern/Jugendlichen
in verschiedenen Entwicklungsbereichen und in Hinblick auf Erziehung und
Unterstützung durch die Eltern (Beelmann & Schmidt-Denter, 1991; Hetherington, 1993; Schwarz,
1999) = Krisenphase
- Für die Kinder kommt die Trennung meist sehr plötzlich; zu wenig
Kommunikation/Erklärung: 23% ‘niemand hat mit mir gesprochen’; 45% nur
kurze Mitteilungen, 5% ausführlich informiert (Dunn et al., 2001)
- Kinder (11- 14 Jahre) wünschen sich, den Sinn in der elterlichen Entscheidung
zu verstehen und in die Überlegungen zu Nachscheidungsregelungen
einbezogen zu werden (Maes et al., 2012)
• Konsolidierung nach 1-2 Jahren, die Probleme verringern sich (Ge et al., 2006;
Hetherington, 1993; Ryan & Claessens, 2013)
• Langfristig haben Scheidungskinder im Durchschnitt etwas mehr Probleme
- Unterschiede moderat (Amato, 2001)
Kurzfristige Krise oder chronischer Stress?
6

Zürcher Fachhochschule
• Mehrheit der Scheidungskinder nicht klinisch auffällig
• In der Krisenphase hoher Anteil, nach der Konsolidierung deutlich verringert
- 9 Monate nach Scheidung 54%, nach 3 Jahren 30% über klinischen Cut-Off
bei Verhaltensauffälligkeiten (Norm: 20%) (Schmidt-Denter & Beelmann, 1997)
• Anstieg klinisch relevanter internalisierender Probleme bei Mädchen im Jugendalter
(14-18 Jahre): bei Scheidung von 23% auf 41%; ohne Scheidung von 12% auf 17% (Storksen et al., 2005)
Substantielle Minderheit von Scheidungskindern zeigt überdauernde psychische
Probleme
Möglicherweise auch wegen psychischer Probleme der Eltern?
Klinisch auffällige Scheidungskinder
7

Zürcher Fachhochschule
Es gibt Gewinner, Verlierer und Überlebende einer
Scheidung
Fazit von Mavis Hetherington (1989)
8

Zürcher Fachhochschule
Im Fokus:
• (anhaltende) Konflikte der Eltern
• Verlust des Kontaktes zu einem Elternteil
Stressoren nach der Scheidung, die das Risiko ungünstiger Entwicklungen fördern
9

Zürcher Fachhochschule
• Unklar, ob Nachscheidungskonflikte stärker wirken als die Konflikte während der
Ehe (z.B. Booth & Amato, 2001 vs. Hetherington, 1999)
• Besonders belastend (Buchanan & Heiges, 2001; Hetherington, 1999; Schwarz, 2009)
• Scheidung kann auch eine Entlastung sein, wenn sie zu einem Ende der Konflikte
führt! (Strohschein, 2005)
Elternkonflikte als wesentliche Belastung für Kinder und Jugendliche
10
Nachscheidungs-
konflikte
Koalitionsforde-
rungen der Eltern
Kind als Spion/
Nachrichten-
übermittler
Schlechtmachen
der Ex-Partner
Loyalitäts-
konflikte
Befinden u
nd V
erh
alten

Zürcher Fachhochschule
• Häufigkeit der Kontakte wenig relevant
• Qualität der Kontakte ist entscheidend
- enge Beziehung
- Erziehung liebevoll und fordernd
- fürsorgliche Kontrolle
- Unterstützung bei Schularbeiten
∑ aktive Rolle des Vaters als Erzieher
- bei jüngeren Kindern: je häufiger die Kontakte, desto besser Beziehung zum
Vater (s. Leon, 2003)
• Regelmässige Unterhaltszahlungen wirken positiv
- auf die Kinder
- auf den Kontakt
Ist es gut für das Kind, den Kontakt zum ausserhalb lebenden Elternteil zu behalten?
Amato & Gilbreth (1999) 11

Zürcher Fachhochschule
• Bei jüngeren Kindern geht der Wechsel zwischen den Eltern häufig mit
Stress der Kinder einher (u.a. Widerstand gegen Trennung,
Anhänglichkeit, Aggression)
• Kontakte sind eher schädlich
• bei anhaltenden Elternkonflikten
• bei Feindseligkeit der Mutter gegen Vater
… Kontakt zum ausserhalb lebenden Elternteil
Amato & Gilbreth (1999); Leon (2003) 12

Zürcher Fachhochschule
Studien aus den USA (Bauserman, 2002):
• Gemeinsame Sorge (joint legal und joint physical custody) leicht besser
als allein Erziehen (Mutter oder Vater) in Hinblick auf:
- Verhaltensprobleme (z.B. Devianz, Aggression, Aufsässigkeit)
- emotionale Probleme (z.B. Depressivität, Ängstlichkeit)
- Selbstbild
- schulische Leistungen
- Eltern-Kind-Beziehung, Erziehung
- Anpassung an die Scheidung
• Keine Auswirkungen auf die Elternkonflikte! (Maccoby & Mnookin, 1992)
Hilft die Sorgerechtsregelung, negative Auswirkungen der Scheidung abzufedern?
13

Zürcher Fachhochschule
• Kinder leben mind. 30% der Zeit bei jedem Elternteil
• Zahl steigt in jüngster Zeit (NL: 1998 5%, 2008 16%)
• Verglichen mit Arrangements, bei denen die Kinder hauptsächlich bei einem
Elternteil leben:
• Eltern kooperieren nicht mehr (häufig «parallele Elternschaft»)
• Haben kaum weniger Konflikte
• Väter haben flexiblere Arbeitszeiten
• Kinder haben bessere Beziehung zum Vater und zur Mutter
• Besseres psycho-sozialem Befinden und Verhalten und bessere Gesundheit
Gemeinsame Sorge und Obhut (joint physical custody, shared residential parenting)
Nielsen (2011) 14

Zürcher Fachhochschule
Nachscheidungsprobleme sind Resultat der Vorscheidungsprozesse (Schwarz, 1999) :
• Teilweise schon Jahre vor der Scheidung mehr Probleme bei späteren
Scheidungskindern
• Deutlich mehr dysfunktionale Familienprozesse
• Beides erklärt zu einem Teil die Nachscheidungsprobleme
• Aber: die mit der Scheidung einhergehenden Stressoren wirken zusätzlich
Massnahmen, die dysfunktionale Familienprozesse in vollständigen Familien
anzielen sowie Hilfsangebote für Familien nach der Scheidung sind angezeigt
Sind die Probleme von Scheidungskindern wirklich Folgen der Scheidung?
15

Zürcher Fachhochschule
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
16

Zürcher Fachhochschule
Im Folgenden nicht gezeigte Folien, die aber vielleicht auch interessant
sind
17

Zürcher Fachhochschule
• Erwachsene Scheidungskinder zeigen schlechtere Bildung, geringeres Wohlbefinden,
schlechtere Beziehung zu den Eltern (insb. Vater) (Amato, 2010; Amato & Sobolewski, 2001;
Schwarz, 2000)
• In aktuellen Studien:
- Kein höherer Cannabiskonsum (Sakyi et al., 2012)
- Kein höherer Bedarf an psychiatrischer oder medizinischer Hilfe (Angarne-Lindberg
& Wadsby, 2012)
- Höheres Risiko für Alkoholprobleme unabhängig von Alkoholproblemen der
Eltern (Thompson et al., 2008)
• Aber
- alle Studien retrospektiver Querschnitt
- unklar welche Entwicklung seit Scheidung
- kaum Faktoren zur Erklärung
Dauern die Probleme bis ins Erwachsenenalter an?
18

Zürcher Fachhochschule
Wie entstehen die negativen Wirkungen der Elternkonflikte?
(Cummings et al., 2006; Davies & Cummings, 1994; Erel & Burman, 1995; Krishnakumar &
Buehler, 2000; Schwarz, Stutz, & Ledermann, 2011; Siffert & Schwarz, 2011) 19
Elternkonflikte • andauernde
• intensive
• offen ausgetragene
• ungelöste
Herabgesetzte
Erziehungskompetenz
• Zu streng, strafend
• Inkonsistent
• vernachlässigend
Emotionale Unsicherheit der
Kinder
• Hohe emotionale Reaktivität
• Probleme der
Emotionsregulation
• Unsicherheit über
Verlässlichkeit von
Familienbeziehungen
Befinden und
Verhalten
Modelllernen

Zürcher Fachhochschule
Passives genetisches Modell:
• Genetische Disposition der Eltern für Eigenschaften (wie Aggression) ist Ursache
der Scheidung und durch Vererbung auch Ursache der Verhaltensprobleme der
Kinder
• Eher nicht bestätigt (z.B. D` Onofrio et al., 2007)
Sind die Probleme von Scheidungskindern wirklich Folgen der Scheidung?
20

Zürcher Fachhochschule
• Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62, 1269-1287.
• Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of
Family Psychology, 15, 355-370.
• Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72, 650-
666.
• Amato, P. R., & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident fathers and children´s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage
and the Family, 61, 557-573.
• Amato, P. R., & Sobolewski, J. M. (2001). The effects of divorce and marital discord on adult children's psychological well -
being. American Sociological Review 66, 900-921.
• Angarne-Lindberg, T., & Wadsby, M. (2012). Psychiatric and somatic health in relation to experience of parental divorce in
childhood. International Journal of Social Psychiatry, 58, 16-25.
• Bauserman, R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic review. Journal of
Family Psychology, 16, 91-102.
• Beelmann, W., & Schmidt-Denter, U. (1991). Kindliches Erleben sozial-emotionaler Beziehungen und Unterstützungssysteme
in Ein-Elternteil-Familien. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 38, 180-189.
• Booth, A., & Amato, P. R. (2001). Parental predivorce relations and offspring postdivorce well-being. Journal of Marriage and
Family, 63, 197-212.
• Buchanan, C. M., & Heiges, K. L. (2001). When conflict continues after marriage ends. Effects of postdivorce conflict on
children. In J. H. Grych & F. D. Fincham (Eds.), Interparental conflict and child development (pp. 337-362). Cambridge:
Cambridge University Press
• Buchanan, C. M., Maccoby, E. E., & Dornbusch, S. M. (1996). Adolescents after divorce. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Literatur
21

Zürcher Fachhochschule
• Cummings, E. M., Schermerhorn, A. C., Davies, P. T., Goeke-Morey, M. C., & Cummings, J. S. (2006). Interparental discord
and child adjustment: Prospective investigations of emotional security as an explanatory mechanism. Child Development, 77,
132-152.
• Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis.
Psychological Bulletin, 116, 387-411.
• D` Onofrio, B. M., Turkheimer, E., Emery, R. E., Maes, H. H., Silberg, J., & Eaves, L. J. (2007). A children of twins study of
parental divorce and offspring psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 667-675.
• Dunn, J., Davies, L. C., O`Connor, T. G., & Sturgess, W. (2001). Family lives and friendships: The perspectives of children in
step-, single-parent, and nonstep families. Journal of Family Psychology, 15, 272-287.
• Erel, O., & Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review.
Psychological Bulletin, 118, 108-132.
• Gähler, M., & Garriga, A. (2012). Has the association between parental divorce and young adults' psychological problems
changes over time? Evidence from Sweden, 1968-2000. Journal of Family Issues, 34, 784-808.
• Ge, X., Natsuaki, M. N., & Conger, R. D. (2006). Trajectories of depressive symptoms and stressful life events among male and
female adolescents in divorced and nondivorced families. Development and Psychopathology, 18, 253-273. Hetherington, E. M.
(1993). An overview of the Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage with a focus on early adolescence. Journal
of Family Psychology, 7, 39-56.
• Hetherington, E. M. (1989). Coping with family transitions: Winners, losers, and survivors. Child Development, 60, 1-14.
• Hetherington, E. M. (Ed.). (1999). Coping with divorce, single parenting, and remarriage. A risk and resiliency perspective.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
• Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: risk and resilience perspectives. Family Relations,
52, 352-362.
Literatur
22

Zürcher Fachhochschule
• Koerner, S. S., Korn, M., Dennison, R. P., & Witthoft, S. (2011). Future money-related worries among adolescents after divorce.
Journal of Adolescent Research, 26, 299-317.
• Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2000). Interparental conflict and parenting behaviors: A meta-analytic review. Family
Relations, 49, 25-44.
• Leon, K. (2003). Risk and protective factors in young children's adjustment to parental divorce: a review of the research. Family
Relations, 52, 258-270.
• Maccoby, E. E., & Mnookin, R. H. (1992). Dividing the child. Social and legal dilemmas of custody. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
• Maes, S. D. J., De Mol, J., & Buysse, A. (2012). Children’s experiences and meaning construction on parental divorce: A focus
group study. Childhood: A Global Journal of Child Research, 19, 266-279.
• Nielsen, L. (2011). Shared parenting after divorce: A review of shared residential parenting research. Journal of Divorce &
Remarriage, 52, 586-609.
• Ryan, R. M., & Claessens, A. (2013). Associations between family structure changes and children's behavior problems: The
moderating effect of timing and marital birth. Developmental Psychology, 49, 1219-1231.
• Sakyi, K. S., Melchior, M., Chollet, A. & Surkan, P. J. (2012). The combined effect of divorce and parental history of
depression on cannabis use in young adults in France. Drug and Alcohol Dependence, 126, 195-199.
• Schmidt-Denter, U. (2005). Belastungen bei Scheidung/Trennung. In P. F. Schlottke, S. Schneider, R. K. Silbereisen & G. W.
Lauth (Eds.), Störungen im Kindes- und Jugendalter - Verhaltensauffälligkeiten; Enzyklopädie der Psychologie – Klinische
Psychologie (Vol. 6, pp. 442-470). Göttingen: Hogrefe.
• Schmidt-Denter, U., & Beelmann, W. (1997). Kindliche Symptombelastungen in der Zeit nach einer elterlichen Trennung - eine
differentielle und längsschnittliche Betrachtung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 29,
26-42.
•
Literatur
23

Zürcher Fachhochschule
• Schwarz, B. (1999). Die Entwicklung Jugendlicher in Scheidungsfamilien. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
• Schwarz, B. (2000). Frauen aus verschiedenen Familienformen und ihre alten Eltern - Beziehungsqualität und wechselseitige
Unterstützung. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 410-424. Schwarz, B. (2009). Elterliche Konflikte
und Depressivität Jugendlicher in Trennungsfamilien: Zur Rolle der Triangulation. Psychologie in Erziehung und Unterricht,
56, 95-104.
• Schwarz, B., Stutz, M., & Ledermann, T. (2012). Perceived interparental conflict and early adolescents’ friendships: The role of
attachment security and emotion regulation. Journal of Youth and Adolescence, 41, 1240-1252.
• Siffert, A., & Schwarz, B. (2011). Parental conflict resolution styles and early adolescent adjustment: Children`s appraisals and
emotion regulation as mediators. Journal of Genetic Psychology, 171, 21-39.
• Storksen, I., Roysamb, E., Moum, T., & Tambs, K. (2005). Adolescents with a childhood experience of parental divorce: A
longitudinal study of mental health and adjustment. Journal of Adolescence, 28, 725-739.
• Strohschein, L. (2005). Parental divorce and child mental health trajectories. Journal of Marriage and Family, 67, 1286-1300.
• Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1980). Surviving the breakup: How children and parents cope with divorce. New York: Basic
Books.
Literatur
24