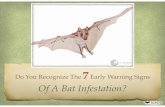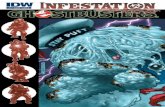Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mitKörnermais...
Transcript of Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mitKörnermais...
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermaisim pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
M. Birlcis und es. Gyuricza
Results of long-term. trials on the direct drilling ofmaize in Hungary
1. Einleitung und Problemstellung
Die Direktsaat ist ein spezielles Produktionsverfahren, bei
dem maximal 10 % der Bodenoberfläche durch eine Spezialsämaschine gestört wird (BALL, 1994; BrRKAs 1995a;
CHRISTENSEN und MAGLEBY, 1983). Die Bezeichnung derMethode ist von Anfang an unterschiedlich, so z. B. che
mische Bearbeitung (chemical ploughinglpreparation) ,
zero tillage, no tillage, 0 tillage), da dieses Verfahren nicht
von der chemischen Unkrautbekämpfung unabhängig gemacht werden kann (BALL, 1994; CANNELL, 1985). Nach
Mitteilungen von ALLEN und FENSTER (1986) wurde schonin den 20er Jahren in Montana (USA) mit Säverfahren in
vorhergehend nicht bearbeiteten Boden experimentiert.
YOUNG (1982) weist aufdas Jahr 1951 als Beginn von Herbizideinsatz kombiniert mit Direktsaat hin. Das Interesse
SummaryIn Hungary trials on direct drilling started 35 years ago in 1962. Experiments on maize have been carried out since 1977in the experimental field of the Institute of Crop Production ofGödöllö University on a Ramann's brown farest soil.
This report covers rwo 5-year periods from 1977-1981 and 1992-1996. The impacts of tillage methods and fertilization on the soil conditions, weed infestation and yield were studied. An additional research objective in the first 5-year
period was to compare direct drillingwith the conventional autumn method (ploughing) and with reduced tillage methods (such as strip rotavatoring, rotavatoring and disking) carried out in spring. This experiment has been continuedsince 1992 to compare direct drilling with conventional (ploughing), reduced (disking) and soil ameliorating (loosening combined with surface tillage) tillage methods. Three levels of ferrilization were resred (0, low and optimal).
The soil condition required by maize can be characterized by a dry bulk density of 1.15-1.35 g.cm-3 in the seedbedand of 1.35 g cm-3 at a depth of 10-40 cm,
The soil condition influenced by tillage can not be eonsidered as a yield-decreasing factor even at the end of the firstfive-year period. At the beginning of the second period the soil was compacted below the ploughed treatment and the
development ofa compacted layer below the depth of disking and below the seedbed of the direet drilling treatment.In the first experimental period the order offactors promoting weed infestation was as folIows: 1. lack offertilization;
2. undisturbed soil condition (direct drilling); 3. shallow primary tillage in spring; 4. cropping without rotation;5. direct drilling and/or shallow tillage applied long-term; 6. spring ploughing, while in the seeond period the mainfactors in weed infestation, including cover by annual, perennial, grassy and summer weeds, were the omission of fertilization, rotation and tillage. However, perennial weed infestation was deereased by regular loosening. Factors lead
ing to a reduction in weed infestation showed the same order in both experimental periods: 1. optimal level of ferti
lization; 2. crop rotation; 3. loosening repeated every year, 4. autumn ploughing.
In the first period autumn ploughing resulted in extremely high yields. However, significant differences in yield werefound berween direct drilling and spring cultivations at all fertilization levels. In the second period the soil conditions
influenced by tillage gave signifieant differences in yield. The order of soil eonditions with regard to yield follows anupward trend for seed bed depth of 10-16 em < 0-22 cm < 0-35 cm, as provided by direct drilling, disking, plough
ing and loosening variants.
Key words: direct drilling, maize, weeds, soil condition, yield.
Die Bodenkultur 19 51 (1) 2000
M. Birkäs und es. Gyuricza
ZusammenfassungMais erfordert für die optimale Entwicklung einen Bodenzustand. der sich mit Trockenrohdichtewerten von1,15-1,35 g.cm-3 (Saatbett) und 1,35 g.cm-3 (in der Tiefe von 10-40 cm) charakterisieren läßt. Bis zum fünften Jahrder ersten Versuchsperiode haben sich die Erträge durch eine unterschiedliche Bodenbearbeitung nicht verändert. ZuBeginn der zweiten Periode hatte sich hingegen der Boden an der Bearbeitungsgr~nze durch ein~n star~en Verd~chtungshorizont verändert. In der fünften Vegetationsperiode wurde eine Pflugsohle 10 der Pflugvariante, eine Verdichtungsschicht bei Scheibenegge und eine deutliche Erhöhung der Trockenrohdichte in der Direktsaatvariante unter-
halb der Saattiefe nachgewiesen.Im ersten Untersuchungszeitraum wurde die Verunkrautung durch folgende Faktoren gefördert: 1. Weglassen derMineraldüngung; 2. Verzicht aufjegliche Bodenbearbeitung (Direktsaat); 3. flache Bearbeitung im Frühling; 4. Pflanzenanbau ohne Fruchtwechsel; 5. dauerhafter Einsatz von Direktsaat und/oder flache Bearbeitung; 6. Pflügen imFrühling. In der zweiten Untersuchungsperiode sind die Mineraldüngung, der unterlassene Fruchtwechsel und derVerzicht auf die Bodenbearbeitung die wichtigsten Faktoren für die Ausbreitung von einkeimblättrigen, mehrjährigen und wärmebedürftigten Unkräutern. Eine starke Vermehrung der mehrjährigen Unkräuter kann durch regelmäßige Bodenlockerung mit dem Grubber zurückgedrängt werden. Verunkrautungsmindernde Faktoren sind in beiden Perioden: 1. bedarfsgerechtes Düngungsniveau; 2. Fruchtwechsel; 3. jährlich wiederholte Bodenlockerung;
4. Ptlugfurche.Die höchsten Erträge und der günstigste Bodenzustand wurden in der ersten Versuchsperiode bei allen Düngungsniveaus mit Herbstfurche erreicht. Die zweite bzw. dritte Stelle in der Rangordnung wiesen die Fräsparzellen (aufvoller Fläche und in Streifen) auf. Der Direktsaat war sowohl das Frühlingspflügen als auch der Scheibeneggeneinsatz imFrühjahr hinsichtlich des Bodenzustandes und der Erträge überlegen.In der zweiten fUnfjährigen Periode wies unter weniger günstigen Witterungs- und Bodenzustandsverhältnissen dieDirektsaat die geringsten Erträge auf
Schlagworte: Direktsaat. Körnermais, Unkräuter, Bodenzustand, Ertrag.
an der neuen Methode wurde erstmals durch starke Winderosion und den Zwang zum Schutz dagegen in denjahrenvon 1934 bis 1940, später durch ökonomische Überlegungen geweckt (ALLEN und FENSTER, 1986; YOUNG, 1982).In den USA wurde ab 1950, in West-Europa ab 1961 mitexakten, vergleichenden Versuchen angefangen. Durch dieersten Ergebnisse mit Winterweizen, Körnermais und beianderen Pflanzenarten - zu denen auch die Entwicklungder neuen und wirksamen Herbiziden beigetragen hat wurden die positiven Aussichten der Methode bestätigt(CANNELL, 1985; FORTUNE, 1994).
Als Vorteile der Direktsaat werden die Minderung vonBodenabtrag. der verminderte Wasserverlust sowie diegeringere mechanische Bodenzerstörung, die Anhebungdes Gehaltes an organischer Substanz in der Krume sowiedie geringeren Kosten angeführt (USDA-Daten, zit. BIRKAs, 1995a; CANNELL, 1985; YOUNG, 1982).
In Ungarn begannen die vergleichenden Versuche 1962,in den umgebenden Ländern einige Jahre später (GYÖRFFY,
1964; BIRKAS, 1993, 1995a, b; KONSTANTINOVIC, 1982;LAcKo-BARTOsovA, 1990; PIrAT und LAcKo-BARTOSovA,
1990; MORGUN et al., 1983; Kovxc, 1991; DEMO undKOLlAR, 1992).
In Ungarn können drei Perioden der Direktsaatversucheangeführt werden. Der Zeitraum der ersten Etappe fällt aufdie Jahre 1962-1974, bei der die vorher unbekannte, neueMethode mit den konventionellen und reduzierten Produktionsverfahren verglichen wurde. Die Versuche wurdenin fünf unterschiedlichen Regionen (Martonväsär, Keszthely, Karcag, Szeged, Nyiregyhäza) mit fünf Kulturpflanzenarten durchgeführt. Die Auswirkung dieser Anbaumethodeauf den Ertrag wurde in konventionell (mit Pflug) undreduziert (generell mit Scheibenegge) bearbeiteten Versuchsvarianten untersucht. In den ersten WinterweizenDirektsaatversuchen wurde unabhängig von der Textur desBodens eine generelle Ertragsminderung im Vergleich zukonventioneller Bearbeitung festgestellt, die sich aber beigünstigerer Nährstoffversorgung minderte (KOLTAY 1971,1974, 1975; SIPOS 1972, 1973; KAPOSZTA, 1973). AlsNachteil der neuen Methode wurde die verstärkte Verunkrautung, als Vorteil der verbesserte Bodenwasserhaushaltnachgewiesen (PUSZTA! und KAz6, 1968; ERDEI, 1971a, b).
Die Bodenkultur 20 51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
21
In den Versuchen mit Körnermais wurden ähnliche
Ergebnisse wie mit Winterweizen nachgewiesen. DasAus
maß der Ertragsminderung wurde aber durch den unter
schiedlichen Bodenzustand beeinflusst (GYÖRFFY und
SUBÖ, 1969 a, b, 1979; KovATS, 1974). Mehrere Autoren
berichten über die Abnahme der Direktsaat-Nachteile
durch zunehmenden Düngemitteleinsatz im Vergleich zu
konventionellen als auch reduzierten Systemen. Der Ver
zicht auf jegliche Bodenbearbeitung führte gleichzeitig zur
Verdichtung und Verunkrauturig der obersten Bodenhori
zonte (RAoICS, 1989), die nur durch eine standortgerechte
Fruchtfolge zu mindern war. Der unmittelbare Effekt der
Direktsaat wurde in Dauerversuchen durch den Bodenzu
stand beurteilt. Eine grössere Ertragsminderung erfolgte
nach 3-5 Versuchsjahren, danach konnte wieder eine Ver
besserung des Ertragsverhaltens nachgewiesen werden
(KovATS, 1974; KIsMANYoKY und BAIAzs, 1996; GYÖRF
FY, 1990; BrRKAs, 1987).
Die zweite Periode der Direktsaatversuche in Ungarn fällt
aufdie Jahre 1982-1990. Die Dauerversuche haben sich inden Forschungsinstituten Keszthely, Martonväsär und
Gödöllö fortgesetzt, begonnen wurde in Kornpolt.
Die jüngste Periode der Direktsaatversuche in Ungarn
begann 1991. Parallel dazu laufen auf einer Fläche von ins
gesamt 100 Hektar ergänzende wissenschaftliche Arbeiten(Keszthely, Gödöllö) und technische (IKR AG., For
schungsinstitut für Agrartechnik Gödöllö) Entwicklungs
versuche. Die Untersuchungsschwerpunkte wurden um
den Einsatz der Direktsaat in Trockengebieten sowie Ent
wicklung zu bodenschonenden Verfahren erweitert.
2. Material undMethoden
Auf dem Versuchsfeld des Institutes für Pflanzenprodukti
on der Agraruniversität Gödöllö werden seit 1977 Direktsaatversuche mit Winterweizen und Körnermais durchge
führt. In der vorliegenden Arbeit wird über die Ergebnisse
von zwei 5jährigen Versuchsperioden, 1977-1981 sowie
1992-1996 berichtet.Von den zahlreichen Untersuchungszielen werden die
folgenden hervorgehoben: 1. Zusammenhang zwischenBodenbearbeitungsverfahren und Bodenzustand; 2. Zu
sammenhang zwischen Bodenbearbeitung und Verunkrautung. 3. Zusammenhang zwischen Bodenzustand und Er
trag.In den Versuchen wurden frühreifende Maissorten - vor
1981 MvSC 1304, seit 1992 MirnaSC, HelgaSC, Furio SC
Die Bodenkultur
- angebaut. Die versuche beider Perioden wurden in Strei
fenanlagen mit 4 bzw. 3 Wiederholungen angelegt. Eine
Bearbeitungsparzelle hat eine Fläche von 177 m2, die Dün
gungsparzellen von 59 m2 (Netto). Die gesamte Versuchs
fläche ist 3534 m2 groß.In der Versuchsperiode von 1977-1981 kamen bei Kör
nermais die folgenden Varianten zur Anwendung:
Bodenbearbeitung:
D = DirektsaatF-10S = Fräse 8-10 cm (in Streifen eingesetzt im Frühling)
F-10 = Fräse 8-10 cm (im Frühling)
S-16 =Scheibenegge 12-16 cm (im Frühling)
P-22F =Pflug 20-22 cm (im Frühling)
P-30H =Pflug 26-30 cm (im Herbst)
Mineraldüngung:
MI = ungedüngt (Kontrolle)
M2 = 65 kg N + 50 kg P20S + 65 kg Kz0/haM 3 = 130 kg N + 100 kg P20S+ 130 kg Kz0/ha
M 4 = 195 kg N + 150 kg PzOS + 195 kg KzO/ha
Seit 1992 gibt es folgende Varianten:
Bodenbearbeitung:
D = DirektsaatS-20 =Scheibenegge (16-20 cm)
P-25H =Pflug (22-25 cm)G+S = Grubber (35-40 cm) + Scheibenegge (16-20 cm)
G+P =Grubber (35--40 cm) + Pflug (22-25 cm)
Mineraldüngung:
MI = ungedüngt (Kontrolle)
M 2 = 80 kg N + 45 kg P20 S+ 75 kg Kz0/ha
M 3 = 160 kgN + 90 kg P20S + 150 kg Kz0/ha
Die Variante Mz entspricht im Verhältnis zu der Nährstoff
versorgung des Bodens einem niedrigen, die M3 einembedarfsgerechten Niveau. In dem Versuch wurde bis 1994
Körnermais in Monokultur, danach im Fruchtwechsel mit
Winterweizen angebaut. Nach der Saat wurde je eine che
mische und mechanische Unkrautbekämpfung eingesetzt.Bodenverbälmisse: Der Versuchsfeld in Gödöllö liegt 242
m über NN, östlich von Budapest im südlichen Teil des
Gödöllöer Hügellandes. Der Boden ist eine flachgründige,
mittelschwere Braunerde und besteht aus sandigem Schluff.
Das Ausgangsgestein ist Sand und Mergel, das in unter
schiedlicher Mächtigkeit von Löß bedeckt ist. Der Tonge
halt der Krume (0-35 cm) beträgt 26 0/0, die Wasserleit
fähigkeit im Oberboden ist gut, im Unterboden gering. Der
51 (1) 2000
M. Bir1cls und es. Gyuricza
Humusgehalt ist mit nur 1,17 % gering, wie auch die Stickstoffversorgung. Die Analysenwerte ergaben für Phosphor(als p205) 120-170 mg/kg, für Kalium (als 1<.20) 140-170mg/kg, für Gesamtstickstoff 0,14-0,17 0/0. Der pB-Wertist 7,1.
Witterung: Die mittlere Jahressumme der Niederschlägeliegt bei 564 rnm, davon 313 mm während der Vegetationsperiode. Die ersten 5 Jahre waren durchschnittlich, mitAusnahme desTrockenjahres 1978 mit ca 384 mm Niederschlag.Von der zweitenVersuchsperiode können zweiJahre(1992, 1993) als trocken, das Jahr 1995 niederschlagsreich
(+75 mm) und die Jahre 1994 und 1996 als durchschnittlich bezeichnet werden. Unter den gegebenen Standortverhältnissen kann durch die herkömmliche Bodenbearbeitung und die bedarfsgerechte Düngung bei günstigerNiederschlagsverteilungbei Winterweizen 2,5-3,0 t/ha, beiKörnermais 3,5-4,0 t/ha Ertrag erreicht werden.
Der Bodenzustand - Trockenrohdichte und Wassergehalt- wurde bis 1993 durch Stechzylinderproben (dreimalwährend der Vegetationsperiode in vier Wiederholungenpro Variante), danach mit einem Penetrometer (dreimalwährend der Vegetationsperiode in vier Wiederholungen
171,5 1,6
Troekenrohdichte(g.cm-)
1,3
F-I0S0...,.......--....,......-....----.------,---.,----.....
12-10
-so .......----------......----....
820~
~E!30
-40 - .. .. .. .. .. - .. .. .. - .. - .. .. - .. .. - .. - - - .... - - .. .. .. .. .. ..
17
Trockenrohdichte(g.cm-3)
1,3
DO....----....,..-~----.,..---.-----...,..---.....12
-10
i:po~
~30
-40
-so .......----------........------.....
171,5 1,6
Treckenrehdichte (g.cm-1
1,4
S-16o..,----..~--....,...----,---.......,.--___.
12-10
-40 ----------------- .. ----- ---------
171,5 1,6
Trockenrohdichte (g.em~
1,40...----_._--........----.----....----.12
·10
~ ----------------------- ----------
-so ......----------......-----' ·50 .......----------......-----'
17
Trockenrohdichte (g.cm-3)
17
Trockenrohdichte (g.cm-3)P-30B
O.,..-----..~--__,_--.....,..--.......,--_.
12·10
-50 -----------__...L- ---'
-40
P-22FO,.....---.~--...,..--__r"'--___..--___.
12-10
-so .......----------...c..._......_--J
D =Direktsaat; F-10S =Fräse 8-10cm (inStreifen): F-10 =Fräse8-10 cm; S-16= Scheibenegge 12-16 cm (im Frühling), I>-22F =Pflug 20-22(im. Frühling) P-30H =Pflug 26-30 cm (im Herbst) , cm
Abbildung 1: TiefenverlaufderTrockenrohdichtein verschiedenen Bearbeitungsvarianten im Frühjahr 1977 (1. Versuchsjahr), Gödöllö (Mittelwertevon 4 Wiederholungen)
Figure 1: Soilbulk density at different soil tillage treatments in Spring 1977 (1st year), Gödöllö (Average of 4 repetations)
Die Bodenkultur 22 51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnis se mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
pro Variante) (DVORACSEK, 1968) beurteilt. Seit 1995 wirdein in Szarvas (Ungarn) entwickeltes Penetrometer benutzt,das bis 75 cm Tiefe den Eindringwiderstand und den Bodenwassergehalt in Massen% gleichzeitig messen kann(KOCSIS und DARÖCZI, 1995).
Zur Untersuchung des Unkrautbedeckungsgrades wurdedie Quadratmethode (U)VAROSI, 1973) verwendet. DieBewertung der Verunkrautung, Düngerwirkung, sowie desErtrageswurde mit Varianz- und Regressionsanalysen durchgeführt.
3. Ergebnisse
3.1 Einfluß der unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren auf den Bodenzustand
Zu Beginn der ersten fünfjährigen Versuchsperiode war derAckerboden in der Krumentiefe von 0-25 cm - einschließlich der flachen Bearbeitungsvarianten - ausreichendgelockert. Unter der Bearbeitungsgrenze kam es zu einemVerdichtungshorizont, in dem die Trockenrohdichte Wertevon 1,58-1,60 g.cm-3 erreichte. Während dieser Zeit kam
17
Trockenrohdichte(g.cm-3)F-I0S
0 ........---.----.....---...,.---....,...----,12
-10
-40
-50 --------------...1......-----..1
E-20~..~-30
17
Trockenrohdichte (g.cm-3)D0.....-------------....----_--_12
-10
E-20~
~
~-30
-40
-50 -'------------.....-----..1
1 71,61,5
Trockenrohdichte(g.cm-3)8-16O"'P"--~--.---~r-----....,----.,..----,
12-10
-40
-50 ...1...- .....1.0...- ---'
i-20Cj
~~-30
17
Trockenrohdichte(g.cm-3)F-I00-----------------...----...12
-10
-50 -L- -l...... ........
-40
161,5
Trockenrohdichte(g.cm-3)
1,4
P-30HO"'P"---..-~-,.------r------,.-----,
1 2-10
-50 ...1...- --'
-40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8-20u
:le: -30
1 71,61,5
Trockenrohdichte(g.cm-3)
1,4
P-22F
0--------....---.....----...-----,1 2
-10
..so ...l- ---li-- ---'
-40 ----------------------- ----------
D = Direktsaat. F-10S = Fräse 8-10 cm (in Streifen); F-10 = Fräse 8-10 cm; 5-16 = Scheibenegge 12-16 cm (im Frühling); P-22F = Pflug 20-22 cm(im Frühling) P-30H = Pflug 26-30 cm (im Herbst)
Abbildung 2: Tiefenverlaufder Trockenrohdichte in verschiedenen Bearbeitungsvarianten im Frühjahr 1981 (5. Versuchsjahr), Gödöllö (Mittelwerte
von 4 Wiederholungen)Figure 2: Soll bulkdensity at different soil tillage treatments in Spring 1981 (5th year), Gödöllö (Average of4 repetations)
Die Bodenkultur 23 51 (1) 2000
eserwartungsgemäß zu einer schichtweisen Verdichtung bis50 cm Bodentiefe. Bis zur Saat- bzw. Bearbeitungstiefe desin Monokultur stehenden Maises blieb der Boden locker,darunter wurde er dichter. In fünf Jahren hat sich derBodenzustand unter 30 cm Tiefe nicht maßgebend verändert (Abb. 2) Bei Direktsaatwurde die Bodendichte in einerTiefe von 7-30 cm in größerem Maße geändert. Nach 5Jahren wurde der Verdichtungsgrad um durchschnittlich 28% gesteigert, aber der kritische Wert von 1,5 g.cm-3 nichterreicht. Mitentscheidend waren die schonende Ackernutzung und die geringere Häufigkeit des Befahrens des Feldes.
Ähnliche Phänomene zeigten sich bei der im Frühlingdurchgeführten Flachbearbeitung. Die Anzahl der Arbeitsgänge dieser Bearbeitungssysteme betrug mit der Saatzusammen nur zwei, dadurch blieb der Boden auch imfünften Vegetationsjahr in einem günstigen Zustand.
Der Bodenzustand der zweiten Versuchsperiode ist aufAbb. 3 und Abb. 4 zu sehen. Am Versuchsbeginn (Abb. 3)war eine verdichtete Schicht in einer Tiefe von 25-30 cmzu beobachten (1,58-1,60 g.cm-3) . Der Verdichtungsgradblieb innerhalb der flachen Bearbeitung « 25 cm), derBearbeitungsvarianten von Direktsaat, Scheibenegge (16-
-40 ........ --JL.-_-J
1 71,61,5
Trockenrohdichte(g.cm-3)8-20
0......--......----------------12
-40 ........_--1
-10
au~20~
E=..30 - - ... ... ... ... - - ... ... ... ... ... - ... - ... ... ... ... - ... ... - - - - _... - ... - ...
17
Trockenrohdichte(g.cm-3)D
0......---......---------------12
-10
171,61,5
Trockenrohdichte(g.cm-3)
1,4
-40 ...-.--------------..;;;=--.---1
G+S0...---......-..---.......,.---.,--------
12
..10
a~
~20 .. - - - _... _.. .. - .. - - - - - - -Q,;
E::-30
17
Trockenrohdichte(g.cm-3)P-2SH0.,............--,.---....,..---...-----.-----...
12
-40 ....... ---JL--_.......
-10
i~20
Q,)
f;
-30
171,61,5
Trockenrohdtchtetg.em..3)
1,4
G+PO-r-........-....,...--.....,..-----,I""'-----~-...;;..
12
-10
e~-20'~r;:
-30
-40...a..------------..;;;;:;;:::::\----'D = Direktsaat; $-20 = Scheibenegge 16-20 cm; P-25H = Pflug 22-25 cm (im Herbst); G+S = Grubber (35-40 cm) + Scheibenegge (16-20 cm);G+P =Grubber (35-40 cm) + Pflug (22-25 cm) )
Abbildung 3: TiefenverlaufderTrockenrohdichtein verschiedenen Bearbeitungsvarianten im Frühjahr 1992 (1. Versuchsjahr), Gödöllö (Mittelwertevon 4 Wiederholungen)
Figure 3: Soll bulk density ar different soil tillage treatments in Spring 1992 (1St year), Gödöllö (Average of4 repetations)
Die Bodenkultur 24 51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermals im pannonischen Produktionsgebier Ungarns
20 cm) sowie Pflug (22-25 cm) gleich, bei Grubber undScheibenegge (G+S) sowie Grubber und Pflug (G + P))wurden die Werte positiv verändert. Die Trockenrohdichte des ungestörten, unbearbeiteten Bodens unter 4045 cm Tiefe weist einen Wert von mindestens 1,62 g.cm-3
auf Da eine erhöhte Verdichtung frühestens unter derSaat- bzw. Bearbeitungstiefe auftritt, wurden die Meßwerte von diesen Schichten in der Tabelle 1. zusammengefasst. Es kann festgestellt werden, daß die Verdichtung in dengegebenen Bodenschichten in allen Varianten nach fünfJahren gesteigert wird, am auffälligsten aber unter der
Scheibenegge- bzw. Pflugvariante. In Abbildung 4 sinddie Werte des Eindringwiderstandes in den Tiefen von0-60 cm zu ersehen.
Es ist festzustellen, daß ein unerwünschter Bodenzustandfür den Mais bei Direktssat unter der Saattiefe, bei anderenVarianten unter der jährlich wiederkehrenden Bearbeitungstiefe entstanden ist. Die Grubbervarianten sind bis35- 40 cm gelockert, es sind aber verdichtetere Schichtenin den Varianten Grubber + Scheibenegge und Grubber +
Pflug zu finden. Diese Verfahrenführten zur Verminderungder Lockerungswirkung des Grubbers.
4
4
Eidringwiderstand(MPa)
Eindringwiderstand(MPa)
4
G+S0......--.---........---.....,...------,.-----.
8-20O........---.r---t-------r-----r-o-----,
-40
..10
E-20CJ
~~-30
-so ..a....- ....... --""
-10
-50"""----------.....----_---a
e..20~~
~-30
Eindringwiderstand(MPa)
4
Eindringwiderstand(MPa)
3
Eindringwiderstand(MPa)D0
1,5-10
..-..S..20(,j
"-"~
~.30
-40
-so
P-25H0
-10
-40 ------------------
e.20CJ"-"~
~ -30
·10
5-20~..-~-30
-40
-so ...&..--------------=---------'
-so ........------------........-----"'-'
D =Direkrsaar; $-20 =Scheibenegge 16-20 cm; P....25H = Pflug 22-25 cm (im Herbst); G+S =Grubber (35-40 cm) + Scheibenegge (16-20 cm):G+P =Grubber (35-40 cm) + Pflug (22-25 cm)
Abbildung 4: TIefenverlaufderTrockenrohdichte in verschiedenen Bearbeitungsvarianten im Frühjahr 1992 (5.Versuchsjahr), Gödöllö (Mittelwertevon 4 Wiederholungen)
Figure 4: Soll bulk density at different soiltillage treatments in Spring 1992 (5th year), Gödöllö (Average of4 repetations)
Die Bodenkultur 25 51 (1) 2000
M. Birkäs und es. Gyuricza
Tabelle 1: Die Trockenrohdichte des Bodens unter der Saattiefe und der Bearbeitungsgrenze (GÖDÖLLÖ, 1977-1981*, 1992-1996**)Table 1: Dry bulk density at the depth ofsowingand annual tillage (GÖDÖLLÖ, 1977-1981*, 1992-1996**)
Bodenbearbeitung Untersuchungstiefe (cm)Trockenrohdichte (g'cm-3)
1. Jahr 5. Jahr
Direktsaat(D) 6 1.32* 1.36*1.32** 1.38**
Fräsenin Streifen*(F - lOS) 6 1.33 1.36
undFräsen" 8-10 cm (F - 10) 12.5 1.38 1.38
Scheibeneggen 12-16* (S - 16) 6 1.33 1.3418.5 1.38 1.48
16-20** (S - 20) 6 1.33 1.3322.5 1.40 1.58
Frühlingspflügen 6 1.32 1.2820-22cm* (S - 22F) 25 1.52 1.56
Herbstpflügen 6 1.30 1.3226-30cm* (P ..30H) 32.5 1.50 1.5422-25cm** (P - 25H) 6 1.28 1.30
27.5 1.56 1.60Grubbern 35-40 cm 6 1.33 1.33+ Scheibeneggen 16-20cm (G+ S) 22.5 1.44 1.58
42.5 1.55 1.58Grubbern35-40 cm 6 1.32 1.32+ Pflügen22-25 cm (G + P) 27.5 1.48 1.46
42.5 1.55 1.57
3.2 Wechselwirkungen zwischen Bodenbearbeitung,Mineraldüngung und Verunkrautung
In der ersten funfjährigen Versuchsperiode waren die imMais vorherrschenden Unkrautarten die ausdauernden Unkräuter mit Ausläufern und die wärmebedürftigten Unkräuter. Die Faktoren - sowohl innerhalb der fünfjährigenVersuchsperiode als auch in einer Vegetationsperiode- diedie Verunkrautung verursachten, waren in ihrer Bedeutunggereiht: 1. Weglassen der Mineraldüngung, 2. Verzicht aufjeglicheBodenbearbeitung (Direktsaar), 3. die flacheBodenbearbeitung im Frühling, 4. Anbau ohne Fruchtwechsel,5. mehrjährige Direktsaat oder flache Bearbeitung, 6. Pflügen im Frühjahr. Unter den Faktoren, die den Unkrautbedeckungsgrad vermindern, sei als wichtigster die günstigeNährstoffversorgung genannt, dann die Grundbearbeitungim Herbst und die mindestens 20 cm tiefe, wendendeGrundbearbeitung. In der Fachliteratur sind Hinweise zufinden, daß das Vermeiden der Bodenbearbeitung und dieFlachbearbeitung im Frühjahr zu einer wesentlichenUnkraurvermehrung führt,
Viele Autoren haben zwar auch festgestellt, daß dieUnkrautvermehrung durch die Verbesserung der Nährstoffversorgung vermindert wird. Die Tendenz der Untersuchungen des Unkrautbedeckungsgrades ist sowohl in derersten Untersuchungsperiode als. auch in den ersten drei
Jahren innerhalb der zweiten Periode identisch: wenn dieMineraldüngung oder die Bodenbearbeitung unterlassenwird, bzw; im Fall der flachen Bodenbearbeitung, erhöhtsich der Unkrautbedeckungsgrad Jahr für Jahr. Deswegenwurde im vierten Jahr ein Winterweizen-Mais Fruchtwechsel eingeführt. Aufdiese Weise gab es eine Möglichkeit, dieAuswirkungen der Mais-Monokultur auf die Verunkrautung sowie die Auswirkungen des Anbaues mit Fruchtwechsel auf die Unkrautregulierung zu beobachten. DieDirektsaat entspricht einem ungestörten Bodenzustand. Eswar aus diesem Grund zu erwarten, daß die mehrjährigenUnkräuter begünstigt würden, daher wurde die Bedeckungdurch mehrjährige und andere Unkrautarten getrennt aufgenommen. Es wurden ferner die Änderungen des Bedeckungsgrades von einkeimblättrigen, von wärmebedürfigten und der restlichen Unkrautarten getrennt untersucht.
Ergebnisse des ersten, dritten und fünften Jahres diemehrjährigen bzw. restlichen Unkrautarten betreffend sindaus Abbildung 5 zu ersehen. Vor Beginn des Versucheswurde Sommergerste ohne Düngung und mit gewöhnlicher, 22-25 cm tiefer Pflugbearbeitung angebaut. Dergesamte Unkrautbedeckungsgrad betrug 7,5 %. Im erstenMaisanbaujahr ist die gesamte Unkrautbedeckung beiDirektsaat ohne Dünger auf 10,5 %, mit Dünger auf12,5 % gestiegen. Im ersten Versuchsjahr lag der Unkraut-
Die Bodenkultur 26 51 (1) 2000
Direktsaat- Dauerversuchsergebnisse mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
bedeckungsgrad in der flachen Scheibeneggenvariante undder Direktsaat auf gleichem Niveau (Abb. 5). In den Varianten, wo die Bearbeitungstiefe unter 20 cm lag, wurde einniedrigerer Bedeckungsgrad im Vergleichzu Sommergerstebei allen drei Mineraldüngungsvarianten festgestellt. DieVerunkrautung der Direktsaat stieg bis zum dritten Jahr beiallen Düngungsvarianten, aber in verschiedenem Maße.Die mit Unkräutern bedeckte Flächewurde ohne Düngungverdreifacht, bei mangelnder Nährstoffversorgung verdoppelt und bei bedarfsgerechter Düngung um 57 % erhöht.Diese Tendenz kann auch in der Ausbreitung der mehr-
jährigen Unkrautarten beobachtet werden. Von den amhäufigsten vorkommenden fünf mehrjährigen Unkrautarten wurde die Bedeckung von Acker-Kratzdistel (Cirsiumaruense) bei allen Nährstoffstufen verdreifacht. Diese Proportion ist durch Einführung des Fruchtwechsels bedeutend verringert worden. Die jährlich wiederkehrendeLockerung mit Grubber hat die Ausbreitung von AckerKratzdistel begrenzt.
Auch die flache Bearbeitung mit Scheibenegge wirktesich auf die Verbreitung der mehrjährigen Unkräuter günstig aus. In der Pflugvariante wurde die Bedeckung durch
o
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
Ohne DüngungUnkrautbedeckungsgrad 0/0
D
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
Bedarfsgerechte DüngungUnkrautbedeckungsgrad 0/0
o 5 10 15 20 25 30 35
D
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
D
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
o
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
Gesamt ""-- 1Mehrjährige Unkräuter
Fruchtfolge (1992-): Körnermais - Körnermais - Körnermais - Winterweizen - KörnermaisD = Direktsaat; S-20 =Scheibenegge (16-20 cm): P-25H =Pflug (22-25 cm), G+P = Grubber (35-40 cm) + Pflug (22-25 cm)
Abbildung 5: Wechselwirkung zwischen Bodenbearbeitung, Mineraldüngung und Verunkrautung bei Mais (Gödöllö, Sommer 1992-1996)Figure 5: Corre1ation between soil tillage,fertilization and weed infestation in maize (Gödöllö, Summer 1992-1996)
Die Bodenkultur 27 51 (1) 2000
M. Birkäs und es. Gyuricza
mehrjährige Unkräuter im Vergleich zu Direktsaat undScheibenegge reduziert, aber eine zunehmende Verunkrautung konnte durch dieseMethode nicht verhindert werden.Bei der Ausdehnung von Unkräutern spielten die Bearbeitung, der Fruchtwechsel sowie der Mangel an Dünger eineerstrangige Rolle. Die mehrjährigen Unkräuter konntendurch regelmäßige Bearbeitung (Lockerung) bis zur Tiefevon 25-40 cm, aufgrund der besseren Nährstoffversorgungsowieder Bestandesdichte von Mais und Winterweizen wirkungsvoll zurückgedrängt werden.
Im Jahr vor Versuchsbeginn ist von den einkeimblättrigenUnkrautarten die Hühnerhirse (Echinochloa crus-gallt) im
Sommergerstenbestand vorgekommen. In den Jahren vonMaisanbau ohne Fruchtwechsel hat die Ausbreitung dereinkeimblättrigen Unkrautarten kontinuierlich zugenommen (Abb. 6). Auch die Unterschiede zwischen den Bearbeitungsvarianten sind in der dritten Vegetationsperiodegrößer geworden. Wird die Bedeckung durch einkeimblättrige Unkrautarten in der Ptlugvariante (60/0) gleich 100 0/0gesetzt, so ergibt sich für die Direktsaat 223 0/0, die Scheibenegge 125 0/0, das mit Grubberbearbeitung variierte Pflügen 93 % im Durchschnitt der drei Düngungsniveaus. DieBedeckung durch einkeimblättrige Unkrautarten war beiDirektsaat in jedemJahr deutlich größer alsbei den übrigen
Ohne DüngungUnkrautbedeckungsgrad %
D
8-20
P-25
G+P
D
8-20
P-25
G+P
D
$-20
P-25
G+P
5. Jahr
o
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
o 5 10 15 20 25 30 35
o 5 10 15 20 25 30 35
Bedarfsgerechte DüngungUnkrautbedeckungsgrad 0/0
o
S·20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
D
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35
5. Jahr
o 5 10 15 20 25 30 35
Gesamt------' ~ lEinkeimblättrige Unkräuter
Fruchtfolge (1992-): Körnermais - Körnermais - Körnermais - Winterweizen - KörnermaisD =Direktsaat; S-20 =Scheibenegge (16-20 cm); P-25H =Pflug (22-25 cm); G+P = Grubber (35-40 cm) + Pflug (22-25 cm)
Abbildung 6: Wechselwirkung zwischen Bodenbearbeitung, Mineraldüngung und Verunkrautung bei Mais (Gödöllö, Sommer 1992-1996)Figure 6: Correlation between soll tillage, fertilization and weed infestation in maize (Gödöllö,Summer 1992-1996)
Die Bodenkultur 28 51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
Ohne DüngungUnkrautbedeckungsgrad 0/0
1. Jahr 5. Jahr
0 D 0
8-20 8-20 S-20
P-25 P..25 P-25
G+P G+P G+P
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
Bedarfsgerechte DüngungUnkrautbedeckungsgrad %
D
8-20
P-25
G+P
o 5 10 15 20 25 30 35 o 5 10 15 20 25 30 35
o
S-20
P-25
G+P
o 5 1Q 15 20 25 30 35
Gesamt ________.....IIWärmebedürftige Unkräuter
Fruchtfolge (1992-): Körnermais - Körnermais - Körnermais - Winterweizen - KörnermaisD =Direktsaar; S-20 =Scheibenegge (16-20 cm): P-25H =Pflug (22-25 cm): G+P =Grubber (35-40 cm) + Pflug (22-25 cm)
Abbildung 7: Wechselwirkung zwischen Bodenbearbeitung, Mineraldüngung und Verunkrautung bei Mais (Gödöllö, Sommer 1992-1996)Figure 7: Correlation berween soil tillage, fertilization and weed infestarion in maize (Gödöllö, Summer 1992-1996)
Bearbeitungsvarianten unabhängig von der Düngung. DerVerzicht auf die wendende Bodenbearbeitung begünstigteebenso die Ausbreitung der einkeimblättrigen Unkrautarten.
Die dominierenden Unkräuter des Maises gehören zumgrößten Teil zu den wärmebedürftigen Arten, deren Anteilan der Gesamtverunkrautung (nach Arten) im ersten Versuchsjahr in der Reihefolge der Nährstoffversorgung bei77-82-83 % lag. In den Jahren der Mais-Monokultur breiteten sich wärmebedürftige Unkrautarten zunehmend aus(Abb. 7). Beispielweise verdreifachte sich der Bedeckungs-
grad unter den für Mais ungünstigsten Verhältnissen (Verzicht auf jegliche Bodenbearbeitung und Nährstoffversorgung). Auch bei Direktsaat zeigte sich eine geringere Verbreitung bei bedarfsgerechter Nährstoffversorgung. DasWeglassen der Düngung begünstigte die Verbreitung derwärmebedürftigen Unkräuter sowohl in der Scheibenegge...als auch in der Pflugvariante. In den Grubbervarianten (inKombination mit Pflug oder Scheibenegge) wurde die Zahldieser Arten vermindert. Gleiches gilt bei allen Mais-Varianten mit Ausnahme von urigedüngten Direktsaatparzellennach Winterweizen-Vorfrucht. Die erwähnte Ausnahme
Die Bodenkultur 29 51 (1) 2000
M. Bir1cls und es. Gyuricza
steht mit Bedeckung durch Hühnerhirse in Zusammenhang. Die Zunahme der Bedeckung durch wärmebedürftige Unkrautarten wurde durch Mais-Monokultur und dasWeglassen der Düngung beeinflußt.
3.3 Wechselwirkungen zwischen Bodenzustand undErtrag
In Hinblick auf die Witterungs- und Bodenzustandsverhältnisse der zwei Untersuchungsperioden ergaben sichUnterschiede, und zwar zum Nachteil der zweiten Periode.Die Ertragsergebnisse der ersten fünfjährigen Versuchsperiode sind in der Tabelle 2 dargestellt. Die Reihenfolge desersten Anbaujahres war im Durchschnitt der Mineraldüngungsstufen die Folgende: Herbstpflügen > Fräsen> Schei-
beneggen > Direktsaat > Fräsen in Streifen> Frühlingspflügen. Im Folgejahr nahm die Direktsaat aufgrund der Erträge die zweite Stelle ein. Nach dem dritten Versuchsjahr wiesen die Erträge nur in den zwei Frühlingsbearbeitungsparzellen (Pflügen und Scheibeneggen) niedrigere Werte als beiDirektsaat auE Bei diesen Varianten wurden jedes Jahr niedrigere Ertragsergebnisse festgestellt, als in den Fräsvarianten, Die Erträge der Direktsaat erreichten unter günstigenBoden- und Nährstoffbedingungen das Niveau der Früh
lingsbearbeitung.Die Erträge der zweiten Untersuchungsperiode (Tab. 3)
wurden durch zwei trockene Jahre, eine ungünstige Niederschlagsverteilung, sowie das Auftreten eines Verdichtungshorizontes unterhalb von 20-22 cm Bodentiefe begrenzt. Die Maiserträge erreichten ein wesentlich geringeres Niveau, als unter den gegebenen Standortverhältnissen
Tabelle 2: Einflußder Bodenbearbeitung und der Düngung auf den Ertrag von Mais (Gödöllö 1977-1981)Table2: Effectofsoil tillageand fertilization on maize yields (Gödöllö, 1977-1981)
Bodenbearbeitung Düngung Ertrag t·ha-1
1977 1978 1979 1980 1981 Mittel
Direktsaat CD) Ungedüngt 6.21 6.45 6.86 3.74 3.08 5.27180 kg NPKJha 6.48 7.56 7.53 4.48 5.25 6.27360 kg NPKJha 7.21 8.01 8.11 5.18 6.27 6.96540 kg NPKlha 7.74 8.41 8.39 5.74 5.86 7.22Mittel 7.00 7.61 7.72 4.79 5.12 6.43
Fräsen in Streifen Ungedüngt 6.07 6.72 6.89 4.11 3.46 5.45CF-lOS) 180 kg NPKlha 6.71 6.98 7.44 4.74 6.06 6.39
360 kg NPK/ha 7.35 7.26 8.37 5.17 6.37 6.90540 kg NPK/ha 7.76 7.65 8.94 5.79 6.20 7.27Mittel 6.97 7.15 7.91 4.95 5.52 6.50
Fräsen (F-lO) Ungedüngt 6.34 6.84 7.15 4.73 2.69 5.55180 kg NPKlha 6.94 7.52 7.85 5.40 5.18 6.58360 kg NPKlha 7.47 7.93 8.32 5.99 5.40 7.02540 kg NPK/ha 7.71 8.15 8.73 6.53 4.97 7.22Mittel 7.11 7.61 8.01 5.66 4.56 6.59
Scheibeneggen (S-16) Ungedüngt 6.31 6.33 6.07 4.13 3.21 5.21180 kg NPKlha 6.98 6.99 6.62 5.23 4.15 5.99360 kg NPKlha 7.25 7.62 6.97 5.68 5.10 6.52540 kg NPKlha 7.66 8.43 7.63 5.90 5.64 7.05Mittel 7.05 7.34 6.82 5.24 4.52 6.19
Frühlingspflügen Ungedüngt 6.17 6.87 6.37 3.32 4.33 5.41(S-22F) 180 kg NPKlha 6.77 7.35 7.04 4.32 5.54 6.20
360 kg NPKlha 6.90 7.82 8.21 4.89 5.37 6.64540 kg NPK/ha 7.43 8.31 9.11 5.75 6.30 7.38Mittel 6.82 7.59 7.69 4.57 5.38 6.41
Herbstpflügen Ungedüngt 7.25 7.33 7.14 5.34 4.55 6.32(P-30H) 180 kgNPK/ha 7.79 7.97 8.10 6.21 5.71 7.16
360 kg NPK./ha 8.28 8.66 9.36 6.64 6.07 7.80540 kg NPK./ha 8.73 9.27 10.59 7.19 7.14 8.58Mittel 8.01 8.31 8.80 6.35 5.87 7.47
GDS% Bodenbearb. 0.11 0.22 0.23 0.16 0.36 0.45Düngung 0.21 0.13 0.13 0.14 0.19 0.55BxD ns 0.31 0.29 0.29 0.55 0.44
ns nicht signifikant
Die Bodenkultur 30 51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
Tabelle 3: Einfluß der Bodenbearbeitung und der Düngung auf den Ertrag von Mais (Gödöllö 1992-1996)Table 3: Effect ofsoll tillage and fertilization on maize yield (Gödöllö 1992-1996)
Bodenbearbeitung Düngung Ertrag t·ha" Mittel
1992 1993 1994 1996Direktsaat(D) Ungedüngt 1.24 0.50 0.78 1.97 1.12
200 kg NPKlha 1.65 0.67 1.68 2.41 1.60400 kg NPK/ha 1.74 0.54 3.11 3.83 2.31Mittel 1.54 0.57 1.86 2.74 1.68
Scheibeneggen(8-20) Ungedüngt 2.11 1.15 0.72 2.16 1.54200 kg NPKJha 2.76 1.29 1.51 3.02 2.15400 kg NPKlha 2.81 1.51 2.70 4.10 2.78Mittel 2.56 1.32 1.64 3.09 2.15
Pflügen(P-25H) Ungedüngt 2.19 1.73 1.85 4.16 2.48200 kg NPKJha 3.08 2.25 3.68 4.80 3.45400 kg NPK/ha 3.53 2.66 4.21 5.71 4.03Mittel 2.93 2.21 3.25 4.89 3.32
Orubbem+ Ungedüngt 2.35 2.29 1.86 4.10 2.65Scheibeneggen(G+S) 200 kg NPKlha 3.27 2.74 2.26 4.99 3.32
400 kg NPKJha 3.66 3.21 2.40 5.70 3.74Mittel 3.09 2.75 2.17 4.93 3.24
Grubbern- Ungedüngt 2.36 3.05 1.95 3.55 2.73Pflügen (G+P) 200 kg NPKlha 3.58 3.72 2.26 5.32 3.72
400 kg NPKJha 4.22 4.05 2.35 5.74 4.09Mittel 3.39 3.60 2•.18 4.87 3.51
OD5% Bodenbearb. 0.27 0.13 0.16 0.52 0.79Düngung 0.10 0.11 0.16 0.29 0.36BxD 0.32 0.19 0.24 ns ns
ns = nicht signifikant
31
zu erwarten wäre. Aufgrund der Ergebnisse der Varianzanalyse sind in den ersten drei Jahren die Faktoren der Boden
bearbeitung und Mineraldüngung signifikant. Im sechstenProduktionsjahr, sowie im Durchschnitt der vier Maisanbaujahre war zwar der Effekt heider Faktoren signifikant,aber ihre Auswirkung nicht. Die Reihenfolge der Erträgenach Bearbeitungsvarianten war die Folgende: Grubbern +
Pflügen > Grubbern + Scheibeneggen > Pflügen > Schei
beneggen > Direktsaat.Eine wichtige Folgerung der zweiten Untersuchungsperi
ode ist, daß sich unter ungünstigen Standortverhältnissensowohl die Direktsaat als auch die flache Scheibeneggenbearbeitung als riskante Methoden darstellen. Die Grubberbearbeitung ist als Verfahren, das die unerwünschtenBedingungen mindern kann, zu beurteilen. Die Bearbei
tungsverfahren können durch die Ertragswirkung der Düngung bewertet werden. Die größten Unterschiede zeigtensich in den Ertragsmengen zwischen ungedüngten und mitNährstoffen bedarfsgerecht versorgten Direktsaatparzellen(206 %). Dies bestätigt erneut den ertragsminderndenEffekt der Maisproduktion durch Weglassen von Düngungund jeglicher Bearbeitung. Es kann aufgrund der Ergebnisse festgestellt werden, daß mit Pflug- oder Grubberbearbei-
Die Bodenkultur
tung ohne zusätzliche Düngung in extrem dürren Jahrenkeine standortgerechten Ertragsmengen erreicht werden
können.
4. Diskussion
Die Bedürfnisse des Maises hinsichtlich des Bodenzustandesmüssen in jedem Fall restlos gesichert werden, insofern diedazu benötigenden Bearbeitungsverfahren keine Schäden fürdie Umwelt verursachen (BIRKAs, 1987; NAGY) 1996). Vondieser Überlegung ausgehend können die Bodenbearbeitungssysteme von Mais geordnet werden. In größtem Maßebeeinflußen Tiefe und Art der Verfahren bzw, das Weglassender Grundbodenbearbeitung den Schutz des Bodens (SIPOS,
1978; MENYH:ERT, 1985). Die tiefe Grundbodenbearbeitung- tiefere Lockerung und Pflügen - wirkt sich durch die Verbesserung der Unterkrume indirekt vorteilhaft aufden Ertragvon Mais aus (SIPOS, 1978; KIsMANYoKY und BALAzs, 1996;NAGY, 1996). Dieser letzteren Behauptung widerspricht
aber, daß erwünschte Ertragsmengen und Bodenschutzwirkungen auch durch Flachbearbeitung und Direktsaaterreicht werden können. Als grundsätzliche Bedingung für
51 (1) 2000
M. Birkäs und es. Gyuricza
32
eine bodenschonende Bearbeitung wird von amerikanischenAutoren (SCHERTZ, 1988; CARTER und KUNELIUS, 1990;BARTON und FARMER, 1997; SALINAS-GARCIA et al., 1997)das Belassen der Ernterückstände an oder nahe der Oberfläche genannt, wobei der Boden vor der Saat mindestens30 % mit Ernterückständen bedeckt sein sollte. Unter unseren Versuchsverhältnissen ist es notwendig, den Bodenschutzund die Melioration der Unterkrume mit dem Anbau vonPflanzen zu verbinden, welche aufdie tiefere Bearbeitung miteiner Ertragssteigerung reagieren (SIPOS, 1978; NAGY, 1996).Die mindestens 40-45 cm tiefe Lockerung mit dem Grubber trägt auf dem angeführten Standort zur Steigerung derErtragsmenge um 6-30 % durch die begünstigte Wasserwirtschaft und die veränderten physikalischen sowie biologischen Bodeneigenschaften bei. Die Grubberbearbeitung istnicht nur unter den ökologischen Verhältnissen des Versuchesvon großer Bedeutung, sondern aufallen Bodenarten impannonischen Produktionsgebiet (SIPOS, 1978; BIRKAs,1987; KIsMANYOKYund BAIAzs, 1996; NAGY, 1996).
Das 22-25 cm tiefe Pflügen kann im Bearbeitungssystemdes Maises als konventionell betrachtet werden, seine Vorteile sind schon auf den meisten Bodenarten bestätigt worden (SIPOS, 1978; GYÖRFFY, 1990; FENYVES, 1996; NAGY,1996). Eine kritische Betrachtung der wendenden Bearbeitung mit Pflug wurde mit Entwicklung der energiesparenden Methoden, ferner durch Erkennung der Schadwirkungen der Pflugsohlen verstärkt (CANARACHE, 1991; SCHERTZ,1988; OUWERKERKundSoANE, 1994). In unserem Versuchkonnte die Verdichtung schon im zweiten Vegetationsjahrbewiesen werden, die in trockenen Jahren den Ertrag negativ beeinflußt hat (BIRKAs, 1987; FENYVES, 1996).
Die flache Grundbodenbearbeitung mit Scheibeneggewurde bisher in erster Linie aus ökonomischen Überlegungen vor dem Mais eingesetzt. Der Ertrag wird durch flacheHerbstbearbeitung bis zu 40 % vermindert. Eine Ertragsminderung konnte nicht festgestellt werden, wenn derZustand der Unterkrume günstig war. Die Verwendung derScheibenegge für die Grundbodenbearbeitung ermöglichtein unserem Versuch die Untersuchung und Bestätigung derSchadwirkungen der Verdichtung in der Oberkrume introckenen Vegetationsperioden.
Die Direktsaat hat sich in Ungarn in der landwirtschaftlichen Praxis auch nach 35 Jahren nicht etabliert, aber inBodenbearbeitungsversuchen ist sie eine allgemein verwendeteVariante, da der ungestörte Bodenzustand. die Verunkrautung, die Düngungseffekte und die Pflanzenschutzprobleme durch ihren Einsatz relativ einfach zu untersuchen sind. Der Zeitraum des kontinuierlichen Einsatzes
Die Bodenkultur
von Direktsaat wird von mehreren Autoren in Abhängigkeit des Standortes mit 2-10 Jahren angegeben (LI1TLE,1992; BIRKAs, 1995a; KAPUSTA et al., 1996). Es ist eine
generelle Erfahrung, die auch in unserem Versuch bestätigtworden ist, daß die Bodenverdichtung ab dem drittenAnbaujahr ein die Produktion begrenzender Faktor wird.Zugleich sind die ersten zwei Jahre wegen der größeren Verunkrautung ungünstig, welche sich in dritten und viertenJahren verminderte, aber dann wieder zunahm. Auch dieUnkrautzusammensetzung wird durch die Bodenverdichtung beeinflußt: die Bedeckung durch charakteristische
Unkräuter bei ungestörtem Bodenzustand ist ab dem dritten bzw. vierten Vegetationsjahr signifikant höher als dieBedeckung mit für einen Maisstandort typischen Unkräutern (YOUNG, 1982; RADICS, 1989; FENYVES, 1996).
Es kann auch ein Zusammenhang zwischen dem Bodenzustand und der Düngung festgestellt werden. Aus dieser
Sicht wird der Ertrag durch die tiefere oder wendende Bearbeitung auch bei niedrigerer Nährstoffausbringung gesteigert (GYÖRFFY, 1990; K!sMANYOKY und BALAzs, 1996).Der Maisertrag wurde durch die flache Bearbeitung undDirektsaat auf allen Düngungsniveaus vermindert. Gleichzeitig konnte bewiesen werden, daß 70-80 % des Ertragsoptimums der Grubber- und Pflugbearbeitung bei bedarfsgerechter Nährstoffversorgung zu erreichen sind.
DerVerzicht aufBearbeitung und Düngung sowie die flache Bearbeitung ohne Mineraldüngung gelten als die Verunkrautung steigernde Faktoren, deren Wirkung durcheinen Mais-Winterweizen-Fruchtwechsel vermindert wer
den kann. Der unkrautmindernde Effekt der Kulturpflanze wird durch das bedarfsgerechte Nährstoffniveau in
Zusammenhang mit der Bestandesdichte von Mais positivbeeinflußt. Die Zahl der mehrjährigen Unkrautarten wurdedurch die regelmäßig durchgeführte Lockerung mit Grubber zurückgedrängt. Gleiches gilt für das Pflügen kombiniert mit Grubberbearbeitung. Es besteht gemäß der Literatur ein starker Zusammenhang zwischen dem Verzichtauf die Bearbeitung, der Verminderung der Bearbeitungstiefe und der Verbreitung der einkeimblättrigen Unkräuter(BARANYAI, 1986; FENYVES, 1996). Der Körnermais-Winterweizen-Fruchtwechsel ermöglichte in unserem Versuchdie Verhinderung der Verbreitung von einkeimblättrigenUnkrautarten. Die dominierenden Unkräuter von Maisgehören zu den wärmebedürftigen, einjährigen Arten undihr Anteil an der Gesamtverunkrautung kann 70 % erreichen.
Die Verbreitung der Direktsaat wird im pannonischenProduktionsgebiet Ungarns in der Praxis größtenteils durch
51 (1) 2000
Direktsaat-Dauerversuchsergebnisse mit Körnermais im pannonischen Produktionsgebiet Ungarns
33
die Ertragsminderung verhindert, die im Vergleich zur
Pflugbearbeitung um 5-49 %, zur Flachbearbeitung mit
Scheibenegge um 0-28 % betragen kann (SIPOS, 1978;
GYÖRFFY, 1990; KIsMANYoKY und BAlAzs, 1996; NAGY,
1996). Die Ertragsminderung wird durch Bodenverdich
tung, den Mangel an Nährstoffen, Monokultur und Ver
unkrautung verursacht (BIRKAs, 1995b; FENYVES, 1996).
Die Bodensehutzwirkung der Direktsaat wurde in erster
Linie für hängige und erosionsgefährdete Flächen bewiesen,
es ist aber nicht empfehlenswert diese aufdemselben Stan
dort über 3-5 Jahre hinaus einzusetzen (WINICNER, 1989;
KAPUSTA et al., 1996).
Literatur
ALLEN, R. R. and G. R. FENSTER (1986): Stubble-mulch
equipment for soil and water conservation in the Great
Plains. Soil and Water Conservation 41 (1), 11-16.
BALL,B. C. (1994): Experience with minimum and zero til
lage in Scotland. EC Workshop - I - Experience with theapplicability of no-tillage erop production in the West
European countries. Giessen, 27-28 june, 1994. Proc.
15-24.BARANYAI, F. (1986): Büzatermesztes-talajmüveles nelkül,
Növenyvedelem.Zz (2), 75-79.
BARTON, D. R. and M. E. FARMER (1997): The effect of
conservation tillage practices on benthic invertebrate
cornmunities. Can. Env. Poll, 96 (2),207-215.
BIRKAS, M. (1987): A talajmüveles minöseget befolyäsolöagron6miai tenyezök vizsgälata, Kandidätusi ertekezes,
Gödöllö.
BIRKAS, M. (1993): 1994: Siker es ketely utjan. A müveles
nelküli (direkt) vetes. I. Agrof6rum 4 (9), 5-6, 11. 5 (2),19-20.
BIRKAS, M. (1995a): A rnüveles nelküli direkrvetes alkalmazhatösäga, elönyei es korlätai. In: BIRKAs M. Energia
takarekos, talajvedö es kfmelö talajmüveles, GATE KTI,
Gödöllö. 111-125.
BIRKAs, M. (1995b): Talajmüvelesi kiserletek eredmenyei.
Elöadasok KSZE Rt. Kukorica bemutatökon, szept. 6., 7.
Gödöllö, kezirat,
CANARACHE, A. (1991): Factors and indices regarding
excessive compactness ofagricultural soils, Soil Till. Res.19, 145-164.
CANNELL, R Q (1985): Reduced tillage in North-West
Europe - A review. SoilTillage Res. 5, 129-177.
CARTER, M. R and H, T KUNELIUS (1990):Adaptingcon-
Die Bodenkultur
servation tillage in cool, humid regions. Soil and Water
Cons. 45 (4), 454-456.CHRISTENSEN, L. A. and R. S. MAGLEBY (1983): Conserva
tion tillage use. J. of Soil and Water Conserv, 38 (3),
156-157.DEMO, M. und B. KOLlAR (1992): Vplyv dlhodobeho
minimalneho obränia pody na ürody pestovanych plodin
v podmienkach juhozäpadneho Slovenska.. In: Zbornik z
vedeckej konferencie. Nitra, 1992. 82-90.
DVORACSEK, M. (1968): Penetrometer a talaj mechanikai
ellenälläsänak szabadföldi meresehez. Agrokemia es Tala
jtan, 17 (3), 319-324.ERDEI,E (1971 a): A kukorica es egyeb elöveternenyek utani
direkrvetes, In: A gabonatermesztesi es nemesitesi kutatäs
eredmenyei es a gyakorlat. Mezögazdasagi Kiad6, Buda
pest, 24-24.
ERDEI, E (1971b): A diquates paraquat gyomfrtoszerekkel
folytatott kiserletek összefoglalo ertekelese. Tanulmäny,OMFB, Budapest.
FENYVES, 1: (1996): A fenntarthat6 gazdälkodäs nehäny
agron6miai feltetele, különös tekintettel a müveles hatäsra,a gyomossägra, es a tragyazasra. Ph, D. ertekezes, Gödöllö,
FORTUNE, T. (1994): Direct drilling and reduced cultivati
on in Ireland. EC Workshop-I. Giessen, 27-28 june,
1994. Proc. 33-38.
FRYE, 'W \Xi: and C. 'W LINDWALL (1986): Zero-tillage rese
arch priorities. Soil Tillage Res. 8, 311-316.GYÖRFFY, B. (1964): Hozzäszöläs "A talaj melymüvelese"
vitaülesen, MTA Agrärtud. Oszt. Közl. 13 (3-4),
362-370.GYÖRFFY, B. (1990): Tartamkiserletek Martonväsäron, In:
Martonväsär mäsodik hüsz eve (Szerk. Koväcs I.) Martonväsär, 114-118.
GYÖRFFY, B. und ]. L. SZABÖ (1969a): Azero, minimum es
normal tillage vizsgälata tartamkiserletekben. In. Kukori
catermesztesi kiserletek 1965-1968. (Szerk. I's6 I.) Akademiai Kiad6, Budapest, 143-155.
GYÖRFFY, B.und]. L.SZABÖ (1969b):Tavaszi szäntäs, mini
mum tillage es a direkrvetes lehetösege a kukoricatermesz
tesben. In. Kukoricarermesztesi kiserletek 1965-1968.(Szerk. Tsö I.) Akademiai Kiadö,Budapest, 136-142.
GYÖRFFY, B. undJ. L. SZABÖ (1979): A talajmüveles optima
lis melysege es a no tillage vizsgälata kukorica monokul
niräban, Kukoricatermeszresi Kiserletek, 1968-1974
(Szerk. Bajai J.) Akademia Kiadö, Budapest 189-206.
KAPoszTA, ]. (1973): A talajm üveles csökkentesi lehetösegecsernozjom talajon öszi büza es kukorica termesztese
eseten, Jubileumi Tud. Ülesszak Kiadv. Kareag, 67-74.
51 (1) 2000
M. Birkäs und es. Gyuricza
KAPUSTA, G., R. ZELlON and P HAVRONIN (1996): Cornyield is equal conventional, reduced and no tillage after20 years. AgronJ. 88 (5), 812-817.
KIsMANYOKY,1: und J. BAIAzs (1996): Keszthely rartarn
kiserletek. ATE Keszthely;.KOCSIS, I. und S. DARÖCZI (1995): Uj fejlesztesi ered
menyek az elektronikus talajvizsgaI6 nyomöszondäval,DATE Föisk. Kar. Szarvas, Kezirat,
KOLTAY, A. (1971): Kiserletek az öszi büza es a tavasziarpatalajmüveles nelküli (direkt) vetesevel. In: Büzatermeszte
si kiserletek 1960-1970. (Szerk, Bajai J.) AkademiaiKiadö, Budapest, 459-463.
KOLTAY, A. (1974): Talajmüveles nelküli biizatermesztesmonokulniräban Talajtermekenyseg, 5: 11-17.
KOLTAY, A. (1975): Az öszi büza direkt vetese (talajmüvelesnelküli termesztese) In: Büzatermesztes es nemesftes(Koltay A.-Balla L.) Mezögazdasägi Kiad6, Budapest,76-81.
KONSTANTINOVIC, J. (1982): Uporedno ispitivanjeklasicne iminimalne obrade i diretkne setve bez obrade fizicke osobine zemljista, razvoj i prinos ozime psenice i kukuriza udvopolju. Savremena Poljopriveda, Novi Sad, 1-2, 6-79.
KovAc, K. (1991): The effect of conventional and minimum tillage on physical properties of soil and on winterwheat grain yield. Vedecke präce; ~U.R.~ Piestanoch,116-127.
KovATS, A. (1974): Talajmüvelesi kiserletek kukoricamonokultüräban, Talajtermekenyseg, 5, 1-9.
LAcKo-BARTOsovA, M. (1990): The ehanges in the physical properties of soil as a result of cultivation in winterwheat growing. Rosdinna Vyroba, 36 (2), 131-138.
LITILE, D. L. (1992): Tillage tilrs toward conservation,Farm Chemieals, 155 (2), 16-18.
MENYHERT, Z. (1985): A kukoricatermesztes kezikönyve,Mezögazdasägi Kiad6, Budapest.
MORGUN,F. T., N. K. SIKUIA and V.MALJUK (1983): Poesvozascsitnoe zemledebie. Urozsaj, Kiev.
NAGY, J. (1996): A müträgyäzäs es a talajmüveles kölcsönhatäsa a kukoricatermesztesben. Növenytermeles, 45 (3),
297-305.OUWERKERK, C. and F. R. vAN-BoONE (1970): Soil physi
cal aspects of zero-tillage experiments. Neth. J. Agr. Sei.18, 247-261.
OUWERKERK VAN, C. and B. D.SOANE (1994): Soil compactionproblemsin worldAgriculture In: SOANE B. D.,OUWERKERK, C. VAN (Ed.): Soil compaction in crop production. Elsevier Science B.Y: Amsterdam, 1-21.
PIlAT, A. and M. LAcKo-BARTOsovA (1990): The influence ofthe date and depth ofsoil tillage on variations ofsoilmoisture contents in winter wheat stands, Rosdinna
Vyroba, 36 (6), 561-572.PUSZTAI, A. und B. Kszo (1968): Üj m6dszer a lejtös
rerületek talajvedelmere. MTA Agr. Tud. Oszt, Közl. 15,
1-12.RADICS, L. (1989): Agroäko16giai tenyezök hatäsa a
szantöföldi gyomnövenyzetre, Kandidärusi ertekezes,Gödöllö,
SALINAS-GARCIA,]. R., G. B. DERMIN and D. REDWARDS
(1997): Leng-term effects of tillage and fertilization onsoil organic matter dynamics. Soil Sei. SOCa Am. 61 (1),
152-159.SCHERTZ, D. L. (1988): Conservation tillage: An analysis
for aereage projections in the United Stares, J. Soil andWater Conservation, 43 (3),256-260.
SIPOS, S. (1972): A talajmüveles csökkentesi lehetösegeinekes a trägyäzäs harekonysägänak vizsgälata tartamkiserletekben. Növenytermeles L 21 (4), 349-360, 11. 22 (1),
45-60.SIPOS, S. (1973): Talajmüvelesi kutatäsok tanulmänyozäsa
1972 evben Angliäban. Utijelentes, kezirat, Kareag.SIPOS, S. (1978): Talajmüveles. In: Földmüvelestan (szerk.
Lörinez J.) Mezögazdasägi Kiad6, Budapest, 156-266.SVAB, J. (1981): Biometriai m6dszerek a kutatäsban, Mezö
gazdasägi Kiadö, Budapest.UJVAROSI, M. (1973): Gyomnövenyek, Mezögazdasägi
Kiadö, Budapest, 832.WINKNER, I. (1989): Discuss. J. Soil and Water Cons.
March-April, 117-120.YOUNG, H. M. (1982): No-tillage farming. No-Till Farmer,
Inc. Brookfield, Wisconsin.
Anschrift der Verfasser
Univ.-Prof Dipl.-Ing. Dr. Marta Birkäs, Dipl.-Ing. CsabaGyuricza, Agraruniversität Gödöllö, Institut für Pflanzenproduktion, Pater K üt 1, H-2103 Gödöllö;e-mail: [email protected]
Eingelangt am 30. September 1999Angenommen am 28. Dezember 1999
Die Bodenkultur 34 51 (1) 2000