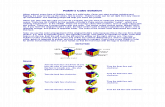diephilosophiein00vaih_bw
description
Transcript of diephilosophiein00vaih_bw
-
"vj
^' CNJ
31TY
()F
006
z CD
00
Vainger, HansDie Philosophie in der
Staatsprfung
.
BHZ
-
Die Philosophie in
der Staatsprfung.
Winke fr Examinatoren undExaminanden. Zugleich einBeitrag zur Frage der philos.Propaedeutik. Nebst 340 The-maten zu Prfungsarbeiten.
Von H. Vaihingen ^^
Berlin, 1906 ^i^t^it^ij^i^i^iVerlag von Reuther & Reichard.
-
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding fromUniversity of Toronto
http://www.archive.org/details/diephilosophieinOOvaih
-
Die Philosophie in
der Staatsprfung.
Winke fr Examinatoren undExaminanden. Zugleich einBeitrag zur Frage der philos.
Propaedeutik. Nebst 340 The-maten zu Prfungsarbeiten.
Von H. Vaihingen >^^^^/zJf^^l
Berlin, 1906 ^^^j^i^^^^it^i^iVerlag von Reuther & Reichard.
-
LAlle Rechte vorbehajten.
73333
UMIVERSITYJFJHHO.
Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner) in Gttingen.
-
Inhalt.Seite
Persnliches zur Einfhrung 1
Erster Teil
Prinzipielle Begrndung.
Die gesetzlichen Bestimmungen 5
Erluterungen :
1) Die Philosophie im Verhltnis zu den brigen Ge-bieten der Allgemeinen Bildung 6
2) Die Philosophie in ihrem Verhltnis speziell zur Pdagogik 8
3) Der Wer^ der philosophischen Allgemeinbildung fr den
Lehrer an hheren Schulen 13
4) Feststellung der philosophischen Allgemeinbildung, spe-
ziell durch eine schriftliche Arbeit 22
5) Die individuelle Wahl des Themas zur schriftlichen Ar-beit (nebst einleitenden Bemerkungen ber die Indivi-dualisierung der Prfungen berhaupt) 28
das Prinzip der Aktualitt 36
das Prinzip der Konzentration 38
das Prinzip der Individualisierung 46
6) Die mndliche Prfung 51
Vorschlag zur Trennung des mndlichen Examens ber-haupt in zwei zeitlich geschiedene Hlften .... 55
das Prinzip der Individualisierung 59
das Prinzip der Konzentration 60
Anknpfungspunkte fr die mndliche philosophische Pr-fung in den Spezialfchern 61
im Deutschen 63
-
VI Inhalt.
Seite
im Franzsisciien 66
im Englischen 68
in den klassischen Sprachen 70
im Hebrischen 74
in der Geschichte 74
in der Erdkunde 76
in der Physik 77
in der Chemie 78
in der Botanik und Zoologie 82
in der Mathematik 90
in der Religion 96
Schlubemerkungen zur Examenstechnik 103
das Prinzip der Kontinuitt nebst Beispielen .... 114
7) Die Prfung fr die philosophische Propdeutik . . . 120
die gesetzlichen Bestimmungen 121
Anforderungen an die schriftliche Arbeit 121
die mndliche Prfung 127
8) Der Unterricht in der philosophischen Propdeutik . . 130
Kritik des bisherigen Verfahrens 131
Nicht besonderer Unterricht in Logik, sondern gelegent-liche Heraushebung der immanenten logischen Elementein den einzelnen Unterrichtsfchern (Logik nicht alsUnterrichtsfach, sondern als Unterrichts p ri n zip) . 133
Schilderung dieses okkasionalistischen Verfahrens imGegensatz zum systematischen 135
Das Herauswachsen der Philosophie aus den Spezial-wissenschaften in der Gegenwart 140
Diese Tendenz wird auch den Lehrer dazu fhren, diein seinen Unterrichtsfchern enthaltenen philosophischen
Elemente okkasionalistisch herauszuheben .... 145Diesem Zwecke dient schon die philosophische Allge-meinbildung des Lehrers 148
Die Spezialprfung fr philosophische Propdeutik be-rechtigt zu einem fakultativen philosophischen Unter-richt in einer Selekta 150
-
Inhalt. VII
Seite
Zweiter Teil
Systematische Zusammenstellung der Themata.
Vorbemerkungen 155
I. Allgemeine Themata No. 136 161
Anhang: Psychologische Themata No. 3743 .... 164
II. Themata fr klassische Philologen No. 44103 . . 164
Erster Anhang: Vergleichungen antiker und modemerPhilosophen No. 104-111 169
Zweiter Anhang: Kombinationen mit andern FchernNo. 112-117 170
III. Themata fr Romanisten No. 118138 170
IV. Themata fr Anglizisten No. 139-173 172
V. Themata fr Lehrer der deutschen Sprache No. 174183 . 175
Anhang zu II V. Sprachwissenschaft No. 184188 . . 176
VI. Allgemeine Themata fr Naturwissenschaft. No. 189199 . 176
VII. Themata fr Mathematiker No. 200216 177
VIII. Themata fr Physiker und Chemiker No. 217232 . . 178
IX. Themata fr Botaniker und Zoologen No. 233246 . . 180
X. Themata fr Geographen No. 247248 181
XI. Themata fr Historiker No. 249262 181
XII. Themata fr Religionslehrer No. 263272 183
XIII. Pdagogische Themata No. 273-316 184
A) Allgemeine pdagogische Themata No. 273286 . . 184
B) Bercksichtigung der speziellen Fcher Nc. 287316 . 185
Nachtrag. Themata aus dem Wintersemester 1905/6 No.317340 186
Epilog: Der Breslauer Antrag 191
-
Persnliches zur Einfhrung.
Der verehrte und verdiente Mann, zu dessen 70. Ge-burtstag 13. Dezember 1905 diese Bltter erschei-nen, ist seit 30 Jahren stndiges Mitglied und seit vielenJahren Direktor der Leipziger Prfungskommission fr Leh-rer an hheren Schulen. Wollte E r seine reichen Erfah-rungen auf diesem Gebiete der ffentlichkeit mitteilen,so wrde das einen erheblich hheren Wert haben, alsdasjenige, was ich selbst hierber zu sagen vermag. Auchmanchem anderen Kollegen steht in dieser Hinsicht rei-chere Erfahrung und ausgedehntere bung zu Gebot alsmir. Indessen kann auch ich selbst auf eine nicht unbe-trchtliche bungszeit in diesem Punkte zurckblicken.Vom Jahre 1884 bis jetzt, also in dem Zeitraum von 21Jahren, war ich immerhin whrend 16 Semestern Mitgliedder Kniglichen Wissenschaftlichen Prfungskommission,wie man sie hierzulande offiziell nennt. Ich habe vonAnfang an gerade dieser Seite des Amtes ganz beson-deres Interesse zugewendet, und am meisten interessiertemich wiederum bei dieser Ttigkeit die Stellung der The-mata zu den schriftlichen philosophischen Prfungsar-beiten.
Ich habe diese Themata, auf deren Formulierung ichviele Mhe verwendet habe, sorgfltig notiert, und mitden Jahren vermehrte sich die Sammlung in erfreulicherWeise. Gelegentliche Unterhaltungen mit Kollegen berVai hinger, Staatsprfung. \
-
Persnliches zur Einfhrung.
diesen Gegenstand zeigten mir, da die Wahl der zustellenden Prfungsthemata auch anderen eine wichtigeund interessante, aber nicht immer ganz leichte Sache er-schien, ber welche man sich wohl gelegentlich den Kopfzerbrechen konnte. Auch wurden mir Themata bekannt,deren Zweckmigkeit mir nicht unzweifelhaft war. Sokam mir der Gedanke, meine Sammlung zum Nutzen jn-gerer Kollegen gelegentlich zu verffentlichen. Auch frKandidaten selbst schien mir eine solche Publikation vonWert , um ihnen fr die Wahl ihrer eigenen ThemataMuster zu geben, nach deren Analogie sie sich selbstneue Themata aufstellen knnen. Endlich schien mirdiese Publikation auch nicht unzweckmig, um den Ver-handlungen ber die philosophische Vorbildung unsererhheren Lehrer einmal eine aktenmige Grundlage zugeben: denn die vorliegende Sammlung hat durchausaktenmigen Wert, da es lauter Themata sind, welcheim Laufe der letzten 20 Jahre bei Oberlehrerprfungenwirklich gestellt und wirklich bearbeitetworden sind. Es ist bekanntlich gelegentlich der man-nigfachen Debatten ber die Philosophische Pro-pdeutik an den hheren Schulen in den letzten Jahrenauch die Frage der philosophischen Allgemeinbildung derOberlehrer berhaupt errtert worden : die vorliegendeSammlung gibt somit fr diese Diskussionen eine bishernicht vorhandene neue positive Grundlage.
Der 7 0. Geburtstag von Max Heinze schienmir nun eben um deswillen eine geeignete Gelegenheit zurVerwirklichung jenes Gedankens der Publikation meinerThemata, als gerade Heinze selbst, wie gesagt, seit dreiJahrzehnten mitten in der Prfungsttigkeit darin stehtund neben seiner wissenschaftlichen Ttigkeit berhauptin dieser wie in so mancher anderen Hinsicht eine emi-nent praktische Wirksamkeit entfaltet. So kommt in dieserPublikation eine Seite unserer amtlichen Ttigkeit zurGeltung, welche bisher vielleicht nicht gengend gewr-
-
Persnliches zur Einfhrung.
digt worden ist, und welche doch, wie sie sehr mhsamist, so auch sehr segensreich sein kann, insbesonderewenn sie von einem nicht blo wissenschaftlich sondernauch didaktisch so geschulten und umsichtigen Mannewie dem Jubilar selbst ausgebt wird.
Die Publikation sollte ursprnglich einen Teil derFestschrift bilden, welche Professor Barth in Leipzig ver-anstaltet, zu der ich ja auch die Einladung mit WilhelmDilthey und Paul Barth gemeinsam unterzeichnet habe.Aber die Rcksicht auf den Raum und der Wunsch,meine Publikation durch eine Sonderausgabe auch wei-teren Kreisen zugnglich zu machen, fhrte zu der uer-lichen Herauslsung meiner nun in dieser Form vorlie-genden Publikation aus dem Ganzen jener Festschrift,der sie sachgem doch innerlich zugehrt.
Es schien mir nun aber zweckmig, die Publikationder Themata mit einigen erluternden Worten zu be-gleiten ; ich konnte so Gelegenheit finden, einerseits meinVerfahren im einzelnen zu schildern und ntigenfalls zurechtfertigen, anderseits die von mir gesammelten Er-fahrungen zu Vorschlgen und Ratschlgen zu verdichten.Erluterungen waren auch ntig, um denjenigen, welchedie preuischen Verhltnisse selbst nicht nher kennen,
aber doch ein Interesse daran haben, sie nher kennenzu Jemen , z. B. Auslndern , diese Verhltnisse zu er-klren ; denn gerade im Ausland , speziell in Frankreichverfolgt man unser hheres Schulwesen mit Aufmerk-samkeit. Auch mchte und knnte diese Schrift dazubeitragen, da in denjenigen Teilen des auerpreuischenDeutschland, in denen die Philosophie im Oberlehrer-examen bis jetzt vernachlssigt worden ist, speziell inBayern und Wrttemberg, die Philosophie knftig zuihrem Rechte kme.
So gibt nun der erste Teil eine ausfhrliche prinzi-
pielle Begrndung, die ich zugleich als einen Beitragzur Hochschulpdagogik bezeichnen kann denn,
1*
-
Persnliches zur Einfhrung.
darum eben handelt es sich, wie wir Universittsprofes-soren es anfangen sollen, um die Staatsprfung in Phi-
losophie fruchtbar und erfolgreich zu gestalten , um somehr , als die Beteiligung der Philosophie am Staats-examen fr Lehrer an hheren Schulen in alter und neuerZeit in hnlicher Weise angegriffen worden ist, wie dieBeteiligung der Philosophie am Doktorexamen; ein der-artiger Versuch, die Philosophie im Staatsexamen her-unterzudrcken, ist in jngster Zeit sogar von der phi-losophischen Fakultt einer preuischen Universitt ausge-gangen !
Die Frage der philosophischen Vorbildung der Ober-lehrer hngt nun aufs engste zusammen mit dem Pro-blem der philosophischen Propdeutik, das ja in letzterZeit wiederum so viel behandelt worden ist. Indem diefolgende Schrift auch dies Problem bespricht, ist sie zu-gleich ein Beitrag zu einem der wichtigsten Kapitel derOymnasialpdagogik.
-
Erster Teil.
Prinzipielle Begrndung.
Die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Preuische Prfungsordnung fr Lehrer an denhheren Schulen und ihr analog auch die Kgl. Sch-sische, die Elsa-Lothringische, die Badische u. a. ver-langt von jedem Bewerber den Nachweis hinreichenderphilosophischer Allgemeinbildung. So sehr die preui-schen Prfungsordnungen im Laufe des 10. Jahrhundertsin manchen anderen Punkten voneinander abweichen,so sind sie doch in der Forderung der philosophischenAllgemeinbildung im wesentlichen konstant geblieben.Ich fhre die Bestimmungen der jetzt geltenden Ord-nung der Prfung fr das Lehramt an hheren Schulenan. Sie stammt vom 12. Sept. 18Q8 (die beiden vorher-gehenden stammen vom 12. Dez. 1866 und vom 5. Fe-bruar 1887) und ist vom > Minister der geistlichen, Un-terrichts- und Medizinal-Angelegenheiten erlassen. Da-nach hat jeder Kandidat auer der Fachprfung noch eineAllgemeine Prfung abzulegen und zwar in P h i-losophie, Pdagogik, deutscher Literaturund Religion ( Q). Dementsprechend erhlt derKandidat auch zwei schriftliche Hausarbeiten ( 28, 1)
:
Zur huslichen Bearbeitung erhlt der Kandidat zweiAufgaben, die eine fr die Allgemeine Prfung aus deren
-
Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Gebieten, die andere fr die Fachprfung aus einem derFcher, in welchen er die Lehrbefhigung fr die ersteStufe nachweisen will. Wnsche des Kandidaten be-zglich der Auswahl der Aufgaben sind tunlichst zu be-rcksichtigen .
ber das Ma der in der Allgemeinen Prfung zustellenden Anforderungen bestimmt 10 folgendes:
Bei der Allgemeinen Prfung kommt es nicht aufdie Darlegung fachmnnischer Kenntnisse an, sondernauf den Nachweis der von Lehrern hherer Schulen zufordernden allgemeinen Bildung auf den betreffenden Ge-bieten . Demnach hat der Kandidat in der ihm nach 28, 1 obliegenden Hau sarbeit nicht blo ausrei-chendes Wissen und ein verstndnisvolles Urteil ber denbehandelten Gegenstand zu bekunden, sondern auch zuzeigen, da er einer sprach richtigen, logisch geordneten,klaren und hinlnglich gewandten Darstellung fhig ist.
Fr die mndliche Prfung ist zu fordern, dader Kandidat in der Philosophie mit den wichtigsten Tat-sachen ihrer Geschichte sowie mit den Hauptlehren derLogik und der Psychologie bekannt ist, auch eine be-deutendere philosophische Schrift mit Verstndnis ge-lesen hat.
Erluterungen.
1) Die Philosophie im Verhltnis zu denbrigen Gebieten der allgemeinen Bildung.
Zu diesen Prfungsbestimmungen finde ich einigekritische und erluternde Bemerkungen zweckmig.Nach den beiden frheren Prfungsreglements von 1866und 1887 war eine schriftliche Arbeit aus dem Gebietder Philosophie oder Pdagogik obligatorisch. Nachder jetzt gltigen Prfungsordnung von 1898 ist dage-gen dem Kandidaten die Wahl freigestellt, ob er eineschriftliche Arbeit aus dem Gebiet der Philosophie,
-
Philosophie als Hauptmittel der Allgemeinbildung.
Pdagogik , deutscher Literatur oder Religion nehmenwill. Man kann in dieser nderung eine verminderteSchtzung der Bedeutung der Philosophie und der mitihr ja zusammenhngenden Pdagogik finden; die Frei-gabe des Gebietes fr diejenige Arbeit , welche demNachweis der Allgemeinbildung dienen soll, ist offenbarder Meinung entsprungen, da auch die Beschftigungmit deutscher Literatur oder mit Religion der Allgemein-bildung diene und da manchen Kandidaten, denen phi-losophische Gedankengnge schwer fallen, die Gelegen-heit geboten werden solle, durch schriftliche Arbeiten ausder deutschen Literatur oder aus der Religion ihre Allge-meinbildung zu beweisen. Man kann ber die darin aus-gesprochene Gleichstellung der deutschen Literatur undder Religion mit der Philosophie und Pdagogik streiten.Wir sprechen aber hier nicht de lege ferenda son dernfflege lata , und konstatieren nur mit Interesse, da dieKandidaten selbst anderer Meinung sind als die Behrde,welche die Prfungsordnung erlassen hat : denn tatsch-lich wird wenigstens hier in Halle die allgemeineArbeit fast niemals aus den freigegebenen Gebieten derdeutschen Literatur oder der Religion gewhlt, son-dern fast immer aus dem Gebiet der Philosophie resp.Pdagogik. Man kann nicht annehmen , da hier blodie Macht der Tradition magebend sei: die jetzige Pr-fungsordnung gilt ja nun schon seit 7 Jahren
,und in
anderen Punkten fanden ja die Kandidaten sofort dieihnen gnstigeren Bedingungen heraus. Da nun trotz-dem von jener Mglichkeit wenig Gebrauch gemacht wird,ist ein sehr erfreulicher Beweis dafr, da die Kandi-daten selbst die Philosophie als das wichtigste Gebietfr ihre Allgemeinbildung erkennen. Man knnte daherfr jene nderung der Prfungsordnung von 1898 nach-trglich der Behrde dankbar sein : denn gegen derenAbsicht ist jene nderung zu einem sehr wertvollen Ex-periment geworden , wie weit Philosophie den jungen
-
8 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Leuten selbst am Herzen liege. Und die jungen Leuteselbst haben diese Probe bisher so gut bestanden, wiedie philosophischen Fcher selbst: jene haben aus freienStcken diese gewhlt, und diese haben also ihre An-ziehungskraft auch ohne gesetzliche Ntigung glnzendbewiesen. So steht also die Philosophie zwar nicht mehrde jure, wohl aber de facto im Zentrum der allgemeinenBildung, und ihre Bedeutung fr diese wird ja auchuerlich noch dadurch anerkannt , da sie in der Pr-fungsordnung immer noch prno loco aufgezhlt wird.
2) Die Philosophie in ihrem Verhltnisspeziell zur Pdagogik.
Whrend die jetzige Prfungsordnung von 18Q8 dieschriftliche Hausarbeit fr den Nachweis der Allgemein-bildung aus den 4 Gebieten der Philosophie, Pdagogik,deutschen Literatur oder Religion zult, war nach denfrheren Prfungsordnungen von 1866 und 1887 hierinneben der Philosophie nur noch die Pdagogik zugelassen.Aber diese steht zur Philosophie in einem ganz andernVerhltnis als jene beiden anderen Fcher: deutsche Lite-ratur und Religion. Diese Gebiete haben wohl Beziehungenzur Philosophie, aber doch nur gelegentliche. DagegenPdagogik hat zur Philosophie ein notwendiges und prin-zipielles Verhltnis. Mit Recht bezeichnet Herbart Psy-chologie und Ethik als Grundwissenschaften der Pda-gogik, und damit sind die Beziehungen der Pdagogikzur Philosophie nicht erschpft. Logik, Aesthetik undReligionsphilosophie und vor allem Geschichte der Phi-losophie bilden die prinzipiellen Grundlagen der wissen-schaftlichen Pdagogik. Es hat deshalb eine gewisseinnere Berechtigung, wenn an unseren Universitten diePdagogik als allgemeine Pdagogik als Teilzur Philosophie gerechnet wird. Da die Pdagogikdoch anderseits, nicht nur in unserer Prfungsordnung,sondern auch sonst vielfach in Praxis und Theorie von
-
Philosophie und Pdagogik.
der Philosophie unterschieden wird, hat freilich ebenfallsseine auf andern Grnden beruhende Berechtigung: eskommen bei der speziellen Pdagogik so viel anderenicht-philosophische Gesichtspunkte in Betracht, da diePdagogik eben als spezielle Pdagogik wiederanderseits aus dem Rahmen der Philosophie hinausfllt.Insofern wird eben mit Recht, wie es auch in der Pr-fungsordnung geschieht, die Pdagogik der Philosophienicht als Teil unterstellt, sondern als ein anderes Gebietgegenbergestellt.
Diese Doppelstellung der Pdagogik findet ja einmaldadurch ihren Ausdruck, da die Pdagogik an unsernUniversitten bald von den Dozenten der Philosophieselbst, bald von eigentlichen Fachmnnern vorgetragenwird mehrfach finden sich beide Mglichkeiten aneiner und derselben Universitt vertreten. Und zweitenskommt dasselbe Doppelverhltnis der Pdagogik zur Phi-losophie ihre Verbindung und ihre Trennung auchnoch in einem anderen Umstnde zum Ausdruck, deruns hier ganz besonders berhrt: die Prfung in derPdagogik wird bald mit der Prfung in der Philosophieverbunden, indem die Prfung in beiden Fchern vondem Vertreter der Philosophie vorgenommen wird, baldaber wird die Prfung in diesen beiden Gebieten ge-trennt: die Prfung in Pdagogik wird dann einem Pda-gogen bertragen, besonders wenn ein solcher zugleichDirektor der ganzen Prfungskommission ist.
Dieses letztere Verhltnis findet gegenwrtig in Hallestatt, woselbst der verdiente und weitbekannte Pdagogeund Schulmann Fries die Prfungskommission leitet undgleichzeichtig in Pdagogik prft. Frher war hierselbstdem Philosophen auch die Prfung in Pdagogik ber-tragen. So habe ich selbst jahrelang in Pdagogik ge-prft, und habe daher auch pdagogische Themata zuschriftlichen Hausarbeiten zu stellen Veranlassung gehabt.
Diese Pdagogischen Themata habe ich unter den
-
10 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
300 Philosophischen Themata mit aufgezhlt, nicht aus
dem usserlichen Grunde, weil nun einmal zeitweise diePrfung in Pdagogik mit der in Philosophie durch Per-
sonal-Union verbunden war, sondern mit Rcksicht auf
jene innere Verwandtschaft der allgemeinen Pdagogikmit der Philosophie. Die Themata, welche der Philosoph
aus dem Gebiete der Pdagogik gibt, werden naturgemsich mehr oder weniger auf die prinzipiellen Fragen be-ziehen, nicht auf dieses oder jenes Detail, dessen Kenntnisja auch dem Philosophen qua Philosophen fehlt. DieseBeschrnkung auf die prinzipiellen d. h. eben mehr philo-sophischen Grundlagen der Pdagogik macht sich ja auchschon mit Rcksicht auf die Kandidaten selbst notwendig:dieselben haben ja gewhnlich noch gar keine Gelegenheit,keine Veranlassung und auch noch gar keine Zeit gehabt,sich mit den Detailfragen der praktischen Methodik zu be-schftigen. Diese liegen ihnen noch ganz ferne ihreganze Vorbildung ist noch eine rein theoretische, auchin Bezug auf die Pdagogik selbst, in der sie ja nur mitden allgemeinen philosophischen Prinzipien des Unter-richts und der Erziehung bekannt gemacht worden sind,sowie mit deren historischer Entwicklung in der Ge-schichte der Pdagogik. So berhren sich denn auch dieihnen in der Staatsprfung gestellten Themata aufs engstemit den rein philosophischen, und dies ist auch dannnicht wesentlich anders, wenn die Prfung nicht mehrvom Philosophen, sondern von einem Pdagogen abge-nommen wird ^). Wird die Prfung vom Philosophen
1) Whrend der Ausarbeitung dieser Schrift ist eine Sammlungvon Themata fr Pdagogische Prfungsarbeiten unter dem letz-teren Titel seitens eines solchen pdagogischen Examinators er-schienen (in Ilberg's Jahrbchern fr Philologie und Pdagogik,1905, S. 497507). Verfasser ist der Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wil-helm Mnch in Berlin. Dieser verdiente Schulmann, der zugleichdie Pdagogik an der Universitt Berlin vertritt, hat 137 von ihmgestellte (resp. vorgeschlagene) Themata in jenem Aufsatz ber-
-
Pdagogik und Philosophie. 11
abgenommen, so wird er, wie ja schon oben bemerktwurde, naturgemss auch ein pdagogisches Thema sostellen, da prinzipielle und allgemeine Gesichtspunktezur Geltung kommen: er wird z. B. schwerlich das Themastellen: -Wie wurde der Rechenunterricht in Pestalozzi'sAnstalten erteilt?
,sondern hchstens: An welchem Zu-
sammenhang steht der Rechenunterricht bei Pestalozzimit dessen allgemeinen Anschauungen ber die Naturdes Menschen und die Aufgabe seiner Erziehung?
. DerPhilosoph wird nicht das Thema stellen: Wie wurdein Herbart's bungsschule in Knigsberg der Unterrichtin den klassischen Sprachen gegeben?
,sondern: >In
welchem Zusammenhang stehen Herbart's Anschauungenber den Unterricht in den klassischen Sprachen mit sei-nen allgemeinen philosophisch-pdagogischen Theorien?Und er wird den Hauptwert auf die klare und umsichtigeDarstellung dieser Prinzipien legen. Diese Prinzipiensind ja auch fr den Kandidaten selbst auf seiner jetzigenBildungsstufe die Hauptsache. Der Philosoph wird esdaher eher verzeihen, wenn nach klarer und umsichtigerEntwicklung der Prinzipien deren Anwendung auf dasbetr. spezielle Gebiet nur ganz kurz und ungengendbehandelt wird, als wenn das Umgekehrte der Fall ist.So sind denn im folgenden auch eine Reihe derartigerpdagogischer Themata mit aufgezhlt, bei denen es aberin dem angegebenen Sinne sich um die philosophischenPrinzipien gewisser pdagogischer Lehren und Methodenhandelt.
Aber auch wenn, wie gegenwrtig in Halle, die
sichtUch zusammengestellt. Bei der Stellung dieser Themata be-rcksichtigte Mnch ebenfalls sehr genau die Individualitt der Kan-didaten : er betont dieses Prinzip der Individualisierung, das ichim folgenden so energisch vertrete, mit Recht stark. Die Samm-lung ist sehr verdienstvoll und sehr lehrreich ; doch scheint mirein Teil der Themata zu sehr in das spezifisch-pdagogische Detailhineinzugehen.
-
12 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Pdagogik von der Philosophie getrennt ist, l
-
Wert der Philosophie fr den Pdagogen. 13
nannten Fllen, doch sua sponte darauf kommen, etwaam Schlu ihrer Arbeit pdagogische Konsequenzen ausderselben zu ziehen oder wenigstens anzudeuten. In derPhilosophie als solcher liegen ja auch so vielfach pda-gogische Gesichts- und Anknpfungspunkte, da einestrenge Trennung nicht durchfhrbar ist: es gengt, anPiaton, Aristoteles und die Stoa, an Kant, Herbart undSchleiermacher zu erinnern. Die ganze praktische Philo-sophie hat ja einen parnetischen Charakter, der vonselbst und ohne Zwang und Sprung in die Pdagogikhinberleitet. Und so sind denn auch im folgendenpdagogische Themata unbedenklich zur Philosophie mit-gezhlt worden.
3) Der Wert der philosophischen Allgemein-bildung fr den Lehrer an hheren Schulen.
Die pdagogischen Themata aber bilden doch immer-hin nur einen kleinen Prozentsatz der schriftlichen Haus-
arbeiten, sowohl unter dem jetzigen, als unter dem frherenRegime. Im allgemeinen wollen die Kandidaten selbstlieber philosophische Themata haben, im richtigen Ge-fhl oder auch in der richtigen Einsicht, da eine grnd-liche rein philosophische Bildung fr die ganze Entwick-lung ihres Geisteslebens von zentraler Bedeutung sei.Es ist ganz richtig, da der Staat von den knftigenLehrern an hheren Schulen eine solche philosophischeBildung verlangt. Da der Staat bei den Medizinern einesolche nicht fordert, ist natrlich; ob er nicht von Juristenwenigstens grndlichere Bekanntschaft mit der Psycho-logie und Logik verlangen sollte, sei dahingestellt; vonden Theologen wird mit Recht philosophische Allgemein-bildung verlangt, vielleicht wrde auch ein Plus hierinzweckmig sein. So viel von den drei oberen < Fakul-tten; die zuknftigen Lehrer an hheren Schulen gehrender philosophischen Fakultt zu. Nicht um dieses Namenswillen, sondern um der Sache willen wird nun von diesen
-
14 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
philosophische Allgemeinbildung verlangt, gewi sehrzu ihrem Nutzen. Die Angehrigen jener 3 anderen Fa-kultten haben es nachher im Leben mit der Praxis zutun: die Angehrigen der philosophischen Fakultt lehrenin ihrer Praxis immer wieder die Wissenschaften selbst;aus diesem Grunde wird ja wohl auch die Kommission,vor der sie ihre Prfung ablegen, xav ii,oxr]v die Wissen-schaftliche Prfungskommission genannt. Die Wissen-schaften, welche hier geprft werden, und in denen dieGeprften selbst nachher, wenn auch in einfacherer Weiselehrend auftreten, sind als Geistes- und als Naturwissen-schaften die reinen Wissenschaften, die zunchst um ihrer
selbst willen getrieben werden. Den Natur- und Geistes-wissenschaften steht aber als ihr gemeinschaftliches Prinzip
die allgemeine Prinzipienwissenschaft, die Philosophie,
gegenber. An allen Stellen drngen die Begriffe undAxiome der Einzelwissenschaften von selbst zur allge-meinen Prinzipien Wissenschaft hin: die Begriffe des Raumes,der Zeit, der Materie, der Bewegung, der Kausalitt,des Lebens, des Zweckes, des Handelns, der Sitte undder Gesittung, der geschichtlichen Entwicklung, des Wertes,
der Vernunft, der Sprache u. s. w. alle diese Begriffe,
auf welchen jene Einzelwissenschaften teils basieren oderauf welche sie hinfhren, erfordern eine prinzipielle undallgemeine Errterung und diese eben nennt sich Philo-sophie. Man kann eigentlich gar nicht die oft gehrteFrage aufwerfen: >Wie kommen wir als Spezialforscherdazu, uns noch mit Philosophie zu beschftigen ?
-
Wert der Philosophie fr hhere Lehrer. 15
In der Prfungsordnung wird die Philosophie alsein Fach neben die anderen Prfungsfcher gestellt. Undein solches offizielles und formelles Aktenstck hat jaauch zunchst keine Veranlassung, die in ihm aufge-stellten Forderungen erst langatmig und umstndlich zubegrnden, und z. B. zu sagen, warum denn berhauptdie Kandidaten in Philosophie geprft werden sollen.Gleichwohl htte doch vielleicht in irgend einer Wendungauf diesen Zusammenhang der SpezialWissenschaften mitder allgemeinen Prinzipienwissenschaft hingewiesen werdenknnen, auch aus einem Grunde, der noch nachher beider Errterung ber die individuelle Wahl des Themasder schriftlichen Hausarbeit zur Sprache kommt: danmlich dieses mglichst mit dem hauptschlichsten Spe-zialgebiet der Kandidaten in Zusammenhang stehen sollte.
Es wird vielleicht hierin auch manchmal von denVertretern der Philosophie selbst gefehlt: manche stellendie Philosophie gar zu sehr als ein Fach neben die an-deren Fcher, anstatt zu betonen, da die Philosophieals allgemeine Prinzipienwissenschaft Etwas ist, in dasalle Spezialfcher notwendig einmnden, wenn sie grnd-lich betrieben werden. Alle Wege fhren nach Rom,sagt ein bekanntes Sprichwort, und lgt damit, wie soviele Sprichwrter; wohl aber fhren alle Wege zur Philo-sophie, wenn man nicht auf ihnen stehen bleibt, sondernrastlos und mutig weitergeht.
Die prinzipielle Besinnung ber die Grundbegriffeund Grundprobleme der einzelnen SpezialWissenschaftenwird von selbst zur Philosophie, und wenn sie auchhufig zu unlsbaren Schwierigkeiten und unaufhellbarenDunkelheiten fhrt, so gewhrt doch solche Beschfti-gung mit den allgemeinen Prinzipienfragen anderseitseine ungemeine Bereicherung an Gesichtspunkten, eine
Ausfhrungen bei, welche P. Natorp vor kurzem in der Frank-furter Zeitung 1905, No. 24, 25 und 55 entwickelt hat.
-
16 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
wesentliche Erweiterung des Gesichtskreises, die Fhig-keit des Umschauens und Zusammenschauens {woQvnach Piaton) und nicht zuletzt auch eine geistige Er-quickung nach den oft so ermdenden, trockenen undeintrocknenden Spezialforschungen. In diesem Sinneist die vorgeschriebene Beschftigung der Kandidaten
mit Philosophie geradezu ein amtlich angeordnetes Schutz-
mittel, um die Geister derselben vor der Erdrckungdurch ihre Spezialfcher zu bewahren.
Dem Gesetzgeber mgen diese oder hnliche Er-wgungen vorgeschwebt haben. Doch wird meistensbeim Studium der Philosophie in erster Linie an ihre Ge-schichte gedacht. Und in der Tat hat das Studium derGeschichte der Philosophie, schon fr sich allein, schonohne die eben berhrte Aufgabe der systematischen Phi-losophie, seinen eigenen groen Wert. Was kann mehrden Geist befreien und erweitern, als die Kenntnis derallmhlichen Entwicklung des menschlichen Denkens berdie Welt? Wenn Philosophie die Orientierung ber dieWelt genannt worden ist, so ist Geschichte der Philo-sophie Orientierung ber die mglichen Weltanschauungenin ihrer notwendigen geschichtlichen Entfaltung. Manmu wissen , was die bedeutendsten Menschen ber dieWelt gedacht haben: man mu das wissen, weil es er-stens schon an sich das Interessanteste ist; aber manmu es auch zweitens wissen, um das eigene Nachdenkenber das Wesen der Welt und den Wert des mensch-lichen Lebens berhaupt erst fruchtbar gestalten zu knnen.
Die Kenntnis der Entwicklung der Weltanschauungenund ihrer verschiedenen Typen bewahrt davor, sich ein-seitig und sklavisch einer einzelnen gerade herrschendenRichtung hinzugeben ; sie befreit vom Aberglauben anFormeln und Dogmen , und befhigt den so geschultenGeist, ebensosehr sich einerseits von dem Zwang einerSchule fern zu halten, als auch anderseits, sich in fremdeMeinungen und Richtungen mit Toleranz hineinzudenken.
-
Nutzen der Philosophie fr hhere Lehrer. 17
Aber die Geschichte der Philosophie steht ja nunauch mit der allgemeinen Kuhurgeschichte und mit derGeschichte alier Einzelwissenschaften in innigstem Zu-sammenhange. Sowohl die Arbeit an der eigenen geistigenBildung, als die Arbeit an dem > Schlermaterial ander jungen Generation bringt den Lehrer an hherenSchulen berall, an allen Ecken und Enden, in die Lage,sein Fachwissen in jenen allgemeinen historischen Zu-sammenhang einzugliedern. Was auch der von Nietzschebetonte Nachteil der Historie* sein mag: ihr Nutzen istdoch unermelich viel grer: jedes einzelne Wissens-gebiet, jedes einzelne Lehrstck steht mehr oder weniger,mittelbar oder unmittelbar im engsten Zusammenhangmit dem geschichtlichen Werden der Wissenschaft, derPhilosophie, der Menschheit: wer nur in der Gegenwartlebt, lebt nur halb, ihm fehlt die Tiefendimension: dieVergangenheit, die Geschichte. Und alle Geschichte hatnur Sinn und Wert als Teil der allgemeinen Geschichteder menschlichen Kultur, und alle kulturgeschichtlicheEntwicklung hngt aufs engste zusammen mit den Mei-nungen der Menschen ber Welt und Leben. Die antikeKultur ist unverstndlich ohne Kenntnis des Sokrates,Piatons, Aristoteles, der Stoa, der Epikureer, der Skep-tiker. Die mittelalterliche Kultur ist unverstndlich ohnedie Kenntnis der Neuplatoniker und der Scholastik. Dieneuere Kultur ist ganz unverstndlich ohne die Kenntnisvon Cartesius, Locke, Spinoza, Leibniz und der von ihnenausgehenden > Aufklrung . Und das neunzehnte Jahr-hundert ist unverstndlich ohne Kenntnis von Kant,Fichte, Hegel, Schopenhauer.
Und auch die Geschichte der Einzelwissenschaftenist berall durchzogen von philosophischen Einflssen,Problemen, Irrtmern und Ideen. Man nehme die Ge-schichte der Mathematik oder der Mechanik, die Geschichteder Physik oder der Chemie, die Geschichte der Botanikoder der Zoologie man nehme die Geschichte derVaihinger, Staatsprfung- ^
-
18 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Grammatik oder der Sprachwissenschaft, kurzweg dieGeschichte der verschiedenen philologischen Disziplinen,man nehme die Geschichte der Geschichtswissenschaftund der Geschichtschreibung selbst berall stt manin der Entwicklung dieser Fcher auf philosophische Be-einflussung einerseits, auf philosophische Nachwirkungenanderseits. Man nehme z. B. die Geschichte der Geo-graphie: sie beginnt mit den Namen des Thaies undAnaximander, und sie mndet mit Herder und Kant indie Gegenwart. Man nehme die Geschichte der Gram-matik: sie verzeichnet die Wechselwirkungen zwischengriechischer Philosophie und griechischer Sprachwissen-schaft bei Aristoteles und bei den Stoikern ebenso gut,als die Beziehungen zur Hegeischen oder zur Wundt-schen Philosophie. Ich habe mich bei diesen Beispielennatrlich auf die Schulwissenschaften beschrnkt bei
den anderen Wissenschaften liegt ja die Sache ebenso.Sofern also der wissenschaftlich gebildete Lehrer die
Geschichte seiner eigenen Wissenschaft begreifen will,kann er dies nicht erreichen ohne philosophische Bildung,ebensowenig wie er seine Wissenschaft in ihrem syste-matischen Zusammenhang treiben kann, ohne berallauf philosophische Grund- und Grenzbegriffe und damitauf philosophische Probleme zu stoen.
Aber noch aus nherliegenden Grnden bedarf geradeder zuknftige Lehrer an hheren Schulen einer grnd-lichen philosophischen Vorbildung. Einmal aus demGrunde, den Schiller in die Worte kleidet:
Den schlechten Mann mu man verachten,Der nie bedacht, was er vollbringt.
Die ganze Ttigkeit des Lehrens, des Unterrichtens,des Erziehens, des Bildens wie soll sie geschehenohne pdagogische Selbstbesinnung? Darber ist ja jetztkein Zweifel mehr: noch vor 20 Jahren freilich herrschtein manchen Kreisen der Oberlehrer eine seltsame Ver-achtung der Pdagogik. Aber gerade von Halle aus, von
-
Notwendigkeit der Philosophie fr hhere Lehrer. 19
den Direktoren der Franckeschen Anstalten, Frick undFries ist jene pdagogische Selbstbesinnung mchtig ge-pflegt worden. Pdagogik aber beruht, wie ja allgemeinzugestanden ist, in letzter Linie auf den philosophischenDisziplinen der Psychologie und Ethik, aber auch derLogik und Aesthetik, der Religions- und der Geschichts-philosophie. Die pdagogische Selbstbesinnung des Leh-rers fhrt, auch wo sie zunchst sich mit reinen Detail-fragen beschftigt , z. B. bei der Wahl dieses oder jenesLehrbuches, ja selbst bei der Frage nach der Formulierungeiner grammatischen Regel , doch in letzter Linie immerwieder auf philosophische Strmungen und Probleme,und zwar sowohl in sachlicher Hinsicht, in Bezug auf dieWahl des Unterrichtsstoffes, als in formeller Hinsicht, inBezug auf die psychologische Begrndung der Methode.Und kommt es zu Kontroversen, so fhren alle Streitig-keiten in letzter Linie auf prinzipielle Gegenstze in denphilosophischen Grundfragen. Und endlich ist demLehrer an hheren Schulen noch aus folgendem GrundePhilosophie notwendig: sein Schlermaterial hat, wenig-stens in den oberen Klassen, schon selbst berall philo-sophische Bedrfnisse. Freilich dieses allgemeinemenschliche Bedrfnis nach philosophischer Vertiefungkann auch erstickt werden unter der verschttenden Flleder Details. Aber die Jugend kann doch zum Glckdarin viel vertragen, ohne sich die hchste Zierde desgebildeten Menschen rauben zu lassen: das Interesse anden allgemeinen letzten und hchsten Fragen sowohl in-nerhalb eines Spezialgebietes, als auch und vor allem inBezug auf das allgemeinste Gebiet, auf die Welt ber-haupt. Innerhalb der einzelnen Spezialgebiete in denEinzelwissenschaften selbst stoen doch die einiger-maen begabteren Schler von selbst auf die allgemeinenPrinzipien und Probleme des betreffenden Faches, undsie merken es dem Lehrer bald sehr an, ob er selbst inden Details stecken bleibt oder ob er einen allgemeinen
2*
-
20 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Blick besitzt. Sie merl
-
Philosophische Bildung der Lehrer ein Staatsinteresse. 21
merken es sehr bald heraus, ob der Lehrer auch hierinihnen vorangeht oder ob er sie im Stiche lt. Ein Lehrerohne philosophische Allgemeinbildung taugt nicht frhhere Schulen.
Ein beraus wichtiger Grund, um deswillen derLehrer an hheren Schulen philosophisch geschult sein
mu, sei hier nur gestreift, da er aus dem Rahmen derbrigen Errterungen hinausfllt. Es ist dies der all-
gemeine kulturpolitische Gesichtspunkt, da dervordrngenden Konfessionalisierung auch der hheren
Schulen gegenber ein philosophisch freier Lehrerstand
notwendig ist. Das geistige Leben der Nation verdetund stirbt endlich ab, wenn die geistigen Fhrer derNation und dazu gehren die Lehrer an den hherenSchulen in erster Linie nicht selbst auf einem freien
hohen Standpunkt stehen. Menschen, die nicht durchdie Philosophie auf einen solchen hohen und freienStandpunkt erhoben worden sind, haben sie mgenim brigen noch so ausgezeichnete Spezialgelehrte sein
nur zwei Wege vor sich: entweder sie verfallen demkrassen Materialismus in theoretischer und praktischerHinsicht, oder sie werfen sich einem einseitigen Konfes-
sionalismus in die Arme, der doch auch nur ein Materia-lismus anderer Art ist. Wenn die Schule, insbesonderedie hhere Schule ein Poticum ist, wie ein berhmtesWort lautet, so mu schon der Selbsterhaltungstrieb denStaat dazu fhren, den hheren Lehrerstand durch eine
mglichst gediegene Bildung vor jenen beiden Extremenzu bewahren. Aber die gediegenste Fachbildung schtztnicht vor jenen Gefahren, sondern nur eine grndlichephilosophische Bildung. Es ist doch wahrhaftig die wich-tigste Sache, die es gibt, da diejenigen Mnner, denender Unterricht und die Erziehung der leitenden Elementeder Nation anvertraut wird, also die Letirer an hheren
Schulen die dazu ntige geistige Hhe besitzen ; dazugehrt aber, da sie nicht in ihrem Spezialfach aufgehen
-
22 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
und gewissermaen ersticken, sondern die freie und hoheLuft der Philosophie einzuatmen gelernt haben.
4) Feststellung der philosophischen Allge-meinbildung, speziell durch eine schriftliche
Arbeit.Der Besuch von Vorlesungen und bungen dient
natrlich in erster Linie dazu , sich diese philosophischeAllgemeinbildung zu erwerben, aber es ist doch eineweise Einrichtung unseres Prfungsreglements, da einspezieller Nachweis hierber nicht verlangt wird. Wohlhat jeder Kandidat seine Exmatrikeln es sind ja mei-stens mehrere vorzulegen, aus denen hervorgeht,welche Vorlesungen und bungen er besucht hat.Aber einmal werden diese Belege wohl in den seltenstenFllen von den einzelnen Examinatoren daraufhin durch-gestbert, wenigstens die Philosophen unter ihnen werdenes schwerlich tun. Und sodann htte auch der philo-sophische Examinator kein Recht, einen Kandidaten vomExamen zurckzuweisen, weil er diese oder jene besondereVorlesung nicht gehrt htte hierin besteht ja unsereso kostbare akademische Freiheit< in erster Linie.
Auch beweisen jene Papiere bekanntlich nur das Be-legen der betreffenden Vorlesungen, nicht den Besuch,so da schon aus diesem Grunde die Prfungsordnungmit Recht auf einen speziellen Nachweis keinen Wert legt.Es gilt ja in verschiedenen anderen Gebieten und Lnderndas System, da der Besuch von Vorlesungen und bungenals solcher obligatorisch gemacht wird als Vorbedingungzur Ablegung eines Examens, ja da der Besuch, ja teil-weise das Belegen allein als gengende Vorbildung gilt.Mit Recht sagt unsere Prfungsordnung wenig hierber.Der Philosoph ist gentigt, durch die Prfung allein dieReife des Kandidaten festzustellen, die sich dieser ja aufandere Weise als durch Vorlesungen , z. B. durch Privat-studium erworben haben kann. Zu jener Feststellung
-
Notwendigkeit einer schriftlichen Prfungsarbeit. 23
dienen nun die mndliche und die schriftliche Prfung nur von letzterer ist hier zunchst die Rede.
Um das Knnen eines Kandidaten festzustellen, dazugengt ja eine mndliche Prfung absolut nicht. Mnd-liche Prfungen haben ja doch neben ihren unleug-baren Vorzgen offenkundige Mngel, von denenbrigens nachher noch besonders die Rede sein v^^ird.Darum werden ja denn auch berall, wo in der Weltgeprft wurde, schriftliche Arbeiten angeordnet^). Dieseknnen nun entweder Klausurarbeiten oder Hausarbeitensein. Klausurarbeiten innerhalb einiger Stunden unterAufsicht anzufertigende Arbeiten kommen fr die Pr-fung in der Philosophie nicht in Betracht: sie knntenhchstens zur Lsung bestimmter logischer Aufgaben mitBeispielen verwendet werden. So ist die Hausaufgabedie natrliche Form, in welcher der Kandidat sein Knnenin der Philosophie, wie auch in seiner wichtigsten Fach-wissenschaft nachweisen kann. Eine solche Hausarbeitgewhrt dem Kandidaten die Mglichkeit zu zeigen, waser wirklich gelernt hat, dem Examinator zu sehen, wasder Kandidat wirklich leisten kann. Whrend die mnd-
1) Zu meiner groen Verwunderung hre ich nach dem Ab-schlu dieser Schrift, da die Breslauer philosophische Fakultt dieAbschaffung der schriftlichen Prfung in den allgemeinbildendenFchern, also besonders in der Philosophie, beim Knigl. Preui-schen Kultusministerium jngst beantragt habe. Diese schriftlichePrfungsarbeit dem Preuischen Oberlehrerexamen nehmen hiee,ihm seinen Hauptvorzug vor anderen Prfungsordnungen z. B. derBayrischen rauben. Die vorliegende Schrift, zufllig zu derselbenZeit entstanden, ist also zugleich eine Verwahrung gegen jenesBreslauer Gutachten. Die schlechten Erfahrungen , welche man inBreslau mit der schriftlichen Arbeit gemacht haben mu, sind dochwohl nur die Folge einer Handhabung der Prfungsordnung, welcheden hier entwickelten Grundstzen diametral gegenbersteht. DieDurchfhrung des Breslauer Gutachtens wrde fr die Ausbildungdes Preuischen Oberlehrerstandes, welcher geistig auf einem er-freulich hohen Standpunkte sich befindet, verhngnisvoll sein, unddas Niveau desselben tief herunterdrcken.
-
24 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
liehe Prfung in Gegenwart der Prfungskommission,ruhiges berlegen und unbefangenes Nachdenken kaumaufkommen lt, hat der Kandidat bei der Hausarbeit dieMglichkeit, unter normalen Verhltnissen sich mit einemThema eindringlich, ruhig und grndlich zu beschftigen,ohne Strung durch lstige Aufsicht wie bei den Klausur-arbeiten.
Schon die ueren zeitlichen Bedingungen sind derAusarbeitung einer grndlichen wissenschaftlichen Ab-handlung gnstig. Das Prfungsreglement bestimmt in
28, Abs. 4: Fr die Fertigstellung der beiden Haus-arbeiten wird eine Frist von insgesamt 16 Wochen ge-whrt . Der Kandidat hat also fr jede Arbeit uerlichgenommen, je zwei Monate Zeit. Aber da der Kandidatdie beiden Arbeiten fr gewhnlich nicht streng hinter-einander, sondern gleichzeitig ausarbeiten wird, so hater was fr die Ausreifung der Arbeit nicht unwesent-lich ist , 4 Monate Zeit (falls er nicht schon eher, wasmanchmal vorkommt, eine fach wissenschaftliche Arbeitals Dissertation vorweggenommen hat. Dann bleiben ihmallerdings fr die philosophische Arbeit nur zwei MonateZeit). In dieser Frist lt sich ein wissenschaftliches
Thema, wie es den Kandidaten gegeben wird, in wissen-schaftlicher Weise grndlich behandeln. Freilich ist inBetracht zu ziehen, da diese scheinbar lange Frist durchUmstnde, welche in .der Natur des wissenschaftlichenArbeitens selbst liegen, sehr verkrzt werden kann : zunchsteinmal durch einen rein ueren Umstand, an welchenman hufig nicht denkt: oft sind die ntigen Werke,deren der Kandidat zu seiner Arbeit bedarf, nicht leichtzu beschaffen; sie sind auf der Bibliothek oft fr Monatevoraus mit Beschlag belegt, derart, da die Fertigstellungmancher Prfungsarbeit dadurch direkt in Frage gestelltist. Wenn der Kandidat die betr. Quellenschriften oderwichtige Bearbeitungen, Monographien u. s.w. nicht be-kommen kann, kann er natrlich seine Arbeit gar nicht
-
Zeitdauer der Prfungsarbeit. 25
oder wenigstens nur sehr unvollkommen ausfhren. Einwenig grndlicher Kandidat kann dann sehr wohl seineArbeit rechtzeitig fertigstellen, whrend gerade der Grnd-lichere schon aus jenem rein uerlichen Grunde nichtzum Abschlu kommt. Aber auch innerliche Grndeknnen gerade wieder den Grndlicheren lnger aufhaltenals den Ungrndlichen: wo dieser keine Probleme sieht,findet jener Schwierigkeiten, und im Bestreben, sie zulsen, kann gerade der Bessere die Frist versumen. Sowenig ist auf uerliche Fristeinhaltung zu geben. Pe-dantische Schulmeisterseelen im schlimmsten Sinne desWortes werden natrlich stets und unter allen Umstndenvon vornherein denjenigen Kandidaten vorziehen, der dieFrist unbedingt einhalten kann: und doch kann geradehier der Pnktliche der Schlechtere sein. Die Innehaltungder ueren Ordnung ist hier wie so oft im Leben, nichtdie Garantie des inneren Wertes ; und man darf sich auchhier nicht verfhren lassen, denjenigen, der die uereForm nicht streng einhlt, darum allein schon fr denMinderwertigen zu halten.
Die Prfungsordnung ist in diesem Punkte sehr ver-nnftig; sie bestimmt, da der Leiter des Prfungsaus- Schusses ermchtigt ist, auf ein begrndetes Gesuch hineine Fristerstreckung bis zur Dauer von 16 Wochen zugewhren
;ja unter besonderen Umstnden kann die
Frist mit Genehmigung des Ministers noch weiter ver-lngert werden.
Diese Weitherzigkeit ist beraus zu billigen. Esknnen so viele Hindernisse die rechtzeitige Fertigstellungunmglich machen: Husliches Unglck, Abgespanntheit,Krankheit, Privatunterricht u. s. w. Es kann aber auchsehr wohl vorkommen, da ein Kandidat sein Thema soenergisch und fest anpackt, da die Arbeit ihm unter denHnden wchst und immer weiter wchst. Er machtdann eventuell daraus spter eine eigene wissenschaft-liche Arbeit, eventuell eine Inauguraldissertation, und da
-
26 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
kann es ja wohl vorkommen, da es im Interesse derArbeit und des Arbeitenden selbst ist, wenn er die ein-mal angefangene Arbeit in einem Zuge zu Ende fhrt,anstatt sie voreilig abzubrechen. Es ist sehr zweckmig,da solchen und hnlichen Eventualitten gegenber Spiel-raum geschaffen ist durch jene weiten Bestimmungen.Ein erfahrener und wohlwollender Leiter einer Prfungs-kommission wird daher solchen und hnlichen Eventua-litten Rechnung tragen. Er wird natrlich aber auchdafr zu sorgen wissen, da die Weitherzigkeit der Pr-fungsordnung nicht anderseits von schlechten Elementenmibraucht werde. Mit Recht ist in Preuen dem Leiterdiskretionre Gewalt in Bezug auf die Verschiebbarkeitdes Ablieferungstermins gegeben, gegenber mancherandern Prfungsordnung, welche den Leiter selbst anstarre Formen und absolut feste Fristen bindet, und ihndadurch gegen seine bessere Einsicht unbillig und un-gerecht macht.
innerhalb der gegebenen, und, wie wir sehen, ziem-lich dehnbaren Frist kann der Kandidat sich nun mitaller Energie auf ein wissenschaftliches Thema werfen,und dasselbe den Anforderungen gem bearbeiten: derKandidat soll ja, wie die Prfungsordnung verlangt, inderselben nicht nur ausreichendes Wissen bekunden,sondern auch ein verstndnisvolles Urteil. Gerade beiphilosophischen Themen ist das letztere doch mindestensebensoviel wert wie das erstere, fr einen -verstndnis-voll Urteilenden sogar mehr wert. Mit Recht verlangtdann ferner die Prfungsordnung eine sprachrichtige,logisch geordnete, klare und hinlnglich gewandte Dar-stellung . Ich betone in diesem Zusammenhange be-sonders die durchaus notwendige Forderung der logischenOrdnung und Anordnung der Arbeit. Diese logischeAnordnung der Arbeit ganz besonders zu garantieren,verlange ich jetzt von den Kandidaten durchgngig etwas,was sonst nur ein Teil freiwillig geleistet hat: eine
-
Energiewert der Prfungsarbeit. 27
spezialisierte Inhaltsdisposition. Ganz abgesehenvon der Erleichterung, welche sie dem Examinator beider Prfung der Arbeit gewhrt, bietet die Notwendigkeiteiner solchen, an Anfang oder Ende gestellten, also extraherausgestellten Disposition die Garantie einer viel sorg-fltigeren Gliederung, als wenn eine Disposition nur inder Arbeit selbst faktisch durchgefhrt ist; durch dieformelle und gesonderte Herausprparierung des ganzenGerippes der Arbeit ist der Kandidat gentigt, die Ge-dankenmae viel schrfer zu berdenken und durchzu-denken. Ich wnschte, da bei der spteren Revisionder Prfungsordnung die Einlieferung einer solchen spe-zialisierten Inhaltsdisposition fr jede Arbeit obliga-torisch gemacht wrde.
Die Bearbeitung eines einigermaen bedeutsamenphilosophischen Themas in der geforderten Weise istnicht leicht und erfordert Konzentration der gesamtengeistigen und sittlichen Energie, welche dem Betreffendenberhaupt zu Gebote steht. Aber die Bearbeitung einessolchen Themas darf nicht blo unter dem Gesichtspunktdes Kraftaufwandes, des Energieverbrauchs betrachtetwerden. Wer eine solche Arbeit macht, ver-braucht nicht blo Energie, sondern vermehrtauch seine geistige Energie. Wundt spricht voneinem Gesetz des Wachstums der geistigen Energie: auchin diesem Zusammenhang drfen wir von einem Energie-zuwachs sprechen. Wer gentigt ist, ein wissenschaft-liches Thema grndlich zu durchdenken, das Durchdachtein logischer Ordnung zu entwickeln, das Entwickelteklar, gewandt und sprachrichtig darzustellen, der hatnicht nur geistige Kraft gebraucht, sondern er hat auchan geistiger Kraft gewonnen. Die Prfungsarbeit dientalso nicht blo dazu, den bisherigen Stand des Wis-sens und Knnens zu konstatieren, sondern sie selbstist ein Teil der wissenschaftlichen Ausbildung des Kan-didaten, ein Teil der Geschichte des Auf- und Ausbaues
-
28 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
seines Geistes; sie macht Epoche in dieser seiner Ent-wicklungsgeschichte und dient als konstitutionellerund konstruktiver Bestandteil in dem Gebude seinesWissens, ja sie bestimmt direkt oder indirekt die Rich-tung seiner spteren wissenschaftlichen Arbeit und Me-thode, Vielleicht wird dieser Gesichtspunkt nicht immerdeutlich und scharf erkannt und anerkannt: wer aber diePrfungsarbeit sub hac specie betrachtet, der wird esauch zu wrdigen wissen, wenn ich die Wahl des Themaszur schriftlichen Arbeit fr eine besonders wichtige Sachehalte, vielleicht fr das Wichtigste an der ganzen Pr-fungsprozedur.
5) Die individuelle Wahl des Themaszur schriftlichen Arbeit (nebst einleitendenBemerkungen ber die Individualisierung der
Prfungen berhaupt).Es ist eine beraus weise Bestimmung unserer Pr-
fungsordnung, da Wnsche der Kandidaten bezglich; der Auswahl der Aufgaben tunlichst zu bercksichtigensind. ( 28, 1). Wie weise diese Bestimmung ist, dajeder Kandidat seine eigene Arbeit bekommt, und dabei der Wahl derselben seine Wnsche ein gewichtigesWort mitsprechen, das kann man erst verstehen, wennman einmal das entgegengesetzte Verfahren in einemExtrem sich vor Augen hlt.
In Wrttemberg bestand bis vor kurzem ^) folgendesVerfahren beim sog. Professoratsexamen, d. h. bei derPrfung fr Lehrer an den oberen Klassen der hherenSchulen. Die Prfungsbehrde verffentlichte im Staats-anzeiger ein Thema und zwar ein und dasselbe Themafr alle Bewerber eines und desselben Jahrganges; z. B.
1) Seit dem 21. Mrz resp. 12. Sept. 1898 besitzt Wrttembergeine neue Prfungsordnung, welche die Wahl des Themas demKandidaten ebenfalls freilt.
-
Ein falsches Prfungssystem. 29
fr klassische Philologen eine Untersuchung ber dieBedeutung der 'Poo^acxr] uQiatokoyCa des Dionysius vonHalicarnass fr die alte Verfassungsgeschichte Roms,oder ber >das Verhltnis des Euripides zu den gleich-zeitigen Philosophen, speziell zu Anaxagoras . DiesesThema muten nun alle Kandidaten bis zu einem festen,unverrckbaren Termin, also alle an einem und demselbenTage abliefern.
Dieses Verfahren ist nun aus verschiedenen Grndenwenig rationell, zunchst aus dem rein uerlichen Grunde,da die Ausarbeitung eines solchen Themas vielen da-durch sehr erschwert, ja eventuell fast unmglich ge-macht wurde, da sie die zur Arbeit ntigen Bcher aufden wenigen Bibliotheken gar nicht rechtzeitig mehr be-kommen konnten, weil ja ebendieselben Werke von denbrigen Kandidaten schon mit Beschlag belegt waren.Dies fhrte zu einem oft sehr peinlichen Wettrennen umdie ntige Literatur, wobei die Mitbewerber einandermanchmal nicht gerade mit den edelsten Mitteln ber-vorteilten. Schlaue lauerten in Stuttgart selbst auf dasErscheinen der amtlichen Mitteilung im Staatsanzeiger,und liefen noch an demselben Tage auf die Bibliothek,eventuell um die unangenehme Erfahrung zu machen,da noch Schlauere sich auf irgend eine Weise nochvor Erscheinen der offiziellen Mitteilung in den Besitzder Kenntnis des Themas gesetzt und infolgedessendie betreffenden Bcher auf der Bibliothek schon tagszuvor abgeholt hatten.
Andere, mehr in der Sache selbst liegende Irrationali-tten liegen auf der Hand. Es ist scheinbar gerecht, daalle Kandidaten ein und dasselbe Thema bekommen,damit die Examinatoren auf diese Weise durch Verglei-chung aller eingereichten Arbeiten ber ein und dasselbeThema einen untrglichen Mastab ber das Knnendes einzelnen erhalten und auf diese Weise alle Be-werber nach dem Ausfall der Arbeit hbsch in einer
-
30 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Reihe von 1 10 aufstellen knnen. Allein gerade diesesscheinbar gerechteste Verfahren schliet die grten Un-gerechtigkeiten ein. Denn der eine Teil der Kandidatenkann sich ja nun zufllig gerade schon mit diesem Themabeschftigt haben, sei es mit dem speziellen Thema selbstoder wenigstens mit dem allgemeinen Gebiet, aus demes genommen ist. Hat sich also einer schon nher mitrmischer Verfassungsgeschichte beschftigt, so wird erjenes erste Thema ber Dionys von Halicarnass viel eherbearbeiten knnen, als ein anderer, der sich zufllig mitanderen Gebieten genauer bekannt gemacht hat. Dieserandere hat vielleicht auf dem Gebiet der griechischenLyrik oder des rmischen Epos genauere Studien ge-macht. Wre das Thema aus diesem Gebiete gegebenworden, so wre wiederum er im Vorteil gewesen.
Endlich verbietet auch die Ablieferung der Themenzu einem und demselben Termin jede Mglichkeit derBercksichtigung individueller Verhltnisse. Der A bekamwhrend der vorgeschriebenen Frist einen Influenzaanfall,dem B starb seine Mutter u. s. w. Gleichgltig, der Ab-lieferungstermin steht ein fr allemal fest, die Arbeit mubis zu dem bestimmten Termin in den Hnden derKommission sein, sonst mu der Kandidat bis zumnchsten Jahre warten. So mu er eine minderwertigeArbeit einreichen, aus der sein Knnen und Kennen garnicht hervorgeht, und die doch und das ist dasBitterste und Ungerechteste sein ganzes ferneres Lebenbestimmt.
Diese ganze Prfungsprozedur ist nun, wie schonaus dem Vorhergehenden hervorgeht, durch den einenUmstand mitbedingt, da berhaupt die Prfung nureinmal im Jahre stattfindet: aus diesem Grunde ist esja schon notwendig, da alle Arbeiten genau zu dem-selben Termin fertig gestellt sein mssen , so da auchdie dringendsten Umstnde eine Hinausschiebung desTermines der Ablieferung nicht mglich machen.
-
Vorzge des preuischen Prfungssystems. 31
Das preuische Prfungsverfahren ist nun in allenPunkten das genaue Widerspiel des eben geschildertenModus. Schon der uerliche Umstand, da die Pr-fungen nicht alle auf einmal stattfinden, sondern berdas ganze Jahr (d. h. ber das Sommer- und Winter-semester) verteilt sind, ist viel rationeller, auch fr diePrfenden selbst, denen die Anhufung der Prfungenauf eine kurze Spanne selbst beraus lstig sein mu,um so mehr, als dieser Generalprfungstermin dann geradein die Universittsferien gelegt wird. Jene Verteilung dereinzelnen Prfungstermine ber das ganze Jahr schlietja nun schon die Mglichkeit ein, in Bezug auf dieueren Umstnde und Verhltnisse der Kandidaten zuindividualisieren. Je nachdem die schriftlichen Arbeitenfrher oder spter fertiggestellt und eingereicht sind,kann die mndliche Prfung auf diesen oder jenen Terminim Laufe des Jahres verlegt werden; und eben darumkann ja auch den einzelnen Kandidaten die Ablieferungs-frist unbedenklich verlngert werden. Es knnen auchsonst die Wnsche und Bedrfnisse der Kandidaten inBezug auf die Festsetzung des Termins der mndlichenPrfung bercksichtigt werden. Wenn dagegen Ein Terminim Jahr fr alle Kandidaten ein fr allemal festgelegt ist,wie viel tausend tckische Zuflle des Lebens knnengerade der Ablegung der Prfung zu einem solchen un-beweglichen Termin hindernd im Wege stehen, resp.den Ausfall ungnstig mitbedingen
!
Aber die Hauptsache, auf die es uns in diesem Zu-sammenhang ankommt, ist die Individualisierung desThemas der schriftlichen Arbeit. Diese liee sich ja auchan sich mit Festsetzung eines und desselben Terminesfr smtliche Kandidaten eines Jahres verbinden, aberdie Individualisierung in letzterer Hinsicht untersttzt dieIndividualisierung auch in der ersteren. Die Unzutrg-lichkeiten des umgekehrten Verfahrens, wie es also z. B.frher in Wrttemberg eingeschlagen wurde, sind nun
-
32 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
schon gengend gekennzeichnet worden und daraus er-geben sich unmittelbar die Vorzge unseres Verfahrens.Man geht hier in liberalster Weise auf die Wnsche derKandidaten ein; man bercksichtigt ausdrcklich geradedas Studiengebiet, mit dem sie sich besonders eingehendbeschftigt haben ; man geht dabei von der richtigenAnsicht aus, da der Kandidat am ehesten auf diesemseinem Lieblingsgebiet eine wissenschaftliche Arbeit liefernkann. Denn seine Arbeit soll einen streng wissenschaft-lichen Charakter haben: sie soll zwar nicht, wie eineDoktor- Dissertation die Wissenschaft produktiv ver-mehren, aber sie soll nach streng wissenschaftlicherMethode gearbeitet sein. Eine Arbeit aus dem schonbisher bevorzugten Studiengebiet kann natrlich dieserAnforderung viel eher entsprechen, als eine Arbeit auseinem Gebiet, in das sich der Betreffende erst hinein-arbeiten mu. Die Prfungsarbeiten bekommen notwendigbei unserem System einen wissenschaftlich viel wert-
volleren Charakter, als bei dem zuerst geschildertenfalschen System. Dieses letztere System bertrgt denModus, wie er bei Schulprfungen blich und notwendigist, auf die wissenschaftliche Prfung und drckt dadurchdas Niveau der letzteren betrchtlich herab. Bei einerSchulprfung wird allen Schlern ein und dieselbe Auf-gabe gestellt, und danach mag man sie dann nachherloderen;, d. h. ihnen ihre Stelle in Reih und Glied an-weisen. Aber bei einer wissenschaftlichen Prfung, wiesie die Prfung der Lehrer an hheren Schulen ist, istjener schulmeisterliche Modus ganz deplaziert. Es kommtja nicht darauf an, da Hinz und Kunz dieselbe Auf-gabe machen, sondern da wissenschaftlich gebildetejunge Mnner diese ihre wissenschaftliche Ausbildungmanifestieren sollen, da sie dazu eine wissenschaftlicheArbeit machen sollen, und dazu ist eben ein individuellesThema am geeignetsten, das nach der Studienrichtungdes Kandidaten und auch nach dem Ma seiner Kraft
-
Wissenschaftlicher Charakter der Prfungsarbeiten. 33
zugeschnitten ist. Die Behandlung eines individuellenThemas hat auerdem sehr viel mehr Reiz und bietetviel mehr Interesse, sowohl fr den Kandidaten, als frden Examinator, als jenes andere System, das alle bereinen Leisten schlagen will. Ebendeshalb nimmt manbei unserem System hier keinen Anstand, den Kandidatensolche Themata zu geben, mit denen sie sich schon ineinem Seminar nher beschftigt haben, das sie in bungenschon einmal bearbeitet haben , und das sie nun aufsneue grndlich durcharbeiten knnen, um eben darauseine wissenschaftlich musterhafte Arbeit zu machen. Sogeschieht es ja denn auch sehr oft bei uns, da solche,schon vorher vorbereitete Examensarbeiten nachher zuPromotionsarbeiten erweitert werden. Auf diese Weiseaber kann der Kandidat dem Thema immer mehr abge-winnen, sich und seine Arbeit immer mehr wissenschaft-lich vertiefen. Man nimmt darum auch z. B. gar keinenAnstand, dem Kandidaten ein Thema zu geben, das ervorher schon in einer Preisarbeit behandelt hat. Geradeaus solchen Preisarbeiten gehen dann oft die bestenExamensarbeiten hervor. Und es liegt ganz in der Liniedesselben Gedankenganges, da demjenigen Kandidaten,der seine wissenschaftliche Leistungsfhigkeit auf einemGebiete durch eine Promotionsarbeit bettigt hat, diesePromotionsschrift als Examensarbeit angerechnet wird.
Es gibt Prfungssysteme, bei denen gerade umge-kehrt ngstlich und peinlich darber gewacht wird, danur ja das Thema dem Kandidaten ganz neu, unerwartetund unvermutet sei. Wie gesagt, dies System verrteinen eng schulmeisterlichen Geist und dazu einen gnz-lichen Mangel an Verstndnis fr den Charakter einerwissenschaftlichen Arbeit im Unterschied von einer bloenSchulleistung. Fr Schler mag jenes engherzige Systemdas richtige sein, fr wissenschaftlich gebildete jungeMnner ist es ganz verwerflich. Dort, bei Schulen undSchlern, handelt es sich um groe Massen gleichmigV a i h i n g e r , Staatsprfung. 3
-
34 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
gedrillter Lehrlinge, hier aber handelt es sich um selb-
stndige junge Mnner, welche ihre eigene wissenschaft-liche Physiognomie haben, und welche weit ber dasLehrlingsstadium hinaus sind und sich um die Meister-schaft bewerben. Bei jenem System kommt der Exa-minator mit dem einzelnen gar nicht in Berhrung; erstellt seine Aufgaben vom hoh'n Olymp herab' undkann die Antworten beurteilen, ohne mit einem einzigenpersnlich zu schaffen zu haben; hier dagegen tritt derKandidat zu dem Examinator in persnliche Beziehung;denn so wenigstens wird es in Halle gehandhabt
der Kandidat stellt sich seinem knftigen Examinator vor,und bei dieser persnlichen Meldung zur Prfung schil-dert der Kandidat seine bisherigen Studien, um auf Grunddieser ihm abverlangten Anamnese ein fr ihn indi-viduell geeignetes Thema zu erhalten ^). Der Examinatorist Freund und Berater des Kandidaten, stellt ihm Vor-zge und Nachteile dieses oder jenes Themas an sich,sowie gerade fr seine Person vor, fragt ihn aus ber seinebisherige Beschftigung und Lieblingsstudien, legt ihmeventuell mehrere Themata zur Auswahl vor, und bertmit ihm zusammen die definitive Entscheidung fr eines.Die eigentliche Entscheidung gibt natrlich der Exami-nator, aber wenn er einigermaen verstndig und wohl-
1) Bei manchen Kommissionen, so auch bei der Breslauer,scheint es Sitte zu sein, da die Kandidaten ihre Meldung nurschriftlich einreichen. Sollte das der Fall sein, so wre eine Mini-sterialverordnung angezeigt, welche persnliche Meldung) bei deneinzelnen Examinatoren , welche schriftliche Arbeiten zu stellenhaben
,direkt vorschreibt oder wenigstens dringend empfiehlt.
In Halle ist es brigens Praxis, da, da zwei Vertreter der Philo-sophie in der Prfungskommission sitzen, die Wnsche der Kandi-daten tunlichst bercksichtigt werden, wenn sie von dem einen oderdem anderen ihr Thema gestellt zu bekommen vorziehen. Fr ge-whnlich hat dann auch derselbe Fachmann, der das Thema stellt,die betreffende Arbeit zu zensieren, sowie das mndliche Examenabzunehmen. Doch knnen hierin gelegentlich unvermeidliche Ver-schiebungen eintreten.
-
Der Examinator als Berater des Kandidaten. 35
wollend ist, so wird er die Wnsche des Kandidatentunlichst bercksichtigen, um so mehr, als dies jaauch ausdrcklich gesetzlich vorgeschrieben ist. Je mehrdas Thema auf die Individualitt des Kandidaten zuge-schnitten ist, desto mehr Garantie besteht dafr, da derKandidat eine wissenschaftlich wertvolle Arbeit liefert,welche eventuell in seiner wissenschaftlichen EntwicklungEpoche bildet. Je mehr das Thema auf den Kandidaten,seine bisherigen Studien und seine LeistungsfhigkeitRcksicht nimmt, mit desto grerer Lust und Liebewird er an dem Thema arbeiten; und davon wird natr-lich auch die Qualitt der Arbeit nicht unberhrt bleiben.
Es bedarf wohl noch kaum der ausdrcklichen Be-merkung, da diese individuelle Themastellung von Fallzu Fall auch fr den Examinator selbst doch viel mehrReiz, viel mehr wissenschaftliches Interesse darbietet, alsjenes erstere System, bei dem ein Thema fr alle Kan-didaten gestellt wurde, und das dann auch die lstigeFolge hat, da der Examinator viele Arbeiten ber einund dasselbe Thema durchlesen mu eine langweiligeund unergiebige Arbeit. Ist aber jedes Thema eine wissen-schaftliche Gre fr sich, so bietet die Prfung solcherabwechslungsreichen Themata ja fr den Examinatorselbst ein gewisses wissenschaftliches Interesse und erkann durch immer neue Variationen von Arbeiten diesessein eigenes Interesse an dem an sich lstigen Prfungs-geschft selbst erhalten und steigern. Er kann durchimmer neue Themastellungen wissenschaftlich die mannig-fachste Anregung geben, er kann dem Gange der Wissen-schaft selbst folgend neue Fortschritte seiner Wissen-schaft zu neuen Themata verwerten und damit die ganzean sich banausische Prfungsprozedur mit wissenschaft-lichem Geist erfllen und gewissermaen veredeln ^).
1) Das oben erwhnte seltsame neuerliche Votum einer preussi-schen philosophischen Fakultt fr Abschaffung der schriftlichen
3*
-
36 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
All dies gilt nun natrlich auch von der philosophi-
schen Prfung speziell, zu der wir uns nach den vorste-henden allgemeinen Ausfhrungen zurckwenden. Ins-besondere gilt hier auch das zuletzt noch angedeutetePrinzip der Aktualitt. Es ist sehr zweckmig,die Prfungsthemata, wenigstens zum Teil, aus dem un-mittelbar fluktuierenden wissenschaftlichen Leben der Ge-genwart zu entnehmen. Hierdurch bekommt die Arbeitdes Kandidaten selbst einen unmittelbar wissenschaft-
lichen Wert, er hat den Vorteil, durch seine Arbeit an
dem frisch pulsierenden Leben der Gegenwart teilzuneh-men. Seine Arbeit macht ihm auch selbst viel mehrFreude, wenn sie in den lebendigen Strom der aktuellenWissenschaft einmndet. Es versteht sich dies insofernfreilich von selbst, als der Kandidat ja natrlich selbst
die neuere Literatur zu irgend einem beliebigen, ihmgestellten Thema benutzen wird. Aber die Sache ge-winnt doch einen ganz anderen Charakter, wenn dasThema selbst schon von vornherein auf eine bestimmte,gerade aktuell gewordene Erscheinung zugeschnitten wird.Einige Beispiele werden besser lehren, was gemeint ist.Ich kann das Thema stellen: Die Beziehungen des Eu-ripides zur griechischen Philosophie, speziell zu Anaxa-
goras. Aber dasselbe Thema gewinnt ein viel lebhaf-teres Interesse, wenn ich es formuliere, wie es sich unterNr. 45 findet: -^Mit welchem Rechte nennt Nestle (-Euri-pides 1901) den Euripides den Dichter der griechischenAufklrung? Ein anderes Beispiel. Ich kann das Themastellen: >Der Lehrinhalt der Platonischen Dialoge Hippiasminor, Laches und Charmides. Aber dasselbe Themaerregt das wissenschaftliche Interesse in viel hheremMae, wenn ich es formuliere, wie dies in Nr. 50 ge-
Arbeiten in Philosophie und den anderen allgemeinbildenden Fchernerklrt sich wohl am einfachsten daraus, da daselbst die Stellungder schriftlichen Arbeiten nicht in dem oben geforderten Geistestattfindet.
-
Prinzip der wissenschaftlichen Aktualitt. 37
schehen ist: Ist die neuerdings (von E. Horneffer inseiner Schrift: Piaton gegen Sokrates, Leipzig bei Teub-ner 1904) aufgestellte Behauptung gerechtfertigt, Piatonhabe im Hippias II
,Laches und Charmides gegen So-
krates polemisiert? Weitere Beispiele findet man in derSammlung selbst genug. Ich will nur noch einige we-nige hier anfhren. Ein beliebtes Thema lautet: >DieBedeutung des Tractatiis de emendaone intelledus frdie Entwicklung der Philosophie Spinoza's \ Aber das-selbe Thema gewinnt an aktuellem Reiz, wenn es (hn-lich wie in Nr. 11) so formuliert wird: Enthalten dievon E. Khnemann in der Abhandlung: ber die Grund-lagen der Lehre des Spinoza (1902) aufgestellten An-sichten ber die Stellung der spinozistischen Schrift:
Tractatiis etc. einen Fortschritt ?
Noch direkter in das unmittelbare wissenschaftlicheLeben der Gegenwart greifen aber Themata ein, wiedie Folgenden: Darstellung und Beurteilung der teleo-logischen Naturanschauung (der Dominantentheorie) von
J. Reinke (Nr. 244) ; oder : Darstellung und Kritikder Einwnde, welche Hans Driesch in seiner Schrift : DerVitalismus als Geschichte und als System, (1905), gegenLotze's Behandlung des Begriffes der Lebenskraft er-hebt (vgl. Nr. 256); oder: >Ostwalds Erneuerung derenergetischen Naturanschauung und deren Kritik durchWundt in der 5. Auflage seiner Grundzge der physio-logischen Psychologie (1903) (Nr. 229); oder endlich:Das Problem des Fortschrittes in der Geschichte, mitbesonderer Rcksicht auf die Anschauungen von Siebeckund Grotenfelt (1904) (Nr. 259).
Eine solche Aktualitt der Themata erregt und er-hht das Interesse der Kandidaten an Philosophie erfah-rungsgem in hohem Mae. Es ist mir auf diese Weisefters gelungen , auch den Widerstrebendsten die Be-schftigung mit der Philosophie geradezu lieb zu machen.Einige weitere charakteristische Beispiele kommen sogleich
-
38 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
nachher noch von einem anderen Gesichtspunkt aus zurSprache.
Fr die Prfung in Philosophie i
-
Prinzip der wissenschaftlichen Konzentration. 39
sind der Meinung, die philosophischen Probleme seiennotwendig ganz abstrakt weltfremd, ohne alle Berh-rung mit der positiven Wissenschaft. So verkehrt dieseMeinung ist, so verbreitet ist sie und wird leider durchmanche Philosophen selbst genhrt. Manche Vertreterder exklusiv erkenntnistheoretischen Richtung in derPhilosophie haben dadurch die Philosophie fast ebensoin Mikredit gebracht, wie die Vertreter der alten speku-lativen Richtungen. So wichtig erkenntnistheoretischeErwgungen sind, so drften sie doch nicht alle Sach-gebiete berwuchern. Auch wird von manchen Vertreternder Philosophie der lebendige Zusammenhang der allge-meinen philosophischen Fragen mit den Problemen derEinzelwissenschaften zu wenig betont, sowohl in Bezugauf die systematische als auf die historische Seite , we-niger aus eigener Unkenntnis, als aus dem leidigen p-dagogischen Fehler, bei den Zuhrern Kenntnisse irrtm-licherweise als selbstverstndlich vorauszusetzen, welchesie selber haben. Auf diese Weise erhalten die Studie-renden nicht selten ein ganz falsches Bild von der Phi-losophie.
Kommt da beispielsweise ein Kandidat zu mir, einNaturwissenschaftler, speziell Botaniker und Zoolog:Ich habe mich zum Examen gemeldet, und mchte umeine philosophische Arbeit bitten. Dies sagt er mit einerStimme und mit einer Miene, da man ihm ansieht, derGang zu einem Zahnarzt wre ihm auch nicht schwerergefallen, als der Gang zum Professor der Philosophie.Nun, worber mchten Sie denn ein Thema haben?Ich bitte um ein Thema aus Cartesius. Warum wollenSie denn gerade ein solches Thema ?>^^ Verlegenes Schwei-gen. -Interessiert denn Cartesius Sie so besonders?Fortsetzung des verlegenen Schweigens. -Nun, sagenSie es mir ganz offen, warum Sie denn gerade auf Car-tesius verfallen sind ; mit Offenheit erreicht man im Lebenam meisten. Meine Bekannten sagten alle, Cartesius
-
40 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung,
sei der leichteste Philosoph und das habe ich auch ge-funden . Haben Sie sich denn mit Geschichte derPhilosophie beschftigt? Ich habe Geschichte der Phi-losophie in meinem ersten Semester gehrt, das war miraber zu hoch. Dann habe ich im vorigen Semester noch-mals Geschichte der Philosophie belegt, aber ich konntenur sehr selten kommen, da ich durch meine praktischenArbeiten im botanischen und zoologischen Institut zusehr in Anspruch genommen war. Dann habe ichSchwegler gelesen, aber ich habe vieles darin nicht rechtverstanden. Cartesius schien mir am verstndlichsten.Gefiel Ihnen denn seine Philosophie? Nein, offen
gestanden, gar nicht, sie erschien mir ganz rckstndig.Aber
. . .. Nun, was . . . aber? Aber, man mu
doch eine Arbeit ber Philosophie machen, und da wollteich eben dazu Cartesius, weil er immer noch am ver-stndlichsten erscheint . Die Philosophie steht fr Sieoffenbar ganz auer Zusammenhang mit Ihren sonstigenStudien. Da haben Sie wohl zur Philosophie kein rechtesVerhltnis gewonnen?- Offen gestanden, ich habe keineBegabung fr Philosophie. Ich bin mit Leib und SeeleBotaniker und Zoolog . Glauben Sie nicht, da auchein Zoolog sich fr Philosophie interessieren kann?Unter meinen Bekannten kenne ich keinen, wenigstensunter meinen Bekannten an der Universitt X. Ob eshier welche gibt, wei ich nicht, ich bin erst seit kurzemhier, ich habe bisher in X studiert. Meine naturwissen-schaftlichen Bekannten haben da auch Arbeiten berCartesius gemacht, einer hat auch ber Spinoza gearbeitet,aber der ist mir zu schwer
. Es ist sehr schade, daSie zur Philosophie und zu philosophischen Problemenkein inneres Verhltnis gewonnen haben. Aber vielleichtist das doch noch mglich. Haben Sie denn gar keineGelegenheit gefunden, zwischen Ihrer Spezialwissenschaftd.h. der Zoologie, und der Philosophie eine Brcke zuschlagen ?^ Der Gedanke ist mir bis jetzt noch gar
-
Wie man die Kandidaten fr Philosophie gewinnt. 41
nicht gekommen
-
42 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
jngster Zeit viel errtert worden, von Forel, von Was-mann, von Maeterlinck; dazu mten Sie auch SchneidersUntersuchungen ber den tierischen Willen und natrlichWundts Vorlesungen ber Menschen- und Tierseele inder 2. Auflage hinzuziehen. Wrde das Thema Sie inter-essieren? Ein solches Thema wrde ich mit grterFreude bearbeiten. Sie knnen brigens das Themaauch eventuell allgemein fassen und z. B. die neuerenAnschauungen ber den Instinkt mit besonderer Rck-sicht auf Wundt behandeln. Der Kandidat whlt einsdieser Themata und verlt seelenvergngt meine Sprech-stunde, in die er mimutig und niedergedrckt gekommenwar. Ich sage ihm noch , da er von einem solchenThema aus nun auch den Zugang nicht blo etwa zurPsychologie sondern zu philosophischen Problemenberhaupt finden werde. Die Frage nach dem Seelen-leben der Tiere mnde ja direkt in das Problem der Be-seeltheit berhaupt, in das Problem der Substantialittoder Aktualitt der Seele und damit in die allgemeinstenund tiefsten Probleme der Philosophie. Gewhnlichmacht man mit solchen Kandidaten, welche trotz anfng-lichen Widerstrebens auf diese Weise fr Philosophiegewonnen sind ^), nachher die besten Erfahrungen. Haben
1) Whrend der Abfassung dieser Schrift ist mir ein ganz hn-licher Fall begegnet: Ein Kandidat, ein Naturwissenschaftler, hatteum ein pdagogisches Thema gebeten. Da er sich aber mit Pda-gogik gar nicht nher beschftigt hatte, schlug ihm Direktor Friesdiese Bitte ab und sandte ihn zu mir, mit der Mitteilung, der Kan-didat habe offenbar nur darum ein pdagogisches Thema verlangt,um sich um die Philosophie zu drcken, im brigen sei er offenbarbegabt. Ich fand dies vollauf besttigt: der junge Mann hattesoeben mit einer ausgezeichneten botanischen Arbeit promoviert,hatte aber zwischen seiner Botanik und der Philosophie keine Brckegefunden. Ich gab ihm das Thema No. 245: Die mechanische unddie teleologische Erklrungsmethode in ihrer Anwendung auf bota-nische Fundamentalprobleme , erlutert an dem Gegensatz von G.Detto und Joh. Reinke. Fr dieses Thema war der Kandidat, dersich bisher unter Philosophie etwas ganz Weltfremdes, Abstruses
-
Das Prinzip der Individualisierung. 43
solche einmal den Zugang zur Philosophie gefunden, sofinden sie sich in dem Gebiet, das bisher ihnen ein ver-schlossener Garten oder gar eine >drre Haide erschien,und zu dem ihnen nun ein fr sie passender Zugangerffnet worden ist, um so rascher und leichter zurecht.
Da alle Wege zur Philosophie fhren, wenn sienur konsequent weiter verfolgt werden, auf diese bekannteWahrheit wurde schon oben hingewiesen. Eben darumgibt es auch fr die verschieden organisierten und ver-schieden ausgebildeten Geister so viel verschiedene Zu-
gnge zur Philosophie, und der Philosoph mu sich auchdarin als Philosoph beweisen, da er nicht nur seinenZugang zur Philosophie, den er als den ihm adquatengefunden hat, auch anderen zumutet. Je mehr sich derPhilosoph vor solcher Einseitigkeit htet, desto mehr wirder den anderen sein knnen. Gerade im Verkehr mitden aus den verschiedensten Studiengebieten kommendenLehramtskandidaten mu diese Regel befolgt werden.Wenn die Philosophie von verschiedenen belwollendenund belberatenen Seiten als Prfungsfach im Staatsexamenoder im Doktorexamen angefeindet wird, so sind andieser Feindschaft auch nicht selten die Philosophen selbstschuld, wenn sie die oben entwickelten natrlichen Regelnnicht befolgen, wenn sie die Philosophie abstrakter undabstruser darstellen als sie ist.
Bei der Wahl der Themata fr die Arbeiten der Lehr-amtskandidaten gilt also jene Regel ganz besonders, undmodifiziert sich dahin, das Thema mit den sonstigen Stu-diengebieten der Kandidaten in Zusammenhang zu bringen.Natrlich gibt es hier auch Ausnahmen. Es kommt vor,da ein Mathematiker sich fr das daiuvLov des Sokratesinteressiert, oder da ein klassischer Philologe ber die
geometrische Methode des Spinoza schreiben will: an
vorgestellt hatte, sofort Feuer und Flamme. Es wurde ihm natrlichnoch spezifisch philosophische Literatur ber mechanische und teleo-logische Naturauffassung angegeben.
-
44 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
sich sehr erfreulich, wenn das philosophische Interesse
ber die Grenzen des Spezialgebietes und der in dasselbeeinschlagenden allgemeinen philosophischen Fragen hin-
ausgeht, und sich auf ganz andere Fragen wirft, durchwelche der Gesichtskreis ja noch mehr erweitert werdenkann. Aber besonders hufig macht man diese Beobach-tung nicht, und es ist auch anderseits gut, da mansie nicht allzuoft macht: es ist doch das Naturgeme,da die jungen Leute dadurch Ordnung und Zusammen-hang in die ihnen dargebotenen Gedankenmassen hinein-bringen, da sie sie aufeinander beziehen, da sie Fdenzwischen denselben ziehen, da sie Zusammenhngestiften. Es werden dadurch nicht blo neue Krfte er-zeugt, sondern es wird auch Kraft erspart, und das letz-tere ist bei den hohen Forderungen, welche das Staats-examen an sie stellt, uerst wnschenswert. Es ist jaeine sehr wichtige pdagogische Regel, da verschiedeneVorstellungsreihen
,
gleichgltig nebeneinander stehend,erheblich viel mehr Kraft zur Bewltigung erfordern , alswenn diese verschiedenen Reihen aufeinander bezogensind. Und dazu kommt die Hauptsache: so aufeinanderbezogene verschiedene Vorstellungsreihen helfen sich ge-genseitig, heben und strken einander und so wird dieErweiterung des Gesichtskreises zugleich zur Vertiefungdes Verstndnisses.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch die Samm-lung der Themata zu beurteilen, welche ich mitteile, ichhabe die Themata gerade entsprechend den sonstigenFchern der Kandidaten bersichtlich zusammengestelltund dabei mglichst spezifiziert. In der Mehrzahl derFlle ist nur Ein Hauptfach des Kandidaten zu berck-sichtigen, sei es Klassische Philologie, oder Romanistikoder Anglizistik oder Germanistik u. s. w. Nicht seltenaber sind, da ja viele Kandidaten mehrere Hauptfcher ingleichem Mae betreiben, auch zwei solche Fcher zubercksichtigen, z. B. Romanistik und Anglizistik, Religion
-
Wie man geeignete Themata findet und sammelt. 45
und Deutsch, Geschichte und Geographie. Die Auffin-dung solcher philosophischer Themata, die sich mit zweisolchen Hauptfchern gleichzeitig berhren, ist natrlichschwieriger; doch bietet ja die Zusammenstellung untenmehrere Beispiele. (Vgl. auch oben S. 12). Die Auffindungder Themata bietet in diesem Falle natrlich dem Exami-nator aber auch seinerseits manche Anregung zum Nach-denken und Nachforschen. Im brigen lt sich die Auf-findung geeigneter Themata durch einen einfachen Kunst-griff sehr erleichtern und vereinfachen: beim Studium ber-haupt und insbes. bei der Lektre wissenschaftlicher No-vitten stoen unser einem so viele passende und reiz-volle Themata zur Bearbeitung auf, da man sie nursogleich am besten jedes auf ein eigenes Blatt zunotieren und nach Fchern zu rubrizieren braucht, um dannim gegebenen Moment eine groe Auswahl von Thematabereit zu haben ^) ; man kann dann aus dem vollenschpfen, indem man einfach in seine Collectaneen hinein-greift. Ohne eine solche Vorsicht kann man leicht in Ver-legenheit geraten, wenn man unerwartet von einem odergar von mehreren Kandidaten mitten im Studium berfallenwird und nun Themata aus dem rmel schtteln soll.Hierauf ist es zurckzufhren, da manche Kollegen,welche sonst einen weiten Gesichtskreis haben, in derWahl der Themata gelegentlich gar zu einfrmig verfahren.
1) Besonders geeignete Thema sind auch natrlich Kontrovers-punkte aus der Geschichte der Philosophie: z.B. die Stellung De-mokrits in der Entwicklung der griechischen Philosophie vor odernach den Sophisten ; die angebliche Cartesianische Epoche des Spi-noza; die verschiedene Auffassung der spinozistischen Attributen-lehre ; die Stellung Lockes zu Cartesius ; die Einwirkungszeit Humesauf Kant u. . Es hat fr die Kandidaten einen besonderen Reiz,in einer solchen Kontroverse zwischen hervorragenden Forscherneine selbstndige schiedsrichterliche Stellungnahme einnehmen undbegrnden zu drfen. Man mu ihnen dann aber auch volle wis-senschaftliche Freiheit lassen und nicht eine bestimmte Parteinahmeverlangen.
-
46 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
Da bekommen zehn Kandidaten hintereinander dasselbeoder ganz hnliche Themata, etwa das eine Mal: HumesLehre von der Kausalitt und ihr Verhltnis zur Kanti-schen Kraft , des Vermgens fft uns ja noch heute inder Form der Lebenskraft und gelegentlich auch sogarin der Form der Seelenvermgen
-
Franzsisch und Philosophie. 67
auch naheliegt, weil an dessen Aesthethii< die franzsischeKuhur noch lange festhielt, trotzdem seine Metaphysikschon lngst mit den Fesseln der Scholastik abgeschtteltwar. Zum Frankreich des 17. Jahrh. gehrt auch Leibniz,der mit seinen Nouveaux Essays ins 18. Jahrh. hinein-reicht und dessen Philosophie noch im 19. Jahrh. inFrankreich eine dominierende Rolle spielt. Die franzsischePhilosophie des 18. Jahrhunderts ist so reich an Wechsel-beziehungen mit der Literatur, da hier kaum etwas Spe-zielles noch besonders hervorgehoben werden kann.Voltaire, der die so verschlungenen Beziehungen dermodernen franzsischen Literatur zur englischen sowieauch zur deutschen inauguriert, sollte keinem Romanistenfremd bleiben: er wird nur jetzt meist vernachlssigt hinterRousseau, der ja allerdings diese Bevorzugung seinerpositiven Ideenflle und ihrem Einflu auf die Gebieteder Geschichts-, der Religions-, der Staats- und derErziehungsphilosophie verdankt. Hinter Rousseau tretengewhnlich auch die Enzyklopdisten ungebhrlich zurck,besonders Diderot. Auch die Deutsch-Franzosen Hol-bach und Grimm verdienten mehr Beachtung. Die Re-staurationsphilosophen sind allerdings wenig wert, aberdagegen sollten die Sozialphilosophen insbesondere Comteden Kandidaten nicht so unbekannt sein, wie es meistensder Fall ist. Die moderne franzsische Schule bietetAnknpfungspunkte einerseits mit Kant durch den Neo-criticisme, anderseits mit Wundt durch die Psychologie;die moderne franzsische Psychologie, speziell z. B. diePsychologie der Sprache (4e language interne ) und diePsychologie der Kinder, bietet viel Interessantes. Wennder junge Romanist, wie das jetzt nicht selten geschieht,vor dem Examen in Frankreich studiert, so hat er da-selbst Gelegenheit, auch nach dieser Seite hin seineStudien zu konzentrieren, indem er philosophische undromanistische Interessen auf die angedeutete Weise ver-bindet. Er kann den franzsischen Neokritizismus an
5*
-
68 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
der Quelle studieren, z. B. bei Boutroux in Paris, er kannin Nancy den dortigen bedeutenden Psychologen nhertreten. Auch kann er Gelegenheit nehmen, den Betriebder philosophischen Propdeutik an den franzsischenLyzeen kennen zu lernen, in welchem Leibniz'sche Be-griffe (auch in der Form des Renouvierschen Neokriti-zismus) noch immer eine bedeutsame Stellung einnehmen;und ebenso kann er die Einrichtung des Moralunterrichtesan den franzsischen Volksschulen verfolgen, in welchem,nebenbei bemerkt. Kantische Ideen eine groe Rolle spielen.Auf diese Weise betrieben, mu die Philosophie demRomanisten eine uerst wertvolle Ergnzung seinesSpezialStudiums werden.
Das Fach des Englischen bietet auch fr Philo-sophie mannigfaltige Anknpfungspunkte. Scotus Eri-gena, Roger Bacon und der Erzbischof Anselm v. Can-terbury (letzterer obgleich er geborener Italiener war) sindNamen, welche fr den Anglizisten nicht blo Namensein sollten. Aber weiterhin spielt dann der Nomina-lismus im englischen Geistesleben eine so entscheidendeRolle, da die hier in Betracht kommenden metaphy-sischen und psychologischen Probleme nicht unberhrtbleiben sollten. Welche Bedeutung dann Franz Baconfr den englischen Geist hat, ist ja sattsam bekannt; derShakespeare-Bacon-Streit hat ja seinen Namen stark inden Vordergrund gestellt. Auch die Streitfrage ber dieEinwirkung von Giordano Bruno, der ja in England einigeseiner Hauptwerke schrieb, auf die englische Literaturdarf gestreift werden. Hobbes ist den meisten Kandi-daten bekannt, aber meist nur nach seiner staatsphilo-sophischen Bedeutung: seine Neubegrndung des Ma-terialismus wird vielfach unterschtzt. Natrlich kennenalle Locke, aber seine Bedeutung fr die englische undeuropische Aufklrung ist doch manchen nicht klargenug. Seine Ethik ist auch meistens nicht gelufig,ebensowenig die brige englische Ethik; und doch hat
-
Englisch und Philosophie, 69
gerade die englische Ethik die engh'sche Literatur stark
beeinflut bei Richardson, Fielding, Sterne. Der NameShaftesbury ist oft schnderweise ganz in Vergessenheitgeraten, und doch sollte dieser nebst Hutcheson denKandidaten bekannt sein, schon um des Einflusses willen,den beide, wie schon oben erwhnt, auf den jugend-lichen Schiller ausgebt haben. Dafr ist Berkeley denmeisten wohlbekannt; sein Idealismus ist noch heutewie damals eine Kuriositt, welche den Widerspruchherausfordert; doch wissen die meisten Kandidaten nicht,warum der Standpunkt Berkeley's, den er selbst Immate-rialismus nannte, Idealismus genannt wurde: nmlichweil eben alle Dinge in bloe ideas = Vorstellungenaufgelst werden; idea ist ja besonders seit Cartesiuseinfach identisch mit Vorstellung schlechtweg geworden.Da Hume nicht eigentlich Skeptiker, sondern Empiristgewesen sei, wissen nun doch schon die meisten. Aberdie Kenntnis der meisten geht auch leider schlechthinnicht hinaus ber Hume, dessen Bedeutung als Histo-riker den meisten aber auch schon unbekannt ist. JohnStuart Mill's Gesetze der Induktion sind zwar manchmalbekannt, und man kommt gewi gerne dadurch inlogische Fragen hinein; dagegen ist Spencer's Name undBedeutung meist unbekannt. Einen bequemen bergangzur Psychologie bietet ja die von so vielen Englndernvertretene und modifizierte Assoziationstheorie, ebensoz. B. Locke's und Berkeley's Bemerkungen zur Theoriedes Sehens, Hume's Theorie der Einbildungskraft. Gernemache ich die Kandidaten auf Bain aufmerksam, dessenpsychologische Werke eine Fundgrube der feinsten Be-obachtungen sind. Zur Psychologie fhrt auch bequemSpencer hinber, der aber leider, wie gesagt, den meistenselbst dem Namen nach unbekannt ist; ebenso bietetDarwin Gelegenheit, Hinweise auf Psychologie zu ver-mitteln, speziell auf die Psychologie der Ausdrucksbe-wegungen, welche ja direkt zur Psychologie der Sprache
-
70 Erster Teil. Prinzipielle Begrndung.
fhren. Der Darwinismus als Ganzes bietet besondersnoch Gelegenheit, logische Fragen anzuknpfen, z. B.ber die Beschaffenheit brauchbarer und wertvoller Hypo-thesen, ber Verifikation von Hypothesen, ber Theorien,ber Gesetze u. . Der Anglizist hat also auch in seinemFach beraus fruchtbare Anknpfungspunkte zur Philo-sophie hinber, die auch ihm, wie leider noch so manchem,nicht blo als eine seinen Fachstudien heterogene Be-schftigung zu erscheinen braucht.
Den klassischen Philologen ist der enge Zu-sammenhang ihres Faches mit der Philosophie meistensdeutlich bewut. Hier liegt ja auch der Zusammenhangklar zu Tage und die Vertreter der klassischen Philologiean den Universitten sind meistens selbst bemht, aufjenen Zusammenhang bei jeder Gelegenheit aufmerksamzu machen, whrend manche Germanisten, Romanistenund Anglizisten es daran fehlen lassen. Bei der klassischenPhilologie ist jener Zusammenhang eben auch viel we-niger zu bersehen: schon der Umstand, da ein Philo-soph Piaton Gegenstand der Schullektre ist, weistja die klassischen Philologen von selbst auf jene Zu-sammenhnge hin. Im Zusammenhang mit Piaton sindja dann naturgem auch Sokrat